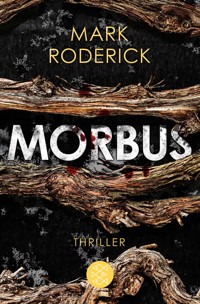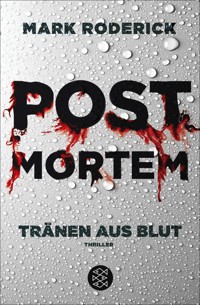9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Post Mortem
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Der fünfte Band der Post-Mortem-Serie mit dem Profikiller Avram Kuyper und Interpol-Agentin Emilia Ness von Spiegel-Online-Bestsellerautor Mark Roderick Beim Atmen bildeten sich dampfende Kondenswolken vor ihrem Gesicht. Nur spärlich bekleidet, hockte Karina Sukowa in ihrem grauen Betonloch, mit dem Rücken zur Wand. So ließen sich Hunger und Kälte am besten ertragen. Und die Schmerzen. Warum gerade sie? Diese Frage hatte sie sich schon tausendmal gestellt. Wann würde er sie wieder zu sich holen? Tiefe Hoffnungslosigkeit legte sich über sie wie ein dunkles Tuch. Wie aus weiter Ferne drang Kindergeschrei zu ihr. Dann öffnete sich die Luke… Kyril Owalischenko ist einer der einflussreichsten Männer im Baltikum. Er liefert alles, was der Osten zu bieten hat: Wodka, Zobel, Kaviar, Drogen und Mädchen. Als Emilia Nachricht von einer Undercover-Agentin erhält, dass dieser Mann mehrere Frauen in seinem Versteck gefangen hält, macht sie sich auf den Weg in die estnischen Länder. Doch auch Avram Kuyper ist an diesem Untergrund-Boss interessiert. Ist der doch für seine Flucht aus dem Gefängnis verantwortlich. Aber warum wollte er ihn draußen haben? Als Avram und Emilia das Versteck finden, kommt es zum tödlichen Duell.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Ähnliche
Mark Roderick
POST MORTEM Herzen aus Wut
Thriller
FISCHER E-Books
Inhalt
Post Mortem
Herzen aus Wut
Für meine Familie, die ich von ganzem Herzen liebe.
Prolog
Karina Sukowa zitterte am ganzen Körper. Es passierte einfach, sie konnte nichts dagegen tun. Das war jedes Mal so, wenn er mit ihr fertig war.
Beim Atmen bildeten sich vor ihrem Gesicht dampfende Kondenswolken. Nur in Unterwäsche hockte die junge Frau in ihrem grauen Betonloch, mit dem Rücken an der Wand, die angewinkelten Beine mit den Armen umschlossen. So ließen sich Hunger und Kälte am besten ertragen.
Und die Schmerzen.
Ihr ganzer Rücken war blutig. Diesmal hatte der Herr der Finsternis sie besonders hart bestraft.
Die Zelle, in der man sie gefangen hielt, maß etwa vier mal vier Meter. Möbel gab es hier keine, nur kahle, abweisende Wände. An einer davon befand sich ganz oben eine kleine, vergitterte Öffnung, durch die sie ein Stück vom Himmel sehen konnte – ihre einzige Verbindung zur Außenwelt. Bei schlechtem Wetter regnete es von dort herein.
Nebenan war ein weiterer Raum, winzig klein, mit einer alten Toilette und einem Waschbecken – immerhin etwas. Zweimal am Tag schob jemand durch eine Klappe in der Tür einen Teller mit Essen herein. Viel war es nicht, und es war auch nicht besonders gut. Es reichte gerade so zum Überleben.
Zum tausendsten Mal, seit sie hier unten gefangen gehalten wurde, fragte sie sich, wie das alles passiert war? Wie sie in diese ausweglose Situation hatte kommen können? Über Schicksale wie ihres las man höchstens in der Zeitung, oder man sah Berichte darüber im Fernsehen. So etwas stieß anderen Leuten zu, Leuten, die nicht auf sich achtgaben, aber doch nicht ihr.
Zumindest hatte sie das geglaubt.
Bis es plötzlich zu spät gewesen war.
Wie lange hielt er sie nun schon gefangen? Mindestens vier oder fünf Monate, schätzte Karina. Irgendwann hatte sie aufgehört, die Tage zu zählen. Zeit spielte hier drinnen keine Rolle.
Wann wird er mich das nächste Mal zu sich holen?
Sie spürte, wie sie vor Angst verkrampfte. Ihre Finger tasteten über den Boden bis zu der Stelle, wo die Klinge lag – ein abgebrochenes Stück von einem Teppichmesser. Der Mann, der sie alle paar Tage besuchte, um sie zu missbrauchen, benötigte es, um die Kabelbinder und die Seile zu zerschneiden, die er zum Ausleben seiner kranken Phantasien benötigte. Vor ein paar Wochen hatte Karina die Klinge in einer Ecke seines dunklen Reichs gefunden. Seitdem behütete sie sie wie einen wertvollen Schatz.
Dass sie keine Chance haben würde, den Mann und seine Helfer damit zu bezwingen, war ihr klar. Aber sie dachte täglich daran, sich damit die Pulsadern aufzuschneiden. Die Versuchung war groß, wie eine verführerische Stimme aus einer besseren Zukunft.
Das Einzige, was sie davon abhielt, war ihr Baby. Aus irgendeinem Grund durfte sie es jeden Tag einmal sehen, für eine halbe Stunde, manchmal sogar länger. Am Anfang hatte Karina befürchtet, dass auch Elena missbraucht würde, aber das war nicht der Fall.
Gott sei Dank!
Eine Weile hockte sie reglos an der Wand, bemüht, die Schmerzen an ihrem Rücken und in ihrem Unterleib zu ignorieren, aber sie schaffte es nicht. Es tat so weh! Wie lange konnte sie das hier noch aushalten? Im Grunde wusste sie, dass sie längst am Ende angelangt war.
Wieder einmal fragte sie sich, ob jemand sie vermisste? Ihre Eltern jedenfalls nicht, zu denen hatte sie jeglichen Kontakt abgebrochen, seit sie vor zwei Jahren von zu Hause ausgebüxt war. Gregor, ihr ehemaliger Freund, vermisste sie wohl auch nicht. Er hatte sie während der Schwangerschaft sitzengelassen und sich seitdem nicht mehr bei ihr gemeldet. Einzig und allein ihrer Freundin Natascha mochte etwas an ihr liegen. Sie bewohnte das Nebenzimmer im Mütterheim, in dem Karina nach der Geburt ihres Babys untergekommen war.
Ob Natascha die Polizei verständigt hatte? Bestimmt! Aber gefunden hatte sie bisher niemand. Karina war mittlerweile sicher, dass man die Suche nach ihr eingestellt hatte.
Tiefe Hoffnungslosigkeit legte sich über sie wie ein dunkles Tuch. Warum hatte das Schicksal ausgerechnet sie so hart getroffen? Nachdem Gregor sie verlassen hatte, war es nur noch bergab gegangen.
Gefangen im Sog der Verzweiflung, starrte sie minutenlang auf die gegenüberliegende Wand ihrer Zelle, während sie sich immer wieder dieselbe Frage stellte.
Warum ich?
Aber natürlich fand sie auch heute keine Antwort darauf.
Irgendwann – sie hatte die Zeit vergessen – wurde sie von Kindergeschrei aus ihren Gedanken gerissen. Wie aus weiter Ferne drang das zarte Gebrüll zu ihr.
Es klang wie Musik in ihren Ohren!
Endlich brachten sie Elena zu ihr. Das taten sie meistens, wenn die Kleine schrie. Dann steckten sie sie zu ihr, bis sie sich wieder beruhigte.
Eine Welle tiefempfundener Dankbarkeit durchflutete Karina. Die Zeit mit ihrem Baby war in diesem Verlies zu ihrem kostbarsten Gut geworden.
Sogar noch wichtiger als die abgebrochene Klinge, die neben ihr auf dem Boden lag.
Das Schreien wurde lauter, gleichzeitig näherten sich draußen im Gang Schritte. Dann machte sich jemand an der Tür zu schaffen.
Auf allen vieren kroch Karina zum Eingang.
Die bodennahe Klappe, durch die man sie auch mit Essen versorgte, wurde mit einem metallischen Geräusch entriegelt. Gleich darauf schob jemand einen Wäschezuber durch die Luke. Eingehüllt in dicke weiße Laken lag Elena darin, aus vollem Halse brüllend, das Gesicht puterrot, die Augen zu schmalen Schlitzen zusammengepresst. Auch ein Milchfläschchen befand sich in der Plastikwanne.
Rasch nahm Karina das brüllende Bündel heraus, um es an sich zu drücken, es sanft zu schaukeln, seine Nähe zu spüren und das rote Köpfchen mit Küssen zu bedecken. Als das Krakeelen nicht aufhörte, hockte sie sich mit dem Baby an ihre Mauer und gab ihm das Fläschchen.
Es war ein eingespielter Ablauf. Später würde jemand dreimal gegen die Tür klopfen, woraufhin Karina das Kind und das leere Fläschchen wieder abgeben musste – hier unten hielt das Glück nicht lange an.
Einmal hatte sie sich widersetzt. Daraufhin hatte man ihr gedroht, das Baby mit Gewalt zu holen und ihm anschließend die Augen auszustechen. Seitdem akzeptierte sie die vorgegebenen Regeln widerspruchslos.
Nach dem Fläschchen tätschelte Karina ihrem Baby so lange den Rücken, bis es aufgestoßen hatte. Danach schlief es friedlich in ihren Armen ein.
Während sie den Anblick ihres Kindes wie ein ausgetrockneter Schwamm in sich aufsog, schien die Zeit um sie herum stillzustehen. Elena war wunderhübsch, ein Baby wie aus dem Bilderbuch: kaum Haare auf dem Kopf, ein kleines, plattes Näschen, rote Pausbacken, samtweiche Haut. Liebevoll streichelte Karina die Wangen der Kleinen, bis sie den Mund im Schlaf zu einer zuckersüßen Fratze verzog, die wie ein Lächeln aussah.
Auch Karina lächelte, aber es war ein Lächeln voller Wehmut. Elena war ein Geschenk Gottes – der einzige Grund, weshalb sie sich noch nicht die Pulsadern aufgeschnitten hatte. Andererseits war genau das ihr Wunsch: endlich einen Schlussstrich unter das fortwährende Martyrium zu ziehen. Doch wie konnte sie das tun, wenn sie Elena in dieser grausamen Welt zurücklassen musste?
Für ihr Dilemma gab es nur eine Lösung.
Ihre zitternde Hand legte sich auf das Gesicht des friedlich schlafenden Säuglings.
Hielt ihm den Mund zu.
Und die Nase.
Es wird nicht lange dauern, mein Kind. Schon bald sehen wir uns wieder.
1
Justizvollzugsanstalt München
»Was ist mit dir passiert? Bist du von einem Güterzug angefahren worden?«
Avram Kuyper stand mit nacktem Oberkörper im Gemeinschaftswaschraum und warf dem einen Kopf kleineren Gustavo Sanchez einen kalten Blick durch den Spiegel zu. Der Kerl war neugierig wie ein Waschweib, aber im Gefängnis konnte man sich seine Gesellschaft nun einmal nicht aussuchen. »Ist eine lange Geschichte«, antwortete er.
»Ich hab die nächsten paar Jahre Zeit zum Zuhören«, sagte Gustavo mit einem Schulterzucken. »Und du auch, soweit ich weiß. Also was ist?«
Avram zögerte. Er hatte keine Lust, der kleinen Quasselstrippe seine Lebensgeschichte zu erzählen. Wenn er Gustavo etwas anvertraute, würde es morgen der ganze Nordblock wissen. Aber seine Vergangenheit ging außer ihm selbst niemanden etwas an.
»Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten«, brummte Avram und griff zum Rasierer.
»Schon gut, ich wollte nur ein bisschen Smalltalk machen«, entgegnete Gustavo. »Dachte, du könntest einen Freund gebrauchen. Jemanden zum Reden. Hier drinnen kann die Zeit verdammt lang werden. Aber das wirst du schon noch merken. Wie lange sitzt du jetzt ein?«
»Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß, hab ich gesagt.«
Gustavo schien ihn gar nicht zu hören. »Fünf Monate? Oder sechs? Jedenfalls noch nicht lange genug, um dich zu langweilen, hä? Aber das wird sich bald ändern, glaub mir. Dann wirst du froh sein, wenn du jemanden zum Plaudern hast.«
»Schon möglich. Jetzt will ich erst mal meine Ruhe.«
»Ja, ja, ich hab’s kapiert, Opa. Was ist mit dir, Güler? Lust auf ein Schwätzchen?« Damit wandte Gustavo sich an sein nächstes Opfer, einen jungen Türken, der am Waschbecken rechts neben ihm stand.
Avram schüttelte innerlich den Kopf. Nach allem, was er wusste, war Sanchez ein hinterhältiges Schwein, das schon mindestens ein halbes Dutzend wohlhabende Witwen umgebracht hatte.
Wahrscheinlich hat er sie totgequatscht.
Aus irgendeinem Grund konnte Avram den kleinen Spanier nicht leiden. Zum Glück hatte er nicht besonders viel mit ihm zu tun. Gustavo arbeitete in der Kantine, er selbst in der Verwaltung. Außer im Waschraum und zu den Mahlzeiten hatten die beiden kaum Kontakt miteinander.
Würde mich nicht wundern, wenn der Bastard mir heute ins Essen spuckt.
Avram stellte den Langhaarschneider auf drei Millimeter ein und begann, sich zu rasieren. Als er das Ergebnis kritisch im Spiegel betrachtete, fiel ihm wieder einmal auf, wie abgehalftert er aussah. Das lag nicht nur an den zahlreichen Narben auf seinem Oberkörper, sondern vor allem an dem grauen Haar, den eingefallenen Wangen und den müden Augen, die hinter seiner dicken Hornbrille noch kleiner wirkten, als sie es tatsächlich waren.
Opa.
Sanchez’ beiläufige Beleidigung hatte Avram einen Stich versetzt. Er konnte nicht leugnen, dass er mit Mitte fünfzig die besten Jahre bereits hinter sich hatte. Der permanente Stress und der Alkohol hatten zusätzlich an ihm gezehrt. Der Mann, der ihm aus dem Spiegel entgegenblickte, war ein Wrack.
Er fragte sich, ob er das Gefängnis jemals lebend verlassen würde. Zwölf Jahre hatte man ihm aufgebrummt – verdammt viel Zeit. Ein guter Anwalt hätte das Strafmaß bestimmt drücken können, aber aus Mangel an Geld hatte Avram mit dem gerichtlich bestellten Strafverteidiger vorliebnehmen müssen.
Zwölf Jahre.
Im Grunde war er damit sogar ganz gut bedient. Man hatte ihm vor Gericht nur Mord in zwei Fällen nachweisen können, in Wahrheit waren es weit über fünfzig.
Wäre die Welt gerecht, hätte man mir eine Giftspritze verpassen müssen.
Mittlerweile hatte Avram sich ganz gut an das Gefängnis gewöhnt. In gewissem Sinn genoss er den Aufenthalt sogar. Endlich musste er nicht mehr ständig auf der Hut sein, nicht mehr ständig darum fürchten, von der Polizei geschnappt zu werden oder von jemandem eine Kugel zwischen die Augen verpasst zu bekommen, dem er irgendwann einmal in die Quere gekommen war. Schon lange vor seiner Verhaftung hatte er sich müde gefühlt. Müde und alt – jedenfalls zu alt für ein Leben als Profikiller. Im Gefängnis fühlte er sich dagegen beschützt, beinahe geborgen.
Es war ein ganz anderes Leben als früher. Aber bestimmt nicht das schlechteste.
2
Dicke Tränen rannen Karina Sukowa über die Wangen, während sie auf das reglose Bündel in ihren Armen blickte. Schon seit einer halben Stunde schluchzte sie stumm vor sich hin, während sie vergeblich versuchte, sich wieder unter Kontrolle zu bringen. Angst und Verzweiflung nagten an ihr, die Hoffnungslosigkeit drohte sie aufzufressen. Immer wieder richtete sich ihr Blick auf die kleine vergitterte Öffnung, ganz oben an der gegenüberliegenden Betonwand, durch das sie ein Stück grauen Himmel erspähen konnte.
Sie würde nie wieder die Sonne sehen, nie wieder frische Luft atmen, nie wieder einen Spaziergang im Freien unternehmen können. Der Herr der Finsternis würde sie so lange hier unten gefangen halten, bis er ihrer überdrüssig wurde, und sie anschließend töten.
Daran gab es keinen Zweifel.
Deshalb musste sie ihm zuvorkommen. Die abgebrochene Klinge des Teppichmessers lag immer noch neben ihr auf dem Boden. Ein einziger Schnitt am Unterarm konnte sie von ihrem Schicksal erlösen.
Das Problem war nur, dass sie trotz aller Verzweiflung den Mut dazu nicht aufbrachte. Genauso wenig wie sie es schaffte, ihre Tochter zu erlösen. Elena lag friedlich schlafend an ihrer Brust, Karina bildete sich sogar ein, ihren Herzschlag zu spüren. Dieses kleine, putzige Wesen mit seinen roten Pausbäckchen – so zart und rein, so ganz ohne Schuld. Falls es einen Gott gab, wie konnte er es dann zulassen, dass so ein süßes Geschöpf in die Hände von Menschen fiel, die anderen die Freiheit raubten, sie missbrauchten, sie demütigten und ihnen weh taten?
Mit dem Handrücken wischte Karina sich die Wangen trocken. Einerseits war sie unendlich dankbar, dass Elena noch lebte. Andererseits schämte sie sich dafür, dass sie zu schwach gewesen war, ihre Tochter zu ersticken.
Wie lange würde es noch dauern, bis der Herr der Finsternis sich auch an diesem unschuldigen Wesen verging? War es nicht ihre verdammte Mutterpflicht, ihr Kind davor zu bewahren? Selbst wenn das hieß, ihm das Leben zu nehmen?
Du sollst nicht töten.
Das fünfte Gebot.
So hatte sie es im Religionsunterricht gelernt. Aber galt das auch für den Fall, dass man jemanden aus Liebe umbringen wollte, oder aus Barmherzigkeit, weil man ihm ein schlimmeres Schicksal ersparen wollte?
Wenn es nur eine andere Möglichkeit gäbe!
So viel sie auch darüber nachdachte, sie fand keine. Sie flehte den Herrn der Finsternis jedes Mal an, Elena freizulassen und sie in fürsorgliche Obhut zu geben. Er reagierte gar nicht darauf. Weshalb sollte er auch? Das Baby war für ihn das beste Druckmittel. Es war der Grund dafür, dass Karina sich noch nicht die Pulsadern aufgeschnitten hatte.
Er wird Elena niemals freiwillig hergeben. Erst durch sie hat er mich vollkommen unter Kontrolle.
Schritte im Gang, wie aus weiter Entfernung, rissen Karina aus ihren trübsinnigen Gedanken. Sie wurden lauter, kamen näher. Vor der Tür erstarb das Geräusch. Dann klopfte es, genau dreimal – das Zeichen dafür, dass Karina das Baby nun wieder abgeben musste.
Wie üblich zerriss es ihr beinahe das Herz, aber sie hatte keine andere Wahl. Die Schmerzen an ihrem blutigen Rücken ignorierend, stand sie auf und legte Elena zurück in den mit weißen Laken ausgelegten Wäschezuber. Wie ein Engel lag das Baby vor ihr, ein unschuldiges kleines Geschöpf, das nichts von dem Bösen ahnte, das ihre Welt beherrschte.
Nach einem letzten Kuss auf die Wange schob Karina den Zuber durch die Luke in der Tür. Gleich darauf wurde der Riegel wieder vorgeschoben, die Schritte entfernten sich, und Karina war wieder alleine mit sich und ihren Sorgen.
3
Nach dem Morgenappell frühstückte Avram in der Gefängniskantine, anschließend begann er pünktlich um 8.30 Uhr seinen Verwaltungsdienst. Papiere sortieren und Akten vernichten, darin sah er zwar nicht gerade seine Erfüllung – er war sich nicht einmal sicher, ob das, was er tat, wirklich Sinn ergab –, dennoch hatte die Arbeit auch etwas Gutes: Er war beschäftigt, und die tägliche Routine half ihm, sich in das soziale Netzwerk des Gefängnislebens einzufügen.
Um zwölf Uhr läutete eine Sirene die Mittagspause ein. Wie die anderen machte Avram sich auf den Weg zur Anwesenheitskontrolle, anschließend ging er in die Kantine. Alle Gefangenen trugen orangefarbene Overalls. An allen Zugängen standen bewaffnete Wärter in Uniform. Sankt Adelheim, wie der Münchener Volksmund die JVA nannte, bot über tausenddreihundert Insassen Platz – die mussten in Schach gehalten werden.
Avram reihte sich in die lange Schlange an der Essensausgabe ein. Der Duft von Gulasch mit Blaukraut ließ ihm das Wasser im Munde zusammenlaufen.
Er nahm sich einen Salat aus dem Frischeregal und bestellte als Getränk wie üblich ein Glas Milch gegen das Magengeschwür. Bei den Beilagen stand Gustavo Sanchez hinter der Edelstahltheke. Kommentarlos schöpfte er Avram eine ordentliche Portion auf den Teller und winkte ihn weiter. Vielleicht war er immer noch sauer, weil Avram sich beim Rasieren ihm gegenüber so wortkarg gezeigt hatte.
Wen interessiert’s? Irgendwann wird er sich wieder einkriegen.
Mit dem vollen Tablett in der Hand setzte Avram sich an einen freien Platz etwas abseits des Trubels. Obwohl er sich mit vielen hier gut verstand, gehörte er keiner festen Gruppe an. Er war Einzelgänger, schon immer gewesen, das hatte sich hier nicht geändert.
Dennoch blieb er nicht lange allein. Eine Gruppe von Männern aus dem Westblock setzte sich zu ihm, in eine angeregte Diskussion über Fußball vertieft. Avrams Tischnachbarn – ein Sunnyboy namens Leo und ein Glatzkopf namens Wolfgang – versuchten, ihn in das Gespräch einzubinden, indem sie seine Prognose für das bevorstehende Spiel von 1860 München hören wollten. Ebensogut hätten die beiden ihn allerdings auch zum Waldsterben in Honduras befragen können. Avram kannte keinen einzigen Spieler beim Namen, geschweige denn, dass er etwas über die Qualität der Mannschaft hätte sagen können.
Aber er anerkannte die gute Absicht und bemühte sich redlich, aktiv an dem Gespräch teilzunehmen. Die beiden machten es ihm auch wirklich leicht. Von links und rechts bombardierten sie Avram mit Fragen, genauso penetrant wie Gustavo Sanchez am Morgen. Nur begingen sie dabei nicht den Fehler, Avram zu nahe zu treten. Das machte sie als Gesprächspartner angenehm.
Avram kam gar nicht richtig zum Essen, im Gegensatz zu den beiden anderen, die ihr Gulasch regelrecht verschlangen. Deshalb waren sie auch längst wieder weg, als bei Avram die Magenkrämpfe einsetzten.
Sein erster Gedanke galt seinem Geschwür – hatte die Milch heute nicht geholfen?
Dann wurden die Krämpfe jedoch derart intensiv, dass dafür nicht allein das Geschwür verantwortlich sein konnte. Jemand musste ihm etwas ins Essen gemischt haben!
Sanchez, du verfluchter Bastard!
Aber wie hätte der dämliche kleine Spanier das bewerkstelligen können, vor Dutzenden von Zeugen in der Warteschlange? War er ein so guter Taschenspieler, dass er Avrams Essen unbemerkt hatte kontaminieren können?
Nein, wahrscheinlich hatte Sanchez gar nichts damit zu tun! Aber die Art und Weise, wie Leo und Wolfgang ihn ins Gespräch verwickelt hatten, kam Avram plötzlich verdächtig vor. Das war keine Diskussion über Fußball gewesen, sondern ein Ablenkungsmanöver! Die beiden hatten sich links und rechts neben ihn gesetzt, so dass Avram bei der Unterhaltung ständig hin- und herschauen musste.
Auf jeden Fall hatte er nicht genug auf seinen Teller geachtet!
Der nächste Magenkrampf ließ ihn zusammenzucken.
Was hatten die zwei Arschlöcher ihm verabreicht? Nur ein Abführmittel, weil sie das aus irgendeinem Grund lustig fanden? Eine Droge, weil sie wollten, dass er bei der Gefängnisleitung in Ungnade fiel? Oder sogar Gift?
Es fühlte sich jedenfalls an, als würde ihm jemand ein glühendes Messer in den Leib rammen.
Keuchend stand Avram auf. Er wollte so schnell wie möglich nach draußen, um sich einen Finger in den Hals zu stecken, aber so weit kam er nicht mehr. Auf halber Strecke begann sich alles um ihn herum zu drehen. Mit einem Mal war ihm so schwindelig, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Die Knie knickten unter ihm weg, ihm wurde schwarz vor Augen. Er fühlte sich plötzlich, als habe ihm jemand den Saft abgedreht.
Ein anderer Gefangener fragte ihn, ob alles mit ihm in Ordnung sei. Als Avram antworten wollte, brachte er nur unverständliches Gebrabbel heraus. Seine Zunge fühlte sich an wie ein Fremdkörper.
Dann kippte er zur Seite wie ein gefällter Baum. Eine Tischkante raste auf ihn zu. Der Aufprall war so hart, dass Avram die Besinnung verlor.
4
Lyon
Von ihrem Büro in der vierten Etage des Interpol-Hauptquartiers hatte Emilia Ness einen wundervollen Blick über den Parc de la Tête d’or mit seinem alten Baumbestand und den weitläufigen Rasenanlagen. Gerade jetzt, im fortgeschrittenen Herbst, bot der Park mit seinen leuchtenden Gelb- und Rottönen ein wahres Postkartenmotiv. Das galt ganz besonders für die kalten, sonnigen Tage, wie es heute einer war.
Sie würde diesen Anblick vermissen, keine Frage. Ein Teil von ihr hasste den bevorstehenden Umzug schon jetzt. Aber sie hatte sich entschieden.
Überall standen Kartons mit ihren Unterlagen herum – an den Wänden stapelten sie sich mannshoch. Am Nachmittag würden die Packer kommen und die Sachen in ihr neues Büro bringen, einen Stock tiefer.
Ohne die schöne Aussicht auf den Park.
Dafür allerdings mit einem nagelneuen, polierten Messingschild an der Tür: Emilia Ness – Leitung SC&A.
SC&A stand für Specialized Crime & Analysis. Künftig würde sie für insgesamt sieben Abteilungen die Verantwortung tragen – ein erhebendes Gefühl, gleichzeitig aber auch ein bisschen beängstigend.
Den Aufstieg hatte sie der Verhaftung von Dr. Albert Rodtmann zu verdanken, der als Maulwurf in den eigenen Reihen jahrelang ein korruptes Doppelleben in der zweiten Chefebene von Interpol geführt hatte. Durch ihren beherzten Einsatz und Rodtmanns Überführung war Emilia dem Generalsekretär aufgefallen, der das Lyoner Hauptquartier leitete. Der hatte ihr aus Respekt vor ihrem Mut den Posten des von Rodtmann ermordeten Jerome Varamont angeboten.
Die Entscheidung war Emilia nicht leichtgefallen. Zunächst hatte sie sogar abgelehnt, und der Job war vorübergehend einem anderen Kollegen übertragen worden. Doch nach dessen Kündigung war die Stelle wieder frei geworden.
Es grenzte an ein Wunder, dass der Generalsekretär noch einmal auf Emilia zugekommen war. Er hatte ihr keinen Druck gemacht, aber durchblicken lassen, dass er eine positive Antwort sehr begrüßen würde. Diesmal hatte Emilia zugesagt, nicht zuletzt, weil sie wusste, dass sie sonst für immer auf dem Abstellgleis landen würde.
Dritte Führungsebene bei Interpol – gar nicht schlecht für ein einfaches Mädchen aus Hamburg.
Es kam ihr vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass sie die Polizeischule absolviert hatte und zur Kripo gegangen war. Dort war sie mit fünfundzwanzig Jahren zur Kommissarin ernannt worden, zwei Jahre später kam dann der Wechsel zu Interpol. Mit dreißig hatte man ihr die Leitung eines zehnköpfigen Teams zur Gewaltverbrechensbekämpfung übertragen.
Jetzt vollzog sie den nächsten Karrieresprung.
Abgesehen von ein paar wenigen Tiefschlägen war es in ihrem Berufsleben immer weiter bergauf gegangen. Rückblickend betrachtet, war dabei natürlich ein gewisses Maß an Glück im Spiel gewesen, aber sie hatte auch hart dafür gearbeitet. Um als Frau im Job ernst genommen zu werden, hatte sie sich oft doppelt so sehr anstrengen müssen wie ihre männlichen Kollegen.
Und der Erfolg gab ihr recht.
Das Problem war nur, dass ihr fürs Privatleben kaum noch Zeit blieb. Seit Jahren vernachlässigte sie ihre Tochter. Nach der Scheidung von ihrem ersten Mann hatte Emilia sie der Karriere zuliebe ins Internat stecken müssen – für Becky ein Schlag ins Gesicht, den sie ihrer Mutter bis heute nicht ganz verziehen hatte. Auch die Beziehung zu Mikka, dem neuen Mann an ihrer Seite, litt unter der permanenten Arbeitsbelastung. Die Hochzeit im vergangenen Jahr hatte daran nichts geändert.
Mit der Leitung des SC&A wird das bestimmt nicht besser.
Emilia seufzte und ließ ihren Blick wieder über den herbstlichen Park gleiten. Warum musste das Leben immer so kompliziert sein?
5
Was nach seinem Zusammenbruch geschah, bekam Avram nur bruchstückhaft mit.
Jemand tätschelte ihm die Wangen. Eine Stimme, düster wie aus einem Grab, fragte: »Können Sie mich hören?«
Als er die Augen aufschlug, starrten ihm haufenweise fragende Mienen entgegen.
»Macht Platz für den Arzt!«, rief jemand, und es kam Bewegung in die Menge.
Ein freundliches Gesicht mit randloser Brille und Schnurrbart schob sich in Avrams Sichtfeld: Dr. Riethammer aus der Krankenstation.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte er.
Zuerst verstand Avram gar nicht, dass er ihn meinte. Als er es endlich begriff, setzten die Krämpfe wieder ein. Auf dem Boden liegend, wand und krümmte er sich mit angezogenen Beinen, die Hände in den Bauch gekrallt. Es fühlte sich an, als würden sich seine inneren Organe auflösen. Die Schusswunden, die er sich in Bolivien eingefangen hatte, waren nicht viel schmerzhafter gewesen.
»Haltet ihn fest, damit ich ihm eine Spritze geben kann«, rief Dr. Riethammer ein paar Helfern zu. Hände griffen nach Avram, zerrten an seinen Armen und Beinen, so dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Sein Körper kämpfte dagegen an, versuchte, sich aufzubäumen und sich den eisernen Griffen zu entziehen, aber gegen die Übermacht der anderen war er machtlos.
Sein Blick fiel auf das kleine, braune Fläschchen in Dr. Riethammers Hand. Auf die Nadelspitze, die durch den Deckel stieß. Auf die fingergroße Spritze, die sich mit einer klaren Flüssigkeit füllte.
Jemand schob ihm den Hemdsärmel nach oben.
Ein alkoholgetränkter Wattebausch desinfizierte seine Armbeuge.
Dann spürte Avram den Einstich und wurde wieder ohnmächtig …
Als er das nächste Mal aufwachte, lag er auf einem Bett in einem weißen Zimmer mit großen, vergitterten Fenstern, durch die die Sonne von draußen hereinflutete. Der Schmerz war erträglicher geworden, aber noch längst nicht verschwunden. Mühevoll drehte Avram den Kopf zur Seite.
Neben ihm stand auf einer Rollkonsole ein grauer Kasten mit diversen LED-Lichtern und digitalen Anzeigen. Mehrere Kabel verbanden ihn mit der sonderbaren Apparatur. Ein grüner Leuchtpunkt hüpfte auf einem kleinen Bildschirm von links nach rechts, begleitet von einem rhythmischen Piepsen.
Sie haben mich in die Krankenstation gebracht.
Der Gedanke war beruhigend. In der Kantine hatte er wirklich geglaubt, sein letztes Stündlein habe geschlagen.
Das muss Gift gewesen sein. Etwas mehr davon, und ich wäre jetzt tot.
Wer steckte hinter dem Mordversuch? Avram war im Gefängnis zwar nicht gerade ein Sympathieträger, aber so unbeliebt, dass jemand ihn ins Jenseits befördern wollte, war er nun auch wieder nicht – zumindest hatte er das bisher geglaubt. Das Schlimmste, was die anderen Häftlinge ihm vorwerfen konnten, war Gleichgültigkeit. Feinde hatte er sich hier drinnen bisher keine gemacht.
Warum also wollte ihn jemand umbringen?
Sein Kopf fühlte sich hohl an. Es fiel ihm unendlich schwer, einen klaren Gedanken zu fassen – vermutlich die Nachwirkung des Narkosemittels, das Dr. Riethammer ihm injiziert hatte. Noch dazu dieses nervtötende Piepsen bei jedem Herzschlag. Wie sollte man sich da konzentrieren?
Wieder überrollte ihn eine Welle der Müdigkeit, seine Lider senkten sich, schwer wie Blei. Und während die Frage nach dem, was heute vorgefallen war, wie ein dumpfes Echo in seinen Gedanken verhallte, versank Avram immer tiefer in eine traumlose Dunkelheit.
6
Lyon
»Ich möchte, dass Sie sich das hier bis morgen ansehen – Akten zu einer Reihe von Kindermorden, die in den letzten sechs Monaten von den Behörden in Nordfrankreich, Belgien, Holland und Südengland gemeldet wurden. Genauer gesagt aus Le Havre, Saint-Malo, Calais, Ostende, Rotterdam und Brighton.«
Der neue Leiter der EDPS – der Executive Directorate Police Services – hieß Louis Benoit und war im Amt, seit Emilia seinen Vorgänger hinter Gitter gebracht hatte. Benoit war ein untersetzter Mann mit Nickelbrille und schütterem Haar, der stets nur Zweireiher mit Seidenkrawatte und Einstecktuch trug. Auf den ersten Blick wirkte er damit wie ein altmodischer, gemütlicher Onkel, aber er stand im Ruf, ein knallharter Hund zu sein, der seine Mitarbeiter gern an der kurzen Leine hielt. Glücklicherweise mochte er Emilia, wohl weil er wusste, dass er ohne ihr Zutun niemals an Rodtmanns Stelle gelangt wäre.
Das hinderte ihn jedoch nicht daran, sie haufenweise mit Aufgaben einzudecken, obwohl sie den neuen Posten erst vor ein paar Tagen offiziell übertragen bekommen hatte. Schon jetzt drohte sie in Arbeit zu ersticken. Dennoch lächelte sie tapfer, als Benoit den zehn Zentimeter dicken Aktenstapel zu ihr über den Tisch schob.
»Der Fall ist brisant, weil es sich ausschließlich um Kinder im Alter zwischen ein und drei Jahren handelt«, sagte Benoit. »Die Presse wird jeden unserer Schritte mit Argusaugen verfolgen. Wir werden unter Beobachtung stehen. Jeder Ermittlungsfehler fällt unmittelbar auf uns zurück.«
Emilia spürte, wie ihr Magen sich zusammenzog. Der Fall bereitete ihr schon jetzt Unbehagen – nicht wegen der Presse, sondern weil tote Kinder ihr immer ganz besonders an die Nieren gingen. Sie erinnerte sich noch gut an die Zeit, als ihre Tochter Becky ein Baby gewesen war. Wie hätte sie sich gefühlt, wenn dieses unschuldige kleine Wesen entführt und ermordet worden wäre?
Eine absolute Horrorvorstellung.
Vor einigen Monaten war Becky tatsächlich aus dem Internat gekidnappt worden. Die Angst, die Emilia damals ausgestanden hatte, wünschte sie niemandem, nicht einmal ihrem ärgsten Feind. Und dennoch musste es noch viel unerträglicher sein, wenn das Opfer ein Kleinkind war.
»Studieren Sie die Unterlagen und lassen Sie uns morgen noch mal darüber sprechen«, sagte Benoit. »Ich will, dass wir schnellstmöglich alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um eine blue notice herauszugeben.«
Damit meinte er die Anforderung von weiteren Informationen über das Vorgehen und die Identität des Mörders. Offenbar gab es in dieser Hinsicht noch Klärungsbedarf.
»Hat die Rechercheabteilung die Akte schon analysiert?«, fragte Emilia.
»Vor drei Wochen. Aber damals gab es erst fünf Kinderleichen, inzwischen ist eine dazugekommen. Vielleicht bringt eine weitere Analyse neue Erkenntnisse.«
»Dann werde ich Luc Dorffler darum bitten, einen Abgleich vorzunehmen.«
»Tun Sie das. Morgen früh um neun Uhr informieren Sie mich dann über den aktuellen Stand, in Ordnung? Außerdem möchte ich, dass Sie bis dahin die Akten Geldermann und Arghan anschauen. Die Unterlagen dazu habe ich Ihnen bereits mit der Hauspost zukommen lassen.«
Emilia nickte, obwohl sie im Umzugschaos längst den Überblick verloren hatte. Heute stand ihr wohl noch ein verdammt langer Tag bevor.
7
Im Lauf des Nachmittags wachte Avram mehrmals auf, aber immer nur für ein paar kurze Momente. Später versuchte er zu rekonstruieren, wie sich alles abgespielt hatte, aber die Erinnerungen ergaben keinen klaren Sinn. Sie waren nur eine Folge von zusammenhanglosen Szenen – blitzlichtartige Fragmente wie in einem Experimentalfilm oder in einem Fiebertraum.
Der graue Apparat auf der Rollkonsole neben dem Bett …
Der hüpfende Leuchtpunkt auf dem Display …
Ein Pfleger, der das Bettzeug aufschüttelte …
Auch Dr. Riethammer kam in einer Szene vor. Er zog Avram mit den Fingern die Lider auseinander und überprüfte seine Pupillenreflexe.
Als Avram das nächste Mal aus dem Sumpf der Bewusstlosigkeit erwachte, zerrte jemand an ihm. Träge öffnete er die Augen, aber es war so dunkel, dass er kaum etwas erkennen konnte – nur den Lichtkegel einer Taschenlampe, der durchs Zimmer tanzte, als besäße er ein Eigenleben.
Was soll das? Wollen die mich auf eine andere Station verlegen? Mitten in der Nacht?
»Scheiße, er wacht auf!«, raunte jemand.
»Dann müssen wir uns beeilen!«, zischte ein anderer.
Avrams umnebelter Verstand ließ keinen klaren Gedanken zu, aber was mit ihm geschah, fühlte sich aus irgendeinem Grund nicht richtig an. Immer wieder streifte der Lichtkegel ein paar weißgekleidete Gestalten, etwa vier oder fünf, aber sie trugen keine Arztkittel, sondern eine Art Arbeitsoverall wie die Leute von der Spurensicherung. Noch sonderbarer war, dass sie Schutzmasken über die Mundpartie gezogen hatten.
Habe ich mir ein ansteckendes Virus eingefangen?
Jedenfalls schien jeder von denen genau zu wissen, was er zu tun hatte. Gerade das wirkte irgendwie unheimlich.
Jemand machte sich an Avrams Hand- und Fußschellen zu schaffen, mit denen er ans Bettgestell gefesselt war. Ein anderer drückte ihm einen Ballknebel in den Mund und zog die Schnalle hinter dem Kopf zu. Avram musste würgen. Spätestens jetzt begriff er, dass die Kerle mit ihm nichts Gutes im Sinn hatten. Der Mundschutz diente nur der Maskierung.
Leise Stimmen raunten sich Befehle zu.
»Nehmt ihr den Oberkörper! Du die Beine.«
Jemand begann zu zählen: »Eins … zwei … drei.«
Avram wurde aus dem Bett gehoben. Im Schein der Taschenlampe begann sein Gesichtsfeld zu wackeln, einen Moment lang glaubte er, dass er zu Boden stürzen würde. Dann stabilisierte sich seine Lage, und die Männer trugen ihn zur Tür, wo ein großer Wäschecontainer auf Rollen stand, wie man ihn in der JVA auf jeder Station sah. Nicht gerade zimperlich wurde Avram dort hineingeworfen.
Obwohl er noch längst nicht bei klarem Verstand war, signalisierte sein Instinkt ihm nun eindeutig Gefahr. Er wollte schreien, aber der Knebel in seinem Mund verhinderte das. Mehr als ein gepresstes Kreischen kam ihm nicht über die Lippen.
Eine Stimme zischte: »Halt’s Maul!«
Dann prasselten Handtücher und Bettlaken auf ihn ein – vermutlich als Tarnung und um ihn ruhigzustellen. Rasch wurde Avram unter einer dicken Stoffschicht begraben.
Unter normalen Umständen wäre das kein Problem gewesen – für niemanden. Doch Avram war immer noch so schwach, dass er befürchtete, unter der Last zu ersticken. Unter Aufbringung all seiner Kräfte schaffte er es, sich durch den Stoff nach oben zu wühlen, bis er wieder Luft bekam.
Was zum Teufel war hier los?
Ich muss auf mich aufmerksam machen! Ich muss verhindern, dass sie mich von hier wegbringen!
Keuchend gelang es ihm, sich durch die Stoffschicht noch weiter nach oben zu wühlen. Seine Hände bekamen den Rand des Wäschecontainers zu fassen. Zitternd vor Anstrengung zog er sich auf die Beine.
Er sah ein grünes Fluchtwegschild, das über der Milchglastür zum Treppenhaus hing …
Er sah die maskierten Gestalten, die den Container in Rekordtempo durch den Gang zum Aufzug schoben …
Er sah eine Tür mit der Aufschrift »Nachtwache« …
Meine letzte Rettung!
Avram schrie in seinen Knebel.
In diesem Moment raste der Knauf einer Pistole auf ihn zu und traf ihn so hart am Schädel, dass die Welt um ihn herum abermals in Finsternis versank.
8
Auf dem Boden hockend, starrte Karina Sukowa auf die gegenüberliegende Wand ihres Verlieses, während sie gegen die Verzweiflung und die innere Leere ankämpfte, die sie wieder einmal heimsuchten.
Das alles nur wegen verfluchter vierhundert Euro!
Diesen Betrag hatte Karina für die Reise nach Kanada zusammenbringen wollen. Ihre Tante und ihr Onkel lebten in Vancouver, und sie hatte vorgehabt, sie dort mit dem Baby zu besuchen.
Vierhundert Euro – für manche Menschen mochte das nicht viel Geld sein, aber für eine arbeitslose Schulabbrecherin im Mütterheim war es eine schier unerreichbar hohe Summe. Deshalb hatte sie sich auf den Rat einer Freundin hin bei Oleg Bartosch gemeldet, der in Riga ein Fotostudio besaß und stets auf der Suche nach Mädchen war, die ihm Modell stehen wollten.
Das Studio lag in einer ruhigen Seitengasse im Hafenviertel und sah von außen ziemlich verwahrlost aus. Von den Wänden bröckelte der Putz, hinter der vergilbten Schaufensterscheibe im Erdgeschoss lagerten die Utensilien eines bankrottgegangenen Schusterladens.
Nichts daran sah einladend aus.
»Lass dich nicht davon abschrecken«, hatte ihre Freundin Natascha gesagt. »Drinnen ist es eigentlich ganz nett. Und warm. Außerdem ist Bartosch ein anständiger Kerl. Wirst schon sehen. Das ist leicht verdientes Geld.«
In Karinas Erinnerung nahm jener verhängnisvolle Tag nun genauere Gestalt an. Der Tag, der ihr Leben zerstört und sie hierher verschlagen hatte. Die Bilder formten sich so plastisch, so real vor ihrem geistigen Auge, als wäre das alles erst gestern geschehen.
Ich habe nicht an der Tür eines Fotografen geläutet, sondern an der Pforte zum Reich des Bösen.
Zunächst schien Bartosch wirklich sehr sympathisch zu sein. Er war groß und schlank, trug einen ausgewaschenen Pullover zu seinen Bluejeans und hatte schulterlanges Haar wie ein zu spät geborener Hippie.
Karina mochte nicht nur seine lockere Art, sondern vor allem seine Verlegenheit und seine spürbare Nervosität – so, als habe er vor dem bevorstehenden Shooting ebenso viel Angst wie sie. Das ließ den Gedanken erträglicher erscheinen, dass er – immerhin ein Wildfremder – sie gleich vollkommen nackt sehen würde.
Karina war so aufgeregt, dass sie kaum atmen konnte.
In ihrer Erinnerung folgte sie Oleg Bartosch über einen schmalen Korridor zu einer Treppe, die ins obere Stockwerk führte.
»Dort befindet sich mein Atelier«, sagte der junge Fotograf auf dem Weg nach oben. »Nichts Besonderes, aber mit allem ausgestattet, was wir für ein paar hübsche Bilder benötigen. Hast du schon mal professionelle Fotos von dir machen lassen?«
»Nein«, antwortete Karina wahrheitsgemäß – genau deshalb war sie ja so nervös.
»Keine Sorge, das wird schon. Wie alt bist du?«
»Achtzehn.«
»Gehst du noch zur Schule?«
»Hab ich abgebrochen.«
Das Atelier entpuppte sich als kleiner, muffiger Raum mit einer fadenscheinigen Couch und einer Fotowand. Davor standen eine Leuchte, ein Reflektor und zwei Stative. Auf dem einen war ein Fotoapparat aufgeschraubt, auf dem anderen eine Videokamera. Ein blickdichtes Tuch vor dem Fenster verhinderte, dass die Nachbarn von der gegenüberliegenden Straßenseite hereinschauen konnten. Die Glühbirne in der staubigen Blechlampe an der Decke verströmte fahles Licht.
Sie setzten sich an einen alten Holztisch mit einem Spiegel und einem Schminkkoffer. Vermutlich wurden die Modelle hier für das Shooting hergerichtet.
»Hat Natascha dir gesagt, was ich für die Fotos bezahle?«, fragte Bartosch mit einem schüchternen Lächeln.
»Dreihundert Euro«, sagte Karina.
Bartosch nickte. »Die Hälfte jetzt, die andere Hälfte, wenn wir fertig sind.« Er zog die Tischschublade auf und kramte zwei Scheine daraus hervor.
Karina schluckte.
Wenn ich das nehme, gibt es kein Zurück mehr.
Aber sie war gekommen, um das Geld für ihre Reise zu verdienen, nicht, um im letzten Moment zu kneifen. Schließlich hatte sie gewusst, worauf sie sich einließ. Ihre plötzlich aufkommenden Bedenken waren wirklich fehl am Platz!
Sie nahm das Geld und steckte es in ihre Handtasche.
»Du kannst dich dort drüben ausziehen«, sagte Bartosch und deutete mit dem Kinn auf eine Ecke mit einem Kleiderständer. Plötzlich wirkte er gar nicht mehr so schüchtern wie an der Tür.
Karina nickte, bemüht, sich ihre Unsicherheit nicht anmerken zu lassen.
Viele Mädchen lassen Aktaufnahmen von sich machen. Was ist schon dabei?
Mutig schlüpfte sie aus ihrer Bluse und ihrer Jeans. Der BH fiel ihr schon deutlich schwerer, und der Slip kostete sie echte Überwindung.
Denk an das Geld! In zwei Stunden ist alles vorbei.
»Keine Sorge, wir machen keine Schmuddelbilder«, sagte Bartosch, der wohl ihre Gedanken lesen konnte. »Nur schöne, ästhetische Fotos. Willst du ein Glas Wein oder einen Schluck Wodka zum Entspannen?«
Karina schüttelte den Kopf. Trotz ihrer Nervosität war es ihr lieber, einen klaren Kopf zu behalten.
»Setz dich auf die Couch, wenn du so weit bist«, sagte Bartosch. »Dann kann ich das Licht einstellen.«
Karina nahm ihren Mut zusammen und folgte der Aufforderung. Sie war froh, dass Bartosch noch nicht auf sie achtete, sondern mit seinen Geräten beschäftigt war – das verschaffte ihr ein paar letzte Sekunden, um sich besser an die Situation zu gewöhnen. Ihre Nacktheit schien sie sensibler zu machen. Der Couchstoff fühlte sich an ihrem Rücken und unter ihrem Po kühl und kratzig an. Sie schlug die Beine übereinander, unterließ es aber, auch noch die Arme vor der Brust zu verschränken, um nicht ganz so prüde zu wirken, wie sie sich im Moment fühlte.
Sie fragte sich, wie viele Mädchen schon vor ihr auf dieser Couch gesessen hatten. Ob sie alle diese Probleme gehabt hatten? Nein, wahrscheinlich gab es einige, denen es überhaupt nichts ausmachte, nackt vor einer Kamera zu posieren. Manchen gefiel es vielleicht sogar.
Aber ich bin nun mal keine von denen.
»Von mir aus können wir loslegen«, sagte Bartosch. »Am besten beginnen wir mit ein paar Fotos im Stehen.«
Zum ersten Mal hatte Karina das Gefühl, dass er sie bewusst ansah. Ein kalter Schauder lief ihr über den Rücken. Sie hoffte, dass Bartosch ihr das nicht anmerken konnte, und stand auf.
»Sehr schön«, kommentierte Bartosch. Er nahm die Kamera vom Stativ und schoss ein paar Bilder aus der freien Hand.
Karina hatte den Eindruck, dass er das Objektiv auf ihr Gesicht richtete. Sie entspannte sich ein wenig.
»Fahr dir mit den Händen durchs Haar«, forderte Bartosch. »Ganz langsam. So, als wolltest du deinen Freund anmachen.«
Sie verstand, was er meinte, auch wenn ihr Freund – besser gesagt, ihr verfluchter Exfreund – im Moment tausend Kilometer weit weg war, weil er meinte, sein Glück in Schweden bei seiner neuen Flamme suchen zu müssen.
»Du bist ein wahnsinnig hübsches Mädchen«, sagte Bartosch und drückte wieder ein paarmal auf den Auslöser.
In gewisser Weise freute Karina das Kompliment. Seit der Geburt ihres Kindes hatte sie ein paar Kilo zugelegt, und spätestens, nachdem Gregor sie wegen dieser Schwedin verlassen hatte, war sie sich bezüglich ihrer körperlichen Attraktivität nicht mehr ganz sicher. Auch die Schwangerschaftsstreifen am Bauch fand sie ziemlich unsexy. Aber Oleg Bartosch schienen sie nicht zu stören.
Er ging vor ihr auf die Knie. Der Sucher seiner Kamera wanderte mit ihm tiefer. Karina versuchte nicht daran zu denken.
»Dreh dich um«, sagte Bartosch.
Karina tat es, so wie sie alle seine Anweisungen befolgte.
»Sieh über die Schulter … das Kinn tiefer … die Augen etwas weiter auf … ja, genau so … jetzt knie dich auf die Couch … drück den Rücken durch … das linke Bein etwas weiter nach vorne … du musst versuchen, mit der Kamera zu flirten … stell dir vor, die Kamera wäre dein Liebhaber …«
Je weiter das Shooting voranschritt, desto mehr legte Bartosch seine Schüchternheit ab, und sogar Karina gelang es immer besser, sich auf seine Anweisungen einzulassen. Sie erlaubte ihm sogar ein paar Aufnahmen, die weit über das hinausgingen, was sie sich vorgenommen hatte. Hin und wieder kam die Kamera so nah an sie heran, dass sie Bartoschs Atem auf ihrer Haut spüren konnte.
Dann begann er auf einmal, sie zu berühren. Seine Hand legte sich auf ihren Oberschenkel, als sei es geradezu selbstverständlich, dass er als Fotograf ein Recht darauf hatte. Unwillkürlich zuckte sie zusammen.
»Nein … bitte. Ich will das nicht«, murmelte sie.
Er machte einfach weiter.
9
Der Wäschecontainer wurde aus der Tür ins Freie geschoben und rollte auf einen großen Mercedes-Transporter zu, der neben dem Gebäude parkte. Beschienen vom fahlen Licht einer Laterne, erkannte Avram auf dem Wagen das Emblem der Firma Alpenweiß, die für die JVA München diverse Arten von Reinigungsarbeiten durchführte. Nur trugen die Angestellten von Alpenweiß normalerweise keinen Mundschutz.
Kräftige Hände zerrten Avram aus dem Container und verfrachteten ihn in den Laderaum des Transporters. Unsanft landete er auf dem Boden. Avram ächzte auf.
»Der will einfach nicht bewusstlos bleiben!«, zischte jemand.
»Dann benutz den Äther, verdammt nochmal!«, kam die Antwort. »Wenn er bei der Kontrolle auf sich aufmerksam macht, sind wir alle am Arsch!«
Der scharfe Geruch von Desinfektionsmittel stieg Avram in die Nase. In einer Ecke des Transporters standen ein paar Eimer mit Wischmobs und Putzlappen, daneben ein großer Wäschezuber. Einer der Männer schob einen Stapel Handtücher beiseite und legte dadurch ein paar Sandsäcke frei, die er gleich darauf auszuladen begann.
Noch während Avram sich fragte, was der Kerl damit bezweckte, wurde er plötzlich durch den Laderaum geschleift und mit Zurrgurten quer an der Trennwand zum Fahrerhaus befestigt. Wie eine Fliege im Spinnennetz klebte er mit dem Rücken an der Wand, er konnte sich kaum noch bewegen.
Jetzt begriff er auch, was es mit den Sandsäcken auf sich hatte: Jedes Fahrzeug, das aufs JVA-Gelände fuhr, wurde an der Einlassschranke von einer Kfz-Waage im Boden gewogen. Dasselbe galt beim Verlassen des Geländes. Sofern die Wachen keine auffälligen Gewichtsdifferenzen feststellten, begnügten sie sich bei der Ausfahrt mit Sichtkontrollen. Andernfalls durchsuchten sie das Fahrzeug bis ins Detail.
Die Sandsäcke stellten das Gegenstück zu Avrams Körpergewicht dar und dienten dazu, den Gewichtsunterschied auszugleichen.
Einer der Männer hielt plötzlich einen Akkuschrauber in der Hand, ein anderer eine Blechverkleidung. Es surrte vier Mal, dann war Avram von den Schuhen bis zur Taille hinter einer weißen Abdeckung verschwunden, die sich durch nichts von der Wand zum Fahrerhaus unterschied, an der man ihn fixiert hatte.
Schon machten die beiden Männer sich daran, auch das zweite Blech in Position zu bringen, diesmal vor seinem Oberkörper. Die Wache an der Schranke würde den Unterschied nicht bemerkten – nicht bei Laternen- und Taschenlampenlicht. Und da die Fahrzeugwaage keine Auffälligkeiten meldete, würde auch niemand genauer nachsehen.
Erst in ein paar Stunden wird man feststellen, dass ich nicht mehr im Gefängnis bin. Man wird rekonstruieren können, wie alles gelaufen ist, aber dann wird es zu spät sein.
Bevor das zweite Blech festgeschraubt wurde, drückte jemand Avram ein feuchtes Tuch aufs Gesicht. Dem ersten Impuls folgend, wollte er sich dagegen wehren, aber die Zurrgurte ließen ihm keinen Bewegungsspielraum. Die Luft anzuhalten hatte auch keinen Sinn – wie lange hätte er das durchhalten können?
Er fragte sich, zum wievielten Mal in den letzten vierundzwanzig Stunden er nun die Besinnung verlieren würde, und nahm einen tiefen Atemzug.
10
Lyon
Emilia Ness lag schon seit Stunden im Bett, aber obwohl sie hundemüde war, fand sie nicht zur Ruhe. Durch ihren Kopf spukte ein sonderbares Gedankengewirr, das sie zuerst auflösen musste, bevor sie ans Einschlafen denken konnte. Doch sosehr sie sich auch bemühte, es gelang ihr nicht.
Der Wecker auf ihrem Nachttisch zeigte mittlerweile zwei Uhr.
Wenn ich nicht bald schlafen kann, wird es morgen ein verdammt zäher Tag!
Sie griff zum Handy, das neben dem Wecker lag, und fragte Mikka per WhatsApp, ob er auch noch wach war.
Die Antwort kam prompt: Schlafen im Dienst ist bei der Frankfurter Kripo nicht erlaubt:-)
Erst jetzt fiel ihr wieder ein, dass er diese Woche Nachtschicht hatte. Durch den Stress im Büro hatte sie das komplett vergessen.
Tut mir leid, ich wollte nicht stören, tippte sie ins Display.
Kein Problem, schrieb Mikka zurück. Bin zurzeit alleine im Büro. Wollen wir telefonieren?
Sie lächelte und wählte seine Nummer.
»Alles klar bei dir?«, fragte er. Die Verbindung war nicht sonderlich gut, aber es wärmte Emilias Herz, seine Stimme zu hören.
»Ich liege schon seit einer Ewigkeit wach im Bett und wälze Probleme«, sagte sie. »Ich dachte, dass es mir vielleicht beim Einschlafen hilft, wenn ich auf andere Gedanken komme.«
»Wo genau drückt der Schuh?«
Sie zögerte, weil sie das Thema schon gefühlte hundert Mal durchgekaut hatten. Dennoch wollte sie mit Mikka darüber sprechen.
»Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe«, sagte sie. »Mit der Übernahme der Leitung von SC&A, meine ich. Da kommt in den nächsten Monaten so viel Arbeit auf mich zu, dass ich schon jetzt gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht. Ich werde für Becky und dich noch weniger Zeit haben als bisher – das finde ich schrecklich.«
»Ich weiß«, sagte Mikka. »Und mir gefällt das auch nicht. Aber Becky ist in einem Alter, in dem die Eltern ihr nur noch peinlich sind. Wie oft besucht sie uns am Wochenende? Höchstens einmal im Monat. Die bleibt mittlerweile lieber im Internat bei ihren Freundinnen. Und ich bin ein erwachsener Mann. Natürlich hätte ich dich gerne in meiner Nähe. Aber ich weiß, dass du auch deine Arbeit liebst.«
Das stimmte. Für sie war es nicht nur ein Job, sonst hätte sie nicht so viel Energie investiert. Mit ihrer Arbeit konnte sie etwas bewirken, die Welt ein kleines bisschen sicherer machen. Deshalb versuchte sie immer, ihr Bestes zu geben – und das kostete Zeit, die sie vom Privatleben abzwacken musste.
»Vielleicht sollte ich doch lieber den Job an den Nagel hängen und zu dir nach Frankfurt ziehen«, seufzte sie. »Ich würde bestimmt eine geeignete Stelle bei der Kripo finden, so wie früher in Hamburg.«
»Das würde mich wahnsinnig freuen«, sagte Mikka. »Aber du könntest damit auf Dauer nicht glücklich werden. Du brauchst den Job bei Interpol mehr, als er dich braucht.«
Sie schwieg einen Augenblick und dachte darüber nach. Tatsächlich hatte Mikka recht. Im Grunde war sie sich dessen schon die ganze Zeit bewusst gewesen, sie hatten ja auch schon oft genug darüber diskutiert. Aber irgendwie fühlte es sich falsch an, eine Wochenendehe zu führen. Konnte das auf Dauer überhaupt gutgehen?
»Du musst auf deine innere Stimme hören«, sagte Mikka, der ihre Verunsicherung wohl immer noch spürte. »Und wenn die nun mal für Lyon ist, dann soll es so sein. Schließlich will ich auch nicht aus Frankfurt weg. Das Wichtigste ist doch, dass wir uns lieben. Außerdem haben wir WhatsApp und Skype. Wir führen eben eine moderne Art von Ehe. Beziehung 2.0 sozusagen. Wenn wir beide damit umgehen können – warum nicht?«
Emilia atmete erleichtert auf. Wieder einmal machte Mikka es ihr leicht. Er setzte sie nicht unter Druck und erwartete nichts von ihr, das er nicht selbst zu geben bereit war.
»Ich liebe dich«, flüsterte sie.
»Ich dich auch«, sagte er. »Geht es dir jetzt wieder etwas besser?«
»Ja. Bestimmt kann ich jetzt schlafen wie ein Baby. Gute Nacht.«
Aber nachdem sie das Gespräch beendet hatte, lag sie weiterhin wach in ihrem Bett und starrte zur Decke.
11
Den Blick starr auf die gegenüberliegende Betonwand gerichtet, spielten sich die Erinnerungen in Karina Sukowas Kopf ab wie in einem Film.
Ein Film, in dem sie unfreiwillig die Hauptrolle spielte.
»Bitte, Oleg, hör auf damit! Sofort!«
Die Schärfe in ihrer Stimme schien ihn nicht besonders zu erschrecken, aber wenigstens ließ er von ihr ab.
»Tut mir leid«, sagte er. »Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Es ist nur … du bist so wunderhübsch.«
Im ersten Moment wollte sie ihm für das Kompliment danken, dann ließ sie es aber doch lieber bleiben, um ihn nicht zu ermutigen.
»Ich wollte dich nicht verärgern«, fuhr er fort. »Bitte entschuldige!«
Er stand auf, ging aus dem Zimmer und kam kurz darauf mit zwei gefüllten Gläsern in der Hand zurück. Eines davon hielt er Karina hin.
»Was ist das?«, wollte sie wissen. »Sekt?«
»Krimskoye. Komm schon. Nimm einen Schluck, sonst fühle ich mich schrecklich!«
Sie gab sich einen Ruck und nippte an dem Glas.
»Ehrlich, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist«, sagte Oleg Bartosch. »Sind wir wieder gut miteinander?« Dabei sah er sie mit seinen dunkelgrünen, scheuen Augen an, als könne er keiner Fliege je etwas zuleide tun. Karina konnte ihm einfach nicht böse sein.
»Schon vergessen«, murmelte sie.
Er hielt ihr sein Glas hin, und sie stießen miteinander an.
»Da bin ich aber froh. Ich verspreche, mich ab sofort besser zu benehmen«, sagte er.
Er leerte sein Glas in einem Zug, woraufhin auch sie einen ordentlichen Schluck nahm. Der Champagner prickelte in ihrer Nase, schmeckte nach ihrem Empfinden aber viel zu sauer. Sie hatte noch nie in ihrem Leben echten Krimskoye getrunken, und sie konnte auch nicht nachvollziehen, weshalb so viele Menschen Gefallen daran fanden. Ein süßer Caipirinha oder eine Piña Colada wären ihr hundertmal lieber gewesen.
Dass mit diesem Champagner etwas nicht stimmte, merkte sie erst, als das Schwindelgefühl einsetzte. Zuerst dachte sie, es sei nur das erste Anzeichen des Schwipses – sie hatte fast das ganze Glas ausgetrunken, und der Alkohol stieg ihr zu Kopf. Aber dann wurde ihr plötzlich schwarz vor Augen.
Er hat mir etwas ins Glas gegeben!
Das war die letzte Erinnerung, die Karina Sukowa an ihr altes Leben hatte. Als sie wieder zu sich gekommen war, hatte sie sich im Reich der Finsternis befunden. Seitdem hielt man sie in ihrer unwirtlichen, kleinen Betonzelle gefangen wie ein Tier.
Ihr Blick wanderte zu dem vergitterten Loch unter der Decke. Sie konnte ein Stück Himmel erkennen, es schien eine wunderschöne Nacht zu sein, kalt, aber sternenklar.
Ich werde hier unten sterben.
Davon war sie überzeugt. Vielleicht noch nicht heute, vielleicht noch nicht morgen. Aber schon ziemlich bald.
Nach ein paar Tagen hatte der Wahnsinnige sie zum ersten Mal besucht. Nicht Bartosch, sondern ein anderer Mann, älter und furchteinflößender. Er hatte sie in eine andere Zelle geführt, eine dunkle, fensterlose Kammer. Dort brannte, wie Karina mittlerweile wusste, immer nur eine Kerze. Die flackernde Flamme verwandelte den Raum jedes Mal in ein morbides Reich aus tanzenden Schatten. Die Wände waren mit stilisierten Zeichnungen übersät: menschliche, tierische und dämonische Figuren, die in den unterschiedlichsten Positionen miteinander kopulierten – Schreckensbilder, bei deren Anblick Karina das blanke Entsetzen überkam.
Noch mehr Angst bereitete ihr dieses Ding in der Mitte der Kammer, eine Art Opferaltar, auf den er sie fesselte, um sie anschließend zu misshandeln.
Dabei raunte er ihr immer wieder dieselben Dinge ins Ohr: »Hier unten kann ich mit dir tun, was ich will. Aber ich verspreche dir: Solange du es schaffst, nicht zu schreien, werde ich dein Baby am Leben lassen.«
Also biss sie jedes Mal die Zähne zusammen, wenn er über sie herfiel. Sie schluchzte, sie vergoss stumme Tränen. Manchmal, wenn der Schmerz übermächtig wurde, kam ihr ein kurzes, unterdrücktes Würgen über die Lippen.
Aber geschrien hatte sie noch nie.
So ging es nun schon seit Monaten. Jedes Mal, wenn er mit ihr fertig war, schnitt er sie los, und jemand anderes brachte sie zurück in ihre Zelle. Danach vergingen oft mehrere Tage, in denen sie in ihrem Kerker alleine war.
Wasser hatte sie genug. Morgens und abends brachte man ihr etwas zu essen, ab und zu auch ihre kleine Tochter, so dass sie sie trotz allen Elends wenigstens stundenweise in den Armen halten konnte.
Auf diese Weise kehrte selbst hier unten eine gewisse Form von Normalität ein – ein Rhythmus, der ihr half, all die Widerwärtigkeiten besser zu ertragen, die sie erdulden musste.
12
Das Dröhnen wurde lauter, steigerte sich bis zur Unerträglichkeit. War das nur in seinem Kopf? Oder ein Geräusch von außen?
Die Grenze zwischen Bewusstlosigkeit und Realität verschwamm. Um Avram herum war es stockdunkel, obwohl er beinahe sicher war, die Augen offen zu haben. Je wacher er wurde, desto stärker überkam ihn der Brechreiz. Er versuchte, die aufkommende Übelkeit zu ignorieren, schaffte es aber nicht, weil der Ballknebel im Mund seine Zunge gegen den Gaumen drückte und ihn permanent zum Schlucken zwang.
Wenn ich mich übergeben muss, werde ich womöglich ersticken.
Die sonderbare Position, in der er sich befand, weckte die Erinnerung an die Entführung: an den Mercedes-Transporter, mit dem man ihn aus dem Gefängnis verschleppt hatte. Avram war immer noch quer an der Wand zum Fahrerhaus festgezurrt wie ein Holzbrett oder ein Stück Frachtgut. Er konnte sich nicht rühren, bekam kaum noch Luft. Sein Körpergewicht drückte auf den unteren Arm – der war schon völlig taub.
Irgendwann wurde der Wagen langsamer, die Fahrt holpriger. Der bittere Geschmack von Magensäure stieg in Avram auf.
Lange stehe ich das nicht mehr durch.
Bei einem besonders großen Schlagloch knallte er mit der Stirn gegen etwas Hartes, das sich direkt vor seinem Gesicht befand. Einen Moment lang tanzten in der Dunkelheit Sterne vor seinen Augen, dann wurde ihm klar, dass er sich an der Blechverkleidung gestoßen hatte. Er war in diesem Versteck eingepfercht wie in einer verdammten Sardinenbüchse.
Endlich kam der Transporter zum Stehen. Avram hörte gedämpfte Stimmen, dann das Geräusch der Seitentür, die aufgeschoben wurde.
Jemand stieg in den Laderaum. Kurz darauf surrte der Akkuschrauber auf, und die Blechverkleidung wurde entfernt.
Endlich!
Im Dämmerlicht der Nacht erkannte Avram zwei Gestalten. Sie trugen jetzt nicht mehr Weiß, sondern Schwarz. Die Masken hatten sie abgezogen, was Avram als schlechtes Zeichen wertete. Offenbar gingen sie nicht davon aus, dass er jemals eine Chance haben würde, sie zu identifizieren.
Aber noch bin ich nicht tot.
Der Kleinere hatte ein Allerweltsgesicht, aber die Visage des anderen hätte einprägsamer nicht sein können: schwarzes, lockiges Haar, ausgemergelte Wangen, blutunterlaufene Augen wie bei einem Drogensüchtigen und eine auffällige Habichtsnase. Ein Italiener vielleicht, oder ein Grieche.
Wer sind diese Kerle?
Warum haben sie mich aus dem Gefängnis geholt?
Was haben sie mit mir vor?
Träge geisterten die Fragen durch seinen benebelten Verstand. Mit Griechenland hatte er schlechte Erfahrungen, seit er dort auf einer Privatinsel einen Ring von reichen Perversen ausgehoben hatte. Ob von damals jemand übrig war, der jetzt auf Rache sann? Avram hätte geschworen, alle Widersacher erfolgreich eliminiert zu haben, aber bei solchen Aktionen gab es immer gewisse Restrisiken.
Die Zurrgurte wurden gelöst, und Avram plumpste auf den Ladeboden wie ein nasser Sack. Der Aufprall raubte ihm beinahe den Atem. Als er aufstehen wollte, gelang ihm das nicht – seine Beine waren durch die mangelnde Blutzirkulation wie gelähmt.
Das Habichtsgesicht packte Avram am Kragen, legte ihm Handschellen an und zerrte ihn aus dem Transporter, nur, um ihn in den Kofferraum eines bereitstehenden Pkw zu stoßen. Dann ging die Fahrt auch schon weiter.
Als der Kofferraum sich wieder öffnete, schlug Avram kühle Nachtluft entgegen. Durch die dunkelgraue Wolkenschicht am Himmel ahnte man den Vollmond mehr, als dass man ihn sehen konnte. Sterne suchte man in dieser Nacht vergeblich.
In weiter Ferne schrillte der Pfiff einer Lokomotive, irgendwo heulte ein Uhu.
Wieder wurde Avram aus dem Wagen gezogen, unsanft landete er auf den Knien.
»Bleib da unten, verstanden?«, zischte das Habichtsgesicht. »Und nimm die Hände hinter den Schädel, sonst puste ich ihn dir weg! Jetzt keine Bewegung mehr, bis ich es dir sage!«
Avram faltete wie befohlen die Hände hinter dem Nacken und blieb reglos auf den Knien, während der andere eine Stahlkette durch seine Handschellen zog und sie mit der am Heck des Autos angebrachten Abschleppöse verband. Als er damit fertig war, ging er vor Avram in die Hocke und tätschelte ihm mit einem höhnischen Grinsen die Wange.
»Du bist jemandem einen verdammt großen Batzen Geld wert, alter Mann: fünfzig Millionen Euro. Und wer immer so viel Kohle für dich bezahlt – es war ihm wichtig, dass dir keins deiner wertvollen Härchen gekrümmt wird. Keine Ahnung, warum. Vielleicht liebt er dich einfach, du verdammte Schwuchtel. Ist mir auch scheißegal. Aber eins verrate ich dir: Sollten du oder dein Wichser-Freund irgendwelche krummen Touren versuchen, wirst du das als Erster bereuen. Siehst du das Auto?«
Avram drehte den Kopf nach hinten. Das Fahrzeug, an das man ihn angekettet hatte, war ein 5er BMW.
»Zweihundertfünfundvierzig PS