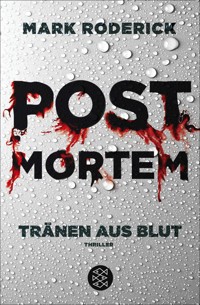9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Post Mortem
- Sprache: Deutsch
Sie heißt Emilia Ness und arbeitet bei Interpol. Er heißt Avram Kuyper und ist Profikiller. Gemeinsam jagen sie einen bestialischen Mörder. Jeder auf seine Weise. Nach dem ersten Band "Tränen aus Blut" verfolgen Profikiller Avram Kuyper und Interpol-Ermittlerin Emilia Ness noch immer die Fährte eines Mannes, der keine Grenzen und kein Gewissen kennt: machthungrig, erfolgsverwöhnt und unberechenbar aggressiv. Der große spannende Mehrteiler von Mark Roderick: schockierend, aufwühlend und mega-spannend. Es ist noch nicht vorbei – das Morden geht weiter… Ein bestialischer Foltermord in einem abgelegenen Landhaus in Südfrankreich. Eine Handschrift, die Interpol-Agentin Emilia Ness und Profi-Killer Avram Kuyper nur zu gut kennen. Jemand möchte, dass sie weiter auf die Suche gehen. Denn das kriminelle Netzwerk des Täters ist größer als gedacht. Und mächtiger als vermutet. Wer hat den Hinweis lanciert? Wer ist dieser große Unbekannte, der so machthungrig, erfolgsverwöhnt und unberechenbar aggressiv ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Mark Roderick
Post Mortem - Zeit der Asche
Thriller
FISCHER E-Books
Inhalt
Zeit der Asche
Prolog
Claus Thalinger saß in einem beigefarbenen Ledersessel am Fenster seines Learjets und starrte in den Abendhimmel, ohne das spektakuläre Farbspiel aus Weiß, Lila und Orange wirklich wahrzunehmen. In Gedanken war er bei den Geschäften des vergangenen Tages – dem Deal mit TOCON in Barcelona, der ihm mit etwas Glück fünfzig Millionen Euro Gewinn einbringen würde. Das heutige Zwei-Augen-Gespräch mit TOCON-Inhaber Pablo Ortega war positiv verlaufen, und beide Parteien waren in gegenseitigem Einvernehmen auseinandergegangen. Thalinger rechnete fest damit, dass der Vertrag schon in den nächsten Wochen unterschriftsreif sein würde.
Im Grunde hätte er also zufrieden sein können. Aber das war er nicht, denn noch viel mehr als der TOCON-Deal beschäftigte ihn die Frage, ob Simon Nadicz, dieser gottverdammte kleine Pisser, schon entführt worden war.
Mit Daumen und Zeigefinger massierte Thalinger sein glattrasiertes Kinn – ein deutliches Zeichen seiner Nervosität. Die schlechte Angewohnheit verfolgte ihn bereits seit Kindertagen, und trotz aller Bemühungen war er sie nie ganz losgeworden. Im Geschäftsleben hatte er diesen verräterischen Tick zum Glück gut im Griff, sonst wäre er bestimmt nie so erfolgreich geworden. Das Schachern um Millionenbeträge war wie ein Pokerspiel, und es gab keinen guten Pokerspieler, dem man die Nervosität offen am Gesicht ablesen konnte. Aber in Momenten wie diesen, wenn er allein und unbeobachtet war, gönnte er sich den Luxus dieser kleinen Schwäche und knetete sein Kinn.
Ein schmales Lächeln umspielte seine Mundwinkel, als er sich wieder einmal klarmachte, wie ambivalent seine Persönlichkeit war. Nach außen hin verkörperte er den perfekten Geschäftsmann, das wusste er. Er trug maßgeschneiderte Anzüge, handgefertigte Lederschuhe aus London, eine Uhr für hundertfünfzigtausend Euro und einen goldenen Siegelring. In seiner Freizeit spielte er Tennis und Squash, dreimal die Woche stemmte er Gewichte in seinem Fitnessraum. Er war Mitte vierzig und in bester Form. Sein Haar begann an den Schläfen zwar ein wenig zu ergrauen, aber aus irgendeinem Grund fanden das die meisten Frauen attraktiv.
So weit der Vorzeige-Geschäftsmann. Das strahlende Äußere, das man aus den Wirtschaftsmagazinen kannte. Doch er wäre niemals das geworden, was er heute war, hätte es nicht auch eine dunkle Seite an ihm gegeben – die Bereitschaft, Dinge zu tun, die nicht nur gegen das Gesetz verstießen, sondern auch gegen jegliche Vorstellung von Moral und Anstand. Dinge, die die meisten Menschen als abstoßend empfanden. Schlimme, abgrundtief böse Dinge.
Anfangs hatte ihn seine Skrupellosigkeit erschreckt. Doch im Lauf vieler Jahre hatte er sich immer mehr daran gewöhnt, letztlich sogar Gefallen daran gefunden. Nicht immer, aber doch so häufig, dass er sich eine gewisse Art von Perversion eingestehen musste.
Thalingers Lächeln wurde breiter. Und kälter. Hinter seinem Saubermannimage verbarg sich ein messerscharfer Geschäftssinn, gepaart mit der freudigen Bereitschaft, auch blutige Wege einzuschlagen, wenn das seinen Zielen diente. Er war ein Wolf im Schafspelz. Ein als harmloser Dr. Jekyll getarnter Mister Hyde.
Das Geheimnis seines Erfolgs.
Er warf einen Blick auf seine Patek-Philippe-Armbanduhr. Kurz nach halb sieben. Lange konnte es nicht mehr dauern, bis endlich der Anruf kam, dass Nadicz sich in seiner Gewalt befand.
Er nahm das Diktaphon zur Hand, das auf dem Tisch vor ihm lag, und versuchte, sich wieder auf TOCON zu konzentrieren. Bis zum tatsächlichen Vertragsabschluss mit dem spanischen Chemieunternehmen gab es noch viele Details zu klären, aber die Eckpfeiler der Zusammenarbeit hatten Ortega und er heute klar definiert. Claus Thalinger wollte die Ergebnisse dieses Gesprächs festhalten, solange die Erinnerung daran noch frisch war, um sie morgen von seiner Sekretärin niederschreiben und dann seinen Anwälten vorlegen zu lassen, damit sie daraus einen ersten echten Vertragsentwurf fertigen konnten.
Eine halbe Stunde lang versuchte er, seine Gedanken zu ordnen und sie in das Aufnahmegerät zu diktieren. Normalerweise fiel ihm das leicht. Heute musste er jedoch immer wieder zurückspulen, um Sätze neu zu formulieren oder sogar um ganze Absätze neu zu strukturieren. Er war nicht hundertprozentig bei der Sache. Denn trotz der verlockenden Aussicht auf den immensen Gewinn bei dem TOCON-Geschäft drängten sich immer wieder der Name und das Gesicht von Simon Nadicz in sein Bewusstsein.
Wie oft hatte Thalinger sich in den letzten Jahren vorgestellt, ihm den Schädel einzuschlagen? Ihm ein Messer in den Bauch zu bohren? Ihm seine lüsternen Finger abzuschneiden, damit er nie wieder eine Frau würde anfassen können? Nicht mehr lange, und dieser dreckige, kleine Hurensohn würde für seine Sünden bezahlen.
Claus Thalinger legte das Diktaphon beiseite und nippte an seinem Mineralwasser. Aus einem Lautsprecher in der Seitenverkleidung des Jets drang die Nachricht des Piloten, dass die Schlechtwetterfront über Frankfurt abgezogen sei. Der Landeanflug werde keine Probleme bereiten, die Limousine stehe abfahrbereit am Hangar.
Thalinger sah noch einmal auf seine Armbanduhr und überlegte, ob er rechtzeitig zur Eröffnung der Lindstoem-Vernissage in der Innenstadt sein würde. Aber selbst wenn – im Grunde stand ihm der Sinn gar nicht nach einem Menschenauflauf und noch viel weniger nach Smalltalk über den Interpretationsspielraum moderner Kunst. Nein, wenn er es sich recht überlegte, wollte er nur noch einen Happen essen und dann früh ins Bett.
Das Handy klingelte. Thalinger zog es aus der Sakkotasche und nahm das Gespräch an.
»Wir haben ihn«, sagte ein Mann.
Ein wohliges Kribbeln breitete sich von Claus Thalingers Nacken über seinen gesamten Körper aus. Wie lange hatte er auf diesen Augenblick gewartet? Fünfzehn Jahre? Mindestens!
»Was sollen wir mit ihm machen?«, fragte die Stimme am anderen Ende der Leitung.
Übergebt ihn Belial! Das wäre Claus Thalingers erste Wahl gewesen. Denn Belial hatte ihm nicht nur jahrelang loyal gedient, sondern ihn darüber hinaus mit unzähligen exquisiten und überaus lukrativen Filmen versorgt. Er war ein Profi gewesen – mehr noch, ein Künstler – vor und hinter der Kamera. Niemand hatte Angst, Schmerz, Verzweiflung und Resignation besser in Bilder fassen können als er.
Aber jetzt war Belial tot, sein Folterkeller existierte nicht mehr – äußerst bedauerlich, denn genau dorthin hätte Thalinger sich Nadicz gewünscht.
Doch es gab Alternativen, sehr gute sogar. Eine davon hatte er bereits ausgewählt. »Bringt ihn nach Valance«, sagte Thalinger und nannte eine Adresse. »Saikoff wartet dort auf euch. Er wird sich um alles kümmern.«
1
Etwas in ihm weigerte sich, in die reale Welt zurückzukehren. Da, wo er war, umhüllte ihn die Dunkelheit wie ein schützender Kokon, der Angst, Schmerz und Demütigung von ihm fernhielt und ihm das Gefühl gab, wieder in Sicherheit zu sein. Niemand konnte ihn hier beleidigen, niemand konnte ihm etwas anhaben. Im nachtschwarzen Universum seines innersten Selbst hatte er Zuflucht gefunden. Ein Ort des Friedens, der Ruhe und der Harmonie.
Alles wird gut, dachte er, und doch wusste er gleichzeitig, dass es eine Lüge war.
Etwas berührte ihn am Bauch. Nein, es war keine Berührung, es war ein Schlag, so unvermutet und heftig, dass die Dunkelheit hinter seinen geschlossenen Lidern in einem gleißenden Feuerball explodierte. Instinktiv kniff er die Augen noch fester zusammen, aber das half nichts. Er war wieder zurück im wahren Leben.
In einem grauenhaften Albtraum!
Vom Magen aus rauschte der Schmerz wie eine glühende Welle durch seinen Körper. Simon Nadicz versuchte, sich zusammenzurollen, um weitere Schläge gegen seinen ungeschützten Bauch zu verhindern, aber es gelang ihm nicht. Etwas zerrte an seinen Händen und Füßen und zwang ihn, in einer ausgestreckten Position zu verharren.
Dann setzte die Atemnot ein. Der Schlag war so brutal gewesen, dass er keine Luft mehr bekam. Nadicz riss den Mund auf und japste, aber der so dringend benötigte Sauerstoff gelangte aus irgendeinem Grund nicht in seine Lungen. Etwas steckte in seinem Mund, drückte seine Zunge gegen den Gaumen. Er versuchte, es auszuspucken, schaffte es aber nicht.
Panik stieg in ihm auf. Fühlte sich so der Tod an? Er war noch nicht bereit zum Sterben. Was würde aus seiner Frau und den drei Kindern werden? Was aus seiner Geliebten?
Nadicz riss die Augen auf. Der Schmerz ließ immer noch grelle Lichtpunkte in seinem Kopf tanzen, so dass er nichts sehen konnte, aber wenigstens gelang es ihm endlich, ein bisschen Luft einzusaugen – nur mit großer Anstrengung, wie durch ein halbverstopftes Ventil, aber immerhin. Alles war besser, als zu ersticken!
Dann erloschen die Lichtpunkte allmählich, und er erkannte seine Umgebung im trüben Schein einer Taschenlampe: schäbige Wände, von denen der Putz großflächig abgebröckelt war. Abgewetzte Bodendielen. Zerbrochene, mit Brettern vernagelte Fensterscheiben. Massives Dachgebälk.
An einem der Balken hing er, die gefesselten Hände in einen Karabinerhaken eingeklinkt, der von der Decke baumelte. Seine Arme spürte Simon Nadicz nicht mehr, sie waren längst taub. In seinem Mund steckte ein Knebel, der ihn jetzt husten und würgen ließ. Aber dann hatte er sich wieder im Griff, und die Erinnerung sickerte in sein Bewusstsein wie lähmendes Gift.
Die Vorstandssitzung. Die Heimfahrt im Auto. Der schwarze Lieferwagen, der ihn auf der einsamen Landstraße zuerst halsbrecherisch überholt und dann ausgebremst hatte. Sein aufwallender Ärger. Schließlich die Überraschung als die Männer ausgestiegen waren und ihn mit vorgehaltener Pistole gezwungen hatten, bei ihnen einzusteigen. Einer hatte ihm eine Spritze in den Arm gejagt. Fast im selben Moment war er ohnmächtig geworden.
Und hier wieder aufgewacht. In einem gottverlassenen, halbverfallenen Landhaus – seiner ganz persönlichen Hölle.
Wie hatte es nur dazu kommen können? Und aus welchem Grund? Warum hatten diese Scheißkerle sich ausgerechnet ihn als Opfer ausgesucht?
Vermutlich weil er Geld hatte. Und Einfluss. Sie wollten ihn erpressen, keine Frage. Erstaunlicherweise beruhigte ihn dieser Gedanke ein bisschen. Wenn es um Erpressung ging, würden sie ihn nicht töten, zumindest nicht gleich. Das würde ihm etwas Zeit verschaffen, und Zeit war im Moment das Kostbarste, das er sich vorstellen konnte.
Die Taschenlampe richtete sich auf ihn, er musste die Augen zusammenkneifen.
»Er ist wieder munter«, sagte eine Stimme. Sie klang heiser, beinahe tonlos, und dadurch umso unheimlicher. »Ich denke, wir können jetzt weitermachen.«
Nadicz blinzelte gegen das Licht an, konnte aber nur wenig erkennen. Der Kerl mit der Taschenlampe war groß und wirkte athletisch. Neben ihm stand ein kleinerer, untersetzter Mann. Beide hatten schwarze Skimasken übergezogen. Der Kleinere trug darunter eine Brille, in der sich Nadiczs angestrahlter Körper widerspiegelte. Ziemlich bizarr.
Außer den beiden Männern war niemand im Raum. Bei der Entführung am Abend waren sie mindestens zu fünft gewesen. Wo die anderen jetzt steckten, wusste Nadicz nicht.
Der kleinere Mann nickte. »Endlich. Ich will, dass sich dieses Arschloch vor Angst in die Hosen scheißt!« Seine Stimme klang irgendwie weibisch.
»Dann gehört er jetzt Ihnen.« Das war wieder die tonlose Stimme mit der Taschenlampe. »Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Ich warte so lange draußen und passe auf, dass Sie ungestört bleiben. Auf dem Tisch liegen ein paar Sachen. Suchen Sie sich aus, was Ihnen gefällt. Und geben Sie mir Bescheid, wenn Sie hier fertig sind. Ich kümmere mich dann um den Rest.«
Nadicz wollte schlucken, aber der Knebel in seinem Mund ließ das nicht zu. Er brachte nur ein kurzes Würgen zustande, und einen Moment lang hatte er wieder das Gefühl, ersticken zu müssen. Erst als er sich wieder unter Kontrolle hatte, begann er, die ganze Tragweite dessen zu begreifen, was die beiden Kerle gerade miteinander gesprochen hatten. Hier ging es gar nicht um eine Lösegeldforderung. Hier ging es darum, ihm etwas anzutun.
Der große Mann reichte dem Kleineren die Taschenlampe und machte sich auf den Weg zur Tür, ohne sich noch einmal umzudrehen. Der Kleinere mit der Brille blieb noch einen Moment vor Nadicz stehen, als wisse er nicht, was er als Nächstes tun sollte. Endlich drehte er sich um und ging zu dem alten Holztisch in der hinteren Ecke. Als der Lichtkegel der Taschenlampe darauffiel, erkannte Nadicz eine Reihe von Messern und Werkzeugen, sauber nebeneinander aufgereiht wie chirurgisches Besteck. Auch ein Fuchsschwanz und ein Rohrschneider waren dabei, außerdem ein gewaltiger Vorschlaghammer.
Der Mann mit der Maske legte die Taschenlampe so auf den Tisch, dass sie in den Raum leuchtete. Dann griff er mit beiden Händen nach dem schweren Hammer und kam damit zurück.
»Ich denke, wir beginnen mit deinen Kniescheiben, Arschloch!«, zischte er und holte aus.
Simon Nadicz brüllte in seinen Knebel.
Freitag
2
Es war ein ungemütlicher Novembermorgen in Amsterdam, bedeckt, diesig und außergewöhnlich kalt. Laut Radio würde das Wetter in den nächsten Tagen kaum besser werden, und glaubte man den Meteorologen, stand nicht nur Holland, sondern ganz Westeuropa ein strenger Winter bevor.
Avram Kuyper schloss den obersten Knopf seiner Jacke, stellte den Kragen gegen den böigen Nordwind auf und beschleunigte seinen Schritt. Er konnte sich an Zeiten erinnern, in denen die Grachten zugefroren und die Menschen auf dem Eis spazieren gegangen oder Schlittschuh gefahren waren.
Ein dünnes Lächeln legte sich auf seine Lippen und erhellte für einen Moment das von tiefen Falten zerfurchte Gesicht mit dem grauweißen Haar und dem stoppeligen Dreitagebart. All die Monate, in denen er untergetaucht war, hatte er nur wenig an Amsterdam gedacht. Er hatte nicht einmal das Gefühl gehabt, etwas zu vermissen. Aber ausgerechnet die Erinnerung an die vereisten Kanäle wärmte ihm aus irgendeinem Grund das Herz.
Sein Lächeln verflog, als er sich klarmachte, warum er die Stadt so lange gemieden hatte. Er stand auf der Fahndungsliste der Polizei. Seine Stadtwohnung hatte er seit dem Sommer nicht mehr betreten, weil sie observiert wurde. Insofern war Amsterdam für ihn nicht nur ein Stück Heimat, sondern gleichzeitig auch eine Schlangengrube.
Seit seiner Rückkehr fühlte er sich verfolgt. Mehr noch: Er hatte das Gefühl, in eine Falle geraten zu sein. Es gab keine konkreten Anhaltspunkte dafür, nur eine vage Ahnung. Aber seine Ahnung hatte ihn bisher selten im Stich gelassen.
Vielleicht hätte ich diesen Auftrag nie annehmen sollen!
Als Profi ließ er sich von Emotionen natürlich nicht ins Bockshorn jagen. Er hatte einen Auftrag angenommen, und den würde er erledigen. Doch diesmal würde er besonders vorsichtig sein.
Er war an diesem Morgen mit dem Bus in die Van Woustraat gefahren. Das letzte Wegstück legte er zu Fuß zurück. Der Trenchcoat und der Aktenkoffer ließen ihn in der Menge verschwinden, denn auf der gegenüberliegenden Seite der Singelgracht befand sich der Hauptsitz der Niederländischen Bank. Hier wimmelte es um diese Uhrzeit nur so vor Geschäftsleuten, die aussahen wie er. Sein Outfit machte Avram gewissermaßen unsichtbar – bei dem, was er vorhatte, musste er das auch sein.
Er schob seine Hornbrille auf der Nase zurecht und ging weiter. Im Einklang mit der Menschenmenge überquerte Avram die Oosteindebrücke. Anstatt in den Bankenkomplex abzubiegen, ging er jedoch weiter bis zur Flevoroute, wo er sich in einer Seitenstraße vergewisserte, dass das Auto, das er gestern Abend dort geparkt hatte, noch da war. Nicht auszudenken, wenn jemand heute Nacht sein Fluchtfahrzeug gestohlen hätte.
Mit dem Wagen war alles in Ordnung.
Avram legte die letzten Meter bis zum Ufer der Amstel zurück. Straße und Fußweg waren an dieser Stelle zwar genauso schmal wie fast überall in der Stadt, aber da der Fluss breiter als jede Gracht war, wirkte es hier viel weiträumiger als anderswo. Zudem tummelten sich hier kaum Menschen, da es sich um keine Durchgangsstraße handelte.
Mit strammem Schritt ging Avram an den roten Ziegelsteinbauten mit ihren kleinen, weißen Erkern vorbei, ohne von ihnen Notiz zu nehmen. Auch für das wundervolle herbstliche Flusspanorama hatte er keine Augen. Er achtete vielmehr auf die Autos, die in langen Reihen links und rechts der Straße parkten – ob jemand darin saß, der sich später womöglich an ihn erinnern konnte. Oder ob die wenigen Fußgänger, die sich hierher verirrt hatten, ihn bemerkten. Aber ihm kamen nur ein verliebtes Pärchen und eine alte Frau mit einem Dackel entgegen. Das Pärchen war mit sich selbst beschäftigt, die alte Frau sprach mit ihrem Hund. Auf Avram achtete niemand.
Er wechselte die Straßenseite. Nun befand er sich direkt am Kai. Fünf Hausboote hatten hier ihren festen Liegeplatz, aber nur drei davon wurden aktuell bewohnt. Zwei standen leer, obwohl sie möbliert waren. Vermutlich befanden sich ihre Besitzer auf Reisen. Eines der beiden Boote, das mittlere, hatte Avram gestern Nacht aufgebrochen, um sich zu vergewissern, dass es für seine Zwecke geeignet war.
Er sah sich ein letztes Mal unauffällig um. Immer noch schien es niemanden zu geben, der sich für ihn interessierte, weder hier noch auf der Torontobrücke, die weiter rechts von ihm über die Amstel führte. Rasch schlüpfte Avram durch die Tür und schloss sie wieder von innen.
Geschafft!
Er atmete durch und versuchte, ein wenig Spannung abzubauen. In all den Jahren war es ihm nicht gelungen, seine Aufregung abzulegen. Er konnte sie zwar besser kontrollieren als früher, aber sie war immer noch da. Weil jeder Auftrag anders war und jedes Mal etwas schiefgehen konnte.
Avram sah sich um. Der Raum war dämmrig, weil die schweren Vorhänge zugezogen waren und kaum Licht von draußen durchließen – einer der Vorteile dieses Verstecks. Auf den ersten Blick sah alles so aus wie in der Nacht. Vor allem wirkte das Hausboot verlassen. Aber Avram musste Gewissheit haben – nicht dass der Besitzer inzwischen zurückgekehrt war und nebenan schlief.
»Hallo? Ist jemand da?«, fragte er.
Keine Antwort.
Sicherheitshalber kontrollierte er die Kajüte, das Bad und die Besenkammer. Aber die Luft war rein.
Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Viertel nach acht. Noch eine halbe Stunde, vorausgesetzt, dass Sergej Worodins Pläne sich nicht geändert hatten.
Eigentlich hatte er Worodin schon gestern töten wollen. Zwei Kugeln in den Kopf, aus sicherer Distanz, sobald er das Haus verließ. Nach seinen Informationen hätte das um 10.00 Uhr der Fall sein sollen. Doch der Russe hatte am Donnerstag keinen Fuß vor die Tür gesetzt, und sein Haus war die reinste Festung: Alarmsensoren an allen Fenstern, eine gepanzerte Tür mit Sicherheitsschloss, sieben Außenkameras, Bewegungsmelder – das ganze Programm. Die Wände und das Dach hatte er mit Kevlareinsätzen verstärken lassen. Avram hätte eine Panzerfaust benötigt, um da durchzukommen.
Worodins Wagen, ein schwarzer Maybach, war mit der Widerstandsklasse VR14 ausgestattet und hielt ebenfalls nahezu jedem gängigen Geschoss stand. Solche Autos leisteten sich normalerweise nur Staatsoberhäupter, reiche Scheichs oder kolumbianische Drogenbarone.
Und Sergej Worodin, der Pate von Sankt Petersburg, der in Amsterdam sein zweites Zuhause gefunden hatte. Von hier aus steuerte er sein kriminelles Imperium in ganz Europa. In gewissen Kreisen ging sogar das Gerücht, dass sein Netzwerk bereits bis in die USA reichte.
Natürlich hatte Worodin sich dabei viele Feinde gemacht, insofern waren seine Vorsichtsmaßnahmen durchaus gerechtfertigt. Aus Sicherheitsgründen wusste auch so gut wie niemand über seine täglichen Termine Bescheid, nicht einmal seine engsten Mitarbeiter. Womit er wohl nicht rechnete, war, dass seine eigene Frau ihn tot sehen wollte.
Jekaterina Ivanovna Worodin war eine stolze Mittvierzigerin, schlank, groß, elegant und weltgewandt – aber für ihren Mann anscheinend nicht mehr attraktiv genug. In den letzten Jahren hatte er sich immer öfter jüngere Freundinnen zugelegt und sich dabei nicht einmal mehr die Mühe gemacht, es vor seiner Frau zu verheimlichen. Anfangs hatte Jekaterina Worodin noch versucht, sich dagegen zu wehren, doch nachdem ihr klargeworden war, dass er sich seine außerehelichen Vergnügungen nicht nehmen lassen würde, hatte sie sich mit der Untreue ihres Mannes arrangiert. Sie hatte ihren Stolz hinuntergeschluckt und weggesehen, nicht weil sie noch besonders viel für ihn empfand, sondern vielmehr weil ihr die Ehe mit dem Oberhaupt des Tschornej Janwar, einer Splittergruppe der russischen Mafia, ein luxuriöses Leben bescherte.
Doch neuerdings wollte Sergej Worodin die Scheidung, und er hatte seiner Frau unmissverständlich klargemacht, dass sie von seinem Vermögen keinen Rubel erhalten würde. Nicht einmal ihre achtjährige Tochter Ava wollte er ihr lassen. So war es zum Streit gekommen, bei dem der cholerisch veranlagte russische Mafia-Boss auch vor körperlicher Gewalt nicht haltgemacht hatte. Beim Treffen mit Avram hatten Jekaterina Worodin zwei Schneidezähne gefehlt, ihr Gesicht war von Blutergüssen und einer hässlichen Platzwunde auf der Stirn verunstaltet gewesen.
Voller Verbitterung hatte sie Avram ihre Geschichte erzählt, auch dass sie in weiser Voraussicht im Lauf der letzten Jahre ein kleines Vermögen beiseitegeschafft hatte. Einen Teil davon wollte sie jetzt dazu verwenden, um ihren verhassten Ehemann beseitigen zu lassen.
Kurz vor dem Streit hatte sie mitbekommen, dass Sergej Worodin sich an diesem Morgen mit Khaled Bashkir treffen wollte, einem islamischen Extremisten, der in dem Ruf stand, beste Kontakte zu Al-Qaida und anderen terroristischen Organisationen des Nahen und Mittleren Ostens zu unterhalten. Worodin wollte über Bashkir eine größere Waffenlieferung aus Russland in den Irak und in den Jemen abwickeln, und es ging darum, noch einige Details abzustimmen. Das Treffen war auf 8.45 Uhr terminiert, in Khaled Bashkirs Hotel, dem Intercontinental Amstel Amsterdam. Jekaterina Ivanovna Worodin hatte Avram auch verraten, dass ihr Mann nicht mit dem Auto dorthin fahren würde, sondern mit seiner Yacht. Denn trotz aller Vorsicht war er eitel genug, seinen Wohlstand gerne zur Schau zu stellen.
Natürlich war auch seine Yacht eine mobile Festung. Doch Avram witterte seine Chance auf einen tödlichen Treffer in der kurzen Zeit, die Worodin benötigen würde, um von der Uferpromenade zum Hotel zu gelangen.
Er ging zum Fenster und schob den Vorhang einen Spalt auseinander. Wie ein gewaltiges englisches Herrenhaus erhob sich auf der anderen Seite der Amstel das Interconti-Hotel, ein rechteckiger Klotz in pastellfarbenen Ocker- und Rottönen, mit einem bläulich schimmernden Dach, weiß umrahmten Fenstern und einem beeindruckend großen Glaspavillon zur Flussseite hin. Irgendwo dort würde Sergej Worodin in einigen Minuten anlegen, nicht ahnend, dass jemand vom gegenüberliegenden Ufer aus auf ihn schießen würde.
Skrupel hatte Avram keine. Worodin war ein Schwein, nicht nur, weil er seine Frau krankenhausreif geprügelt hatte, sondern auch, weil er seine Geschäftsinteressen mit brutaler Härte vertrat. Angeblich gingen über dreihundert Menschenleben auf sein Konto. Wer sich ihm in den Weg stellte, wurde eiskalt abserviert. Nicht umsonst nannte man ihn in Sankt Petersburg Angel smerti.
Todesengel.
Avram zog den Vorhang wieder zu und ging zum Esstisch. Dort gab er eine Zahlenkombination ins Schloss seines Aktenkoffers ein und klappte ihn auf. Zum Vorschein kamen die Einzelteile seines Scharfschützengewehrs, passgenau eingefügt in eine Schaumstoffummantelung. Mit geübten Griffen setzte er die Waffe zusammen. Leise klickten die Federbolzen ein, der vertraute Geruch von Waffenöl und Metall stieg ihm in die Nase. Er spürte, wie seine Nervosität nachließ.
Es dauerte nur ein paar Augenblicke, dann war das Gewehr einsatzbereit und geladen. Zu guter Letzt stellte Avram noch die Entfernung an seinem Visier ein. Von seiner Position bis zur gegenüberliegenden Uferpromenade waren es ziemlich genau achtzig Meter. Je nachdem, an welcher Stelle Worodins Yacht anlegen würde, konnten es auch ein paar Meter mehr sein. Aber Avram war sich dessen bewusst und darauf eingestellt. Auf diese Distanz würde er nicht danebenschießen. Die Sicht war gut, es regnete nicht, und die beiden Fahnen auf dem Dach des Interconti-Hotels zeigten ihm, dass er Rückenwind hatte. Ideale Voraussetzungen für einen präzisen Treffer.
Wie immer an solchen Tagen kroch die Zeit zäh dahin. Minuten dehnten sich zu kleinen Ewigkeiten. Immer wieder warf Avram einen Blick zwischen den Vorhängen hindurch, für den Fall, dass Sergej Worodin früher hier auftauchte. Aber das tat er nicht.
Um 8.40 Uhr traf Avram seine letzten Vorbereitungen. Er öffnete das Fenster ein paar Zentimeter, schob leise den Esstisch heran, warf ein Sofakissen auf den Boden und kniete sich darauf. Dann legte er sein Gewehr auf den Tisch, rückte seine Hornbrille ein letztes Mal zurecht und schob den Lauf der Waffe in den Fensterspalt. In dieser Position harrte er aus.
8.45 Uhr
8.50 Uhr.
8.55 Uhr.
Von Worodin keine Spur. Hatte der Russe seinen Plan geändert? Ahnte er womöglich, dass seine Frau ihm einen Killer auf den Hals gehetzt hatte?
Aber dann schob sie sich plötzlich in Avrams Visier – die fünfzehn Meter lange Sportyacht Beluga, die Jekaterina Ivanovna Worodin angekündigt hatte. Auf dem schlanken, weißen Rumpf saß ein dunkelblauer Aufbau mit einer Vielzahl von Antennen und einer beeindruckenden Radaranlage auf dem Dach. Mit einer solchen Ausrüstung hätte man mühelos den Atlantik überqueren können.
Die Scheiben des Aufbaus waren getönt. Avram konnte keine Gesichter dahinter erkennen, nur Silhouetten. Bis die Yacht am Ufer festmachte, würde er sich noch gedulden müssen.
Zwei Crewmitglieder kamen heraus und legten die Leinen an, einer vorne, einer hinten. Als sie damit fertig waren, betraten sieben Männer mit ernsten Mienen das Hinterdeck. Sie trugen trotz der kühlen Temperaturen keine Mäntel, sondern nur dunkle Anzüge, unter denen sich ihre durchtrainierten Körper und ihre Pistolenholster abzeichneten – Worodins Bodyguards. Erst nachdem sie sich nach allen Seiten vergewissert hatten, dass keine Gefahr bestand, nickte einer von ihnen ins Innere der Yacht, um Entwarnung zu geben.
Avram kniff sein linkes Auge zu, atmete noch einmal tief durch und zielte. Einen Moment lang geschah nichts. Dann trat Sergej Worodin ins Freie. Avram erkannte ihn sofort. Wie bei jedem Auftrag hatte er sich genau über seine Zielperson erkundigt. Dazu gehörten sein familiäres und sein berufliches Umfeld, seine finanziellen Verhältnisse, seine Gewohnheiten und natürlich sein Aussehen. Worodin war etwas größer als seine Bodyguards, hatte rötliches Haar und trug ebenfalls einen dunklen Anzug. Im Gegensatz zu den anderen schien er jedoch bester Laune zu sein, er strahlte über das ganze Gesicht.
Avram richtete das Fadenkreuz auf Worodins Stirn, atmete langsam aus, krümmte den Finger … und hielt plötzlich inne, als der Russe sich, umringt von seinen Leibwächtern, hinabbeugte. Als er wieder hochkam, trug er ein kleines Mädchen auf dem Arm – Ava, seine Tochter, die ihn fest an sich drückte und ihm einen dicken Kuss auf die Wange gab.
Leise fluchend löste Avram seinen Finger vom Abzug. Solange das Kind da war, konnte er nicht schießen. Er war zwar sicher, dass er es nicht verletzen würde, aber den Schock würde es sein Leben lang nicht vergessen. Das war es nicht wert, und es war gewiss auch nicht im Sinne der Mutter.
Avram wartete ab, ob der Angel smerti seine Tochter wieder absetzen und alleine an Land gehen würde. Aber er behielt sie den ganzen Weg bis zum Hotelpavillon auf dem Arm. Von da an spiegelte das Glas zu stark, als dass Avram noch ein konkretes Ziel hätte ausmachen können.
Verdammt!
Unschlüssig stand er auf und sicherte sein Gewehr. Auf der gegenüberliegenden Seite der Amstel legte die Beluga wieder ab. Sie machte eine Kehrtwende und tuckerte in gemächlichem Tempo davon.
Was jetzt?
Avram wusste nicht, wie Sergej Worodins weiterer Tagesplan aussah – wie lange sein Treffen mit Khaled Bashkir dauern würde und was er danach vorhatte. Worodins Frau hatte ihm darüber keine Auskunft geben können. Somit gab es keine Möglichkeit, später woanders sein Glück zu versuchen.
Hier zu warten und darauf zu hoffen, dass Sergej Worodin irgendwann zum Ufer zurückkehren würde, machte aber auch keinen Sinn. Die Yacht war weg. Wenn er das Hotel verließ, dann wahrscheinlich durch den Haupteingang auf der anderen Seite des Gebäudes.
Ebenso schnell, wie er das Gewehr zusammengesetzt hatte, zerlegte Avram es wieder. Die Einzelteile verstaute er im Koffer. Als er das Hausboot verließ und wieder in den kalten Novembermorgen hinaustrat, war er so in Gedanken vertieft, dass er das Motorrad auf der gegenüberliegenden Straßenseite gar nicht wahrnahm. Auch nicht den Fahrer, der darauf saß. Erst als der sich bewegte, spürte Avram plötzlich instinktiv die Gefahr. Er blickte auf, sah die Gestalt im schwarzen Lederanzug, den dazu passenden Helm mit dem dunklen Klappvisier – und vor allem den Lauf der schallgedämpften Pistole, der direkt auf sein Gesicht zielte. Reflexartig zog Avram den Kopf ein – gerade noch rechtzeitig, denn schon zischten zwei Kugeln an ihm vorbei. Irgendwo hinter ihm schlugen sie in die Fassade des Hausboots ein.
Die dritte Kugel traf ihn – mitten in die Brust. Avram wurde von der Wucht des Aufpralls so hart zurückgeschleudert, dass er mit dem Hinterkopf auf den Asphalt aufschlug. Einen Moment lang wurde seine Welt ein dunkler, bodenloser Abgrund, aber er war Profi genug, um zu wissen, dass er sich nicht aufgeben durfte. Wenn der andere noch einmal treffen würde, wäre es mit ihm aus.
Er ignorierte die Schmerzen in der Brust und die Dunkelheit im Kopf, griff zu dem Schulterholster unter seiner Jacke und zog seine Glock 22 heraus. Zum Glück begann er schon wieder, Konturen zu erkennen, auch einen menschlichen Umriss, der zwischen den Autos vor ihm auftauchte.
Avram schoss – fünfmal, kurz hintereinander –, und der Umriss verschwand wieder aus seinem Gesichtsfeld. Hatte er getroffen? Oder war der Kerl nur in Deckung gegangen?
Der Schleier vor seinen Augen lichtete sich, er konnte jetzt wieder klar sehen. Vor allem konnte er wieder klar denken. Deshalb richtete er sich nicht auf, sondern nutzte die freie Sicht unter den parkenden Autos, um nach dem Motorradfahrer zu suchen. Tatsächlich sah er die schwarzen Lederstiefel zwei Wagen weiter.
Avram zielte und feuerte einen weiteren Schuss ab.
Ein unterdrückter Schrei drang zu ihm. Getroffen! Was würde der Kerl als Nächstes tun? Zum Angriff übergehen oder die Flucht ergreifen?
Halb hüpfend, halb hinkend eilten die Lederstiefel zum Motorrad zurück. Avram schoss auch noch auf den anderen Fuß, verfehlte ihn aber. Dann heulte die Maschine auf und jagte davon.
Wer war der Kerl, der es auf ihn abgesehen hatte? Um das herauszufinden, durfte Avram ihn nicht entkommen lassen!
Mühevoll richtete er sich auf. Der Schmerz in seiner Brust wurde plötzlich so heftig, dass es ihm einen Moment lang den Atem raubte. Rasch befühlte er die getroffene Stelle. Erleichtert stellte er fest, dass seine kugelsichere Weste den Schuss abgefangen hatte.
Das Knattern des Motorrads riss Avram aus seinen Gedanken. Er stand auf und zielte, direkt auf den Rücken des Fahrers. Doch der hatte schon die rettende Kurve vor dem Singelkanal erreicht und verschwand hinter den Häusern.
Avram rannte hinterher. Vielleicht war der Kerl dumm genug, über die Oosteindebrücke auf die Stadhouderskade zu flüchten, die ein gutes Stück geradeaus führte. In diesem Fall hätte Avram vielleicht eine Chance, ihn doch noch zu erwischen.
Aber er spürte, dass er viel zu langsam vorankam. Die Schmerzen in seiner Brust raubten ihm den Atem, der Gewehrkoffer in seiner Hand behinderte ihn zusätzlich. Aber er konnte den Koffer schließlich nicht einfach auf der Straße liegenlassen.
Als er die Kurve am Singelkanal erreichte, bog das Motorrad gerade in die Hemonystraat ein. Keuchend blieb Avram stehen. Zu Fuß würde er den Kerl niemals einholen! Und bis er am Auto war, wäre das Motorrad schon über alle Berge. Einen Moment spielte er mit dem Gedanken, eines der am Kai festgemachten Motorboote kurzzuschließen, aber auch das hätte ihm nichts gebracht, weil in Richtung Hemonystraat kein Wasserweg führte.
Verfluchter Mist!
Zähneknirschend musste er einsehen, dass der Angreifer entkommen war. Und höchstwahrscheinlich würde er schon sehr bald einen neuen Versuch unternehmen, Avram zu töten. Aber zumindest gab es eine Chance, herauszufinden, wer dieses Arschloch war – immerhin etwas.
Avram ging zum Hausboot zurück, verschwand im Innern und kramte in den Küchenschränken, bis er fand, wonach er suchte: Wattetupfer, einen Gefrierbeutel und einen Clipverschluss. Damit ausgerüstet, trat er wieder ins Freie.
3
»Biegen Sie dort vorne ab. Ich glaube, das ist es.«
Emilia Ness saß auf dem Beifahrersitz eines dunkelblauen Renault Mégane und verglich das Foto auf ihrem Handy mit ihrer realen Umgebung. Das Haus auf dem Bild war bei Dunkelheit und aus einem ganz anderen Winkel aufgenommen worden, aber es war mit ziemlicher Sicherheit dasselbe Haus. Umgeben von frischgepflügten, dampfenden Äckern, stand es verlassen mitten im Nirgendwo. Ein verwahrloster Bauklotz, allein auf weiter Flur. Nicht mal eine Adresse gab es hier.
Philippe Ruiz, Emilias Kollege hinter dem Steuer, drosselte die Geschwindigkeit und bog in den befestigten Seitenweg ein, der von der Landstraße abzweigte. Kein Schild zeigte in diese Richtung, und der rissige Asphalt war schon seit mindestens zehn Jahren nicht mehr ausgebessert worden.
Der holprige Weg führte sie ein paar hundert Meter kerzengerade zwischen zwei Feldern hindurch. Am Ende machte er einen Knick nach links. Von hier aus waren es noch mal zweihundert Meter bis zum Ziel.
»Soll ich bis zum Haus vorfahren?«, fragte Ruiz. Er hatte sein schulterlanges Haar glatt nach hinten gekämmt und trug einen dicken Wollpullover. Obwohl er schon seit seinem zwölften Lebensjahr in Frankreich lebte, hörte man immer noch seinen spanischen Akzent.
»Nein. Bleiben Sie hier stehen. Den Rest gehen wir zu Fuß«, sagte Emilia und wartete, bis er den Wagen angehalten hatte.
»Sind Sie sicher, dass wir nicht lieber Verstärkung anfordern sollen?«
Emilia nickte. »Wir holen Verstärkung, sobald wir wissen, worum es hier überhaupt geht.« Entschlossen öffnete sie die Tür und stieg aus.
Ein kühler Novembermorgen empfing sie, wolkenverhangen und trüb. Noch regnete es nicht, aber es konnte jeden Moment anfangen.
Sofort kroch Emilia die Kälte in die Knochen. Sie nahm ihre Waffe aus dem Schulterholster und zog den Reißverschluss ihrer Jacke bis ganz nach oben. Nicht mehr lange, bis der erste Schnee fallen würde.
Auf der anderen Seite des Wagens stieg Ruiz aus. Vor seinem Mund kondensierte sein Atem zu kleinen Wolken, aber falls ihm die Kälte etwas ausmachte, ließ er es sich zumindest nicht anmerken.
Auch er zog seine Dienstwaffe und lud sie durch. »Von mir aus kann’s losgehen«, raunte er.
Emilia setzte sich in Bewegung.
Aus irgendeinem Grund kam ihr das Haus, auf das sie nun zugingen, unheimlich vor. Vielleicht lag es daran, dass hier – abgesehen von Ruiz und ihr – weit und breit keine Menschenseele zu sehen war. An einem gewöhnlichen Freitagmorgen hätte sie zumindest ein paar Autos auf der Landstraße erwartet. Aber da war niemand. Die Krähen, die auf den umgepflügten Feldern pickten, machten die Atmosphäre auch nicht gerade angenehmer. Noch dazu der grau bewölkte Himmel – hier herrschte eine Stimmung wie in einem Horrorfilm.
Aber tief im Innern wusste Emilia, dass weder die Abgeschiedenheit noch die Krähen noch das Wetter der Auslöser für ihre Beklemmung waren, sondern die sonderbare Botschaft, die sie gestern erhalten hatte. Ein anonymer Schreiber mit der E-Mail-Adresse [email protected] hatte ihr das Bild dieses heruntergekommenen Bauernhauses und eine ungefähre Lagebeschreibung geschickt, zusammen mit dem Hinweis: Das Morden geht weiter. Belial ist tot, aber sein Geist lebt. Überzeugen Sie sich selbst!
Diese Zeilen waren es, die ihr einen kalten Schauer über den Rücken trieben – jetzt noch mehr als beim ersten Lesen. Welches Grauen würde sie hinter diesen verfallenen Mauern erwarten? Sie spürte, wie sich die feinen Härchen in ihrem Nacken aufrichteten.
Belial ist tot, aber sein Geist lebt.
Das konnte im Grunde nur eines bedeuten: Foltermord. Gewissenloser, bestialischer Foltermord. Genau davor hatte sie Angst. Gab es womöglich einen Nachahmungstäter?
Vielleicht hätten wir doch besser Verstärkung anfordern sollen, dachte sie. Mit einem mehrköpfigen Einsatzteam an ihrer Seite hätte sie sich wohler gefühlt.
Was aber, wenn die Mail nur ein Fake war? Wenn irgendein Witzbold mit schlechtem Humor versuchte, Interpol an der Nase herumzuführen? Nach Belials Tod vor einem knappen halben Jahr waren immer wieder Nachrichten dieser Art eingegangen, von Leuten, die die Polizei ärgern wollten, oder von Schülern, die sich einen Spaß erlaubten, ohne die Konsequenzen zu überblicken. Allerdings hatte Emilia schon seit einiger Zeit keine solchen Nachrichten mehr erhalten, wohl weil der Fall von damals im Bewusstsein der Öffentlichkeit allmählich in Vergessenheit geriet.
Und jetzt das!
Das Morden geht weiter … Überzeugen Sie sich selbst!
Eine innere Stimme sagte ihr, dass die Nachricht ernst gemeint war. Sonst wäre sie heute Morgen auch nicht mit Ruiz hierhergefahren, immerhin lag dieser Ort über sechzig Kilometer von Lyon entfernt. Aber falls ihre innere Stimme sie nun doch trog und jemand sie in die Irre geführt hatte, wollte sie nicht schuld daran sein, dass ein ganzes Aufgebot von Beamten hier draußen seine Zeit mit der Aufklärung eines Verbrechens vertrödelte, das nie begangen worden war.
Nein, bis sie nicht genau wusste, was sie hier erwartete, würden sie und Ruiz diesen Ort erst einmal allein in Augenschein nehmen.
Zwei Krähen stoben krakeelend auf und flatterten davon. Emilia konzentrierte sich wieder auf das Haus. Es war mit Natursteinen errichtet worden und maß etwa acht Meter in der Breite und zwölf in der Länge. Das Satteldach hing in der Mitte ein wenig durch, aber trotz einiger gebrochener Ziegel gab es keine sichtbaren Löcher. Die Fenster waren von außen vernagelt worden, die Witterung hatte die Holzbretter beinahe schwarz gefärbt. An die rechte Seite des Hauses war ein offener Schuppen angebaut, der vielleicht einmal als Stellplatz für einen Traktor oder für ein Auto gedient hatte. Jetzt stand er leer.
Im Gegensatz zu den Fenstern war die Eingangstür nicht mit Brettern verbarrikadiert worden. Emilia gab Ruiz mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass sie da reingehen wollte. Er nickte, und sie entsicherten ihre Waffen.
Der Türsturz war so niedrig, dass Emilia beinahe mit dem Kopf daran streifte. Um keine Fingerabdrücke zu verwischen, drückte sie die verwitterte Eisenklinke nur am äußersten Ende nach unten. Als sie vorsichtig daran zog, öffnete sich die Tür mit einem gähnenden Quietschen.
Ruiz hatte seine Taschenlampe bereits an den Lauf seiner Pistole angelegt und zielte damit durch den Eingang. Emilia zog ihre Meglight aus der Jackentasche und tat es ihm gleich.
Als sie eintraten, spürte sie instinktiv, dass hier etwas nicht stimmte. Dass sie gleich etwas Grauenhaftem gegenübertreten würde. Aber noch war nichts Verdächtiges zu sehen. Sie befanden sich in einem Vorraum, der früher wohl als eine Art Garderobe benutzt worden sein musste. Darauf ließen jedenfalls die alten Wandhaken auf der rechten Seite schließen. Darunter lag in einer Ecke ein vergammelter Lederstiefel, an dem immer noch Reste von Dreck und Stroh klebten.
Die nächste Tür stand offen. Es ging drei Steinstufen hinab, so dass man nun etwas mehr Kopffreiheit hatte. Dadurch wirkte der Raum nicht so gedrungen wie der Eingangsbereich, gleichwohl aber düster wie ein Verlies, weil von außen kaum noch Licht hereindrang. Emilia und Philippe Ruiz schwenkten die an ihre Pistolen gepressten Taschenlampen hin und her, um sich einen Überblick zu verschaffen.
Sie befanden sich in der ehemaligen Küche. Alles was noch irgendeinen Wert gehabt hatte, war entweder von den Besitzern mitgenommen oder später geplündert worden. Aber der gusseiserne Herd und ein paar heruntergekommene Überreste der alten Einrichtung standen noch an Ort und Stelle und ließen erahnen, wie es hier einmal ausgesehen haben musste.
Die nächste Tür war wieder geschlossen. Als Emilia sie mit vorgehaltener Waffe öffnete, schlug ihr der kupferartige Geruch von Blut wie eine dunkle Woge entgegen. Sie musste sich abwenden und in der Küche noch einmal tief Luft holen, bevor sie sich ein Herz fasste und den dritten Raum betrat.
Dieser war größer als die Küche und das Vorzimmer zusammen, ein weitläufiger Raum, der früher einmal der Wohnbereich gewesen sein musste. Im fahlen Licht der Taschenlampen sah Emilia, dass der größte Teil der Wände von bröckeligem Putz bedeckt war, unter dem an vielen Stellen der rohe Stein hervorschaute. Der Fußboden bestand aus abgewetzten Holzdielen. Alle Fenster waren von außen zugenagelt, die Scheiben zersprungen. Einrichtungsgegenstände gab es hier keine, abgesehen von einem alten Holztisch in der hinteren Ecke des Raums. Dort, wo früher die Zwischendecke zum Dachboden aufgelegen hatte, führten fünf massive Querbalken von einer Hauswand zur anderen. Unter dem mittleren stand ein Mann mit gesenktem Kopf und erhobenen Händen, reglos wie eine Schaufensterpuppe. Er trug ein gestreiftes Hemd, eine Krawatte und dunkle Stoffhosen.
Aber etwas an diesem Bild stimmte nicht: Die Hände des Mannes waren gefesselt. Sie hingen an einem in den Querbalken eingelassenen Stahlhaken. Und unter dem Körper des Mannes befand sich eine riesige Lache Blut, in der irgendetwas lag, das man nicht sofort erkennen konnte.
Irgendwo neben Emilia raunte Philippe Ruiz: »Was um alles in der Welt ist hier passiert?«
4
Der Wagen, den Avram am Vorabend unweit des Hausboots geparkt hatte, war ein VW Golf in unauffälligem Schwarz – kein anderes Auto in Holland war in den letzten Jahren öfter zugelassen worden. Seine Häufigkeit, aber auch seine Kompaktheit und nicht zuletzt die hundertneunzig PS unter der Motorhaube machten es zu einem perfekten Fahrzeug für einen Auftragskiller, insbesondere in einer engen Großstadt wie Amsterdam.
Avram verließ die Innenstadt und durchfuhr den Tunnel, der unter der IJ in den Norden von Amsterdam führte. Sein Waffenkoffer lag auf dem Beifahrersitz. Die kugelsichere Weste hatte er wegen der Schmerzen in der Brust im Kofferraum verstaut. Durch den Schuss des Motorradfahrers waren mindestens zwei oder drei Rippen geprellt.
Hätte das Dreckschwein Penetrator-Munition verwendet, wäre ich jetzt tot.
Er fischte sein Handy aus der Jackentasche und drückte die Taste für die Wahlwiederholung. Endlich nicht mehr das Belegtzeichen! Ein kleines Wunder.
»Hallo, hier Griersson«, meldete sich eine gelangweilte Herrenstimme.
»Ich bin’s, Avram. Ich wollte nur sichergehen, dass du im Labor bist, wenn ich gleich vorbeischaue.«
»Wie höflich du fragen kannst!«
Avram seufzte still in sich hinein. Johannes Griersson war ein begnadeter Mikrobiologe, aber empfindlich wie eine Mimose. »Ich brauche deine Hilfe, Johannes. Und die deines Bruders. Ich würde dich nicht darum bitten, wenn es nicht dringend wäre.«
»Das klingt schon besser. Wann wirst du da sein?«
Avram bremste, weil vor ihm ein Wagen einscherte. »In etwa zehn Minuten«, sagte er. »Seid ihr allein?«
»Sind wir. Klingel fünfmal, damit wir wissen, dass du es bist. Aber schlepp uns keine Bullen an, verstanden? Wir haben einen Ruf zu verlieren.«
Avram beendete das Gespräch und steckte das Handy wieder weg. Noch bevor er die Tunnelausfahrt erreichte, kam ihm auf der Gegenspur ein Polizeiauto mit Blaulicht und Sirene entgegen – schon das fünfte auf dem Weg durch die Stadt. Beim ersten hatte er sich noch die Frage gestellt, ob sie womöglich nach ihm suchten. Aber erstens glaubte er nicht, dass jemand die Schießerei am Hausboot beobachtet hatte, und zweitens war schließlich er es, der überfallen worden war, nicht umgekehrt. Nein, das Polizeiaufgebot musste eine andere Ursache haben. Vermutlich war nur irgendwo ein Unfall passiert.
Johannes und Lasse Griersson bewohnten ein kleines Anwesen unweit des Grietje Tump Museums. Ihr Besitz umfasste ein weiß gestrichenes, hölzernes Wohnhaus, einen Springbrunnen im Vorgarten, eine Doppelgarage und – gewissermaßen das Herzstück – ein modernes biochemisches Labor in einem Flachdachbungalow. All das befand sich hinter einem massiven Stahlzaun.
Auf dem Schild am Eingangstor stand »G&G – Institut für angewandte Gentechnik«, und tatsächlich bestritten die beiden Brüder einen guten Teil ihres Lebensunterhalts mit der Durchführung von Nahrungsmittelanalysen und Vaterschaftstests. Weniger bekannt war, dass sie auch immer wieder als Sachverständige konsultiert wurden, wenn es um genetische Fingerabdrücke bei Gerichtsverhandlungen ging. Dieser spezielle Bereich ihrer Arbeit war der Grund für Avrams Besuch – das und die Tatsache, dass die Griersson-Brüder ihm einen Gefallen schuldeten.
»Ich möchte, dass ihr das hier für mich untersucht«, sagte er, als er in ihrem Büro stand. Johannes Griersson, der Ältere der beiden Geschwister, saß hinter seinem Schreibtisch und spielte mit einem Bleistift herum. Sein Bruder Lasse lehnte mit verschränkten Armen an der Wand. Beide trugen weiße Laborkittel.
»Was ist das?«, fragte Lasse und deutete mit einer Kopfbewegung auf die Tüte mit rot verfärbten Wattebäuschen, die Avram ihnen hinhielt.
»Eine Blutprobe«, sagte Avram. »Jemand hat versucht, mich umzubringen. Vor einer halben Stunde.«
»Aber du hast dich gewehrt.«
Avram nickte. »Ich habe ihn angeschossen. Das hier ist sein Blut. Ich habe es von der Straße auftupfen müssen, es wird also verunreinigt sein. Aber ich will wissen, wer es auf mich abgesehen hat.«
»Hast du ihn nicht gesehen?«
»Er trug einen Helm. Und es ging alles ziemlich schnell.«
Lasse Griersson kam einen Schritt näher, nahm die Tüte und hielt sie gegen das Licht. »Viel ist es nicht«, stellte er fest. »Noch dazu die Verschmutzungen … Versprechen kann ich dir nichts. Und billig wird es auch nicht.«
»Das Geld ist kein Thema. Aber ich will das Ergebnis so schnell wie möglich.«
Lasse Griersson betrachtete Avram mit trüben Augen. »Wir werden uns beeilen«, sagte er. »Dennoch kann es ein paar Tage dauern.«
Avram seufzte. Das hatte er schon befürchtet. »Schneller geht es nicht?«
»Kommt drauf an, in welchen DNA-Datenbanken der Kerl abgespeichert ist, der es auf dich abgesehen hat. Wenn er hier in Holland registriert ist, hast du vielleicht morgen schon ein Ergebnis. Wenn wir erst herumsuchen müssen, kann schnell eine Woche ins Land gehen.«
Avram nickte. »Ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Gebt mir Bescheid, sobald ihr etwas für mich habt.«
Er wollte schon zur Tür gehen, als Johannes Griersson sich zu Wort meldete, der seit Avrams Ankunft kein Wort gesagt hatte. »Bevor wir uns um diese Blutprobe kümmern, will ich wissen, wie heiß die Sache ist. Nicht dass wir uns die Finger verbrennen, weil du uns etwas Wichtiges verschweigst.«
»Dein Misstrauen kränkt mich, Johannes.«
»Ich frage nur nach der Wahrheit.«
Avram hatte keine Ahnung, was Griersson damit meinte. »Ich habe dir gesagt, was ich weiß: Ein Arschloch auf einem Motorrad hat auf mich geschossen, und ich will wissen, wer das war.«
Johannes Griersson hielt Avrams Blick eisern stand. Er war ein Typ vom alten Schlag, der sich nicht so leicht einschüchtern ließ. »Also gut, dann frage ich dich ganz konkret: Hat diese Blutprobe etwas mit der Sache im Interconti zu tun?«
Einen Moment lang war Avram verwirrt. Woher um alles in der Welt wusste Griersson von seinem fehlgeschlagenen Attentat auf Sergej Worodin? Etwas stimmte hier nicht, und das bereitete ihm ein ziemlich flaues Gefühl in der Magengegend. »Wovon zum Teufel sprichst du, Johannes?«
»Von dem Bombenanschlag vor kaum einer halben Stunde. Mindestens fünf oder sechs Tote, darunter ein russischer Industrieller und seine Tochter. Das haben sie vorhin im Radio gebracht. Sag mir, dass du damit nichts zu tun hast.«
Avram schluckte. Sein Hals fühlte sich plötzlich rau an. »Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist«, sagte er.
5
Es war immer noch empfindlich kühl, aber allmählich verzogen sich die Wolken. Die durchschimmernde Vormittagssonne ließ auf einen schönen Tag hoffen.
Am Wegrand vor dem Landhaus in den Monts de Forez parkten mittlerweile sieben Autos: der Renault Mégane von Philippe Ruiz, ein Kleinbus der Spurensicherung sowie fünf Einsatzfahrzeuge der örtlichen Polizei. Emilia hätte ein bisschen mehr Diskretion bevorzugt, aber nachdem sie Interpol von ihrem grausigen Fund berichtet hatte, waren von Lyon aus wie üblich die Verantwortlichen vor Ort eingebunden worden, und der für Mordermittlungen zuständige Beamte in Montbrison hatte es sich nicht nehmen lassen, diesen schockierenden Fall mit einem gebührenden Polizeiaufgebot zu würdigen.
So hatte der parkende Konvoi an Einsatzfahrzeugen auch schon die ersten Reporter auf den Plan gerufen. Sie standen an der Landstraße, ein paar hundert Meter entfernt, fotografierten und telefonierten, vermutlich mit ihren Redaktionen. Bald würden weitere Reporter folgen, das war immer so. Wie die Geier scharten sie sich überall dort, wo der Tod zugeschlagen hatte, um sich ihren Anteil zu sichern. Wodurch sie der Polizei das Leben zusätzlich erschwerten.
Der Leiter des Spurensicherungsteams stelzte mit seinen langen Beinen auf Emilia zu. Er hatte sich bereits bei der Ankunft vorgestellt und hieß Arancourt. Seinen Vornamen hatte Emilia vergessen.
Arancourt war ein hagerer Mann, an die zwei Meter lang und etwa dreißig Jahre alt. Er trug einen weißen Plastikoverall, der ihm eine Nummer zu klein war, und weiße Überstülper über den Schuhen. Als er vor Emilia stehen blieb, streifte er sich die Handschuhe ab und zog die Kapuze vom Kopf. Darunter kam ein schwarzer Minipli zum Vorschein, wie er in den Siebzigern einmal modern gewesen war.
»Bis wir mit unserer Arbeit fertig sind, wird es noch eine Weile dauern«, sagte er. »Aber Sie müssen nicht die ganze Zeit hier warten. Wenn Sie wollen, können wir drinnen gerne schon über den Tathergang sprechen. Ich schicke Ihnen meinen vollständigen Bericht dann später per E-Mail.«
Ein Gespräch an der frischen Luft wäre Emilia zwar lieber gewesen, aber sie wollte sich keine Blöße geben. Deshalb nickte sie nur und folgte Arancourt hinüber zum Landhaus. Philippe Ruiz kam ebenfalls mit, obwohl auch er nicht besonders glücklich darüber schien. Ihre Arbeit bei Interpol bestand hauptsächlich darin, polizeiliche Ermittlungen bei Gewaltverbrechen grenzübergreifend zu koordinieren. Sie telefonierten viel, sorgten für den nötigen Informationsaustausch, analysierten die Struktur der Verbrechen, um wiederkehrende Muster zu erkennen. Sie organisierten die Einsätze vor Ort, aber sie nahmen selten selbst daran teil. Deshalb waren Situationen wie diese hier eher ungewohnt für sie.
Arancourt musste sich ein gutes Stück hinunterbeugen, als er durch die Eingangstür ging, und irgendwie hatte dieses Bild etwas Lächerliches. Dennoch konnte Emilia nicht darüber lachen, weil sie wusste, was sie gleich erwarten würde. Die Erinnerung an den grausamen Fund im Haus erstickte jeden Anflug von Humor im Keim.
Sie passierten den Vorraum und stiegen die drei Stufen zur Küche hinab. Ab hier konnte Arancourt wieder aufrecht gehen. Dann gelangten sie in den ehemaligen Wohnbereich, und Emilia spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog. Sie hoffte nur, dass man ihr das nicht ansehen konnte. Es war ihr wichtig, professionell zu wirken. Als Frau hatte sie auch so schon mit jeder Menge Vorurteile zu kämpfen, noch dazu, weil sie erst Mitte dreißig war.
Sie versuchte, den Blutgeruch zu ignorieren, indem sie sich auf die Arbeit der Spurensicherung konzentrierte. Mehrere Standleuchten fluteten den Raum mit Licht, so dass man alles gut sehen konnte. Fünf Männer in Schutzanzügen nahmen Materialproben vom Boden und verstauten sie in Plastikbeuteln, die sie sauber beschrifteten und in die bereitgestellten Klappboxen legten. Jede Fundstelle wurde mit einem Nummernschild versehen und vor der Probenentnahme abfotografiert, um Lage und Position des Fundstücks exakt zu dokumentieren. Bei der späteren Analyse konnte jedes noch so winzige Detail von Bedeutung sein.
Arancourt blieb vor dem Toten stehen und drehte sich zu Emilia und Philippe Ruiz um. »Das Opfer ist männlich, zwischen vierzig und fünfundvierzig Jahre alt und dem äußeren Anschein nach ein erfolgreicher Geschäftsmann«, begann er mit seinem Vortrag. »Das Hemd, die Manschettenknöpfe und die Hose sind von Boss, die Krawatte von Zegna. Ich verstehe nicht viel von Mode, aber sein Outfit war nicht gerade billig. Ich tippe auf einen Anwalt oder auf einen Immobilienmakler. Etwas in der Art jedenfalls. Papiere hat er keine bei sich. Im Moment können wir also nicht sagen, wer der Tote ist.« Er rieb sich die Nase und dachte einen Moment lang nach. Schließlich fuhr er fort: »Nach dem Grad der Totenstarre und der Körpertemperatur zu urteilen, wurde er vor etwa dreißig bis fünfunddreißig Stunden umgebracht, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 23.00 und 4.00 Uhr. Nach der pathologischen Untersuchung können wir das bestimmt noch etwas genauer eingrenzen.«
»Wissen Sie schon, was die Todesursache war?«, fragte Emilia. »Ich meine, die Sache mit seinen Beinen ist offensichtlich, aber es gibt ja offensichtlich noch andere Verletzungen.«
Arancourt nickte. »Auch das werde ich mit letzter Gewissheit erst nach der Obduktion sagen können, aber ich denke, die Frakturen an Kopf und Oberkörper sind nur peripher. Jemand wollte ihm weh tun, und das ist ihm garantiert auch gelungen. Aber gestorben ist er daran nicht.«
»Das heißt …?«
»Er ist verblutet. Weil ihm jemand beide Beine an den Knien abgetrennt hat und ihn dann hier hängen ließ, bis er tot war.«
Emilia schluckte. Die Art, wie Arancourt die Dinge beim Namen nannte, jagte ihr eine Gänsehaut über den Rücken.
Ihr Blick wanderte auf den Boden zu der halbgetrockneten, dunklen Lache, in der die beiden Beinstümpfe lagen, umhüllt von zerfetztem Hosenstoff. Die Füße steckten noch in den Schuhen. Die Knöchel hatte jemand mit einem Seil gefesselt und daran ein Betongewicht angebunden. Auf diese Weise hatte das Opfer sich nicht wehren können, während es massakriert worden war.
Emilia musste sich zusammenreißen, um die aufkommende Übelkeit niederzukämpfen.
Beide Beine … An den Knien abgetrennt …
Was für ein Mensch war in der Lage, einem anderen so etwas anzutun?
6
»Heute Morgen um kurz nach neun Uhr gab es im Speisesaal des Intercontinental-Hotels Amstel Amsterdam eine Explosion, bei der mindestens fünf Menschen getötet und drei weitere schwer verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich unter den Todesopfern der russische Industrielle Sergej Worodin sowie seine achtjährige Tochter, außerdem ein mutmaßliches Mitglied der afghanischen Al-Qaida, Khaled Bashkir. Wie es zu dem Anschlag kam und wem er gegolten hat, ist zur Stunde noch unklar. Augenzeugenberichten zufolge detonierte der Tisch, an dem die betroffenen Personen saßen, während die Getränke serviert wurden. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen im Griff, die Verletzten wurden ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist im Moment dabei, Spuren zu sichern und Zeugen zu vernehmen …«
Avram schaltete das Radio ab – er hatte genug gehört. Nach seinem Besuch bei den Griersson-Brüdern hatte er auf der A10 die Innenstadt umrundet. Nun durchquerte er mit seinem Auto West-Amsterdam.
Da sein Reihenhaus an der Herrengracht schon seit Monaten unter polizeilicher Beobachtung stand, hatte er vorübergehend seine Ersatzwohnung am Jacob-van-Lennep-Kanal bezogen. Vor fünf Jahren hatte er sie unter dem Decknamen Huub Eendrich erworben, für den Fall, dass er einmal irgendwo Unterschlupf finden musste. Bis gestern hatte sie leer gestanden. Jetzt erwies sich die Investition zum ersten Mal als lohnend.
Avram parkte den Wagen in der Garage. Von dort stieg er die alte, knarrende Holztreppe ins erste Stockwerk hinauf, wo sich das Wohnzimmer befand. Er stellte den Waffenkoffer ab, ging in die Küche und trank ein Glas Wasser. Eigentlich war ihm angesichts der niedrigen Temperaturen eher nach einem heißen Kaffee zumute, aber in letzter Zeit bereitete Kaffee ihm immer Magenprobleme. Und Tee konnte er nicht ausstehen.
Er goss sich noch einmal nach, öffnete seinen Trenchcoat und setzte sich an den Küchentisch. Von hier aus hatte er freie Sicht auf den Kanal mit den an den Ufern festgemachten Booten, aber er nahm sie gar nicht wahr. Seine Gedanken kreisten unaufhörlich um die Geschehnisse dieses Morgens. Was zum Teufel war hier los? Jekaterina Worodin hatte ihn angeheuert, damit er ihren Mann umbrachte, doch Avram hatte das Attentat nicht verübt, weil Sergej Worodin bei der Ankunft am Interconti-Hotel seine Tochter auf dem Arm getragen hatte. Unmittelbar danach hatte ein Unbekannter auf einem Motorrad versucht, Avram zu erschießen. Und kurz darauf waren Sergej Worodin und seine Tochter bei einem Bombenanschlag gestorben, ganz zu schweigen von den anderen Opfern.
Offenbar gab es jemanden, der weniger Skrupel als Avram gehabt hatte, ein unschuldiges Kind und eine Handvoll Unbeteiligter zu töten. Wer war das? Der Motorradfahrer? Oder ein unbekannter Dritter? Und warum hatte er das getan? Hatte Jekaterina Worodin einen zweiten Killer engagiert, weil sie von vornherein Zweifel gegenüber Avram gehegt hatte? Oder einfach nur, weil sie sicher sein wollte, dass ihr Mann den Tag auch ganz bestimmt nicht überleben würde?
Zu viele Fragen, auf die er keine Antworten kannte.
Avram hasste es, wenn Auftraggeber zweigleisig fuhren, weil das immer wieder zu unvorhergesehenen Komplikationen führte. In diesem Fall war sogar die ganze Stadt in Aufruhr. Ein Sprengstoffanschlag in einem der angesehensten Hotels von Amsterdam. Herrgott nochmal! Mit keiner anderen Methode hätte man in so kurzer Zeit ein größeres Polizeiaufgebot heraufbeschwören können!
Avram nippte an seinem Wasser und stieß zischend einen Fluch aus. Er war mit einem unguten Gefühl nach Amsterdam zurückgekehrt und hatte Jekaterina Worodins Auftrag nicht nur des Geldes wegen angenommen, sondern auch aus Mitgefühl. Sie hatte so erbärmlich ausgesehen mit ihrem zerschundenen Gesicht – der aufgeplatzten Lippe, den fehlenden Vorderzähnen und den Blutergüssen –, dass er es nicht über sich gebracht hatte, den Auftrag abzulehnen.
Ebenfalls aus Mitgefühl hatte er den Schuss auf Sergej Worodin nicht abgefeuert. Weil er dem Kind keinen Schock fürs Leben verpassen wollte. Aber wohin hatte ihn sein Mitgefühl geführt? Das Kind war tot, und in der Stadt herrschte höchste Alarmstufe. Wenn er nicht Gefahr laufen wollte, von der Polizei erwischt zu werden – oder ein zweites Mal von dem unbekannten Motorradfahrer –, musste er Amsterdam verlassen. Je früher, desto besser.
7
Emilia wartete noch, bis der Leichnam aus dem Landhaus abtransportiert worden war, dann tauschte sie mit Arancourt und mit dem zuständigen Ermittlungsbeamten der örtlichen Polizei ihre Kontaktdaten aus. Bis jetzt handelte es sich um einen schlichten Mord. Zwar um einen besonders grausamen, aber das machte ihn noch nicht zu einem Fall für Interpol. Nur wenn die örtlichen Behörden Amtshilfe in Lyon anforderten, wäre Emilia auch weiterhin eingebunden.
Oder falls sich herausstellte, dass dieser Mord tatsächlich etwas mit Belial zu tun hatte.
Auf der Rückfahrt nach Lyon dachte sie viel darüber nach, wohl wissend, dass ein abschließendes Urteil in diesem frühen Stadium der Ermittlung unmöglich war. Aber sie beschäftigte sich ganz automatisch mit der Suche nach Zusammenhängen. Glücklicherweise war Philippe Ruiz hinter dem Steuer ebenfalls sehr schweigsam, so dass Emilia genug Gelegenheit fand, in Ruhe über alles nachzudenken.
Die Sonne hatte inzwischen die meisten Wolken vertrieben, und unter ihrem wärmenden Schein war auch der Bodennebel verschwunden. Dennoch wirkten die Wiesen und die gepflügten Felder entlang der Straße trist und unwirtlich. Selbst das schöne Wetter konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Winter vor der Tür stand.
Emilia starrte aus dem Beifahrerfenster, während die karge Landschaft wie ein herbstliches Gemälde an ihr vorbeizog. Unentwegt kreisten ihre Gedanken um den grausigen Fund in dem verfallenen Bauernhaus.
Der Tipp, den sie gestern Abend erhalten hatte, war zumindest nicht aus der Luft gegriffen gewesen. Er hatte sie in den Kanton Saint-Jean-Soleymieux geführt, in die Gegend zwischen Margerie-Chantagret und Boisset-Saint-Priest, wo ein brutaler, gewissenloser Mord stattgefunden hatte. Die Ortsangabe war korrekt gewesen, und im Moment gab es für Emilia keinen Grund, den Rest der Nachricht anzuzweifeln.
Das Morden geht weiter. Belial ist tot, aber sein Geist lebt. Überzeugen Sie sich selbst!
Sie rieb sich mit einer Hand über das müde Gesicht. Die E-Mail hatte sie schon heute Nacht tüchtig ins Grübeln gebracht und ihr ein paar wertvolle Stunden Schlaf geraubt. Der Fall Belial war bei Interpol unlängst eingestellt worden. Auf ihrem Schreibtisch stapelten sich schon neue Akten, die ihre Aufmerksamkeit erforderten. Sie hatte gar keine Zeit, sich nun wieder um diesen alten Fall zu kümmern. Ein Teil von ihr war auch gottfroh gewesen, sich nicht mehr damit beschäftigen zu müssen. Endlich vergessen zu können und sich wieder auf die Zukunft zu konzentrieren.
Und jetzt dieser Rückschlag.
Sie hatte am eigenen Leib erlebt, wie es war, sich in Belials Gewalt zu befinden. Sie hatte Demütigung und Schmerz ertragen und Ängste durchlebt, die sie ihren schlimmsten Feinden nicht wünschte. Zwar war Belial tot, daran bestand kein Zweifel, aber wenn es nun jemanden gab, der ihn nachahmte, jemanden, der sein grausames Werk fortsetzte, dann würde Emilia das keine ruhige Minute lassen.
Sie fröstelte. Wer kam als Nachahmungstäter in Frage? Hatte Belial einen Vertrauten gehabt, von dem sie nichts wusste? Oder einen heimlichen Bewunderer? Wer hatte ihn gut genug gekannt, um seine Vorgehensweisen kopieren zu können? Dass Belial kein Einzeltäter gewesen war, stand außer Frage. Er war Teil eines kriminellen Netzwerks gewesen, das sich bis weit nach Osteuropa hineinzog. Gehörte der Mörder aus dem Landhaus diesem Netzwerk an?
Aber es stand ja noch nicht einmal fest, ob es überhaupt einen Zusammenhang mit Belial gab. Auf den ersten Blick war auch keiner erkennbar. Belial hatte, soweit es Interpol bekannt war, nur in seinem Folterkeller gemordet, nirgendwo sonst. Für jedes seiner Opfer hatte er dort ein eigenes Filmset aufgebaut, mit verschiedenen Hintergrundszenarien, Beleuchtungseinstellungen und Requisiten. Die Filmaufnahmen vom Tod seiner Opfer hatte er professionell zusammengeschnitten und sie ins Internet eingestellt, auf seinem Snuff-Movie-Portal www.enterpainment.to.
Das Landhaus zwischen Margerie-Chantagret und Boisset-Saint-Priest war dagegen nicht als Ort für einen Wiederholungstäter geeignet. Der Mörder hatte sein Opfer dorthin verschleppt, weil das Haus abgeschieden genug für sein grausames Vorhaben gewesen war. Weit und breit wohnte dort niemand, und selbst bei Tage fuhren kaum Autos auf der Straße. Bei Nacht – Arancourt hatte die Tatzeit auf 23.00 bis 4.00 Uhr eingegrenzt – musste die Gegend nahezu verwaist sein.
Emilia seufzte. Sie war ziemlich sicher, dass in dem Landhaus nur dieser eine Mord hatte stattfinden sollen. Bis jetzt gab es keine Anzeichen dafür, dass dort irgendwelche Filmaufnahmen stattgefunden hatten. Vielleicht würde Arancourts Bericht über die Spurensicherung darüber Aufschluss geben, aber aus irgendeinem Grund glaubte sie das nicht.