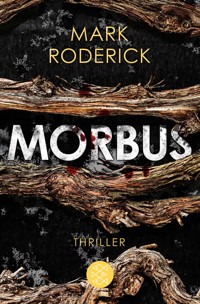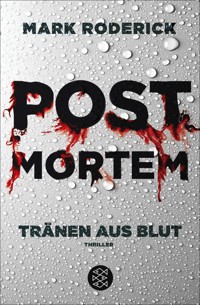9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Post Mortem
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Lina Sattler ist Geldeintreiberin. Im Hamburger Milieu kennt man sie, sie ist berüchtigt wegen ihrer Wutausbrüche, Gefühle wie Angst oder Mitleid sind ihr fremd. Lina hat keinerlei Erinnerung an ihre Kindheit, sie weiß nur, dass ihre Eltern brutal ums Leben kamen. Doch warum? Als sie Hinweisen folgt, die mit ihrer Vergangenheit zu tun haben könnten, stößt sie auf die Spur eines Profikillers: Avram Kuyper. Er kann ihr helfen, weiß er doch um das Komplott, das seinerzeit von einer mächtigen verschwiegenen Organisation aus Wirtschaftsbossen und einflussreichen Politikern geschmiedet wurde. Sie wissen ihre Interessen zu verteidigen, selbst höchste Kreise von Interpol sollen involviert sein. Gemeinsam mit Interpol-Agentin Emilia Ness versuchen sie, diese Gruppe zu zerschlagen, auch wenn ihrer aller Leben nur mehr an einem seidenen Faden hängt. Post Mortem - Die Spiegel-Bestsellerserie geht weiter! In Band 4 geraten Interpol-Agentin Emilia Ness, Profikiller Avram Kuyper und die junge Lina Sattler ins Visier einer Gruppe von mächtigen, skrupellosen Männern, die alles tun, um ihre Interessen zu wahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 520
Ähnliche
Mark Roderick
POST MORTEMSpur der Angst
Thriller
FISCHER E-Books
Inhalt
Prolog
Vor neunzehn Jahren
»Wem hast du davon erzählt?«
Robert Burgmüller wusste sofort, worauf Bernhardt Goller abzielte – und er wusste auch, dass er sich mit einer ehrlichen Antwort in Teufels Küche bringen würde. »Was meinst du damit?«
Goller verzog keine Miene. Wenn überhaupt, spiegelte sich in seinem Gesicht so etwas wie Mitleid wider. »Ich bin nicht zum Spaßen aufgelegt, Robert. Die Angelegenheit ist ernst. Ernster, als du es dir vorstellen kannst. Besser, du sagst uns die Wahrheit. Das wäre für alle am einfachsten. Auch für dich.«
Eindeutig eine Drohung, die nicht zuletzt deshalb wirkte, weil Burgmüller sich auf seinem Stuhl ziemlich isoliert vorkam. Auch die karge Zimmereinrichtung förderte sein Unwohlsein: weißgekalkte, nackte Wände, gefliester Boden, alte Fenster, hohe Decken. In einer Ecke standen ein paar mit Leintüchern abgedeckte Möbel, nach den Konturen zu urteilen zwei Sessel und eine Kommode. Abgesehen davon gab es nur noch Burgmüllers Stuhl und den Tisch daneben. Keine Bilder, keine Dekoration, nichts, was diesen Raum wohnlich machte.
Burgmüller seufzte innerlich auf. Er war der Einzige, der saß. Die drei anderen standen – Goller vor ihm, seine zwei Begleiter hinter ihm. Diese beiden machten Burgmüller besonders nervös, nicht nur, weil sie groß und kräftig waren und er nicht wusste, was sie hinter seinem Rücken taten, sondern vor allem, weil ihre Augen eine Kälte verströmten, die einem durch und durch ging. Das war das Erste, was ihm aufgefallen war, als Goller ihn hereingeführt hatte.
»Ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst«, log Burgmüller, diesmal selbstbewusster. Ängstliches Verhalten wirkte oft verdächtig. Das wollte er unter allen Umständen vermeiden.
Bernhardt Goller fuhr sich mit zwei Fingern über das glattrasierte Kinn, wie ein Schachspieler, der sich seine nächsten Züge überlegt. Er war groß und sportlich, seine blonde Mähne harmonierte perfekt mit dem braungebrannten Teint, den er zweimal wöchentlich im Sonnenstudio auffrischte, wenn seine Firma ihm keine Zeit fürs Windsurfen oder Reiten ließ.
»Das Problem ist, dass ich dir nicht glaube«, sagte er. Das Bedauern in seiner Stimme klang vorgetäuscht. »Ich denke, du weißt ganz genau, was ich meine.«
Burgmüllers Zunge begann, am Gaumen zu kleben.
Auch das noch! Ein trockener Mund kommt einem Geständnis gleich!
Er versuchte, den Schluckreiz zu unterdrücken, weil er nicht wollte, dass man ihm das schlechte Gewissen ansehen konnte. Aber es gelang ihm nicht. Um abzulenken, legte er den Arm auf den Tisch neben sich, wobei er hoffte, dass die Geste halbwegs locker rüberkam.
Jetzt bloß nicht die Fassung verlieren.
Sein Blick wanderte durchs Fenster, was ihm etwas Zeit zum Nachdenken verschaffte. Draußen war der Himmel grau und wolkenverhangen. An den Bäumen auf der Wiese hing kaum noch Laub. Die Anlage war riesig, beinahe wie ein Park. Unter anderen Umständen und mit einer heißen Tasse Tee in der Hand wäre es das Bild eines perfekten Oktobertags gewesen.
Burgmüller beschloss, sich nicht länger in die Ecke treiben zu lassen. »Ich weiß nicht, was du mir anhängen willst, Bernhardt«, sagte er. »Aber ich lasse mich von dir nicht länger grundlos beschuldigen. Wenn du mir etwas vorzuwerfen hast, dann raus damit. Wenn nicht, schlage ich vor, dass wir wieder zu den anderen gehen.«
Goller sah ihn ein paar Sekunden lang aus seinen eisblauen, unberechenbaren Augen an. Schließlich presste er die Lippen zusammen und nickte.
Eine Sekunde lang dachte Burgmüller tatsächlich, dass es ihm gelungen sei, Goller zu überzeugen. Doch dann spürte er die schraubstockartigen Hände der beiden anderen auf seinen Schultern, die ihn gegen seinen Willen weiter auf den Sitz pressten. Er wollte protestieren, sich losreißen, sich wehren, aber dazu kam es nicht mehr. Eine Schlinge legte sich von hinten um seinen Hals, schon bekam er keine Luft mehr. Bei dem Versuch zu schreien, brachte er kaum mehr als ein Krächzen über die Lippen. Seine Finger wollten sich unter die Schlinge krallen, um sie zu lockern – vergeblich. Burgmüller spürte, wie ihm bereits die Kräfte schwanden.
Goller, der reglos vor ihm stand, als würde ihn die ganze Sache nichts angehen, beugte sich jetzt zu ihm. Er griff nach Burgmüllers Unterarm und zwängte ihn gewaltsam zurück auf den Tisch.
»Mach schon!«, zischte Goller.
Diesmal wusste Robert Burgmüller nicht sofort, was er meinte. Viel zu langsam begriff er, dass die Aufforderung gar nicht ihm galt, sondern einem der Männer hinter ihm. Eine zweite Faust ballte sich um Burgmüllers Unterarm. In seinem Augenwinkel blitzte ein Hammer auf, der auf seine Hand niederfuhr.
Dann explodierte der Schmerz in ihm. Ausgehend von seiner zertrümmerten Hand schoss er ihm durch sämtliche Glieder, bis hinein in die Fußspitzen. Seine Ohren klingelten, vor seinem Gesicht tanzten gleißende Lichtpunkte. Instinktiv wollte er das verletzte Körperteil schützen – es an sich heranziehen, oder es mit der anderen Hand vor dem nächsten Schlag abschirmen –, doch Goller und seine beiden Helfer ließen ihm dafür keinen Spielraum. Einen Moment lang glaubte Burgmüller, das Bewusstsein zu verlieren, entweder wegen des Schmerzes oder wegen des Luftmangels. Viel fehlte dazu jedenfalls nicht.
Sie wollten ihn fertigmachen und hatten jede Möglichkeit dazu.
Als er sich schon beinahe innerlich aufgegeben hatte, lockerte sich wie durch ein Wunder die Schlinge um seinen Hals. Keuchend schnappte er nach Luft, so gierig, dass er sich verschluckte und husten musste. Seine Lungen brannten, in seinen Ohren rauschte das Blut. Nie zuvor war er sich der Vergänglichkeit seines Lebens klarer bewusst gewesen. Nie zuvor hatte er solche Angst verspürt.
Sein Blick fiel auf seine ramponierte Hand. Die Haut war an den Knöcheln aufgeplatzt, aus der offenen Wunde quoll Blut. Noch schlimmer als das Blut war allerdings die Tatsache, dass er zwei seiner Finger nicht mehr bewegen konnte – die Gelenke waren durch den Schlag gebrochen. Er brachte mit ihnen nur noch ein unkontrolliertes Zittern zustande.
Tränen stiegen ihm in die Augen. Er hasste sich dafür, denn auch das war eine Art Schuldeingeständnis. Zumindest würden sie es so interpretieren, und allein darauf kam es an.
»Falls du uns jetzt etwas sagen willst, dann raus mit der Sprache«, raunte Goller. »Wir können aber auch noch eine Weile so weitermachen. Ich schätze, acht Finger sind noch in Ordnung. Wie viele willst du noch opfern, bevor du endlich auspackst?«
Robert Burgmüller versuchte fieberhaft, seine Gedanken zu ordnen, was wegen der Schmerzen, vor allem aber aufgrund seiner Angst, gar nicht so einfach war. Er hatte geglaubt, dass Goller wenn auch nicht sein Freund, so doch wenigstens ein vertrauenswürdiger Geschäftspartner war. Dass er und die anderen ihm vielleicht ein paar unangenehme Fragen stellen oder ihm sogar drohen würden. Aber mit diesem Maß an körperlicher Gewalt hatte Burgmüller nicht gerechnet.
Er hatte sich einen Schritt zu weit in die Höhle der Löwen vorgewagt. Jetzt gab es kein Zurück mehr.
Die Tränen wollten nicht enden. Sie flossen einfach so aus ihm heraus. »Am Anfang fand ich die Vorstellung, bei euch mitzumachen, verführerisch.« Es war nur ein dünnes Wispern. Zu mehr war er im Moment nicht in der Lage. »Aber ich habe erkannt, dass das nichts für mich ist. Ich bin nicht wie ihr. Ich kann das nicht länger. Deshalb habe ich beschlossen auszusteigen, Bernhardt.«
Goller fixierte ihn mit einem undefinierbaren Blick. »Das hättest du dir früher überlegen müssen«, sagte er. »Du hängst schon viel zu tief mit uns drin. Tut mir leid, aber zum Aussteigen ist es zu spät.«
Burgmüller nickte schwach. Hätte er damals gewusst, worauf er sich einlassen würde, wäre er nie hierhergekommen. Ohne es zu ahnen, hatte er einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Jetzt musste er dafür büßen.
»Warst du bei der Polizei?«
Burgmüller zuckte zusammen. »Nein! Ich habe mit niemandem darüber geredet. Das musst du mir glauben!«
»Was ist mit Viktoria?«
Es fühlte sich an, als würde jemand seine Eingeweide zusammenpressen. Woher wusste Goller davon, dass er mit seiner Frau gesprochen hatte?
»Vinzent hat mir gesagt, dass Viktoria bei ihm angerufen hat, weil sie sich Sorgen um dich macht. Hast du mit ihr darüber geredet, Robert?«
Burgmüller schüttelte den Kopf – nicht, weil er leugnen wollte, sondern aus Hilflosigkeit. Was sollte er sagen? Goller wusste ja ohnehin schon alles.
»Viktoria kennt keine Details«, wisperte er. »Ihr fiel nur auf, dass ich mich in letzter Zeit verändert habe. Sie wollte wissen warum, und ich brauchte jemanden, der mir zuhört. Aber sie wird ganz bestimmt mit niemand anderem darüber reden.«
»Mit Vinzent hat sie es getan.«
Wieder nickte Goller. Prompt kam der nächste Schlag mit dem Hammer, diesmal von schräg hinten, mitten ins Gesicht. Im ersten Moment wusste Robert Burgmüller gar nicht, was geschehen war. Er hörte nur ein unheimliches, knackendes Geräusch, während gleichzeitig sein Sichtfeld erschüttert wurde und ihm für ein paar Sekunden die Sinne zu schwinden drohten. Als seine Gedanken wieder aufklarten, spürte er einen dumpfen, nicht genau lokalisierbaren Schmerz. Etwas stimmte nicht mit seinem Mund. Seine Zunge ertastete ein paar ausgeschlagene Zähne.
Robert Burgmüller wusste jetzt endgültig, dass er heute sterben würde. Er hoffte nur noch, dass sie es nicht unnötig in die Länge ziehen würden.
»Mach mit mir, was du willst«, raunte er, erstaunt darüber, wie unverständlich das klang. Der Schlag mit dem Hammer musste stärker gewesen sein als vermutet. »Versprich mir nur, dass Viktoria nichts geschieht.«
»Tut mir leid, aber das kann ich nicht.«
Das Letzte, was Robert Burgmüller sah, war der Blick, den Goller den beiden Männern hinter ihm zuwarf – ein stummes Todesurteil.
Dann zog sich die Schlinge um seinen Hals wieder zu.
Diesmal endgültig.
1
Heute
Hamburg-Wilhelmsburg, südlich der Hafen-City
Es war eine ziemlich verwahrloste Gegend, das konnte selbst die Nacht nicht kaschieren – eine Mischung aus schäbigen, mehrstöckigen Wohnhäusern und leerstehenden Industriegebäuden. Ohne Notwendigkeit wäre Lina Sattler niemals hierhergekommen, schon gar nicht zu dieser Uhrzeit. Aber Samir Habib – der Mann, mit dem sie sich treffen wollte –, arbeitete im Schichtbetrieb. Er kam erst nach Hause, wenn andere Leute ins Bett gingen. Und morgen würde er für vier Wochen nach Kenia in den Urlaub fliegen.
Lina hatte sich in den Kopf gesetzt, unbedingt noch vorher mit ihm zu sprechen. Habib hatte ihr auch einen Termin nach seinem Urlaub angeboten, aber sie wollte nicht warten. Das hatte sie schon viel zu lange getan. Vier Wochen machten zwar kaum einen Unterschied, wenn man bedachte, dass sie schon seit Jahren nach Antworten suchte. Andererseits drängte es sie mit jedem Tag mehr danach, endlich einen Hinweis darauf zu finden, wer sie eigentlich war. Aus anfänglicher Neugier war längst ein sehnliches Verlangen geworden, beinahe so wichtig wie Luft oder Nahrung.
Deshalb hatte sie Samir Habib zu diesem nächtlichen Treffen überredet.
Langsam fuhr die Siebenundzwanzigjährige mit dem Auto die Straße entlang, bis sie endlich die richtige Hausnummer fand. Habib wohnte im fünften Stock. Durch ein paar Schlitze in den Jalousien drang Licht – offenbar war er bereits zu Hause.
Sie warf einen Blick auf das Armaturenbrett ihres Wagens. 23.17 Uhr. Sie hatte noch fast eine Viertelstunde Zeit bis zu ihrer Verabredung. Was sollte sie tun?
Dem ersten Impuls folgend, wollte sie die nächste freie Parklücke suchen, ein paar Minuten warten und dann bei Habib klingeln. Allerdings sahen die Autos, die hier am Straßenrand standen, allesamt ziemlich mitgenommen aus – zerbeult, verkratzt oder beides. Eines hatte zwei platte Reifen. Das konnte kein Zufall sein.
Hundert Meter weiter hockten ein paar Männer an einer Bushaltestelle. Im Schein der Straßenlaterne konnte Lina sehen, dass sie miteinander sprachen und immer wieder verstohlene Blicke zu ihr herüberwarfen. Besser gesagt zu ihrem nagelneuen Ford Mustang, der in dieser Gegend ungefähr genauso auffiel wie ein Diamant zwischen Kohlestücken.
Lina beschloss, lieber weiterzufahren und woanders nach einem Parkplatz zu suchen. Nicht, dass ihr anschließend die Räder fehlten oder gar das ganze Auto. Selbst ein Kratzer im Lack wäre ärgerlich genug.
Dann lieber ein paar Schritte laufen.
Langsam fuhr Lina durch die Nacht, bis sie einige Blocks weiter eine Stelle am Straßenrand fand, die ihr besser gefiel. Allerdings musste sie sich jetzt beeilen, wenn sie es pünktlich zu Samir Habib schaffen wollte.
Es war eine frische Herbstnacht. Eine Windbö trieb das Laub der Bäume, die in regelmäßigem Abstand am Straßenrand wuchsen, über den Gehweg. Am Himmel waren weder Mond noch Sterne zu erkennen, nur eine unheimliche, tiefliegende Wolkenmasse, die träge wie Teer über die Stadt hinwegkroch. Wahrscheinlich würde es bald regnen.
Lina zog den Reißverschluss ihrer Jacke nach oben und machte sich zu Fuß auf den Rückweg zu Samir Habibs Haus. Sie hatte etwa die Hälfte der Strecke zurückgelegt, als sie eine Kneipe sah, die ihr bereits während der Parkplatzsuche aufgefallen war. Sie hieß Schwarzer Bock, vor der Tür standen ein paar Skinheads mit Biergläsern und Zigaretten in der Hand. Die Art, wie sie miteinander umgingen, deutete darauf hin, dass sie schon einiges getrunken hatten.
Lina kannte diese Art von Männern. Manche waren einzeln ganz umgänglich, aber in der Gruppe mutierten sie alle zu Alphatieren, die sich gegenseitig etwas zu beweisen versuchten. Bei Alkoholkonsum galt das sogar doppelt.
Deshalb entschied sie sich für einen Umweg. Der führte sie am Parkplatz eines Supermarkts vorbei, dann weiter durch eine Straße mit Sozialbauten aus den 1960ern bis zum Gelände einer stillgelegten Tankstelle. Die Zapfsäulen waren längst abgebaut worden, das Kassenhäuschen stand leer. Nirgends brannte Licht, nur von den Straßenlaternen drang etwas Helligkeit auf das Areal. Die schlauchartige Waschstraße hinter dem Kassenhäuschen verlor sich irgendwo weiter hinten in der Dunkelheit.
Da es keine Absperrung gab und es für Lina, die mittlerweile ohnehin schon spät dran war, eine Abkürzung bedeutete, überquerte sie mit eiligen Schritten das Gelände. Als sie am Kassenhäuschen vorbeikam, trat plötzlich eine Gestalt aus dem Eingangsbereich: ein hagerer Kerl mit eingefallenen Wangen und weit auseinanderstehenden Augen. Er trug Turnschuhe, Jogginghosen und eine Basketballjacke. Auf seiner Schirmmütze war das Emblem des FC Sankt Pauli aufgenäht.
»Wohin denn so eilig, Schätzchen?« Er legte den Kopf schief, vermutlich, weil er das cool fand, und entblößte dabei eine Reihe schlecht gepflegter Zähne.
»Bin auf dem Weg nach Hause«, sagte Lina. Was sie wirklich hier tat, ging niemanden etwas an.
»War das ’ne Einladung?«
Lina schüttelte belustigt den Kopf. »Ich gehe jetzt weiter. Wehe, du folgst mir!«
Gerade wollte sie wieder loslaufen, da stellte er sich ihr in den Weg. Sein breites Grinsen sollte wohl Selbstsicherheit ausstrahlen. Auf Lina wirkte es eher dümmlich. Sie hatte den Eindruck, dass er unter Drogen stand.
»Lust auf ’n Fick?«
Allmählich wurde er entschieden zu aufdringlich. »Ganz bestimmt nicht mit dir«, entgegnete Lina scharf, um ihn spüren zu lassen, dass sie es ernst meinte.
»Ich hab noch zwei Kumpels«, sagte Sankt Pauli. »Vielleicht gefallen die dir besser. Aber ficken tun wir alle drei wie die Weltmeister. Wirst schon sehen …«
In diesem Moment spürte Lina, wie jemand sie von hinten packte und umklammerte. Gleichzeitig wurde ihr ein Sack über den Kopf gestülpt. Eine Hand presste sich auf ihren Mund und verhinderte, dass sie schrie, obwohl sie es natürlich versuchte. Aber sie wusste, dass das nicht genug sein würde, um auf Hilfe hoffen zu können.
Übelkeit stieg in ihr auf. Der Sack stank nach vergammelten Kartoffeln und Rauch. Der Griff um ihren Körper schien ihr die Luft aus den Lungen zu pressen. Zu allem Übel konnte sie die Arme nicht bewegen.
Hätte ich bloß einen anderen Weg eingeschlagen!
Lina wollte sich losreißen, aber es ging nicht. Als sie versuchte, nach ihren unsichtbaren Gegnern zu treten, griff jemand nach ihren Beinen und hielt sie fest. Sie verlor das Gleichgewicht, wurde von den Kerlen aber aufgefangen. Ohne etwas dagegen tun zu können, musste sie es geschehen lassen, dass sie weggetragen wurde.
Erneut versuchte sie, sich aus den Klammergriffen herauszuwinden – ohne Erfolg. Mit knapp einem Meter sechzig Körpergröße und einem Gewicht von neunundvierzig Kilo hatte sie ihren Gegnern viel zu wenig entgegenzusetzen.
Durch das dünne Gewebe des Kartoffelsacks hörte sie Gelächter. Offenbar waren die Männer sich ihrer Sache ziemlich sicher.
»Die Stute hat Feuer«, zischte einer. »Das gefällt mir.«
»Du kannst sie haben, wenn ich mit ihr fertig bin.«
»Jetzt erst mal weg von der Straße, ihr beiden Trottel. Wir klären drinnen, wie wir es mit ihr machen!«
Also waren sie zu dritt.
Obwohl Lina wusste, dass sie Angst haben sollte, hatte sie keine. Auf andere – insbesondere auf Männer – wirkte sie mit ihrer zierlichen Gestalt häufig wehrlos. Wie ein typisches Opfer eben. Wegen ihres mädchenhaften Aussehens und der geringen Oberweite glaubten außerdem viele, sie sei noch minderjährig – wenn sie Alkohol kaufte, musste sie regelmäßig ihren Personalausweis an der Kasse vorzeigen. Kurz: Die meisten Menschen hielten sie für jung, schwach und ungefährlich.
Aber der Eindruck täuschte.
Die Männer zerrten sie in einen Raum. Lina hörte, wie eine Tür ins Schloss fiel. Nach einigen Schritten brachten sie sie in eine aufrechte Position, bis sie wieder fest stand. Gerade, als sie zu einem kräftigen Tritt ausholen wollte, spürte sie ein Messer an ihrer Kehle.
»Jetzt mal ganz ruhig, mein Kätzchen«, raunte ihr einer der Kerle ins Ohr. »Wenn du nicht willst, dass wir dir weh tun, bist du sofort ganz lieb zu uns, kapiert?«
Sie nickte. Die Hand löste sich von ihrem Mund, jemand zog ihr den Sack vom Kopf. Endlich konnte sie wieder frei atmen.
Um sie herum war es stockfinster.
»Timmy, mach’s Licht an«, zischte jemand.
Ein Feuerzeug sprang an. Lina erkannte, dass man sie auf die Tankstellentoilette verschleppt hatte. Rechts von ihr hing das Waschbecken an der Wand, links ein Pissoir. Hinter dem Kerl, der ihr das Messer gegen den Hals drückte, befanden sich zwei klapprige Klokabinen.
Der mit dem Feuerzeug zündete eine Campinglampe an und stellte sie auf dem Waschbecken ab. Er hatte schiefe Vorderzähne, einen orangeroten Ziegenbart und eine tätowierte Träne auf der Wange.
»Du bist ja mal ’n hübsches Ding«, sagte er.
»Was man von dir nicht gerade behaupten kann.«
Er grinste. »Eine, die sich nichts gefallen lassen will, hä? Mit dir werden wir viel Spaß haben.« Er beugte sich zu ihr und drückte ihr einen langen, intensiven Kuss auf die Lippen, während der mit dem Messer sie in Schach hielt und Sankt Pauli sie nur gierig anglotzte. Die Zunge des Ziegenbarts schob sich tief in ihren Mund, bohrte und forschte – am liebsten hätte sie einfach zugebissen. Aber noch war der Zeitpunkt nicht günstig.
Ohne sich zu wehren, ließ Lina den Kuss, oder was auch immer das sein sollte, über sich ergehen. Sie ertrug den Zwiebelgeschmack, den sauren Atem, die Hand, die sich auf ihre Hüfte legte und von dort langsam zwischen ihre Beine wanderte.
»Knöpf ihr die Hose auf, Pauly«, raunte der Ziegenbart, ohne den Blick von Lina zu wenden. »Und du, Korre, passt auf, dass sie keine Dummheiten macht. Hörst du, Süße?« – jetzt sprach er wieder mit Lina –, »wenn du schreien willst, wird mein Freund dich mit seinem Messer bearbeiten!«
Seine Hand glitt über ihren Bauch nach oben. Gleichzeitig begann Pauly, an ihrem Jeansknopf herumzunesteln, während der mit dem Messer ihre Brüste begrabschte.
Nur eines hatten die dämlichen Idioten in ihrem Eifer vergessen: sie auf Waffen abzusuchen.
Vorsichtig glitt ihre Hand hinter ihren Rücken und zog die Pistole aus dem Hosenbund – eine Heckler & Koch P8, wie sie auch von der deutschen Bundeswehr benutzt wird. Der schwarze, glasfaserverstärkte Polyamidgriff fühlte sich kühl und vertraut in ihrer Faust an. Das Gewicht der 9 mm-Waffe gab ihr Vertrauen.
»Wird’s bald was mit der scheiß Hose, Pauly?«, blökte der Ziegenbart, dem das Warten wohl zu lang dauerte. »Ich will hier nicht bis Weihnachten rumstehen!«
In diesem Moment drückte Lina den Abzug. Ein ohrenbetäubender Knall ließ den Raum erzittern, für den Bruchteil einer Sekunde schien die Welt stillzustehen. Dann ließ Korre das Messer fallen und begann, wie von Sinnen zu brüllen, während er gleichzeitig zu Boden ging und sich das blutende Bein hielt, in das Lina ihm eine Kugel gejagt hatte.
Pauly war vor Schreck wie gelähmt. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er auf die Waffe, deren Mündung sich jetzt direkt auf seinen Kopf richtete. Im flackernden Schein der Campinglampe spiegelte sich im Gesicht dieses Arschlochs eine ganze Bandbreite von Emotionen wider, von Fassungslosigkeit bis hin zu schierer Angst. Sein Mund formte lautlose Worte, die wohl so viel wie »Bitte nicht schießen« bedeuten sollten.
Lina feuerte.
Die Kugel durchschlug die Klotür und ließ in der Kabine eine Wandfliese zersplittern, aber sie verletzte Sankt Pauli nur am Ohr. Mit Genugtuung beobachtete Lina, wie der junge Hosenscheißer zusammenbrach und sich wimmernd neben seinem Kumpel auf dem Boden wand, die Beine zum Körper gezogen, die Arme um den Kopf gelegt, als könne er sich so vor weiteren Kugeln schützen.
Aber Lina war gar nicht mehr an ihm interessiert, denn sie jagte dem Ziegenbart nach, der mit erstaunlichen Sprinterqualitäten nach draußen geflüchtet war. Mit wehendem Mantel rannte er davon, weg von dem Toilettenhäuschen, weg von der Straße, weg von den Laternen, hin zu dem mannshohen Dickicht, das auf dem Grundstück hinter der Tankstelle wucherte.
»Stehen bleiben, Arschloch!«, schrie Lina ihm nach.
Aber er tat es nicht. Wie ein gehetztes Tier raste er weiter.
Lina hob ihre Waffe, brachte Kimme und Korn in Einklang, richtete sie auf die Stelle zwischen den Schulterblättern aus. Alles in ihr brannte danach, diesem triebgesteuerten Widerling die letzte Lektion seines Lebens zu erteilen.
Doch dann besann sie sich in letzter Sekunde eines Besseren. Sie war nicht hergekommen, um drei notgeile Halbstarke das Fürchten zu lehren. Sie war hier, weil sie nach Antworten suchte.
2
Hotelübernachtungen waren für Emilia nie erholsam. Oft schlief sie schlecht wegen der unbequemen Betten, manchmal war es zu laut, manchmal zu stickig. Insofern hatte sie diesmal Glück gehabt, es gab nichts zu beanstanden. Dennoch fand sie nicht zur Ruhe.
Der Vortrag, den sie morgen zum Thema »Internationale Schwerverbrechensbekämpfung« im Kölner Congress-Centrum Ost halten sollte, lag ihr im Magen. Über dreihundert Zuhörer waren angemeldet, darunter die polizeiliche Führungsriege des halben Ruhrpotts. Wenn sie nur daran dachte, vor all diesen Leuten am Rednerpult zu stehen, wurde ihr Mund ganz trocken. Aus irgendeinem Grund schaffte sie es nicht, bei solchen Anlässen ihr Lampenfieber auf ein erträgliches Maß herunterzuschrauben. Schon tagelang vorher kreisten ihre Gedanken unentwegt um die Frage, ob wohl alles gutgehen würde – was bisher immer der Fall gewesen war. Dennoch versetzten sie solche Situationen in Stress.
Ein Kollege hatte ihr einmal geraten, sich das Auditorium nackt vorzustellen, das würde helfen, die Aufregung in den Griff zu bekommen. So richtig geklappt hatte das bisher aber nicht.
Emilia starrte durch die schräg stehenden Lamellen ihrer Jalousie in den Nachthimmel und seufzte.
Nein, sie machte sich etwas vor. Ihre innere Anspannung war gar nicht so sehr auf den Vortrag zurückzuführen, sondern auf den morgigen Besuch bei Samuel Witt. Der lag ihr noch viel mehr im Magen.
Wie wird er reagieren, wenn er mich sieht? Hat er mir inzwischen verziehen? Oder wird er mich hassen?
Die Ungewissheit nagte wie Säure an Emilias Nerven. Sie fühlte sich für Samuel Witts Schicksal verantwortlich, auch wenn die Sache schon eine gefühlte Ewigkeit zurücklag. Es war ihr erster Fall bei Interpol gewesen, und als frischgebackene Agentin hatte sie damals unter keinen Umständen versagen wollen. Getrieben von der Gier nach Erfolg hatte sie Samuel Witt zu einer Aufgabe genötigt, der er nicht gewachsen gewesen war.
Mein Ehrgeiz hat ihn ins Unglück gestürzt.
Jahrelang hatte Emilia die Sache verdrängt. Erst, als ihr Chef ihr den Vortrag in Köln aufgebrummt hatte, waren die Erinnerungen zurückgekehrt – wie alte Dämonen, die nur auf eine passende Gelegenheit gewartet hatten, sie endlich wieder heimsuchen zu können.
Schon zum hundertsten Mal sagte sie sich, dass sie sich eigentlich gar nichts vorzuwerfen hatte. Es war eine falsche Entscheidung gewesen, unter Stress gefällt. Alles hatte verdammt schnell gehen müssen, Zeit zum Nachdenken war nicht geblieben.
Unter dem Strich änderte das allerdings nichts: Emilia hatte Samuel Witt in sein eigenes Verderben geschickt.
Sie stand auf, holte aus der Minibar ein Mineralwasser und trank einen Schluck aus der Flasche.
Ich muss endlich schlafen, sonst wird der Vortrag morgen eine Katastrophe.
Zurück im Bett schloss sie eine Weile die Augen, aber das brachte nichts. Sie war glockenwach.
Vielleicht würde es mir helfen, mit Mikka zu sprechen.
Welche Sorgen sie auch plagten, irgendwie schaffte er es immer, sie auf andere Gedanken zu bringen. Leider waren sie häufig getrennt, weil er in Frankfurt arbeitete und sie in Lyon – wenn sie sich nicht gerade auf einer Geschäftsreise befand, so wie heute. Jedenfalls vermisste sie ihn, und im Moment hätte sie sich gerne ein wenig von ihm aufmuntern lassen.
Aber es war schon spät – gut möglich, dass Mikka sich bereits aufs Ohr gelegt hatte. Emilia beschloss, ihn nicht anzurufen, sondern ihm stattdessen eine WhatsApp-Nachricht zu schicken, in der Hoffnung, dass er doch noch wach war und sich bei ihr meldete.
Ein paar Minuten lang starrte sie aufs Display und versuchte, nicht mehr an Samuel Witt zu denken, doch es gelang ihr nicht. Immer wieder sah sie ihn vor sich, blutend und schreiend, unfähig sich zu bewegen. Wie sollte sie mit dieser Schuld leben?
Emilia schluckte, ihre Zunge klebte trocken am Gaumen. Sie stand noch einmal auf, um den Rest ihres Mineralwassers zu trinken. Als sie wieder ins Bett kroch, hatte Mikka immer noch nicht auf ihre Nachricht geantwortet. Sie würde die Nacht wohl alleine mit sich und ihren inneren Dämonen verbringen müssen.
3
Lina erreichte das Haus, in dem Samir Habib wohnte, um Viertel vor zwölf. Trotz ihrer zunehmenden Neugier fühlte sie sich plötzlich unsicher. Würde sie heute Nacht erfahren, wer sie wirklich war? Oder war Samir Habib nur ein gefährlicher Irrer, der Frauen mit sonderbaren, kleinen Briefbotschaften zu sich nach Hause lockte, um anschließend über sie herzufallen?
Sie zog ein zusammengefaltetes Kuvert aus ihrer Tasche, strich es glatt und las die Aufschrift im fahlen Licht der Straßenlaterne:
Für die Frau mit den interessanten Augen.
Das Kuvert hatte sie gestern von Toni Chang bekommen, dem Besitzer eines Asia-Restaurants am Hamburger Hafen, bei dem Lina regelmäßig Schutzgeld für ihren Boss abkassierte.
»Das ist für dich abgegeben worden«, hatte Toni gesagt. »Vor drei oder vier Tagen. Von einem Kerl, den ich hier noch nie gesehen habe. Araber oder Türke, denke ich. Hat mich gefragt, ob du öfter hier bist. Als ich ja gesagt habe, hat er das Kuvert hiergelassen und mich gebeten, es dir beim nächsten Mal zu geben.«
Für die Frau mit den interessanten Augen – im ersten Moment hatte Lina es für einen Liebesbrief gehalten. Sie war zwar nicht gerade eine klassische Schönheit, aber auf manche Männer wirkte sie scheinbar recht attraktiv. Sie hatte gedacht, dass irgendein schüchterner Typ ihr auf diese Weise ein Kompliment machen wolle.
Aber das Kuvert hatte keinen Liebesbrief enthalten, sondern einen Zettel, auf dem stand:
Bist du das Mädchen aus der Lürmanstraße? Wenn ja, dann melde dich bitte (0162/3454683).
Nach kurzem Zögern hatte sie angerufen. Der Mann am anderen Apparat hatte sich mit dem Namen Samir Habib gemeldet.
»Ich habe Ihren Brief bekommen«, hatte Lina gesagt. »Was wollen Sie von mir?«
»Wenn Sie die sind, für die ich Sie halte, möchte ich Ihnen etwas geben.«
»Und was soll das sein?«
Das hatte er ihr am Telefon nicht sagen wollen, weil sie ihn auf der Arbeit erwischt hatte und er schlecht reden konnte. Also hatten sie dieses nächtliche Treffen verein-bart.
Bist du das Mädchen aus der Lürmanstraße?
Wenn ich das nur wüsste.
Nach dem Telefonat hatte Lina die Lürmanstraße in ihrem Navi eingegeben, sie aber nicht gefunden. Auch die Suche im Internet war erfolglos geblieben. In Hamburg gab es keine solche Straße.
Warum sollte jemand versuchen, mich mit einer falschen Adresse zu ködern? Vielleicht doch ein perverser Irrer?
Nein, eine innere Stimme flüsterte Lina zu, dass Samir Habib etwas über ihre Vergangenheit wusste – mehr als sie selbst. Dass er in der Lage war, die Lücke zu füllen, die seit ihrem achten Lebensjahr in ihrem Gedächtnis klaffte. Zumindest einen Teil davon.
Das alles ging ihr binnen weniger Sekunden durch den Kopf, während sie im Schein der Straßenlaterne vor dem großen Mehrfamilienhaus stand und hinauf in den fünften Stock sah, wo immer noch Licht durch die Lamellen der Jalousie fiel.
Eine kalte Bö riss Lina aus ihren Gedanken und holte sie wieder zurück in die Gegenwart. Sie fasste sich ein Herz, überprüfte den Sitz ihrer Pistole unter der Jacke und klingelte.
Samir Habib war etwa sechzig Jahre alt. Um die Halbglatze auf seinem Kopf kräuselte sich kurzes, graues Haar, in seinem olivfarbenen Gesicht schien das Weiße in seinen Augen förmlich zu strahlen. Das war das Erste, das Lina auffiel, als er die Tür öffnete.
Seine Wohnung war karg eingerichtet: Es gab keine Bilder an den Wänden, keine Dekoration, die wenigen Möbel wirkten einfach und schlicht. Er musste alleinstehend sein – eine Frau hätte sich hier nicht wohl gefühlt.
Im Wohnzimmer setzten sie sich auf die abgewetzte Ledergarnitur. In einer Ecke lag ein halb gepackter Koffer. Habib bot Lina eine Tasse Tee an, doch sie lehnte ab. Stattdessen wollte sie lieber gleich zur Sache kommen.
Habib nickte. »Ich habe dich kürzlich in der Stadt gesehen«, begann er. »Im Hafenviertel beim Störtebeker-Denkmal. Ich darf doch du sagen?«
Lina nickte, obwohl sie es unpassend fand. Sie hatte den Mann noch nie gesehen.
»Du bist aus einem China-Restaurant gekommen und hättest mich dabei fast umgerannt. Aber bis mir klarwurde, dass du es bist, warst du schon verschwunden. Also habe ich dir über den Ladenbesitzer eine Nachricht zukommen lassen.«
Er stockte, zog plötzlich die Stirn in Falten und beugte sich in seinem Sessel nach vorne, um Lina besser sehen zu können. Die musternden Blicke, die er ihr über den Wohnzimmertisch hinweg zuwarf, bereiteten ihr Unbehagen. Als sei sie eine Ware, die er gerade begutachtete.
»Vielleicht habe ich mich getäuscht«, murmelte er. »Vielleicht bist du doch nicht die Frau, die ich meinte. Neulich, am Hafen, da sind mir deine Augen aufgefallen. Zwei verschiedene Farben, sonst hätte ich dich nach all den Jahren gar nicht erkannt. Aber heute sind sie anders.«
»Kontaktlinsen«, sagte Lina. Sie trug normalerweise immer welche, schon so lange sie sich zurückerinnern konnte, nur hatte sie sie letzte Woche wegen einer Bindehautentzündung weggelassen. »Die meisten Menschen finden meine Augen sonderbar. Eins grün, das andere blau. Deshalb habe ich meistens Linsen drin.«
Habib entspannte sich. Ein dünnes Lächeln legte sich auf sein Gesicht, und er lehnte sich wieder in seinen Sessel zurück.
»Woher kennen Sie mich?«, fragte Lina.
»Aus der Lürmanstraße. Das ist bestimmt schon zwanzig Jahre her. Ich besaß damals einen kleinen Tabakwarenladen, den ich von meinem Vater geerbt hatte. Du warst ab und zu bei mir, um Süßigkeiten zu kaufen. Ich glaube, du hast einige Häuser weiter gewohnt. Kontaktlinsen hattest du damals noch nicht.«
»Es gibt hier keine Lürmanstraße«, sagte Lina.
Habib zog die Augenbrauen nach oben. »Nicht in Hamburg. Aber in Bremen.«
Lina suchte in den Tiefen ihres Gedächtnisses nach einer Erinnerung an die Lürmanstraße oder an Samir Habib oder an irgendetwas anderes aus Bremen, aber es gelang ihr nicht. War sie tatsächlich schon mal dort gewesen?
»Gehen wir einmal davon aus, ich wäre dieses Mädchen …«
»Heißt das, du weißt nicht, ob du früher in Bremen gewohnt hast?«
Sie zögerte. »Ich kann mich an nichts erinnern, was vor meinem achten Lebensjahr geschehen ist«, sagte sie schließlich. Das stimmte nicht ganz. Ein paar wenige Erinnerungen gab es doch, aber die waren zusammenhanglos wie einzelne Puzzlestücke und so unangenehm, dass Lina es nach Möglichkeit vermied, daran zu denken. »Ich hatte einen Unfall«, fuhr sie fort. »Ich muss wohl einen Abhang hinuntergestürzt und mit dem Kopf auf einen Felsen aufgeschlagen sein. Viel weiß ich gar nicht darüber, nur das, was meine Mutter mir erzählt hat.«
Die allerdings gar nicht meine richtige Mutter ist, fügte sie in Gedanken hinzu, und sie spürte, wie die Bitterkeit ihr Herz erkalten ließ. Ihr Leben schien eine einzige große Lüge zu sein. Genau deshalb war es ihr wichtig, zu ihren Wurzeln zurückzufinden.
»Gehen wir also einmal davon aus, dass ich tatsächlich dieses Mädchen bin«, sagte sie. »Warum haben Sie Kontakt mit mir aufgenommen?«
Habib ließ sich mit der Antwort Zeit. Er legte die Stirn in Falten und massierte mit Daumen und Zeigefinger sein Kinn, als müsse er sich über die Antwort erst klarwerden. »Es gibt Situationen, die dich ein ganzes Leben lang nicht mehr loslassen«, sagte er schließlich. »Situationen, die einen noch Jahre später beschäftigen. Erinnerungen, die dich verfolgen, selbst wenn du glaubst, schon längst damit abgeschlossen zu haben.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«
»Du bist vor zwanzig Jahren wie vom Erdboden verschwunden. Entführt, hat es damals geheißen. Die Polizei war bei mir, um meine Frau – Gott habe sie selig – und mich zu befragen. Nicht nur uns, die ganze Nachbarschaft. Aber die Ermittlungen hatten keinen Erfolg und wurden bald wieder eingestellt. Die Angelegenheit hat meine Frau so sehr mitgenommen, dass sie kaum mehr über etwas anderes sprechen konnte. Sie hat gelitten, deshalb habe auch ich gelitten.« Habib machte eine Pause, seufzte. »Irgendwann, nach ein paar Wochen, kam jemand in meinen Laden und hat nach dir gefragt«, fuhr er schließlich fort. »Kein Polizist, sondern ein Freund der Familie, glaube ich. Er hat den Fall noch mal aufgerollt, weil er sich nicht damit zufriedengeben wollte, dass die Polizei nichts herausgefunden hat …«
Habib war nachdenklich geworden, sein Blick wirkte verklärt. Vor seinem geistigen Auge spielte sich alles noch einmal ab, das war ihm am Gesicht abzulesen.
»Wissen Sie, wer dieser Mann war?«
Habib schüttelte den Kopf. »Den Namen habe ich vergessen. Aber er hat mir damals etwas dagelassen – eine Art Steckbrief, auf dem stand, dass du gesucht wirst. Meine Frau hat ihn über all die Jahre aufgehoben. Nach ihrem Tod brachte ich es nicht über mich, ihn wegzuwerfen. Ich habe ihn schon herausgesucht. Wenn du willst, kannst du ihn haben.«
Lina spürte, wie sich ihr Magen zusammenzog – ein Gefühl, das sie normalerweise nicht kannte. Gerade wegen ihrer starken Nerven hatte sie den Geldeintreiberjob bei Dmitrij Tashkov ergattert, einem der einflussreichsten Untergrundbosse in Hamburg.
»Wenn Sie mir den Brief geben könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar«, sagte sie.
Habib stand auf, ging ins Nebenzimmer und kam kurz darauf mit einem DIN-A4-Papier in der Hand zurück, das er Lina hinhielt. Sie schluckte, nahm es an sich und betrachtete es eingehend.
Das Papier war an den Rändern ein wenig vergilbt, ansonsten aber in tadellosem Zustand. Der Text lautete:
Gesucht: Ivana Battista
Alter: 8 Jahre
Vermisst seit dem 20. Mai 1999
Wenn Sie irgendetwas wissen, das helfen könnte, sie zu finden, dann melden Sie sich bitte unter Tel.: 0161/3243556
Darunter war die Farbkopie eines Fotos zu sehen, besser gesagt ein Ausschnitt davon. Er zeigte das Gesicht eines Mädchens mit dunklem Haar, das glatt bis zu den Schultern herabfiel. Der Mund des Mädchens stand halb offen, als habe es während der Aufnahme geplappert. In der oberen Zahnreihe klaffte eine breite Lücke, auf beiden Wangen zeichneten sich hübsche, kleine Grübchen ab. Noch mehr als die Zahnlücke und die Grübchen stachen jedoch die Augen aus dem Bild hervor – eins grün, eins blau. Wie zwei lichtdurchflutete Edelsteine glänzten sie auf dem Papier, selbst jetzt noch, viele Jahre später – ein Smaragd und ein Saphir.
Das Mädchen auf dem Foto war eindeutig Lina.
Auf den Bildern in den Alben ihrer Mutter oder besser gesagt der Frau, die sie fälschlicherweise für ihre Mutter gehalten hatte, sah sie genauso aus. Vielleicht einen Tick älter, weil es dort nur Aufnahmen gab, die nach ihrem achten Geburtstag entstanden waren. Ihre Mutter hatte ihr einmal erzählt, das Album mit ihren Baby- und Kleinkindfotos sei bei einem Umzug verlorengegangen. Aber das war eine Lüge gewesen, genau wie alles andere.
Ivana Battista – ist das mein richtiger Name?
Er fühlte sich fremd an, ja geradezu falsch, wenngleich sie sich eingestehen musste, dass ihr schwarzes Haar viel besser zu einer Ivana Battista passte als zu einer Lina Sattler.
Ihr Blick wanderte zu den beiden Gesichtern links und rechts des Mädchens. Sie waren nicht einmal zur Hälfte auf dem Bild – der Ersteller des Steckbriefs hatte sie mittendrin abgeschnitten.
Es waren zwei Männer. Der linke hatte ein schmales Gesicht, eingefallene Wangen, einen dichten, schwarzen Bartansatz und eine kleine Narbe an der Schläfe. Der rechte war fülliger und wirkte dadurch freundlicher. Er trug einen buschigen Schnauzbart unter der Nase und lächelte in die Kamera. Auf seinem Kopf wuchsen wirre, blonde Locken.
»Wissen Sie, wer die beiden sind?«, fragte Lina.
Habib beugte sich zu ihr und betrachtete das Bild. »Der da ist dein Vater, glaube ich«, sagte er und deutete mit dem Finger auf den schmalgesichtigen Mann mit dem südländischen Aussehen. »Ich kann es aber nicht beschwören. Ihr wart nur wenige Male gemeinsam bei mir im Laden. Aber an den hier« – er tippte auf den Lockenkopf mit dem Schnauzer – »kann ich mich noch genau erinnern. Der hat den Steckbrief verteilt. Auf dem Bild wirkt er so fröhlich, aber damals bei mir im Laden hat er ausgesehen wie der leibhaftige Tod.«
»Wissen Sie, wie er heißt?«
»Nein, tut mir leid. Falls er es damals erwähnt hat, habe ich es mir nicht gemerkt.«
Obwohl der Name natürlich hilfreich gewesen wäre, spielte er im Moment keine große Rolle. Lina hatte von Samir Habib wesentlich mehr Informationen über ihr früheres Leben erhalten, als sie es sich erhofft hatte. Sie kannte jetzt ihren Geburtsnamen. Und sie hatte ein – wenn auch unvollständiges – Porträt ihres Vaters in den Händen.
Nach Jahren der Suche war sie ihrem Ziel heute Nacht einen großen Schritt nähergekommen.
4
Eingehüllt in ihre Bettdecke, zuckte Emilia zusammen und öffnete die Augen. Im ersten Moment wusste sie nicht, wo sie war. Dann erinnerte sie sich an den Vortrag, den sie halten musste, und an das Hotel in Köln. Müde warf sie einen Blick auf ihren Wecker.
00.23 Uhr.
Sie hatte kaum mehr als eine halbe Stunde geschlafen.
Mit zwei Fingern strich sie sich eine Haarsträhne aus der schweißnassen Stirn und klemmte sie hinters Ohr. Ihr Herz hämmerte wild in ihrer Brust, so dass sie den Puls bis in die Schläfen spürte.
Sie hatte geträumt, so plastisch und real, als erlebe sie die Durchsuchung des Hartweiler-Hauses noch einmal – in allen grausamen Details.
Begonnen hatte das Unglück in einer kalten, verregneten Novembernacht des Jahres 2010 in einem Einsatzfahrzeug der Kölner Polizei, einem umgebauten Lieferwagen, der bis unters Dach mit modernster Überwachungstechnik ausgestattet gewesen war. Emilia, damals frischgebackene Interpol-Agentin, saß zwischen zwei Polizisten. Der eine war Hauptkommissar Granitz, Leiter des Kölner Morddezernats, ein Mann mit knapp zwei Metern Körperlänge, der beim Sitzen den Kopf einziehen musste, um nicht an der Decke anzustoßen. Sein vierköpfiges Team wartete in einem anderen Polizeifahrzeug draußen am Wegrand. Links von Emilia saß Oberkommissar Jurak, der Leiter des Sondereinsatzkommandos, das für diesen Fall abkommandiert worden war. Im Gegensatz zu Granitz hatte Jurak einen eher untersetzten, fassförmigen Körperbau. Seine Männer warteten in einem Polizeikleinbus auf weitere Befehle.
»Das Haus wird von einem Mann namens Joachim Hartweiler bewohnt«, sagte Emilia. »Er ist alleinstehend und arbeitet als selbständiger Unternehmensberater. Seine Kundschaft befindet sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz und in Luxemburg, deshalb kommt er viel herum. Hartweiler steht im Verdacht, in den letzten Jahren mindestens ein Dutzend Menschen in diesen Ländern entführt zu haben, vielleicht sogar mehr. Vor einer Woche war er in Salzburg, wo er tagsüber ein Projekt für eine Niederlassung von Siemens leitete. Abends hat er in einem Salzburger Schnellimbiss etwas gegessen und später eine dreiundzwanzigjährige Frau überwältigt, Miryam Goldmann, die am Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte arbeitet. Er hat sie auf dem Nachhauseweg abgepasst, ihr einen Sack über den Kopf gezogen und sie betäubt. Danach fuhr er wieder in Richtung Köln, aber zwischen Ulm und Würzburg legte er eine Toilettenpause ein. Miryam Goldmann wachte auf und konnte fliehen. Sie hat Hartweiler zwar nicht gesehen und sich auch nicht das Nummernschild seines Wagens gemerkt, aber an ihrer Bluse hafteten ein paar von Hartweilers Haaren, anhand derer eine DNA-Analyse durchgeführt werden konnte.«
»Das heißt, dass Hartweiler vorbestraft ist.« Die Anmerkung kam von Oberkommissar Jurak. Mit den Fingern tippelte er ständig gegen seine kugelsichere Weste.
»Er ist vor etlichen Jahren in Frankreich wegen Körperverletzung verurteilt worden«, sagte Emilia. »Er hat eine Prostituierte misshandelt und sie halb totgeprügelt.«
»Woher wissen Sie, dass er zwölf Menschen entführt hat?«, fragte Hauptkommisar Granitz. Er trug keine kugelsichere Weste, sondern seine Uniform.
»Hartweiler fährt seit Jahren dasselbe Auto – einen dunkelblauen Kastenwagen, genauer gesagt einen VW T5. Laut unserer Datenbank in Lyon gab es seit dem Jahr 2005 achtundsiebzig Entführungsfälle, bei denen ein blauer T5 gesehen wurde. In rund zwölf dieser Fälle passt die Beschreibung des Fahrers auf Joachim Hartweiler. Das ist zwar kein Beweis, aber zumindest ein hinreichender Verdacht für eine Hausdurchsuchung.«
»Außerdem wurden in den letzten Jahren immer wieder Schreie aus dem Hartweiler-Haus gemeldet«, ergänzte Granitz für Jurak, denn der war mit seinem SEK-Team erst heute Nacht zu dem Fall hinzugezogen worden. »Vor sechs Monaten hat ein Postbote die Polizeidienststelle in Bensberg informiert, vor anderthalb Jahren hat ein Spaziergänger Meldung bei der Wache in Rösrath erstattet. Die Kollegen haben Hartweiler beide Male einen Besuch abgestattet, konnten aber nichts Verdächtiges feststellen.«
Jurak nickte. »Sonst noch etwas, das wir wissen sollten?«
»Nur noch eines«, sagte Emilia ernst. »Er besitzt einen gültigen Waffenschein und übt regelmäßig auf dem Schießstand. Wir müssen davon ausgehen, dass er bei seiner Festnahme Widerstand leisten wird.«
»Ist er im Augenblick daheim?«
»Das wissen wir nicht mit Sicherheit«, sagte Granitz. »Zwei meiner Männer beobachten das Haus schon seit den frühen Abendstunden. Es scheint leerzustehen. Laut Anrufbeantworter in seinem Büro befindet er sich noch bis übermorgen auf Geschäftsreise. Die Chancen stehen also gut, dass wir uns ohne unangenehme Zwischenfälle drinnen umsehen können. Darauf verlassen würde ich mich allerdings nicht.«
»Also gut, wir werden vorsichtig sein«, sagte Jurak. »Haben Sie einen Grundriss?«
Granitz zog ein großes Blatt Papier aus einer Aktentasche und entfaltete es zwischen sich und den beiden anderen. »Das hier ist Hartweilers Grundstück«, sagte er, während er mit dem Finger eine rechteckige Umrisslinie nachfuhr. »Fünftausend Quadratmeter, das meiste davon Wald. Die nächsten Nachbarn wohnen einen Kilometer entfernt. Die einzige Anbindung zur Straße ist die geschotterte Zufahrt, auf der wir im Moment stehen. Sie führt von der Überlandstraße durch zwei Weizenfelder hindurch, macht dann einen Knick, wie Sie sehen, und mündet schließlich vor dem Haus. Das hier« – er deutete auf eine schraffierte Fläche zwischen dem Haus und dem Ackergelände – »ist der Vorgarten. Dann kommt das Haus, daneben die Garage. Nach hinten raus, also in den Wald hinein, ist das komplette Areal eingezäunt. Dort hängen auch überall Betreten-verboten- und Gefahrenschilder. Hartweiler will keinen unerwarteten Besuch auf seinem Grundstück haben.«
»Was ist das?« Jurak deutete auf ein kleines Rechteck hinter dem Gebäude.
»Ein altes Räucherhäuschen«, sagte Granitz. »Das Anwesen hat bis 1960 dem hiesigen Förster gehört. Der hat dort sein Wild geräuchert.«
Jurak nickte nachdenklich. Er studierte noch einen Moment lang die örtlichen Gegebenheiten und erklärte den beiden anderen schließlich, wie das Sondereinsatzkommando bei der Einnahme des Hauses vorgehen würde. Team 1 würde sich durch den Vordereingang Zutritt verschaffen, Team 2 würde seitlich ein Loch in den Zaun schneiden und versuchen, von hinten über die Terrasse einzudringen. Die Teams 3 und 4 sollten den Außenbereich rund um das Grundstück sichern, falls Hartweiler wider Erwarten daheim war und flüchtete.
»Ihre Leute bleiben draußen, bis das Haus gesichert ist«, schloss Jurak und sah dabei Granitz an. »Sie auch.« Das galt Emilia. »Ich will nicht, dass wir versehentlich einen Polizisten erschießen, nur, weil der es nicht erwarten kann. Noch irgendwelche Fragen? Wenn nicht, dann schlage ich vor, dass wir loslegen.«
5
Es war bereits weit nach Mitternacht, als Lina in ihrem Ford Mustang durch die Innenstadt fuhr. Leichter Nieselregen hatte eingesetzt, das monotone Hin und Her des Scheibenwischers machte sie müde. Aber bevor sie nach Hause gehen konnte, gab es noch etwas für sie zu erledigen.
Etwas ziemlich Unangenehmes.
Die vorbeiziehenden Straßenlaternen warfen breite Streifen aus Licht und Schatten durch die Seitenfenster. Der Steckbrief, den Lina von Samir Habib erhalten hatte, lag neben ihr auf dem Beifahrersitz. Immer wieder wanderte ihr Blick dorthin, angezogen wie von einem magischen Sog.
Dieser Steckbrief konnte der Schlüssel zu ihrer Vergangenheit sein. Zu ihrer Kindheit.
Zu ihrem wahren Ich.
Nach jahrelanger, erfolgloser Suche hatte sie jetzt endlich etwas, mit dem sie arbeiten konnte. Einen Namen – Ivana Battista. Das Porträt ihres Vaters, zumindest eine Hälfte davon. Die Lürmanstraße in Bremen. Damit musste sich doch etwas anfangen lassen können.
Nur eine Sache brachte sie ins Grübeln: Sie hatte gehofft, dass der Besuch bei Samir Habib ein paar Saiten in ihrem Kopf zum Schwingen bringen würde, aber das war nicht der Fall. Weder der Steckbrief noch das, was Habib ihr erzählt hatte, weckte eine Erinnerung in ihr.
Das bereitete ihr Sorgen.
Wenig später hielt sie den Mustang auf einem der reservierten Parkplätze hinter dem Club Sauvage, einer Szene-Disco, die ihr Boss, Dmitrij Tashkov, in Altona betrieb. Um diese Uhrzeit waren er und sein Buchhalter immer hier anzutreffen. Sie liebten das Nachtleben mit all seinen Zerstreuungen.
Lina stieg aus und holte aus dem Kofferraum ihres Wagens einen silbern glänzenden Metallkoffer, außerdem ihre Ersatzpistole, eine kleinkalibrige Ruger, die sie sich unter den Saum ihres Strumpfs schob. Sie hatte das Gefühl, dass sie sie heute noch brauchen würde.
Mit Koffer und Ersatzwaffe ausgestattet, ging sie zum Hintereingang, wo sie die Klingel an der massiven Stahltür betätigte. Beinahe im selben Moment wurde eine Sichtluke aufgeschoben, und ein Kerl, den Lina nur als Kalle kannte, warf einen Blick hindurch.
»Ah, du bist’s«, raunte er.
Die Luke schloss sich wieder, ein Summer ertönte, und Lina trat ein. Drinnen gab sie Kalle freiwillig ihre Pistole aus dem Holster, dann tastete er sie kurz ab. Es war das übliche Pro-forma-Ritual, mehr nicht. Deshalb übersah er auch die Ruger, die sie diesmal dabei hatte.
Vom Hintereingang aus führte eine Treppe nach oben. Dieser Teil des Gebäudes war für die Öffentlichkeit gesperrt und nur Tashkovs Vertrauten sowie den geladenen Gästen vorbehalten. Begleitet vom dumpfen Dröhnen der Musik aus dem Tanzsaal kam Lina in der oberen Etage an. Die Treppe mündete in einen kleinen Vorraum mit stylischen Stühlen, einem Stehtisch und einem Getränkeautomaten. An der Wand hingen zwei riesige Warhol-Nachdrucke.
Vor der Tür zur VIP-Lounge saßen zwei von Tashkovs Bodyguards – Grizzlybären in Menschengestalt. Aber auch sie kannten Lina lange genug, um sie dem Boss gegenüber als ungefährlich einzustufen. Mit einem Nicken ließen sie sie passieren.
Lina trat durch die Sicherheitstür und fand sich in einem weitläufigen Areal wieder, in dem Echtholzparkett, weißes Leder und Chrom das Bild beherrschten. Links von ihr standen zwei Mädchen in Bunnykostümen hinter der geschwungenen Bar, rechts befanden sich ein paar Flipperautomaten und Billardtische. Den größten Teil des Raums nahmen die fünf kreisrunden Sitzgruppen ein, von denen im Moment jedoch nur eine belegt war. Umhüllt von einer dicken Rauchwolke saßen dort etwa ein Dutzend Personen um einen niedrigen Tisch, der vor Cocktailgläsern, Champagnerflaschen, Erdbeerschalen und Tellern mit Lachshäppchen förmlich überquoll: Dmitrij Tashkov, ihr Boss, außerdem Leonid Schumann, sein Buchhalter, und drei Männer in Anzügen, die Lina nie zuvor gesehen hatte – vermutlich Geschäftspartner. Alle anderen am Tisch waren weiblich, spärlich bekleidet und noch keine zwanzig Jahre alt. Tashkov und Schumann hatten eine Vorliebe für junge Mädchen, die als Gegenleistung für etwas Bargeld eine gewisse Offenherzigkeit an den Tag legten.
Lina ging zur Bar und legte den Metallkoffer auf den Tresen, damit Tashkov ihn von seiner Sitzgruppe aus sehen konnte. Stören wollte sie ihn nicht, die Stimmung schien gerade ziemlich gut zu sein. Und seine gute Stimmung schlug meistens ins krasse Gegenteil um, wenn man ihn bei seinen sogenannten Geschäftsbesprechungen unterbrach.
Noch dazu hatte Lina schlechte Nachrichten für ihn. Es war auf jeden Fall ratsam, zu warten, bis Tashkov sie entweder zu sich winkte oder er zu ihr kam.
Lina bestellte bei einer der Bardamen eine Cola und ließ den Blick durch die breite, blaugetönte Fensterfront wandern, durch die man in den Tanzbereich hinunterschauen konnte. Dort bewegten sich die Discobesucher wie eine homogene Masse zum rhythmischen Stampfen der Musik. Zum Glück wurde die Lautstärke durch das dicke Glas gedämpft, so dass im VIP-Bereich eine angenehme Atmosphäre herrschte. Nur der Zigarren- und Marihuanarauch war hier so dick, dass man die Luft schier schneiden konnte.
Lina ging zur Toilette, wo sie sich ihre Ruger vom Strumpf in den Hosenbund am Rücken steckte. Falls nötig, wollte sie die Waffe gerne griffbereit haben.
Einen kurzen Moment lang überlegte sie, ob es vielleicht besser gewesen wäre, heute Nacht nicht hierherzukommen, doch sie verwarf den Gedanken sofort wieder. Tashkov wartete auf seine Geldlieferung. Wenn die nicht pünktlich kam, war der Teufel los.
Zurück in der Lounge nippte sie an ihrer Cola und wartete. Nach einigen Minuten gab Tashkov ihr mit einer Handbewegung zu verstehen, dass er sie registriert hatte. Sie deutete mit dem Kinn auf den Stahlkoffer, der neben ihr auf dem Tresen lag. Daraufhin entschuldigte Tashkov sich bei seinen Gästen und kam zu ihr an die Bar.
Er hatte getrunken, das sah man an seinen glasigen Augen. Außerdem war er so aufgedreht, dass er garantiert irgendwelche Aufputschdrogen genommen hatte. Er war einen Kopf größer als Lina und mit seinen Muskelbergen, die sich unter dem taubengrauen Maßanzug abzeichneten, bestimmt doppelt so schwer. Unter seiner eingedrückten Nase – dem Ergebnis diverser Schlägereien – zeichnete sich ein schiefes Grinsen ab.
»Wie viel ist das?«, fragte er mit Blick auf den Geldkoffer.
»Etwa siebzigtausend«, antwortete Lina wahrheitsgemäß.
»Heißt das, dass Lehmann, Keller, Brazcek und Markowitz gezahlt haben?«
»Bis auf den letzten Cent.«
Tashkov nickte zufrieden, gab eine Zahlenkombination in das Kofferschloss ein und öffnete den Deckel. »Was ist mit Pandrelli? Hat der auch endlich seine Schulden beglichen?«
Das war die Frage, die Lina befürchtet hatte.
»Die Hälfte«, sagte sie. »Der Rest soll bis Ende des Monats kommen.«
Tashkovs Miene blieb nahezu unverändert – nur sein Blick verhärtete sich. »Nichts als Ärger mit dem scheiß Itaker«, zischte er. »Der vertröstet mich schon seit Wochen.«
»Bei meinem nächsten Besuch wird er zahlen. Ich habe ihm heute die Nase gebrochen. Der Denkzettel wird helfen.«
Tashkov lächelte kalt. »Ach, meinst du?«
»Ja, das meine ich. Mach dir wegen des Geldes keine Sorgen.« Doch Lina spürte, dass das Gespräch in eine falsche Richtung abdriftete.
»Du hast ihm also eins auf die Nase gegeben und denkst, dass er jetzt zahlt.« Der Hohn in seiner Stimme war unüberhörbar. »Und was, wenn er nur wieder Zeit schindet?«
»Ich bin sicher, dass er das Geld beim nächsten Mal zusammenhat.«
Tashkovs Kieferknochen begannen zu mahlen. »Beim nächsten Mal, beim nächsten Mal – wenn ich das schon höre!«, brauste er auf. »Wofür brauche ich dich, wenn du nicht in der Lage bist, mein Geld pünktlich einzutreiben?«
Der Vorwurf machte Lina wütend. Es ging nur um fünftausend Euro, die Hälfte davon hatte Pandrelli ihr heute gegeben. Also regte Tashkov sich über zweieinhalbtausend Euro auf, was für ihn allenfalls Spielgeld war. Der heutige Abend mit dem Schampus, den Häppchen und den leichten Mädchen kostete ihn garantiert ein Vielfaches davon.
»Ich will, dass du diesem Bastard nicht nur die Nase brichst«, zischte Tashkov. »Schieß ihm ins Knie. Oder schlag seinen Kindern die Zähne ein. Ist mir scheißegal, wie du es anstellst, Lina, aber wage es nicht, noch mal ohne mein verdammtes Geld hier aufzutauchen. Dein Versagen macht mich zum Gespött, das kann ich mir nicht leisten, kapiert?«
Noch ein Vorwurf. Lina biss die Zähne zusammen. Sie hasste es, wenn man so mit ihr redete. Das hatte sie sich schon früher nicht bieten lassen, weder von ihren Freunden noch von ihrer Mutter, noch von ihren Lehrern.
Von niemandem.
Tashkov bildete da keine Ausnahme. Sie war genauso jähzornig wie er, vielleicht sogar noch mehr. Solange sie beide sich im Griff hatten, kamen sie gut miteinander aus. Aber wehe, sie gingen aneinander hoch. Dann konnte alles passieren.
»Ich habe dir von Anfang an geraten, Pandrelli kein Geld mehr zu leihen«, sagte Lina und sah ihrem Boss dabei fest in die Augen. Angst verspürte sie keine. Eher so etwas wie Kampflust. »Wenn du einem schlechten Schuldner Geld gibst und dich hinterher aufregst, dass du es nicht pünktlich zurückbekommst, machst du dich selbst zum Gespött, Dmitrij.«
Jetzt platzte Tashkov endgültig der Kragen. »Wage es nicht, so mit mir zu sprechen, kurwa!«, knurrte er. »Du hast dich in meiner Organisation weit hochgearbeitet, aber vergiss nie, dass du mir gehörst.«
Blitzschnell packte er sie an der Gurgel.
»Du tust mir weh!«, röchelte Lina.
»Das ist noch gar nichts!« Sein schraubstockartiger Griff wurde enger, sie bekam kaum noch Luft. Plötzlich hielt er in der anderen Hand auch noch ein Messer, mit dem er vor Linas Gesicht herumwedelte – ähnlich wie dieser notgeile Idiot von der Tankstelle, der sie mit seinen beiden Kumpels vergewaltigen wollte. Nur, dass Tashkov kein Anfänger war.
»Hör mir genau zu, Lina«, raunte der Russe, wobei seine schwarzen Augen glänzten wie polierter Obsidian. »Wenn du nicht willst, dass ich dir deine hübsche Visage zerschneide, schlage ich vor, dass du deinen Arsch zu Pandrelli bewegst, und zwar jetzt, auf der Stelle, und dass du ihn so lange weichprügelst, bis er endlich mit meiner Kohle herausrückt.«
»Und ich schlage vor, dass du mich in Ruhe lässt«, keuchte Lina. »Sonst schieß ich dir dein bestes Stück weg.«
Einen Moment lang schien er nicht zu begreifen, was sie meinte. Dann spürte er wohl den Lauf der Ruger zwischen den Beinen.
Etwas in seinem Gesicht veränderte sich. Seine Lippen wurden schmal, ein Augenwinkel zuckte. Er stand kurz davor, vor Wut zu explodieren. Aber gerade als sie glaubte, er werde tatsächlich mit dem Messer zustechen, ließ er es langsam sinken, und der Griff um Linas Hals lockerte sich.
Sein Mund verzog sich zu einem kalten Lächeln. »Du hast Mut, Mädchen«, sagte er. »Das bewundere ich an dir. Keiner der anderen würde es wagen, mir so die Stirn zu bieten. Aber ich rate dir, es nicht zu übertreiben. Beim nächsten Mal hast du vielleicht nicht so viel Glück wie heute.« Er steckte das Messer wieder weg, strich sich den Anzug glatt, klappte den Geldkoffer zu und nahm ihn an sich.
»Morgen gehst du zu Pandrelli und besorgst mir mein Geld, verstanden? Egal wie, aber du tauchst erst wieder hier auf, wenn du es hast.«
»Ich werde die nächsten Tage nicht in Hamburg sein«, entgegnete Lina. Die Pistole behielt sie sicherheitshalber in der Hand.
»Du willst mich unbedingt provozieren, was?« Die Röte in Tashkovs Gesicht zeigte, dass er schon wieder zu kochen begann.
»Ich will mich nicht mit dir anlegen, Dmitrij. Aber ich habe endlich eine Spur, die mich zu meiner Kindheit führen könnte.«
Tashkov kannte Linas Gedächtnislücke, hatte aber noch nie nachvollziehen können, weshalb es ihr so wichtig war, sie zu füllen. »Du suchst deine Erinnerungen, seit wir uns kennen. Was macht es da aus, einen Tag länger zu warten? Besorg mir mein Geld, danach kannst du tun, was du für richtig hältst.«
»Ich bin seit meinem achten Lebensjahr ein unvollständiger Mensch – eine verdammt lange Zeit, Dmitrij. Genau deshalb werde ich nicht noch länger warten. Wenn dir deine zweieinhalbtausend Euro so wichtig sind, dann wirst du jemand anderen zu Pandrelli schicken müssen.«
Sekundenlang fixierte Tashkov sie mit Blicken, aber schließlich erkannte er, dass er sie nicht würde einschüchtern können.
»Geh mir aus den Augen«, sagte er tonlos. »Verschwinde von hier, und komm nicht so schnell wieder, verstanden?«
Lina drehte sich um und ging.
6
November 2010.
Jedes SEK-Mitglied war mit einer lichtempfindlichen Helmkamera ausgestattet, die Bilder wurden live auf einen Monitor im zentralen Einsatzwagen übertragen. Oberkommissar Jurak konnte wahlweise zwischen den Kameraeinstellungen hin- und herschalten oder die Monitoranzeige nach Belieben kombinieren. Im Moment waren die vier Aufnahmen von Team 1 und 2 zu sehen, die sich Zutritt zum Haus verschaffen sollten. Der Ton wurde über die Headsets übertragen. Auf diese Weise bekamen Emilia, Granitz und Jurak einen genauen Überblick über den Fortschritt bei der Einnahme des Hartweiler-Hauses.
Nachdem die Spezialkräfte sich am Waldrand in Position gebracht hatten, dauerte es nur wenige Minuten, bis Team 1 und 2 im Haus waren. Alles daran wirkte alt und reparaturbedürftig, als seien schon seit Jahrzehnten keine Ausbesserungsarbeiten mehr durchgeführt worden.
Als Erstes sicherte das Sondereinsatzkommando das Erdgeschoss, wo sich die Küche, eine Toilette und das Wohnzimmer befanden. Alle Räume standen leer. Danach machten sich drei der Männer an das Obergeschoss, wo sie das Schlafzimmer, das Bad und ein Büro durchsuchten. Der Vierte blieb unten, um dort die Lage weiter unter Kontrolle zu behalten.
»Oben ist alles gesichert«, sagte eine Stimme. Es war Gruppenführer Neuffert, der das operative Kommando über die beiden Innenteams hatte. »Keine besonderen Vorkommnisse, abgesehen vielleicht von den vielen Tierpräparaten.«
Das war Emilia auch schon aufgefallen. Im Wohnzimmer, im Flur, im Schlafzimmer und im Büro standen eine Reihe von ausgestopften Tieren – Eichhörnchen, Wiesel, Marder und verschiedene Vögel, wie man sie gelegentlich bei Sammlern fand. Allerdings gab es auch ein paar ganz und gar ungewöhnliche Exponate, bei deren Anblick Emilia ein Schauder über den Rücken lief: eine Perserkatze, ein Labrador und ein Kapuzineräffchen.
Irgendwie gruselig.
»Wir nehmen uns jetzt den Keller vor«, kam Neufferts Stimme durch den Lautsprecher.
Vom Eingangsbereich führte eine steinerne Innentreppe eine Etage tiefer. Die restlichtverstärkten Bilder der Helmkameras schimmerten grünlich und verliehen der Situation eine gespenstische Atmosphäre. Unten zweigten vier Räume von einem kleinen Flur ab. Einer diente als Vorratskammer für Lebensmittel und Getränke, der zweite als Waschraum, der dritte als Werkzeugkeller.
Der Vierte war vollgestopft mit toten Tieren. Die kleineren Präparate lagerten dicht gedrängt in den deckenhohen Wandregalen, ein Schäferhund und ein Seeadler standen links hinten in der Ecke. Über einem großen Edelstahltisch in der Mitte des Raums hing eine schmucklose Lampe mit einem Griff, an dem man sie in der Höhe verstellen konnte. Offenbar war das der Ort, an dem die Tiere präpariert wurden.
»Was ist das da auf dem Boden?«, fragte eine Stimme. Gleichzeitig richtete die Kamera sich nach unten. Auf dem Monitor stand der Name Roth.
»Ich denke, das ist Blut«, sagte Neuffert.
Mangels Licht gab es kein rotes Farbspektrum, nur unterschiedlich intensive Grau- und Grüntöne. Viele dunkle Flecke verliehen dem Estrich ein unregelmäßiges Muster.
Oberkommissar Jurak drückte einen Knopf. »Die Spurensicherung wird sich das später genau ansehen und feststellen, ob es sich nur um tierisches Blut oder auch um Menschenblut handelt«, sagte er.
»Gibt es im Keller noch irgendwelche anderen Räume?«, fragte Emilia in Richtung des Mikrophons, das neben dem Monitor stand.
»Sieht nicht so aus.« Das war wieder Neuffert.
»Ich möchte, dass Sie sich das genau ansehen. Wenn Hartweiler ein mehrfacher Entführer ist, wird er ein Versteck für seine Opfer haben.«
»Vielleicht hinter dem Haus«, mutmaßte Neuffert. »Groß genug wäre das Waldgrundstück.«
»Stimmt schon. Aber der Postbote, der die Schreie gehört haben will, sagt, dass sie aus dem Haus kamen. Bitte durchsuchen Sie den Keller genau. Falls es dort eine Art Verlies gibt, will ich es wissen.«
»In Ordnung. Wir schalten dazu das Licht ein.«
»Aber stellen Sie Ihre Helmkameras vorher um«, sagte Jurak. »Sonst sehen wir hier nichts mehr.«
Einen Moment lang erschien auf dem Monitor Schneegestöber, dann wurde das Bild wieder klar. Die Übertragung war nun farbig, wenngleich aufgrund des schummrigen Lichts ziemlich dunkel. Dadurch wirkten die Räume noch beengter als zuvor.
Das SEK-Team nahm sich nacheinander den Waschraum, den Vorratsraum und den Werkzeugkeller vor, fand aber weder eine in die Wand eingelassene Tür noch eine Bodenluke, die zu einem Versteck hätte führen können.
Erst im Präparationsraum wurden sie fündig: Ein Teil des Regalgestells stand nicht auf dem Boden, sondern war an die dahinterliegende Mauer montiert. Wenn man einen Riegel zur Seite schob und daran zog, konnte man das Konstrukt wie eine Tür aufklappen. Vor den Kameras des SEK-Teams tat sich ein abweisendes, finsteres Loch auf.