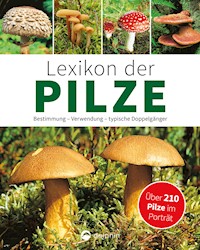Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Von Stacheln, Dornen oder Brennhaaren einmal abgesehen, machen Pflanzen auf den ersten Blick einen eher harmlosen Eindruck. Aber das täuscht, denn viele besitzen auch eine dunkle Seite. So produzieren zahlreiche Arten gefährliche Toxine, die man nicht nur als Pfeilgifte für die Jagd und kriegerische Auseinandersetzungen nutzte, sondern mit denen außerdem versucht wurde, unliebsame Zeitgenossen aus dem Weg zu räumen, darunter gekrönte Häupter und Präsidenten. Andere galten als magische Pflanzen, denen man Zauberkräfte nachsagte, sodass für ihren Besitz hohe Summen ausgegeben wurden. Und nicht zuletzt gibt es Pflanzen mit bewusstseinsverändernde Substanzen, deren Konsum so starke Sinnestäuschungen hervorrufen kann, dass unsere Vorfahren sogar glaubten, sie seien in die Welt der überirdischen Kräfte vorgedrungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Einführung
Kapitel 1: Giftmischer und Meuchelmörder
Ein gut abgeschirmtes Verbrechen
Weitere Versuche mit wechselndem Erfolg
Mord und Totschlag in der Ewigen Stadt
Tücken einer Ehe
Bewährtes bewahren
Gut getarnte Heimtücke
Wenn Zauberinnen Rache üben
Fortsetzung mit tragischen Folgen
Groß, Größer, Alexander
Erklärungsversuche des Unerklärbaren
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt
Die Königin der Gifte
Ein Graf auf Abwegen
Ohne Rücksicht auf Verluste
Tödliches Katzengulasch
Der letzte Ausweg
Genaues weiß man nicht
Für Vögel hui, für Menschen pfui
Die böse Schwiegermutter
Im Namen des Gesetzes
Schierlingsbecher mit Schuss
Ein Kraut für die keuschen Ordensleute
Urteile von ganz oben
Griff in die Trickkiste
Troja 2.0
Der lautlose Tod
Ein Exzentriker und drei Esel
Hinweis aus der Reisetasche
Das Geheimnis der Kräuterfrau
Lebensgefährliche Trickserei
Auswahl ohne Ende
Kapitel 2: Hexen, Geister und Dämonen
Uralte Geheimnisse
Begehrte Zauberwurzel
Die Leiden des liebestrunkenen Jakob
Vierbeinige Helfer
Kraut der unbegrenzten Möglichkeiten
Interessantes Innenleben
Die Alraune und die schönen Künste
An ihrem Namen sollt ihr sie erkennen
Ein fragwürdiger Blick in die Zukunft
Treibstoff für den Besen
Hühnerdiebe und Bierpanscher
Der durchtrennte Lebensfaden
Falsch verstandene Vorsicht
Für alles ist ein Kraut gewachsen
Bruderschaft mit Geschäftssinn
Gemüse auf Abwegen
Neues aus der Neuen Welt
Viel heiße Luft
Versuche einer Gegensteuerung
Tiefe Erstarrung und leerer Blick
Viele kleine Helferlein
Die Angst vor Hexen
Dem Teufel keine Chance
Blitz und Donner
Schatzsuche leicht gemacht
Für Zaubertränke unverzichtbar
Kapitel 3: Im Rausch der Sinne
Kraut des Vergessens
Die Ärzte entdecken den Mohnsaft
Mehr als nur Arznei
Die Droge erreicht Indien und China
Europa mit Nachholbedarf
Das Dunkel lichtet sich
Falsche Versprechungen
Wirkstoffe ohne Ende
Hausmittel mit zweifelhaftem Ruf
Nach alter Väter Sitte
Vielseitige Nutzpflanze
Kein Schnee von gestern
Sogar der Papst hilft mit
Zwanghafte Wiederholung
Jugendsünden
Kriegsfolgen
Die lieben Verwandten
Mein kleiner grüner Kaktus
Kleine Samen – große Wirkung
Die Mutter aller Körner
Der Trank der Schamanen
Gemeinsam sind sie stark
Die Turboversion
Der Salbei der Heiligen
Und zum Schluss der blaue Dunst
Gefährliche Zeiten für Raucher
Literatur
Anmerkungen
EINFÜHRUNG
Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt, auf der ganzen Erde und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise …
1. Mose 1, 291
Ohne Pflanzen geht wenig auf dieser Erde, was vor allem daran liegt, dass diese etwas können, wozu die meisten anderen Lebewesen nicht in der Lage sind. Gemeint ist die Fotosynthese, also die Fähigkeit, mithilfe der Sonnenenergie aus Kohlendioxid und Wasser organische Substanzen herzustellen und diese anschließend zu speichern. Von der auf diese Weise entstehenden Biomasse leben dann die unterschiedlichsten Tiere, ebenso wie Pilze und viele Mikroorganismen, die alle zum Leben notwendigen Nährstoffe mit ihrer Nahrung aufnehmen müssen. Und das gilt natürlich auch für den Menschen, für den Pflanzen aber schon immer mehr waren, als nur ein unverzichtbarer Bestandteil ihrer Nahrung. So wurden sie außerdem für den Bau von Behausungen genutzt, aber auch, um Feuer zu machen oder Kleidung daraus herzustellen.
Allerdings ist die Nutzung von Pflanzen für Nahrungszwecke nicht ganz unproblematisch, denn es gibt bekanntlich Arten, deren Verzehr schwere körperliche Schäden oder sogar den Tod verursachen können. Unsere Vorfahren haben sich über den Grund dieser Eigenschaften vermutlich wenig Gedanken gemacht, aber heute weiß man, dass diese Inhaltsstoffe dazu dienen, die entsprechenden Pflanzen vor Fressfeinden schützen. Natürlich ist ein solcher Schutz keine geplante Strategie, sondern es handelt sich bei den Substanzen oft um Nebenprodukte des Stoffwechsels, bei denen die Evolution im Verlauf von Jahrtausenden dafür gesorgt hat, dass sie dort abgelagert werden, wo sie wenig Schaden anrichten können, etwa in den Zellvakuolen. Im einfachsten Fall handelt es sich dabei um ungenießbare Substanzen, etwa Bitterstoffe, wie sie beispielsweise Enziane (Gentiana) besitzen, die den Geschmack so sehr verschlechtern, dass die meisten Tiere sie verschmähen. Bei anderen Arten sind es dagegen starke Gifte, die Fressfeinde nicht nur abschrecken, sondern sogar töten können.
Sehr gut geschützt sind dabei häufig die Samen, denn sie sind für die Verbreitung und damit für das Überleben einer Art besonders wichtig. So bilden viele Rosengewächse (Rosaceae), darunter die Bittermandel (Prunus dulcis var. amara), so gefährliche Toxine, dass schon der Verzehr weniger Samen auch beim Menschen tödliche Vergiftungen verursachen kann. Grund dafür ist, dass sie Amygdalin enthalten, eine Substanz, die während des Verdauungsprozesses zu Cyanwasserstoff, also Blausäure umgewandelt wird, die den typischen Bittermandelgeruch besitzt und deren Kaliumsalz das berüchtigte Zyankali ist. Aber auch die Kerne anderer Steinobstfrüchte, etwa Aprikose oder Pfirsich enthalten in kleineren Mengen Blausäure. Der Schlafmohn (Papaver somniferum) hat ebenfalls gut geschützte Samen, denn der giftige Milchsaft, den man in getrocknetem Zustand Opium nennt, ist in der Samenkapsel besonders hoch konzentriert. Und dieser Schutz ist für einjährige Pflanzen wie Mohn besonders wichtig, weil sie nur durch ihre Samen den Winter überleben.
Auch wenn unsere frühen Vorfahren über solche Zusammenhänge nichts wussten, war eine gute Kenntnis über die essbaren und giftigen Kräuter, Sträucher und Bäume ihres Lebensraumes dennoch sehr wichtig, denn sie konnte schließlich über Leben und Tod entscheiden. Man kann annehmen, dass sich die Menschen dieses Wissen zumeist durch sicher manchmal schmerzhaftes Ausprobieren aneigneten. Aber vor allem bei der Erkennung giftiger Pflanzen könnte auch die Beobachtung von Tieren eine Rolle gespielt haben. So kann man auch heute noch beobachten, dass Weidetiere wie Schafe, Rinder oder Pferde gelernt haben, welche Pflanzen als Nahrung ungeeignet sind, sodass sie diese nicht fressen. Das gilt zum Beispiel für das giftige Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobaea), das zumeist unberührt auf der Weide stehen bleibt, während andere, um die giftige Pflanze herumstehende Kräuter abgefressen werden. Notwendig war es aber auch, dass die Menschen lernten, die entsprechenden Pflanzen später sicher wiederzuerkennen. Außerdem war es wichtig, das neue Wissen nicht nur in der Gruppe zu teilen, sondern auch an nachfolgende Generationen weiterzugeben.
Natürlich gibt es aus der Frühphase der menschlichen Existenz nur wenige Informationen darüber, was unsere Vorfahren genau über die unterschiedlichen Eigenschaften der in ihrem Lebensraum wachsenden Pflanzen wussten. Man kann aber davon ausgehen, dass sie relativ schnell gemerkt haben, dass es Pflanzen gibt, die nicht nur den Hunger stillen, sondern eine wohltuende Wirkung auf das körperliche Befinden haben oder sogar bestimmte Beschwerden lindern können, während andere das genaue Gegenteil bewirken. Anschließend wird es dann wohl auch nicht mehr lange gedauert haben, bis jemand auf die Idee gekommen ist, Giftpflanzen für die Jagd einzusetzen oder bei kriegerischen Auseinandersetzungen. Und vermutlich haben einige Menschen auch schon bald die Möglichkeit erkannt, mithilfe von Pflanzen unliebsame Zeitgenossen aus dem Weg zu räumen. Daher ist die Beschäftigung mit Giftpflanzen auch immer so etwas wie eine Beschäftigung mit der Geschichte des Verbrechens.
Eine ganz besondere Erfahrung der damaligen Menschen muss es aber gewesen sein, als sie auf Pflanzen mit halluzinogenen Inhaltsstoffen stießen, deren Konsum ihnen etwas Unglaubliches zu ermöglichen schien. Denn die teilweise fantastischen und irrealen Bilder, die ihnen das Gehirn nach dem Konsum psychoaktiver Pflanzen vorgaukelte, konnten sie sich nur so erklären, dass es ihnen gelungen war, in die Welt übernatürlicher Mächte vorzudringen.
Und dies muss Ihnen wie ein wahrer Glücksfall vorgekommen sein. Schließlich waren die Menschen über Jahrtausende davon überzeugt, dass gute und böse Mächte praktisch alle Bereiche ihres Lebens bestimmten. So hatten sie beispielsweise Einfluss darauf, ob eine Jagd erfolgreich war oder ob man vor Angriffen gefährlicher Tiere verschont blieb, sie konnten aber auch beim Auftreten von Krankheiten ihre Finger im Spiel haben. Zwar behandelten die Menschen leichtere Beschwerden mit Kräuterarzneien, aber wenn es sich um Fälle handelte, bei denen sich die Symptome nicht ohne Weiteres erklären ließen oder alle Behandlungsversuche keinen Erfolg brachten, machte man häufig eine Störung der Harmonie zwischen der physischen und der Geisterwelt dafür verantwortlich. So glaubte man, ein Erkrankter habe möglicherweise ein Tabu gebrochen oder den Ärger der Geisterwelt durch ein anderes Fehlverhalten heraufbeschworen, und die Krankheit sei nun die Strafe. Daher gab es in solchen Fällen auch keine andere Möglichkeit, als zu versuchen, die überirdischen Kräfte zu besänftigen. Und wenn das gelang, konnte man vielleicht erfahren, ob es doch noch Abhilfe gab und wie man diese erreichen konnte.
Vor allem bei sehr ursprünglich lebenden Bewohnern abgelegener Regionen Südamerikas, die immer noch wenig Kontakt mit der Außenwelt haben, sind derartige Praktiken bis heute üblich. Daher wissen wir auch, wie solche Rituale in etwa abgelaufen sein könnten. Hergestellt werden die Kontakte mit der Geisterwelt zumeist durch einen Schamanen, der nicht nur wusste, welche Pflanzen ihn in einen Zustand versetzen, in dem er glaubte, mit der Geisterwelt kommunizieren zu können, sondern der auch in der Lage war, die Pflanzen so zu dosieren, dass es nicht zu einer tödlichen Vergiftung kam. Und augenscheinlich ist es den Menschen in vielen Regionen der Erde gelungen, Pflanzen für solche Zwecke zu finden und einzusetzen, wobei in den unterschiedlichen Kulturen verschiedene Arten zum Einsatz kamen, deren Wirkung aber vergleichbar ist.
Sehr frühe Hinweise auf eine Nutzung von Pflanzen, die nicht allein der Nahrungsaufnahme dienten, hat man bei der Untersuchung rund 50.000 Jahre alter Skelette von Neandertalern, den vor etwa 30.000 Jahren ausgestorbenen Verwandten des heutigen Menschen gefunden. So ließen sich in ihren Zähnen hohe Konzentrationen von Substanzen nachweisen, die man typischerweise in Heilpflanzen findet, vor allem Azulen- und Cumarinverbindungen. Diese sind beispielsweise in Schafgarben (Achillea) oder Kamille (Matricaria) reichlich vorhanden, beides Pflanzen mit einem eher bitteren Geschmack, die zudem nicht sehr nahrhaft sind. Daher glaubt man auch, dass sie nicht der Ernährung, sondern medizinischen Zwecken gedient haben.
Bei der Ausgrabung jungsteinzeitlicher Siedlungen in Mitteleuropa hat man ebenfalls Hinweise auf eine frühe Verwendung von Heilkräutern gefunden. So ließen sich dort zwischen dem üblichen Hausrat, der über die Jahrtausende erhalten geblieben ist, auch Samen von typischen Heilpflanzen wie Holunder (Sambucus) oder Schlehdorn (Prunus spinosa) nachweisen, und zwar in Mengen, die auf eine Vorratshaltung der Kräuter hindeuten könnten. Daher nimmt man an, dass Heilkräuter spätestens zu dieser Zeit im täglichen Leben unserer Vorfahren eine größere Rolle gespielt haben.
Zunächst wurden die Kenntnisse über Pflanzen mit einer bestimmten Wirkung sicher ausschließlich mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Aber aus der Zeit vor etwa 4000 bis 5000 Jahren sind dann erste, wenn auch sehr vereinzelte schriftliche Belege in Keilschrift über den Einsatz von Kräutern bei der Behandlung unterschiedlicher Krankheiten erhalten geblieben. Allerdings handelt es sich dabei überwiegend um kurze Erwähnungen einzelner Pflanzen und knappe Angaben zu ihrer Verwendung, die wenig Rückschlüsse auf den wirklichen Umfang ihrer Benutzung zulassen.
Das änderte sich mit dem sogenannten Papyrus Ebers, einer ägyptischen Papyrusrolle aus dem 16. Jhdt. v. Chr., die nach dem deutschen Ägyptologen Georg Ebers (1837-1898) benannt wurde, der die aus einer Raubgrabung nahe Luxor stammende Kostbarkeit 1873 im Auftrag der Stadt Leipzig für eine beträchtliche Geldsumme erworben hatte. Der Papyrus Ebers enthält auf über 18,63 Metern insgesamt 879 Einzeltexte, von denen sehr viele Anwendungen aus der ägyptischen Heilkunde betreffen. Dabei werden auch zahlreiche Heilkräuter erwähnt, und es gibt eine Reihe von Anweisungen zur Behandlung von Erkrankungen des Verdauungstraktes, der Augen oder der Haut, wie auch Hinweise zur Bekämpfung von Parasiten oder Linderung von Zahnbeschwerden. Außerdem beschäftigt sich der Papyrus mit Empfängnisverhütung und gynäkologischen Beschwerden, beschreibt aber auch, wie man Verbrennungen, Abszesse oder Knochenbrüche behandelt.
Erwähnt werden außerdem das Bilsenkraut (Hyoscyamus), eine Pflanze mit halluzinogenen Inhaltsstoffen und der Schlafmohn, aus dem sich bekanntlich Opium und andere Wirkstoffe gewinnen lassen. Vermutlich wusste man zu dieser Zeit aber auch schon, dass eine klare Abgrenzung zwischen Heil- und Giftpflanzen nicht möglich ist, weil es fließende Übergänge gibt, was einer der berühmtesten Ärzte des Mittelalters, Paracelsus (1493–1541) später so zusammenfasste: Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, dass ein Ding kein Gift sei.2
Insgesamt muss die gesamte medizinische Versorgung der Menschen im alten Ägypten bereits ziemlich umfassend gewesen sein, denn vor allem griechische Geschichtsschreiber, aber auch Reiseberichte aus jener Zeit erwähnen übereinstimmend die große Zahl von Ärzten, die es dort gegeben habe, wobei viele von Ihnen sogar auf bestimmte Leiden spezialisiert gewesen seien. Doch selbst in einer hoch entwickelten Gesellschaft wie der ägyptischen zur Pharaonenzeit war man weiterhin überzeugt, dass es sich bei vielen Krankheiten, besonders solchen, deren Symptome man nicht ohne Weiteres erklären konnte oder die einen dramatisch schlechten Verlauf nahmen, um eine göttliche Bestrafung handelte.
Daher gibt es im Papyrus Ebers neben den Heilkräuterrezepturen auch noch zahlreiche Beschwörungsformel, mit deren Hilfe bestimmte Gottheiten oder andere überirdische Mächte um Unterstützung bei der Heilung gebeten wurden. Dies geschah durch Gebete, Reinigungszeremonien, Besänftigungsrituale oder Opfergaben, sodass die Ärzte jener Zeit nicht nur über medizinische Kenntnisse verfügen, sondern auch noch Zaubersprüche und magische Beschwörungsformeln kennen mussten, die für eine erfolgreiche Behandlung unerlässlich waren. Daher heißt es im Papyrus Ebers auch: Wirksam ist der Zauber zusammen mit dem Heilmittel, wirksam ist das Heilmittel zusammen mit dem Zauber.3
Mit der Entstehung der antiken Hochkulturen im Mittelmeerraum begann sich die Heilkunde dann aber langsam aus der Welt der Magie und des Übernatürlichen zu lösen. Für diesen Wandel steht vor allem ein Name: Hippokrates von Kos, der um 460-377 v. Chr. lebte und oft als „Vater der Medizin“ bezeichnet wird. Anders als die meisten seiner Vorgänger betrachtete er Krankheiten als natürliche und nicht als übernatürliche Phänomene, sodass er bei der Behandlung auch auf rituelle Zeremonien oder Zauberformeln verzichtete. Nicht zuletzt durch das Wirken dieses berühmten Arztes, entstanden in den folgenden Jahrhunderten in Griechenland und Rom dann auch die ersten größeren Abhandlungen zur Heilkunde. Eine davon ist die Naturalis historia von Plinius dem Älteren, einem römischen Gelehrten, der etwa von 23-79 n. Chr. lebte. Bei seinem Werk handelt es sich um eine umfassende Enzyklopädie aus 37 Bänden, in der das naturkundliche Wissen er damaligen Zeit zusammengefasst war.
Aus dieser Zeit stammt auch die Materia medica des griechischen Arztes Pedanios Dioskurides, der heute als der berühmteste Pharmakologe des Altertums gilt. Er war viele Jahre unter den römischen Kaisern Claudius (10 v. Chr. bis 54 n. Chr.) und Nero (37-68 n. Chr.) Militärarzt und verfasste in dieser Zeit auch sein umfangreiches Werk, dessen Titel übersetzt etwa „Über Heilmittel“ bedeutet. Darin wurden bereits mehr als 800 Pflanzen erwähnt, die für die unterschiedlichsten Behandlungen eingesetzt werden konnten, wobei das Werk aber nicht nur eine Beschreibung der jeweiligen Pflanze und ihrer Wirkung enthielt, sondern auch Angaben über die genaue Zubereitung und manchmal sogar Ratschläge zur richtigen Lagerung. Außerdem waren häufig Hinweise zur Herkunft der einzelnen Kräuter angegeben, denn zu dieser Zeit bestand bereits ein reger Handel zwischen Europa, dem Nahen Osten, Indien und anderen Regionen Asiens, sodass einige der damals angewendeten Heilkräuter aus weit entfernten Regionen stammten. Und natürlich äußerte sich Dioskurides auch zu Giftpflanzen, denn er schreibt:
Die Vorbeugung gegen Gifte ist schwierig, weil die, welche heimlich Gift geben, es so anstellen, dass auch die Erfahrensten getäuscht werden. Die Bitterkeit nehmen sie den Giften dadurch, dass sie Süßes hinzufügen, und den schlechten Geruch decken sie durch Duftmittel. Sie mischen Gifte auch Arzneimitteln hinzu, die, wie sie wissen, zu Gesundungszwecken gegeben werden … Sie tun sie in Getränke, in Wein, Suppen, in Honigwasser, in Linsengerichte und anderes, was essbar ist.4
Und er wusste wohl, wovon er sprach, denn es heißt, im antiken Rom seien Giftmorde nicht gerade selten gewesen. Aber auch für die Vollstreckung von Todesurteilen wurden Pflanzengifte verwendet, ebenso wie für militärische Zwecke, etwa zur Vergiftung von Pfeilen, Speeren und Schwertern, sodass selbst kleine Wunden tödliche Folgen haben konnten. In der Materia medica kann man außerdem etwas über die Gewinnung von Opium nachlesen und es gibt zahlreiche Rezepte, die angeben, wofür und wie sich die Droge anwenden ließ. Die Materia medica war aber nicht nur das wichtigste Heilkräuterbuch ihrer Zeit, sondern sie galt in Europa sogar bis zum 17. Jahrhundert als Standardwerk und wurde im Laufe der Jahre in zahlreiche andere Sprachen übersetzt.
Beträchtlichen Einfluss auf die Entwicklung der Pflanzenheilkunde hatte zudem Galen, auch als Claudius Galenos oder Aelius Galenus bekannt, der ebenfalls zu den einflussreichsten Gelehrten der Antike gehörte. Er wurde um 130 in Pergamon, einer damals griechischen Ansiedlung in der heutigen Türkei geboren und arbeite nach Ende seiner medizinischen Ausbildung zunächst als Arzt für Gladiatoren, wo er sich vermutlich gute Kenntnisse über die Behandlung von Wunden und Knochenbrüchen aneignete. Im Jahre 161, als er sich schon einen Ruf als erfolgreicher Arzt erworben hatte, siedelte er dann nach Rom über, wo er zahlreiche aristokratische Patienten hatte und einige Zeit auch als Leibarzt des römischen Kaisers Marc Aurel (121-180) tätig war. Und als solcher macht er sich notgedrungen auch Gedanken über Gifte, denn die Herrscher der damaligen Zeit rechneten fast ständig mit einem Anschlag auf ihr Leben. So schreibt er denn auch, dass es unter all den Übeln des Lebens nichts Gefährliches gäbe als Gift und giftige Tiere. Opium lobte er in seinen Schriften als gutes Mittel zur Behandlung der unterschiedlichsten Krankheiten, warnte aber auch vor einem Dauergebrauch der Droge.
In China und Indien gab es um diese Zeit ebenfalls bereits fortschrittliche medizinische Traditionen, die sich in Form der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) bzw. der traditionellen indische Heilkunst, die man unter dem Begriff Ayurveda kennt, was übersetzt etwa „Wissen über das lange Leben“ bedeutet, bis heute erhalten haben. Und sie spielen neben der westlichen Schulmedizin immer noch eine wichtige Rolle, nicht zuletzt als preisgünstige Alternative für ärmere Bevölkerungsschichten.
Mit dem Zerfall des Römischen Reiches in der Spätantike endete dann die Phase, in der griechische und römische Gelehrte die wichtigsten Beiträge zur Weiterentwicklung der Pflanzenheilkunde beitrugen. Dafür begann nun die Blütezeit der arabischen Medizin. Ihre Vertreter orientierten sich zunächst an griechischen Texten, von denen viele auch ins Arabische und Persische übersetzt wurden. Später erweiterten dann einheimische Mediziner die antiken Schriften ganz erheblich durch eigene Ansätze. Zu ihnen gehörte vor allen Dingen der persische Arzt und Philosoph Avicenna, der von 980-1037 lebte. Seine Enzyklopädie „Kanon der Medizin“ war später über Jahrhunderte auch in Europa eines der wichtigsten medizinischen Handbücher.
In Europa spielten inzwischen vor allem Klöster eine wichtige Rolle in der alltäglichen medizinischen Praxis, denn für die Nonnen und Mönche war die Behandlung und Pflege von Kranken ein Akt christlicher Nächstenliebe. Ihre Fähigkeiten verdankten sie vor allem dem Studium antiker medizinischer Texte, die aus dem arabischen Raum inzwischen vermehrt in die abendländische Kultur zurückgelangt waren und nun in Klöstern gesammelt und kopiert oder ins Lateinische übersetzt wurden. Daher war es den Angehörigen der Klostergemeinschaften möglich, sich grundlegende Kenntnisse über Diagnose von Krankheiten und über die anschließende Behandlung, hauptsächlich mit Heilpflanzen, anzueignen. Und weil sich die Klöster nicht nur für die Gesundheit ihrer Mitglieder verantwortlich fühlten, sondern auch für Menschen, die in der Umgebung des Klosters lebten, leisteten die Nonnen und Mönche in vielen Regionen einen großen Beitrag für die medizinische Versorgung der Bevölkerung.
So gab es in vielen Klöstern Krankenstationen und natürlich hatten alle einen Kräutergarten, in dem die Heilpflanzen für die Behandlung der Kranken angepflanzt wurden. Diese stammten zum großen Teil aus dem Mittelmeerraum, weil sich die Heilkundigen weiterhin an überlieferten Rezepten aus der Antike orientierten. Zu den typischen Pflanzen der Klostergärten gehörten aber auch Kräuter, von denen es hieß, sie könnten helfen, das Keuschheitsgelübde, also die Verpflichtung zur sexuellen Enthaltsamkeit, leichter einzuhalten, etwa der Mönchspfeffer (Vitex agnus-castus).
Von pflanzlichen Rauschmitteln ist dagegen aus dieser Phase praktisch nichts überliefert, ebenso wenig wie über den Einsatz von Gift aus niederen Beweggründen. Literarisch gibt es allerdings eine Ausnahme, denn im Roman Der Name der Rose von Umberto Eco (1932-2016) spielt ein tödliches Gift durchaus eine Rolle. Aber vielleicht war es hinter dicken Klostermauern auch einfach nur leichter, derartige Dinge zu verheimlichen. Die Phase der Klostermedizin endete – jedenfalls offiziell – mit dem Konzil von Clermont im Jahre 1130, auf dem beschlossen wurde, allen Nonnen und Mönchen die Ausübung einer ärztlichen Tätigkeit zu untersagen, weil dadurch die weltabgewandte, klösterliche Lebensweise zu stark beeinträchtigt werde.
Außerhalb der Klöster lag die Behandlung von Krankheiten der ländlichen Bevölkerung hauptsächlich in den Händen heilkundiger Frauen und Männer der Dorfgemeinschaften. Deren Kenntnisse stammten aus oft jahrhundertealten Überlieferungen, die aber ständig durch eigene Erfahrungen bei der Behandlung von Kranken oder in der Geburtshilfe erweitert wurden. Diese Heilkundigen verfügten zumeist über eine ausgezeichnete Kenntnis heimischer Pflanzen, die sie als eine Art natürlich Apotheke nutzten. Viele kannten sich zweifellos auch mit Pflanzengiften aus und man kann annehmen, dass einige von ihnen mit den halluzinogenen Inhaltsstoffen von Nachtschattengewächsen wie Bilsenkraut und Tollkirsche (Atropa belladonna), die auch in Mitteleuropa vorkommen, vertraut waren. Nicht zuletzt diese gute Pflanzenkenntnis wurde vor allem vielen Frauen unter den Kräuterkundigen später zum Verhängnis, als man sie beschuldigte, Hexen zu sein und anschließen häufig zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilte.
Im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit erfuhr die Pflanzenkunde dann einen Aufschwung, weil vermehrt Kräuterbücher in deutscher Sprache erschienen. Möglich war das durch die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg (1400-1468), die es ermöglichte, solche Bücher in größerer Zahl und zu einem erschwinglichen Preis herzustellen. Beispiele dafür sind das Neu Kreutterbuch von Hieronymus Bock (1498-1554) und das New Kreüterbuch von Leonhart Fuchs (1501-1566).
In dieser Phase fällt auch die Entdeckung des amerikanischen Kontinents, in deren Folge völlig neue Pflanzen nach Europa kamen. Dazu gehörten nicht nur Mais, Kartoffel oder die Tomate, sondern auch der Kokastrauch (Erythroxylum coca) mit seinem Inhaltsstoff Kokain oder der Tabak und damit das Nikotin. Aber auch das geheimnisumwitterte Pfeilgift Curare, das indigene Völker, etwa in den Tropen Süd- und Mittelamerikas, für die Jagd mit Blasrohren benutzten, fand seinen Weg nach Europa. Und als starkes Nervengift hätte man es hier eigentlich auch gut für hinterhältige Anschläge missbrauchen können, aber das geschah praktisch nicht. Vermutlich hielten sich Giftmörder wohl doch lieber an Substanzen, die sich über Jahrhunderte bewährt hatten. Und um diese soll es im 1. Kapitel gehen.
KAPITEL 1
GIFTMISCHER UND MEUCHELMÖRDER
Gift in den Händen eines Weisen ist ein Heilmittel, ein Heilmittel in den Händen des Toren ist Gift.
Giacomo Casanova5
Weil Pflanzen ein unverzichtbarer Teil der Nahrung vieler Tiere sind, ist es für sie natürlich besonders fatal, dass sie fest an ihrem Standort verwurzelt sind, also nicht fliehen können, wenn sich ein Fressfeind nähert. Daher haben sie im Verlauf von Millionen von Jahren die verschiedensten Abwehrmechanismen entwickelt, um Tiere davon abzuhalten, sie zu fressen. Typische Beispiele dafür sind Dornen und Stacheln, an denen sich ihre Feinde das Maul verletzten können oder auch widerlich schmeckende Substanzen, die sie praktisch ungenießbar machen. Aber am wirkungsvollsten ist es aber wohl, wenn Pflanzen zur Abschreckung ihrer Feinde starke Gifte produzieren. Und unter denen gibt es durchaus einige mit Killerpotenzial.
EIN GUT ABGESCHIRMTES VERBRECHEN
Eine solche Killersubstanz wurde beim Anschlag auf den regimekritischen bulgarischen Schriftsteller Georgi Markow verwendet, der Ende der 60er-Jahre des vorigen Jahrhunderts aus seinem Heimatland nach Italien emigriert war, um dann später nach London überzusiedeln, wo er als Journalist für die BBC arbeitete. Markow ahnte sicher nichts von dem sich anbahnenden Unheil, als er am 7. September 1978 an einer Haltestelle auf der Waterloo Bridge auf den Bus wartete. Und auch als ihn ein vorbeieilender Passant mit dem Schirm anstieß, sodass Markow einen leichten Schmerz in der rechten Wade verspürte, ärgerte er sich vermutlich über den ungeschickten Zeitgenossen, maß dem Vorfall ansonsten aber wohl wenig Bedeutung bei.
Doch bereits einige Stunden später muss der Schriftsteller, damals 49 Jahre alt, geahnt haben, dass es sich bei dieser Begegnung nicht um einen harmlosen Vorfall gehandelt hatte, denn er bekam plötzlich Kreislaufbeschwerden und zudem hohes Fieber. Als er daraufhin die Notaufnahme einer Klinik aufsuchte, erzählte er den Ärzten von der Begebenheit mit dem Regenschirm und fügte hinzu, er sei ganz sicher, vom russischen Geheimdienst KGB vergiftet worden zu sein und dass vermutlich niemand mehr etwas für ihn tun könne. Tatsächlich fiel Markow schon kurz darauf ins Koma und starb dann am 11. September 1978, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben.
Aufgrund der Aussage des Schriftstellers und weil man die Todesursache auch nicht genau feststellen konnte, benachrichtigte die Klinik die Polizei, die eine Obduktion anordnete. Dabei wurde auch eine kleine Wunde an Markow Bein genauer untersucht, in der der Pathologe zu seiner Verblüffung eine winzige, nur etwa eineinhalb Millimeter große Platinkugel fand. Aber das war noch nicht die einzige Überraschung, denn bei einer genaueren Untersuchung des Objekts fanden Experten schnell heraus, dass in sich der Platinkugel zwei röhrenförmige Hohlräume befanden, in denen sich noch Reste einer hochgiftigen Substanz, die Rizin genannt wird, feststellen ließen. Außerdem konnten sie ermitteln, dass die Öffnungen mit einer verfestigten Zuckerlösung verschlossen worden waren, um das Austreten des Giftes zu verhindern. Allerdings hatte man diese Lösung so angesetzt, dass sie sich bei Körpertemperatur verflüssigte. Dadurch gelangte das Rizin über kurz oder lang in den Körper des Dissidenten und entfaltete dort schon bald seine unheilvolle Wirkung.
Über Rizin muss man wissen, dass es zu den gefährlichsten natürlichen Giften gehört, die wir kennen. Produziert wird es von einer Pflanze, die wegen ihres schnellen Wachstums zumeist Wunderbaum (Ricinus communis) genannt wird, aber auch als Christuspalme, Hunds- oder Läusebaum bekannt ist. Sie stammt ursprünglich aus Afrika und dem Nahen Osten, wird inzwischen aber in vielen tropischen und subtropischen Regionen zu kommerziellen Zwecken angebaut und ist auch in Mitteleuropa manchmal in Gärten zu finden.
Die zu den Wolfsmilchgewächsen (Euphorbiaceae) gehörende Pflanze, die unter optimalen Bedingungen innerhalb weniger Monate mehrere Meter hoch werden kann, hat große, handförmig geteilte Blätter und auffällige stachlige Früchte. In diesen sitzen bohnenförmige Samen, die beträchtliche Mengen des genannten Toxins enthalten. Chemisch betrachtet handelt es sich dabei um ein Glykoprotein, also ein Makromolekül aus einem Protein mit einer oder mehreren Kohlenhydratgruppen. Die toxische Wirkung entsteht dadurch, dass sich eine Untereinheit des Moleküls außen an eine Zelle bindet, während die zweite in das Zellinnere geschleust wird. Dort verhindert sie dann die Produktion neuer Proteine an den Ribosomen, den „Proteinfabriken“ der Zelle, was den baldigen Zelltod zur Folge hat und bei einer hohen Dosis schließlich den Tod des Organismus.
So gesehen war es auch nicht überraschend, dass Markow das Attentat nicht überlebte. Aber zunächst war noch unklar, wie die kleine Kugel in den Körper des Dissidenten gelangt war. Aufgrund der vorliegenden Informationen kamen die untersuchenden Experten zu dem Ergebnis, dass man dafür vermutlich einen speziell konstruierten Regenschirm verwendet hatte, sodass man in der Folge auch vom „Londoner Regenschirmattentat“ sprach. Danach soll der Schirm im unteren Teil einen Zylinder mit komprimiertem Gas besessen haben und an der Spitze eine Art Injektionsnadel. Außerdem gab es im Griff einen Auslöseknopf, der betätigt wurde, sobald die Nadel die Kleidung und die Haut des Opfers durchdrungen hatte. Das führte dazu, dass die winzige Kugel durch das sich ausdehnende Gas in den Körper gedrückt wurde und das Gift, nachdem der Zuckerverschluss sich aufgelöst hatte, seine Wirkung entfalten konnte.
Sollte das Attentat tatsächlich in dieser Form ausgeführt worden sein, kann man die Planung durchaus als raffiniert bezeichnen, denn in einem Land, wo viele Menschen fast ständig mit einem Schirm unterwegs sind, gibt es vermutlich keine viel unauffälligere Mordwaffe. Mittlerweile zweifeln viele Experten allerdings an dieser Theorie. Sie nehmen vielmehr an, dass der Regenschirm, der nach der Berührung Markows zu Boden fiel, nur zur Ablenkung diente, während die Kugel mit einer kleineren und daher handlicheren Apparatur in die Wade injiziert wurde.
Sehr viel später gelang es dann sogar, einen Verdächtigen auszumachen, von dem man annahm, dass er das Attentat ausgeführt hatte. Dabei handelt es sich um Francesco Guillino, einen Dänen italienischer Herkunft, der auch zur Tat vernommen, aber aufgrund mangelnder Beweise wieder freigelassen wurde. Kurz darauf verschwand Guillino von der Bildfläche und tauchte, wie es heißt, in den Untergrund ab, aus dem er bisher auch nicht wieder aufgetaucht ist.
Was die Identität der Auftraggeber für das Attentats betraf, gab es schon bald erste Vermutungen. So waren sich die Ermittler schnell sicher, dass der Mord eigentlich nur durch Angehörige des bulgarischen Geheimdienstes geplant und in Auftrag gegeben worden sein konnte. Beteiligt war aber wohl auch der russische Geheimdienst KGB, der angeblich das Gift und die kleine präparierte Platinkugel zur Verfügung gestellt hatte. Ausgeführt wurde das Attentat dann vermutlich auf Befehl des bulgarischen Partei- und Staatschef Todor Schiwkow, den Markow nicht nur immer wieder kritisiert, sondern auch persönlich angegriffen und sogar lächerlich gemacht hatte. Als Datum für den Anschlag wählte man den 7. September – Schiwkows Geburtstag. Im Großen und Ganzen bestätigt wurden diese Vermutungen später durch ein Interview, das der ehemalige Generalmajor des sowjetischen Geheimdienstes Oleg Kalugin einem bulgarischen Radiosender gab.
WEITERE VERSUCHE MIT WECHSELNDEM ERFOLG
Vermutlich war dies aber nicht der einzige Versuch, einen unliebsamen Kritiker auf diese Weise mundtot zu machen. Wie später herauskam, wurde wohl schon einige Wochen vorher ein ähnliches Attentat auf Wladimir Kostow verübt, einen weiteren bulgarischen Dissidenten. Dieser gab an, er habe bei einer Fahrt in der Pariser Metro einen Schlag im Rücken verspürt und einen Knall gehört. Später entdeckte er eine kleine Wunde im Rücken, aus der ihm ein Arzt mehrere Objekte entfernen musste, über deren Beschaffenheit es aber keine weiteren Informationen gibt. Immerhin überlebte Kostow das Attentat.
Jahre später gab es dann sogar einen Nachahmer dieser Tat, den möglicherweise die sehr ungewöhnliche Methode des Anschlages fasziniert hatte, denn im Jahr 2011 stach ein Unbekannter in Hannover einem Familienvater eine Spritze ins Gesäß, die an einem Regenschirm befestigt. Darin befand sich eine giftige Quecksilberverbindung, die einige Monate später den Tod des Opfers verursachte. Über die genauen Gründe und den Verursacher des Anschlags ist nichts weiter bekannt.
Und auch Drohbriefe, die 2013 unter anderem an den Präsidenten der Vereinigten Staaten Barack Obama geschickt wurden, enthielten Rizin, allerdings in Pulverform, das leicht in die Atemwege gelangt. Als Täter wurde später der Kampfsportlehrer James Everett Dutschke aus Mississippi festgenommen und zu 25 Jahren Haft verurteilt. Der Grund für den Anschlag war wohl, dass er versuchen wollte, den Verdacht auf einen Mann zu lenken, mit dem er sich im Streit befand. Dieser wurde zunächst verhaftet, aber wieder freigelassen, nachdem sich seine Unschuld herausgestellt hatte.
Und auch die Schauspielerin Shannon Richardson verurteilte man wegen eines solchen Verbrechens zu 18 Jahren Gefängnis. Sie hatte ebenfalls Briefe mit Rizin an den US-Präsidenten geschickt und versucht, ihren Ehemann, der sich von ihr scheiden lassen wollte, mit dieser Tat in Verbindung zu bringen. In beiden Fällen gelang es, zum Glück für die Adressaten, die Briefe rechtzeitig abzufangen, denn für eine Rizin-Vergiftung gibt kein Gegengift und auch keine wirkungsvolle Behandlungsmöglichkeit. Und weil es sich um ein so starkes Toxin handelt, haben die Vereinigten Staaten in den 1960er-Jahren auch schon darüber nachgedacht, ob sich die pulverisierten Samen des Wunderbaumes nicht vielleicht als Kampfmittel einsetzen ließen. Vorsichtshalber ließ man sich schon einmal ein Patent darauf sichern, aber eine Anwendung hat es wohl nicht gegeben und inzwischen wäre ein Einsatz aufgrund der vereinbarten Chemiewaffenkonvention auch verboten, was natürlich nicht immer etwas zu bedeuten hat.
In Deutschland gab es ebenfalls schon Versuche, einen Anschlag mit Rizin durchzuführen. So plante ein Tunesier, der 2016 nach Deutschland gekommen war, gemeinsam mit seiner deutschen Ehefrau einen Terroranschlag, bei dem möglichst viele Menschen ums Leben kommen sollten. Durchführen wollten sie das Attentat in einem geschlossenen Raum mit einer Streubombe, die mit Rizin und 250 Stahlkugeln bestückt war. Dafür hatte das Ehepaar bereits Tausende von Rizinsamen verarbeitet, die Stahlkugeln besorgt und den Sprengstoff hergestellt, während sich der Zünder noch in Arbeit befand.
Auf die Schliche kamen ihnen die Sicherheitsbehörden nur deswegen, weil einem ausländischen Geheimdienst die Online-Beschaffung der Unmengen von Rizinsamen aufgefallen war, und er diese Informationen an die deutschen Behörden weitergegeben hatte. Daraufhin wurden die Bombenbauer im Juni 2018 festgenommen und der Mann später zu zehn, die Frau zu acht Jahren Haft verurteilt. Wie ein Gutachten zuvor festgestellt hatte, wäre die Menge an Rizin ausreichend gewesen, um mehr als 13.000 Menschen umzubringen.
Obwohl die Samen des Wunderbaumes so toxisch sind, dass sie für Mordanschläge verwendet wurden oder dass man sie als Kriegswaffen nutzen wollte, lässt dennoch ein giftfreies Öl (Ricini oleum) daraus gewinnen, das man in der richtigen Dosierung schon seit vielen Jahrhunderten als Arznei einsetzt. So wird die Pflanze bereits im Papyrus Ebers erwähnt, wobei Rizinusöl im Ägypten der Pharaonenzeit vor allem als sehr wirksames Abführmittel verwendet wurde. Der Grund ist, dass die im Öl enthaltenen Substanzen die Gleitfähigkeit des Darminhalts erhöhen, durch Reizung der Darmschleimhaut für eine verstärkte Kontraktion des Dickdarms sorgen und zudem die Aufnahme von Flüssigkeit aus dem Darm hemmen.
Die ägyptischen Ärzte nutzen das Öl außerdem zur Behandlung von Kopfschmerzen sowie Hautausschlag und die frisch gepflückten Blätter des Baumes als Wundverschluss. Vor allem wegen der abführenden Wirkung hat sich die Anwendung dieses sehr effektiven Mittels bis in unsere Zeit erhalten, denn man verwendet es bei Vergiftungsfällen immer noch zur Entleerung des Darms. Aber auch für verschiedene äußere Anwendungen, etwa zur Behandlung von Warzen oder Akne, als Massageöl, das die Durchblutung fördern soll und als Haut- oder Haarpflegemittel lässt sich das Öl einsetzen,
Neben der medizinischen Anwendung nutzt man Rizinusöl außerdem zur Herstellung von Schmierstoffen für Motoren, als Zusatz für Farben und Lacke, als Weichmacher in der Kunststoffindustrie, zur Produktion von Kosmetika, etwa Cremes, Salben oder Lippenstiften oder bei der Fertigung von Seifen und Kerzen. Gewonnen wird es durch kalte Pressung der geschälten Samen und eine anschließende Wärmebehandlung. Dass giftige Rizin ist darin nicht enthalten, weil es nicht fettlöslich ist und daher in den Pressrückständen verbleibt. Diese werden dann häufig von noch vorhandenen Restöl befreit und nach einer zusätzlichen Entgiftung durch eine Hitzebehandlung als Tierfutter oder Düngemittel verwendet.
MORD UND TOTSCHLAG IN DER EWIGEN STADT
Der Mord an Georgi Markow ist aber nur ein Fall aus einer längeren Liste von Mordversuchen mit Giftpflanzen, die es im Laufe der vergangenen Jahrhunderte gegeben hat oder gegeben haben soll. Dabei sind vor allem aus dem antiken Rom mehrere Berichte über heimtückische Giftanschläge überliefert. Zumeist handelt es sich dabei aber um Gerüchte, was nicht verwundert, weil Giftmörder ihre Taten normalerweise nicht an die große Glocke hängen, aber auch, weil die Täter gute Chancen hatten, unentdeckt zu bleiben, denn Giftmorde waren zu jener Zeit nur schwer nachzuweisen. Unglücklicherweise sind die genauen Umstände häufig nur lückenhaft überliefert, sodass der Wahrheitsgehalt aus heutiger Sicht zumeist nur schwer einzuschätzen ist. Dennoch kann man wohl davon ausgehen, dass Giftmorde im antiken Rom nicht wirklich selten waren, wobei es sich besonders häufig um Mordversuche an und von Mitgliedern einflussreicher Familien handelte, die dazu dienten, eigene Machtansprüche durchzusetzen.
TÜCKEN EINER EHE
Einer dieser Fälle, bei denen der Wahrheitsgehalt wohl höher ist als bei anderen Gerüchten, betrifft Kaiser Claudius (Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus; 10 v. Chr. bis 54 n. Chr.). Er gehörte zur mächtigen julisch-claudischen Dynastie, aber seine Familie hatte ihn zunächst von allen öffentlichen Ämtern ferngehalten, weil er stets kränklich war, eine Gehbehinderung hatte und zudem stotterte. Trotz seiner körperlichen Schwächen, scheint Claudius aber durchaus das Leben eines privilegierten römischen Edelmannes geführt zu haben, wozu auch ein recht ausschweifendes Eheleben gehörte.
Erst Caligula, der 37 n. Chr. römischer Kaiser geworden war, ermöglichte Claudius eine politische Karriere, denn er ernannte ihn zu seinem Mitkonsul. Als Caligula 41 n. Chr. einer Verschwörung zum Opfer fiel und von Angehörigen der Prätorianer, also seiner Leibgarde, ermordet wurde, übernahm Claudius, der zu diesem Zeitpunkt bereits über 50 Jahre alt war, die Macht in Rom. Bis dahin war der neue Kaiser bereits dreimal verheiratet gewesen, darunter mit Valeria Messalina (um 20-48 n. Chr.), die fast 30 Jahre jünger war als er. Mit ihr hatte er einen Sohn und damit einen potenziellen Nachfolger. Dieser hieß Tiberius Claudius Caesar Germanicus (41-55 n. Chr.), ist aber besser unter dem Namen Britannicus bekannt. Messalina wird von der Geschichtsschreibung als habgierig, herrschsüchtig sowie ausgesprochen leichtlebig beschrieben und soll ihren Ehemann ständig betrogen haben. Daher ließ dieser sie schließlich zusammen mit ihrem aktuellen Geliebten hinrichten. Danach beschloss er, dass dies seine letzte Ehe gewesen sein sollte. Angeblich gab er seinen Prätorianern sogar das Versprechen, sie dürften ihn töten, wenn er jemals wieder heiraten würde.
Allerdings hielten die guten Vorsätze nicht sehr lange, denn schon bald kam es zu einer neuen Eheschließung. Seine vierte Ehefrau wurde seine Nichte Agrippina die Jüngere (um 15-59 n. Chr.), eine Schwester von Kaiser Caligula, die bereits ebenfalls zweimal verheiratet gewesen war und aus ihrer ersten Ehe einen Sohn hatte, der Lucius Domitius Ahenobarbus hieß, später aber unter dem Namen Nero bekannt wurde. Damit diese Ehe geschlossen werden konnte, änderte der Senat sogar das gültige Inzuchtgesetz, das eine Heirat zwischen nahen Verwandten verbot.
Agrippina erwies sich jedoch als ähnlich herrschsüchtig und arglistig wie Messalina, denn ihr gelang es schon kurz nach der Eheschließung, ihren gutgläubigen Gatten zu überreden, Nero, ihren Sohn aus erster Ehe zu adoptieren. Damit brachte der Kaiser allerdings seinen eigenen Sohn, der jünger war als Nero, um die Erbfolge. Wie der römische Schriftsteller Sueton (Gaius Suetonius Tranquillus; um 70-130 n. Chr.), dem wir ein achtbändiges Werk über die römischen Kaiser seit Caesar verdanken, berichtet, deutete Claudius später offen an, dass er seine Heirat mit Agrippina und die Adoption Neros bereue und überlege, seinen leiblichen Sohn wieder für die Nachfolge einzusetzen oder zumindest eine Machtteilung ins Auge zu fassen. Dies soll dann dazu geführt haben, dass Agrippina glaubte, zum Wohle ihres Sohnes handeln zu müssen, sodass sie sich entschied, ihren Gatten umzubringen, noch bevor Britannicus schließlich volljährig wurde. Dazu schreibt Sueton:
Daß er durch Gift ermordet wurde, steht allgemein fest … nur über das Wo? und Von wem? weichen die Angeber ab. Einige sagen: bei einem Festschmause mit den Priestern auf der Burg D. i. auf dem Kapitol durch den Verschnittenen Halotus, seinen Vorkoster, andere: an seiner Haustafel durch die Agrippina selbst, die ihm Pilze, sein Lieblingsgericht, vergiftet vorgesetzt habe. Auch über den weiteren Verlauf lautet das Gerücht verschieden. Viele versichern: er habe gleich nach dem Genusse des Giftes die Sprache verloren und sei, nachdem er die ganze Nacht in furchtbarer Schmerzenspein zugebracht, gegen Tagesanbruch gestorben. Einige sagen: er sei anfangs in Schlummer versunken, dann habe er, weil der Magen mit Speise überladen war, alles wieder von sich gegeben, worauf man ihm eine neue Dosis Gift beigebracht habe, ungewiß, ob mittels eines Klystiers, mit welchem man ihm, wie wenn er an Magenüberfüllung litte, scheinbar auch von dieser Seite zu Hilfe kommen wollte ...6
In den Annalen des berühmten römischen Geschichtsschreibers Tacitus (Publius Cornelius Tacitus; ca. 58-120 n. Chr.), die zu den wichtigsten Quellen für die Geschichte des alten Roms gehören, finden wir eine ähnliche Darstellung.
Da nahm Agrippina, schon seit langem zu dem Verbrechen entschlossen, die sich bietende Gelegenheit schleunigst wahr. An Helfershelfern fehlte es ihr dabei nicht. Nur über die Art des Giftes war sie sich noch nicht klar. Denn durch ein ganz plötzlich und unmittelbar wirkendes Gift konnte das Verbrechen ans Tageslicht kommen. Wählte sie aber ein langsames, schleichendes Gift, so stand zu befürchten, daß Claudius, wenn er sich dem Tode nahe fühlte, die Machenschaften durchschaute und sich wieder seinem Sohne näherte.
Sie entschied sich für ein ganz ausgezeichnetes Gift, das zunächst den Verstand verwirrte und den Tod erst nach einiger Zeit herbeiführte. Die Wahl fiel auf Locusta, die sich auf dergleichen Dinge vorzüglich verstand. Erst kurz vorher wegen Giftmischerei verurteilt, blieb sie trotzdem noch lange ein Werkzeug der Regierung. Dieses erfinderische Weib bereitete also das Gift; und der Eunuch Halotus, der die Speisen vorzusetzen und vorzukosten hatte, brachte es dem Kaiser bei.
Alles wurde bald so bekannt, daß zeitgenössische Schriftsteller berichtet haben, das Gift sei in ein Pilzgericht, seine Lieblingsspeise, geträufelt worden. Die Wirkung des Giftes sei aber (von den Eingeweihten) nicht sofort gemerkt worden, weil man sich nicht darauf verstand oder sie auf die Trunkenheit des Claudius zurückführte. Zugleich schien ein Durchfall die Wirkung abzuschwächen.
Da erschrak Agrippina. Und weil alles auf dem Spiele stand, kümmerte sie sich nicht um den schlechten Eindruck, den ihr Handeln im Augenblick machen mußte, sondern zog den schon längst eingeweihten Arzt Xenophon hinzu. Dieser soll dem Claudius, als wolle er ihm durch Erbrechen Erleichterung schaffen, mit einer Feder, die mit einem rasch wirkenden Gift bestrichen war, in den Hals gefahren sein. Er wußte, daß es zwar gefährlich sei, sich zu solch verruchten Freveltaten herzugeben, daß aber andrerseits der Erfolg belohnt werde…7
Der Geschichtsschreiber Lucius Cassius Dio (ca. 163-235) berichtet ebenfalls, dass Agrippina bei ihrem Anschlag die Hilfe von Locusta in Anspruch genommen habe, die sicherlich bekannteste Giftmischerin im alten Rom. Über das Leben dieser geheimnisvollen Frau ist wenig bekannt. Sie war vermutlich als gallische Sklavin in die Ewige Stadt gekommen, wo sie sich dank ihrer Kenntnis über Giftpflanzen und deren effektive Anwendung schnell einen Namen und daher für einige der Mächtigen unentbehrlich machte. Zur Zeit des Todes von Claudius war sie bereits wegen Giftmischerei verurteilt und in Gewahrsam, was aber augenscheinlich kein Hinderungsgrund für ihre Unterstützung bei Agrippinas Mordkomplott war.
Da Claudius letzte Mahlzeit ein Pilzgericht war, ist immer wieder vermutet worden, Locusta hätte diesem einen Giftpilz untergemischt, etwa den tödlich giftigen Grünen Knollenblätterpilz (Amanita phalloides). Aus Sicht des neutralen Beobachters würde man eine solche Wahl als durchaus gelungen bezeichnen müssen, denn die ersten Vergiftungssymptome durch diesen Pilz werden erst viele Stunden nach dem Konsum sichtbar. Das wäre insofern wichtig gewesen, als die Herrscher der damaligen Zeit, die stets mit Anschlägen solcher Art rechneten, einen Vorkoster beschäftigen. Dieser probierte die kaiserliche Mahlzeit, und wenn er anschließend nicht tot umfiel, fühlte sich Majestät einigermaßen sicher, dass sein Essen nicht vergiftet war.
Daher war es nicht so einfach, mit einem schnell wirkenden Gift zum Ziel zu kommen. Und weil beim Genuss von Knollenblätterpilzen zunächst nichts passiert, hätte ein in das Komplott eingeweihter Vorkoster – in diesem Fall war es ein wohl in jeder Beziehung als unglücklich zu bezeichnender Eunuch namens Halotus – ohne besonders große Bedenken von dem Mahl kosten können, denn sein Risiko war im Vergleich mit der sicherlich fürstlichen Belohnung eher gering, da er die Pilze schon kurz darauf wieder erbrechen konnte, während das Gift im Körper des ahnungslosen Kaisers sein unheilvolles Werk begann. Allerdings lassen sich die beim Ableben des Kaisers beschriebenen Symptome einer Knollenblätterpilzvergiftung nicht problemlos zuordnen, denn die Vergiftung setzte viel zu schnell ein. Daher muss man wohl davon ausgehen, dass Locusta eine andere Substanz für das Attentat ausgewählt hatte.
Weiter ist überliefert, dass der Kaiser sich schon bald nach der Mahlzeit übergeben musste und Durchfall bekam, aber mehr passierte zunächst nicht. Daher gerieten die Verschwörer, die mit einem schnelleren Tod des Kaisers gerechnet hatten, schon bald Panik, weil sie fürchteten, die Symptome, die Claudius zeigte, seien nicht auf das verabreichte Gift zurückzuführen war, sondern auf den reichlichen Weingenuss. Daher sorgte Agrippina wohl in aller Eile dafür, dass sein ebenfalls eingeweihter Leibarzt hinzugezogen wurde, der sofort ein Erbrechen herbeizuführen versuchte, indem er ihm eine Pfauen- oder Gänsefeder tief in den Rachen steckte. Dies war eine übliche und eigentlich sinnvolle Maßnahme, denn durch Erbrechen ließ sich Gift zumindest teilweise aus dem Körper entfernen, wäre da nur nicht der Umstand gewesen, dass der Arzt die Feder zuvor mit Gift bestrichen hatte. Und dies sorgte nun endgültig dafür, dass der Kaiser den nächsten Tag nicht mehr erlebte.
BEWÄHRTES BEWAHREN
Seither ist viel darüber gerätselt worden, welches Gift die Verschwörer tatsächlich für den Anschlag verwendet haben könnten. Bei den antiken Geschichtsschreibern Sueton und Tacitus finden wir dazu keine Angaben, aber die Experten späterer Jahrhunderte hatten schnell eine Giftpflanze ausgemacht, die in Rom zweifellos in ausreichender Menge zur Verfügung gestanden hätte, und deren Vergiftungssymptome auch sehr gut zu denen passten, die bei Claudius Tod beschrieben wurden: Starke Schmerzen bei vollem Bewusstsein, Übelkeit und Durchfall, außerdem nicht selten auch eine Lähmung der Zunge sowie Gleichgewichtsstörungen. Gemeint ist der Blaue Eisenhut (Aconitum napellus), dessen Wurzel damals schon seit Jahrhunderten als Pfeilgift für die Jagd benutzt wurde. Dazu rieb man die Spitzen von Pfeilen oder Speeren mit einem Extrakt der giftigen Pflanze ein, um so zu erreichen, dass die Beute bei einem Treffer getötet oder zumindest gelähmt wurde.
Der Blaue Eisenhut wird unter anderem vom griechischen Philosophen und Naturforscher Theophrastus (etwa 372-287 v. Chr.) erwähnt, wie auch vom griechischen Arzt Dioskurides, der im 1. Jhdt. n. Chr. lebte. Der Legende nach entstand die Pflanze aus dem giftigen Speichel des dreiköpfigen Höllenhundes Cerberus, der auf den Boden tropfte, als der griechische Sagenheld Herkules ihn im Rahmen der zwölf Aufgaben, die ihm gestellt worden waren, am Berg Akonitos in Kleinasien ans Tageslicht zerrte.
Die Menschen der damaligen Zeit wussten aber nicht nur von der Gefährlichkeit des Eisenhutgiftes, sondern ihnen war natürlich außerdem klar, dass man es nicht nur für die Jagd oder kriegerische Auseinandersetzungen, sondern auch für eher hinterhältige Zwecke einsetzen konnte. Daher erließ bereits die Obrigkeit im antiken Griechenland strenge Gesetze, die der Bevölkerung untersagten, den Eisenhut anzupflanzen. Aber auch der Handel mit Extrakten der Pflanze war streng verboten, und unter Umständen konnte schon der Besitz des Blauen Eisenhuts mit dem Tode bestraft werden.