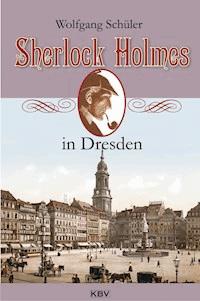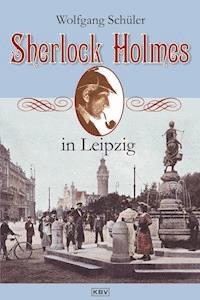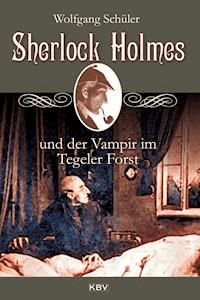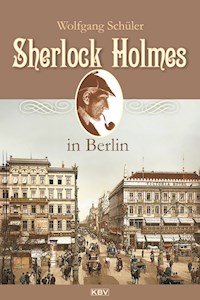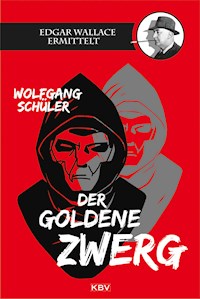Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Blutiger Osten
- Sprache: Deutsch
Morde, Autoschieberbanden, Entführung, abgetauchte Verbrecher - Kriminalfälle, die von den Ermittlern besonderen Einsatz verlangen. Die Autoren berichten als Insider, wie man gewitzten und abgebrühten Tätern mit Hilfe der Zielfahndung und anderen kriminaltechnischen Methoden doch irgendwann auf die Spur kommt. Eine spannende Dokumentation aus dem Polizeialltag!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Schüler / Wilfried Zoppa
Mörder auf der Flucht
und sechs weitere Fälle
Bild und Heimat
eISBN 978-3-95958-723-5
1. Auflage
© 2015 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: capa
Umschlagabbildung: Chris Keller / bobsairport
In Kooperation mit der SUPERillu
www.bild-und-heimat.de
Der S-Bahn-Mörder
Am 20. 12. 1990 konstituierte sich im Berliner Reichstag das erste frei gewählte gesamtdeutsche Parlament seit 1932. Alterspräsident Willy Brandt brachte in einer von allen Fraktionen beklatschten Rede die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich das deutsch-deutsche Verhältnis von »oben und unten, von Lehrern und Belehrten« bald »in eines von Gleichen zu Gleichen verwandeln« werde.
Johannes Gerster, der damalige innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, teilte am gleichen Tag der Presse mit, dass die Regierung beabsichtige, im Januar ein Gesetz in den Bundestag einzubringen, demzufolge alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes auf eine eventuelle Stasi-Mitarbeit zu überprüfen seien.
Radio One, ein Berliner Radiosender, berichtete live von der Pressekonferenz. Im Westteil der Stadt, zehn Kilometer Luftlinie vom Reichstag entfernt, arbeitete der Kriminaloberkommissar Frank Greger in seiner Dienststelle, der Berliner Fahndungsinspektion. Auf seinem Schreibtisch in der Charlottenburger Heerstraße stapelte sich ein Wust von beinah 30 Fahndungsfällen. In den Akten stand nichts Erfreuliches. Es ging um Betrüger, Sexualtäter und einen entwichenen Totschläger. Doch diese aktuellen Fälle des Kriminalbeamten stellten nur einen Bruchteil der rund 7.000 Fahndungssachen dar, die im Jahresdurchschnitt auf die Inspektion zukamen. Den Kopf leicht anhebend, mit der linken Hand das Radio lauter stellend, blickte Greger verschmitzt zum Nebentisch, wo ein ihnen neu zugeordneter ehemaliger Volkspolizist, der Polizeiobermeister Joachim Bayer, ebenfalls interessiert lauschte. »He, Bayer, kannst dir bald die lange Anfahrt von Hohenschönhausen zur Heerstraße sparen, was?«, frotzelte der Kriminaloberkommissar.
Sein Kollege schluckte und wurde blass. »Haben ja wohl nicht alle unterschrieben. Werden schon noch Kollegen übrig bleiben, die keinen Stasi-Vertrag hatten«, gab Joachim Bayer betroffen zurück. Nach der Wende waren die meisten Westberliner Dienststellen durch Kollegen aus dem Ostteil aufgefüllt worden. Die Fahndungsinspektion hatte an die 20 ehemalige Volkspolizisten übernommen, vom einfachen Polizeimeister bis zum Kriminalrat. Etwa zehn von ihnen blieben dabei, die Übrigen gingen.
Im Ostteil der Stadt, 15 Kilometer Luftlinie vom Berliner Reichstag entfernt, saß zur selben Zeit der Polizist Wilfried Jakobczak im Polizeirevier Buch an seinem zerschrammten Schreibtisch und machte Teepause. Er nippte gedankenverloren an einem Getränk mit der irreführenden Bezeichnung »Earl Grey«. In dem Teeglas, auf dem »Mitropa« stand, schwappte eine lauwarme dunkelbraune Flüssigkeit hin und her, auf der ein leichter Ölfilm glänzte. Obwohl Wilfried Jakobczak kein Radio hörte und noch nichts von den aktuellen Plänen der Bundesregierung wusste, schaute er sorgenvoll in die Zukunft. Allen ehemaligen Ostberliner Volkspolizisten wehte seit dem 3. Oktober 1990 ein scharfer Wind um die Nase. Nur gar zu gerne hätten die »Lehrer«, von denen der Altbundeskanzler so blumig gesprochen hatte, sämtliche Vopos in die Wüste geschickt. Doch auf einmal war das nicht gegangen. So wie nicht alle Richter, Staatsanwälte, Justizangestellte und Gefängniswärter in den neuen Bundesländern schlagartig ausgetauscht werden konnten, ließ sich das auch bei der Polizei nicht bewerkstelligen. Deshalb ging der Prozess schleichend vonstatten. Das Bucher Revier sollte in Kürze aufgelöst werden. Niemand konnte und wollte Wilfried Jakobczak sagen, wie es mit ihm weitergehen würde.
Patienten beim Ausgang
Berlin-Buch lag am nördlichen Stadtrand hinter dem Autobahnring und war vor allem durch sein Klinikum bekannt, das aus mehreren verstreut liegenden Krankenhäusern bestand. Zum Gesamtkomplex gehörte auch eine psychiatrische Abteilung, die in einem baufälligen Gebäude mit schadhaftem Innen- sowie Außenputz untergebracht war. Die Station A, Haus 213 lag etwas abseits. Der geschlossene Bereich ließ sich leicht an den verrosteten Gitterstäben vor den staubigen Fenstern erkennen.
Während Wilfried Jakobczak seinen abgestandenen Tee zu Ende trank, verließ die Krankenschwester Kathrin Patzelt mit zwei Patienten das Krankenhausgelände. Obwohl sie erst 37 Jahre alt war, hatte sie schon graue Haare und tiefe Falten neben den schmalen Lippen. Das rührte von den unzähligen Überstunden (bei gleichbleibend miserabler Bezahlung auch nach der Wende) und den vielen persönlichen Problemen her. Ihr Ehemann war vor drei Jahren an Magenkrebs gestorben und hatte sie allein mit einer hyperaktiven Tochter zurückgelassen. Ihr derzeitiger Partner trank sich kontinuierlich einer Leberzirrhose entgegen und taugte noch nicht einmal mehr für etwas Spaß im Bett.
Bei ihren beiden männlichen Begleitern handelte es sich um zwei chronisch Kranke, die als kaum therapierbare Langzeitfälle galten. Trotzdem durften sie von Zeit zu Zeit ausgehen, um unter Aufsicht in den Geschäften der näheren Umgebung einzukaufen. Auf diese Weise sollten sie sich die grundlegenden Elemente sozialer Kompetenz einprägen, wieder erlernen oder nicht völlig vergessen – je nach den unterschiedlichen Standpunkten der behandelnden Ärzte. Im Ergebnis liefen alle Behandlungsmethoden auf dasselbe hinaus.
Die Krankenschwester kannte ihre beiden Begleiter, Frank Schurian und Hans Müller, nur oberflächlich. Sie war der Meinung, dass beide an der Grenze zur Debilität standen. Die äußeren Anzeichen sprachen dafür: Frank Schurian saß meistens im Gruppenraum mit offenem Mund vor dem Fernsehapparat, während Hans Müller entweder in seinem Zimmer Musik hörte oder regungslos am Fenster verharrte und stundenlang hinausstarrte. Beide galten als unauffällig. Sie bekamen keine Wutausbrüche, schurigelten keine anderen Patienten, nahmen widerspruchslos ihre Medikamente ein und wurden nie aggressiv.
Aber Kathrin Patzelt hatte die Krankenakten ihrer beiden Begleiter nicht eingesehen, ein schwerer Fehler, der ihr später nie wieder unterlaufen sollte. Als die Gruppe hinaus auf die Straße trat, war es genau 14.30 Uhr. Die Krankenschwester sprach zu den beiden Männern – Frank Schurian war 43 Jahre alt, Hans Müller sogar schon 57– als wären es kleine Kinder: »Wenn wir über den Fahrdamm gehen, fassen wir uns an den Händen. Zuerst sehen wir nach links, und dann nach rechts.«
Von den übrigen Passanten nahm keiner von den drei Fußgängern Notiz. Patienten auf Ausgang gehörten zum gewohnten Bild in dieser Stadtrandlage. Manchmal waren größere Gruppen unterwegs, die sowohl geistig, als auch körperlich schwerst behindert waren, zum Selbstschutz Fahrradhelme trugen und tierähnliche Laute ausstießen.
Die beiden Männer und die Frau gingen die Karower Straße entlang, bogen vor der Kirche nach links in die Straße Alt Buch ein, liefen 200 Meter bis zur Kreuzung, überquerten die Wiltbergstraße und steuerten das Postamt an. Als sie dort eintrafen, war es 15 Uhr. »So, und nun gehen wir in die Post und kaufen uns Briefmarken. Es ist bald Weihnachten, und da wollen wir unseren Lieben daheim noch eine hübsche Ansichtskarte schicken.«
Hans Müller schüttelte den Kopf und brummte: »Kann nich’ schreiben, kann nich’ lesen, hab keine Familie.«
»Dann bleibe brav hier draußen stehen, wir sind gleich wieder zurück.«
Doch Hans Müller war nicht artig. Als seine Begleitung fünf Minuten später wieder vor die Tür des Postamtes trat, sah sich Kathrin Patzelt um und konnte ihn nirgendwo entdecken. Der ihr Anvertraute war verschwunden. Es überlief sie siedend heiß, Panik machte sich breit. »Mist, Scheiße, Kacke!«, fluchte sie ärgerlich, denn dieses Vorkommnis würde ihr einen dicken Minuspunkt in ihrer Personalakte einhandeln, wenn nicht gar etwas Schlimmeres.
»Du sollst keine braunen Worte sagen«, nuschelte Frank Schurian durch seine Hasenscharte.
»Halt die Klappe, du Schwachkopf«, schrie sie den verdutzten Patienten an, packte ihn am Ärmel und schleifte ihn hinter sich her in Richtung Klinikum.
Achim Gallrein, der diensthabende Stationspfleger, hatte schon ganz andere Sachen in seinen langen arbeitsreichen Jahren erlebt und problemlos überstanden. Er beruhigte seine Kollegin: »Mach dir keine unnötigen Sorgen, Mädchen. Der kommt schon wieder. Draußen ist es kalt. Wir haben noch vier Tage bis Weihnachten. Kein Mensch ohne einen Pfennig Geld in der Tasche bleibt da freiwillig auf der Straße.«
Der Pfleger sprach aus Erfahrung, diesmal jedoch sollte er sich irren. Aber er tat seine Pflicht, rief die Polizeiwache in Buch an und gab eine Vermisstenmeldung auf.
Wilfried Jakobczak nahm die Anzeige entgegen. Er füllte den Vordruck Pol 900 G (neu) »Vermisste Person« sorgfältig aus, teilte ihm eine Vorgangsnummer zu und gab die Fahndungsausschreibung in den Verteiler mit der untersten Prioritätenstufe ein. Ob noch andere Dienststellen davon Kenntnis nahmen, ist nicht bekannt. An diesem kalten Dezembertag jedenfalls verschwendete niemand einen weiteren Gedanken an den Verschwundenen, der lapidar als korpulent, dunkelhaarig, 1,50 Meter groß und nachlässig gekleidet beschrieben wurde. In der Klinik machte sich niemand die Mühe, in seine Krankenakte zu schauen. Auf dem Polizeirevier überprüfte man nicht, ob Polizeiberichte über ihn vorlagen. Alle waren permanent überlastet und hatten, wenige Tage vor Heilig Abend, den Kopf voll mit anderen Dingen. Auch nach den Weihnachtsfeiertagen sollte sich daran nichts ändern.
Ereignisse der Silvesternacht
Der Jahreswechsel 1990/1991 verlief für Berliner Verhältnisse außergewöhnlich friedlich. Es gab nur einige wenige Wohnungsbrände, am Brandenburger Tor hatten sich lediglich 2.000 Menschen eingefunden, die verwirrt und frierend auf und ab liefen. In Kreuzberg blockierten etwa 100 Jugendliche in alter Tradition den Heinrichplatz mit einem umgekippten Glascontainer, worauf rund 30 Mannschaftswagen und etwa 400 Beamte anrückten, um mit einem Schlagstockeinsatz die Sache routiniert und rasch zu beenden. Insgesamt fiel die Bilanz der Silvesternacht durchschnittlich aus: 56 Personen erlitten Verletzungen beim Abbrennen von Knallkörpern, elf Randalierer wurden festgenommen, und die 19-jährige Hotelangestellte Nicole Plesch erhielt um 6.10 Uhr in der S-Bahn bei einem Halt an der Station Mexikoplatz in Zehlendorf einen Messerstich in den Rücken. Die junge Frau, die sich auf der Heimfahrt von der Arbeit befunden hatte, wurde zwar sehr schwer verletzt, aber sie überlebte.
Im Jahr zuvor waren die Ereignisse wesentlich dramatischer gewesen: Am Brandenburger Tor, wo rund 100.000 Menschen gefeiert hatten, fiel ein Gerüst um und hinterließ über 100 Verletzte und einen Toten. In der Weddinger Prinzenallee erschoss ein Mann einen 14-jährigen Jungen, als er mit einer scharfen Waffe auf eine Haustür feuerte. In Tempelhof brannte eine Wohnung nach einem Treffer mit einer Raketenfontäne aus. Die Feuerwehr konnte die 89-jährige Mieterin nur noch tot bergen. Die Krankenhäuser in Ost und West nahmen insgesamt 300 Schwerverwundete auf. Die Krankenwagen, die pausenlos im Einsatz waren, mussten bis zu vier Verletzte gleichzeitig transportieren. »Wie sie lagen, wurden sie eingeladen«, erklärte Wolfgang Lausch vom Lagedienst der Westberliner Polizei am nächsten Tag lakonisch im Fernsehen.
Der Bucher Patient blieb auch im neuen Jahr weiter verschwunden und war damit einer von vielen. 1991 wurden im Großraum Berlin insgesamt 17.204 Personen aus den unterschiedlichsten Gründen per Haftbefehl gesucht. 374 von ihnen waren aus Straf- und Unterbringungseinrichtungen entwichen. Da jedoch die große Mehrzahl, nämlich 207, aus eigenem Antrieb reumütig zurückkehrte, gab es keinen Grund zur Annahme, dass es bei Hans Müller anders sein könnte.
Nachdem Nicole Plesch so weit von dem Messerstich genesen war, dass sie vernommen werden konnte, wurde sie im Krankenhaus von Kriminalkommissar Siegfried Schley von der Direktion 4 befragt. Er gehörte zum Referat Verbrechensbekämpfung, das für die Bezirke Schöneberg, Steglitz, Zehlendorf und Tempelhof zuständig war. Die Hotelangestellte schien froh zu sein, sich endlich ihr schreckliches Erlebnis in der S-Bahn von der Seele reden zu können. Für den Polizisten war das nur gut so, denn er war kein erfahrener Vernehmer, konnte aber leidlich gut Protokoll führen.
Die junge Frau sagte aus, dass sie nach ihrer anstrengenden Schicht sehr müde gewesen sei und die Umwelt nur noch wie durch einen Schleier wahrgenommen habe. »Ich war am Anhalter Bahnhof eingestiegen und döste vor mich hin. Am Mexikoplatz wurde ich hellwach, weil es plötzlich grauenhaft stank. Ein Penner in einem schmutzigen Mantel stand vor mir und quatschte mich an. Was er von mir wollte, habe ich nicht verstanden, und ich verspürte nicht das geringste Interesse, es herauszufinden. Ich will damit nicht sagen, dass ich hartherzig bin und mir das Schicksal fremder Leute gleichgültig wäre. Aber ich finde, es gibt gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Dazu gehört an oberster Stelle Reinlichkeit und Sauberkeit. Ich stand deshalb auf, drehte mich um und wollte das Abteil verlassen, da spürte ich einen scharfen Schmerz im Rücken. Es war so, als hätte mir jemand einen Schlag mit einem Knüppel versetzt. Im nächsten Moment wurde mir furchtbar schlecht. Ich stützte mich an einer halbhohen Zwischenwand ab und beugte mich vor, um den Magen zu entlasten. Dabei schaute ich unwillkürlich nach unten und sah Blut von meinem Mantel auf den Boden tropfen. Im nächsten Moment wurde ich ohnmächtig. Der Schock war wohl zu groß gewesen. Meine nächste Erinnerung ist, dass alles um mich herum weiß war und gleichzeitig golden leuchtete. Über mir sah ich verschwommene Schatten. Eine wie in Watte gepackte Stimme sagte: ›Es hat keinen Zweck mehr, wir haben sie verloren.‹ Dann ging das Licht aus und alles wurde schwarz. Aber sie müssen es noch einmal probiert haben, mich zurückzuholen, sonst könnte ich jetzt nicht mit Ihnen sprechen.«
Der Kriminalkommissar räusperte sich betreten, notierte alles gewissenhaft und fragte dann nach: »Wie sah der Mann aus?«
»So genau kann ich das nicht mehr sagen. Wie schon erwähnt, bin ich sehr müde gewesen, und ich habe ihn nur für einige wenige Sekunden gesehen. Er war mittelgroß, hatte braune Haare, eine Stirnglatze, eingefallene Wangen und schlechte Zähne.«
»Vielen Dank, Sie besitzen eine präzise Beobachtungsgabe. Das ist sehr selten. Die meisten Menschen können sich solche Details nicht merken. Sie haben uns sehr geholfen«, sagte Siegfried Schley. Und zum Abschied fügte er hinzu: »Ich bin mir sicher, wir werden ihn kriegen.« Letzteres war eine faustdicke Lüge, denn 1991 war es um die Berliner Polizei alles andere als gut bestellt.
Stille Post
In allen neuen Bundesländern brachte die Neuorganisation der staatlichen Einrichtungen große Probleme mit sich. Die Ministerien und Behörden hatten lange Zeit mit sich selbst genug zu tun. Berlin war etwas besser dran, aber es verlor seine Insellage und vergrößerte sich um den Ostteil der Stadt. Die Finanzausstattung blieb weit hinter den neuen Anforderungen zurück. Die Personenfahnder der Fahndungsinspektion, einer dem Landeskriminalamt angegliederten Dienststelle, fuhren ausgemusterte schwarze Staatsschutzlimousinen, die sich für eine verdeckte Ermittlung so gut eigneten, wie ein Frack für den Diskobesuch. Darüber hinaus parkten die Wagen nicht vor dem Haus, sondern in einer 900 Meter weit entfernten Tiefgarage. Bei dringenden Einsätzen rannten dann die Fahnder im Schweinsgalopp samt Einsatztaschen, Waffen und Funkgeräten zu ihren Fahrzeugen.
Autopannen gehörten zum Dienstalltag. In der Stadt stellten sie kein großes Problem dar. Die gefesselten Straftäter wurden dann eben mit der S- oder U-Bahn zur nächsten Polizeidienststelle gebracht. Ab und zu sah man aber auch Männer in Handschellen die Landstraßen entlanggehen – so weit, bis eine Ortschaft und damit eine Telefonzelle in Sicht kam.
Auf den Dienststellen wurden die Berichte noch mit alten mechanischen Schreibmaschinen nach dem Ein-Finger-Suchsystem »Adler« getippt (erst kreisen, dann zustoßen), Computer gab es so gut wie keine. Alle Fern- und Ortsgespräche mussten in der Telefonzentrale mit Dienstgradangabe und Namen des Vorgesetzten, der den Anruf genehmigt hatte, angemeldet werden.
Noch im Jahr 1992 gab es in Berlin pro Kommissariat für sechs Streifen nur jeweils vier Dienstfahrzeuge. Das waren entweder alte Schrottkisten mit weit über 200.000 Kilometern auf dem Tacho oder klapprige Ladas ohne Martinshorn. Die sowjetischen Autos verfügten zwar fast alle über Funkgeräte, aber mit ihnen ließ sich kein direkter Kontakt zur Funkbetriebszentrale (Fubz) im Westteil der Stadt herstellen, weil die unterschiedlichen Systeme nicht kompatibel waren. Sämtliche Meldungen mussten daher nach dem Prinzip der stillen Post abgesetzt werden: Nachricht an die Fubz Ost, Weiterleitung an die Fubz West, von dort aus Information an die Dienststelle.
Die Ausstattung entsprach also in etwa derjenigen, die die Kriminalpolizei am Ende des 19. Jahrhunderts gehabt hatte, als sie noch am Molkenmarkt residierte. Das zentrale Telegraphenamt der Polizei stand damals mit sämtlichen Revieren in der Stadt in Verbindung: Eine pneumatische Klingel im Kommissariat signalisierte jeweils durch die Anzahl der Glockenschläge den Inhalt der angekommenen Depeschen. Einmal Läuten bedeutete eine Routinenachricht, zweimal Läuten eine aufgefundene Leiche, und dreimal Läuten zeigte ein Kapitalverbrechen an. Ein Schutzmann musste dann zum Telegraphenamt laufen und die eingegangenen Depeschen abholen.
Holger Bernsee vom Bund deutscher Kriminalbeamter (BdK) stellte 1991 desillusioniert fest: »Nur noch jeder elfte Wohnungseinbruch wird aufgeklärt. Die Kriminellen arbeiten mit immer weniger Risiko. Grund dafür ist die katastrophale Ausstattung. Das Telefonieren zwischen Ost und West funktioniert nicht.« Letzteres lag daran, dass es keine direkten Leitungen gab, sondern nur über eine Vorwahl angerufen werden konnte, die ständig besetzt war.
Im Ostteil der Stadt sah es noch schlimmer aus. Beispielsweise war das Einbruchskommissariat in der Pablo-Picasso-Straße für die Stadtbezirke Pankow, Weißensee, Marzahn, Hellersdorf, Hohenschönhausen und Prenzlauer Berg zuständig. Im Jahr 1991 mussten die 35 Mitarbeiter mit drei Umweltkarten für öffentliche Verkehrsmittel und zwei Dienstwagen – einem Barkas und einem Wartburg ohne Funk – auskommen. Die Geschädigten, die vom Kommissariat am weitesten entfernt wohnten, bekamen deshalb meistens nur einen Brief mit einem Formular geschickt. Darin sollten sie mitteilen, was abhanden gekommen war und ob sie einen Hinweis auf den Täter geben könnten.
Aus diesen Gründen war klar, dass die beiden eingangs erwähnten Fälle – der des aus dem Klinikum Buch entwichenen Patienten und der des am Mexikoplatz niedergestochenen Mädchens – rein routinemäßig behandelt wurden, was im Januar 1991 im Klartext bedeutete: gar nicht.
Ein grausiger Fund
Die Lage änderte sich dramatisch, als am 26. Februar 1991 zwischen den S-Bahnhöfen Blankenburg und Pankow-Heinersdorf eine Frauenleiche neben den Gleisen gefunden wurde. Wenige Meter entfernt von ihr am Bahndamm lag ein dolchähnliches Küchenmesser mit schwarzem Plastikgriff. Die Tote konnte rasch identifiziert werden. Sie hieß Heike Block und stammte aus Riesa. Die Rekonstruktion des Tatgeschehens ergab: Die junge Frau, eine 25-jährige Studentin und Mutter einer kleinen Tochter, war am 26. Februar um 17.31 Uhr in Oranienburg in die fast menschenleere S-Bahn nach Schönefeld eingestiegen. In dem Abteil, in dem sie saß, hatten sich zwei Männer befunden. Der eine stieg um 17.37 Uhr in Borgsdorf aus, der andere war mit größter Wahrscheinlichkeit ihr Mörder gewesen. Er wartete bis zur Station Mühlenbeck-Mönchmühle, bevor er handelte. Dafür gab es einen plausiblen Grund: Bis zur nächsten Station benötigte die S-Bahn acht Minuten. Eine ausreichende Zeitspanne, um das Opfer töten, es zur Tür schleifen und aus dem fahrenden Zug stoßen zu können.
Die Beamten in der Mordkommission, die sich in der Keithstraße befand und verharmlosend »Delikte an Menschen« nannte, brauchten nicht lange, um einen Zusammenhang zum Messerattentat vom 1. Januar herzustellen. Die Direktion 4, Referat Verbrechensbekämpfung, übergab ihnen zuständigkeitshalber die Akten. Es schien sich um dieselbe Waffe zu handeln. Stichkanal und Stoßrichtung waren fast identisch.
In der Ermittlungsgruppe fasste Kriminalkommissar Gerhard Hoscheck, ein erfahrener Beamter mit kurzen eisgrauen Haaren, die ersten Ergebnisse zusammen: »1. Der Täter fährt S-Bahn. 2. Er kennt sich auf der Strecke Oranienburg–Pankow gut aus, denn er wusste, dass die Züge um diese Zeit nur schwach besetzt sind. Ihm war bekannt, dass er zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle und Blankenburg sein Vorhaben in aller Ruhe in die Tat umsetzen konnte.«
Der Kriminalkommissar trank einen Schluck Wasser, dann fuhr er fort: »Die zweite Tat unterscheidet sich in einigen wesentlichen Punkten von der ersten. Bei dem Mordversuch in Zehlendorf war das Risiko für den Täter äußerst groß gewesen. Er hätte leicht entdeckt und gestellt werden können. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass er die erste Tat im Affekt beging. Der Entschluss dazu muss für ihn spontan und ebenso überraschend wie für die Geschädigte gekommen sein, was ihr letztendlich das Leben rettete, denn er hatte keine Zeit mehr, sie aus dem Zug zu stoßen. Der zweite Anschlag hingegen war zielgerichtet geplant. Mit großer Sicherheit können wir davon ausgehen, dass der Täter sein Opfer bereits in Oranienburg ausgesucht und mit Vorbedacht auf den für ihn günstigen Moment gewartet hatte. Er warf die Frau nicht nur aus dem Zug, sondern raubte sie auch aus und stahl ihr die Tasche. Außerdem wischte er das Messer ab und entledigte sich der Mordwaffe.«
Im Besprechungsraum machte sich Unruhe breit. Es lag auf der Hand, dass der Täter Anstalten machte, eine »Karriere« als Serienkiller zu beginnen. Die Uhr lief, nun war höchste Eile geboten. Die Kriminalpsychologen wussten aus bitterer Erfahrung, dass die Abstände zwischen den Taten immer kürzer werden würden. Die lebende Zeitbombe musste so schnell wie möglich entschärft werden.
Die Pressemitteilung – es wurde eine Belohnung in Höhe von 10.000 DM ausgesetzt – löste eine Flut von Sensationsmeldungen in den Boulevardzeitungen aus. Angst und Massenhysterie machten sich breit. Nach Einbruch der Dunkelheit waren die S-Bahnen wie leergefegt. Die Hersteller von Reizgassprays und Gaspistolen räumten ihre Lager leer. In einem Supermarkt in Alt-Moabit (unweit vom Strafgericht und von der Untersuchungshaftanstalt) wäre ein kleiner Mann mit Stirnglatze von einer aufgebrachten Menschenmenge fast gelyncht worden, als er sich ein einzelnes Brotmesser kaufen wollte.
Die Nadel im Heuhaufen
Die Kriminalbeamten taten unterdessen das, was Ermittler in solchen Fällen zu tun pflegen: Sie begannen, nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen. Auf diese Weise stießen sie auf die Vermisstenmeldung aus Buch vom 20. 11. 1990. Es war das falsche Formular verwendet worden. Statt »vermisste Person« hätte der Vordruck die Überschrift »Entwichene Person oder entwichener Straftäter« tragen müssen. Im Ergebnis allerdings wäre es dasselbe gewesen. Im Dezember hatten die Verbrechen in der S-Bahn noch nicht stattgefunden. Der Fall Müller war einer von vielen gewesen.
Es gab einen Anhaltspunkt. Hans Müller stammte aus der Nähe von Oranienburg (nämlich aus Buch) und besaß damit die notwendige Ortskenntnis, auch wenn die Personenbeschreibung der Anzeige in keinem einzigen Punkt mit derjenigen übereinstimmte, die Nicole Plesch abgegeben hatte. Vorsichtshalber fuhr ein Beamter in die Klinik und ließ sich ein Foto des 59-Jährigen geben. Er mischte es unter fünf Bilder von anderen Männern und legte sie der jungen Frau vor. »Der da sieht dem Täter am ähnlichsten«, sagte sie und deutete auf das Foto des entsprungenen Psychiatrieinsassen.
Gerhard Hoschek erwirkte die Freigabe der Patientenakte. Als sie vor ihm auf dem Tisch lag und er die ersten Zeilen gelesen hatte, stieß er mehrere lange Flüche aus, die einem Vollmatrosen die Schamröte ins Gesicht getrieben hätten. In der Akte stand schwarz auf weiß: »Hans Müller wurde wegen eines Sexualmordes im Jahr 1989 durch die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin in die geschlossene Abteilung der Klinik Buch eingewiesen. M. gilt als sexuell abartig und äußerst gewalttätig.«
Der Kriminalkommissar forderte die Strafakte an. Es ergab sich folgendes Persönlichkeitsbild: Hans Müller war zeitlebens verhaltensauffällig gewesen und bereits 1941, im Alter von acht Jahren, in die Nervenheilanstalt Brandenburg eingewiesen worden. Wie durch ein Wunder hatte er die Euthanasie überlebt. Auch nach Kriegsende verblieb er in der geschlossenen Abteilung. Dort mussten merkwürdige Zustände geherrscht haben, denn Hans Müller vertrieb sich seine Zeit hinter Gittern damit, dass er in seiner Abteilung mehrere Jungen vergewaltigte und eine Patientin im Park fast zu Tode prügelte.
1980 wurde er als geheilt entlassen. Auf Grund welcher therapeutischer Erfolge dies möglich gewesen war, ließ sich nicht aus der Akte ersehen. Gerhard Hoschek vermutete, dass es sich lediglich um jahrelanges Wohlverhalten gehandelt hatte. Hans Müller bekam eine Wohnung, und in der Wäscherei des Fachkrankenhauses Herzberge eine Arbeitsstelle zugewiesen. 1984 lockte er ein siebenjähriges Mädchen auf einen Speicher, belästigte es dort sexuell und legte abends den Schlüpfer des Kindes unter sein Kopfkissen. Diesmal wurde er für einige Monate in das Klinikum Buch eingewiesen. Von 1985 an arbeitete er in mehreren Gaststätten als Küchenhelfer und verhielt sich bis Herbst 1989 insoweit unauffällig, dass nichts aktenkundig wurde. Am 8. Oktober entdeckte er in der Bierkneipe »Friedrichsfelder Eck« an der Straße der Befreiung eine völlig betrunkene Frau von Mitte 20, die Ute Cizek hieß. Er schleppte sie mit in seine Wohnung in der Lichtenberger Weitlingstraße, fesselte und vergewaltigte sie und tötete sie anschließend mit einem Stromstoß aus einem abisolierten Kabel. Die Leiche warf er am helllichten Tag aus dem Fenster.
Die Polizei verhörte einige Mieter, kam dem Täter ziemlich rasch auf die Spur und nahm Hans Müller fest. Er legte ein umfassendes Geständnis ab. Zu seinem Motiv sagte er, eine Stimme habe ihm den Befehl gegeben, die Dirne in den Himmel zu schicken. In der Staatsanwaltschaft machte sich niemand die Mühe, den Mörder auf seine etwaige Schuldfähigkeit untersuchen zu lassen. Vor den Juristen, aber nicht nur vor ihnen, standen im Herbst 1989 ganz andere Probleme.
Der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker hatte noch einen Tag vor der Tat, auf der Feier zum 40. Jahrestag, mit zittriger Stimme verkündet: »An diesen Realitäten ist nichts zu ändern, dass sich die Deutsche Demokratische Republik an der Westgrenze der sozialistischen Länder in Europa als Wellenbrecher gegen Neonazismus und Chauvinismus bewährt.« Mit der Bewährungsprobe sollte es bald zu Ende sein, die Lage drohte zu eskalieren. Die friedlichen Demonstrationen nahmen in den folgenden Stunden und Tagen ungeahnte Ausmaße an, es gab Hunderte von Festnahmen. Die DDR stand am Rande des Kriegsrechts. Die alles entscheidende Frage lautete: Bleiben die sowjetischen Truppen diesmal in ihren Kasernen, ja oder nein?
Die Mitarbeiter der Staatsanwaltschaften leisteten Sonderschichten, um mit heißer Nadel Anklageschriften gegen die so genannten Störer der öffentlichen Ordnung zusammenzustricken. Die Sache Hans Müller lag da völlig anders und schien außerdem klar zu sein. Aus Zeitnot wurde er deshalb ohne Anklage und ohne Prozess in die geschlossene Abteilung in Buch eingewiesen. Das war sicherlich nicht die verkehrteste Entscheidung jener Tage gewesen, selbst wenn sie sich kaum in Übereinstimmung mit rechtsstaatlichen Grundsätzen bringen ließ.
Auch nach der Wende griff niemand korrigierend ein. Der entscheidende Fehler passierte auf anderer Ebene. In der Nervenheilanstalt machte sich keiner die Mühe, die Akte richtig zu lesen. Dieses Versäumnis sollte letztendlich Nicole Plesch große Schmerzen bereiten und Heike Bloch das Leben kosten.
Auf der Jagd
Ende Februar 1991 rief Kriminaloberrat Frank Backhaus, der Leiter der Berliner Fahndungsinspektion (VB F I-Fahndung), seine drei Kommissariatsleiter zu einer wichtigen Besprechung in sein Büro. Die Inspektion befand sich damals in der Charlottenburger Heerstraße, gehörte zur Direktion Spezialaufgaben der Verbrechensbekämpfung und bestand aus drei Personenfahndungskommissariaten, der Haftbefehlssammlung und einer Datenstation. Der Inspektionsleiter kam gleich zur Sache: »Meine Herren, es gibt etwas zu tun. Erster Tagungsordnungspunkt: Die Mordkommission hat den Fall des S-Bahn-Mörders an uns abgegeben. Sicherlich nicht freiwillig, aber der politische Druck war wohl zu groß. Der Regierende Bürgermeister, der Innensenator und der Polizeipräsident wollen endlich Ergebnisse sehen. Es wurde höchste Priorität angeordnet. Da der Name des Flüchtigen mit einem ›M‹ beginnt, ist das zweite Kommissariat, zuständig für die Buchstaben I–Q, von dieser reizvollen Aufgabe betroffen. Die Akten können in der Gothaer Straße angefordert werden. Ich habe mir versichern lassen, dass die bislang mit der Bearbeitung befassten Kollegen gerne zu Auskünften bereit sind, insbesondere Kriminalkommissar Hoschek.«
Kriminalhauptkommissar Günther Meeden, der Leiter des zweiten Kommissariats, stellte die rhetorische Frage: »Bis zum erfolgreichen Abschluss bleiben alle anderen Sachen liegen, richtig?«
»Richtig!«, lautete die knappe Antwort. »Kommen wir zum zweiten Tagesordnungspunkt …«
Günther Meeden, ein drahtiger, sportlicher Typ mit vollem schwarzen Haar, war Berliner und Deutscher Boxmeister im Weltschwer- und Mittelgewicht. Mit seinem offenen, netten Lächeln wirkte er wie ein zu groß geratener Schuljunge. Momentan hatte er allerdings nichts Jungenhaftes an sich. Seine Stirn war gerunzelt, und er seufzte. Auf den Schreibtischen seiner Mitarbeiter stapelten sich die Haftbefehle. Allen diesen Betrügern, Einbrechern, Straßenräubern und Totschlägern wurde nun eine unfreiwillige Verschnaufpause gegönnt, sämtliche Planungen waren vorerst über den Haufen geworfen. Außerdem hatte niemand im Kommissariat große Lust, Übergaben anderer Fachdienststellen weiterzubearbeiten. Keiner konnte wissen, was die Kollegen tatsächlich ermittelt, welche Spur sie inzwischen zertrampelt, welchen Beteiligten sie aufgeschreckt oder gar verscheucht hatten. Die Akten konnten nur äußerst unvollkommen Auskunft über den tatsächlichen Stand der Ermittlungen geben. Ihr Inhalt fasste lediglich die wichtigsten Ergebnisse zusammen und diente als Gedächtnisstütze. Kein noch so gewissenhaft geführtes Protokoll war in der Lage, den persönlichen Eindruck einer Zeugenbefragung oder eines Verhörs zu ersetzen. Also musste noch einmal gründlich nachermittelt werden.
Den sechs Streifen vom zweiten Kommissariat standen drei Autos zur Verfügung: ein uralter Opel Rekord, ein Lada der ehemaligen Volkspolizei ohne Kopfstützen und Funkgerät sowie ein Opel Vectra. Der Kriminalhauptkommissar befahl seinen Stellvertreter Carsten Minx zu sich, einen leidenschaftlichen Fahnder, der gern im Team arbeitete, dem Überstunden nichts auszumachen schienen und der Träger des schwarzen Gürtels im Judo war. Sie nahmen sich den Opel Vectra und fuhren mit ihm nach Buch. Die übrige Mannschaft teilte sich in die restlichen beiden Fahrzeuge auf und schwärmte in alle Himmelsrichtungen (oder besser gesagt: zwei davon) aus, um den Mörder zu fangen.
Im Klinikum verlangte Günther Meeden zunächst, den leitenden Arzt von Haus 213 zu sprechen. Die beiden Kriminalisten mussten über 20 Minuten warten und liefen verärgert in dem nach Desinfektionsmitteln riechenden Flur auf und ab. Schließlich kam eine kleine zierliche Frau von Ende 20 in einem weißen kragenlosen Kittel auf sie zugeschlendert. »Was kann ich für Sie tun?«, fragte sie.
»Nichts«, knurrte der Kriminalhauptkommissar verärgert. »Ich warte auf Dr. Altweck.«
»Die steht direkt vor Ihnen. Ich bin die Stationsärztin von Haus 213. Es tut mir leid, wenn ich nicht Ihren Erwartungen entspreche.«
Günter Meeden verfluchte innerlich seine Instinktlosigkeit. Die meisten Menschen (außer natürlich die Berufsverbrecher) sind gehemmt, wenn sie mit einem Kriminalbeamten reden. Sie pflegen jedes Wort auf die Goldwaage zu legen und verschweigen wichtige Details. Deshalb war es äußerst wichtig, zu Beginn einer jeden Vernehmung einen persönlichen Kontakt zu dem Gesprächspartner herzustellen. Günter Meeden erinnerte sich an seinen Eintritt in den Polizeidienst und eine weit zurückliegende Prüfung zu den Vernehmungsgrundsätzen. Die zwei wichtigsten Sätze hatten gelautet: »Zeugen sind wertvolle Helfer bei der Aufklärung von Straftaten. Daher ist alles zu vermeiden, was ihren Willen, zur Wahrheitsfindung beizutragen, beeinträchtigen könnte.«
Das hatte er nun gründlich vermasselt, daran ließ sich leider nichts mehr ändern. Er übersah geflissentlich das spöttische Grinsen im Gesicht seines Stellvertreters und ließ sich zuerst zu Frank Schurian führen, dem Patienten, der am 20. 12. 1990 mit zur Post gegangen war. Doch der Mann mit der Hasenscharte wusste nichts und hatte nichts gesehen. Zu persönlichen Eigenheiten oder Kontakten des Geflohenen konnte er keine Angaben machen.
Vor der Tür befragte Günter Meeden die Stationsärztin dazu. Dr. Renate Altweck bestätigte die Angaben des Patienten und bezeichnete Hans Müller als einen typischen Einzelgänger, der nie Besuch bekam und keinerlei Kontakte zu anderen Kranken pflegte.
Der Kriminalhauptkommissar untersuchte das Krankenzimmer und die wenigen verbliebenen Sachen des Flüchtigen: abgetragene Kleidungsstücke, Musikkassetten, persönliche Papiere. Er fand nichts, was ihm hätte weiterhelfen können. »Wer schläft in dem anderen Bett?«, fragte er die Ärztin.
»Franz Zumpke, ein extremer Eigenbrötler.«
»Wo finden wir ihn?«
»Im Aufenthaltsraum. Aber es wird wenig Zweck haben, mit ihm zu reden.«
»Das lassen Sie mal bitte meine Sorge sein«, wies der Kriminalist Frau Dr. Altweck zurecht. Es gab nun keinen Grund mehr, auf ihre Befindlichkeiten Rücksicht zu nehmen.
Franz Zumpke stotterte und konnte keinen einzigen zusammenhängenden Satz herausbringen, doch mit viel Geduld und Mühe verriet er zwei äußerst wichtige Dinge: Erstens hatte ihm sein Bettnachbar bereits einige Tage vor dem 20. 12. 1990 mitgeteilt, dass er den nächsten Ausgang für die Flucht nutzen werde. Und zweitens wolle er zu seinem Freund Lars Thost nach Magdeburg fahren.
Günther Meeden sah die Ärztin fragend an. Frau Dr. Altweck dachte einen Augenblick nach, dann erläuterte sie: »Der Name Thost sagt mir nichts. Aber Herr Müller hat eine Zeitlang mit einem gewissen Lars Trost sein Zimmer geteilt. Trost ist ein extrem gefährlicher Mensch, der andere Leute aus Spaß an der Freude quält. An Herrn Müller hat er sich jedoch nicht herangetraut. Komisch eigentlich. Jetzt im Nachhinein verstehe ich nicht, wieso uns das damals nicht zu denken gegeben hat.«
»Sie meinen, dass Trost ahnte, wer und was Hans Müller wirklich war, erkannte, welches Gefahrenpotenzial in ihm steckte, und dass er deshalb Angst vor ihm hatte?«
»So in etwa, ja«, antwortete die Ärztin bedrückt.
»Was ist aus Trost geworden?«
»Er wurde im Dezember 1990, wenige Tage vor Müllers Flucht, in die Untersuchungshaftanstalt nach Potsdam verlegt. Soviel ich weiß, muss er dort immer noch sein.«
Günter Meeden bedankte sich und verließ das Klinikgelände. In einem Tante-Emma-Laden schräg gegenüber von der Schlosskirche kaufte er sich eine belegte Semmel und eine Flasche Milch. Während der Rückfahrt in die Heerstraße verzehrte er genüsslich das Wurstbrötchen, trank ab und zu einen Schluck Milch und besprach das Ergebnis der Ermittlungen mit seinem Stellvertreter: »Potsdam würde passen, weil es in der Nähe von Zehlendorf liegt. Dort am Mexikoplatz hat der Täter zum ersten Mal zugeschlagen.«
»Aber, Chef, er wird doch kaum bei seinem Freund im Knast wohnen«, gab Kriminaloberkommissar Carsten Minx zu bedenken.
»Das sicherlich nicht. Aber ich denke, dass es sich um einen entscheidenden Hinweis handelt. Ich bin mir sicher, Trost kann und wird uns weiterhelfen. Wollen Sie am Montag hinfahren und mit ihm sprechen?«
Der Kriminaloberkommissar schüttelte den Kopf. »Frank Greger wäre der geeignetere Mann. Er ist ein erfahrener Verhörspezialist. Er wird einen Schlüssel finden, um Trost aufzuschließen.«
»Sollte das jetzt die Andeutung einer versteckten Kritik sein?«
»Um Gottes willen, nein, Chef.«
»Okay, Greger soll mit Trost sprechen. Aber vorher muss er noch in die Weitlingstraße fahren und die ehemaligen Wohnungsnachbarn von Müller befragen. Vielleicht ist der Typ dort irgendwann einmal aufgetaucht. Außerdem ist es von Lichtenberg nach Potsdam nur ein Katzensprung, jedenfalls der Karte nach zu urteilen.«
An der Kreuzung Spandauer Damm/Königin-Elisabeth-Straße musste Kriminalhauptkommissar Meeden scharf bremsen. Die Flasche fiel um, die Milch ergoss sich auf den Wagenboden und tränkte die Fußmatte.
»Oh, oh. Wollen wir es ihm sagen?«, fragte Carsten Minx.
»Nein, er merkt es früh genug am Montag«, antwortete sein Chef.
Protein Casein
Die Lust von Kriminaloberkommissar Greger, einem ehemaligen Personenschützer, der auf schnelles Erkennen von Gefahrensituationen trainiert war, sich stundenlang durch verstopfte Straßen zu quälen – damals gab es nur wenige passierbare Verkehrswege zwischen Ost- und Westberlin – hielt sich in Grenzen. Aber am Montag, dem 4. März 1991, rang er sich ein gequältes Lächeln ab, weil er wenigstens den Opel Vectra benutzen durfte. Beim Einsteigen rümpfte er zwar die Nase, dachte sich aber noch nichts dabei. Schlechte Gerüche und Parkdecks bildeten eine Einheit. Doch nachdem er die Tiefgarage verlassen hatte, einige hundert Meter weit gefahren war und die Heizung auf vollen Touren lief, versteinerte sich sein Gesichtsausdruck. Die auf die Fußmatte vergossene Milch hatte inzwischen einen anderen Aggregatzustand angenommen: Der Milchzucker war zu Milchsäure vergoren, und die Milchsäurebakterien hatten den Ausfall des Proteins Casein veranlasst. Der auf diese Weise ausgesonderte Quark ähnelte in seinem Aussehen (und vor allem in seinem Geruch) herkömmlichem Frischkäse. Der Kriminaloberkommissar hatte keine andere Wahl. Er musste mit geöffnetem Seitenfenster fahren und eine Erkältung riskieren. Sein Partner machte ein verwundertes Gesicht, als er am U-Bahnhof Kaiserdamm zustieg. Kriminalkommissar Florian Faistel war ein unscheinbarer grauer Mann mit einem Dutzendgesicht, der sich ausgezeichnet für Observationen eignete, da er aufgrund seines nichtssagenden Äußeres kaum wahrgenommen wurde und förmlich mit der Umgebung verschmolz.
Das Haus in der Weitlingstraße hatte seine Zukunft schon lange hinter sich. An der Fassade waren nur noch wenige Putzbrocken übrig geblieben, und eine unsichere Hand hatte das schadhafte Pappdach an mehreren Stellen notdürftig mit Folie geflickt. Die dritte und die vierte Etage standen komplett leer. Bei den letzten Hausbewohnern schien es sich nicht um die wichtigsten Stützen der menschlichen Gesellschaft zu handeln, wie sich an den ungeputzten Fenstern ablesen ließ.
Die Korridortür zur Wohnung von Hans Müller war mehrfach aufgebrochen worden, Schloss und Türgriff fehlten ganz. Jemand hatte ein Stahlseil durch zwei Bauklammern gezogen. In den Ösen hing ein Vorhängeschloss. Kriminaloberkommissar Greger zog die Tür einen Spaltbreit auf, so weit, wie es das Stahlseil eben zuließ, und äugte in das finstere Innere. Es roch modrig und nach Fäkalien.
»Wenn Sie wollen, Herr Kollege, kann ich Ihnen aufschließen«, sagte eine Stimme hinter ihm.
Der Kriminaloberkommissar drehte sich um. Vor ihm stand ein weißhaariger, unrasierter Mann in einem braunen Trainingsanzug mit gelben Streifen an der Seite.
»Ursel, Heinz Ursel, ABV adé«, meinte der Alte.
»AB was?«
»Abschnittsbevollmächtigter der Deutschen Volkspolizei, seit 1988 im Ruhestand. Ich habe die Tür gesichert, weil dort nachts immer Stadtstreicher hausten. Aber Sie werden nichts mehr finden. Dort gibt es nur noch Dreck, Gestank und alten Plunder. Seitdem ich angerufen habe, ist der Müller hier nicht wieder aufgetaucht.«
»Wen haben Sie wann angerufen?«
»Das Revier in Friedrichsfelde. Das wird so etwa am 28./29. 12. gewesen sein. Da schlich der alte Sack hier im Haus herum. Vielleicht hoffte er, noch etwas zu finden, was er gebrauchen könnte. Aber da hatte ihm das andere Lumpenpack schon lange vorher einen Strich durch die Rechnung gemacht.«
»Wie sah er aus?«
»Wie immer: unrasiert und schmutzig. Mich kann er nicht leiden, deshalb hat er sich auch gleich wieder verdrückt.«
»Woran haben Sie erkannt, dass ich von der Kripo bin?«
»Weil Sie zu zweit sind. Außerdem an der Art, wie Sie sich bewegen, und an Ihrer Kleidung. Sie ist bequem, strapazierfähig und soll eine gewisse Eleganz vortäuschen. Kein normaler Mensch würde einen Schlips zu einer Lederjacke tragen.«
Kriminaloberkommissar Frank Greger lachte. »Das ist nur Zufall. Aber bitte, öffnen Sie das Schloss.« Er hielt sich ein Taschentuch vor die Nase und ließ sich die Wohnung zeigen. Sie bestand lediglich aus Zimmer und Küche. Auf dem Fußboden lagen Putzbrocken, zerknüllte Zeitungen, verdreckte Kleidungsstücke, Flaschen, Büchsen und Holzreste von zerschlagenen Möbeln. Die Fenster waren von innen mit Brettern vernagelt.
»Wie ich schon sagte, hier gibt es nichts mehr zu holen. Selbst nicht für einen Keim wie den Müller. Hoffentlich sind Sie nicht in etwas Weiches getreten. Machen Sie es gut, Kollege«, brabbelte der Alte und gab ihm zum Abschied die Hand.