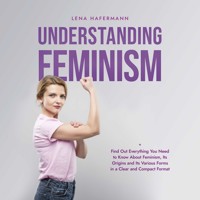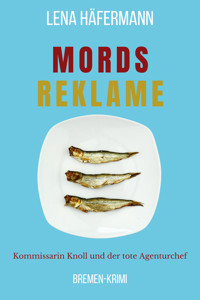
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kommissarin Mia Knoll ist gerade aus München nach Bremen versetzt worden. Als Empfang wartet gleich ihr erster Fall auf sie: Bernd Knusen, Inhaber einer Werbeagentur, wurde erschlagen in seinem Büro aufgefunden. Sein Tod schockiert Angehörige wie Mitarbeiter - aber wirklich alle von ihnen? Mia und ihr Kollege Andreas Paulsen stoßen bei ihren Befragungen neben echter Trauer auch auf so manch geheuchelte Anteilnahme. Schnell stellt sich heraus, dass Knusen längst nicht so beliebt war, wie es den Anschein hatte. Vielmehr gibt es einige Leute in seinem Umfeld, die ihm nicht wohlgesonnen waren, seien es geprellte Geschäftspartner oder ausgenutzte Praktikanten. Während Mia Knoll versucht, in dem unübersichtlichen Beziehungsgeflecht einen kühlen Kopf zu bewahren, lernt sie ihre neue Heimatstadt und den hanseatischen Charme kennen und lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mordsreklame
Kommissarin Knoll und der tote Agenturchef. Bremen-Krimi
Lena Häfermann
1. Auflage 2017, Oldenburg (Deutschland) © 2017 Schardt Verlag, Oldenburg Impressum Lena Häfermann Kantstraße 124 28201 Bremen wwww.hanse-zauber.deTitelbild: PolaRocket / photocase.deAlle Rechte vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf - auch auszugsweise - nur mit Genehmigung der Autorin wiedergegeben werden.
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 1
Ich wankte und musste mich stark konzentrieren, einen der vielen Raufaserknuddel an der Wand im Blick zu behalten, um nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen. Mir war schwindelig geworden. Vor Ärger oder vielleicht auch von dem vielen Bier, das ich bereits intus hatte. Ich konnte das nicht mehr genau bestimmen. Wütend ballte ich meine schwitzigen Hände zu noch schwitzigeren Fäusten, während dieser arrogante Fiesling aufreizend beiläufig ein paar zusammengeheftete Unterlagen durchblätterte, die er gar nicht richtig anzusehen schien. Mit angelecktem Zeigefinger. Warum Menschen das machten, habe ich nie verstanden.
„Ist das alles?“, fragte er jetzt mit diesem für ihn so typisch hängenden, gelangweilten Blick und stand auf, um einen Schritt auf mich zuzugehen. Tränig sah er mich an, so, als müsste er gleich ein Gähnen unterdrücken. Doch ich wusste, er spielte die Langeweile nur: Seine Mundwinkel zuckten verräterisch. Er amüsierte sich prächtig. Macht auszuüben amüsierte ihn immer ungemein.
„Ich ...“, stotterte ich und wich unwillkürlich einen Schritt zurück. Ich musste auf der Hut sein. Er hatte schon häufig unter Beweis gestellt, wie unberechenbar er sein konnte. „Nein! Das war natürlich nicht alles. Was soll denn das jetzt? Wir hatten doch eine Abmachung!“ Zum Ende des Satzes war ich lauter geworden. Beinahe selbstbewusst sah ich ihn an.
„Eine Abmachung“, wiederholte er leise lachend, und sein Lachen klang gar nicht mal aufgesetzt.
Dass ich an unser Abkommen glaubte, schien er wirklich lustig zu finden. In seiner Welt galten mündliche Verträge wohl nicht. Schon gar nicht mit jemandem wie mir. Man kann also sagen, unser Gespräch verlief ganz nach seinem Geschmack. Er liebte es, Oberwasser zu haben. Im Nachhinein war ich mir sicher, er konnte sich nur groß fühlen, indem er die anderen kleinhielt.
Als ich keine Antwort gab, ihn nur verwirrt und, wohl aufgrund des Alkohols, leicht schielend anstarrte, wies er mit übertriebener Geste zur Tür. „Wenn ich dann bitten dürfte ...“
Und dann war es leider passiert. Ich hatte es gar nicht gewollt. Aber da ich inzwischen kläglich lallte (das Bier war mit einer plötzlichen Wucht in meiner Blutlaufbahn angekommen), konnte ich meiner Wut nicht mehr mit Worten gerecht werden. Jedenfalls nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. In meiner verbalen Ohnmacht sammelte ich also meine Kräfte und stieß ihn so fest es ging von mir. Er taumelte. Es fühlte sich gut an. Endlich hatte ich mich gewehrt. Nicht nur für mich. Es hatte schon andere vor mir gegeben. Und sicher würde es auch nach mir einige geben, die sich von ihm ausnutzen ließen.
Der kalte Wind zog durch die schmalen Gassen, stolperte über das schiefe Kopfsteinpflaster und verlor sich schließlich in einem schier endlosen Grau. Der Sommer hier im Norden war kurz gewesen, und auch der goldene Herbst war längst vorbei, sofern es denn überhaupt einen klitzekleinen goldenen Funken in den trostlosen Tagen gegeben hatte. Bremen – so trüb und ungemütlich wie seine neueste Bewohnerin es sich in ihren kühnsten Albträumen nicht vorgestellt hatte. Kalt, windig und wenig einladend.
Zumindest rückte aber das Ende des Novembers in greifbare Sicht und damit auch der Beginn der Weihnachtszeit, die versuchen würde, mit flackerndem Kerzenlicht gegen das Wintergrau anzukämpfen, um es zumindest zeitweilig zu vertreiben.
In jenem Augenblick kämpfte auch Mia Knoll – und zwar am Weserufer mit stürmischer Nordluft. Besinnlich oder gar weihnachtlich war ihr überhaupt nicht zumute. Leise schimpfend bemühte sie sich, dem Weg an der Weser zu folgen, der mit graubraunen Pfützen gigantischen Ausmaßes bedeckt war. Der Sturm zerrte dabei mit eisigen Fingern, mal kraftvoll, mal nachlässig, an ihrer Kleidung. Mia Knoll war weder besonders groß noch besonders kräftig, und so schien es, als hätte sie keine Chance, dem Unwetter überhaupt etwas entgegenzusetzen. Fast befürchtete man, die nächste Böe würde sie mühelos emporheben und davontragen. Ihr roter Regenschirm, ein verlorener bunter Fleck an diesem sonst so farblosen Novembertag, bäumte sich im Sturm, drehte sich um die eigene Achse und beugte sich dem Wind schließlich in einer unterwürfigen Geste.
Mia fluchte abermals und mit mehr Nachdruck als zuvor. Ihre Worte verfingen sich jedoch in den Pranken des Regenwetters, und so schwebten die Fetzen ihrer Unflätigkeit über die Weser und verschwanden in den Wolken.
Schwere Regentropfen stürzten auf sie nieder, fast so, als hätten sie nur auf die bittere Niederlage ihres Regenschirms gewartet. Innerhalb von Sekunden klebte Mias blondes feines Haar klatschnass am Kopf, und der Regen suchte sich rasch einen Weg in die dunkelblauen Gummistiefel bis zu den bunten Socken, die sie am Morgen angezogen hatte, weil sie dachte, das brächte ihr vielleicht Glück.
Was für eine Schwachsinnsidee, dachte sie jetzt.
Dass unifarbene Socken der Nässe Norddeutschlands auch nicht besser trotzen könnten, kam ihr natürlich vage in den Sinn. Doch an manchen Tagen in manchen Momenten war die Vernunft bei ihr eben an der falschen Adresse.
Mia schüttelte sich kräftig, als sie die „Kleine Kneipe“ betrat, zu der sie im Eilschritt geflüchtet war. Von außen (und in den Augen einer Münchnerin wie Mia sie war) sah die Gaststätte aus, wie sie sich eine sehr miese Hafen-Spelunke vorstellte. Aber das ignorierte Mia jetzt geflissentlich. Um dem nassen Wetter zu entkommen, hätte sie vermutlich noch ganz andere Hütten betreten.
Was für ein mieser, mieser Tag, dachte sie erneut. Mit weniger Boshaftigkeit als eben, dafür aber mit mehr Melancholie.
„Na, min Deern, nass geworden?“
Hallo? Skeptisch blickte Mia hoch und fragte sich, ob das angesichts ihrer triefenden Haare und der Pfützen, die sich unter ihr ausbreiteten, besonders lustig sein sollte. Gerade wollte sie zu einer heftigen Erwiderung ansetzen, froh über die Gelegenheit, ihre Wut jemandem entgegenzuschleudern, der sie nicht so wortlos schlucken würde wie der Weserwind, da sah sie in das gutmütige Seebärengesicht des Kneipenwirts und beließ es dabei. Er sah so freundlich aus, dass sie sich sofort willkommen fühlte. Und das war das erste Mal, seitdem sie vor ein paar Tagen in dieser Einöde angekommen war.
Der Wirt stellte sich knapp mit „Herman Jansen“ vor, nickte ihr zu und wies auf die dampfende Tasse, die er prompt für sie auf die Theke gestellt hatte. Duftende Schokowolken versöhnten Mia fast augenblicklich mit dem draußen tobenden Schietwetter.
Schietwetter – natürlich einer der ersten Begriffe, die sie hier gelernt hatte.
„Danke“, murmelte sie leise, als sie sich einen Hocker heranzog und mit nasssteifen Gliedern etwas umständlich darauf krabbelte. Vorsichtig legten sich ihre verfrorenen Finger an das heiße Porzellan, und sie pustete bedächtig in die Tasse. Der heiße Dampf taute ihre Nasenspitze auf, die sich mit einem sachten Kribbeln zurückmeldete. Sie beugte sich noch ein wenig vor, um auch Stirn und Wangen über dem Schokoladendampf zu wärmen, und schloss wohlig die Augen, als sie die Wirkung verspürte.
Jansen wandte sich derweil wieder seinen Biergläsern zu. Sein mächtiger Bauch war nur mäßig im Weg, wenn er sich wendig hinter der Theke bewegte.
Verstohlen musterte Mia ihren Gastgeber aus den Augenwinkeln. Er musste um die sechzig sein. Bis auf die Koteletten und einen gepflegten Schnurrbart war das Gesicht glattrasiert. Unter dem dunkelblauen Seemannspulli aus Wolle lugte der Kragen eines rotweiß karierten Flanellhemdes hervor. Dazu eine Jeans, die schon bessere Tage gesehen hatte. Ein hellblau-weiß gestreiftes Küchentuch steckte lässig in der rechten Gesäßtasche.
Als Kneipenwirt war Herman Jansen schon die Optimalbesetzung, befand sie. Gemütlich, schweigsam und bestimmt mit einem Herz aus purem Gold.
Wie oft hier wohl einsame Gestalten an der Theke saßen, die in ihren Sorgen versunken auf dem Grund des Bierglases nach Lösungen suchten, fragte sich Mia, oder vielleicht sogar auf dem Grund von Schnapsgläsern. Und die dabei eigentlich nur zu schüchtern oder zu betrunken waren, um das zu erbitten, was sie eigentlich gerne wollten: schroffe Ratschläge von einem Gastwirt, dem man in Sachen Lebenserfahrung nichts vormachen konnte.
Auch Mia spielte mit dem Gedanken, Herrn Jansen von ihr und ihren Sorgen zu erzählen. Die Atmosphäre in der Kneipe regte sie dazu an. So als würde das, was hier gesprochen wird, tatsächlich hierbleiben, wenn man selbst den Heimweg antritt. Zurück in ein Leben, das einen nach dem Kneipenbesuch und der Aussprache mit dem Wirt vielleicht weniger sorgenvoll erwartete.
Eine geschäftige Stille hatte sich ausgebreitet, die nur ab und zu von dem leisen Quietschen durchbrochen wurde, das der Lappen auf den Gläsern hinterließ. Behutsam stellte Jansen die Gläser auf die Ablage über dem Zapfhahn und drehte die Beck’s Prägung nach vorne. Er erledigte seine Arbeit mit einer liebevollen Routine. Jeder Handgriff saß perfekt.
Mia sah sich um. Und fand es gemütlich. In der Ecke stand eine altmodische Juke-Box, die zu später – oder manchmal auch früher – Stunde die Bude zum Brodeln brachte. Wurde „Lebenslang Grün-Weiß“ gespielt, gab es kein Halten mehr. Dass man sich dann rührselig in den Armen lag und einander schwor, dass es in der nächsten Saison wieder „Mit uns“ bergauf ginge, erfuhr sie aber erst später.
Ihr gefielen die Holzmöbel mit den roten Polstern und die urige Einrichtung, die eine heimelige Gemütlichkeit ausstrahlten und Mia entfernt an ihre Heimat erinnerten. (Wenn Herman Jansen das gewusst hätte, wäre er vermutlich weniger begeistert gewesen. Welcher norddeutsche Kneipenwirt wollte schon, dass es bei ihm aussah wie in Bayern?) In Erinnerung an ihr altes Zuhause entfleuchte ihr ein tiefer Seufzer. So inbrünstig, dass sie sich anhörte wie ein röhrender Hirsch. Mia erschrak über sich selbst. Auch Jansen blickte überrascht. Er schmunzelte über die Geräusche, die sich aus einer so kleinen Person den Weg ins Freie suchten. Zugleich fragt er sich besorgt, was seine Besucherin so bekümmerte.
Mia fielen absurde Szenen aus Büchern und Filmen ein, in denen sich die Protagonisten in ausschweifenden Sätzen über den Sinn der eigenen Existenz verloren. Sie stellte sich vor, wie eine zierliche blonde Frau Mitte dreißig in einem Hollywood-Streifen an einer Bar sitzt. Was könnte sie für Sorgen haben? Liebeskummer wahrscheinlich. Während Männer in Unterhaltungsmedien auch in Bars gingen, wenn sie echte Probleme hatten, haftete Frauen dabei immer etwas Komödiantisches an. Ein kleiner Hauch von Lächerlichkeit. Doch ehe Mia weiter darüber nachdenken konnte, was sie über ihre eigene Existenz zu sagen hätte, ungeachtet davon, ob das jemanden interessierte, da wurde plötzlich krachend die Tür aufgerissen, und mit dem pfeifenden Wind, der den Raum erfüllte, wurde sie in die Wirklichkeit zurückgeholt.
„Was für ein Schietwetter!“ Ähnlich wie Mia zuvor kam schüttelnd ein junger Mann in Regenjacke und Gummistiefeln herein, die allerdings, wie Mia bemerkte, mit einem praktischen Tunnelzug dem zu aufdringlichen Regenwasser trotzen würden. Augenblicklich wurden ihr die eigenen feuchten Füße wieder bewusst, und schon krabbelte die nasse Kälte an ihrem Schienbein hoch und ließ sie fröstelnd das Gesicht verziehen.
„Guten Tag! Mit wem habe ich die Ehre?“ Gutgelaunt streckte ihr der Neuankömmling die Hand entgegen. Mit einer Kopfbewegung schüttelte er die dunklen, feuchten Haare nach hinten, die ihm vor die Augen gefallen waren. Ein strahlendes Lächeln, das sympathische, kleine Wangengrübchen zutage förderte, und braune Augen blitzten Mia entgegen.
Sie schaute ihn mit einer Mischung aus Verwunderung und Entsetzen an. Begrüßten sich hier etwa alle Kneipengäste mit kumpelhaftem Handschlag? Du liebe Zeit, in welchem verschlafenen Nest war sie hier nur gelandet? Wahrscheinlich sagten sich Fuchs und Hase hier nicht nur gute Nacht, sondern gingen aus Mangel an Alternativen sogar gemeinsam ins Bett.
„Mia Knoll“, entgegnete sie dementsprechend muffelig.
„Jansen. Henrik Jansen.“
Das hatte ich ja gar nicht gefragt, erwiderte sie spitz, jedoch nur in Gedanken. Jansen. Henrik Jansen, äffte sie tonlos nach. Waren sie hier bei James Bond?
Henrik Jansen war groß, muskulös und kräftig. Mit dem nachlässigen Dreitagebart hätte man ihn im ersten Moment für einen Studenten halten können, doch beim genaueren Hinsehen war er dafür doch zu alt. Er hatte kleine Lachfalten um die Augen, und in seinem dunklen, vollen Haar hatte sich die eine oder andere graue Strähne versteckt.
„Ich habe heute ein wenig früher geöffnet als sonst“, unterbrach Herman Jansen die Unterhaltung, die keine war. Mit leichtem Unbehagen fiel Mia jetzt erst auf, dass sich außer ihr noch gar keine Kundschaft in der Gaststätte befand. Eigentlich kein Wunder, es war schließlich noch am Vormittag. Nicht unbedingt das, was man als Stoßzeit für Kneipen bezeichnete. Sie war die Einzige, die zwischen Holzmöbeln und Kneipengeruch Ruhe vor dem gesucht hatte, was sie selbst als tobendes Unwetter bezeichnete, die Bremer aber nur als „büschen feucht“.
Henrik Jansen wandte sich seinem Vater zu. „Ich habe alles bekommen beim Großmarkt. Lassen wir die Regenwolken vorbeiziehen, und dann laden wir aus“, schlug er vor. Ohne eine Zustimmung abzuwarten, nickte er Mia noch einen Gruß zu und verschwand dann mit eingezogenen, aber immer noch bemerkenswert breiten Schultern, wie sie fand, wieder im stürmischen Regen. Sie sah ihm nach.
„Mein Sohn“, bemerkte Herman Jansen erklärend.
„Sehr nett“, antwortete sie. Und ausgesprochen attraktiv. Das sagte sie aber wohlweislich nicht.
Geschäftig wischte der Wirt die letzten Wassertropfen, die vom Spülen übriggeblieben waren, von seiner Arbeitsfläche. Mia überlegte, ob sie den Fremden vielleicht nun doch an ihren Gedanken teilhaben lassen sollte. Also nicht die über seinen hübschen Sohn, sondern die davor. Sie seufzte wieder. Dieses Mal aber unterdrückt, damit sie nicht wieder klang wie brunftiges Wild.
Mit einem recht ausdruckslosen Gesicht schaute sie dem Wirt bei seiner Tätigkeit zu. Ihr Blick blieb an den verschwundenen Tropfen auf der Arbeitsfläche haften. So albern es ihr auch vorkam, ihr Leben mit ein paar Spritzern Spülwasser zu vergleichen, so musste sie plötzlich über die Vergänglichkeit nachdenken. Eben waren die Tropfen noch dort, auf der metallenen Fläche. Hätte Jansen sie nicht mit dem Geschirrtuch aufgenommen, so hätten sie Wasserflecken hinterlassen, die man noch lange hätte sehen können. Fast hatte Mia Tränen in den Augen. Nicht wegen der eigentlichen Tropfen, nur über sie selbst als einen Tropfen, der anderswo schon Wasserflecken hinterlassen hatte, ehe er fortgescheuert worden war.
Sie schluckte.
„Ganz schön stürmisch heute, was?“, wagte Jansen vorsichtig einen weiteren Vorstoß, aber auch der wurde von seiner Besucherin mies gelaunt abschmettert.
„Ja“, gab Mia mürrisch zurück. „Aber ist das nicht normal hier?“, fügte sie resigniert hinzu und wedelte mit der Hand abwertend nach draußen.
Nur widerwillig löste sie ihren Blick von der blanken, glänzenden Arbeitsfläche, die ihr gerade noch Anlass für ihre semi-tiefsinnigen Grübeleien gegeben hatte.
„Es gefällt Ihnen hier nicht?“, fragte Jansen, dem es nur leidlich gelang, seine Ungläubigkeit und auch sein flüchtiges Missfallen darüber zu verbergen.
Wie Mia im Laufe ihrer Zeit in Bremen feststellen würde, liebte jeder Bremer seine Stadt. Abneigungen wurden hier höchstens widerwillig akzeptiert. Akzeptiert. Aber verstanden eigentlich nie.
„Hrmpf“, war jetzt ihre Antwort, „das ist meine erste Woche hier in Bremen.“
Sie rutschte vom wackeligen Hocker, griff in ihre Hosentasche nach ein paar Münzen, um den Kakao zu bezahlen, und schnappte sich ihre immer noch feuchte Regenjacke und den verbogenen Regenschirm. Doch Herman Jansen winkte ab, als sie die Münzen mit einem fragenden Blick nach der Summe neben die Untertasse legen wollte. Mit einem schiefen Lächeln bedankte Mia sich und hielt noch einen Moment inne. Doch außer „Danke“ wusste sie nicht wirklich etwas zu sagen. Während sie hinausging, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, nahm sie sich allerdings fest vor, wieder einmal herzukommen.
Die fetten, platschenden Regentropfen hatten sich mittlerweile in einen feinen Sprühregen verwandelt. Wie ein dünner Schleier legte sich die Feuchtigkeit auf jede noch so kleine Oberfläche und nicht zuletzt erneut in die Kluft zwischen Jeans, Gummistiefel und Ringelsocke.
Der Besuch in der „Kleinen Kneipe“ hatte Mia gutgetan, auch wenn das für den Wirt Jansen durch ihre hilflose Kratzbürstigkeit vielleicht nicht erkennbar gewesen war. Der Alltag von Vater und Sohn, die ihre Kneipe bewirtschafteten, in den Großmarkt fuhren und Gläser spülten, gaben ihr ein wunderbar behagliches Gefühl. Schon bald, so hoffte sie nun, würde ihr auch beim Gedanken an den eigenen Alltag in der neuen Stadt ähnlich zumute werden.
Ein wenig beschwingter als noch eine Stunde zuvor lief sie am Weserufer entlang. Der zerrende Wind hatte an Kraft verloren und schien sie nicht weiter mit aller Gewalt daran hindern zu wollen, ihren Weg zu machen. Sie nahm es als Zeichen.
Mia beeilte sich, nach Hause zu kommen. Eine steile Falte bildete sich auf ihrer Stirn, als sie kurz darauf die Stufen zu ihrer Wohnung hochlief und über ihren bevorstehenden Einstand nachdachte. In der Vergangenheit war sie leider nie besonders gut darin gewesen, einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen.
Im Flur stolperte Mia fast über den letzten Umzugskarton. In der Hoffnung, sich so schnell es nur ging, heimisch zu fühlen, hatte sie die ersten Tage fast ununterbrochen damit verbracht, die Wohnung herzurichten und ihr Leben aus den Kartons zu räumen.
Von der Eingangstür gesehen ging es geradeaus in eine kleine Küche. In den Winkeln und unter den Schrägen hatte ein geschickterer Handwerker als Mia es je sein würde eine Einbauküche installiert. Es war noch Platz für eine schmale Bank und einen Tisch. Blauweiße Fliesen gaben dem Raum ein altmodisches und norddeutsches Flair. Mia liebte ihre kleine Küche schon jetzt und freute sich darauf, hier schon bald mit neuen Freunden und Bekannten zu sitzen, zu essen, zu trinken und zu lachen.
Das Glanzstück der Wohnung war ein großzügiger Balkon, der von der Küche abging. Ein paar verkümmerte Pflanzen in dreckigen Übertöpfen hatten den Versuch gewagt, hier zu überwintern und waren damit noch im November gescheitert. Wenn der Frühling käme, würde Mia sie austauschen müssen. Vielleicht würde sie sich sogar einen pinken Sonnenschirm kaufen, hatte sie überlegt. Eines dieser Dinger, die aussahen als wären sie aus buntem Bast, aber in Wirklichkeit bestanden sie aus Plastik.
Auf der rechten Seite des Flurs befand sich das Wohn- und Esszimmer, das mit Holzbalken in zwei Bereiche getrennt war. Zwei flauschige, weiße Teppiche, einer vor dem Sofa und einer unter dem Esstisch, bedeckten partiell die alten Holzdielen und machten die Räume gemütlich und einladend. Blickte man aus dem Fenster, sah man die Gärten, die von oben aussahen wie kunterbunte Rechtecke und die mit verteiltem Spielzeug, Sandkästen oder ordentlichen Blumenbeeten so viel über ihre Bewohner preisgaben.
Auf der linken Seite befand sich das Schlafzimmer. Jetzt suchte sich Mia hier ein paar trockene Sachen heraus, um dann im Badezimmer vorne links neben der Haustür zu verschwinden und eine heiße Dusche zu nehmen.
Während das heiße Wasser ihren Rücken hinunter prasselte, versuchte sie eine diplomatische Antwort zu formulieren, sollte jemand Fragen stellen, warum sie eigentlich nach Bremen gekommen war und ob es ihr hier gefiel.
Denn Mias neuer Chef wusste noch nichts über das kleine Malheur, das ihr in München passiert war und das sie dazu zwang, sich versetzen zu lassen, da die Zusammenarbeit mit den Kollegen geradezu beschwerlich geworden war. Beide Augen fest zugedrückt hatte ihr damaliger Vorgesetzter kein Wort zuviel darüber verloren, und an ihrem letzten Arbeitstag machte er rührselig ungelenke Anstalten, sich mit einer Umarmung zu verabschieden. Durch einen winzigen Schritt nach hinten war Mia der Gefühlsregung aber ausgewichen, die sie fast in Tränen hatte ausbrechen lassen. Denn Abschiede waren etwas, das Mia fast noch mehr hasste als Neuanfänge.
Am schlimmsten jedoch war, dass das eine mit dem anderen einherging.
Tot! Er war tatsächlich tot. Wie oft müsste ich den Artikel in dem schmierigen Boulevardblatt wohl noch lesen, bis ich es wirklich begriffen hatte? Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich zu so etwas fähig wäre. Einen Menschen zu töten und seine Angehörigen in Trauer zurückzulassen ...
Mir wurde schlecht. Ich sah mich um und übergab mich in einen Mülleimer. Der Kioskbesitzer warf mir einen sehr schrägen Blick zu.
Seit der Tat, von der ich bis eben gar nicht wusste, dass es eine war, war fast eine Woche vergangen. Ich konnte nicht fassen, in welches unbeschreibliche Schlamassel ich mich wieder mal bugsiert hatte. Ich hätte auf meinen Vater hören sollen: Der hatte immer gewollt, dass ich was Anständiges lernte.
Obwohl Mia die Strecke bereits am Tag zuvor einmal abgefahren war, um sich alles einzuprägen, kam ihr das Bremer Straßengewirr nun gänzlich unbekannt vor. Mehrfach musste sie rechts anhalten, um sich zu vergewissern, noch auf dem richtigen Weg zu sein. Die Navi-App auf ihrem Smartphone war ihr dabei nur mäßig behilflich. Die Technik schien sich gedanklich noch in München zu befinden, so wie Mia ja eigentlich auch, und kapitulierte nun vor den unzähligen Einbahnstraßen in der Hansestadt, die der App-Programmierer anscheinend übersehen hatte.
Als Mia ihr Ziel ohne größere Umwege, wie sie glaubte, endlich erreicht hatte, blieb sie noch eine Weile in ihrem kleinen und etwas klapprigen alten Golf sitzen, lehnte sich zurück und versuchte sich zu entspannen.
Ein mulmiges Gefühl hockte in ihrer Magengegend. Es galt ja nicht nur eine tief sitzende Schüchternheit zu überwinden, sondern auch einen guten ersten Eindruck zu machen. Und sie hatte ja mit beidem so ihre Schwierigkeiten.
Erst ein lautes Lachen, das im Innenhof verhallte, ließ sie zusammenzucken und in die Wirklichkeit zurückkehren. Zwei junge Männer in Regenjacken gingen plaudernd auf den Haupteingang zu. Der schwache Nieselregen störte sie nicht. Mit leichtem Unbehagen schnallte Mia sich ab und stieg aus. Sie schloss das Auto ab, suchte auf ihrer Kleidung nach Fusseln und überprüfte den Inhalt ihrer Tasche auf Vollständigkeit. Erst als ihr keine weiteren sinnlosen Tätigkeiten mehr einfielen, die eine erneute Verzögerung rechtfertigten, betrat Mia Knoll, die neue Kommissarin der Bremer Mordkommission, das Dienstgebäude.
Kapitel 2
Die Kollegen hatten sich die Zeit genommen, Mia mit einem kurzen Umtrunk zu begrüßen. Im Foyer waren ein paar Stehtische aufgestellt worden, besonders eifrige Mitarbeiter hatten verschiedene Blechkuchen vorbereitet, die appetitlich auf einem langen Tisch angerichtet worden waren, und Sekt sowie Orangensaft machten die Runde.
Matthias Fercheler, der Chef der Abteilung, ergriff das Wort, begrüßte sein Team, das Mia schon neugierig beäugte, und rief seine neue Kommissarin dann zu sich, um sie offiziell vorzustellen.
Fercheler war ein gutaussehender Mann, hochgewachsen und von kräftiger, aber sportlicher Statur. Er hatte braunes volles Haar, das ein wenig wild und unzähmbar wirkte. Die Augen, die fast immer zu lächeln schienen, waren ebenfalls braun. Kleine Grübchen auf seinen Wangen verliehen ihm etwas Lausbubenhaftes. Unschwer zu erraten, dass Matthias Fercheler der heimliche Schwarm vieler weiblicher Angestellter im Präsidium war.
Mia hatte dafür indes kaum einen Blick übrig. Nervös schritt sie auf ihn zu, reichte ihm die Hand und wandte sich dann an die Kollegen.
Sie sagte ein paar Worte zu ihrer Person, behauptete, sie würde sich freuen, hier zu sein, und begrüßte die Mitarbeiter im Anschluss mit kurzem Smalltalk fast alle persönlich.
Es wurde viel gelacht und geschwatzt. Dazu fielen Kommentare über den Vorgänger, den tüchtigen Pulbe, den alle sehr geschätzt hatten. Sein freundliches Wesen und seine ausgeglichene Art hätten ihn zu einem wirklich angenehmen Mitarbeiter gemacht, wurde erzählt. Und bisweilen schaute Herr Pulbe sogar bei seinen ehemaligen Kollegen vorbei, wenn einer seiner ausgedehnten Spaziergänge ihn am Präsidium vorbeiführte. So würde Mia sicherlich auch bald seine Bekanntschaft machen können, versicherte man ihr. Doch sie solle sich mal keine Sorgen machen. Einmischen würde der sich bestimmt nicht mehr. Mia schwirrte der Kopf von all den neuen Informationen, ganz besonders über ihren Vorgänger. Sie hatte wohl in ziemlich große Fußstapfen zu treten. Das hörte man beim Einstieg ja besonders gern.
Anekdoten und Erinnerungen schossen weiter durch den Raum. Mit einem höflichen, aber zum Ende auch manchmal bemühten Lächeln nahm Mia an allem teil und versank schließlich erschöpft und erleichtert im Bürostuhl, als sich die Zusammenkunft nach einer Weile aufgelöst und Jasmin, die Assistentin, die für Mia und ihren Partner zuständig war, sie zu ihrem Arbeitsplatz geführt hatte. Sie lächelte ihr noch einmal aufmunternd zu und schloss leise die Tür hinter sich.
Wunderbar, diese Ruhe nach einer lauten Gesellschaft, stellte Mia fest. Die Ohren fühlten sich an wie in Watte gepackt, so still war es auf einmal. Sie verschaffte sich erst mal einen Überblick und begutachtete ihr neues Arbeitsumfeld. Weiße Raufaser-Wände, ein paar grüne Pflanzen in bunten Töpfen und zwei pedantisch aufgeräumte Schreibtische, von denen einer, Mias, bald in einem kreativen Chaos versinken würde. Dazu ein kratziger Teppichboden, eine Glastür zum Flur hinaus und eine helle Schrankwand, hinter deren Türen sich all die Unordnung verbarg, die oberflächlichen Blicken verborgen bleiben sollte. Eine Fensterfront gegenüber von Tür und Schrankwand ließ erstaunlich viel Licht in den Raum, und Mia fragte sich ganz unwillkürlich, wo all die Helligkeit herkam, die sie draußen gar nicht bemerkt hatte. Ihr Schreibtisch stand neben den hohen Fenstern, und so konnte sie ohne aufzustehen den Blick über das Treiben im Hof schweifen lassen. Genau gegenüber befand sich ungefähr mit zwei Schrittlängen Abstand der Schreibtisch des Kollegen, der auf den Namen Andreas Paulsen hörte. Dahinter eine weiße, blank geputzte Metalltafel, die so rein und unschuldig aussah wie der Arbeitsplatz von Herrn Paulsen. Der würde erst gegen Abend noch einmal ins Büro kommen, um sie zu begrüßen. Tagsüber war er in Bremerhaven bei einer Fortbildung zum Thema „Burnout“.
Für den Rest des Tages und bis zur Ankunft des Kollegen würde Mia damit beschäftigt sein, in die Untiefen der Kriminalfälle einzutauchen und sich überhaupt ein Bild von der kriminellen Energie in Bremen zu machen. Entschlossen zog sie sich den Akten-Stapel heran, den ihr Kollege vorsorglich schon mal auf ihren Schreibtisch gelegt hatte, und öffnete den ersten Hefter. Er war nicht besonders dick und behandelte einen Einbruch mit Todesfolge an einer Tankstelle in einem Stadtteil namens Findorff. Mia tippte den Namen in die Suchmaschine ein und fand heraus, dass er unweit der Stadtmitte gelegen war und eher als gutbürgerlich bezeichnet wurde.
Der Täter war zu seinem Nachteil nur dürftig maskiert in die Tankstelle gestürmt, um die Einnahmen des Tages zu erbeuten. Ein Kunde, der nach ihm eintrat und zunächst nichts von dem Überfall ahnte, der sich da direkt vor seinen Augen abspielte, musste ihn überrascht, vielleicht sogar erschreckt haben. In seiner Nervosität fuchtelte der Räuber wild mit dem mitgebrachten Messer herum, das er eigentlich nur als Drohung dabeihatte, wie er später beteuerte. Dabei verletzte er sein Opfer jedoch so schwer, dass es später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Eine Fahndung mit Phantombild führte rasch zum Täter, der ganz in der Nähe wohnte und die Tankstelle häufig als Kunde, vielleicht auch um sie schon mal auszuspähen, besucht hatte. Und so erinnerte sich schließlich ein anderer Mitarbeiter an den jungen Mann Mitte zwanzig, der ihm zuvor allerdings nie negativ aufgefallen war. In der Vernehmung im Kommissariat wirkte er zerbrechlich wie ein Jugendlicher, schluchzte, was das Zeug hielt, und schien ernsthaft zu bereuen, was er getan hatte. Zurzeit saß er in Untersuchungshaft, das Urteil stand noch aus. Er kam aus einer intakten Familie, wie man so schön sagte, weder er noch seine Geschwister waren vorbestraft, und die Eltern hatten ihm einen teuren Anwalt besorgt, der ihn so gut es ging aus der elenden Geschichte herausboxen würde.
Fälle wie diesen gab es zuhauf. Und das nicht erst seitdem sich die Medien auf jedes Vergehen eines Teenagers stürzten, um die verrohte Jugend mit ihrer fehlenden Empathie und dem Überschuss an Gewaltfreude anzuprangern.
Erst als Mia den dringenden Wunsch nach einem heißen Kaffee verspürte, legte sie den Stift beiseite. Vier von sieben Fällen hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits verfolgt. Eine kleine Kaffeepause war also getrost vertretbar.
Die Teeküche lag am anderen Ende des Flurs, und während Mia an den meist offenen Bürotüren vorbeiging, warf sie hier und da ein zaghaftes Lächeln in die Räume, wenn jemand von seiner Arbeit aufblickte und sie neugierig ansah.
Als Mia die Teeküche betrat, streckte ihr ein lächelnder Kollege mit strahlend rotem Pullunder, der sie augenblicklich und ein wenig schmerzlich an ihren kaputten Regenschirm erinnerte, schon einen Kaffee entgegen: „Moin, Frau Knoll, auch einen?“ Er sah sie erwartungsvoll an.
Mia nickte dankbar
„Mit Milch und Zucker?“, fragte er.
„Nur Zucker, bitte.“
Der Kollege nickte eifrig und gab zwei Löffel Zucker in den Becher, der mit einer kaffeebecherhumorigen Aufschrift „Morgen ist auch noch ein Tag“ verziert war.
„Harald Lüske“, stellte sich der Mann jetzt vor, „wir haben uns zwar eben schon getroffen, aber bei all den vielen neuen Gesichtern haben Sie sich bestimmt nicht alle Namen merken können, oder? Wir duzen uns hier übrigens fast alle in der Abteilung. Harald“, plapperte Harald und hielt ihr seine riesige, feingliedrige Hand zum Einschlag hin. Er war viel größer als Mia, fast zwei Meter, und sehr schlaksig. Sein Gesicht war mit langer, schmaler Nase, beinahe eingefallenen Wangen und dünnen Lippen hager und dürr. Stechend blaue Augen, mit denen er Mia gerade anstrahlte, verliehen ihm trotz der mageren Erscheinung einen unbändigen Charme.
„Mia“, schlug sie ein und war sehr erfreut über das nette Verhalten ihres neuen Kollegen. Vielleicht war hier ja doch nicht alles so schlecht, dachte sie.
Bei leichtem Geplauder über das Wetter tranken Harald und Mia einträchtig ihren Kaffee, als der Chef seinen Kopf in die Küche streckte. Mit einem Lächeln blickte er Mia an. „Moin, Frau Knoll, haben Sie sich schon ein wenig eingelebt?“, fragte er und blieb in der Tür stehen.
Sie musste lachen. „So schnell nun auch wieder nicht. Aber ich denke, ich werde mich tatsächlich schon bald heimisch fühlen.“ Sie bedachte beide Kollegen mit einem breiten Lächeln, von dem sie optimistisch annahm, dass es nicht aussah wie der Joker. Das passierte ihr nämlich leider manchmal, wenn ihre Freude nicht ganz ehrlich war. Als ihr das einfiel, fing ihr Gesicht an zu glühen, wie sie nervös bemerkte, und sie hoffte, die anderen beiden würden das in der künstlich beleuchteten Küche nicht bemerken. Es wirkte so kindlich, schalt sie sich innerlich, so unerwachsen, wenn man errötete, sobald einem ein wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde. Der heiße Kaffee in ihrer Hand trug indes auch nicht zur Abkühlung bei.
Sofern Fercheler Mias Unwohlsein überhaupt bemerkte, so ließ er es sich nicht anmerken. „Wir werden dich gern dabei unterstützen, dich einzuleben, nicht wahr, Harald? Und wenn du Fragen hast oder irgendetwas brauchst, dann melde dich bitte.“ Er stockte kurz. „Geht das in Ordnung mit dem Du? Machen wir hier alle so.“
„Natürlich“, beeilte sich Mia zu sagen und lächelte. Ihre Gesichtsfarbe hatte sich mittlerweile wieder erholt.
Mit einer fröhlichen Melodie auf den Lippen verschwand Matthias und ließ die beiden wieder allein. Mia blickte ihm kurz nach und wandte sich dann Harald zu, der damit begann, ihr von seinen Anfangstagen bei der Bremer Polizei zu berichten. Er sei in Schleswig-Holstein, nähe Rendsburg, aufgewachsen und könne sich gar nicht vorstellen, Norddeutschland zu verlassen, sagte er.
„Ach, was muss, das muss, nicht wahr?“ Wieder der Joker. „Wobei“, fuhr sie dann fort, „um ehrlich zu sein, könnte ich mir natürlich auch sehr gut vorstellen, dass ich eines Tages wieder in meine Heimat zurückkehre.“
Das war eiskalt gelogen. Zu jenem Zeitpunkt konnte Mia sich ja nicht nur vorstellen, dass sie eines fernen Tages möglicherweise wieder nach Bayern zog, sondern sie hatte sich sogar fest vorgenommen, der Hansestadt Bremen so schnell es nur irgend ging, den Rücken zuzukehren. Es müsste eben nur etwas Gras über die Sache in München gewachsen sein.
Kräftige Strahlen der Nachmittagssonne schienen ins Büro, als Mia aus ihrer kleinen Kaffeepause mit Harald zurückkam. Verträumt blieb sie einen Moment stehen und genoss den vertrauten Geruch von warmem Staub.
Dann nahm sie wieder am Schreibtisch Platz, um sich die restlichen drei Akten vorzunehmen. Den Kopf in die Hände gestützt, studierte sie den Weg der Kriminellen, die in den letzten Wochen und Monaten Straftaten in Bremen begangen hatten. Die letzte, unscheinbar blassrote Akte barg dabei den aktuellsten Fall: der gewaltsame und bisher noch ungeklärte Tod des Inhabers einer kleinen Werbeagentur in der Innenstadt. Seit einigen Tagen beschäftigten sich die Beamten und unvermeidbar auch die Bremer Medien mit dem Fall. Auch Mia hatte schon die eine oder andere Schlagzeile in aufmerksamkeitsgeilen Boulevardblättern gelesen, wenn sie beim Bäcker war oder im Supermarkt an der Kasse stand. „Tod in der schnelllebigen Werbebranche“ (das „lebig“ dabei kursiv und rot) oder „Auch der Mörder machte Überstunden“ waren die beiden Headlines, die ihr am meisten in Erinnerung geblieben waren, da sie an schreiberischer Raffinesse kaum zu überbieten waren, wie sie fand.
Interessiert vertiefte sie sich nun in die wahren Fakten und die bisherigen Ergebnisse der Ermittlungen. Bernd Knusen, der Inhaber der Werbeagentur K:Werbung wurde am Dienstagmittag der vorherigen Woche tot vor seinem Schreibtisch aufgefunden. Er hatte oft bis spät in die Nacht gearbeitet und war dann erst im Laufe des Vormittags in die Agentur gekommen. So hatte ihn bis zum Zeitpunkt seines Auffindens auch niemand vermisst. Seine Sekretärin hatte ihn entdeckt. In geschäftiger Eile wollte sie eigentlich nur schnell die persönliche Post in sein Büro bringen. Den Blick noch prüfend auf die Briefe gerichtet, ob wirklich nur die wichtigen Sendungen dabei waren, schritt sie durch den Raum und bemerkte die Leiche erst, als sie schon direkt davor stand. Ihr Schrei lockte nahezu die gesamte Belegschaft an, die sich um den Schreibtisch herum versammelte. Ein Grauen. Auch für die Kollegen der Spurensicherung.
Bernd Knusen starb an einer Kopfverletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung. Zunächst hätte man es für einen Unfall halten können, vielleicht war Herr Knusen schlichtweg über seine eigenen Füße gestolpert (in der Zeitung hieß es, er habe sich zu sehr an der goldbraunen Flüssigkeit aus der Glaskaraffe bedient, die auf dem kleinen Beistelltischchen unter dem Fenster stand – so läuft es schließlich in der Werbung), doch schnell wurde festgestellt, dass dem Ganzen eine Rangelei vorausging. Blutergüsse an den Schlüsselbeinen verrieten den aggressiven, wütenden oder verzweifelten Täter. Zudem wurden unter den Fingernägeln des Toten Hautreste gefunden, die nicht ihm selbst gehörten, was darauf schließen ließ, dass er vor seinem Tod jemanden gekratzt hatte. Gegen einen bloßen Unfall sprach zudem der üppige Blumenstrauß, den der Tote in der Hand hielt und der ihm erst nach seinem Tod in die Hand gedrückt wurde, wie die Kriminaltechniker betonten. Das Bild hatte schon etwas Gruseliges. Die Leiche mit dem frischen Blumenstrauß. Wie der Titel eines morbiden Gemäldes.
Mia zog sich eine Nahaufnahme des Tatorts heran, die sie in der Akte gefunden hatte, studierte sie eine Weile, schloss dann die Augen und versuchte, sich vorzustellen, wie es an jenem Tag am Tatort gewesen war. Es hatte Unordnung geherrscht. Der Geruch von Blut hatte wohl noch in der Luft gehangen, und das Opfer hatte inmitten einer Blutlache und fallengelassener Post gelegen. Nicht zu vergessen die vielen Fußabdrücke der Mitarbeiter, die nach dem entsetzten Aufschrei der Sekretärin herbeigeeilt waren, und eben der Blumenstrauß, der so gar nicht ins Bild gepasst hatte.
Mia sammelte ihre Gedanken und ging wieder einen Schritt zurück. Ein Detail hatte sie stutzig gemacht. Es hatte mit den angetrockneten Abdrücken in der Blutlache zu tun. Etwas stimmte hier nicht. Doch sie kam nicht drauf. Vorerst nicht.
Die Angestellten waren über den Mord oder vielleicht auch nur angesichts der Tatsache, dass sie den Vormittag über Wand an Wand mit ihrem leblosen Chef gearbeitet hatten, verständlicherweise verschreckt und erschüttert. Eine besonders sensible Praktikantin hatte sich sogar übergeben müssen. Zum Glück nicht direkt am Tatort. Die ätzende Magensäure hätte für die letzten Spuren, die sich vor den Füßen der angelaufenen Mitarbeiter retten konnten, den Rest bedeutet. Für einen anderen Angestellten wurde ein Notarzt gerufen, da er blass und starr vor sich hin stammelte und weder auf die ermittelnden Beamten noch auf seine Kollegen reagierte. Er war noch jung, hatte gerade erst die Schule beendet und sei für das bevorstehende Studium und dem vorab geforderten Praktikum erst vor kurzem zu Hause ausgezogen, gab er später zu Protokoll. Zu Hause war ein kleines Hundertseelendorf mitten in der Heide. Mit solchen Dingen sei er zuvor nie in Berührung gekommen. Ist das die Großstadt oder das Erwachsensein, hatte er noch gefragt und die Polizeibeamten damit in stotterndes Staunen versetzt.
„Mitarbeiter übermäßig schockiert?“ Eine kleine Notiz in akkuraten, kantigen Buchstaben, die vom Kollegen Andreas Paulsen stammte, klebte an der Innenseite des Aktendeckels. Mia stutzte erneut. Warum war ihm das wohl fragwürdig vorgekommen, grübelte sie. Aus eigener Erfahrung konnte sie durchaus bestätigen, dass starke Übelkeit bei Menschen, die mit dem Tod eher selten zu tun hatten, nicht unüblich war. Vor allem nicht, wenn die Leiche getrocknete Blutreste am Kopf kleben hatte und einen starr ansah, ja schon fast anglotzte. Bedauerlicherweise sprach Mia dabei wirklich von eigenen Erfahrungen. Eine sehr peinliche Sache, die ihr noch während ihrer Ausbildung passiert war und die sie nur selten erwähnte.
Stirnrunzelnd machte sie nun ebenfalls eine kleine Notiz und klebte ihn zur Anmerkung des Kollegen, um mit ihm am nächsten Tag darüber zu sprechen. „Was bedeutet ‚übermäßig schockiert‘?“, wollte sie von ihm wissen und war schon jetzt gespannt darauf, was Herr Paulsen dazu zu sagen hätte. Es konnte ein bloßes Gefühl sein, das sich nicht weiter erklären ließ. Genauso gut konnten es aber auch handfeste Indizien sein, die der Kollege herausgefunden hatte und aufgrund derer er das Verhalten im Team nur als ungewöhnlich beschreiben konnte.
Mit den weiteren Aussagen der Zeugen und den näheren Hintergründen würde sie sich morgen befassen, beschloss sie jetzt mit einem Blick auf ihre Armbanduhr, die ein Geschenk von ihrem Ex-Freund war und die sie längst hatte abnehmen wollen. Aber eigentlich mochte sie die schmale, filigrane Uhr zu sehr und brachte sie nur noch selten mit ihrer so desaströs gescheiterten Beziehung in Verbindung. Man konnte ja nicht alles verbannen, das irgendetwas mit dem Ex-Partner zu tun hatte, hatte sie sich eingeredet. Das würde doch bedeuten, ein paar Jahre seines Lebens komplett streichen zu müssen. Schließlich war man auch in der Zeit, die man gemeinsam verbracht hat, nicht nur Paar, sondern auch man selbst.
Aber den Verlobungsring, den muss ich wirklich noch zurückgeben, fiel ihr jetzt auf, als ihr Blick von der Uhr weiter zu ihrem Ringfinger gewandert war. In einem plötzlichen Anfall von Zukunftszuversicht nahm Mia ihn ab und verstaute ihn sorgfältig in einem kleinen Fach mit Reißverschluss in ihrem Portemonnaie. Dann betrachtete sie zufrieden ihren nackten Finger. „Es geht voran“, murmelte sie.
Herr Paulsen hatte sein Versprechen, Mia nach dem Seminar in Bremerhaven noch willkommen zu heißen, noch nicht eingelöst, aber sie glaubte nicht recht daran, dass er noch kam. Es war schon spät geworden, und es zog sie nach Hause. Nach Hause. Sie seufzte leise. Wie lange würde es wohl noch dauern, bis sie das ohne Seufzer zu Ende denken konnte? Bis sie nicht mehr daran erinnert würde, dass ihr Zuhause viele hunderte Kilometer weiter südlich lag?
Mia knipste das Licht aus, zog die Tür hinter sich zu und verabschiedete sich von den Kollegen, die im Schein ihrer Computerbildschirme und Schreibtischlampen noch arbeiteten. Während sie langsam zu ihrem Auto ging, suchte sie in der Handtasche nach dem Schlüssel und ihrem Handy, das sie im Laufe des Tages kein einziges Mal aus der Tasche geholt hatte. Als sie es nun in den Händen hielt, leuchtete ihr die Anzeige zweier Nachrichten und eines Anrufs von Unbekannt entgegen. Die erste Nachricht war von Mias Mutter. Sie hatte ihrer einzigen Tochter am Mittag per SMS einen schönen ersten Arbeitstag gewünscht, und auch ihre Freundin Caro hatte an sie gedacht und ließ sie wissen, dass sie ihr für ein Leben unter wortkargen Norddeutschen die Daumen drückte. Hrmpf, machte Mia unwillig und befand, dass auch das breit grinsende Emoji dahinter es nicht besser machen konnte. Wer angerufen haben könnte, wusste Mia allerdings nicht. Sie erwartete keinen Anruf. Schon gar nicht von unbekannter Nummer. Der oder diejenige würde es schon noch mal versuchen, dachte sie und steckte das Handy wieder ein.
Auf dem Weg zu ihrer Wohnung versuchte Mia dann wie schon am Morgen, sich markante Punkte, wie große Gebäude, Straßenkreuzungen oder besonders mächtige Bäume einzuprägen. Einiges erkannte sie tatsächlich wieder, stellte sie erfreut fest und fühlte sich fast ein wenig heimisch, als sie das letzte Stück auch ohne die blecherne Stimme ihres Navis geschafft hatte. Ein Kollege, der in der Nähe wohnte, hatte ihr morgens beim Umtrunk vorgeschlagen, mal gemeinsam mit dem Rad zu fahren. Herrlich sei das, hatte er gesagt, die frische Luft am Morgen, ein Stück an der Weser lang, richtig ausgeruht käme man so bei der Arbeit an.