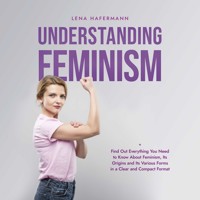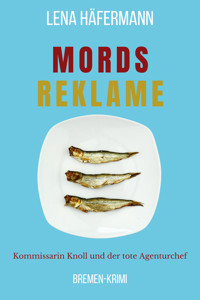1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jule braucht eine Auszeit. Die stressgeplagte Eventmanagerin kehrt auf die idyllische Insel Friesum zurück, um den Kopf freizubekommen und sich zu erholen – doch schon bald kommt alles anders. Der beliebte Friesumer Weihnachtsmarkt steht vor dem Aus, und Jule kann nicht tatenlos zusehen. Mit kreativen Ideen und großem Engagement versucht sie, Sponsoren zu gewinnen und den Markt zu retten. Dabei dreht sich alles um eine alte Sage: die Friesumer Weihnachtsfeder, die einst für Hoffnung und Gemeinschaft sorgte. Doch nicht alle Inselbewohner sind begeistert von Jules Vorhaben. Besonders Tischler Thies hält nichts von den alten Bräuchen – zu viele Erinnerungen an schmerzhafte Verluste. Kann Jule den Glauben an das Weihnachtswunder zurück auf die Insel bringen und Thies zeigen, dass die Sage mehr ist als nur eine Geschichte? Und wird es ihr gelingen, seinem verlorenen Lächeln neues Leben einzuhauchen – und dabei auch ihre eigene Seele retten? Eine herzerwärmende Geschichte über Liebe, Zusammenhalt und die Magie der Weihnachtszeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lena Häfermann
Weihnachten auf Friesum
Cover erstellt mit canva.comInhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Impressum
Kapitel 1
Weihnachten, die besinnlichste Zeit im ganzen Jahr. Jule seufzte schwer und fragte sich, wer das eigentlich mal bestimmt hatte. Mehr noch: wer sich das ausgedacht hatte und nun Generation um Generation dazu verdonnerte, spätestens ab Mitte November besonders besinnlich zu sein. Sie ließ ihren Kopf auf ihre gekreuzten Arme sinken, die sich zwischen Tastatur, Kaffeetasse und Papierstapeln, die in ihrem modernen papierlosen Büro eigentlich längst der Vergangenheit angehören sollten, einen Platz freigeschaufelt hatten. Ihr Rücken schmerzte. Die ungewollte Dehnung, die sie ihrer Wirbelsäule und all den Muskeln auf ihrer Rückseite nun mit der ungewohnten Vorbeuge zumutete, verschlimmbesserte das nur. Doch Jule blieb liegen. Sie wollte das Chaos auf ihrem Schreibtisch nicht sehen. Nicht die zahllosen Emails auf ihrem Monitor mit An- und Nachfragen. Pling. Wieder eine digitale Erinnerung daran, dass sie zu arbeiten hätte und dass es Menschen gab, die etwas von ihr wollten. Pling. Noch eine E-Mail. Pling, pling. Gleich zwei auf einmal. Sie hätte den Ton ausstellen sollen.
Jule atmete schwer. Sie fühlte sich mit einem Mal unendlich erschöpft und müde. Waren das zwei Begriffe, die den gleichen Gemütszustand beschrieben? War müde das gleiche wie erschöpft? War man immer, wenn man erschöpft war, auch müde? Jule kam zu ihrer Eingangsfrage zurück. Was zur Hölle sollte das sein – besinnlich? Sie konnte sich nicht auf den Geist der Weihnacht besinnen, nicht auf Jesus, nicht auf ihre eigene Familie. Sie wurde schier wahnsinnig in der Zeit, in der es überall dudelte und duftete. In der man sich nach Feierabend mit Freunden oder Kollegen auf dem Weihnachtsmarkt traf, um klebrig süße Feuerzangenbowle zu trinken. Wenn die Schwester zum Adventsbrunch einlud und darum bat, etwas Besonderes mitzubringen. Jule dachte, dass sie Glück hatte, wenigstens in diesem Jahr Single zu sein. Letztes Jahr hatte sie um diese Zeit noch zusätzlichen Stress damit gehabt, einen Adventskalender für ihren Freund Olaf zu basteln und zu bestücken, weil alle in ihrem Instagram Feed das für ihren Lieblingsmenschen taten. Ein Kalender, der dann in der eleganten Wohnung in dem perfekten Wohnzimmer über der beige-creme-weißen Cord-Couch aufgehängt wurde. Eine Wohnung, die im Advent durch stilvolle und am besten selbst gebastelte Deko noch verschönert wurde. Das erledigten diese Menschen dann so nebenbei. Neben Familienleben, Sportprogramm, Haushalt und Job. Sie selbst war froh, wenn sie es einmal die Woche ins Fitnessstudio schaffte. Ihre Einkäufe ließ sie sich liefern. Ihr Sozialleben tendierte in stressigen Zeiten wie November und Dezember gegen Null. Und ihre Wohnung war sowieso viel zu bunt und zu unaufgeräumt, um sie öffentlich auf Social Media zu zeigen, aber den Druck, ihrem Partner eine schöne Adventszeit zu bereiten, hatte sie im letzten Jahr trotzdem gespürt.
Ob Olaf in diesem Jahr wohl wieder jeden Tag ein Türchen öffnen könnte? Liebevoll hergerichtet von seiner neuen Freundin, die er im Frühling beim Ostermarkt kennen- und offenbar ziemlich schnell lieben gelernt hatte? Jule wusste es nicht. Sie könnte nachgucken. Der Account von Hanna war öffentlich. Sie liebte es, ihr Leben und ihre Liebe jedermann und jederfrau unter die Nase zu reiben. Auch, wenn Jule glaubte über die Enttäuschung, angerichtet von Olaf und Hanna, hinweg zu sein, juckte es ihr in den Fingern, mal eben nachzusehen, was die beiden trieben.
Zum Glück klopfte es jetzt an der Tür und hielt sie von ihrem Vorhaben ab. Mühsam richtete sie sich auf und rief krächzend: „Ja bitte?“
„Ich bin es nur.“ Ihre Kollegin Rita schob sich in den Raum. Mit der rechten Hand versuchte sie, zwei Becher gleichzeitig zu tragen und gerade zu halten. Mit der anderen Hand schob sie die Tür wieder hinter sich zu. „Tee?“
Jule nickte.
„Du siehst müde aus. Nein, eigentlich sogar richtig erschöpft.“
Erschöpft war also die Steigerung von müde.
„Bin ich auch“, gab Jule zu. Jetzt, da sie wieder aufrecht saß, stellte sie rasch den Ton ihres Laptops ab, der vom letzten Call mit einer Kundin noch angestellt war. Sie wollte die eingehenden Nachrichten nicht länger hören müssen.
Rita kam näher, ließ die Tasse über dem Schreibtisch schweben, weil sie keine freie Stelle entdecken konnte, und stellte sie schließlich kurzentschlossen auf einem Angebot für eine Weihnachtsfeier mit 25 Personen ab.
„Hey“, protestierte Jule. „Das muss ich noch rausschicken.“ Vorsichtig nahm sie den Becher wieder hoch und legte das Schriftstück beiseite. Nicht ohne zu prüfen, ob die Tasse Flecken oder Abdrücke hinterlassen hat.
Rita verfolgte das kopfschüttelnd. „Wir haben bereits Anfang Dezember! Wem willst du denn so kurzfristig noch eine Weihnachtsfeier anbieten?“ Streng sah sie Jule an.
„Friemel Industriebedarf.“
„Und wer soll das bitte schön planen?“ Statt einer Antwort warf Jule ihr einen langen Blick zu.
„Ich weiß, was das bedeutet. Du übernimmst dich wieder mal.“ Rita schien zu überlegen, ob es etwas bringen würde, zu schimpfen. Sie entschied sich dagegen und ließ merklich die Schultern hängen. Jule wusste, dass sie ihr manchmal Sorgen bereitete. Rita war ein großer Fan einer gelungenen Work-Life-Balance. Jule im Grunde auch. Allerdings eher in der Theorie. Was sollte sie auch tun? Die Arbeit wurde und wurde nicht weniger. Egal, wie sehr sie sich anstrengte und bemühte. Immer waren am Ende des Tages noch Aufgaben übrig. Sie war Geschäftsführerin einer Event-Agentur namens Better Events. Jetzt, zu Ende des Jahres, war naturgemäß die Hölle los: große Weihnachtsfeiern, gemütliche (besinnliche!) Meetups, Silvesterpartys, Winterhochzeiten für Menschen, die Steuern sparen wollten. Es nahm kein Ende. Jule wusste überhaupt nicht mehr, wo ihr der Kopf stand. Gestern Abend, als sie im Büro noch die Angebote geprüft hatte, die vom Azubi vorbereitet worden waren, hatte sie plötzlich entsetzliches Herzrasen bekommen. Sie hatte Schweißausbrüche, die sich auch vor dem geöffneten Fenster nicht hatten bändigen lassen. Ihre Kehle war eng geworden und sie hatte fürchterliche Angst davor gehabt, gerade einen Herzanfall zu erleiden. Es hatte sich angefühlt, als hätte sie ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle. Kein gutes Gefühl! Als sie schon das Telefon in der Hand hatte, um sich selbst einen Krankenwagen zu rufen, hatten die Symptome mit einem Mal nachgelassen. Jule hatte trotzdem noch eine gute Stunde im Büro verbracht, unfähig, aufzustehen und nach Hause zu fahren. Sie hatte niemandem davon erzählt. Ihrer Schwester nicht, der sie sonst alles erzählte. Ihren Eltern nicht. Sie wollte nicht, dass sich jemand Sorgen um sie machte. Jetzt schielte sie zu Rita. Vielleicht würde sie es verstehen.
Ihre Kollegin stand am Fenster und sah hinaus. Rita gehörte seit Jahren zu ihren besten Freundinnen. Sie hatten sich bei der Arbeit kennengelernt. Erst war es ein wenig seltsam gewesen, sich anzufreunden, weil Jule ihre Chefin war und sie eingestellt hatte. Doch Rita machte sich nichts aus Hierarchien. Mit ihrer unbekümmerten Art sorgte sie dafür, dass es Jule bald ebenso ging. Zunächst gingen sie nur hin und wieder zusammen Mittag essen. Bald war es ein Glas Wein nach Feierabend. Und dann unternahmen sie schließlich auch immer mal wieder am Wochenende etwas zusammen. Rita und Jule waren im gleichen Alter. Beide Mitte 30. Sie hatten so viel gemeinsam, dass es fast ungehörig gewesen wäre, sich nicht anzufreunden. Rita war auf Usedom aufgewachsen, Jule auf der Nordseeinsel Friesum. Jule hatte eine ältere Schwester namens Annabelle, die alleinerziehend war und in der gleichen Stadt lebte. Rita hatte einen größeren Bruder, mit dem sie sich sogar eine Wohnung teilte. Sie mochten beide klassische Musik, gingen nicht gern ins Kino, ernährten sich vegetarisch mit gelegentlichen Ausnahmen und konnten beide einen überaus grünen Daumen vorweisen. Allerdings unterschieden sie sich äußerlich: Rita war groß und schlaksig, hatte rotes lockiges Haar und trug fast immer Schwarz. Jule war brünett, durchschnittlich groß und liebte alles, was Farbe hatte.
Jetzt war es 17 Uhr. Draußen war es dunkel, die Schneeflocken sausten im Dezemberwind von rechts nach links. Auch sie tanzten nicht besinnlich, wie sich das eigentlich gehörte, fiel es Jule von ihrem Schreibtisch aus auf. Sie öffnete schon den Mund, um Rita von ihrem Anfall am Abend zuvor zu berichten, da entschied sie sich doch dagegen. Nach ihrer Recherche schien es sich um eine Panikattacke gehandelt zu haben. Etwas, das sich furchtbarer anfühlte, als es für den Körper eigentlich war. Das hatte sie zumindest aus den Blogartikeln, die sie durchforstet hatte, herausgelesen. Was man dagegen tun konnte? Zur Ruhe kommen. Und dafür hatte Jule gerade gar keine Zeit.
„Wo bleibst du denn? Ich warte schon seit mindestens 20 Minuten auf dich. Lola ist schon ganz ungeduldig…“ Als Jule die Stimme ihrer großen Schwester durch das Telefon hörte, fuhr ihr ein Schreck in die Glieder. Lola und das Theater! Sie hatte die Verabredung komplett vergessen. Dabei stand der Termin schon seit Wochen fest. So ein verdammter Mist! Die Karten hingen noch unter dem Magneten an ihrem Kühlschrank. Panisch warf sie einen Blick auf die Uhr. Halb sieben. Die Vorstellung würde um sieben Uhr beginnen, wenn sie sich recht erinnerte. Mist, Mist, Mist, wiederholte sie innerlich fluchend, während sie ihrer Schwester weiterzuhörte, die mindestens genauso ungeduldig war wie ihre Tochter, weil sie nämlich in der Zeit, in der sie ihre Tochter bei ihrer Schwester wähnte, ein Date mit Paul hatte. Annabelle kannte Paul bisher nur vom Schreiben, aber er war mal wieder der Eine. Jule kannte das bereits. Trotzdem freute sie sich jedes Mal aufrichtig und litt gehörig mit, wenn sich der Eine als Null herausstellte. Mit Paul sollte das nun alles anders sein. Er war nicht nur gutaussehend (seinem Profilbild zufolge), ein paar Jahre älter als Annabelle, mit solidem Job in einem Planungsbüro, er war außerdem ebenfalls alleinerziehend mit einem Sohn namens John. Die Mutter war Engländerin, daher der Name. Sie war jedoch vor zwei Jahren nach London zurückgekehrt und wollte weder Paul noch John mitnehmen. Paul war das recht gewesen. Zumindest letzteres. Denn er hätte sonst, nach eigenen Aussagen, mit allen Mitteln um das Sorgerecht gekämpft. Bei Annabelle hatte er damit bleibenden Eindruck hinterlassen. Und bei Jule auch, das musste sie zugeben. „Ich beeile mich“, rief sie in den Hörer, legte auf und warf das Handy in ihre Handtasche. Dann zog sie sich hektisch die Winterstiefel an, die sie nach dem allgemeinen Feierabend, als niemand von den Angestellten mehr im Büro war, ausgezogen hatte, um sie gegen gemütliche Plüsch-Puschen auszutauschen. Nebenher fuhr sie den Computer herunter und löschte das Licht.
Draußen empfing sie winterliche Nässe. Die weißen Flocken waren längst matschigen Pfützen und einer graubraunen Farbe gewichen. Die Straßen waren voll. Alle wollten in die Stadt, um Weihnachtsgeschenke einzukaufen oder dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abzustatten. Es nieselregnete. Die Temperaturen näherten sich dem Gefrierpunkt. Alles in allem ein Abend fürs Sofa und den Lieferdienst. Oder, in Jules Fall, Überstunden im Büro. Als endlich ein Taxi neben ihr hielt, das frei zu sein schien, dankte Jule einem Gott, an den sie eigentlich gar nicht glaubte. Sie öffnete die Tür, da hörte sie ihr Handy wieder klingeln und ging ran.
„Wo bist du denn?“, hörte sie Pascal, ihren Geschäftspartner, fragen. „Wir warten auf dich.“
Siedend heiß fiel Jule ein, dass sie zu einem Geschäftsessen mit einer befreundeten Agentur zugesagt hatte. Es galt, zu besprechen, wie sie in Zukunft zusammenarbeiten könnten und Pascal hoffte, die andere Agentur, die derzeit etwas schwächelte, übernehmen zu können. Daher sagte er jetzt eindringlich: „Du weißt, wie wichtig dieser Termin für uns sein könnte, Jule.“
„Was ist denn nun, junge Frau? Rein oder raus? Ich habe noch andere Kunden“, blaffte der Taxifahrer da in Jules anderes Ohr.
„Es ist schon 20 vor sieben“, fügte Pascal hinzu. „Wir waren halb sieben verabredet.“
„Tür zu!“, rief der Taxifahrer. „Von außen!“
20 vor sieben Uhr, dachte Jule. Das schaffte sie niemals bis in die Wohnung, zum Kühlschrank, dann zu Annabelle und weiter bis zum Theater im anderen Teil der Stadt. Wie hatte sie das nur vergessen können?
Plötzlich begann die Welt, sich zu drehen. „Kommst du noch?“, hörte sie Pascal sagen. „Junge Frau, ist Ihnen nicht gut?“, brummte der Fahrer.
Es hatte wieder zu schneien begonnen. Die Flocken fielen auf Jule herab. Und jetzt tanzten sie wirklich. Immer im Kreis. Immer schneller und schneller. Ein letzter Gedanke galt Lola. Jule hasste es, die Menschen, die ihr lieb waren, zu enttäuschen.
Kapitel 2
„Meine Güte, Puschi, wir haben uns solche Sorgen gemacht!“ Puschi, das war der Spitzname ihrer Schwester für sie. Schon seit Kindesbeinen. Der Nachbarshund trug damals den gleichen Namen, und Annabelle fand, Jules Frisur hätte Ähnlichkeit mit seinem Fell. Schmeichelhaft war etwas anderes.
Ermattet sah Jule ihre Schwester an. Sie lag in einem Krankenzimmer. Ihre private Krankenkasse ermöglichte ihr, trotz der aktuell vollen Belegung durch Stürze und Infektionen bei rutschigem, nasskaltem Wetter, ein ruhiges Einzelzimmer. Wenigstens dafür lohnte sich der satte Betrag, den sie monatlich zu zahlen hatte. Vorsichtig befühlte Jule ihren Kopf, der sich nicht entscheiden konnte, ob er dröhnen, brummen oder hämmern sollte. Sie spürte einen Verband und einen schmerzhaften Stich, als sie darauf fasste.
„Was ist denn passiert? Der Pfleger meinte, ich sei gefallen?“ Jule erinnerte sich nicht mehr. Alles, was sie wusste, war, dass sie überstürzt aus dem Büro geeilt war, um mit ihrer Nichte ins Theater zu fahren. Sie wollte noch die Karten aus ihrer Küche holen. Ein Taxi hatte neben ihr gehalten. Dann war da noch etwas. Ein Anruf?
„Ja, genau. Du bist böse gefallen.“ Annabelles mitfühlender Blick lag auf ihr. „Direkt auf die Bordsteinkante. Du hast eine leichte Gehirnerschütterung. Aber es hätte wohl schlimmer ausgehen können, sagt die Ärztin. Ich habe gerade mit ihr gesprochen.“
Was für einen Anruf hatte sie bekommen? War er wichtig gewesen?
„Hörst du mir überhaupt zu?“
„Pascal“, rief Jule entsetzt. „Oh nein. Ich muss ihn unbedingt zurückrufen. Wo sind meine Sachen? Wo ist mein TELEFON?“, rief sie schrill und zuckte zusammen, als ein überwältigender Schmerz in ihrem Kopf über ihr zusammenbrach.
Mit einem Satz war Annabelle neben ihr und drückte sie behutsam aufs Bett. „Deine Tasche mit all deinen Habseligkeiten liegt da drüben im Schrank. Aber du wirst jetzt niemanden anrufen. Du bleibst erstmal hier liegen und ruhst dich mindestens eine Stunde lang aus, ehe du dich wieder um die Belange deiner Firma kümmerst.“ Sie seufzte, wohl angesichts dessen, dass ihr diese popelige Stunde viel zu kurz und Jule viel zu lang erschien.
„Sie brauchen mich doch“, unternahm Jule einen lahmen Versuch, ihre Schwester, die sich wie eine Barrikade zwischen dem Krankenbett und dem Schrank mit dem Telefon aufgebaut hatte, umzustimmen.
„Ich brauche dich auch“, entgegnete sie ungerührt. „Und Lola auch. Du hast uns gestern einen Riesenschrecken eingejagt, Schwesterherz! Erst kommst du nicht, wir warten und warten, und dann geht auch noch irgend so ein schnoddriger Taxifahrer an dein Handy, der uns erklärt, dass du gerade in den Krankenwagen geschoben wirst!“ Annabelles Stimme war laut geworden. „Mir ist das Herz stehen geblieben“, schimpfte sie weiter. Dann, als ihr bewusst wurde, dass sie ihre kränkliche Schwester besser nicht aufregen sollte, lenkte sie ein: „Wir sind sehr froh, dass dir nichts Schlimmeres passiert ist.“ Sie sah zu einem üppigen Strauß Winterblumen, der in einer wenig passenden Vase mit Marienkäfermotiven neben Jules Bett auf dem Nachttischchen stand. „Von Pascal“, erklärte sie und wies mit dem Kinn auf den Strauß. „Er hat sich auch Sorgen gemacht. Du bist während eures Telefonats umgefallen, sagt er. Es hat gerumst und dann hast du nichts mehr gesagt.“
Jule seufzte. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mich zu entschuldigen.“ „Bei niemandem“, ließ sich da eine Pflegerin vernehmen, die unbemerkt von den beiden Schwestern ins Krankenzimmer getreten war. Sie überprüfte den Tropf und warf Annabelle einen misstrauischen Blick zu: „Regen Sie Ihre Schwester etwa auf?“
„Nein, nein“, erwiderte sie sofort und hob in einer unschuldigen Geste die Hände. „Ich halte sie sogar davon ab, ihr Telefon zu holen und zu arbeiten“, erklärte sie mit einem gewissen Stolz in der Stimme.
„So ist es recht.“ Die Frau hatte das resolute Auftreten einer Oberschwester. Sie war klein und kräftig. Die grauen Haare trug sie in einem ordentlichen Nackenknoten. Die blauen Augen, die mit zahlreichen Lachfältchen umrahmt waren, milderten den strengen Eindruck erheblich. „Sie müssen sich schonen“, erklärte sie Jule mit einem freundlichen Lächeln. „Ich sehe hier so viele Menschen, die sich abrackern und schließlich zusammenbrechen. Das sind Warnsignale Ihres Körpers, Frau Fredriksen. Warnsignale! Beim nächsten Mal geht es vielleicht nicht so glimpflich aus. Sie haben ohnehin Glück gehabt. Der Aufprall hätte wesentlich Schlimmeres verursachen können als eine Gehirnerschütterung.“
„Ich weiß“, murmelte Jule. Fast hätte sie ‚Entschuldigung‘ gesagt, so mahnend hatte die Schwester gesprochen.
„Benötigen Sie noch etwas?“, fragte die Pflegerin dann. Als Jule mit vorsichtigen Bewegungen den Kopf schüttelte, verschwand sie wieder, nicht ohne Annabelle vorher noch einen warnenden Blick zuzuwerfen: „Passen Sie auf sie auf!“
Als sie wieder allein waren, fragte Jule: „Ist Lola sehr traurig, dass ich nicht mit ihr im Theater war?“
Annabelle lachte auf: „Die ist vor allem froh, dass du wieder gesund wirst!“
„Und Pascal? Hat er etwas gesagt?“, wollte Jule dann wissen. „Hast du mit ihm gesprochen?“ Sie fühlte sich unruhig. Die Theaterkarten waren verfallen. Ihre Nichte hatte das Stück verpasst, auf das sie sich seit Wochen gefreut hatte. Über Pascal wollte sie eigentlich gar nicht nachdenken. Nicht nur, dass sie ein wichtiges Geschäftsessen vergessen hatte, sie ließ ihn außerdem in der hektischsten Zeit des Jahres mit der Firma allein.
„Wie spät ist es überhaupt?“, fragte sie dann, als ihr auffiel, dass sie jegliches Zeitgefühl verloren hatte. „Und welchen Tag haben wir?“
„Es ist Mittwochvormittag. Du bist erst gestern Abend gestürzt“, erklärte ihre Schwester behutsam. „Keine Sorge. Du liegst hier noch nicht seit Tagen ohnmächtig im Krankenhaus.“ Sie nahm auf der Bettkante Platz und griff nach Jules Hand. „Warum hast du mir nicht erzählt, dass es dir nicht gut geht?“, wollte sie dann wissen. „Ich kann dir doch helfen. Du weißt, ich bin immer für dich da.“ Ihre Stimme zitterte. Annabelle war nah am Wasser gebaut. Dass ihre Liebsten unbemerkt von ihr in eine Krise schlitterten, war nichts, was sie auf die leichte Schulter nehmen konnte. Wie Jule fühlte auch sie sich immer verantwortlich.
„Du hast dein Date verpasst“, fiel es Jule ein. Wieder etwas, das sie unruhig werden ließ. Hätte sie doch nur besser auf sich aufgepasst und den Warnschuss ihres Körpers am Vorabend nicht einfach ignoriert, hätte sie die Karten nicht am Kühlschrank vergessen, hätte sie den Geschäftstermin nicht verpasst, hätte sie die Uhr im Blick behalten und sich rechtzeitig ohne Stress auf den Weg gemacht, hätte, hätte, hätte, dann hätte Annabelle vielleicht einen wirklich schönen Abend verlebt. Nach dem Drama mit Lolas Vater und den vielen Fehlgriffen, die sie seither unternommen hatte, hätte Jule ihr das von Herzen gegönnt. Jetzt liefen ihr die Tränen über die Wangen. Annabelle stimmte aus schwesterlichem Mitgefühl gleich mit ein.
„Warum weinen wir?“, fragte sie nach einer Weile.
Unter Tränen musste Jule lachen. „Weil alles Mist ist.“
„Nein. Ist es nicht“, widersprach Annabelle da und wischte sich energisch über das Gesicht. „Du ruhst dich jetzt erstmal schön aus. Ich gehe in die Stadt und besorge uns Baumkuchen und Vanillekipferl. Dann komme ich mit Lola wieder und wir machen uns einen richtig gemütlichen Nachmittag. Und wir besprechen, wie und wo du dich am besten erholen kannst. Keine Widerrede“, rief sie, als sie sah, dass Jule den Mund öffnete. Annabelle drückte ihre Schwester sachte an sich, dann schlüpfte sie in ihren Mantel und schlang den bunten Wollschal, den sie selbst gestrickt hatte, mehrfach um den Hals. Ehe sie ging, marschierte sie doch noch zum Kleiderschrank und holte Jules Handy hervor. „Aber verrat mich nicht“, sagte sie und legte den Zeigefinger auf den Mund. „Wenn man dich erwischt, hast du es dir selbst aus dem Schrank geholt.“
Jule grinste verschwörerisch und nickte. „Natürlich“, gab sie zurück. „Danke dir.“
„Versprich mir, dass du nur das Nötigste machst“, bat Annabelle noch mit einem Seufzer, ehe sie ihre Schwester allein ließ.
Jule und Annabelle sahen einander so ähnlich wie Zwillingsschwestern. Die vier Jahre, die sie trennten, sah man ihnen zu Annabelles Freude kaum an. Sie teilten ihre Vorliebe für bunte Farben, waren von schlanker Statur und trugen ihr Haar in der gleichen Länge: Jule in mausbraun, Annabelle in blond. Auch die blauen Kulleraugen, die etwas zu groß geratene Nase und der breite Mund waren ihnen gemein. Während sie sich äußerlich bis auf die Haarfarbe fast wie ein Ei dem anderen glichen, waren sie in ihrem Wesen so unterschiedlich, wie es nur ging: Jule gründete nach dem Studium der Betriebswirtschaft umgehend ein eigenes Unternehmen und führte ihr gesamtes Leben stets zielstrebig und mit Bedacht. Beziehungen hielten meist nicht lange, sie war, wie man so schön sagte, mit der Arbeit verheiratet. Annabelle war ein Familienmensch und von jeher der Freigeist der Fredriksens. Sie liebte es, zu reisen, mal dieses und mal jenes zu studieren und sich vom Leben treiben zu lassen. Mittlerweile hangelte sie sich von Job zu Job. Aktuell arbeitete sie in einer Drogerie als Aushilfe. Man könnte meinen, eben jene Unterschiede ließen es kaum zu, dass sich die beiden Schwestern gut verstanden, doch genauso war es. Jede von ihnen entdeckte an der anderen Charakterzüge, die sie an sich selbst manchmal vermisste. Jule dachte oft, sie müsste mal etwas lockerlassen. Nicht so versessen auf den Erfolg sein. Die Fünfe gerade sein lassen, anstatt alles zu durchdenken und dreifach zu prüfen. Im Beisammensein mit ihrer Schwester fiel ihr das Loslassen leichter. Die Stunden, die sie mit Annabelle und Lola verbrachte, hinterließen bei ihr ein Gefühl von Freiheit, Ruhe und Familie. Annabelle hingegen schätzte Jules Ernsthaftigkeit. Ihren Sinn für Logik und für Pläne. Immer dann, wenn er ihr selbst abhandengekommen war. Als sie festgestellt hatte, dass sie schwanger war, war es vor allem Jule gewesen, die ihr beigestanden und ihr gute Ratschläge gegeben hatte. Alex, Lolas Vater, war im Grunde ein lieber Kerl, nur eben noch freiheitsliebender als Annabelle. Sein Leben an der portugiesischen Küste aufzugeben, um in Deutschland ein Kind großzuziehen, war nicht das, wonach ihm der Sinn gestanden hatte. Und so hatte Annabelle es auch nicht gewollt.
„Juleeee“, rief Lola und rannte auf das Bett zu. Jule, die eingenickt war, rappelte sich auf und schloss ihre Nichte in den Arm.
„Na du Rabauke“, grüßte sie zärtlich. „Wie war die Schule?“
„Wie immer“, gab Lola Auskunft. „Wir haben einen Test in Mathe zurückbekommen. Ich habe eine Eins!“
„Und das ist ‚wie immer‘?“, wiederholte Jule lachend.
Lola zuckte mit den Schultern. „Mathe macht mir eben Spaß. Geht es dir wieder gut?“, wollte sie dann wissen und beäugte den Tropf und den dünnen Schlauch, der in der Haut auf Jules Hand verschwand. Sie verzog das Gesicht. „Tut das weh?“
„Nein, überhaupt nicht“, beruhigte Jule sie.
„Und dein Kopf?“ Sie wies auf den Verband.
„Ein bisschen“, gab Jule zu. „Bist du traurig, weil wir nicht im Theater waren?“
Lola schüttelte mit dem Kopf. „Nein. Samira hat gesagt, es war langweilig.“
Samira war Lolas beste Freundin seit der ersten Klasse. Jetzt gingen sie gemeinsam in die Fünfte und Annabelle machte sich manchmal darüber Sorgen, dass die beiden zu sehr aneinander hingen. Wenn mal eine von beiden sitzenbleiben würde oder eine Sportart anfinge, die die andere nicht mochte, wäre das Drama sicher groß.
Jule musste sich ein Schmunzeln verkneifen. „Na, da bin ich aber froh.“
Lola zog ihre Winterjacke auf, die sie auf den Besucherstuhl legte, und setzte sich zu ihrer Tante. Annabelle begann, aus ihrer Tasche Plätzchen und den versprochenen Baumkuchen zu holen. Sogar an Kaffee hatte sie gedacht, wie Jule jetzt erst bemerkte, obwohl sich der verlockende Geruch schon seit ihrem Eintreten im Zimmer verteilt hatte.
Jules Magen machte ein freudiges Glucksen, das Lola lachen ließ. „Du hast wohl Hunger.“
„Das ist ein gutes Zeichen“, fand Annabelle.
„Das Mittagessen habe ich ausfallen lassen“, verriet Jule. „Ich habe geschlafen.“
Wieder nickte Annabelle beifällig. „Auch ein gutes Zeichen. Ich hatte schon Angst, du würdest es mit der Arbeit übertreiben.“ „Nein, nein“, antwortete Jule auch sofort. „Ich habe tatsächlich nur mit Pascal telefoniert und eine Weiterleitung meiner Mails eingerichtet.“
Pascal Dietermeier war Jules bester Freund seit dem ersten Tag im BWL-Studium. Nervös hatten sie beide draußen vor dem Hörsaal gestanden, in dem die erste Vorlesung stattfinden sollte: Einführung in die betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Jule, die von einer kleinen Insel stammte, hatte sich schrecklich unwohl gefühlt. Sie war erst seit ein paar Tagen in der Stadt, die ihr laut und ziemlich schmutzig vorkam. Sie hatte Heimweh und wollte sich mit diesem kindischen Gefühl niemandem anvertrauen, was sie noch einsamer machte. In der Hoffnung, beim Rauchen vor der Tür schneller mit jemandem in Kontakt zu kommen, hatte sie ihre erste und letzte Packung Zigaretten gekauft.
„Blöd, so ganz allein, was?“ Das war Pascals Bemerkung, nachdem er sie wohl schon einen kurzen Moment beobachtet hatte. Viele ihrer Kommilitonen hatten bereits in Grüppchen beieinandergestanden. Sie beide waren die einzigen, die allein von einem Fuß auf den anderen getreten waren und an der Zigarette gezogen hatten.
Überrascht hatte sie aufgesehen. Pascal hatte ihr ein unsicheres Grinsen geschenkt. Eine leichte Röte hatte sein Gesicht überzogen, als sie nicht sofort geantwortet hatte. Sie waren im gleichen Alter, Erstsemester, die Schule gerade erst abgeschlossen.
„Stimmt“, hatte Jule schließlich lächelnd zugegeben. Aufatmend war Pascal nähergetreten, sie hatten sich einander vorgestellt und waren binnen weniger Minuten ein Herz und eine Seele gewesen. Sie teilten den Sinn für schwarzen Humor, fanden die gleichen Kommilitonen doof und oft die gleichen Männer gut, entdeckten Parallelen in der Herkunft und waren sich bereits im zweiten Semester sicher, dass sie gemeinsam eine Firma gründen würden. Sie entwarfen Ideen, schmissen Einfälle wieder über den Haufen, feilten an innovativen und bahnbrechenden Konzepten und entschieden sich schließlich dafür, das Rad doch nicht ganz neu zu erfinden. Als sie im Ausschuss für die Abschiedsfeier eines beliebten Dozenten, der an die Harvard University wechseln sollte, saßen und ihre Talente für Planung und Delegation entdeckten, beschlossen sie, neben dem Studium eine kleine Eventagentur zu gründen. Es war als Test gedacht. Als Probe und Nebeneinkommen. Doch sie hatten Erfolg. Schon bald gab es mehr Anfragen als sie bearbeiten konnten. Zunächst arbeiteten sie mit einer freiberuflichen Hochzeitsplanerin zusammen, als sie die Flut der Aufträge nicht mehr bewältigen konnten, dann mit einer Arbeitsvermittlung und schließlich wagten sie es, Aushilfen einzustellen. Sie machten einen Schritt nach dem anderen. Keiner von beiden preschte vor. Wie so oft waren sie auch in Bezug auf die unternehmerischen Entscheidungen stets auf einer Wellenlänge. Erst seit Kurzem, seit Pascal mit Jens zusammen war, einem in Jules Augen erstaunlich überheblichen Unternehmensberater, von dem sie sich immer wieder fragte, was es war, das Pascal in ihm sah, gab es hin und wieder Knatsch. Pascal strebte nach oben und spielte mit dem Gedanken, weitere Agenturen zu übernehmen, ihr Portfolio zu vergrößern und bundesweit Dependancen zu schaffen. Jule wurde das zu viel. Sie hätte es lieber gehabt, sich auf eine Stadt und eine Dienstleistung zu konzentrieren. Sie hatte ohnehin viel zu oft das Gefühl, alles würde ihr über den Kopf wachsen. Wie sollte sie da mehrere Büros überblicken? Wie sollte sie Chefin für Mitarbeiter sein, die 400 Kilometer entfernt saßen, die sie selten bis nie zu Gesicht bekam und von denen sie nichts Persönliches wusste, weil man das seiner Chefin eben nicht mehr anvertraute, wenn man nur einer von sehr vielen war?
Zum Glück konnten die aufkeimenden beruflichen Differenzen zwischen Pascal und ihr nicht die innige Verbundenheit lösen, die sich über all die Jahre zwischen ihnen aufgebaut hatte. Zwar schaffte er es an diesem Tag nicht mehr, Jule zu besuchen, doch sein Ton am Telefon war unmissverständlich gewesen: „Du ruhst dich bis Ende des Jahres aus!“, hatte er verlangt. Auf Jules ungläubiges Lachen hatte er gesagt: „Lach du nur. Ich meine es ernst. Ehrlich Jule, du musst auf dich achtgeben. Wem hilfst du, wenn du vor lauter Stress und unerledigten Aufgaben einfach umklappst?“
Darauf hatte Jule keine Antwort gehabt. Jetzt fragte sie sich allerdings wieder einmal, warum es nur ihr so ging. Pascal schien das gestiegene Arbeitspensum nichts auszumachen. Mehr noch: er blühte förmlich auf, je mehr zu tun war. Dass er sie nicht spüren ließ, zu welch unpassendem Zeitpunkt ihr Ausfall kam, rührte sie. Sie wusste, dass er Himmel und Hölle in Bewegung setzen musste, um die bereits unterschriebenen Verträge zu erfüllen. Ihr war auch klar, dass er nach Auswegen suchen würde, um auch die bis dato hereingeflatterten Anfragen fix zu machen. Doch ihr gegenüber tat er so, als sei das alles gar kein Problem. Auch, wenn er natürlich wusste, dass sie wusste, dass es doch dazu werden konnte.
Bis Ende des Jahres eine Auszeit nehmen. Gut vier Wochen. Wie stellte er sich das vor? Und: viel wichtiger noch, wie stellte sie sich das vor? Wo sollte sie ausspannen? Etwa in der Stadt, die voller besinnlicher Menschen war, voller Möglichkeiten, die Adventszeit zu genießen, Weihnachtsgeschenke einzukaufen und Freunde zu weihnachtlichen Verabredungen zu treffen? In der der Winter zumeist nicht frisch und voller Verheißung war, sondern nasskalt und voller matschiger Straßen? Nicht zu vergessen, der Lärm der Menschen, der Autos, der Weihnachtsmusik, wo hin man auch ging. Sie rümpfte die Nase und fragte sich, warum sie plötzlich so eine Grummeltante war. Sie liebte doch ihre Stadt, ihr Zuhause. Das Getümmel und das Versprechen, jeden Tag etwas anderes zu tun. Auch, wenn sie nicht jeden Tag etwas anderes tat, sondern üblicherweise morgens ins Büro und abends wieder in ihre Wohnung fuhr. Allein die Möglichkeit, am Montag ins Theater, am Dienstag in die Oper, am Mittwoch ins Musical, am Donnerstag ins Fitnessstudio, am Freitag in die angesagte Bar, am Samstag in den Zoo und am Sonntag ins Museum zu gehen, machte ihr Leben doch so lebenswert. Wieder spürte sie eine Enge, als sie an die Woche für Woche vertanen Chancen dachte. Sie benötigte unbedingt Ruhe. Da hatte Pascal schon recht. Und die Stationsleiterin auch.
Friesum, dachte sie. Und im gleichen Moment sagte ihre Schwester: „Du solltest ein paar Tage zu Mama und Papa fahren. Mal so richtig ausspannen.“
Kapitel 3
Die Sonne stand schon tief, als Jule auf die Brücke fuhr, die Friesum mit dem Festland verband. Sie kniff die Augen zusammen, befürchtete kurz, das blendende Orange würde ihr die Sicht nehmen, doch sie konnte die nahezu leere Straße vor sich gut ausmachen. Es herrschte wenig Verkehr. Nur ein einzelner Lieferwagen befand sich vor ihr. Von einer Tischlerei auf der Insel, dessen Name ihr komischerweise überhaupt nichts sagte, obwohl sie ihr halbes Leben dort verbracht hatte. Thies Christensen – Wunder in Holz. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die, die von der Insel hinunterführte, fuhr kein einziges Auto. Es war später Nachmittag, kurz vor 16 Uhr. Die Insulaner blieben jetzt auf ihrer Insel. Hier hatten sie schließlich alles, was sie für den Abend brauchten. Etwa 2.000 Menschen lebten dauerhaft auf Friesum. Jules und Annabelles Eltern waren zwei von ihnen. Im Sommer wuchs die Anzahl der Bewohner auf das Vielfache an. Im Herbst und Frühling kamen je nach Wetterlage auch mal mehr und mal weniger Touristen. Jetzt Anfang Dezember war es ruhig. Zu Weihnachten und Silvester würden sich wieder einige Urlauber auf die bisher noch eher unpopuläre Insel wagen. Sylt, Norderney und Amrum waren beliebter. Dort war mehr los. Für die Friesumer war das in Ordnung. So hielten sich die Besucherströme und ihre hochgeschätzten Ruhezeiten in bester Balance.
Jule hatte sich, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden war, noch zwei Tage Zeit genommen, um Sachen zu packen, zuhause Ordnung zu schaffen, die Blumen für Rita zusammenzustellen, damit sie bei ihren regelmäßigen Gießgängen nicht durch die gesamte Wohnung laufen müsste, und im Büro eine für sie halbwegs befriedigende Übergabe zu organisieren. Sie wurde nicht müde, zu betonen, dass sie nur nach Friesum fuhr, nicht ans andere Ende der Welt in eine andere Zeitzone, und dass sie erreichbar wäre, wenn die Luft zu brennen begänne. Und Pascal wurde seinerseits nicht müde, ihr rigoros ins Wort zu fallen und jeden, der ihr Angebot gehört hatte, darauf hinzuweisen, dass er oder sie eine Abmahnung kassieren würde, wenn jemand tatsächlich Jule anrief und sie mit Problemen aus dem Büro belästigen würde. Schließlich hatte Jule aufgegeben, zu der bereits bestehenden Weiterleitung zusätzlich eine Abwesenheitsnotiz eingerichtet und sich vom Team in die frühzeitigen Weihnachtsferien verabschiedet.
Die Luft über Friesum war frostig und klar. Jule konnte die Weite über dem Horizont erkennen, der sich vor und neben ihr vom Meer abhob, während sie langsam über die Brücke rollte. Zuhause, dachte sie mit einem Anflug von Ruhe und lächelte. Wenn sie nicht im Auto, sondern im Zug gesessen hätte, hätte sie nun für einen Moment die Augen geschlossen, um die Ankunft zu genießen. Für eine Sekunde innehalten.
So erkannte sie aber bereits jetzt die ersten Reetdachhäuser, die sich in die sanften Hügel schmiegten, den Strand, der zu dieser Jahres- und Tageszeit nahezu menschenleer war, und sie konnte die kupferfarbene Spitze des Friesumer Leuchtturms erahnen, der zur Meerseite hin erbaut worden war.
Sie erreichte das Eiland, dessen winterlich karge Landschaft ihr nach den Monaten in der Stadt, zwischen Häusern und Menschen, wie ausgestorben vorkam. Im Sommer war sie das letzte Mal hier gewesen. Da sah die Insel natürlich etwas anders aus: begrünt, bevölkert, flirrende Luft und strahlender Sonnenschein. Sie ließ das Fenster hinunter: der Duft unterschied sich aber gar nicht so sehr vom Sommer, dachte sie. Frisch und salzig, aromatisches Kieferngrün, nasses Holz, wenn sie besonders tief einatmete.
Bald erreichte sie die Sackgasse, in der der Hof ihrer Eltern lag. Sie hatte sich telefonisch angekündigt, nur vage davon erzählt, wie lange sie bleiben würde und vor allem warum, und ihre Eltern erwarteten sie schon. Sie hatte mit ihrem Vater gesprochen, ein kluger Mann von der wortkargen Sorte. Als sie angedeutet hatte, dass sie sogar bis Januar bleiben würde, hatte er geseufzt, als hätte er geahnt, dass der Gesundheitszustand seiner Tochter nichts anderes zuließ, als Zuflucht in der Heimat zu suchen. „Wir freuen uns auf dich, Julken“, hatte er gesagt und dann hatte er wissen wollen, ob sie auch noch ihre Mutter sprechen wollte. Jule hatte abgelehnt, erklärt, sie würde nun packen und Dinge erledigen, die sie vor ihrer mehrwöchigen Abwesenheit eben noch erledigen musste, und hatte sie nur grüßen lassen. Jetzt, als sie geparkt hatte, entdeckte sie ihre Mutter, die von einem Spaziergang mit Fritz, dem Golden Retriever, nach Hause kam. Fritz lief freudig auf sie zu, schwanzwedelnd, drückte ihr die feuchte Nase ans Bein und guckte sie so dümmlich-freundlich an, wie es nur Golden Retriever tun können. Er schien zu lächeln, und die Zunge hing hechelnd zwischen den Lefzen.
„Hallo Fritz“, grüßte Jule, hockte sich hin und umarmte ihn lange. Er duftete nach Heimat.
Dann kam ihre Mutter Stine lachend dazu. „Willst du deine alte Mutter auch begrüßen?“, fragte sie, wartete die Antwort aber gar nicht erst ab, sondern schob den Hund beiseite und nahm ihre Tochter, die sich beeilte, aufzustehen, in den Arm. „Jule, mein Schatz“, sagte sie dabei, die Stimme gedämpft, weil sie ihr Gesicht in das Haar ihrer Tochter presste. „Was machst du nur für Sachen? Verdacht auf Burnout! Du meine Güte!“
„Woher wisst ihr…?“
Stine ließ sie los und betrachtete sie forschend. „Na, hör mal, wir sind deine Eltern! Annabelle hat uns natürlich informiert, als du ins Krankenhaus eingeliefert wurdest.“
„Natürlich. Entschuldige, dass ich nicht selbst nicht angerufen habe.“ „Hör auf, dich zu entschuldigen!“, wies Stine sie liebevoll zurecht. „Das ist doch Teil des Problems.“
Jule runzelte die Stirn. „Ein Teil meines Problems?“ Ihre Mutter neigte dazu, die Dinge zu esoterisch zu betrachten.
„Du willst es immer allen recht machen“, meinte Stine streng. „Fühlst dich für alles verantwortlich, halst dir Aufgaben noch und nöcher auf und vergisst dich darüber selbst.“ Sie schüttelte mit dem Kopf, als fragte sie sich, was sie an ihrer Erziehung falsch gemacht haben könnte. „Nun, komm erstmal rein. Für alles andere haben wir noch den ganzen Dezember Zeit. Wir freuen uns, dich so lange bei uns zu haben.“
Jule, die vor ihrer Abreise befürchtet hatte, ihr würde das alles zu viel werden, stellte fest, wie gut es sich anfühlte, willkommen zu sein, mit dem Wissen, den ganzen Monat bleiben zu dürfen. Und das Eso-Gerede ihrer Mutter würde sie einfach, so gut es ging, ignorieren.
„Deine Sachen holt Papa gleich“, meinte Stine noch, als Jule ihre Taschen aus dem Auto holen wollte. „Komm erstmal in Ruhe an.“
Mit einer Hand auf Fritz‘ Kopf ging Jule voran ins Wohnhaus, ihre Mutter folgte ihr. In der Diele zog Stine die schmutzigen Gummistiefel aus und schlüpfte in Pantoffeln. Auch Jule zog sich die Winterstiefel von den Füßen und stellte erfreut fest, dass ihre Mutter ihre alten Hausschuhe hervorgeholt und bereitgestellt hatte.
„Jule ist da“, rief Stine ins Wohnzimmer und ging die paar Stufen, die hinab in die Stube führten, voraus. Sie fanden Ernst liegend vor dem alten Plattenspieler vor, wo er einer Platte von Reinhard Mey lauschte, diverse weitere Hüllen lagen vor ihm verteilt auf dem Boden, so, als hatte er sich nicht entscheiden können, welche er einlegen sollte. Jetzt dudelte „Es ist Weihnachtstag“.
„Ist das nicht noch etwas früh?“, schmunzelte Jule und ließ sich neben ihrem Vater auf dem Boden nieder. Sie drückte ihn kurz an sich und lehnte sich dann aufatmend an die Wohnzimmerwand. „Schön, zuhause zu sein“, fand sie und lächelte ihre Eltern an, die ihr Lächeln beide still erwiderten.
„Ich koche uns mal einen Tee“, sagte Stine, die nie ruhig sitzen konnte und immer etwas zu tun brauchte.
Jule ließ ihren Blick schweifen. Die Stube war schon weihnachtlich geschmückt. Es gab einen klassischen Adventskranz aus Tanne mit dicken roten Kerzen und goldenen Schleifen. Auf den Regalbrettern hockte lustige Wichtel. In einem Fenster leuchtete ein Weihnachtsstern, in einem anderen schaukelte ein Fensterbild, das Lola gebastelt hatte. Durch die großen Terrassentüren konnte Jule in den winterlichen Garten sehen. Am Vogelhaus auf der Terrasse bediente sich gerade eine Amsel aus einem dicken Knödel.
Als Stine mit dem dampfenden Tee zurückkam, setzten sie sich auf das Sofa, und Jule berichtete von ihrem Sturz und den Wochen davor, die ihr rückblickend wie ein einziger voller Tag erschienen. Sie erwähnte ihren Panikanfall, einen Tag bevor ihr Körper endgültig sein Veto eingelegt hatte. Ihre Eltern sahen sie besorgt, aber in dem Wissen an, dass sie eine erwachsene Frau war, der man nicht reinreden durfte. Sie musste selbst wissen, was das Beste für sie war.
„Dass du dir eine Auszeit nimmst, ist sicher eine gute Entscheidung“, meinte Stine schließlich.
„Kommt Pascal klar?“, wollte ihr Vater wissen und fing sich einen warnenden Blick seiner Frau ein. „Nicht, dass das wichtig wäre…“, stotterte er gleich darauf und Jule musste lachen: „Doch, natürlich ist das wichtig. Es ist auch meine Firma! Es wäre schlimm, wenn ich mir darüber keine Gedanken machen würde, meint ihr nicht? So verantwortungslos habt ihr mich schließlich nicht erzogen.“
„Deinem Körper gegenüber hast du dich offenbar nicht unbedingt verantwortungsvoll verhalten“, konnte sich Stine nicht verkneifen und steuerte zu dem Thema zurück, das Jule als Eso-Zeug betitelte. Stine hatte vor einigen Jahren eine Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht und betrachtete ihren Körper als Tempel, den es zu bewahren und schützen galt. Zu ihrem Bedauern hatte sie ihrer Tochter davon bisher noch nicht viel vermitteln können. Jule rollte mit den Augen. Sie liebte ihre Mutter von Herzen, doch mit diesem esoterischen Krempel sollte sie ihr bloß fernbleiben. Ernst, der ahnte, dass ihr gemütliches Wiedersehen ein Ende fände, sobald Stine mit ihren Grundsätzen anfangen und Jule widersprechen würde, erhob die Stimme: „Wir haben dir dein Zimmer fertig gemacht, Julken. Soll ich deine Sachen aus dem Auto holen?“
Jule nickte und dankte ihm. Die Unterbrechung hatte das drohende Konfliktthema zur Seite geschoben.
„Ich werde noch einen Spaziergang zum Strand machen“, erklärte Jule. „Fritz will wohl nicht nochmal mit?“ Sie warfen einen Blick auf den schnarchenden Hund, der es sich vor dem flackernden Kamin gemütlich gemacht hatte.
Stine lachte. „Sieht nicht so aus.“ Sie umarmte ihre Tochter ein weiteres Mal, ehe sie aufstand, die Teetassen einsammelte und verkündete: „Dann bereite ich mal das Abendessen vor. Es gibt Scholle mit Kartoffelbrei und Gemüse.“
Der Himmel war inzwischen von einem blassgrauen Dunst bedeckt, sodass der Horizont in der Ferne kaum mehr auszumachen war. Die Luft war feucht und duftete nach Meer, Algen und Nordsee. Jule liebte diesen Duft. Jetzt, da sie in der Großstadt lebte, vielleicht sogar noch mehr als früher, als sie ihn jeden Tag riechen konnte. Wie das eben so ist. Dinge, die immer da sind, verlernt man wertzuschätzen. In dicker Fleecejacke, Mütze und Schal eingemummelt näherte sie sich der Wasserkante. Sie trug die Gummistiefel ihrer Mutter und wagte sich ein paar Schritte ins Meer hinein. Die Wellen brandeten auf und umspülten den pinken Kunststoff. Jule spürte, wie die Anspannung langsam von ihr abzufallen begann und ihre Schultern ein Stück absackten. Herrlich, dachte sie und schloss die Augen. Möwen kreischten enttäuscht über ihr. In den Wintermonaten, wenn die Menschen drinnen aßen, fiel zu wenig für sie ab. Die Wellen rauschten weiter. Jule hörte den Wind und ein Schiff, das hupte. Sonst waren da keine Geräusche. Nur Wellen, Wind, Möwen und ab und zu ein tutendes Schiff. Es war so still, dass sie ihren eigenen Atem hören konnte. Nach einer Weile öffnete sie ihre Augen wieder, schob die Hände in die Jackentaschen und begann, parallel zum Ufer ein Stück in Richtung Ort zu gehen. Vielleicht würde sie Finn oder Hinnerk über den Weg laufen. Sie waren zusammen zur Schule gegangen, zwar nicht in eine Klasse, nicht mal in die gleiche Stufe, doch sie hatten zum gleichen Freundeskreis gehört. Nun hatten sie sich seit Monaten nicht gesehen. Wie sie wusste, führte inzwischen beide eine glückliche Beziehung. Jule musste unwillkürlich grinsen. Ob die beiden Frauen wussten, worauf sie sich da eingelassen hatten? In der Schule waren Hinnerk und Finn der Schwarm aller Mädchen gewesen: Hinnerk durch seine zurückhaltende, freundliche Art gepaart mit außergewöhnlich gutem Aussehen und seinen blitzblauen Augen. Er galt als Frauenversteher. Finn, der Abenteurer, war mindestens genauso attraktiv. Er war wilder, spontaner und um einiges temperamentvoller als sein Freund. Ohne jemals zu viel nachzudenken war er für jeden Spaß zu haben gewesen.
Ein Blick auf die Uhr sagte Jule nun aber, dass sie es heute nicht mehr schaffen würde, bis in die Ortsmitte zu laufen, um Hinnerk in der Stadtverwaltung oder Finn bei seinem jüngst abgeschlossenen Projekt, dem Altfriesumer Leuchtturm, zu besuchen. Ihre Mutter würde bald schon mit dem frühen Abendessen auf sie warten und wäre sicher ungehalten, wenn sie sich gleich am ersten Tag verspäten würde. Die Dämmerung kroch heran. Bald wäre es sowieso zu dunkel, um den Strandspaziergang genießen zu können. Jule warf noch einen Blick auf die ersten Lichter, die in Friesum auf den Straßen und in den Häusern, die sie vom Strand aus sehen konnte, zu flackern begannen, und machte dann kehrt. Sie hätte in den kommenden Wochen noch genug Zeit, um spazieren zu gehen und die Jungs und ihre Freundinnen zu besuchen. Sie war schon gespannt auf die beiden Frauen, die es geschafft hatten, die zwei Insel-Casanovas zu bändigen. Während Hinnerk bei diesem Spitznamen immer gequält die Nase gerümpft hatte, weil er sich selbst überhaupt nicht so sah und immer betonte, er hätte die Eine für sich eben noch nicht gefunden, hatte sich Finn in der Rolle gut gefallen. Es klang schließlich nach Aufregung und Sex-Appeal, so hatte er damals immer gesagt, was sollte er also dagegen haben? Aber vielleicht hatte sich das mittlerweile geändert, überlegte Jule. Auch Abenteurer wurden älter.
Während sie mit der rauschenden Brandung zu ihrer Rechten zurücklief, dachte sie an ihre Freunde und die Clique von früher und rief sich in Erinnerung, wohin der Wind sie gestreut hatte. In Hamburg lebten einige ihrer früheren Schulkameraden; ein Junge war nach New York gezogen, um als Künstler zu arbeiten. Nicht bei allen wollte es ihr einfallen. Hinnerk und Finn lebten auf Friesum, Greta auch, wenn sie sich recht erinnerte, aber was war aus Pia und Jost geworden? Die beiden waren im letzten Schuljahr vor dem Abitur ein Paar geworden und beide hatten damals zu ihren engsten Freunden gezählt. Sie würde später mal bei Instagram recherchieren, nahm sie sich vor. Und ihnen vielleicht eine Nachricht schicken, wie es ihnen ginge und ob man sich beim jährlichen Friesumer Weihnachtsmarkt träfe.
Kapitel 4
Der Friesumer Weihnachtsmarkt war bei den Insulanern eine beliebte Tradition, die sich vor vielen Jahren etabliert hatte. Er fand immer die Woche vor Weihnachten statt und die meisten Friesumer richteten es so ein, dass sie möglichst viel des Weihnachtsstresses dann schon hinter sich hatten, um die Zeit mit Freunden auf dem Markt zu genießen, bei den hiesigen Künstlern und Händlern noch ein paar Weihnachtsgeschenke einzukaufen und rechtzeitig vor dem Fest zur Ruhe zu kommen.