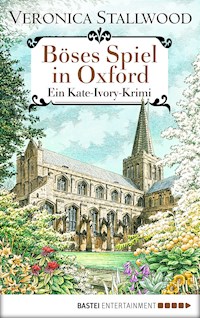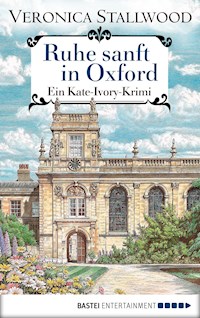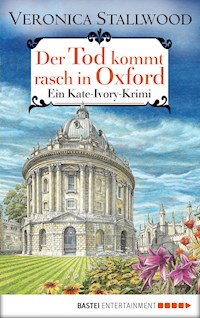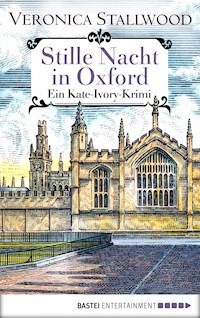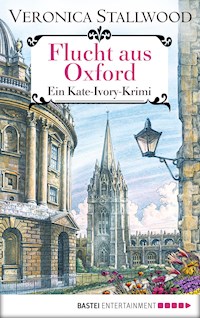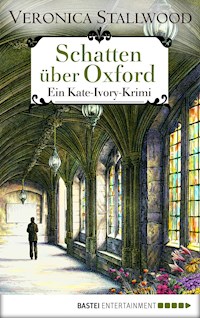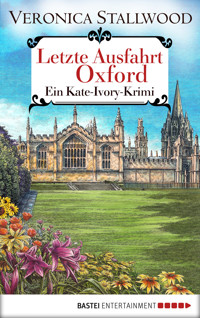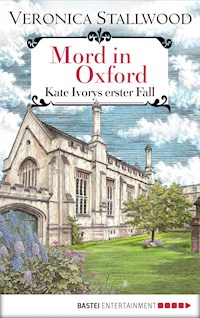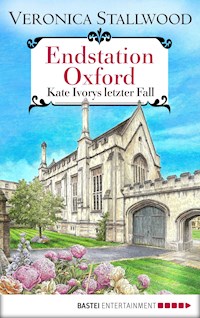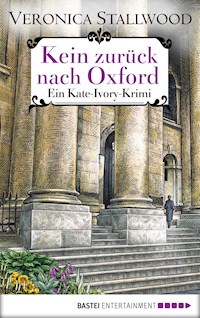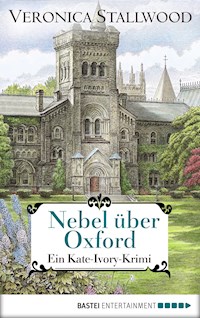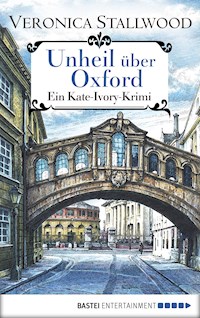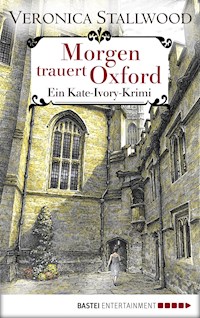
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate Ivory
- Sprache: Deutsch
Für ihr nächstes Buch über Charles Dickens braucht Kate Ivory historische Informationen - Details, die sie einem spektakulären Manuskript-Fund entnehmen will. Eine gewisse Dr. Olivia Blacket, Dozentin am Leicester College in Oxford, bewacht diese kostbaren Manuskripte jedoch mit Argusaugen und weigert sich hartnäckig, Kate Zugang zu dem faszinierenden Material zu gewähren. Als Blacket unversehens tot in ihrem Büro aufgefunden wird, nimmt sich Kate des Falles an - und muss erschüttert feststellen, dass die Spur unter anderem zu ihrem Geliebten führt.
Ein neuer Fall für die ermittelnde Schriftstellerin Kate Ivory. Eine atmosphärische Kriminalserie mit einer besonderen Heldin, deren scharfe Beobachtungsgabe und ungewöhnliche Methoden die gemütliche britische Stadt Oxford ordentlich durchwirbeln. Perfekt für Liebhaber von intelligenter und charmanter Cosy Crime, für Leser von Martha Grimes und Ann Granger.
"Stallwood gehört zur ersten Riege der Krimiautoren." Daily Telegraph
"Unterhaltung pur!" Daily Mail (über "Ruhe sanft in Oxford")
"Atmosphärisch und fesselnd!" The Sunday Times (über "Der Tod kommt rasch in Oxford")
"Stallwoods Heldin sprüht vor Intelligenz und Witz." The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungDanksagung1. Kapitel2. Kapitel3. Kapitel4. Kapitel5. Kapitel6. Kapitel7. Kapitel8. Kapitel9. Kapitel10. Kapitel11. Kapitel12. KapitelÜber dieses Buch
Für ihr nächstes Buch über Charles Dickens braucht Kate Ivory historische Informationen – Details, die sie einem spektakulären Manuskript-Fund entnehmen will. Eine gewisse Dr. Olivia Blacket, Dozentin am Leicester College in Oxford, bewacht diese kostbaren Manuskripte jedoch mit Argusaugen und weigert sich hartnäckig, Kate Zugang zu dem faszinierenden Material zu gewähren. Als Blacket unversehens tot in ihrem Büro aufgefunden wird, nimmt sich Kate des Falles an – und muss erschüttert feststellen, dass die Spur unter anderem zu ihrem Geliebten führt.
Über die Autorin
Veronica Stallwood kam in London zur Welt, wurde im Ausland erzogen und lebte anschließend viele Jahre lang in Oxford. Sie kennt die schönen alten Colleges in Oxford mit ihren mittelalterlichen Bauten und malerischen Kapellen gut. Doch weiß sie auch um die akademischen Rivalitäten und den steten Kampf der Hochschulleitung um neue Finanzmittel. Jedes Jahr besuchen tausende von Touristen Oxford und bewundern die alten berankten Gebäude mit den malerischen Zinnen und Türmen und dem idyllischen Fluss mit seinen Booten – doch Veronica Stallwood zeigt dem Leser, welche Abgründe hinter der friedlichen Fassade lauern.
Veronica Stallwood
Morgen trauert Oxford
Ein Kate-Ivory-Krimi
Ins Deutsche übertragen von Ulrike Werner-Richter
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe: Oxford Mourning
© 1995 by Veronica Stallwood
© für die deutschsprachige Ausgabe 2006 by
Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Gerhard Arth/Stefan Bauer
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von © shutterstock: Megin
Illustration: © phosphorart/David Hopkins
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-3462-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Robert McNeil
Danksagung
Von ganzem Herzen danke ich:
Colin Harris vom Department of Western Manuscripts bei der Bodleian Library, der die unleserlichen Manuskripte gefunden hat.
Robert McNeil, dem Chef der Hispanic Section bei der Bodleian Library, dafür, dass er mich auf das Dach der Radcliffe Camera geführt und mir eine Heidenangst verursacht hat.
Ruth Gosling, die früher im Department of Western Manuscripts bei der Bodleian Library beschäftigt war, weil sie mir erklärt hat, wie man unleserliche Manuskripte entziffert.
Ann Bowes, einer ehemaligen Sekretärin beim Lincoln College, die mir alles Wissenswerte über die Verwaltung eines Colleges und Indie-Chart-Rock-Gruppen vermittelt hat. Jesus ama Los Swervies, wie es so schön heißt.
Barbara Peters vom Poisoned Pen Bookstore in Scottsdale, Arizona, die uns Lamm-Koteletts geschnitten und mich wieder einmal daran erinnert hat, wie wunderschön Oxford ist.
Hugh Griffith, weil er die T-Shirts sortiert und die losen Enden erkannt hat, aber ganz besonders für seine Nachhilfestunden in Alexander-Technik.
Und Annabel Stogdon für alles andere.
Bei dem Buch, das einige Male im Text nicht ganz wörtlich zitiert wird, handelt es sich um The Invisible Woman von Claire Tomalin, das 1990 in London bei Viking erschien. Es beschäftigt sich in erheblich informativerer und genauerer Weise mit den Lebensläufen von Maria und Ellen Ternan als Oxford Mourning oder der düstere Roman, an dem Kate Ivory zurzeit arbeitet.
1. Kapitel
Oxford, wach auf!
Das Land erträgt schon viel zu lang
deines schläfrigen Liedes sinnlosen Klang …
G. V. Cox, Black Gowns and Red Coats, 1834
Zwei kleine, in blaue Tuniken und goldene Helme gewandete Ritter rückten unter dem Surren und Klicken des Uhrwerks langsam vorwärts. Irgendwann blieben sie stehen, und nach einem kurzen Moment der Ruhe schlugen sie auf ihre goldenen Glöckchen, um die Bürger von Oxford zu informieren, dass es sechs Uhr war.
Auf der Straße unterhalb des Carfax Tower hasteten Massen müder Menschen durch die feuchte Oktoberluft zu ihren Bushaltestellen. Niemand achtete auf die Glocken. Niemand – außer einer Frau in den Dreißigern mit kurz geschnittenem, blondem Haar und runden grauen Augen. Sie war Schriftstellerin und hieß Kate Ivory.
Als das erste Glöckchen erklang, blieb sie mitten auf der Kreuzung stehen und verursachte ein mittleres Verkehrschaos. »Entschuldigung!«, lächelte sie die Leute an, die in sie hineinrannten. Aber seht doch nur!, hätte sie am liebsten gerufen. Fällt euch denn nichts auf? Diese Stadt ist voll gestopft mit wunderhübschen alten Sachen, die wir überhaupt nicht mehr registrieren. Die einzigen Dinge, die wir noch wahrnehmen, sind die neue Herbstmode im Schaufenster von Marks & Spencer und die Schlagzeilen am Zeitungsstand.
In ihrer Fantasie entfernte Kate sämtliche Busse nebst der hektisch rennenden Menge und versetzte sich ins Jahr 1865. Das ist es, worauf du dich konzentrieren solltest, ermahnte sie sich. Denk an deine Arbeit. Finde die zündende Idee, die außergewöhnliche Wendung, die dein nächstes Buch zu etwas ganz Besonderem macht.
Doch leider kam die Eingebung nicht. Kate musste sich mit dem Klang der Glöckchen über dem brausenden Verkehrslärm begnügen.
Sie zuckte die Schultern, fuhr sich mit beiden Händen durch das kurz geschnittene blonde Haar – ihr Frisör hätte bestimmt wieder geschimpft – und setzte ihren Weg im Strom der anonymen Menge fort. Sie ging die Queen Street entlang, kam am Gefängnis und am Castle Mound vorüber und bog schließlich in Richtung Bahnhof ab. Sensationelle Entdeckung in Oxford lautete die reißerische Schlagzeile einer Zeitung.
Kate Ivory ging am Zeitungsstand vorüber. Die Nachricht machte keinen Eindruck auf sie, und sie unterließ es, die Zeitung zu kaufen. Wie hätte sie auch ahnen können, dass die Titelgeschichte etwas mit ihr zu tun hatte?
Liam Ross saß in seinem Büro im College. Er blickte nur kurz auf, als die Trauerglocke elf Mal geschlagen wurde. Die Flagge über dem Pförtnerhaus hing auf Halbmast. Beim Klang der Glocke fiel Liam wieder ein, dass kürzlich ein seit langer Zeit pensionierter und längst aus dem Gedächtnis der Leute verschwundener Dozent verstorben war. Ross entsann sich seiner dunkel als eines gebückten, ziemlich tauben alten Herrn, der sich beim letzten Festessen über die Speisenfolge beschwert hatte. Liam schob die Erinnerung mit der Leichtigkeit eines Menschen von sich, der noch mindestens fünfzig Jahre vor sich hatte, ehe er sich um die eigene Senilität sorgen musste. Er blickte auf die Uhr. Viertel nach sechs. Er würde noch eine weitere Stunde arbeiten können und ausreichend Zeit für eine ausgiebige Dusche haben, ehe er sich zum Essen mit seiner Liebsten traf.
Das Leben war schön. Liam führte einige ausgesprochen befriedigende Beziehungen, ohne langweilige Verpflichtungen befürchten zu müssen. So durfte es durchaus noch ein paar Jahre weitergehen. Er klappte das Buch zu, in dem er gelesen hatte, und legte es auf den schwankenden Stapel, der sich bereits auf seinem Schreibtisch angehäuft hatte. Demnächst würde er unbedingt einmal aufräumen müssen, dachte er, während er die hoffnungslos überquellenden Aktenordner, die Berge von Musik-CDs und die CD-roms betrachtete, die ringsherum in seinem Büro verstreut lagen. Vielleicht ein andermal. Sein Hausdiener meckerte zwar immer wieder über die Unordnung, aber er selbst fühlte sich damit gar nicht einmal unwohl. Er fand, dass so etwas zu einem richtigen Akademiker-Leben gehörte.
Der Klang der Glocken erhob sich über den Verkehrslärm. Er schwebte am Magdalen College vorüber und trieb über die Magdalen Bridge auf einen kleinen, grünen Hügel zu. Eine Gruppe junger Leute, die sich auf dem Gras niedergelassen hatte, sah hinab in den bläulichen Dunst, aus dem Kuppeln, Türme, Bäume und Zinnen herausragten, und lauschte dem Geläut.
Lediglich die junge Frau, die sie Angel nannten, saß ein wenig abseits und hatte keinen Blick für die schöne Aussicht. Mit kerzengeradem Rücken starrte sie in die entgegengesetzte Richtung, auf eine Reihe schöner alter Häuser, die den Hügel hinabzuwandern schienen und ihre Fenster mit Gardinen verhüllt hatten.
»Oxford!« Ant schob die blasse Haarsträhne beiseite, die das Gesicht der jungen Frau vor den anderen verbarg. »Freust du dich nicht, Angel?«, flüsterte er dicht neben ihrem Ohr. »Die Stadt der träumenden Türme und vielfältigen Möglichkeiten. Die Stadt der Legenden und der Romantik.«
Angel schloss die Augen. »Verpiss dich, Ant«, sagte sie.
»Wir dürfen nicht fluchen«, meldete sich Dime, der den letzten Satz mitbekommen hatte. »Das ist Ants Gesetz.«
»Dime hat Recht«, nickte Ant. »Wie sagt man, Angel?«
»Verzeihung, Ant«, antwortete die junge Frau pflichtbewusst, jedoch mit abgewandtem Blick. »Eigentlich finde ich es ganz schön hier. Wirklich, Ant, ich finde es schön. Es ist nur einfach nicht der Ort, wo ich jetzt sein möchte.« Ant ließ ihre Haarsträhnen fallen und entfernte sich ein paar Schritte.
Angel wollte die jungen Männer wirklich nicht brüskieren. Sie hatten sich ihrer angenommen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Doch das, was sie sagten, bedeutete ihr nichts. Sie musste an ihrer Vision festhalten, und das bedurfte ihrer gesamten Energie und Konzentration. Die fortgesetzte Anstrengung ermüdete sie so sehr, dass sie sich am liebsten gleich hier auf dem Hügel zwischen verstreuten Cola-Dosen und alten Hamburger-Schachteln zum Schlafen hingelegt hätte. Die ununterbrochenen Sympathiebeweise der anderen gingen ihr auf die Nerven. Aber sie brauchte ihre Unterstützung und ließ sich daher auf ihre Regeln ein. Andererseits war sie es leid, Ant und der Familie ständig dankbar sein zu müssen. Doch das war nicht das Einzige, was ihr zu schaffen machte. Es gab einen Ort, den sie unbedingt aufsuchen musste, und die Familie – Ant, Gren, Dime und Coffin – sollte sie dort hinbringen. Sie waren dazu bereit, allerdings taten sie es in ihrem eigenen Rhythmus, und der erschien Angel unendlich langsam. Bleib standhaft, ermahnte sie sich. Komm wieder zu Kräften. Werde stark für das, was du zu tun hast.
Coffin nahm eine Flöte aus dem mit schwarzem Samt ausgeschlagenen Köfferchen, in dem er seine Instrumente aufbewahrte, und begann, eine einfühlsame keltische Melodie zu spielen. Dime setzte sich unmittelbar neben Angel und kam mit seinem rundlichen Gesicht dem ihren so nah, dass sie den Geruch der kürzlich verspeisten Pizza wahrnahm.
»Ist dir kalt?«, fragte er. »Wenn du möchtest, leihe ich dir meinen Pullover.« Doch Dimes Pullover roch, ebenso wie Dime selbst, abgestanden und nach altem Essen. Angel schüttelte den Kopf.
»Lass mich einfach in Ruhe«, sagte sie.
»Keine Sorge, Angel«, erwiderte er. »Wir bringen dich schon an den richtigen Ort.« Hilflos runzelte er die Stirn. »Wohin wolltest du nochmal?«
Angel seufzte. »Nach Leicester«, sagte sie. »Ich muss nach Leicester.« Es kam ihr vor, als hätte sie diesen Satz während der vergangenen Wochen mindestens hundert Mal wiederholt. Sie fürchtete ernsthaft, dass ihr die Hand ausrutschen könnte, falls Dime sie noch einmal fragte. Als sie sich den verblüfften Ausdruck seines runden, roten Gesichts vorstellte, musste sie lächeln. Dime lächelte zurück. Er freute sich, wenn sie fröhlich aussah.
Genau genommen waren sie alle recht glücklich. Sie saßen oder lagen auf dem Hügel und genossen den Anblick der Stadt. Unwillkürlich hatten sie sich in einer Art Dreieck angeordnet, in dessen Scheitelpunkt sich Ant befand. Er war schwarz gekleidet, wie immer. Schwarze Jeans, schwarze Stiefel und ein schwarzes T-Shirt mit ausgerissenen Ärmeln. Während des Sommers war sein Haar sehr lang geworden. Er trug es straff aus dem Gesicht gekämmt in einem Pferdeschwanz.
»He, sag mal, Ant«, fragte Gren mit der weinerlichen Stimme eines übermüdeten Kindes, »wo pennen wir eigentlich heute Nacht? Schon was aufgetan?« Er kramte das Stück Pappe hervor, das er ständig mit sich herumtrug. Heimatlos und hungrig, stand darauf. Er hielt es Ant vor die Nase und verstaute es wieder. Angel hatte noch nie begriffen, wie er dieses Schild bei sich tragen konnte, ohne dass es auch nur im Geringsten auffiel. Gren war unglaublich dürr und seine Kleidung eher dürftig. Trotzdem brachte er es fertig, an seinem Körper allerlei Dinge zu verstecken, die sich bei Gelegenheit als nützlich erweisen konnten.
»Gebt mir zwanzig Minuten«, sagte Ant. »Ich suche uns eine Bleibe. Null Problemo.«
Coffins Flötenmelodie wurde deutlich heiterer. Sie konnten sich bedenkenlos auf Ant verlassen, dachte Angel. Schon seit undenklichen Zeiten verließen sie sich auf ihn – vielleicht schon länger als ein Jahr. Das hatte ihr Coffin erzählt, doch er hatte den Überblick über die genaue Anzahl der Monate verloren. Ant war ihr Anführer, hatte Coffin gesagt. Sie glaubten an ihn. Sie befolgten seine Regeln und er sorgte für sie. Das Leben war einfach, wenn man zu Ants Familie gehörte.
»Wartet hier«, sagte Ant und stand auf. »In spätestens einer Stunde bin ich zurück.« Er kontrollierte den Inhalt seines kleinen, blauen Rucksacks und warf ihn über die Schulter.
»Bald wird es dunkel«, gab Dime mit besorgtem Gesicht zu bedenken. »Bist du sicher, dass du noch etwas findest?«
»Habe ich euch je enttäuscht?«, fragte Ant. »Ich bin vor Einbruch der Dunkelheit wieder da. Verlasst euch auf mich.«
Kate Ivory erreichte ihr kleines Haus im Vorort Fridesley. Ehe sie sich jedoch eine Tasse Tee und ein Stück Käse dazu gönnte, ging sie hinunter in ihr Arbeitszimmer und blätterte durch die Notizen, die sie sich am Morgen für ihr nächstes Buch gemacht hatte. Irgendetwas fehlt noch, dachte sie. Zwar ist genügend Material da – nur leider viel zu abgedroschen. Nichts, was den Leser überraschen könnte. Nichts wirklich Neues. Der Entwurf braucht dringend mehr Biss. Etwas, was man nicht in jedem der Bücher findet, die ich über das Thema gelesen habe. Etwas Spannendes. Einen guten Aufhänger.
Aber wo findet man so etwas? Sie hatte den Katalog der Bodleian Bibliothek durchstöbert und alles gelesen, was sie über Maria Susanna Taylor und ihre Schwester Ellen Ternan finden konnte. Viel war es nicht gewesen. Außerdem hatte sie jede auffindbare Biografie von Ellens Liebhaber Charles Dickens durchforstet. Alle hatten sich über seine Liebesbeziehungen weitestgehend ausgeschwiegen und als Grund dafür angeführt, dass Dickens seine sämtlichen Tagebücher und die gesamte Korrespondenz im Jahr 1860 verbrannt und später alle weiteren Briefe unmittelbar nach ihrer Zustellung vernichtet hatte. Allerdings waren in den Literaturbeilagen der Sonntagszeitungen in letzter Zeit gewisse Gerüchte über pikante Einzelheiten aufgetaucht, die das Thema wieder aktuell erscheinen ließen. Was Kate brauchte, war ein Gespräch mit jemandem, der sich auf diesem Gebiet gut auskannte. Leider hatte sie wenig Zugang zur Literaturwissenschaft. Sie benötigte eine Kontaktperson.
In diesem Augenblick klingelte das Telefon.
»Kate? Hier ist Andrew.«
Andrew Grove, ihr bei der Bodleian Bibliothek arbeitender Freund. Er war ihr noch den ein oder anderen Gefallen schuldig. Fünf Monate zuvor hatte sie ihm zuliebe in der Bibliothek einen kleinen Job angenommen, der hauptsächlich aus langweiliger Katalogarbeit bestand, sie aber um Haaresbreite einem lebensgefährlichen Psychopathen ans Messer geliefert hätte.
»Hättest du vielleicht Lust, nächste Woche mit mir in ein Konzert zu gehen? Wirklich hübsche Musik. In der Kapelle des Bartlemas College.«
»Geht Isabel nicht mit?« Andrew kannte Kates Ansicht über seine Freundin Isabel Ryan nur allzu gut: Sie hielt sie für etwas hohlköpfig und zwanzig Jahre zu jung für ihn.
»Ich muss zugeben, dass ich die Karten in der Absicht gekauft habe, Isabel mit einfacher klassischer Musik vertraut zu machen.«
»Wie einfach?«
»Ach, das Übliche. Der Kanon von Pachelbel. Das Gloria von Vivaldi. Und etwas von Händel mit jeder Menge fröhlicher Trompeten.«
»Und sie wollte trotzdem nicht?«
»Sie sagte, sie käme mit, wenn ich dafür mit ihr in das Konzert einer Gruppe namens Swervedrivers gehe. Sie sollen ganz groß in den so genannten Indie-Charts sein – was auch immer das bedeuten mag.«
Kate musste lachen. »Du hättest dich darauf einlassen sollen. Vielleicht hätte es dir sogar gefallen.«
Sie konnte fast durch die Telefonleitung spüren, wie Andrew sich schüttelte, und bekam Mitleid mit ihm. Andrew ließ sich so leicht an der Nase herumführen, dass es nicht wirklich Spaß machte.
»Ich komme gern mit in das Konzert. Sag mir nur, wann und wo.«
Nachdem er sie informiert hatte und gerade auflegen wollte, fragte sie plötzlich: »Andrew, du weißt nicht zufällig irgendetwas über Charles Dickens und Ellen Ternan?«
»Seine Freundin? Die Schauspielerin? Darüber gibt es ein tolles Buch von …«
»Weiß ich. Habe ich längst gelesen. Ich dachte eher an etwas bisher Unveröffentlichtes.«
»Aha! Du hast also die Schlagzeile heute gelesen!«
»Welche Schlagzeile?«
»Sensationelle Entdeckung in Oxford.«
»Klingt ganz nach meinem intellektuellen Niveau.«
»Die Zeitung hat Wind davon bekommen, dass eine Dozentin für englische Literatur eine Sammlung von Tagebüchern und Briefen bearbeitet. Man hat die Manuskripte kürzlich in der Bibliothek des Bartlemas College gefunden. Die Papiere stammen aus dem Nachlass von Nelly Ternans Schwester Maria. Ich nehme an, dir ist längst bekannt, dass sie hier in Oxford mit einem Bierbrauer verheiratet war und in der Banbury Road wohnte.« Wenn es nicht gerade um harte Rockmusik ging, fand Andrew schnell zu seinem angestammten Selbstvertrauen zurück.
»An Maria bin ich ausgesprochen interessiert«, erklärte Kate. »Eine Frau ganz nach meinem Geschmack.«
»Künstlerische Ader, unabhängig, Schriftstellerin. Ich kann mir denken, dass sie dir gefällt. Mir wäre das alles zu unruhig.« Andrew liebte sein ruhiges, vorhersehbares Leben, das er sich nicht von den Ansprüchen einer kapriziösen Frau diktieren lassen wollte. Noch nicht einmal von einem Fan der Swervies. Kate glaubte kaum, dass Isabel nach diesem jüngsten Vorfall noch viele Chancen bei Andrew hatte.
»Was meinst du, wie könnte ich vorgehen, damit ich einen Zugriff auf dieses Material erhalte?«, erkundigte sie sich.
»Die Frage ist, ob man dich lässt. Warum schreibst du nicht einfach an die Dozentin? Vielleicht gestattet sie dir, ihr bei der Arbeit über die Schulter zu blicken. Allerdings würde ich nicht darauf wetten.«
»Gute Idee. Weißt du, wie die Frau heißt und in welchem College sie arbeitet?«
»Leider habe ich die Zeitung inzwischen entsorgt. Aber ich könnte es sicher für dich herausfinden. Ich melde mich wieder.«
Es war immerhin ein Anfang.
Die Frau griff nach dem Blatt und las.
Was hast du mit dem Kind gemacht? Du weißt, dass ich es genommen und wie mein eigenes aufgezogen hätte. Niemand hätte je erfahren, dass es nicht mein leibliches Kind ist. Konntest du mir nicht vertrauen? Sag mir, was hast du mit dem Kind gemacht?
Sie las den Text noch einmal und änderte etwas an der Interpunktion. Ja, jetzt war es richtig. Mit der Schrift nach unten legte sie es auf einen Stapel ähnlicher Blätter und nahm sich das nächste vor. Sie begann, auf die Schreibtischunterlage zu schreiben, schüttelte verwirrt ihren Stift und begann von neuem.
Nachdem sie weitere zwanzig Minuten gearbeitet hatte, legte sie das Manuskript zur Seite, stand auf, holte ihre Jacke und griff nach ihrer Handtasche und den Schlüsseln.
Ant ging den Hügel hinunter. Seine dünnen Beine in den schwarzen Jeans bewegten sich rasch in Richtung Stadt. Bei der ersten Möglichkeit bog er links ab, doch erst nachdem er aus dem Blickfeld der Familie verschwunden war, gestattete er sich, ein wenig langsamer zu laufen. Er zog die Schultern hoch und knurrte vor sich hin: »Scheiß-Lieferwagen. Scheiß-Stadt. Scheiß-Typen.« Dann grinste er. »Wie sagt man, Ant?«
»Verzeihung, Ant.« Ein winzig kleiner Anflug von Rebellion. Einmal durfte er sich das erlauben, doch dann musste auch er sich wieder den Regeln unterwerfen. Wenn die anderen ihm gehorchen sollten, hatte er mit gutem Beispiel voranzugehen.
Trotzdem war es angenehm, die Familie für eine Weile los zu sein. Angenehm, wenigstens für kurze Zeit nicht die Verantwortung für ihr Überleben übernehmen zu müssen. Jeder von ihnen wusste, dass Gesetze notwendig waren und befolgt werden mussten, wenn man in einer funktionierenden Gemeinschaft leben wollte. Und genau diese Disziplin unterschied sie von anderem fahrenden Volk. Keine Rasta-Frisuren!, hatte er ihnen befohlen. Keine Hunde! Kein Alkohol und keine Prügelei! Keine Frauen, zumindest jetzt noch nicht! Und natürlich keine Drogen! Auf diese Vorschrift hatte Coffin ein wenig säuerlich reagiert, und Ant hatte ihn auch schon ein paar Mal mit einem Joint erwischt. Aber meistens gehorchten sie, denn sie wollten Mitglieder von Ants Familie bleiben. Wenn man nämlich zu Ant gehörte, brauchte man nicht zu befürchten, eines Tages in einem Pappkarton schlafen zu müssen. Ant hatte sogar versucht, eine Art gruppeninterner Sprache zu entwickeln – etwas, das sie von anderen unterschied und ihnen eine eigene Identität verleihen sollte. Doch obwohl Dime wirklich guten Willens war, vergaß er die Sprache immer wieder. Gren war es egal, und Coffin zuckte nur die Schultern, hob eine seiner Flöten an die Lippen und begann zu spielen.
Manchmal verspürte Ant die verlockende Versuchung, sich von ihnen loszusagen und allein weiterzugehen – so wie gerade jetzt. Aber natürlich gab er der Verlockung nicht nach. Er kannte sich gut genug, um zu wissen, dass er seine Macht über die anderen durchaus genoss.
An einer Kreuzung wandte sich Ant nach rechts in ein Sträßchen, das den Hügel wieder hinaufkroch. Kurz darauf bog er erneut rechts ab. Er folgte allein seinem Instinkt. Nachdem er eine Straße überquert hatte, wandte er sich wieder nach links. Die Häuser wurden höher und rückten enger zusammen. Hier lebten die ständig wechselnden Bewohner einer Stadt mit zwei Universitäten. Irgendwo in dieser Gegend würde er ein Haus nach seinem Geschmack finden, mit Nachbarn, die sich nicht um fremde Gesichter kümmerten. Er hielt Ausschau nach Schildern, die den Verkauf eines Hauses anzeigten, nach vorhanglosen Fenstern und nach ungemähten Rasenflächen. Ein Stückchen weiter glaubte er, das Richtige gefunden zu haben: ein wild wuchernder Vorgarten, in dem wilder Wein den Eingangsbereich und die seit langem nicht mehr geputzten Fenster im Erdgeschoss verdunkelte. Im Briefkasten steckten ein paar große Umschläge, und unter einer schmuddeligen Milchflasche klemmte ein Zettel mit der Aufschrift: Bitte vorläufig keine Milch. Zwar gab es kein Verkaufsschild, aber das Haus wirkte, als ob sein Besitzer schon seit einiger Zeit abwesend wäre. Ant blickte die Straße hinauf und hinunter. Nichts. Niemand interessierte sich für ihn. Er fuhr mit der Überprüfung fort.
Die Eingangstür war mit zwei guten Schlössern gesichert – eines davon ein Sicherheitsschloss. Alle Fenster waren geschlossen und sahen aus, als seien sie zusätzlich verriegelt. Es würde schwieriger werden, als er vermutet hatte. Doch zunächst musste er die Gartenseite in Augenschein nehmen. Immer noch nahm niemand Notiz von ihm. Er rüttelte am Riegel des Gartentors, das ihm Zugang zur Hintertür verschafft hätte. Abgeschlossen. Der Eigentümer war umsichtiger, als Ant erwartet hatte. Erneut sah er sich um. Die dichten Zweige eines Baumes schützten ihn vor neugierigen Blicken aus dem Nachbargarten. Ant begann zu schwitzen. Er spürte ein Jucken im Nacken. Die Gegend machte nicht den Eindruck, als würden sich hier alte Damen den Tag damit vertreiben, sich hinter Gardinen zu verstecken und die Nachbarschaft auszuspionieren. Es war eher unwahrscheinlich, dass man ihn entdeckte. Trotzdem wurde Ant allmählich nervös. Er würde sich erst wirklich sicher fühlen, wenn er endlich im Haus und damit außer Sichtweite war. Er musste es wagen.
Das Tor war hoch. Ant griff nach der obersten Strebe und war innerhalb weniger Sekunden im Garten. Mit lautem Scheppern landete er auf zwei Mülltonnen. Erschrocken hielt er die Luft an, während er sich leise fluchend das Schienbein rieb. Doch immer noch interessierte sich niemand dafür, was er tat.
Angel saß ein Stück von den anderen entfernt und blätterte in einem Notizbuch. Bei einer bestimmten Seite hielt sie inne und las den Text ein zweites Mal. Die Handschrift war schwer zu entziffern und einige Worte kaum zu erkennen, doch sie verstand zumindest den Sinn der Passage. Was sie nicht lesen konnte, reimte sie sich in ihrer Fantasie zusammen.
Das Zimmer ist mit Lilienduft angefüllt. Es ist ein süßer, schwerer Geruch, der den ganzen Raum durchdringt und wie eine ansteckende Krankheit oder ein verräterischer, giftiger, heimtückischer Dunst in jeden Winkel kriecht. Die Lilien sehen aus wie große, hungrige Wesen mit klaffenden Mündern. Die purpurfarbenen Münder schreiender Säuglinge. Zahnlos und röhrend wie primitive Musikinstrumente.
Wenn ein Uneingeweihter dies hier lesen könnte, würde er mich für geistesgestört halten. Es würde seine Ansicht bestätigen, dass eine Frau verrückt wird, wenn sie kein Kind hat. Und vielleicht hat er sogar Recht. Vielleicht ist meine Urteilsfähigkeit verloren gegangen, hier in diesem ruhigen, schweigenden Raum mit den grauen Wänden und der Aussicht auf einen grünen Hügel.
Die Lilien sind weiß, wie das Häubchen, das sie trug. Ein Häubchen mit einer Borte aus weißen Spitzen und langen Bändern. Eigentlich ist der Januar nicht die richtige Jahreszeit für ein solches Häubchen, aber jetzt wird sie es für immer tragen.
Die Lilien in ihrer dunkelblauen Vase auf dem Tisch am Fenster – sie leben. Sie leben wie aufgedunsene, weiße Tiere, die ihren Duft ausatmen und mein Zimmer mit Erinnerungen füllen.
Sicher hat man Lilien auf ihren Sarg gelegt – oder etwa nicht? Große weiße Königslilien. Vielleicht aber auch Maiglöckchen, wer weiß. Mich erhielten sie am Leben; ahnungslos ließen sie mich schlafen.
Sie gehören verscharrt. Tief verscharrt. Für immer vergessen.
»Was machst du da?«, fragte Coffin.
»Nichts. Ich lese ein bisschen«, antwortete Angel.
»Sieht aus, wie mit der Hand geschrieben«, meinte Coffin. »Hast du das geschrieben?«
»Keine Ahnung«, sagte Angel. »Vielleicht. Ich versuche gerade, einen Sinn dahinter zu entdecken. Aber es geht nicht.«
»Dann lass es doch sein«, erklärte Coffin. »Es macht dich nur unglücklich. Lebe doch einfach mit uns in der Gegenwart und denke vielleicht ab und zu an die Zukunft. Du musst versuchen, alles loszuwerden, was dich zurückhält.«
»Ich glaube kaum, dass ich es loswerden kann, solange ich es nicht verstehe. Man kann nicht vorwärts gehen, wenn man nicht weiß, was vorher war. Man steckt in einer ständig andauernden Gegenwart fest.«
Coffin schüttelte den Kopf, suchte eine Flöte aus und spielte eine muntere Weise für sie. Angel klappte das Notizbuch zu und verstaute es in ihrer Tasche.
Ant ging so methodisch vor wie immer. Die solide Hintertür verfügte über ein ebenso solides Schloss. Die Terrassentüren waren aus dickem Glas und verriegelt. Einzig die Küche schien zugänglicher zu sein, denn sie ragte wie ein rechteckiger – wahrscheinlich später an das Haus angebauter – Daumen in den Garten und hatte ein Flachdach. Und über diesem Flachdach entdeckte Ant ein vermutlich zu einem Badezimmer gehörendes Milchglasfenster, dessen oberer Teil einen Spalt geöffnet war. Die Öffnung bot kaum Platz genug, um ins Haus zu kommen, doch Ant war dünn, und wenn seine Schultern hindurchpassten, würde der Rest auch nachkommen.
»Los, Ant, rein mit dir! Da drin ist es sicherer als hier draußen.« Ant hatte herausgefunden, dass man sich zu fast allem bringen konnte, wenn man laut mit sich selbst sprach.
Es war nicht besonders schwer, das Dach zu erklimmen, die obere Hälfte des Fensters gewaltsam zu öffnen und sich hineinzuschlängeln. Wie ein Aal, dachte Ant und lachte ein wenig verunsichert. Inzwischen stand ihm wirklich der kalte Schweiß auf der Stirn, denn das ganze Unternehmen hatte deutlich länger gedauert, als ihm lieb gewesen war. Kopfüber landete er zwischen Toilette und Badewanne, aber außer einer Schramme an der Schulter blieb er heil. Endlich war er im Haus. Allmählich verebbte der Adrenalinstoß. Ant rappelte sich auf, erschnüffelte einen leichten Schimmelgeruch, runzelte beim Anblick eines deutlichen Schmutzrings in der Wanne die Stirn und gönnte einer traurig vor sich hin dörrenden Grünlilie ein Zahnputzglas voll Wasser.
»Kopf hoch«, sagte er zu der Pflanze, »wachse und gedeihe, denn demnächst wird sich eine neue Familie um dich kümmern.«
Er benutzte die Toilette und betätigte die Wasserspülung. Und jetzt ans Werk, befahl er sich und nahm die nach dem gelungenen Eindringen zweitwichtigste Sache in Angriff: seinen Rückzug zu sichern. Vermutlich hatte der Hausbesitzer seine Schlüssel mitgenommen, aber Ant war fast sicher, dass sich irgendwo im Haus noch Ersatzschlüssel befanden. Doch wo mochten sie versteckt sein?
Die Frage war schnell beantwortet. Alle Ersatzschlüssel hingen an einem Schlüsselbrett neben der Hintertür und waren ordentlich beschriftet – Haustür, Fenster, Terrasse, Hintertür. Ant entriegelte die Hintertür und probierte den mit »Hintertür« beschrifteten Schlüssel aus. Er funktionierte. Ant steckte ihn in die Tasche für den Fall, dass er schleunigst verschwinden musste, und machte sich daran, den Rest des Hauses zu erkunden. Er musste sicherstellen, dass ihr vorläufiges Domizil noch mindestens so lange leer stehen würde, wie Gren brauchte, um einen fahrbaren Untersatz zu besorgen und auf Vordermann zu bringen. Erst dann konnten sie die Weiterreise ins Auge fassen.
Die Frau trat aus dem Haus und ging zu ihrem Wagen. Auf ihrem Gesicht lag ein entschlossener Ausdruck, als würde sie zu einer langen, anstrengenden Reise aufbrechen oder wäre im Begriff, ein Verbrechen zu begehen.
Sie fuhr ins Stadtzentrum von Oxford, bog in Richtung Botley ab und folgte der breiten, eintönigen Straße bis zu einem Einkaufszentrum, dessen Betongebäude eher wie Lagerhäuser wirkten. Sie stellte das Auto auf einem endlos großen Parkplatz ab, ließ das Lenkradschloss einrasten und stieg aus.
Unmittelbar vor ihr schubste eine ausgemergelte junge Frau einen Kinderwagen mit einem Säugling sowie ein etwas älteres Kind mit einem heißen, roten Gesichtchen und wunden Lippen durch die Tür in das Geschäft. Natürlich gab es hier Verkaufspersonal und sicher auch noch weitere Kunden. Doch die Frau hatte nur Augen für die hohen, weiten, mit allerlei in Plastik verpacktem Spielzeug gefüllten Gänge. Sie begann nach dem zu suchen, was sie haben wollte, und ging bis ans Ende des wie ein Hangar wirkenden Verkaufsraums.
Puppen. Süße Puppen, schwarze Puppen, politisch korrekte Puppen mit diskret angedeuteten Geschlechtsteilen. Sie ging an allen vorüber und blieb erst bei den altmodischen Puppen mit ihren realistisch gestalteten Gesichtern und weichen, schmiegsamen Körpern stehen. Baby-Puppen. Eine Baby-Puppe lag in ihrer blauseidenen Schachtel mit geschlossenen Augen und lockeren Gliedmaßen auf der Seite. Schlief sie oder war sie tot? Die Frau ging weiter.
Ein mit Stickerei verziertes, weißes Häubchen, rundliche, rote Wangen und Augen in dem unspezifischen Blau, das allen Säuglingen eigen ist – das wusste sie aus ihren Beobachtungen der Kinderwagen anderer Frauen. Das war ihre Puppe. Sie erkannte sie sofort. Ein helles Gesicht, dünnes blondes Haar, rundlich gedrungene Gliedmaßen und weiche Lederschühchen. Sie nahm die Puppe so vorsichtig aus dem Regal, als wäre sie ein echtes Baby, und wiegte sie in ihren Armen; selbst das Gewicht war ihr vertraut. Sie könnte sie unter ihrer Jacke verstecken und einfach zwischen den Kassen hindurch zu ihrem Wagen gehen. Sie könnte den schmiegsamen Körper wiegen und ihr etwas vorsingen, bis sie ihre blauen Augen schließen und an ihre Schulter gelehnt einschlafen würde. Sie könnte sagen, dass sie ihr Eigentum sei. Und für etwas, das ihr immer schon gehört hatte, brauchte sie nicht zu bezahlen. Tafeln über ihrem Kopf verkündeten, dass das Geschäft videoüberwacht wurde und die Ware elektronisch gesichert war. Was man nicht alles zu deinem Schutz unternimmt, raunte sie dem Baby zu und legte es in seine Schachtel zurück. Sie ging zur Kasse.
»Wie wollen Sie bezahlen?«, fragte der Kassierer. Argwöhnisch beobachtete er das ungezogene Kleinkind, das eine Spielzeugverpackung aufriss.
Die Frau zögerte mit der Antwort. »Bar. Vielen Dank.« Sie reichte dem Kassierer einige Zehn-Pfund-Noten. Dann stand sie da und starrte in die graue Anonymität der Straße hinaus, bis man ihr die Schachtel verpackt übergab.
Vorsichtig trug sie die weiße Schachtel hinaus. Auf keinen Fall wollte sie die Puppe falsch herum halten oder mit dem Gesicht nach unten drehen. Sie stellte die Schachtel auf den Rücksitz und sicherte sie mit dem Sicherheitsgurt, damit sie nicht herunterfiel, falls sie eine Kurve zu schnell nehmen sollte. Und so vorsichtig, als hätte sie ein lebendiges Baby an Bord, fuhr sie zurück nach Hause.
Als sie durch die Innenstadt von Oxford kam, begann gerade die erste Glocke zu läuten. Der Klang verfolgte sie durch die ganze Stadt. Überall zogen College-Pförtner an Stricken; mechanische Klöppel trafen auf Bronze. Die Frau hoffte inständig, dass es bald vorüber war.
»Es hört sich an wie bei einer Beerdigung«, sagte sie zu dem Baby in der Schachtel. »Das ist nicht gut. Sie sollten ein neues Leben willkommen heißen und nicht den Toten Lebewohl sagen.«
Drinnen im Haus nahm sie die Puppe aus der Schachtel, strich mit dem Finger über ihren kühlen Nacken, schmiegte den weichen Körper an ihre Schulter und gurrte leise. Mit dem Baby auf dem Arm stieg sie die Treppe zu ihrem Schlafzimmer hinauf. Sie öffnete einen Schrank. Zehn weitere Babypuppen saßen im Dämmerlicht auf Regalen, sahen sie an und streckten ihre steifen Händchen flehend nach ihr aus. Jede von ihnen trug ein weißes Häubchen, jede von ihnen starrte sie aus babyblauen Augen an.
»Da wären wir«, sagte sie zu der Neuerwerbung. »Hier bist du sicher.« Mit diesen Worten setzte sie sie zu den anderen Puppen. Dann streichelte sie jeder einzelnen Puppe über das starre Gesicht und sprach jede an.
»Ich wollte dich nicht verlieren. Es war nicht meine Schuld. Aber jetzt passe ich auf dich auf. Ich sorge für dich, das verspreche ich dir.« So ging sie die ganze Reihe entlang, bis sie das neueste Baby erreichte. »Schlaf schön«, sagte sie und streichelte der Puppe zum Abschied die Wange.
»Gute Nacht«, wandte sie sich an die anderen. »Passt auf euer neues Schwesterchen auf.« Mit diesen Worten schloss sie die Tür.
2. Kapitel
Die in diesem College zugelassenen Studenten
haben ihre Mahlzeiten gemeinsam einzunehmen, sollten sich möglichst gleich kleiden und
aufeinander achten.
Aus den Statuten des Leicester College
Ant hatte gefunden, was er suchte. Ein mit Computer, Drucker, einer ganzen Wand voller Bücher und einem riesigen, rechteckigen, mit Papieren übersäten Schreibtisch ausgestatteter Raum, der dem Besitzer offenbar als Arbeitszimmer diente. Über dem Computer hing ein Übersichtskalender an der Wand, dessen Eintragungen darauf schließen ließen, dass der Hauseigentümer zurzeit an einer Konferenz in Atlanta, Georgia teilnahm. Nach deren Ende würde er eine Woche in New Mexico verbringen und von dort aus für drei Tage nach Colorado fliegen, ehe er nach Oxford zurückkehrte. Ihnen blieben also noch mindestens zwölf Tage. Ant entspannte sich; auf jeden Fall hatte er ausreichend Zeit, das Haus gründlich in Augenschein zu nehmen.
Rechts vom Computer staubte ein altes Klavier vor sich hin, auf dessen Deckel drei Röhrenradios ihre Innereien preisgaben. Bei der weiteren Inspektion pfiff Ant leise durch die Zähne. Hier gab es eine Menge Dinge, die sich als nützlich erweisen konnten. Ein langes Sideboard im Esszimmer bog sich unter der Last vielerlei Öl-Lampen in den verschiedensten Reparatur-Stadien und den Bestandteilen von mindestens einem Dutzend Kaffeemaschinen. Hast du eine Ahnung, was du hier für Schätze hortest?, fragte Ant halblaut. Wann hast du zum letzten Mal Inventur gemacht? Falls Gren tatsächlich mehrere Tage für die Reparatur des Lieferwagens brauchte und sie Angel überzeugen konnten, ihre Hysterie zu einem anderen Zeitpunkt auszuleben, dann könnten sie hier in Oxford sicherlich ein paar Kröten machen. Mit tausend Ideen im Kopf wanderte Ant durch das Haus.
Die Luft war so abgestanden, als wäre das Haus schon seit längerer Zeit unbewohnt. Die einzige Gefahr bestand darin, dass vielleicht ein Nachbar, der einen Schlüssel besaß, zum Staubwischen, Heizung einschalten, Fische füttern oder Blumen gießen kommen könnte. Doch im Grunde befürchtete Ant nichts Derartiges. Die Wohnung sah nicht danach aus. Im Aquarium befand sich etwas, das wie dicker grüner Pelz aussah. Was mochte es sein? Unkraut? Algen? Ant spähte durch das Glas, konnte aber nichts erkennen. Schwammen da Fische? Piranhas vielleicht?
Die wenigen Zimmerpflanzen waren längst vertrocknet und tot. Eine Frau schien es in diesem Haus nicht zu geben. Ant holte zwei verräterische Umschläge aus dem Briefkasten, ließ aber die Notiz für den Milchmann wo sie war. In den zur Straßenseite liegenden Zimmern zog er die Vorhänge halb zu, damit niemand sehen konnte, wenn sich Menschen im Haus bewegten.
Er fand noch ein paar Wasserhähne aus Messing, einige Maschinenteile, die aussahen, als gehörten sie zu einem Automotor, und drei Bände einer Enzyklopädie aus dem neunzehnten Jahrhundert. Dieses Haus bot wahrlich ungeahnte Möglichkeiten für einen Unternehmer.
Kates Telefon klingelte. Es war Andrew.
»Liebste Kate, eigens für dich habe ich den Mülleimer im Aufenthaltsraum auf den Kopf gestellt und tatsächlich den Zeitungsartikel gefunden, den du haben wolltest. Aber während ich mich so durch gebrauchte Teebeutel und Einwickelpapier wühlte, kam mir der Gedanke, es wäre vielleicht einfacher gewesen, wenn du eben kurz bei Mrs Clack vorbeigegangen und dir ein eigenes Exemplar gekauft hättest.«
»Mrs Clack hat seit einer Stunde zu, Andrew. Außerdem schuldest du mir jetzt einen Gefallen weniger.«
»Hast du etwas zu schreiben?«
»Habe ich.«
»Also, die Frau, nach der du suchst, heißt Dr. Olivia Blacket und ist Dozentin für Englische Literatur am Leicester College.«
»Ist das nicht dein College? Kennst du sie vielleicht?«
»Ich fürchte nein. Ich bin lange nicht mehr da gewesen, weil ich die Gesprächsthemen am Mittagstisch immer einigermaßen öde finde.«
»Du bist auffällig zurückhaltend, Andrew. Was ist los mit ihr?«
»Nichts«, antwortete er einen Tick zu schnell. »Allerdings steht sie in dem Ruf, ein wenig schwierig zu sein.«
»Was soll das heißen? Hat sie einen schlechten Charakter? Nimmt sie Drogen?«
»Du übertreibst mal wieder maßlos, Kate. Sie ist eine außergewöhnlich gut aussehende Frau. Hochgewachsen, schlank, blond. Zieht sich gut an. Elegant, würde ich sagen. Was den Rest angeht, muss ich dich bitten, dir dein eigenes Urteil über Dr. Blacket zu bilden.«
»Mit anderen Worten: Ich soll ins Leicester College gehen, mich bei Frau Doktor melden lassen und abwarten, ob sie mich mit ihren exquisiten Perlenzähnen beißt?«
Andrew ignorierte die Spitze. »Am besten wäre es, wenn du von jemandem eingeführt würdest. Vielleicht kann dir dein Freund weiterhelfen.« Andrew brachte den Namen von Kates Liebhaber beim besten Willen nicht über die Lippen.
»Stimmt. Ich könnte Liam fragen. Apropos: Wie geht es Isabel?«
»Sie ist so süß wie immer.«
»Ich sehe dich dann beim Konzert. Tschüs, Andrew. Und vielen Dank.«
Liam Ross. Sein Fach war die Musik, aber er verbrachte so viel Zeit im College, dass ihm die Spezialistin auf dem Gebiet der Literatur des neunzehnten Jahrhunderts sicher schon über den Weg gelaufen war. Vermutlich gehörte dieses Fach zu den Lieblingsthemen beim gemeinsamen Mittagstisch der Dozenten. Liam hatte Kate zwar erzählt, dass sie beim Essen über kaputte Heizungen und Fußballergebnisse sprachen wie alle Normalsterblichen, aber Kate glaubte ihm kein Wort.
Sie sah auf die Uhr. Um diese Zeit dürfte Liam freihaben und sich in seinem Büro im College aufhalten. Sie wählte seine Nummer. Bereits beim zweiten Läuten nahm er ab.
»Ross.«
Er war beschäftigt. Er arbeitete. Er wollte nicht unterbrochen werden. Alles das schwang in dieser einzigen Silbe mit. Kate schaltete auf ihre freundlichste, einschmeichelndste Stimme um.
»Hallo Liam, hier ist Kate.«
»Ja?«
Sie sah ihn geradezu vor sich, wie er am Schreibtisch saß und seine langen Gliedmaßen auf dem rotbraunen Kelim-Teppich ausbreitete. Die Finger der rechten Hand lagen wahrscheinlich an der Stelle der Seite, die er gerade gelesen hatte, als sie ihn bei der Arbeit störte.
»Ich brauche deine Hilfe. Es geht um mein nächstes Buch.«
Sie hörte ihn seufzen. »Ich bin Musiker, falls du das vergessen haben solltest. Ich arbeite mit Noten, nicht mit Worten.«
»Ich weiß«, erwiderte sie knapp. »Aber du könntest mir trotzdem helfen.« Ihn um Hilfe bei ihrem Buch zu bitten hieß, dass sie ihm einen tiefen Einblick in ihr intimstes Innenleben bot. Etwas, das er mit ihr teilen durfte. Er sollte es nicht so abtun. Mit Andrew war es in dieser Beziehung wirklich erheblich einfacher gewesen.
»Genau genommen brauche ich Hintergrundinformationen über eine Person, eine Frau, die im neunzehnten Jahrhundert in Oxford gelebt hat«, fuhr sie fort.
»Versuch es doch mal in der Bodleian Bibliothek«, sagte er abweisend. Kate glaubte zu hören, wie am anderen Ende der Leitung eine Seite umgeblättert wurde.
»Habe ich schon. Ich suche nach etwas Neuerem. Etwas, das bisher nicht veröffentlicht ist.« Beachte mich wenigstens, hätte sie am liebsten in die Muschel geschimpft. Speise mich nicht mit Antworten ab, die ich mir selbst geben könnte! Leg endlich das Buch weg und konzentriere dich wenigstens ein paar Minuten lang auf mich!
»Nicht mein Arbeitsgebiet.«
»Habe ich mich etwa mit Arbeit rausgeredet, als du mich angerufen hast, um dich über das miserable Management in dem Theater zu beschweren, wo du deine Oper unterbringen wolltest? Habe ich dir vielleicht erklärt, es wäre sowieso egal, weil ihr ohnehin alle nur blutige Amateure seid? Also hör mir endlich zu und hilf mir.«
»Weiter.«
»Ich habe gehört, dass es bei euch am College eine Dozentin gibt, die Briefe und Tagebücher von Maria Susanna Taylor in ihrem Besitz hat.«
»Von wem?«
Kate seufzte auf. »Charles Dickens pflegte eine jahrelange Freundschaft, möglicherweise auch eine Liebesbeziehung mit einer Schauspielerin namens Ellen Ternan, besser bekannt als Nelly. Und diese Nelly hatte eine Schwester. Sie hieß Maria und war mit einem gewissen Rowland verheiratet, seines Zeichens Braumeister in Oxford.« Allmählich bekam sie Übung darin, den Romanhintergrund mit wenigen Worten wiederzugeben; dabei hoffte sie inständig, später in der Lage zu sein, den Textumfang für ihr Buch auf über hunderttausend Worte zu erweitern. Sie wusste, dass sie Liam längst von Maria und Nelly erzählt hatte. Vielleicht würde er sich ja dieses Mal ein paar Tage länger erinnern – wenigstens bis zum nächsten Mal.
Liam legte eine weitere Pause ein. »Jetzt, wo du es sagst: Ich glaube, ich habe da etwas läuten hören. Könnte sein, dass wir hier jemanden haben, der damit zu tun hat.«
»Könntest du mich der Dame bitte vorstellen?«
»Mal sehen, was ich tun kann.«
»Bald?«
»So bald wie möglich.«
»Prima. Und vielen Dank. Sehen wir uns am Wochenende?«
»Soviel ich weiß, ja.« Mit diesen Worten legte er auf.
Kate ermahnte sich, Liams Mangel an Interesse nicht allzu persönlich zu nehmen. Immerhin kamen sie zurzeit wunderbar miteinander aus. Sie hatte sich sogar überlegt, ihn zu fragen, ob er nicht zu ihr ziehen wollte – nun ja, wenigstens für ein paar Tage in der Woche. Das eben abgeschlossene Gespräch durfte sie höchstens als winzigen Stolperstein auf dem sonst so glatt verlaufenden Weg ihrer Beziehung ansehen. Wahrscheinlich hatte sie ihn mitten in einer wichtigen Lektüre erwischt. Auch sie selbst wurde leicht ungeduldig, wenn jemand sie bei der Arbeit unterbrach, und es gab keinen Grund, Liams Beruf für weniger wichtig zu halten als ihren eigenen. Doch so sehr sich Kate auch zu überzeugen versuchte, dass alles in bester Ordnung war – sie verspürte weiterhin eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Verlauf des Gesprächs. Hätte er nicht ein wenig mehr Enthusiasmus für das gemeinsame Wochenende an den Tag legen können?
Liam Ross hatte gerade seinen Computer abgeschaltet und war dabei, einen Stapel studentischer Hausarbeiten zu korrigieren. Dabei summte er eine Passage eines Vivaldi Concertos. Es war Zeit für einen angenehm entspannenden Feierabend im Norden Oxfords. Gerade wollte er die Tür hinter sich abschließen, als das Telefon klingelte und er dieses unbefriedigende Gespräch mit Kate Ivory führen musste.
Vier Minuten später überquerte er den mit Clematis bewachsenen vorderen Innenhof, wo er sein Fahrrad abgestellt hatte. Als er das Schloss öffnete und langsam Richtung Norden strampelte, sang er nicht mehr.
In der ersten Etage befanden sich drei Schlafzimmer. Das Dachgeschoss war zu einem einzigen großen Raum ausgebaut, der offenbar als Werkstatt benutzt wurde. Im Erdgeschoss gab es eine Gästetoilette und im ersten Stock das Bad, wo Ant in das Haus eingedrungen war. Im Keller fand er einen mit Waschmaschine und Trockner ausgestatteten Wirtschaftsraum. Sehr gut. Allmählich wurde es höchste Zeit, einen Waschtag einzulegen: Die penetranten Ausdünstungen von Dimes Klamotten gingen Ant allmählich auf die Nerven.
Als Dime darum gebeten hatte, in die Familie aufgenommen zu werden, musste Ant ihn zunächst beiseite nehmen und ihm seine Vorstellung von persönlicher Hygiene erklären. Zwar hatte sich Dime durchaus bereitwillig gezeigt, Ants Ansprüchen zu genügen, verfügte allerdings nur über sehr spärliche Erfahrung, wie »Sauberkeit« zu riechen hatte. Eines Tages, nachdem Coffin in ihrer damaligen Bleibe ein Bad genommen und zum Waschen eine teure Rosenseife benutzt hatte, schnüffelte Dime an Coffins blassen Ohren und rief hingerissen: »Toll! Wirklich toll!« Coffin allerdings hatte ihn von sich geschubst. »Hau ab!« Doch auch nachdem Dime selbst gebadet hatte, roch er weiter nach altem Schweiß und den Fritten des Abends zuvor. Ant musste ihn nun noch davon überzeugen, dass man nach einem Bad tunlichst auch die Kleidung wechseln sollte.
Der Hausbesitzer schien Ants Vorstellung von Reinlichkeit nicht unbedingt zu teilen. Nicht nur, dass alles mit einer Staubschicht bedeckt war – auch die Treppe war offenkundig seit langer Zeit nicht mehr geputzt worden. Überall lagen Staubflocken und zerknüllte Tempos herum, und unter den Betten fand Ant ein paar vereinzelte Socken. Die Küche konnte sich einigermaßen sehen lassen, denn der Abwasch war gemacht, auch wenn der Herd seit mindestens zwei Jahren nicht mehr geputzt worden war. Angel würde das Bad gründlich putzen müssen. Ant ekelte sich vor Haaren im Bad und würde nie und nimmer in eine Wanne mit einem Schmutzrand steigen. Eigentlich müsste der Mann uns dankbar sein, dachte Ant. Wir werden das Haus sauberer verlassen, als wir es vorgefunden haben. Aber nicht zu sauber, ermahnte er sich. Wir wollen doch nicht, dass er argwöhnt, es könne einer im Haus gewesen sein. Ant hatte die Erfahrung gemacht, dass sich die meisten Leute nicht allzu genau an den Zustand ihrer Wohnung erinnerten, wenn sie auf Reisen gingen. Meistens fühlten sie sich unangenehm berührt, wenn sie heimkehrten – selbst nach kurzer Abwesenheit – und Schmutz vorfanden; dabei vergaßen sie völlig, dass sie eigentlich immer so lebten. Die Familie würde jedenfalls ein bisschen sauber machen, ohne dass der Eigentümer gleich Verdacht schöpfen musste.
Andererseits würde er sicher etwas bemerken, sinnierte Ant. Sie würden bestimmt das ein oder andere verändern. Einen Moment lang blieb Ant im Flur stehen und träumte von der Zukunft. Allmählich wurde es dunkel. Ohne Licht konnte er kaum noch etwas erkennen. Es war Zeit, zu den anderen zurückzukehren.
Normalerweise wechselte Ant die Schlösser aus, wenn er mit der Familie irgendwo einzog. Allerdings würden sie in diesem Haus nur ein paar Tage bleiben, und es war kaum zu erwarten, dass der Besitzer vor ihrem Verschwinden zurückkehrte. Wenn sie die Haustür während ihrer Anwesenheit immer ordentlich verriegelten, würde niemand unerwartet eindringen können, selbst wenn er einen Schlüssel besaß.
Ehe er die Familie holen ging, stieg Ant noch einmal in den Keller hinab. Es könnte nicht schaden, die Heizung ein wenig höher zu drehen, dachte er. Gegen Abend würde es sicher recht kühl werden, und vor allem Angel brauchte die Wärme. Anschließend verriegelte er sorgfältig alle Türen, dachte im letzten Moment daran, auch das Badezimmerfenster abzusperren, und verließ das Haus leise durch die Eingangstür. Am liebsten hätte er die Fingerspuren vom Lack gewaschen und den Messingbriefkasten poliert, doch er wusste, dass das keine besonders gute Idee war.