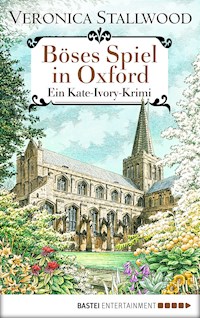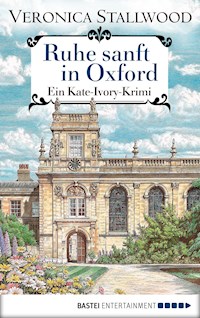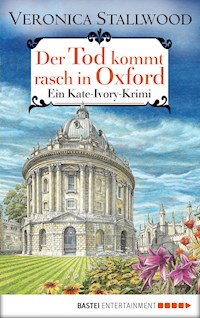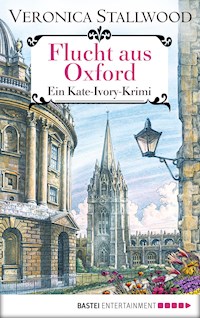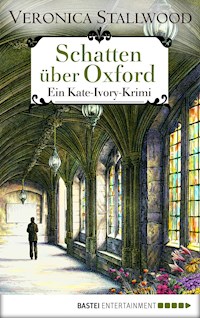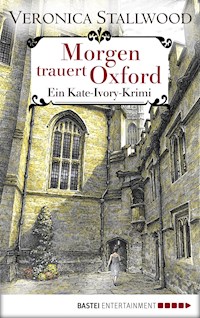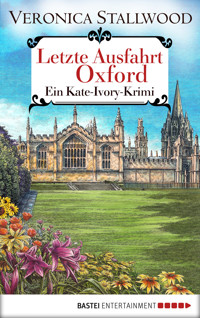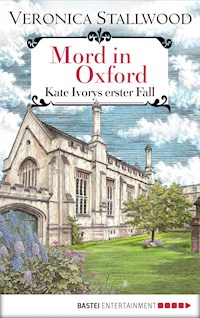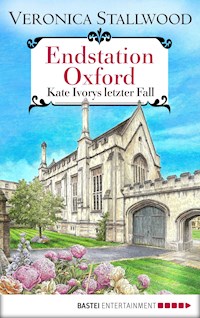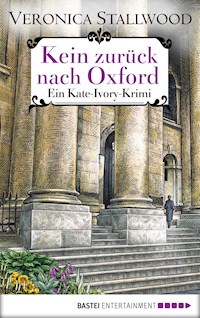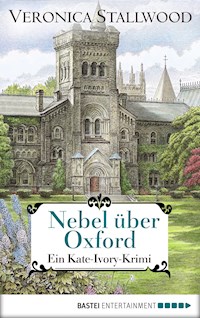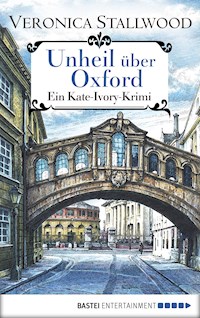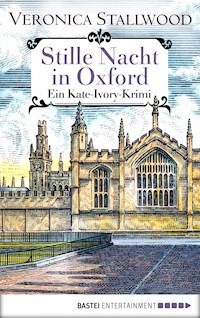
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kate Ivory
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Wo ist Joyce Fielding? Kate Ivory sucht nach der unbescholtenen älteren Dame, die kurz vor Weihnachten verschwunden ist. Bei ihren Nachforschungen stößt sie ausgerechnet in Joyce' Wohnung auf eine böse Überraschung - die Leiche eines Mannes. Der Verdacht liegt nahe, dass die Vermisste etwas damit zu tun hat, doch Kate ist überzeugt, dass Joyce keine Mörderin ist. Vielmehr spürt sie instinktiv, dass die alte Dame sich selbst in Gefahr befindet ...
Ein neuer Fall für die ermittelnde Schriftstellerin Kate Ivory. Eine atmosphärische Kriminalserie mit einer besonderen Heldin, deren scharfe Beobachtungsgabe und ungewöhnliche Methoden die gemütliche britische Stadt Oxford ordentlich durchwirbeln. Perfekt für Liebhaber von intelligenter und charmanter Cosy Crime, für Leser von Martha Grimes und Ann Granger.
"Stallwood gehört zur ersten Riege der Krimiautoren." Daily Telegraph
"Stallwoods Heldin sprüht vor Intelligenz und Witz." The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1 Joyce
2 Kate
3 Joyce
4 Kate
5 Joyce
6 Kate
7 Roz
8 Kate
9 Emma
10 Kate
11 Kate
12 Roz
13 Kate
14 Joyce
15 Kate
16 Roz
17 Kate
18 Roz
19 Kate
20 George und Kate
21 Roz
22 Ruth
23 Kate
24 Kate
25 Roz
26 Kate
27 Kate
28 Joyce
29 Kate
30 Kate
31 Joyce
32 Kate
33 Joyce
34 Kate
35 Joyce
36 Kate
37 Roz
38 Kate
39 Stephen
40 Kate
41 Ruth
42 Kate
43 Kate
44 Joyce
45 Roz und George
Über das Buch
Wo ist Joyce Fielding? Kate Ivory sucht nach der unbescholtenen älteren Dame, die kurz vor Weihnachten verschwunden ist. Bei ihren Nachforschungen stößt sie ausgerechnet in Joyce’ Wohnung auf eine böse Überraschung – die Leiche eines Mannes. Der Verdacht liegt nahe, dass die Vermisste etwas damit zu tun hat, doch Kate ist überzeugt, dass Joyce keine Mörderin ist. Vielmehr spürt sie instinktiv, dass die alte Dame sich selbst in Gefahr befindet … Ein neuer Fall für die ermittelnde Schriftstellerin Kate Ivory. Eine atmosphärische Kriminalserie mit einer besonderen Heldin, deren scharfe Beobachtungsgabe und ungewöhnliche Methoden die gemütliche britische Stadt Oxford ordentlich durchwirbeln. Perfekt für Liebhaber von intelligenter und charmanter Cosy Crime, für Leser von Martha Grimes und Ann Granger. »Stallwood gehört zur ersten Riege der Krimiautoren.« Daily Telegraph »Stallwoods Heldin sprüht vor Intelligenz und Witz.« The Times
Über die Autorin
Veronica Stallwood kam in London zur Welt, wurde im Ausland erzogen und lebte anschließend viele Jahre lang in Oxford. Sie kennt die schönen alten Colleges in Oxford mit ihren mittelalterlichen Bauten und malerischen Kapellen gut. Doch weiß sie auch um die akademischen Rivalitäten und den steten Kampf der Hochschulleitung um neue Finanzmittel. Jedes Jahr besuchen tausende von Touristen Oxford und bewundern die alten berankten Gebäude mit den malerischen Zinnen und Türmen und dem idyllischen Fluss mit seinen Booten ? doch Veronica Stallwood zeigt dem Leser, welche Abgründe hinter der friedlichen Fassade lauern.
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für dieOriginalausgabe:
© 1999 by Veronica Stallwood
Titel der englischen Originalausgabe: »Oxford Shift«
Originalverlag:Headline Book Publishing, A division ofHodderHeadline
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2007 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Anke Stockdreher
Titelillustration: Dave Hopkins/phosphorart
Umschlaggestaltung: Bianca Sebastian
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN: 978-3-7325-3465-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
1Joyce
Als sie den Schlüssel im Schloss drehte und die Tür aufstieß, merkte sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Zwar neigte ihre Einbildungskraft nicht zur Übertreibung, doch in diesem Moment spürte sie eine zitternde Anspannung in der Luft wie einen kalten Atemhauch auf der Wange.
Anstatt die Tür vernehmlich ins Schloss fallen zu lassen und zu rufen »Ich bin es nur!«, wie sie es sonst tat, blieb sie auf der Schwelle stehen, starrte die geschlossenen Türen im Flur an und fragte sich, welches der Zimmer leer sein mochte und in welchem sich wohl ihre neue Freundin Ruth aufhielt.
Ihr fiel auf, dass sie unwillkürlich den Atem angehalten hatte; jetzt atmete sie mit einem leicht pfeifenden Geräusch aus. Erneut lauschte sie. Irgendetwas an der Stille, die in der Wohnung herrschte, ließ sie vermuten, dass sie nicht allein war. Jemand war da. Wenn es jedoch Ruth sein sollte, warum war sie ihr dann nicht mit ihrem breiten Lächeln und dem üblichen »Das Teewasser ist schon aufgestellt« entgegengekommen? Während des gesamten Heimwegs hatte Joyce sich auf eine Tasse Tee gefreut.
»Ich bin es nur«, sagte sie in das Schweigen hinein. Doch die Worte kamen als heiseres Flüstern aus ihrer trockenen Kehle und wurden von der Leere des Flurs geschluckt. »Bist du zu Hause?«
Sie machte einige Schritte auf die Küche zu, blieb aber sofort wieder stehen. Die Wohnung gehörte Ruth, nicht ihr. Zwar hatten sie nie über die Eigentumsverhältnisse gesprochen, doch in dieser Hinsicht bestand eine Art schweigende Übereinkunft. Joyce war als Ruths Gast hier, und da sie sich erst seit drei Tagen in der Wohnung aufhielt, würde sie sich keine Freiheiten herausnehmen. Sie war ohnehin kein Mensch, der Gegebenheiten als selbstverständlich hinnahm. Nie hätte sie ohne Ruths ausdrückliche Erlaubnis die Küche, geschweige denn einen der anderen Räume betreten. »Komm rein und setz dich«, hätte Ruth zur Begrüßung sagen müssen, worauf Joyce geantwortet hätte: »Ich habe uns Schokoladenkekse mitgebracht.« Eine Tasse Tee und ein Schokoladenkeks wären ihr in diesem Augenblick wie der Himmel auf Erden vorgekommen.
Heute fühlte sie sich zum ersten Mal wie eine Fremde; als wäre sie widerrechtlich in die Wohnung eingedrungen. Sie musste sich zusammennehmen. War es nicht lächerlich, so nervös zu reagieren? Sie setzte die Einkaufstasche ab und schüttelte den schmerzenden Arm.
Vom anderen Ende der Wohnung schienen gedämpfte Geräusche zu kommen – oder bildete sie sich das nur ein? Ruth war bestimmt da. Gleich würde sie auftauchen und sagen: »Komm in die Küche, Joyce. Magst du eine Tasse Tee?« Oder vielleicht auch: »Ich war einkaufen. Hast du Lust, dir meine Schnäppchen anzuschauen?« Wie ein Kind würde sie Ruth in ihr Zimmer folgen und ihr zusehen, wie sie bunte Plastiktüten leerte und Päckchen auspackte. Eine Kleinigkeit für Joyce war immer dabei.
Doch Ruth kam nicht aus ihrem Zimmer. Ungeduldig wie ein Kind trat Joyce von einem Fuß auf den anderen. Warum ging sie nicht einfach in die Wohnung und suchte? Aber Ruth war ein so wunderbarer Mensch, so freundlich und so großzügig, dass Joyce es nicht übers Herz gebracht hätte, ihre Intimsphäre zu stören – ihren Freiraum, wie sie es gern nannte.
Sie hatte den Eindruck, schon mindestens eine Stunde lang so dazustehen, obwohl es höchstens eine Minute gewesen sein konnte. Plötzlich sah Joyce, dass eine der Türen einen Spaltbreit offen stand. Es kam ihr vor wie Zauberei; ihr war, als hätte keine menschliche Hand die Klinke gedrückt und die Tür geöffnet. Sie blinzelte. Nur Sekunden zuvor, das wusste sie ganz sicher, war die Tür noch fest geschlossen gewesen.
Und ebenso plötzlich stand Ruth in der Tür. Ihre stämmige Gestalt ließ keinen Blick in das Wohnzimmer hinter ihr zu. Zwar war Ruth keineswegs übermäßig korpulent oder außergewöhnlich groß, doch mit ihren fast einsachtzig überragte sie Joyce um ein gutes Stück und war nicht nur muskulös, sondern auch ausgesprochen kräftig gebaut. Wenn sie eine Tür versperrte, kam man ohne ihre Zustimmung nicht an ihr vorbei. Trotz ihres massigen Körpers wirkte ihr Gesichtsausdruck sanft. Vielleicht aber auch leer. Überrascht stellte Joyce fest, dass ihr dieser Gedanke zum ersten Mal kam. Möglicherweise wollte Ruth aber auch nur nicht zeigen, was in ihrem Kopf vorging. Ihre dunkelbraunen Augen, die hinter Brillengläsern blitzten, starrten Joyce an. Wie eine Eidechse, dachte Joyce und fragte sich, warum sie ihre Freundin plötzlich in einem völlig neuen Licht sah. Ruths dunkle, kurz geschnittene Locken, die bereits erste graue Ansätze zeigten, waren wie immer aus dem Gesicht gebürstet und standen vom Kopf ab, als ob sie eben einen elektrischen Schlag bekommen hätte. Sie trug eine beige Bluse und einen Tweedrock in der gleichen Farbe, ihre Schultern waren so breit, ihre Hüften so rund und ihre Beine so stämmig wie eh und je. Und doch wirkte sie irgendwie verändert. Sie hielt die weißen, kräftigen Hände mit aufwärts gerichteten Handflächen locker vor dem Körper verschränkt, als wolle sie demonstrieren, dass sie nichts zu verbergen hatte.
»Ja?«, fragte Joyce nervös und erinnerte sich an die seltenen Male, als sie sich als Schülerin vor der Schuldirektorin zu verantworten hatte.
»Ich fürchte, es gibt da eine kleine Unannehmlichkeit«, sagte Ruth. »Wir müssen weg.«
»Weg?«, fragte Joyce bestürzt.
»Die Wohnung verlassen«, erklärte Ruth geduldig.
»Die Wohnung verlassen?« Joyce wusste, wie dumm es klang, wenn sie jedes Wort wiederholte. »Was für eine Unannehmlichkeit? Warum müssen wir gehen?«
»Für Erklärungen habe ich jetzt keine Zeit. Außerdem bin ich sicher, dass du es ohnehin nicht erfahren möchtest.«
Ruth wusste sehr genau über die Dinge Bescheid, vor denen Joyce gern die Augen verschloss.
»Ich weiß, es ist unangenehm«, sagte Ruth mit ihrer wohlerzogenen Klein-Mädchen-Stimme, »und ich möchte mich dafür entschuldigen. Aber leider müssen wir wirklich hier fort. Und zwar möglichst schnell.«
»Was hast du da im Gesicht?«, fragte Joyce und wünschte sich sofort, sie hätte den Mund gehalten.
»Wo denn?«
»Neben dem Ohr.« Es war die Stelle, die man gern übersah, wenn man sich vor einem Spiegel reinigte und dabei vergaß, den Kopf zu drehen.
Ruth wischte den Fleck weg. »Ach, das ist nichts«, sagte sie. »Absolut gar nichts.«
»Im ersten Moment sah es aus wie getrocknetes Blut«, verteidigte sich Joyce.
»Ach was«, tat Ruth das Thema mit fester Stimme ab. »Am besten, du gehst jetzt und packst. Du wirst sicher nicht lang brauchen.« Jetzt lächelte Ruth sie an. Ihr breites Lächeln blähte ihre Wangen und hob die Brillengläser bis fast zu den Augenbrauen, was ihr ein erstauntes Aussehen verlieh.
»Ich habe aber keinen Koffer«, bemerkte Joyce kläglich.
»Stimmt ja! Wie dumm von mir! Warte …«, das Wort klang weniger wie eine Bitte als vielmehr wie ein Befehl, »… ich hole dir einen.«
Ruth verschwand in ihrem Schlafzimmer und kam kurz darauf mit einem hübschen dunkelblauen Koffer zurück, der mit Rollen und einem Griff ausgestattet war. Ein richtiger Stewardessen-Koffer, dachte Joyce.
»Wie lieb von dir!« Ruths Liebenswürdigkeit überwältigte sie fast. Ihr eigener Koffer, den sie in ihrem früheren Leben zurückgelassen hatte, war aus grünkariertem Nylon, hatte abgestoßene Ecken und besaß keine Rollen.
»So, Liebes, und jetzt eil dich.« Ruths Gesicht wirkte nun wieder so heiter wie immer, und ihre Stimme klang besänftigend wie die einer Krankenschwester, die ihrem Patienten eine Spritze verabreicht.
Joyce nahm den dunkelblauen Koffer mit in ihr Zimmer, legte ihn auf das Bett und begann, ihre Habseligkeiten zusammenzufalten und ordentlich einzupacken. Sie besaß nicht viel, weil sie ihr voriges Zuhause ziemlich überstürzt verlassen hatte. Es war ihr schwergefallen, die Zwanzig-Pfund-Note zu akzeptieren, die Ruth ihr in die Hand gedrückt hatte. »Kauf dir erst einmal etwas Anständiges zum Anziehen«, hatte Ruth gesagt, ihre Finger um den Geldschein geschlossen und ihrer Hand einen leichten Klaps versetzt. »Du hast es verdient, dir ein kleines Vergnügen zu gönnen.« Joyce hatte sich geschworen, dass sie das Geld zurückzahlen würde, doch bis ihre Rente ausgezahlt wurde, würde noch einige Zeit ins Land gehen. Sie hatte Ruth vorgeschlagen, in ihre Wohnung zurückzukehren und wenigstens ein paar ihrer eigenen Sachen zu holen, doch davon wollte Ruth nichts hören.
»Du solltest nicht einmal im Traum daran denken zurückzugehen«, hatte Ruth sie mit unangenehm schnarrender Stimme zurechtgewiesen. »Du hast jetzt ein neues Leben begonnen und musst das alte endgültig hinter dir lassen. Sagt nicht schon die Bibel, dass man neuen Wein nicht in alte Flaschen füllen sollte? Nein, wir bringen die leeren Flaschen zum Glascontainer und kaufen uns neuen Wein im Supermarkt.« Dabei strahlte sie Joyce an, reichte ihr eine Tasse Tee und erklärte ihr zum soundsovielten Mal, welch gute Werke sie miteinander vollbringen würden, während Joyce versuchte, sich an den genauen Wortlaut von Markus 2,22 zu erinnern, und überlegte, ob Ruth den wahren Sinn dieser Textstelle erfasst hatte.
Es kostet mich so gut wie keine Zeit, mein gesamtes Leben zusammenzupacken, dachte Joyce, während sie ihren Waschlappen um ihre Zahnbürste wickelte und wünschte, sie hätte ihren wasserdichten Kulturbeutel zur Hand. Doch wenn sie ihr Handtuch unter die feuchten Utensilien legte, konnte sie immerhin hoffen, dass ihre Unterwäsche nicht nass wurde.
Als sie fertig war, rollte sie den Koffer in den Flur, stellte ihn neben der vergessenen Einkaufstasche ab und wartete auf Ruth. Natürlich würde die Freundin länger brauchen, denn sie hatte weit mehr zu packen als Joyce.
»Kann ich dir helfen, Ruth, Liebes?«, rief sie durch die geschlossene Tür.
»Danke, aber ich bin so gut wie fertig«, kam Ruths gedämpfte Antwort. Und dann ging die Wohnzimmertür auf, Ruth streckte ihren Kopf in den Flur und fügte mit scharfer Stimme hinzu: »Bleib, wo du bist, Joyce. Rühr dich nicht vom Fleck!«
Joyce hörte, wie Möbel verschoben und schwere Gegenstände über den Fußboden gezogen wurden. Sie fühlte sich alt und nutzlos, wie sie so dastand, während Ruth schwer zu schuften schien. Warum ließ die Freundin sich nicht helfen? Traute sie Joyce etwa nicht zu, zu ihrer Zufriedenheit zu arbeiten? Aber so ist Ruth nun einmal – eine wahre Perfektionistin, dachte sie, während sie sich müßig im Flur umblickte.
Der Lack an der Eingangstür war zwar alt und zerkratzt, doch er war peinlich sauber, und Schloss und Klinke blinkten wie frisch poliert. Der mit gelben und roten Sonnenblumen gemusterte Läufer im Flur war hässlich, aber zeigte nicht das geringste Stäubchen. Jemand hatte sich sogar die Mühe gemacht, die Fußspuren der vergangenen Jahre zu entfernen. Jetzt wies der Teppich einige hellere Flecken auf und war sehr sauber. Derselbe Jemand hatte auch die Fußleisten gereinigt und die Glaseinsätze an den Türen abgewischt. Joyce war von alledem sehr angetan. Sie und Ruth hatten in der Wohnung nach ihren eigenen Vorstellungen geschaltet und gewaltet. Beide waren sich absolut einig, dass Sauberkeit und Ordnung zu den wichtigsten Dingen im Leben gehörten. Manche Menschen hielten so etwas sicherlich für altmodisch, doch für Joyce war eine ordentliche Wohnung gleichbedeutend mit einem reinen Gewissen. Wenn man nachlässig wurde, wenn man Schmutz und Unordnung die Oberhand übernehmen ließ, geriet man schnell auf den schlüpfrigen Pfad der Unmoral und der Verdammnis. Und Verdammnis gehörte ebenfalls zu den Worten, die man in einem modernen, angeblich liberalen Haushalt nicht auszusprechen wagte.
Sie und Ruth jedoch hatten lange und sehr aufschlussreiche Gespräche über Verdammnis geführt. Beide wussten, ohne dass es einer besonderen Erwähnung bedurfte, dass man sofort nach dem Essen abzuwaschen hatte, und zwar bevor man es sich in den roten Sesseln bequem machte. Spülen, abtrocknen, wegräumen. Alles musste sauber und an seinem Platz sein.
Ruth erschien kurz an der Tür, lächelte Joyce zu und verschwand in ihrem eigenen Schlafzimmer. Es war erstaunlich, wie schnell sie sich bewegen konnte, wenn sie wollte. Mit einer vollgestopften schwarzen Mülltüte in jeder Hand tauchte sie wieder auf und ließ die beiden Säcke neben Joyce auf den Läufer fallen.
»Du trägst doch hoffentlich Handschuhe, Joyce?«, erkundigte sie sich.
»Nur einen«, antwortete Joyce, die den zweiten Handschuh in der Hand hielt.
»Zieh sie beide an. Gutes Kind!«, lobte Ruth, als wäre Joyce höchstens fünf und nicht schon über sechzig Jahre alt. Sie blieb stehen, bis Joyce den zweiten Handschuh übergestreift hatte, dann wuselte sie wieder davon.
»Bin gleich fertig!«, rief sie.
»Wo gehen wir überhaupt hin? Und wer hilft uns mit dem Gepäck?« Joyce sprach die Fragen zwar laut aus, erwartete aber keine Antwort. In der Vergangenheit hatte es immer einen Mann gegeben, der solche Probleme für sie löste. Wie aber sollten zwei einsame Frauen mit dieser Art praktischer Schwierigkeiten umgehen?
Plötzlich tauchte Ruth neben ihr auf. »Mach dir keine Sorgen«, sagte sie. »Ich habe angerufen. Gleich kommt ein Auto und bringt uns in unsere neue Wohnung.«
Ein Auto? Joyce betrachtete das Gepäck, das sich an der Eingangstür stapelte.
»Na ja, eher ein Lieferwagen«, erklärte Ruth und wuchtete eine Plastiktüte auf den Haufen. Die pralle Hülle sah aus, als enthielte sie eine Daunendecke.
Joyce hörte das Geräusch von laufendem Wasser aus der Küche und sah zu, wie Ruth mit Schrubber und Eimer durch den Flur lief. Sie trug Gummihandschuhe.
»Ich würde dir wirklich gern helfen«, sagte Joyce. Sie stand neben ihrem kleinen Koffer und fühlte sich völlig nutzlos.
»Ich will die Wohnung einfach nur sauber hinterlassen«, rief Ruth ihr zu. Mit einem gelben Staubtuch in der Hand tauchte sie erneut auf und wienerte die Beschläge der Eingangstür.
Irgendwann stand sie endlich neben Joyce. Sie trug ihren beigen Mantel und einen braunen Filzhut, den sie tief über Stirn und Ohren gezogen hatte. Ihre Hände steckten in dicken Lederhandschuhen.
Seit sie Joyce erklärt hatte, dass sie die Wohnung verlassen müssten, waren kaum dreißig Minuten vergangen.
»So! Das war doch nicht schlecht, oder?«
Während sie sprach, klopfte jemand an die Tür.
»Da ist unser Wagen«, verkündete Ruth. »Sei so lieb und mach auf – jetzt geht es los!«
2Kate
Um diese Jahreszeit setzte die Dämmerung bereits um drei Uhr nachmittags ein. Gegen vier würde Kate das Licht anmachen müssen, und um Viertel nach vier wandten sich die Gedanken unwiderruflich dem Nachmittagstee zu, gepaart mit der Frage, wie man den langen Abend verbringen würde. Wenn ab halb fünf der Himmel ein trübes Blau annahm und die Straßenbeleuchtung ihr schwefliges Licht auf den schmutzigen Bürgersteig warf, wurde klar, dass für den Rest des Tages nicht mehr an ernsthafte Arbeit zu denken war.
Kate Ivory warf einen müßigen Blick aus dem Fenster und überlegte, ob sie vielleicht den Rasen zum letzten Mal in diesem Jahr mähen und anstelle der verstreut wachsenden Gänseblümchen und des Löwenzahns ein paar Blumenzwiebeln setzen sollte, ehe der Frost den Boden erstarren ließ. Doch dann siegte ihre Trägheit, und sie sagte sich, dass es bereits spät im November war und dass sie den Garten gut und gern bis zum Frühjahr sich selbst überlassen konnte.
Regen klatschte gegen die Fensterscheiben ihres Wohnzimmers. Doch auch der Wind, der an den Rahmen rüttelte, erschütterte Kates innere Zufriedenheit nicht im Geringsten. Das Sofa, auf dem sie sich ausgestreckt hatte, war von Kopf bis Fuß bequem und hatte genau den samtigen Rosaton, der zu ihrem Gemütszustand passte. Auf dem Fensterbrett stand eine dunkelgrüne Vase mit Freesien, im Hintergrund waren die sanften Klänge einer CD zu hören. Unten im Arbeitszimmer spuckte der Drucker die Seiten ihres neuen, soeben beendeten Romans eine nach der anderen aus. Wenn Kate konzentriert lauschte, konnte sie das Greinen und Knacken hören, mit dem das Gerät Zeile für Zeile ihrer Prosa auf blütenweißem Papier verewigte. Sie stellte sich vor, wie sich die Blätter mit Buchstaben füllten, bereit, ihre Leser in Fantasiewelten zu entführen. Kurz und gut: Es war wundervoll, nach Wochen erzwungener Abwesenheit endlich wieder zu Hause zu sein.
Einige Monate zuvor hatte sich in ihrem Haus in der Agatha Street eine Tragödie abgespielt, nach der sie eine gewisse Auszeit gebraucht hatte. Sie hatte sich im Cottage einer Freundin auf dem Land verkrochen, dort allerdings schnell gemerkt, dass sie im Grunde eine unverbesserliche Großstadtpflanze war. Ich spüre nun einmal lieber Asphalt unter meinen Joggingschuhen als den Schlamm eines Saumpfads, dachte sie. Ich liebe das Geräusch von Autoverkehr – in einer gewissen Entfernung – und das gelbe Licht der Straßenlaternen. Und ich bevorzuge Dieseldünste gegenüber dem Gestank von Silage. Keinen Kilometer von meiner Haustür in Fridesley entfernt gibt es Restaurants, Kinos und Geschäfte voll toller Kleider und kulinarischer Genüsse. Wie langweilig ist doch dagegen der Anblick von Kühen auf matschigen Wiesen und das unbarmherzige Zwitschern kleiner brauner Vögel!
Vielleicht gehe ich morgen ein wenig in die Stadt und kaufe mir etwas Nettes zum Anziehen, dachte sie träge. Vielleicht probieren Roz und ich das neue Fischrestaurant in St. Clement’s aus. Vielleicht lümmele ich mich aber auch nur auf meinem Sofa und tue gar nichts.
Aus dem Haus nebenan drang die übliche Geräuschkulisse der Familie Venn. Von draußen hörte Kate das Rollen und Klappern von Skateboards. Autos fuhren vorüber, deren Musikanlagen so weit aufgedreht waren, dass das Wummern der Bässe die ganze Straße entlangdröhnte. Ein Hubschrauber knatterte über die Häuser hinweg, und in der Ferne erklang das Jaulen einer Krankenwagensirene auf dem Weg zum Hospital. Kate liebte jeden einzelnen Laut. Für sie bedeutete es, dass sich vor ihrem Fenster das wahre Leben – und manchmal auch der Tod – abspielte. Auf dem Land hatte es nichts anderes gegeben als das Schweigen des wachsenden Getreides und das rhythmische Wiederkäuen der Kühe auf der Weide nebenan; nur ab und zu durchbrach das Motorengeräusch eines Traktors die Langeweile. Als sie endlich das Häuschen ihrer Freundin Callie hinter sich abschließen und mit ihren beiden Koffern und ihrem Computer nach Fridesley zurückkehren konnte, hatte sie sich richtig erleichtert gefühlt, zumal ihre Mutter Roz ihr in ihrem dottergelben Käfer nach Oxford folgte. Auch das hatte ihr ein gutes Gefühl vermittelt.
Nachdem sie in ihr eigenes Haus zurückgekehrt war, hatte sie, bestärkt vom Lärmpegel der Großstadt, beschlossen, ihr Territorium zu verteidigen und es von den Gespenstern der Vergangenheit zurückzufordern. Sie hatte Zeichnungen gemacht, Farbtabellen studiert und Stoffmuster geprüft. Sie hatte den Teppichboden im Flur herausgerissen und zur Müllkippe gebracht. Zusammen mit Roz war sie durch Baumärkte gepilgert, hatte alle möglichen Utensilien gekauft und das halbe Haus auf den Kopf gestellt.
Vorbei war es mit den geschmackvollen, hellen, abgetönten Farben. Statt dessen prunkte die Wohnung in Hyazinthblau, Marine und Pistaziengrün. Kate veränderte die Beleuchtung und hängte große, bunt gerahmte Kunstdrucke an die Wände. Sie verwandelte den Eingangsbereich und das Treppenhaus so grundlegend, dass nichts mehr an früher erinnerte. Selbst Schlafräume und Wohnzimmer wurden neu gestrichen. Nur vor Küche und Bad war Kate zurückgeschreckt, weil hier ein Anstrich zu viel Zeit gekostet hätte. Jetzt strahlte fast alles in neuem Glanz, und nichts erinnerte mehr an die Tragödie. Nur manchmal in der Dämmerung, ehe Kate die Lichter anknipste, lauerten wohlbekannte Schatten im Treppenhaus.
Wie auf ein Stichwort schlüpfte ein kleiner, geisterhafter Schatten durch die angelehnte Tür ins Zimmer.
»Hallo Suse«, begrüßte Kate erfreut die hochbeinige Katze mit dem roten Fell.
Doch Susanna wandte den Kopf ab und verbarg sich, als könne sie Kate nicht vertrauen, in dem schmalen Raum zwischen Sofa und Wand.
»Ich bin wieder da, Suse. Für immer. Ganz ehrlich«, lockte Kate. Sie bedauerte sehr, dass sich Susanna nicht mehr wie früher auf ihren Schoß kuschelte, mit den krallenbewehrten Tatzen ihre Oberschenkel knetete oder schmutzige Pfotenspuren auf den makellosen Seiten eines Manuskripts hinterließ. Das höfliche, distanzierte Verhalten der Katze stimmte Kate ein wenig traurig. »Ich lasse dich nie mehr allein. Versprochen.« Susanna antwortete nicht, sondern begann, zunächst auf dem Teppich und später am Rückenteil des Sofas ihre Krallen zu wetzen. Kate versuchte, das Zerstörungswerk zu übersehen. Eines Tages würde ihre Katze ihr verzeihen. Und bis dahin musste sie nachsichtig sein.
Auf dem Tisch lag in einladender Griffweite die Biografie von Fanny Trollope. Immer schon war Kate der Ansicht gewesen, dass es viel einfacher war, die Bücher anderer Leute zu lesen als eigene zu schreiben. Eben erwog sie, ein noch ungeöffnetes Päckchen Schokoladenkekse, das sie für ein heimliches, einsames Gelage verwahrt hatte, in Angriff zu nehmen, als zum Glück für ihre Taille ihre Mutter ins Zimmer trat.
»Von Keksen wirst du fett«, verkündete Roz Ivory, öffnete das Päckchen, nahm einige Plätzchen heraus und knusperte sie genussvoll und vernehmlich.
»Du wirst von gar nichts dick«, erwiderte Kate und sah zu, wie ihre Mutter auf den Teppich krümelte.
»Ich weiß. Gemein, nicht wahr?«, sagte Roz mitleidig, drehte die CD lauter und machte es sich in einem von Kates bequemen Sesseln gemütlich.
»Ich glaube, ich gehe eine Runde joggen«, sagte Kate.
»Etwas Langweiligeres fällt dir wohl nicht ein«, gähnte Roz.
»Joggen ist gesund, belebt und verlängert das Leben«, dozierte Kate.
»Für Sex gilt das Gleiche. Aber damit scheinst du es weniger wichtig zu nehmen.«
Gerade setzte Kate zu einer Antwort an, als sie, sehr zum Wohl der manchmal noch etwas zerbrechlichen familiären Harmonie, vom Klingeln des Telefons unterbrochen wurde.
»Ich gehe ran«, sagte Kate.
»Hallo Kate, hier ist Emma.«
»Hallo Emma. Wie geht’s?« Kate reagierte ein wenig zurückhaltend. Die Freundschaft zwischen ihr und Emma hatte deutlich gelitten, nachdem Kate für einige Wochen Emmas Schreibkurs übernommen und einen Mörder enttarnt hatte, der inmitten der Möchtegern-Schriftsteller sein kreatives Unwesen getrieben hatte. Aus einem Grund, den Kate nach wie vor nicht verstand, hatte Emma ihr die Schuld daran gegeben, dass die freundschaftliche Atmosphäre innerhalb des Kurses danach wie eine Seifenblase zerplatzt war. Offensichtlich hatte alles zum Besten gestanden, ehe Kate auf der Bildfläche erschienen war. Zwar erschien Kate der Vorwurf einigermaßen unlogisch, doch es machte keinen Sinn, mit Emma zu diskutieren: In ihrem Kopf herrschten das gleiche Durcheinander und dieselbe Unordnung wie in ihrer Wohnung. Im vergangenen Jahr dann hatte Kate auf Emmas Bitte am Bartlemas College bei einem Seminar namens »Gender und Genre« ausgeholfen. Auch hier waren ihr ein paar massive Unregelmäßigkeiten aufgefallen, die sie nicht auf sich beruhen lassen konnte. Merkwürdigerweise hatte sie dafür ebenfalls keine Dankbarkeit geerntet, sondern wurde tatsächlich beschuldigt, unerfreuliche Vorfälle wie ein Magnet anzuziehen. Doch vielleicht bedeutete der Anruf, dass Emma ihr endlich verziehen hatte oder wenigstens allmählich zu vergessen begann.
»Ich weiß echt nicht mehr weiter. Weihnachten steht vor der Tür, und ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich nehme an, du weißt, was Sam passiert ist?«
Emma sprudelte mehr oder weniger zusammenhanglos heraus, was sie mitzuteilen hatte. Kate sortierte die Halbsätze und konzentrierte sich auf die lückenhafte Information, die sich ihr erschloss. Der zuverlässige Sam. Ein wolliges Mammut von Mann, immer gut gelaunt und nie nervös. Emmas Ehemann und Vater ihrer sechs Kinder. Oder waren es inzwischen sieben? Kate hatte längst aufgehört mitzuzählen. »Nein«, erwiderte sie. »Ich war eine Zeit lang nicht da. Was ist mit Sam? Erzähl doch!«
»Er ist mit dem Fahrrad die Cowley Road entlanggefahren. Ich sagte ihm noch, er solle seinen Helm aufsetzen – ich habe ihm erst zum Geburtstag einen richtig hübschen, gelb reflektierenden geschenkt –, aber er meinte, für die kurze Strecke würde es sich nicht lohnen, er hätte nur ein paar hundert Meter zu fahren. Am Kreisverkehr kurz vor der High Street ist es dann passiert. Im Kreisel hätte er eigentlich absteigen und sein Rad schieben müssen. Ich mache das immer und halte auch die Kinder an, es zu tun. Aber Sam wollte nicht auf mich hören. Er sagte etwas davon, dass das Leben heutzutage viel zu abgesichert ist, dass man auch einmal fünf gerade sein lassen und ein Risiko eingehen sollte und dass er immer schon ohne Helm durch den Kreisverkehr geradelt ist, ohne dass etwas Schreckliches passiert wäre, und ich solle ihn gefälligst in Frieden lassen. Wenn das keine Herausforderung des Schicksals war, dann weiß ich nicht!«
»Und was ist passiert?«
»Ein Lastwagen kam aus der Iffley Road geschossen und hat die Vorfahrt missachtet. Der Fahrer sagte später, er hätte nicht mit einem Fahrradfahrer gerechnet, der zudem noch mit solcher Geschwindigkeit unterwegs war – er hat ihn schlicht und einfach übersehen. Hätte Sam seinen reflektierenden Helm getragen, wäre das nicht passiert, nicht wahr?«
Emma brach ab, und Kate hörte erstickte Schlucklaute am anderen Ende der Leitung. Hatte Sam den Unfall etwa nicht überlebt? Aber das hätte sie bestimmt erfahren! »Und wie geht es ihm jetzt?«, fragte sie mit krampfhaft gekreuzten Fingern.
»Gott sei Dank ist er inzwischen nicht mehr auf der Intensivstation, aber es dauert sicher noch Wochen, bis er nach Hause kommt. Morgen wird er in die Maxwell-Klinik verlegt; dort ist es einfacher für uns, ihn zu besuchen. Anschließend muss er noch mehrere Wochen zur Krankengymnastik und in die Reha. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich tun soll. Du musst mir helfen, Kate!«
»Aber ich habe kein besonders gutes Händchen für Kinder. Ehrlich gesagt bin ich auch nicht wirklich wild auf die kleinen Racker.« Sie sah zu ihrer Mutter hinüber. Roz lümmelte sich dekorativ in einem Sessel, nippte an einer Margarita und schmökerte in ihrer Sportzeitung. Zwar hatte sich Roz entschlossen, vorläufig bei Kate zu wohnen, doch sie erweckte nicht den Eindruck, als ob ihr Großmutter-Aufgaben wirklich lägen. »Und was Roz angeht, kann ich dir auch keine großen Hoffnungen machen.«
»Ich weiß, dass du mit Kindern hoffnungslos überfordert bist«, stellte Emma abweisend fest. »Außerdem würdest du sie, wie ich dich kenne, vermutlich in die Grundlagen von Bestechung und Korruption einweihen. Nein, nie im Leben würde ich dir meinen Kleinen anvertrauen. Und soweit ich feststellen kann, ist deine Mutter noch schlimmer. Du brauchst dir doch nur anzusehen, was sie dir in deiner Jugend alles hat durchgehen lassen. Ehrlich gesagt hätte ich Angst um die Zukunft meiner Kinder, wenn eine von euch beiden sich länger als eine Stunde um sie kümmern würde. Aber was ich sagen wollte – es geht um meine Mutter.«
»Jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof! Hatte sie etwa auch einen Unfall?«
»Mein Gott, Kate, hör doch wenigstens zu! Wenn Sams Krankengeld ausläuft, bin ich der Hauptverdiener in der Familie. Meine Mutter hatte sich bereit erklärt, mir im Haushalt und mit den Kindern zu helfen.«
Sam arbeitete für einen Hungerlohn, und Kate konnte sich gut vorstellen, dass Emma sich schon mit dem Krankengeld keine großen Sprünge erlauben konnte. Wenn Sam tatsächlich so lange krankgeschrieben wurde, wie sie vermutete, würde der Haushalt sicher schwer zu knapsen haben.
»Alles klappte wie am Schnürchen. Ich habe mir Lehraufträge an Land gezogen, und Mami kümmerte sich pünktlich wie ein Uhrwerk um Haus und Kinder. Und dann ist sie plötzlich verschwunden.«
»Ach!« Kate konnte sich nur allzu gut an Emmas Haus erinnern, wo man auf Schritt und Tritt über Kinder oder herumliegenden Krimskrams stolperte. Aus allen Ecken dröhnte Musik aus Radios oder CD-Playern oder jaulte, sofern man so etwas Musik nennen konnte, aus der Geige eines untalentierten Nachkömmlings. Vor dem Fernseher stritten sich weitere Kinder um die Wahl des Programms. Allein der Gedanke an Emmas Haus verursachte Kate Kopfschmerzen. Wäre sie Emmas Mutter gewesen, sie hätte sich ebenfalls vom Acker gemacht. »Vielleicht brauchte sie einfach ein paar Tage Auszeit«, beruhigte sie Emma. »Sicher will sie sich nur ein wenig ausruhen.«
»Das würde sie nie tun. Zumindest nicht, ohne mir vorher Bescheid zu sagen.«
»Hat sie keine Nachricht hinterlassen?«
»Nichts.«
»Hat sie denn etwas mitgenommen? Einen Koffer vielleicht? Handtasche? Kleidung?«
»Keine Ahnung.«
Kate verstand sofort, dass man bei den im ganzen Haus verstreut herumliegenden Kleider-, Bücher-, Teddybär-, Rollschuh- und Manuskriptbergen, zwischen denen zudem noch überall Kinder herumliefen, kaum erkennen konnte, ob etwas hinzugefügt oder entfernt worden war.
»Ihre Handtasche habe ich länger nicht gesehen«, sagte Emma plötzlich. »Ich glaube, die wäre mir aufgefallen.«
»Und wie kann ich dir helfen?«, erkundigte sich Kate mit dem unguten Gefühl, dass sie sich wieder einmal auf mehr einlassen würde, als sie eigentlich vorhatte.
»Wir hängen auf Gedeih und Verderb von Mami ab. Mein ganzes Leben lang war sie der Fels in der Brandung, auf den ich mich verlassen konnte. In dieser Beziehung taugte mein Vater nicht viel. Er war mir immer irgendwie fremd, und ich hatte das Gefühl, ihm nicht vertrauen zu können. Mami ist da ganz anders. Das ganze Haus drehte sich um sie. Ich möchte, dass du sie findest.«
»Warum ausgerechnet ich?«
»Weil du gern deine Nase in Angelegenheiten steckst und Dinge herausfindest. Recherchierst du nicht auf diese Art auch für deine Bücher?«
»So würde ich es nicht unbedingt ausdrücken. Aber lass mich darüber nachdenken. Ich habe natürlich auch ein paar Verpflichtungen.«
»Du musst doch höchstens einen deiner historischen Romane schreiben. Und nachdem du mindestens schon ein Dutzend dieser Dinger zu Papier gebracht hast, bin ich sicher, du schreibst den nächsten locker im Schlaf. Rufst du mich an, wenn du dich entschieden hast?« Emma klang wirklich verzweifelt.
»In einer Stunde«, versprach Kate. Sie brauchte die Zeit, um sich darüber klar zu werden, ob sie wirklich noch einmal für Emma arbeiten wollte. Dass sie soeben ein Buch vollendet hatte und nicht vor Ablauf einer Woche mit dem nächsten Manuskript beginnen wollte, behielt sie vorsichtshalber für sich. Manchmal war es wichtig, sich gewisse Optionen offenzuhalten. Kate legte auf.
»Und?«, fragte Roz neugierig. »Was war das jetzt?« Sie setzte ihre Margarita ab und blickte Kate interessiert an. »Hat man uns einen Job angeboten?«
3Joyce
»Ist es hier nicht viel gemütlicher?«
Ruth reichte eine Tasse Tee mit Milch und drei Löffeln Zucker über den Tisch. Joyce, die ihren Tee normalerweise ungesüßt trank, akzeptierte dankbar, weil sie dachte, dass die zusätzliche Energie ihr vielleicht guttäte.
»Eine wirklich hübsche Wohnung. Die Möbel sind nett.«
»Ich wusste doch, dass es dir hier gefallen würde!«
Die Wohnung war tatsächlich hübscher als die vorige. Im Wohnzimmer stand ein polierter Holztisch mit passendem Sideboard, und auch die drei übrigen Zimmer waren ansehnlich ausgestattet.
»Obwohl ich nicht einmal die Zeit hatte, mich in der alten Wohnung heimisch zu fühlen, ehe wir hierher umgezogen sind«, fügte Joyce hinzu. »Aber natürlich will ich mich keinesfalls beklagen.«
»Ich brauche nur einen bequemen Sessel, um mich rundum glücklich zu fühlen«, verkündete Ruth. »Einen wie diesen hier. Er ist genau richtig.«
Der fragliche Sessel passte sich in seiner ausladenden Breite Ruths Körperformen an. Auch die Armlehnen unter dem sanft grünen Bezug waren breit. Ruth schmiegte sich in die Polster wie Teig in eine Form. Unter ihrem Gewicht sackte das Sitzmöbel so tief in sich zusammen, dass sie beim Aufstehen vermutlich Schwierigkeiten bekommen würde. Aber Ruth war ohnehin nicht der aktive Typ, das hatte Joyce längst bemerkt. »Statisch« war wohl das Wort, das am besten auf Ruth passte. Vor allem, seit sie in die neue Wohnung umgezogen waren. Aber dann fiel Joyce ein noch besserer Ausdruck ein: »in sich ruhend«. Genau, so stimmte es: Ruth war eine in sich ruhende Persönlichkeit.
»Ich bin vergangene Nacht aufgewacht«, erzählte Joyce zögernd.
»Jeder Mensch braucht ein paar Tage, ehe er sich an ein neues Bett gewöhnt.« Ruth, deren leises, regelmäßiges Schnarchen zwischen Mitternacht und halb acht morgens ohne Unterbrechung durch die Schlafzimmerwände gedrungen war, nickte. »Heute Nacht schläfst du sicher wie ein Murmeltier.«
»Mag sein. Aber diese Nacht wurde ich wach und konnte lange nicht einschlafen.«
»Machst du dir etwa Sorgen?«, fragte Ruth mitfühlend.
Joyce fiel ein, dass der Name Ruth im Englischen so viel wie »Mitleid« bedeutete. Wie passend! Immer machte sie sich mehr Sorgen um das Wohlbefinden ihrer Mitmenschen als um ihr eigenes. »Ich musste nur ständig darüber nachdenken, warum wir so Hals über Kopf aus der Wohnung in der Carpenter Street ausgezogen sind«, antwortete sie.
Sie saß da, starrte Ruth an und fragte sich nervös, ob ihre Zweifel die Freundin vielleicht ärgerten. Doch Ruths heiterer Gesichtsausdruck veränderte sich nicht.
»Mach dir mal keine Gedanken«, beruhigte sie Joyce. »Bald wirst du sicher froh darüber sein, dass wir unsere Zelte dort abgebrochen haben.« Sie wuchtete sich so weit aus ihrem Sessel, dass sie den Arm über den Tisch strecken und Joyce’ Hand tätscheln konnte. »Ich kann verstehen, dass dich die ständigen Veränderungen beunruhigen, die da eine nach der anderen auf dich zugekommen sind, aber bald schwimmen wir wieder in ruhigerem Fahrwasser. Keine Sorge!«
Dreißig Minuten, dachte Joyce. Wir haben die Wohnung tatsächlich innerhalb von dreißig Minuten verlassen. Woran mag es gelegen haben, dass wir uns derart beeilen mussten? Und dann auch noch ohne jede Vorwarnung! Ruth hatte nicht mit einem Wort die Gründe für ihre Hast erwähnt und, seit sie in der neuen Unterkunft wohnten, nie wieder auch nur davon gesprochen. Kein Wunder, dass Joyce nachts wach lag, das Licht der Straßenlaternen durch die Vorhänge schimmern sah und sich Fragen stellte. Bei Tageslicht, und mit Ruths sanften Worten im Ohr, wirkte dann alles gleich weniger beunruhigend. Joyce vertraute Ruth. Sie musste ihr vertrauen. Sie hatte sie zu einem Zeitpunkt kennengelernt, als sie völlig verwirrt war, mit ihrem Leben nicht mehr klar kam und unbedingt eine Freundin brauchte. Und die wunderbare Ruth hatte sie so akzeptiert, wie sie war, und sie unter ihre Fittiche genommen. Ruths solide Art und wie sie dort in ihrem grünen Sessel saß, die Füße in den vernünftigen Schnürschuhen ordentlich nebeneinander auf dem beigen Teppich, bürgte für ihre Zuverlässigkeit. Joyce selbst verfügte über keine Erfahrung als die, sich über sechzig Jahre hinweg den Wünschen anderer Menschen gebeugt zu haben; sie war nicht besonders gut darin, den eigenen Standpunkt zu vertreten.
»Die Wohnung ist wirklich sehr hübsch«, sagte sie, um sowohl Ruth als auch sich selbst zu beruhigen.
Das Zimmer war erst kürzlich magnolienfarben gestrichen worden. Die Doppelhaushälfte stammte aus der Nachkriegszeit und war in zwei unabhängige Wohnungen unterteilt. Ihre Wohnung lag im Obergeschoss, bestand aus zwei kleinen Schlafzimmern, einer winzigen Küche, einem Bad und einem riesengroßen Wohnzimmer, von dem aus man einen Park überblicken konnte.
»Um diese Jahreszeit macht der Park natürlich nichts her«, sagte Ruth, als ob sie Joyce’ Gedanken gelesen hätte. »Aber warte nur ab: Im Februar und März ist er voller Narzissen und Krokusse. Das wird dir sicher gefallen. Ich finde, es gibt nichts Hübscheres als büschelweise Narzissen.«
»Vielleicht blühende Bäume«, wandte Joyce ein. »Ich sehe für mein Leben gern rosa blühende Bäume.« Zwar hatte Ruth sie nicht erwähnt, aber Joyce ging davon aus, dass auch Kinder im Park spielen und herumtoben würden, sobald das Wetter wärmer wurde.
»Was würdest du davon halten, wenn wir uns einen kleinen Hund anschaffen?«, schlug Ruth vor. »Du könntest mit ihm spazieren gehen.«
»Lieber nicht«, lehnte Joyce ab. »Hunde machen viel Schmutz. Außerdem verlieren sie ständig Haare.« Sie war der Ansicht, dass Tiere grundsätzlich nach draußen und nicht in eine gepflegte Wohnung gehörten.
»Es war Zeit, den Standort zu wechseln. Du wirst bald einsehen, dass ich Recht habe.« Ruth verlagerte ihr Gewicht nach vorn und griff nach einem weiteren Cremeteilchen. Ihr Ton wurde vertraulicher. »Um dir die Wahrheit zu sagen: Die Wohnung ging mir schon längst auf die Nerven. Und der Vermieter war ein echter Mistkerl – ich hoffe, du entschuldigst meine Wortwahl.« Das grobe Wort klang in der Tat seltsam aus Ruths keuschem Mund mit den rosigen Lippen.
»Ich bin sicher, du hast Recht«, erwiderte Joyce und biss zierlich in ihr drittes Teilchen. Die Krümel sammelte sie ordentlich auf ihrem Teller. »Was ist passiert? Hat er dich verärgert?« Es war schwierig, sich vorzustellen, wie ein Mann wie Mr Bettony eine Frau wie Ruth verärgern könnte.
»Ich hatte mich über den Zustand des Daches beschwert«, erklärte Ruth. »Du hast doch bei Regenwetter sicher auch den feuchten Fleck an der Badezimmerdecke bemerkt.«
»Eigentlich nicht. Aber in praktischen Dingen war ich noch nie besonders gut. Solche Sachen überlasse ich lieber meiner Tochter und meinem Schwiegersohn. Zumindest hielt ich es bis vor einigen Tagen so«, verbesserte sie sich hastig.
»Jedenfalls war der feuchte Fleck da und wurde immer größer. Und dieser Bettony hatte tatsächlich die Stirn, mir ins Gesicht zu sagen, dass ich für neue Dachziegel selbst aufzukommen hätte, wenn ich unbedingt welche wollte.«
»Ich bin sicher, dass er sich da täuscht«, sagte Joyce. »Als Vermieter ist er für den Zustand seines Hauses verantwortlich. Wie unfreundlich von ihm, dir zu sagen, du müsstest den Schaden aus eigener Tasche bezahlen!«
»Ich muss allerdings zugeben, dass mir ihm gegenüber ganz schön der Kragen geplatzt ist«, berichtete Ruth mit sanfter Stimme. Dabei sah sie ganz und gar nicht wie jemand aus, der sich vor Wut zu Unbeherrschtheiten hinreißen ließ. »Ich weiß, das hätte ich nicht tun dürfen. Es war nicht richtig von mir. Aber als er zu schimpfen anfing, erklärte ich ihm, er könne sich seine ekelhafte Wohnung an den Hut stecken, denn ich würde keine Minute länger bleiben.«
Einen Moment lang fragte sich Joyce, ob »ekelhaft« das richtige Wort zur Beschreibung der Wohnung war. »Du hast dich völlig richtig verhalten«, tröstete sie die Freundin. »Man darf solchen Leuten nicht gestatten, die Oberhand zu gewinnen. Aber wie hast du so schnell eine neue Wohnung gefunden?«
Gedankenverloren kaute Ruth einen Bissen ihres Teilchens, ehe sie ihn mit einem Schluck Tee hinunterspülte.
»Soll ich noch etwas heißes Wasser auf die Blätter gießen, oder machen wir uns lieber frischen Tee?«, fragte sie.
»Ich denke, heißes Wasser reicht. Ich kümmere mich darum«, sagte Joyce. Sie fürchtete die Unruhe, bis Ruth ihre Massen aus dem Sessel gewuchtet hätte, griff eilig nach der Teekanne und verschwand in der Küche.
»Lass mich eingießen«, bat Ruth, als Joyce mit der Kanne zurückgekehrt war. Sie schloss ihre plumpe rosige Hand elegant um den Henkel und schenkte ein. Was für eine kultivierte Person, dachte Joyce. Bestimmt stammt sie aus einer ausgezeichneten Familie.
»Worüber sprachen wir gerade?«, erkundigte sich Ruth.
»Über die Wohnung«, half Joyce ihr auf die Sprünge. »Ich frage mich natürlich, wie du in derart kurzer Zeit eine neue Unterkunft für uns finden konntest.«
»Ich hatte schon einige Zeit darüber nachgedacht umzuziehen«, antwortete Ruth leichthin. »Die andere Wohnung gefiel mir schon lange nicht mehr, und ich hatte bereits über verschiedene Bekannte Erkundigungen eingezogen. Zufällig kam mir just an diesem Morgen zu Ohren, dass die Wohnung hier frei geworden war. Glück muss der Mensch haben, findest du nicht? Jedenfalls sah ich keinen Sinn darin, den Umzug auf die lange Bank zu schieben, und habe gleich alles in die Wege geleitet.«
Joyce hätte gern gewusst, wie hoch die Miete war und wann Ruth den Vertrag unterschrieben hatte, doch es erschien ihr unhöflich, derart direkte Fragen zu stellen, und daher schwieg sie lieber. Vielleicht handhabte man solche Dinge in den Kreisen, in denen Ruth verkehrte, anders, als Joyce es aus ihrem früheren, eher gesetzten Leben gewohnt war.
Ruth lächelte ihr schmeichelnd zu. Seit sie wieder ein Dach über dem Kopf hatten, zeigte ihr Gesicht nicht mehr die angespannten, maskenartigen Züge, sondern hatte seine weichen, aufwärts strebenden Linien wiedergefunden. Ruth wirkte immer, als hätte sie ihre Haut mit pfirsichfarbenem Puder überstäubt, was ihr ein flaumiges, verletzliches Aussehen verlieh. Schade, dass sich ihre schönen braunen Augen hinter dicken Brillengläsern versteckten, denn sie waren groß und ausdrucksvoll. Zumindest vermutete Joyce das – richtig gesehen hatte sie sie noch nie.
»Arbeiten wir bald wieder?«, fragte sie.
»Aber natürlich! Wir haben nur ein paar Tage Urlaub«, erwiderte Ruth behaglich. »Die anderen werden uns schon vermissen und freuen sich bestimmt, wenn wir wieder da sind.«
»Ich habe das Gefühl, diese Arbeit ist meine Erlösung«, sagte Joyce.
»Stimmt, meine Liebe. Du musst dich von der Schlechtigkeit deiner früheren Freunde, Verwandten und Bekannten lossagen und deinen Geist mit den Worten und Taten Gottes füllen. Faste, bete und verbringe deine Tage mit guten Taten«, dozierte Ruth und nahm sich das letzte Teilchen. »Sieh weder nach rechts noch nach links, sondern folge dem Pfad des Lichts.«
»Ich will es versuchen«, sagte Joyce.
Die heute so tatenlose Ruth würde sich in ein sprühendes Energiebündel verwandeln, sobald sie wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehrte.
»Und natürlich freue ich mich auch, alles zu tun, was in meiner Macht steht«, fügte Joyce hinzu. »Immer schon wollte ich mein Leben unserem Herrn und dem Werk seiner Hände weihen. Zum Beispiel gefällt es mir ganz und gar nicht, hier herumzusitzen und nichts zu tun. Ich bin es gewöhnt, mich zu beschäftigen.«
»Mach dir keine Sorgen, meine Beste. Du leistest einen wertvollen Beitrag zu unserer Arbeit.«
»Wo wir gerade darüber sprechen – ich sorge mich ein wenig um meinen Beitrag zu unserer Haushaltskasse«, fuhr Joyce fort, der dieses Thema schon seit einiger Zeit unter den Nägeln brannte und die jetzt ihre Chance gekommen sah.
»Denk einfach nicht darüber nach. Für mich spielen diese Dinge keine Rolle«, erklärte Ruth. Doch das hatte Joyce eigentlich nicht hören wollen.
»Aber ich möchte auf jeden Fall die Hälfte der Miete für diese Wohnung hier zahlen. Allerdings ist meine Rente nicht besonders üppig, und du hast mir bisher noch nicht gesagt, wie viel ich dir schulde.« Sie hatte noch nicht einmal angefangen, das Geld zurückzuzahlen, das Ruth ihr am ersten Tag in die Hand gedrückt hatte.
»Behalte deine Rente lieber für deine persönlichen Bedürfnisse«, entgegnete Ruth. »Du brauchst eine gewisse Unabhängigkeit. Du willst doch sicher nicht jedes Mal betteln kommen, wenn du ein Paar Strümpfe brauchst oder dich der Appetit auf einen Schokoriegel packt.«
Joyce kämpfte mit ihrer guten Kinderstube. Sie brachte es einfach nicht fertig, Ruth direkt zu fragen, wie sie es schaffte, für sie beide zu zahlen. Und wenn sie nun eines Tages in Schwierigkeiten kam? Joyce ließ sich auf einen Kompromiss ein.
»Aber du lässt mich bitte wissen, wenn es irgendetwas gibt, was ich für dich tun kann«, sagte sie und hoffte, dass Ruth verstand, was sie meinte.
»Aber natürlich«, beruhigte Ruth sie. »Möchtest du noch Tee?«
»Lieber nicht. Ich hatte schon zwei Tassen.«
»Na los, gönn dir ruhig einmal etwas. Es ist noch genug da. Und anschließend könntest du dich mit Bügelbrett und Sprühstärke bewaffnen und unsere Uniformen wieder so richtig in Schuss bringen.«
»Gern. Ich freue mich, wenn ich dir irgendwie helfen kann.«
»Du bügelst bestimmt ganz toll«, sagte Ruth. »Du kümmerst dich um unsere Uniformen, und anschließend kannst du mir helfen, die Ware einzupacken. Ich habe Geschenkpapier und Goldband gekauft und zeige dir, wie es gemacht wird. Mir ist aufgefallen, dass alles eine Frage der Präsentation ist. Alles sieht gleich ganz anders aus, wenn es hübsch verpackt ist.«
»Oh ja, da gebe ich dir völlig Recht. Der Schein ist ungeheuer wichtig«, stimmte Joyce zu.
»Jetzt stehen die Feiertage vor der Tür, und deshalb strengen wir uns ganz besonders an. Mir gefällt der Gedanke, dass alle Herzen gen Himmel streben, wenn einer meiner Sonnenschein-Engel mit seinem Wägelchen auf die Station kommt.«
»Ich werde versuchen, meinen Teil zur Zufriedenheit zu erledigen.«
»Macht es dir etwas aus, wenn ich dich bitten würde, heute Nachmittag für ein oder zwei Stunden auszugehen? Ich bekomme nämlich geschäftlichen Besuch …«
Joyce hob unwillkürlich die Augenbrauen, und Ruth brach ab.
»Es geht um meine Rente«, fuhr sie schließlich fort. »Es stört dich doch sicher nicht, mir ein wenig Privatsphäre zu gönnen, nicht wahr?«
»Aber natürlich nicht«, antwortete Joyce hastig. »Ein schöner Spaziergang an der frischen Luft wird mir sicher guttun.« Ruth war so viel jünger, als sie tatsächlich aussah, dass Joyce manchmal Schwierigkeiten hatte, sich daran zu erinnern, dass sie nicht gleichaltrig waren. Wahrscheinlich war es durchaus sinnvoll, dass eine Frau um die dreißig sich um ihre Rente kümmerte, vor allem, wenn sie selbstständig war. Zumindest nahm Joyce an, dass Ruth selbstständig war.
»Könntest du mir bitte, ehe du zu bügeln anfängst, mein Strickzeug reichen?«, bat Ruth. »Ich möchte nicht untätig herumsitzen.«