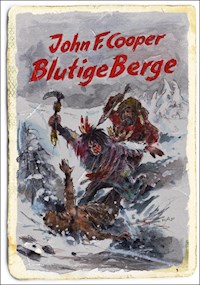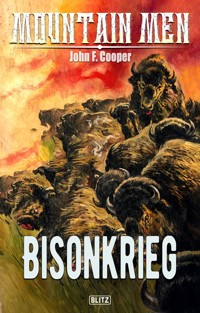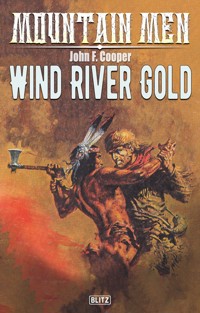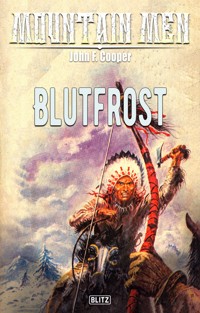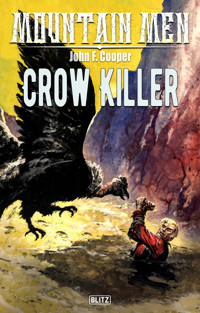Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mountain Men
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Frühsommer 1821 Die Trapper Jedediah Jones und Malcolm McGruder kehren nach einer abenteuerlichen Saison nach St. Louis zurück. Dort werden sie von einem reichen Pelzhändler angeheuert, um nach seiner Tochter zu suchen. Die junge Frau ist als Teil eines Erkundungstrupps in den Rocky Mountains verschwunden. Doch gerade jetzt ist der Ferne Westen kein guter Platz für Weiße, denn die Blackfeet haben das Kriegsbeil ausgegraben. Bisonkrieg (Teil 1) Die Printausgabe des Buches umfasst 254 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mountain Men
In dieser Reihe bisher erschienen
4501 John F. Cooper Wind River Gold
4502 John F. Cooper Der goldene Fluss
4503 John F. Cooper Stadt der Pelze
4504 John F. Cooper Bisonkrieg
4505 John F. Cooper Das alte Volk
John F. Cooper
Stadt der Pelze
Erster Band der Bisonkrieg-Trilogie
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-767-2Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Was bisher geschah ...
Der junge Malcolm McGruder ist neu in den Bergen des Fernen Westens. Nach einer turbulenten Saison an der Seite des erfahrenen Bergläufers Jedediah Jones fühlt er sich längst nicht mehr als Greenhorn. Gemeinsam haben sie Jeds Todfeind, den Blackfoot Hunting Coyote, besiegt und die Schätze gefunden, die ihnen der Trapper Jehan Prevost vermacht hat: ein Caché, randvoll mit erstklassigen Biberpelzen, sowie einen unterirdischen Fluss, dessen Ufer mit Goldnuggets übersät sind. Mel verliebte sich in die Crow-Indianerin Tis-see-wpp-na-tis, die, ermordet von weißen Männern, in seinen Armen starb. Nachdem sie Rache geübt haben, machen sich Jed und Mel auf den Weg nach Osten, zurück in die Zivilisation ...
Prolog
Rocky Mountains, Winter 1821
Der Berg war so alt wie die Welt und barg ein Flüstern vom Anbeginn der Zeit. Wie ein monströser Steinriese wachte er über ein fruchtbares Tal, das jetzt, im Winter, unter einer Leichendecke aus Schnee erstarrt war. Manchmal zeigte sich ein Adler träge kreisend am Himmel, und einmal hatten sie die Spuren eines Berglöwen gefunden, der nachts um ihr Lager geschlichen war. Aber die große Katze hatte es nicht gewagt, die Höhle zu betreten, in der fünf Menschen auf das Ende des Winters warteten.
Einmal mehr beglückwünschte sich Hannah Billings zu ihrer Entscheidung, das Lager in der Kaverne aufzuschlagen, obwohl dieser düstere Ort einigen Mitgliedern ihrer kleinen Expedition Furcht einflößte, besonders ihrem Fährtenleser Baptiste, einem Halbblut-Delawaren, und seiner Squaw, die beide im Aberglauben der Ureinwohner dieses Kontinents gefangen waren.
„Böser Ort“, hatte Baptiste gesagt und ein Kreuz über der Brust geschlagen, wie es ihm französische Missionare beigebracht hatten. Anschließend hatte er den indianischen Talisman berührt, den er um den Hals trug, weil er den Beschwörungen der Weißen nie vollständig vertraute.
Eulenfrau, seine Squaw vom Stamm der Shawnee, beteiligte sich mit einem verschreckten Murmeln an der Unterhaltung. „Geister von Gestern“, hatte Baptiste ihre Worte übersetzt.
Geister der Vergangenheit, natürlich. Das war offensichtlich. Aber kein Anlass zur Furcht, oder? Im Gegenteil, Hannah Billings war überzeugt, dass sie eine bedeutende Entdeckung gemacht hatten: Sie waren nicht die ersten Menschen in dieser Höhle.
Der Beweis war an die Felswände gemalt: bunte Bilder, viele davon. Manche wirkten, als habe man sie mit farbbeschmierten Pranken hingeklatscht. Die meisten jedoch waren mit sanften Fingern kunstvoll aufgetragen worden. Büffel waren zu sehen und Antilopen und seltsam zottelige Elefanten, und Männer mit Speeren, die Jagd auf sie machten. Manchmal fand einer der Jäger den Tod, aber meist blieben sie Sieger über die Tiere.
Die Tiere machten diese Höhlenzeichnungen so außergewöhnlich. Es gab keine Elefanten in Amerika. Und doch hatten die Künstler pelzige Riesen mit langen Rüsseln und gebogenen Stoßzähnen gemalt. Sie mussten solche Tiere gesehen haben, genauso wie Kamele und merkwürdige Katzen mit dolchartigen Hauern, eine Kreuzung aus Löwe und Riesenschwein möglicherweise. Selbst die Bisons, Bären und Biber an den Felswänden wirkten im Vergleich zu den dargestellten Menschen wie Giganten. Das mochte der Unfertigkeit der Maler geschuldet sein, oder ihrem Hang, zu übertreiben, aber Hannah glaubte, dass die Künstler die Wesen, die sie malten, mit eigenen Augen gesehen hatten.
„Riesenbiber, davon habe ich gehört“, meinte Patrice Vichery, ein wettergegerbter Voyageur, der sein halbes Leben auf den Großen Seen verbracht hatte. „Die Indianer erzählen manchmal davon. Micmac, Huronen, Ottawa.“ Er wandte sich dem Halbblut zu. „Ba’tiste, wie ist das bei den Delawaren?“
„Große Biber, ja. Sind lange fort.“
„Was ist mit diesen Pelzelefanten?“, wollte Henry Folsom wissen, ein weißer Trapper und das fünfte Mitglied ihrer Mannschaft. „Und die Dolchzähne? Diese Viecher sehen aus als könnten sie es mit einem Mississippi-Krokodil aufnehmen.“
Hannah hatte die Antwort des Halbbluts nicht gehört. Sie hatte ein Glitzern an der Wand bemerkt, war nähergetreten und hatte eine der Zeichnungen berührt. Wenn diese Bilder in einer fernen Epoche entstanden waren, wie Baptiste andeutete, wieso war die Farbe an dieser einen Stelle dann noch feucht?
Ihre Entdeckung ließ Hannah den Atem anhalten. War es möglich, dass die Künstler – irgendwelche Indianer, die ihnen bis jetzt verborgen geblieben waren – diese Tiere noch vor kurzem gesehen hatten? Dass sie nach einer großen Jagd in diese Höhle kamen, um ihre Erlebnisse für ihre Nachkommen aufzuzeichnen? Allein die Möglichkeit, dass es solche riesigen Kreaturen hier oben in den abgeschiedenen Tälern des Felsengebirges noch geben konnte, war so erregend wie ein verbotener Kuss in einer Sommernacht.
Hannah empfand Triumph wie ein General nach einer gewonnenen Schlacht. Sie hatte sich bewiesen. Ihr Vater würde stolz auf sie sein. Ihre Expedition war ein voller Erfolg. Sie hatten alles gefunden, weswegen sie so tief in die Berge gezogen waren, und diese seltsamen Geschöpfe konnten sich als unverhoffter Bonus erweisen.
Was mochte der Pelz eines solchen Elefanten wert sein?
*
Hannah Billings war die Tochter eines reichen Pelzhändlers aus St. Louis. Sie war ein uneheliches Kind, ihre Mutter eine Hure in dem weithin bekannten Etablissement von Molly Swingwater. Dennoch geriet Hannahs Existenz nicht zum Skandal. Ihr Vater war einer der einflussreichsten Männer im Zentrum des Pelzhandels am Mississippi, ein Wohltäter und Mäzen der Stadt, die er mitbegründet hatte. Selbst seine Feinde überlegten es sich zweimal, ehe sie sich das Maul über ihn zerrissen.
Ihr Vater hatte seine Bastard-Tochter nie offiziell anerkannt, sie aber auch nie verleugnet. Er kümmerte sich um Hannah wie ein vermögender Mann sich um eine Lieblingsnichte bemüht. Er schickte ihr Spielzeug und Kleider, kam für ihre Ausbildung auf, und mit den Jahren wurden aus den Spielsachen Bücher, Parfüm und Schmuck. Die Kleider wurden üppiger.
Hannah freilich trug die mondäne Garderobe aus Tüll und Seide selten. Am liebsten kleidete sie sich in bequeme Baumwollsachen, durchstreifte die Natur, beobachtete Tiere und sprach mit den Fallenstellern, die aus der Wildnis heimkehrten, beladen mit Fellen und übersprudelnd vor Geschichten über ihre Abenteuer in den fernen Bergen. Wenn man den Trappern glaubte, dann hatten sie jenseits der Zivilisation das Paradies gefunden, und man musste nur weit genug nach Westen wandern, um es ihnen gleichzutun.
Das interessierte Hannah. Sie hatte weder Ambitionen, in Molly Swingwaters Dienste zu treten, noch auf ein Leben als Hausfrau an der Seite eines respektablen Mannes, wenngleich ihr dieser Weg durch die Zuwendungen ihres Vaters zweifelsohne offenstand. Sie wollte Abenteuer erleben und beweisen, dass nicht nur harte Männer im unerforschten Westen zurechtkamen. Schließlich lebten dort seit Hunderten, wahrscheinlich seit Tausenden von Jahren Indianerfrauen zusammen mit ihren roten Kriegern. Was diese Squaws konnten, vermochte eine weiße Frau genauso gut, fand Hannah. Natürlich nur, wenn sie nicht in Seidenkleidern herumlief.
Als ihre Mutter starb, ließ ihr Vater Hannah in seine weiße Kalksteinvilla kommen, um mit ihr über ihre Zukunft zu sprechen. Er bot ihr eine Mitgift und seine Unterstützung bei der Suche nach einem soliden Ehemann an. Sollte sie solcherart Beistand nicht wünschen, stand es ihr frei, sich für eine Leibrente zu entscheiden, die ihr ein behagliches Auskommen sichern würde. Hannah entschied sich für einen dritten Weg, der im Angebot ihres Vaters nicht vorgesehen war: Sie wollte für seine Pelzhandelsgesellschaft arbeiten.
Ihr Vater hob überrascht eine Braue.
„Du versprichst mir Freiheit, doch wenn ich sie einfordere, machst du einen Rückzieher?“, rief Hannah, noch ehe er etwas Ablehnendes sagen konnte. Und dann überraschte sie ihn ein weiteres Mal, indem sie ihn mit ihrem Wissen über den Fellhandel konfrontierte.
„Aus Bibern werden in Europa Hüte gemacht. Das ist ein einträgliches Geschäft, doch der beste Pelz von allen ist der des Vielfraßes, denn sein Fell vereist nicht. Regen und Schnee perlen einfach daran ab als seien die Haare mit Wachs überzogen.“ Sie dachte kurz nach. „Für den Biberfang benötigt man Fallen, während Eichhörnchen mithilfe vergifteten Futters erlegt werden, was ich persönlich sehr traurig finde, zumal sich die Eichhörnchenjagd gar nicht lohnt. In Europa gelten Eichhörnchenfelle aus Amerika als nahezu wertlos; man liebt dort die tiefschwarzen Eichhörnchen aus Sibirien.“
Ihr Vater hob die zweite Braue.
Dann bot er ihr eine Anstellung in einem seiner Lagerhäuser an. Hannah Billings war fünfundzwanzig Jahre alt, hatte sich in der Schule im Rechnen hervorgetan, und er konnte sich durchaus vorstellen, ihr die Leitung eines seiner Lager anzuvertrauen.
Hannah lehnte ab. Sie wollte lieber in einem Handelsposten arbeiten, irgendwo am oberen Missouri, wo das Land von Menschen unberührt und voller Wunder war.
Hätte ihr Vater eine dritte Augenbraue gehabt, wäre sie in diesem Moment in die Höhe geschnellt.
„Du bist verrückt, Kind.“
„Ich bin deine Tochter.“
Ihr Vater widersprach nicht, was aber nicht hieß, dass er gewillt war, ihr einen Job in der Wildnis zu geben.
„Glaubst du, ich lasse mich von den Rothäuten übers Ohr hauen?“, brauste Hannah auf und feuerte eine Kostprobe ihres Wissens über die im Pelzgeschäft üblichen Tauschkurse hinterher: „Für eine Hudson´s-Bay-Decke müssen die Indianer zwölf Biberfelle geben, für eine Muskete zwanzig. Aber es ist schlauer, ihnen zu sagen, dass sie die Biberfelle so hoch stapeln müssen wie eine Muskete lang ist. Dann kann man dreißig Biberfelle herausholen, Pulver und Blei nicht mitgerechnet. Na, wer haut hier wen übers Ohr?“ Hannah blickte ihren Vater triumphierend an.
Der alte Mann schüttelte den Kopf. „Kleines, ich bin überzeugt, dass du jedem Gauner Paroli bieten könntest. Aber dort draußen braucht man nicht nur einen klugen Kopf. Es kommt vor allem auf Stärke an.“
Hannah konnte reiten, sogar schießen. Sie hatte sich von einem Trapper zeigen lassen, wie man die Kentucky-Rifle in weniger als einer halben Minute lud und einen Kürbis auf hundert Meter Entfernung zum Platzen brachte. Sie hatte auf einer ihrer Wanderungen dreißig Meilen zu Fuß an einem Tag zurückgelegt, am Abend ihre Blasen versorgt und war am nächsten Tag die ganze Strecke zurück nach St. Louis marschiert, wo ihre Mutter, krank vor Angst, auf sie wartete.
„Es ist zu gefährlich“, beharrte ihr Vater. „Nimm die Leibrente und geh wandern so oft du willst. Das mit dem Heiraten ergibt sich irgendwann.“
„Vielleicht nehme ich mir einen Trapper zum Mann und ziehe mit ihm in die Berge“, gab Hannah zurück. „Ich weiß, wie man das Fell eines Zobels einschneiden muss, damit es doppelt so lang und breit wirkt als es tatsächlich ist. Damit werden mein Mann und ich deine Clerks um ein hübsches Sümmchen erleichtern.“
Ihr Vater runzelte die Stirn, gab jedoch nicht nach.
„Dann gehe ich zu Astor und bitte ihn um Arbeit.“
Das war eine Drohung, die ihr Vater nicht auf die leichte Schulter nehmen konnte. Johann Jacob Astor, der Besitzer der American Fur Company, war einer der reichsten Männer Amerikas. Er unterhielt zahlreiche Handelsposten an den Großen Seen, am Mississippi und am Missouri. Vor allem Letztere waren den alteingesessenen Pelzhändlern ein Dorn im Auge. Die Männer aus St. Louis betrachteten das Missouri-Territorium als ihr ureigenes Revier. Astor war Deutscher; nach dem Selbstverständnis der einheimischen Pelzbarone hatte er in den Vereinigten Staaten genauso wenig verloren wie die Briten, die sich im Norden Missouris und in Oregon breitmachten. Dass sich die Händleraristokratie von St. Louis zu einem Gutteil aus Franzosen rekrutierte, blendeten Astors Neider aus.
„Astor …“, schnaubte Hannahs Vater und tat beleidigt. „Astor beschäftigt vor allem Kanadier und ganz gewiss keine amerikanischen Frauen.“
„Astor“, widersprach Hannah, „hat mit der Gründung seines Forts Astoria am Pazifik mehr Weitblick gezeigt als alle Händler von St. Louis zusammen in die Waagschale werfen können. Vielleicht stellt er sein Gespür ein weiteres Mal unter Beweis, indem er als Erster Frauen einstellt. Wir Frauen verstehen es nämlich nicht nur, Kinderstuben zu beleben.“
„Astors hochtrabendes Astoria ist gescheitert. Die Briten haben es ihm abgenommen.“
„Mag sein. Aber der Gedanke war richtig. Wenn die amerikanischen Händler der Hudson’s Bay Company und der North West Company den Rang ablaufen wollen, müssen sie dorthin vordringen, wo es die besten Pelze zu holen gibt: in die Berge des Fernen Westens.“
Nun stahl sich ein Schmunzeln ins Gesicht des alten Mannes. „Verdammt will ich sein, du dreistes Weibsbild. Du hast deinen Besuch hier gut vorbereitet, was?“
Hannah lächelte zurück.
„In Ordnung, geh heim und warte, bis ich dich in ein oder zwei Wochen wieder rufen lasse. Dann werde ich dir etwas über Weitsicht beibringen. Ich habe da ein paar Ideen.“
Bei ihrem nächsten Besuch hatte er Hannah den Plan einer kühnen Expedition unterbreitet, die weit ins Biberland vordringen sollte. Ihr Vater wollte sich nicht mehr damit zufriedengeben, Pelze von Fallenstellern und Indianern anzukaufen. Er wollte eigene Trapperbrigaden in die Berge schicken, um sich die besten Felle in der von ihm bestimmten Menge zu sichern.
Manuel Lisas Missouri Fur Company hatte gezeigt, wie es ging, und dabei gewaltige Geschäfte gemacht, und nun bereiteten sich eine Reihe Händler in St. Louis darauf vor, Horden abenteuerlustiger Männer nach Westen zu entsenden. Was den Zielort ihrer Unternehmungen anging, verließen sie sich größtenteils auf die prahlerischen Reden der wettergegerbten Mountain Men, der einzigen Weißen, die den Fernen Westen kannten.
Doch was aus ihren Erzählungen entsprach der Wirklichkeit, welcher Teil entsprang bloßer Aufschneiderei? Hannahs Vater hatte vor, allen anderen einen Schritt voraus zu sein, indem er einen Erkundungstrupp ausschickte, der herausfand, wo sich die besten Fanggründe tatsächlich befanden. Die Gunst welcher Indianerstämme konnte man gewinnen und welche der roten Völker mied man besser? Auch solches Wissen entschied über den Erfolg der Pelzjägerei.
Der schlaue Fuchs hatte zwei erfahrene Waldläufer angeheuert, Patrice Vichery, einen Frankokanadier, der die Arbeit in den Diensten der Hudson’s Bay Company als schlecht bezahlt empfand, und Henry Folsom, einen freien Trapper, der zwei Winter in Folge Ärger mit den Blackfeet gehabt hatte und nur sein nacktes Leben hatte retten können. Folsom war pleite, er besaß nicht einmal mehr ein Gewehr, nur noch sein Wissen. Hannahs Vater war bereit, dafür zu zahlen.
Der Halbblut-Delaware Baptiste und seine sanftmütige Squaw vervollständigten die Gruppe, deren Leitung Hannah Billings an einem milden Nachmittag im Frühsommer 1820 übertragen wurde. Ihr Vater empfahl ihr mit Nachdruck, die Ratschläge Folsoms und Vicherys zu beachten, doch falls eine Entscheidung auf der Kippe stand, sollte ihr Wort es sein, das den Ausschlag gab.
Vichery akzeptierte das Arrangement achselzuckend. Sein Sold für dieses Abenteuer war im Vergleich zum Hungerlohn für die Plackerei in Diensten der Briten fürstlich, und je weniger er kommandieren musste, desto mehr konnte er die Reise genießen.
Folsom grinste Hannah an. „Dürfte interessant werden, Missy. Teufel auch, warum nicht? Ich habe schon Indianergäule kotzen sehen.“
„Und ich, Mister Folsom“, entgegnete Hannah, „nehme an, dass die Indianergäule auch Sie schon dabei beobachten mussten, wie Sie nach einer durchzechten Nacht Ihr Innerstes nach außen gekehrt haben.“
Folsom dachte eine Weile darüber nach, dann verbreiterte sich sein Grinsen. „Anzunehmen, Missy. Wahrlich, das ist anzunehmen.“ Mit diesen Worten war ihre Freundschaft besiegelt.
Tatsächlich hatte Hannahs Weiblichkeit den Ausschlag dafür gegeben, ihr die Leitung der Expedition zu übertragen. Durch ihre Anwesenheit konnte ihr Vater die Unternehmung wie eine Studienreise aussehen lassen. Er ließ verbreiten, Hannah Billings reise gen Norden, um seltene Pflanzen und Schmetterlinge zu suchen und sich so auf ein Studium der Botanik und Zoologie vorzubereiten, das ihr größter Herzenswunsch sei. Außerdem, vertraute er flüsternd seinen Tischnachbarn im Herrenklub an, könne er die etwas delikate Angelegenheit eines unehelichen Kindes auf diese Weise weit von sich schieben, jetzt, wo sich in St. Louis bedeutende Geschäfte anbahnten. Diese Legende enthielt genügend Wahrheit, um von allen geglaubt zu werden.
Und so war Hannah Billings zum Abenteuer ihres Lebens aufgebrochen.
*
Sie fuhren auf einem Kielboot den Missouri aufwärts, ließen das wogende Grasmeer der Prärie hinter sich und drangen in die Berge vor, die Hannah wie ein Reich aus steinernen Festungen und Wolkenschlössern vorkamen. Sie mieden die Arikara, Sioux und Blackfeet, palaverten mit Mandan, Crow, Gros Ventres und Flathead und fanden die phantastischen Erzählungen der Mountain Men bestätigt. Die Grizzlybären waren vielleicht nicht ganz so groß und blutrünstig wie von den Bergläufern behauptet, aber die Biber waren in der Tat so zahllos, wie man sich erzählte.
„Jetzt glaubst du mir, Missy, was?“, brummte Henry Folsom.
„Ich habe Ihnen immer geglaubt, Mister Folsom“, sagte Hannah. „Ich war mir nur nicht sicher, wie viel Whisky Sie bei Ihren Ausflügen ins Gebirge intus hatten.“
Folsom meinte, sein Whisky sei längst alle, und so sei es auf jeder seiner Reisen gewesen.
Im Spätherbst hatten sie nach St. Louis zurückkehren sollen, um Bericht zu erstatten, aber Hannah begnügte sich nicht mit dem, was sie gesehen hatte. Sie ließ den Erkundungstrupp immer tiefer in die Rocky Mountains vordringen, in Täler, die selbst den Indianern fremd waren. Sie wusste, dass Pelze umso hochwertiger wurden, je weiter nördlich man sich befand. Im Norden saßen die Briten, daran war nichts zu ändern. Die Hudson’s Bay Company und die North West Company hielten geographisch gesehen die besten Pelzgründe besetzt, doch Hannah glaubte, dass die Nordrichtung nur ein Teil der Wahrheit war.
„Im Norden ist es kalt“, sagte sie. „Deshalb haben die Biber dort das dichteste Fell.“
„Aye“, stimmte Folsom zu.
„Oui“, nickte Vichery.
„Im Winter ist es kälter als im Sommer“, setzte Hannah ihre Betrachtung fort. „Deshalb ist Winterfell am meisten wert. Im Sommer ist der Pelz der Tiere zu dünn, wegen der Wärme.“
Erneut pflichteten ihr die beiden Haudegen bei.
„In Ordnung. Es geht also gar nicht um die Himmelsrichtung, sondern um die Temperatur. Je kälter das Klima, desto besser die Pelze. Seht ihr, worauf ich hinauswill?“
Es war Eulenfrau, die von ihrer Kocharbeit aufschaute und als Erste antwortete. „Im Norden immer kalt. Weit oben auf Berg auch immer kalt.“
Und so waren sie noch höher in die Berge gestiegen und hatten dieses Tal gefunden, in dem es vor Bibern wimmelte. Da sie den Rückweg nun vor dem Wintereinbruch unmöglich schaffen konnten, hatten sie sich ein Quartier gesucht. Die Höhle, die Henry Folsom entdeckt hatte, wurde nicht von allen bevorzugt, aber selbst der abergläubische Baptiste musste zugeben, dass sie als Unterkunft besser geeignet war als eine rasch zusammengezimmerte Hütte aus Astgabeln, Zweigen und Büffeldecken.
Die Biber, die sie probeweise fingen, ließen sie alle Strapazen vergessen. Es waren die besten Pelze, die selbst Henry Folsom und Patrice Vichery je gesehen hatten. Ihr Vater würde stolz auf Hannahs Weitblick sein.
Aber nicht nur der Erfolg ihrer Suche, sondern auch die Naturwunder, denen sie begegnet waren, machten Hannah so glücklich wie ein kleines Mädchen, dem eröffnet wurde, dass es ab sofort jeden Tag Geburtstag feiern durfte. Sie hatte Büffelherden gesehen, die alles in den Schatten stellten, was sie für möglich gehalten hatte. Obwohl in Mathematik bewandert, war sie plötzlich nicht mehr sicher, ob das menschliche Zahlensystem ausreichte, um die schier unglaubliche Anzahl der Büffel zu beschreiben, die stampfend über die Hochprärien zogen. Hannah hatte ihren ersten Berglöwen beobachtet, Luchse im verbissenen Liebesspiel sowie einen dunklen Fleck in der Landschaft, von dem Henry Folsom behauptete, dass es sich um einen der seltenen Vielfraße handelte, einen bösartigen Marder, der mit dem Mut eines Bären kämpfte. Sie hatten nicht versucht, das Tier einzuholen.
Unweit ihrer Höhle hatte Baptiste einen Berg aus schwarzem Glas vorgefunden, Obsidian, das in grauer Vorzeit zu Säulen erstarrt war. Welche Naturgewalten mochten hier gewirkt haben? Am Fuße des Felsens fand der Delaware eine kunstvoll gehämmerte Speerspitze aus dem eigenwilligen Material, die so scharf war, dass man damit einen Biber häuten konnte. Hannah hatte die Spitze eingesteckt. Die Vorfahren der heutigen Menschheit hatten solche Klingen hergestellt, und Hannah hielt sie für einen wertvollen Fund, der allerdings von den Felsenzeichnungen in ihrer Winterhöhle übertroffen wurde.
An den Tagen erzwungenen Nichtstuns im nicht enden wollenden Winter der Rocky Mountains stand Hannah oft mit einer Fackel in der Hand vor den Felswänden und vertiefte sich in die Malereien. Die Bilder erzählten eine Geschichte. Die Geschichte eines Stammes, der vor langer Zeit auf Wanderschaft gegangen war, um einem Land aus Eis zu entfliehen. Der Stamm hatte eine neue Heimat und reiche Jagdgründe gefunden, in denen er Pelzelefanten, Riesenbisons und gezahnten Katzen nachstellte sowie Krieg gegen andere Stämme führte. Meist blieb das Volk der Felsenmaler siegreich, und doch wurde es allmählich aus seiner neuen Heimat in eine unwirtliche Bergregion verdrängt. Wenn Hannah die Bilder richtig deutete, lag das einfach daran, dass die Feinde der Elefantenjäger zahlreicher waren. Und je tiefer sich das kleine Volk in die Berge zurückzog, desto weniger Stammesangehörige überlebten die Unbilden der rauen Natur. Aber sie unterwarfen sich nie. Es war eine stolze, aber auch eine traurige Geschichte, und immer wieder fragte sich Hannah, ob mit den Elefantenjägern vielleicht auch ein paar ihrer Beutetiere die Zeiten überdauert hatten.
*
„Missy!“
Das scharfe Flüstern Henry Folsoms riss Hannah Billings aus ihren Tagträumen. „Komm mal hier rüber. Ich könnte ein paar jüngere Augen gebrauchen.“
Der Trapper, der auf die Fünfzig zuging, hockte am Eingang der Höhle und spähte nach draußen in die von Schnee und Eiskristallen bedeckte Winterwelt. Ein stahlblauer Himmel spannte sich über dem Tal, die Strahlen der Sonne brachten die Landschaft zum Glitzern wie einen der Kristallkronleuchter in Molly Swingwaters Etablissement. So viel Schönheit tat den Augen weh. Folsom rannen Tränen aus den Augenwinkeln und erstarrten zu Eis, noch ehe sie seinen Bart erreichten. Er musste schon eine Weile in den grellen Tag gestarrt haben.
„Was ist los?“
„Weiß nicht“, murmelte der Trapper. „Irgendwas stört mich da draußen.“
Hannah konnte nichts Außergewöhnliches entdecken. Bloß eine betörende Winterlandschaft, deren Zauber lediglich durch die klirrende Kälte beeinträchtigt wurde, die auch in die Höhle und unter die vielen Schichten ihrer Kleidung drang.
„Dort drüben.“ Mit einem Nicken deutete Folsom auf eine Gruppe mannshoher Tannen, deren Äste sich unter der Last des Schnees zum Boden bogen. Die Bäume wirkten wie Lastenträger mit ermatteten Armen.
Hannah sah zwar die Tannen, aber Folsom musste ihr erklären, was ihn beunruhigte: Einer der Äste schimmerte grün. Seine Nadeln lagen frei. Der Schnee musste abgerutscht sein, wie bei einsetzendem Tauwetter. Im Tal aber herrschte seit Tagen strenger Frost. Folglich musste etwas anderes für das Herunterfallen der weißen Last verantwortlich sein. Ein Tier vielleicht, ein Elch oder der Berglöwe, der noch immer dort draußen herumschlich, womöglich aber auch …
„Menschen“, knurrte Folsom und wies auf eine Spur zwischen den Tannen, eine Reihe tiefer Eindrücke im Schnee wie von Beinen, die bis zu den Knien eingesunken und mit beharrlicher Kraftanstrengung wieder herausgezogen worden waren, Schritt um Schritt.
Die Fährte war gewiss zweihundert Meter vom Höhleneingang entfernt. Hannah brauchte ihr Fernrohr, um zu sehen, was Folsom meinte. Sie fragte sich, wieso der alte Trapper nach jüngeren Augen rief. Mit seinem Sehvermögen war alles in Ordnung.
„Vielleicht ist es Baptistes Fährte“, meinte sie. Der Delaware war im Morgengrauen aufgebrochen, um nach Wild zu suchen.
Folsom zuckte mit den Schultern. „Ba’tiste sollte eigentlich weiter südlich sein.“
Hannah bemerkte, dass er das Futteral von seiner Kentucky-Rifle abgestreift hatte, als erwarte er Ärger.
Sie starrte nun ebenfalls zu den Tannen hinüber, bis ihre Augen zu tränen begannen. Aber da war nichts, nur diese beunruhigenden Eindrücke im Schnee, die von einem Menschen, wahrscheinlicher aber von einem Tier stammten.
Die Monate in der Wildnis hatten Hannah gelehrt, eine solche Entdeckung nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Hier draußen konnte ein Treffen mit fremden Menschen tödlicher sein als die Begegnung mit einem Bären. Ein Bär mochte schlechte Laune haben. Ein Mensch konnte lächeln und dabei einen Mord planen. Hannah hatte Schauergeschichten über die Blackfeet, die Sioux und die Arikara-Indianer gehört, wobei der Grad der Gefahr, die von diesen Stämmen ausging, immer davon abhing, wer die Geschichten erzählte. Eulenfrau zum Beispiel fürchtete die Sioux über alles, schien mit den Blackfeet aber nichts Übles zu verbinden.
Hannah dachte an die Schöpfer der Felsenmalereien. Ihre Bilder sprachen von ewigem Kampf. Wie würden sie das Eindringen einer Gruppe von Fremden in ihr Stammesgebiet aufnehmen? Im Spätherbst hatte Hannah feuchte Farbe an einer der Zeichnungen entdeckt, als habe der Künstler eben erst die Höhle verlassen. Doch bisher war niemand gekommen, und jetzt hoffte sie, sich geirrt zu haben. Vielleicht war es nur Kondenswasser an der kalten Höhlenwand gewesen. Mit einem Mal schien es ihr ratsam, dieses kriegerische Bergvolk nicht herauszufordern.
Ein Geräusch ließ sie aufhorchen. Henry Folsom schwenkte seine Kentucky-Rifle in die Richtung, aus welcher der Laut kam.
Knirschen von Schnee, ein Mann schnaufte.
Baptiste arbeitete sich den Hang zur Höhle herauf. Atem dampfte vor seinem Gesicht. Er trug ein Stück Wildbret auf den Schultern und winkte, nachdem er Hannah und Folsom am Höhleneingang gewahrte.
„Irgendwas bemerkt?“, fragte Folsom, als Baptiste keuchend vor Anstrengung bei ihnen ankam. Hannah sah, dass es eine Elchkeule war, die er sich auf die Schultern geladen hatte. Sein Gewehr steckte in der Hülle aus Büffelhaut, die es vor der Kälte schützen sollte. Das war Antwort genug. Der Delaware war nichts Verdächtigem begegnet, sonst hätte er die Waffe längst schussbereit gemacht.
„Der Berglöwe treibt sich wieder da draußen herum“, sagte Baptiste.
„Der macht mir keine Sorgen“, brummte Folsom. Er machte den Halbindianer auf die Spuren bei der Tannengruppe aufmerksam.
Baptiste kniff die Augen zusammen und sah eine Weile in die angegebene Richtung.
„Wo ist Vichery?“, fragte er dann.
Der Voyageur war vor einer Stunde zum Holzschlagen gegangen. Die seltsame Fährte konnte nicht von ihm stammen, da er eine Richtung eingeschlagen hatte, die ihn von den Tannen fortführte. Sie holten ihr Brennholz stets von Plätzen abseits der Höhle, um umherstreifende Indianer nicht mit der Nasenspitze auf ihren Unterschlupf zu stoßen.
Baptiste kam zu einem Schluss.
„Wahrscheinlich der Berglöwe. Möglich, dass wir etwas gegen ihn unternehmen müssen.“ Seine Squaw hatte das schon vor Tagen verlangt. Sie fürchtete, dass die große Katze nachts in die Höhle eindrang und sie alle im Schlaf umbrachte.
„Einen von uns vielleicht“, hatte Henry Folsom grinsend gemeint. „Wenn der dann laut genug schreit, können die anderen den verdammten Berglöwen kriegen.“
Eulenfrau hatte keine Miene verzogen.
Jetzt kam die Shawnee-Squaw aus dem Inneren der Höhle lächelnd nach vorne, um ihrem Mann mit dem Wildbret zu helfen.
Für einen kurzen Moment standen die vier Menschen dicht beieinander, weshalb der Angriff sie mit vernichtender Härte traf.
Rechts vom Eingang wurde der Schnee lebendig. Zumindest kam es Hannah so vor. Eine weiße Fontäne explodierte vor ihren Augen, kalte Klumpen trafen ihr Gesicht, und inmitten der Schneegeschosse wuchsen graue Teufel aus dem Boden. Drahtige Krieger, in Roben aus Marderfell gehüllt, mit Speeren und Keulen in den Fäusten.
Henry Folsom feuerte seine Kentucky-Rifle ab. Die Kugel riss einem der Angreifer ein Ohr vom Kopf, dennoch durchbohrte er den alten Trapper mit einem kraftvollen Stoß seines Speeres. Hannah sah die Spitze an Folsoms Rücken austreten. Obsidian, wie die Klinge aus schwarzem Glasstein, die sie in der Tasche trug.
Eine Steinkeule zerschmetterte Baptistes Gesicht. Eben noch hatte der Scout gelächelt, jetzt klappte sein Unterkiefer unter der Wucht des Schlages zur Seite weg. Ein zweiter Hieb traf seine Stirn. Blut und Hirnmasse spritzten in Hannahs Gesicht. Am Hang setzte ein vielstimmiges Geheul ein, als weitere Gegner wie Dämonen aus dem Schnee sprangen.
Hannah wich in die Höhle zurück, die jedoch schon einen Atemzug später von den unheimlichen Angreifern geflutet wurde. Hannah begriff, dass die Spur, die Henry Folsom so beunruhigt hatte, von diesen Kriegern stammte. Sie waren im Schutz der Nacht bis zur Tannengruppe geschlichen und hatten von dort aus Tunnel unter den Schnee gegraben. Es hatte Stunden gedauert, aber so waren sie unbemerkt nähergekommen. Ein Trick, den nicht einmal der mit allen Wassern gewaschene Trapper vorausgesehen hatte.
Einer der Krieger warf sich auf Eulenfrau, ein anderer griff Hannah an. Sie zog die Obsidianklinge aus der Tasche und riss sie durch das Gesicht des Kriegers. Die scharfe, grifflose Waffe verletzte ihre Hand, schlitzte aber auch ihrem Feind die Wange auf. Überrascht sprang er zur Seite, was Hannah Gelegenheit gab, die Angreifer genauer zu betrachten.
Es waren gedrungene Männer mit dunklen indianischen Gesichtern, die jedoch anders wirkten als alle Rothäute, die Hannah bisher kennengelernt hatte: härter, unerbittlicher, fanatischer als selbst die Angehörigen von Kriegerbünden. Mit den Angreifern verbreitete sich ein durchdringender Gestank nach nassen Fellen und ungewaschenen Körpern in der Höhle. Diese Männer hier würden selbst unter Wilden als Wilde gelten.
Sollten das die Schöpfer der Höhlenbilder sein?
Der verletzte Krieger warf Hannah zu Boden. Er hob seine Keule, um sie auf ihren Schädel niederfahren zu lassen. Hannah schrie entsetzt auf, und wahrscheinlich war es dieser Laut, der ihr das Leben rettete.
Ein anderer Krieger gebot dem Ersten mit einem herrischen Grunzen Einhalt. Er trat Hannah die Obsidianspitze aus der Hand und beugte sich zu ihr herunter. Seine Nasenflügel blähten sich, als er Witterung aufnahm. Grobe Hände tasteten über Hannahs Kleidung, verharrten auf ihren Brüsten, wanderten dann in ihren Schritt.
Ein weiteres Grunzen, überrascht diesmal.
Von irgendwoher hörte Hannah das panische Heulen von Eulenfrau. Aber die fremden Krieger taten ihnen nichts mehr. Sie hatten erkannt, dass sie zwei Frauen vor sich hatten.
Mein Gott, dachte Hannah Billings, wo steckt Vichery?
Kapitel 1
Die Great Plains, Frühsommer 1821
Erst kamen die Wölfe, dann die Indianer, und es musste sich erst noch erweisen, welches das kleinere Übel war.
Es war an einem Ort, an dem die Berge auf das endlose Grasmeer der Prärie stießen, einem Ort ohne Namen in einem weithin einsamen Land. Es war früher Morgen, der Nachttau auf den Gräsern verflüchtigte sich zu weißem Dunst, der in sanft wogenden Schleiern aus Bodensenken und flachen Mulden stieg, bis er von der aufstrebenden Sonne verzehrt wurde. Eine Gruppe Gabelantilopen äste friedlich auf einer mit Blumen gesprenkelten Wiese. Die Tiere fraßen sich die Bäuche voll, denn in den wenigen Stunden, in denen die Sonne noch Kraft schöpfte, schmeckte das Grün am frischesten. Bereits am Vormittag würde es drückend heiß werden. Die Antilopen zogen es dann vor, träge im Schatten eines Baumes, einer Buschgruppe oder eines Felsblocks zu dösen und auf die befreiende Abendkühle zu warten.
Plötzlich hob eines der Tiere witternd den Kopf und blickte aufmerksam in eine Richtung. Ein Geräusch aus den Hügeln am Fuß der Berge hatte die Antilope, einen Bock mit stattlichem Gehörn, aufgeschreckt. Die Geräusche schwollen an, und immer mehr Angehörige der Herde wurden aufmerksam. Etwas näherte sich ihrem Futterplatz. Antilopen waren neugierige, verspielte Tiere. Stießen sie auf etwas Unbekanntes, wollten sie es näher in Augenschein nehmen. Heute aber überwog ihre Vorsicht, und so gaben sie das Äsen auf und rannten davon.
Die Quelle ihres Misstrauens war ein kleiner Trupp aus Menschen und Pferden, der eine Viertelstunde später den Lagerplatz der Antilopen erreichte: Zwei bärtige weiße Männer und zwölf Pferde, überwiegend kräftige Indianerponys. Außer den beiden Reittieren und einem Pony, das die Ausrüstung der Männer trug, waren alle mit dicken Ballen Biberpelzen beladen, wohl an die tausend Pfund. Erstklassige Ware, gewiss viereinhalbtausend Dollar wert. Ein Vermögen, aber nicht hier draußen in den Bergen.
Die beiden Trapper waren auf dem Weg nach St. Louis, der Stadt der Pelzhändler am Mississippi, und um die Felle zu Geld zu machen, mussten sie die Prärie überqueren, was Wochen dauern konnte. Sie waren spät dran, die meisten Pelztierjäger würden ihre Ware längst zu den Handelsposten gebracht haben, und das würde die Preise drücken, aber darum machten sich die Männer keine Sorgen. In ihren Taschen klickten leise je eine Handvoll Goldnuggets, und sie wussten, wo es mehr davon gab. Das Gold war der Lohn eines gemeinsam bestandenen Abenteuers im letzten Winter, das sie Blut und das Leben guter Freunde gekostet, sie aber auch fest zusammengeschweißt hatte. Sie waren Männer der Berge, Überlebende der Wildnis, und sie wussten, dass sie aufeinander zählen konnten.
„Müssen Antilopen gewesen sein“, sagte Jedediah Jones, der ältere der beiden, nachdem er das niedergetretene Gras betrachtet hatte. Er war wettergegerbt und etwa vierzig Jahre alt, von denen er mehr als die Hälfte in den Bergen verbracht hatte. Jedes einzelne Jahr hatte Narben hinterlassen und seine Haut so dunkel wie die eines Indianers gemacht. Jedediah Jones wirkte verwittert wie ein Berg, der seit tausenden von Jahren den Elementen trotzte, aber nach weiteren tausend Jahren noch immer da sein würde. Das war natürlich Unfug, aber sein Partner hatte entschieden, dass er Jed so sehen wollte. Als einen Berg, den nichts erschüttern konnte.