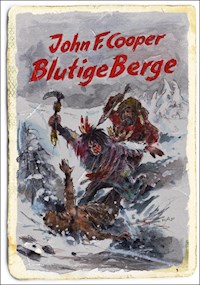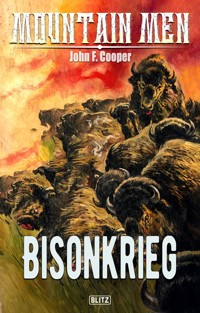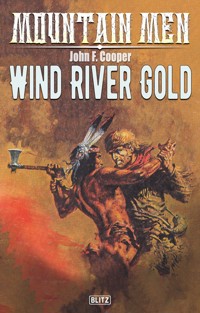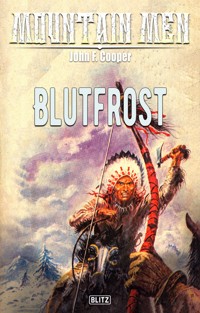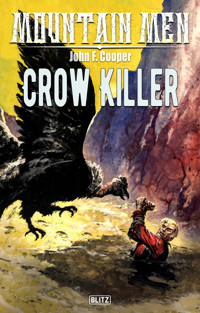Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mountain Men
- Sprache: Deutsch
Spätherbst 1822. Die Trapper Jedediah Jones und Malcolm McGruder begleiten eine Brigade Fallensteller in die Wind-River-Berge. Doch das Unternehmen steht unter keinem guten Stern. Räuberische Indianer lauern in den Wäldern. Noch ahnen Jed und Mel nicht, dass sich auch ein übermächtiger Gegner an ihnen rächen will. Erster Teil der Blutfrost-Trilogie. Die Printausgabe des Buches umfasst 206 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 218
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mountain Men
In dieser Reihe bisher erschienen
4501 John F. Cooper Wind River Gold
4502 John F. Cooper Der goldene Fluss
4503 John F. Cooper Stadt der Pelze
4504 John F. Cooper Bisonkrieg
4505 John F. Cooper Das alte Volk
4506 John F. Cooper Camp des Todes
4507 John F. Cooper Blutfrost
4508 John F. Cooper Die Belagerung
John F. Cooper
Camp des Todes
Erster Band der Blutfrost-Trilogie
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-356-8
Was bisher geschah ...
Nachdem sie den Goldenen Fluss gefunden haben, könnten sich der Mountain Men Jedediah Jones und sein Protegé Malcolm McGruder eigentlich zur Ruhe setzen. Doch die beiden lockt das Abenteuer, weshalb sie einen Auftrag des reichen Pelzhändlers Auguste Chouteau übernehmen: Sie befreien Chouteaus Bastard-Tochter Hannah Billings aus der Gewalt eines prähistorischen Indianerstammes. Dieses Unternehmen führt gleich zum nächsten, denn die junge Frau ist wild entschlossen, sich einen Namen in der rauen Männerwelt des Pelzhandels zu machen, als Bourgeoise ...
Prolog
Der Mississippi, Sommer 1822
Morgengrauen über dem Mississippi. Der heraufziehende Tag brachte Nebel, und mit dem Nebel kam der Tod.
Lautlos wie ein Geist schoss eine Eule aus den aufsteigenden Schwaden, ein Jäger der Nacht, der nun selbst vor etwas auf der Flucht zu sein schien. Augenblicklich war Weißer Hirsch hellwach. In den drei Tagen, die er am Ufer des Vaters der Flüsse auf der Lauer lag, hatte er die Eule schon mehrere Male bemerkt. Er hatte ihren Flügelschlag gehört, hatte gespürt, wie sie in der Dunkelheit über sein Versteck hinweggeglitten war, und er hatte sie von der Jagd heimfliegen sehen, mit einer Maus oder einem Fisch in den Krallen. Die Rückkehr des großen Vogels ohne einen Fang konnte nur eines bedeuten: Dort hinten, im Nebel, näherte sich etwas.
Weißer Hirsch war ein Krieger der Iowa. Mit fünfundzwanzig Sommern stand er in der Blüte seiner Jahre. Sein Haar war an den Seiten geschoren und am Hinterkopf zu einem Zopf gebunden. Er hatte sich den Schwanz eines Gabelbocks hineingeflochten, was Feinde davor warnte, dass seine Pfeile treffsicher genug waren, um ein so schnelles Tier zu erlegen. Seine Haut schimmerte wie poliertes Kupfer. Sein Körper war mit Antilopenfett eingerieben, um die schwarzen Schnaken fernzuhalten, die an den Ufern des Més-a-sipih alles Lebende plagten. Weißer Hirsch ertrug die Insekten klaglos. Er konnte sich sogar in sie hineinversetzen, denn wie die Schnaken war er auf Beute aus.
Jeden Tag schwammen Schiffe an seinem Versteck vorüber: Die schlanken Einbäume fremder Stämme, schwerfällige Kielboote der Weißen oder ihre stinkenden Rauchschiffe, die auf Rädern über das Wasser eilten. Letztere interessierten Weißer Hirsch nicht. Sie ließen sich kaum stoppen, und an Bord befanden sich zu viele Männer, die Widerstand leisten konnten. Mit den Kielbooten und Einbäumen sah es anders aus. Ihre Besatzungen zählten nur wenige Köpfe. Ein Kampf war meistens rasch vorüber.
Die Iowa waren ein kriegerisches Volk. Wenngleich ihr Land heute von den Weißen beherrscht wurde, hatte der Stamm sich niemals ergeben. Sie schlossen keinen Frieden, und wenn sie sich doch auf einen Vertrag einließen, dann nur, um den Gegner über ihre wahren Absichten zu täuschen. Weißer Hirsch war stolz auf die Unbeugsamkeit seines Volkes, obwohl die Iowa, die sich selbst Grauer Schnee nannten, kaum noch dreihundert Köpfe zählten.
Grau wie der Schnee vor der Frühjahrsschmelze, dachte der junge Krieger. Und wie Grauschnee schmelzen wir dahin. Doch während wir vergehen, fürchtet man uns wenigstens.
Im Frühling war der Més-a-sipih auf das Vierfache seiner üblichen Breite angeschwollen, und die Iowa hatten keine Gelegenheit für Überfälle bekommen. Es war, als ob der Vater der Flüsse atmete, als ob er tief Luft holte, um die Bootsführer mit seiner schieren Weite und seiner reißenden Strömung zu entmutigen. Aber jetzt hatte sich der Fluss wieder beruhigt, und die Iowa waren an seine Ufer zurückgekehrt, um ihre Feinde zu berauben.
Der Familienverband, dem Weißer Hirsch angehörte, lagerte in Rufweite. Zwölf Kuppelzelte mit siebzig Männern, Frauen und Kindern. Fünfzehn Krieger waren unter der Führung von Weißer Hirsch ausgezogen. Sie lauerten in Verstecken. Weißer Hirsch konnte nicht von jedem Einzelnen sagen, wo er sich verbarg. Er freute sich über die Geschicklichkeit seiner Krieger, doch bald würden sie auch ihre Gefährlichkeit im Kampf unter Beweis stellen müssen. Drei Tage des Wartens waren eine lange Zeit.
Der Umriss eines Bootes schälte sich aus dem Nebel, und Weißer Hirsch glaubte, endlich auf Beute gestoßen zu sein.
*
Das Boot war schlank wie die Kanus der Einheimischen, aber es war nicht aus einem Baumstamm herausgehauen worden. Statt aus massivem Holz schien seine Wandung aus Birkenrinde zu bestehen. Rinde! Weißer Hirsch verzog geringschätzig die Mundwinkel. Er hatte von Völkern gehört, die solche Boote bauten. Man sagte, die Krieger dieser Stämme seien gewandte Kanufahrer, die die großen Seen im Norden beherrschten, aber Weißer Hirsch bezweifelte das. Rindenkanus waren schwach, und wer ein schwaches Boot steuerte, konnte nicht sehr stark sein.
Die Männer in dem Rindenkanu sahen jedoch nicht schwach aus. Es waren sehnige Weiße in derben Baumwollhemden, mit wettergegerbten Gesichtern. Unter roten oder blauen Mützen lugten schwarze Haare hervor, und ihre Haut war verwittert vom Aufenthalt unter freiem Himmel. Mit sparsamen Bewegungen stachen sie ihre Paddel ins Wasser. Sie nutzten die Strömung und bewegten sich dreimal so schnell voran wie das Wasser selbst.
Am Bug kniete ein junger Kerl mit wildwucherndem braunem Haar. Ein Stirnband bändigte seine Mähne. Die Muskeln an seinen Armen wirkten, als sollten sie ebenfalls mit einem Reif gebändigt werden. Der Bootsführer machte einen entschiedenen Eindruck, und Weißer Hirsch beschloss, ihn ziehen zu lassen. Das Kanu war acht Yards lang und mit zehn Männern besetzt. Außer ihrer persönlichen Ausrüstung konnte nicht viel an Bord sein, was das Risiko eines Überfalls lohnte.
Das Kanu glitt unbehelligt an den versteckten Iowa vorüber. Seine Besatzung ahnte nicht, wie nahe sie dem Tode gewesen war.
Während das Bootsheck im Morgendunst verschwand, kam hinter ihm ein weiterer Bug aus dem Nebel. Ein zweites Rindenkanu, ebenfalls mit zehn Paddlern besetzt. Der Führer dieses Bootes war ein Mann mit kahlgeschorenem Kopf, der wie das Gegenstück des Langhaarigen wirkte. Er mochte fünfzig Sommer zählen, aber er wirkte noch immer so hart wie ein Krieger, den der Große Geist aus einem Stück Fels geformt hatte. Der alte Mann trug ein Gewand aus miteinander verbundenen Vierecken. Die Farben Rot, Blau und Grün bildeten ein Muster, wie Weißer Hirsch noch keines gesehen hatte. Es löste Unbehagen in ihm aus, je länger er hinstarrte. Dieses Gewand war Große Medizin. Erneut unterließ er es, seinen Kriegern das Zeichen zum Angriff zu geben.
Verglichen mit den ersten beiden Booten erschien das dritte Kanu als ein Koloss. Wie ein Riesenwels, der seinen Kopf aus den Wellen hebt, zerriss es die Nebelschwaden und schob sich ins Blickfeld der lauernden Iowa.
Am Bug kniete ein Indianer, dessen Schädel bis auf ein Haarbüschel am Hinterkopf kahlgeschoren war. Sein Gesicht war hager wie das eines Mannes, dessen Leben nur Entbehrungen kannte. Allerdings wirkte er alles andere als ausgezehrt. Falls das mit den Entbehrungen stimmte, so hatten sie ihm nichts anhaben können.
Das große Boot war mit fünfzehn Paddlern besetzt. Es war fast doppelt so lang wie die beiden anderen Kanus und auch wesentlich breiter. Weißer Hirsch erkannte zahlreiche, in Öltuch gewickelte Packen, die jeden freien Fleck an Bord in Beschlag nahmen. Augenblicklich wurde ihm klar, dass er ein Lastenkanu vor sich hatte. Die Packen mochten Felle enthalten oder andere Waren aus dem Norden, und wahrscheinlich waren die Paddler unterwegs nach St. Louis. Was immer die Rindenkanus geladen hatten, war wertvoll genug, um den weiten Weg in die Stadt der Pelzhändler auf sich zu nehmen. Die Besatzungen mussten sich einen hohen Gewinn versprechen, groß genug, dass ihr Anführer mit dem Erlös fünfunddreißig Männer zufriedenstellen konnte.
Plötzlich erscholl ein Ruf aus dem Nebel.
„Prudence, un banc de sable!“
Jemand aus dem zweiten Boot warnte die Paddler des Lastenkanus vor der Sandbank, die an dieser Stelle wie der bleiche Bauch eines gestrandeten Fisches aus dem Fluss ragte. Weißer Hirsch erkannte die Sprache. Franzosen! Der Singsang eines Volkes, dessen Angehörige zahlreich in dieser Gegend lebten, sich aber niemals im Krieg ausgezeichnet hatten. Die Iowa hatten gegen Franzosen gekämpft. Sie waren Farmer und Viehzüchter und liefen davon, wenn man schnell und hart zuschlug. Zwar gab es auch zähe Waldläufer unter den Franzosen, aber an diese dachte Weißer Hirsch in diesem Augenblick nicht. Er war des Wartens überdrüssig, Gier und Kampflust ergriffen von seinem Denken Besitz. Laut schallte sein Kriegsruf über das Wasser. Der dreifache Schrei einer Nachteule. Das Zeichen zum Angriff.
Jetzt! Tötet sie!
*
Die Sandbank befand sich dreißig Yards vom Ufer entfernt. Eine langgestreckte Insel, bedeckt von Treibholz, das an gebleichte Knochen erinnerte. An einigen Stellen war das Holz zu Haufen geschichtet worden. Die Bootsbesatzungen hatten sich über diese Seltsamkeit offenbar keine Gedanken gemacht, und so wählten die Männer im Lastenkanu die Fahrrinne zwischen der Sandbank und dem Ufer.
Viele Flussfahrer taten das. Wer nicht in einem der großen Rauchschiffe unterwegs war, hielt sich meistens instinktiv in der Nähe des Ufers, weil die Rettung aus einem gekenterten Boot von dort aus viel leichter erschien.
Aber die Flussrinne war nicht so harmlos, wie sie schien.
Die Treibholzhaufen auf der Sandbank gerieten in Bewegung. Äste wurden zur Seite gestoßen, und die Iowa, die sich im Innern der improvisierten Biberburgen verborgen hatten, sprangen heraus. Weißer Hirsch hatte sieben Krieger auf der Insel postiert. Ein paar von ihnen griffen nach ihren Bogen, um Pfeile in Richtung des Lastenkanus zu schicken, während zwei junge Männer zu einer Stelle rannten, die mit drei Steinen markiert war.
Unter den Steinen lag das Ende eines Seiles, das die Frauen der Iowa aus dünnen Wurzeln geflochten hatten. Das Seil führte unter der Wasseroberfläche zum Ufer, wo es an einem Baum befestigt war. Steine, die im Abstand einer Armlänge an dem Flechtwerk befestigt waren, sorgten dafür, dass das Tau unter Wasser blieb. Als die beiden Krieger das eine Ende an sich rissen, schnellte das Seil wie der Leib einer Mokassinotter aus dem Wasser und spannte sich als Hindernis über den Fluss.
Der Bug des schweren Lastenkanus stieß gegen die Barriere, das Boot begann sich zu drehen, bis seine Flanke an dem Wurzelseil scheuerte, und das Kanu zum Stillstand kam.
Die Krieger am Seil stemmten ihre Füße mit aller Kraft in den nassen Sand. Als es schien, als würden sie es allein nicht schaffen, eilte ein dritter Iowa herbei. Die anderen vier schossen weiter Pfeile auf die überraschte Besatzung, schwenkten Tomahawks und Schädelbrecher und veranstalteten einen Heidenlärm.
Vom Ufer aus führte Weißer Hirsch die restlichen acht Krieger in den Kampf. Sie sprangen ins Wasser und wateten zu ihrer Beute, während Gischtfetzen hochspritzten wie Regen, der zurück in den Himmel fliehen will.
Die Männer im Kanu reagierten anders als erwartet.
Ein scharfer Ruf des Indianers am Bug ließ die Mannschaft die Paddel mit neuer Kraft in den Fluss stechen. Statt einen Fluchtversuch zu unternehmen, steuerten die Männer das schwerfällige Gefährt in Richtung der Sandbank. Die Besatzung bestand zu zwei Dritteln aus Indianern, die ähnlich aussahen wie der Bootsführer; zähe Rothäute mit Skalplocken oder Haarkämmen auf den geschorenen Köpfen. Zum ersten Mal kamen den Iowa Bedenken, dass dieser Überfall nicht so glatt verlaufen würde, wie andere zuvor.
Knirschend lief der Rumpf des Lastenkanus auf die Sandbank. Die Ruderer warfen die Paddel ins Boot und griffen nach ihren Waffen. Eine Salve aus langläufigen Northwest-Guns fegte zwei der Iowa von den Füßen. Zwei Ruderer waren zuvor von Pfeilen verwundet worden. Sie bissen die Zähne zusammen und nahmen die Gewehre ihrer Kameraden, um nachzuladen, während sich die anderen Männer der Bootsbesatzung in den Nahkampf stürzten.
Der große Indianer am Bug hielt sich nicht mit einer Feuerwaffe auf. Mit dem Paddel in der Hand sprang er an Land und lief auf die drei Iowa zu, die das Seil hielten. Ehe sie ihre Messer oder Tomahawks zücken konnten, drosch er mit dem Paddel auf sie ein. Dem ersten spaltete er mit einem einzigen Hieb den Schädel. Blut und Hirnmasse spritzten dem zweiten Krieger ins Gesicht, und noch während dieser die Körperflüssigkeiten wegblinzelte, traf ihn die Unterkante des Paddels mit der Wucht eines Huftritts in den Mund. Sein Unterkiefer brach, Zähne splitterten, der Krieger spuckte Blut und ging röchelnd zu Boden.
Der große Indianer nahm den Tomahawk an sich, den der Sterbende hatte ziehen wollen. Gleichzeitig griff er nach einer Keule, die hinten in seinem Gürtel steckte. Der Keulenkopf war mit Zähnen gespickt, die ihm das Aussehen eines deformierten Igels verliehen.
Der dritte Iowa ließ sein Messer fallen und wandte sich zur Flucht. Der große Indianer hackte ihm das Kriegsbeil in die Schulter und zog ihn damit zu sich heran. Dunkle, fast schwarze Augen sahen den Iowa an. Ihrem Blick schien jegliches Leben zu fehlen. Mitleid war von diesem Gegner nicht zu erwarten. Der große Indianer hob seine Keule und zerschlug das Gesicht des Kriegers zu blutigem Brei.
Währenddessen hatten seine Männer die restlichen Iowa auf der Sandbank niedergemacht. Bis auf die beiden Verletzten im Kanu hatten die Bootsbesatzungen keine Verluste erlitten.
Weißer Hirsch und seine verbliebenen acht Krieger erreichten das Schlachtfeld und zögerten. Sie standen dreizehn kampfbereiten Feinden gegenüber und hatten jegliches Überraschungsmoment verloren.
Gar nicht gut.
Im selben Moment ertönte flussabwärts ein Ruf.
„Delsy, nous arrivons!“
Die Besatzungen der anderen Kanus hatten das Fehlen des dritten Bootes bemerkt und kamen zurück.
Das gab den Ausschlag. Weißer Hirsch brüllte den Befehl zum Rückzug. Die Iowa machten kehrt und stapften durch das gischtende Wasser zum Ufer. Der große Indianer deutete ihnen stumm mit seiner blutigen Keule hinterher. Wegen der eingesetzten Zähne wirkte die Waffe jetzt wie das Gebiss eines Ungeheuers, das ein Kalb gerissen hatte.
Die Männer wussten, was der Bootsführer von ihnen erwartete. Sie nahmen die nachgeladenen Gewehre von ihren Kameraden entgegen und schossen den flüchtenden Iowa in den Rücken.
Nur Weißer Hirsch und zwei seiner Stammesbrüder schafften es ans Ufer. Einer von ihnen war ein älterer Krieger, der in seinen jungen Jahren Raubzüge im Norden mitgemacht hatte. Er erinnerte sich daran, schon einmal auf Feinde wie die aus dem großen Kanu getroffen zu sein. Männer, die sich die Schädel bis auf einen schmalen Haarstreifen kahlschoren und die ohne Gnade kämpften.
„Irokesen!“, stieß er hervor. „Die Bluthunde der Wildnis!“
Ein weiterer Schuss von der Sandbank verwandelte sein rechtes Auge in eine leere Höhle.
„Zurück! Schützt das Lager!“, keuchte Weißer Hirsch.
*
Der Name des großen Irokesen war Delsy. In der Sprache der Weißen bedeutete das He-is-so. Er ist so. Es war ein seltsamer, fatalistisch klingender Name, aber Delsy war kein Mann, der sich in sein Schicksal ergab. Er bestimmte über das Schicksal anderer. Seinen Namen hatte er durch außergewöhnliche Grausamkeit erworben.
Delsy gehörte zum Stamm der Mohawk. Er war dreißig Jahre alt und hatte die Hälfte seines Lebens in den Diensten der Northwest-Company gestanden, der kleineren und aggressiveren der beiden kanadischen Pelzhandelsgesellschaften. Eines Tages war er mit anderen Voyageuren in ein Dorf der Cree gekommen. Die Cree hatten eine Vereinbarung mit der Hudson’s Bay Company, und als sie nicht bereit waren, ihre Felle der Konkurrenz zu überlassen, befahl der Anführer der Northwesterner, den gesamten Familienverband niederzumachen. Delsy, der damals einen anderen Namen trug, tat sich in dem Gemetzel hervor. Er nahm die jüngste Tochter des Häuptlings und fing an, ihr vor den Augen ihres Vaters Körperteile abzuschneiden. Mehrere Finger, eine Hand, einen Fuß, eine Brust. Er warf alles in einen Kochtopf, rührte um und sagte dem sterbenden Häuptling, dass er das Mädchen später aufessen werde. Als er seine Drohung wahrmachte, obwohl dafür überhaupt keine Notwendigkeit mehr bestand, erntete er selbst unter seinen eigenen Leuten Abscheu.
„Zum Teufel, was macht der Kerl da?“, entfuhr es einem der Voyageure.
Ihr Anführer hatte nur mit den Schultern gezuckt.
„Lass ihn. Er ist so.“
So war Delsy zu seinem Namen gekommen.
Jetzt stand er am Rand der Sandbank und blickte den anderen beiden Kanus entgegen. Während er wartete, bückte er sich, um eine Handvoll der Zähne aufzuklauben, die er dem Iowa-Krieger ausgeschlagen hatte.
Delsys Kriegskeule war mit den Reißzähnen von Berglöwen gespickt, mit Eckzähnen von Bären und den Hauern wilder Schweine. Der Schaft wies im oberen Bereich Verzierungen auf, die ebenfalls aus Zähnen bestanden. Es waren menschliche Backenzähne.
Delsy untersuchte die Zähne des Iowa, befand, dass sie minderwertig waren, und warf sie in den Fluss.
Die beiden leichteren Kanus schälten sich aus dem Nebel. Jeweils die Hälfte der Besatzung paddelte gegen die Strömung an, während die restlichen Männer ihre Northwest-Guns schussbereit im Anschlag hielten. Als sie Delsys aufragende Gestalt erblickten, entspannten sie sich.
Die Kanus landeten. Der ältere der beiden Bootsführer sprang als erster in den Sand. Er trug Mokassins und Leggings aus Wildleder wie ein Indianer, dazu ein Baumwollhemd und eine Jacke, deren Tartanmuster ihn als Highlander vom Clan der McTavishs auswies. Doch niemand in der Neuen Welt würde die Anordnung der roten, blauen und grünen Karos zu deuten wissen, und auch in der Alten Welt gab es vermutlich nicht mehr viele Menschen, die sich an die McTavishs erinnerten. Nach der verheerenden Niederlage der Schotten im Hochmoor von Culloden vor einem dreiviertel Jahrhundert hatte der Clan alles verloren. Die meisten seiner Männer waren in der Schlacht von den Engländern getötet worden, und wer entkam, war für den Rest seines Lebens auf der Flucht. Bald hatte es nur noch einige wenige verstreut lebende Abkömmlinge des Clans gegeben.
Staunton McTavish war neunzehn Jahre alt gewesen, als er sich in einer mondlosen Nacht aus der ärmlichen Hütte seiner Familie geschlichen hatte und zwei Wochen später als blinder Passagier an Bord eines Handelsschiffes gegangen war. Zurück ließ er einen trunksüchtigen Vater, zwei bleiche Schwestern und eine Mutter, aus der fast alles Leben gewichen war. Lieber wollte er beim Versuch, sein Schicksal zu verbessern, in der Neuen Welt sein Leben aushauchen, als weiterhin ein Lumpendasein in den Highlands zu fristen. Sein Plan war bestenfalls vage, aber er ging auf.
In den folgenden dreißig Jahren machte Staunton McTavish eine steile Karriere in den Diensten der Northwest Company. Die Pelzhandelsgesellschaft, die der britischen Hudson’s Bay Company einen harten Handelskrieg lieferte, wurde von Schotten geführt, und ein Junge aus dem Hochland bekam hier alle Möglichkeiten. Er musste sie nur ergreifen.
McTavish wurde Waldläufer. Er besuchte Indianerstämme und überzeugte sie, ihre Pelze den Northwesternern zu verkaufen. Er lebte mehrere Jahre bei den als erbarmungslos geltenden Irokesen, fand aber, dass sie ihren Ruf zu Unrecht trugen. Die Irokesen taten nur, was nötig war, um Feinden Respekt einzuflößen. Auch Freunden, wenn es sein musste. McTavish verstand das. Vielleicht wären die Engländer nie in die Highlands gekommen, wenn die Schotten wie die Irokesen gewesen wären.
Er wurde der Anführer, unter dessen Kommando sich Delsy seinen Namen gemacht hatte.
Delsy war ohne Vater aufgewachsen, bis Staunton McTavish das Lager seiner Mutter geteilt hatte und geblieben war. Der Schotte behandelte Delsy wie einen Sohn. Ein paar Jahre später hatten sie gemeinsam eine Mannschaft aus Voyageuren aufgestellt und waren auf der Jagd nach Pelzen bis in den Hohen Norden vorgedrungen.
Dort hatten sie den dritten Mann in ihrem Bund kennengelernt, einen hochgewachsenen Franzosen, der ihre Lebensweise teilte und ihre Methoden auf dem Weg zum Erfolg guthieß. Sein Name war Gael Prevost. Bald betrachtete Staunton McTavish auch ihn als Ziehsohn, und der Franzose respektierte den Rat des älteren Mannes.
McTavish wusste, dass er selbst kein großartiger Geschäftsmann war, aber in dem jungen Prevost erkannte er alles, was man neben Skrupellosigkeit noch benötigte, um sich im Fellhandel durchzusetzen. Nach einer Weile bot er dem Franzosen die Führung ihrer Party an. Prevost akzeptierte und wurde ihr Commis, der Anführer einer beinharten Truppe von Pelzbeschaffern. Sie nannten sich Hommes du Nord, Nordmänner, weil sie die Winter weit oben im Norden verbrachten, wo die Wälder endeten und es nur noch unwirtliche Steppen und Seen gab, die monatelang gefroren blieben. Es war ein Land, gegen das die übliche Wildnis Britisch-Nordamerikas zivilisiert wirkte. Ein Land, in dem nur die Härtesten überlebten.
Prevost, McTavish und Delsy liebten den wilden Norden. Hier mussten sie sich vor niemandem verantworten. Die Felle der Biber, Otter und Marder waren so dicht wie nirgends sonst, und die Eingeborenen ließen sich mit einem Bruchteil der Tauschwaren abspeisen, die südlich der Hudson’s Bay für erstklassige Pelze den Besitzer wechselten. Die Hommes du Nord brachten der Northwest Company enorme Gewinne.
Bis jetzt hatte ihre Mannschaft aus Franzosen, Schotten und Irokesen ein gutes Auskommen in den Diensten der Gesellschaft gehabt. Sie waren geachtete Männer gewesen, und ihre Unternehmungen fingen an, auch sie selbst reich zu machen. Doch dann hatten sich die Zeiten geändert.
Letzten Herbst war die Northwest Company von der Hudson’s Bay Company geschluckt worden. Jahrelang hatte zwischen den verfeindeten Gesellschaften ein Handelskrieg getobt, und die Northwesterner waren am Gewinnen gewesen. Aber dann hatten politische Winkelzüge über die Kompetenz der Wildnis gesiegt. Die Regierung in London wollte nicht länger zusehen, wie der Pelzhandel unter den gegenseitigen Überfällen und Raubzügen litt, und hatte die Vereinigung beider Gesellschaften erzwungen. Obwohl die Hudson’s Bay Company kurz vor dem Zusammenbruch gestanden hatte, triumphierte sie am Ende. Unverdientermaßen, wie die Hommes du Nord fanden.
Bald hatten die Northwesterner in ihren eigenen Handelsposten nichts mehr zu melden. Schotten, die das Rückgrat der Company gebildet hatten, wurden auf unbedeutende Posten abgeschoben, Franzosen herablassend behandelt, indianische Voyageure rangierten fortan nur knapp über den Eingeborenen, denen man ihre besten Felle für wenig Gegenwert abnahm. Für stolze Männer wie Prevost, McTavish und Delsy konnte es darauf nur eine Antwort geben: Sie verließen die Hudson’s Bay Company und arbeiteten auf eigene Rechnung.
Wahrscheinlich hätten sie im Norden ihr Auskommen finden können. Ihre Fähigkeit, erstklassige Pelze zu beschaffen, war unangefochten. Doch als Aufkäufer kam nur die verhasste Hudson’s Bay Company in Frage. Der Stolz der Hommes du Nord ließ eine solche Partnerschaft nicht zu.
Außerdem hatte Gael Prevost noch ein Eisen im Feuer. Ein Angebot, das ihm vor Jahren gemacht worden war und das noch größeren Reichtum verhieß als der Fellhandel in den britischen Territorien. Deshalb waren die drei Nordkanus in diesem Frühjahr nach Süden gefahren.
Für die Iowa war es einfach Pech gewesen.
*
Gael Prevost setzte seinen Fuß auf die Sandbank. Er war ein stattlicher Mann, bei dem selbst ein so ein beiläufiger Schritt wie die Inbesitznahme eines Königreichs wirkte. In seinem Gürtel steckte eine Steinschlosspistole, deren Achtkantlauf verriet, dass es keine gewöhnliche Waffe war. Die Pistole stammte aus der Waffenschmiede von Lamotte in St. Etienne und hatte einem Oberst der Grande Armee gehört, der nach der Niederlage Kaiser Napoleons in die Neue Welt gekommen war. Die Pistole war Teil eines Paars und besaß einen gezogenen Lauf, der ihr eine hohe Treffsicherheit verlieh, sodass Prevost auf ein unhandliches Gewehr verzichtete.
Der Oberst hatte sich nicht freiwillig von seinen Waffen getrennt. Er hatte in den Pelzhandel einsteigen wollen, und da er das in einer Gegend tat, die von den Hommes du Nord beansprucht wurde, hatte Prevost ein Exempel statuieren müssen. Die zweite Pistole war in seinem Gepäck verstaut. Prevost trug immer nur die nötigste Ausrüstung, denn er schätzte Beweglichkeit über alles. Neben der Pistole hing die Scheide eines schlanken Messers, mit dem er einen Fisch genauso leicht ausnehmen konnte, wie er es mit dem Oberst getan hatte. Als er jetzt an Land ging, hielt Prevost es nicht für nötig, eine der Waffen zu ziehen. Er sah, dass seine Männer alles unter Kontrolle hatten.
„Was war hier los?“ Er sprach mit ruhiger Stimme, als erkundige er sich nach ein paar Kindern, die Steine geworfen hatten.
„Verdammte Rothäute“, sagte McTavish und spuckte aus.
Delsy neben ihm verzog keine Miene. Er fühlte sich nicht als Rothaut. Er war ein Homme du Nord.
„Krieger“, sagte der Mohawk. „Drei Hände, ein Finger.“
Sechzehn Männer also. Mit wenigen Blicken verschaffte sich Prevost einen Überblick. Er zählte elf Tote.
„Drei weitere hat der Fluss genommen“, sagte Delsy. „Zwei sind fort. Schwächlinge.“
„Welche Richtung?“, fragte Prevost.
Delsy wies zum Ufer, wo die Andeutung eines Pfades zwischen dem Baum- und Strauchwerk zu sehen war.
Prevost starrte hinüber. Sie hatten Pelze im Wert von mindestens fünfzehntausend Dollar an Bord ihres Lastkanus. Die Ware musste beschützt werden. Doch die Hommes du Nord ließen keine Provokation unbeantwortet. Das war ihre Art. Niemals Schwäche zeigen, niemals nachgeben.
Irgendwo mussten die räuberischen Rothäute ihr Lager haben. Wie viele Krieger mochten dort sein? Prevost standen fünfunddreißig Männer zur Verfügung. Zwei Dutzend Schotten und Franzosen, elf Irokesen. Diese Streitmacht konnte es leicht mit hundert Wilden aufnehmen. Was aber, wenn da drüben mehr lauerten?
Am Ufer erschienen zwei von Delsys Irokesen und riefen etwas in ihrer kehligen Sprache. Der große Mohawk hatte an alles gedacht. Sofort nach der Flucht der Iowa hatte er ihnen zwei Späher hinterhergeschickt.
„Ein kleines Dorf“, übersetzte er. „Sechs mal zwei Hände. Frauen, Kinder, Alte. Wenige Krieger.“
Prevost nickte. „Ich hab’s schon verstanden.“
Er befahl fünf Franzosen, bei den Kanus zu bleiben. Alle anderen sollten ihm folgen. Die Hommes du Nord zogen in den Kampf, um sich für den Überfall zu rächen.
*
Die Vergeltung kam wie ein Präriebrand über das Lager der Iowa. Das Feuer flackerte an den Rändern des Dorfes auf und fraß sich ins Zentrum vor. Doch nicht Flammen brachten Tod und Vernichtung, sondern Männer mit Büchsen, Kriegskeulen und Tomahawks.
Prevost hatte seine Leute in drei Gruppen aufgeteilt. Franzosen und Schotten griffen das feindliche Lager in einer Zangenbewegung an. Sie feuerten eine Salve, luden nach und feuerten wieder. Frauen und Kinder fielen, wo sie gerade standen. Die Angreifer machten keinen Unterschied. Sie schossen immer weiter. Nicht so diszipliniert wie Soldaten in einer Schlachtreihe, aber genauso beharrlich. Schießen, laden, schießen. Der Bleihagel hörte niemals auf.
Prevost sah einen alten Iowa vor einem der Kuppelzelte sitzen, die wie große Backöfen aussahen. Er zog seine Pistole und schoss dem Alten in die Stirn. Der Iowa kippte ins Dunkel der Hütte. Ein kleiner Junge krabbelte weinend über den Toten ins Freie. Prevost war noch beim Laden, aber einer seiner Voyageure stand bereit und erschoss das Kind.
Der Zorn der Hommes du Nord