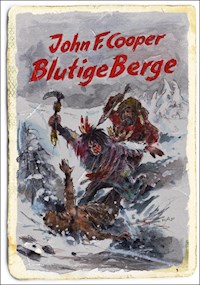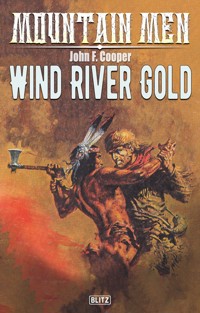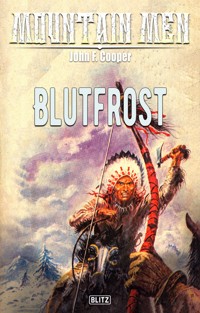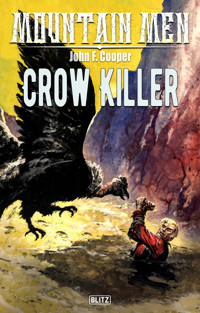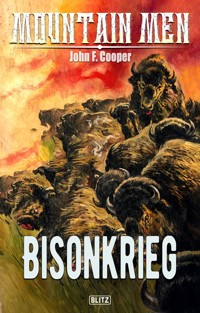
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mountain Men
- Sprache: Deutsch
Sommer 1821 Die Trapper Jed und Mel wurden von dem Pelzhändler Auguste Chouteau angeworben, um nach seiner Tochter zu suchen, die in den Rocky Mountains verschollen ist. Gemeinsam mit dem Sklaven André und Louis Breton, einem ehemaligen Elitesoldaten aus Napoleons Alter Garde, ziehen sie erneut in den Fernen Westen. Der Zeitpunkt könnte nicht ungünstiger sein, denn die Blackfeet sind auf dem Kriegspfad: Sie wollen ihre Bison-Jagdgründe gegen Stämme von jenseits der Berge verteidigen. Bisonkrieg (Teil 2) Ein neues Abenteuer aus der wilden Zeit der Mountain Men, das ein bislang wenig beachtetes Thema behandelt. Kriege, die die Indianer untereinander um die Herrschaft über die Bison-Prärien ausgetragen haben. Die Printausgabe des Buches umfasst 246 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mountain Men
In dieser Reihe bisher erschienen
4501 John F. Cooper Wind River Gold
4502 John F. Cooper Der goldene Fluss
4503 John F. Cooper Stadt der Pelze
4504 John F. Cooper Bisonkrieg
4505 John F. Cooper Das alte Volk
John F. Cooper
Bisonkrieg
Zweiter Band der Bisonkrieg-Trilogie
Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-768-9Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Was bisher geschah ...
Auf dem Weg nach St. Louis, der Stadt der Pelze, treffen Jed und Mel auf Bloody Buffalo, einen Kriegshäuptling der Blackfeet. Er will die Stämme seines Volkes einigen, um Krieg gegen Indianer von jenseits der Berge zu führen, die in jedem Sommer in die Büffeljagdgründe auf den Plains vordringen. Bloody Buffalo ist ein schrecklicher Gegner, doch Jed erkauft ihnen mit dem Iniskim, den er seinem Todfeind Hunting Coyote abgenommen hat, freies Geleit. Der heilige Büffelstein bringt Bloody Buffalo seinem Ziel ein gutes Stück näher.
Nachdem sie einem Wirbelsturm und einem psychopathischen Mörder getrotzt haben, verkaufen Jed und Mel ihre Pelze in St. Louis und machen die Goldnuggets aus Vermächtnis des französischen Trappers Jehan Prevost zu Geld. Sie wollen ihren neuen Reichtum genießen, doch bald schon werden sie in neue Abenteuer hineingezogen. Erst wird Mel von Straßenräubern überfallen, die anscheinend etwas über den Goldenen Fluss in den Jagdgründen der Crow wissen, dann werden sie von dem Pelzhändler Auguste Chouteau angeheuert. Sie sollen Hannah Billings finden, Chouteaus uneheliche Tochter, die mit einem Erkundungstrupp in den Rocky Mountains verschollen ist.
Gemeinsam mit dem Sklaven André und Louis Breton, einem ehemaligen Grenadier aus Napoleons Alter Garde, fahren sie auf einem Dampfschiff den Missouri aufwärts. Als das Boot eine tagelange Pause einlegen muss, weil eine gewaltige Büffelherde den Fluss überquert, beschließen sie, ihre Reise an Land fortzusetzen.
Kapitel 1
Missouri River, Sommer 1821
Nach dem Ausschiffen zogen sie westwärts, wie Jed es vorgeschlagen hatte, vier Männer und sechs Pferde, von denen zwei mit Ausrüstung und Tauschwaren beladen waren. Als Packtiere wären Jed ein paar stoische Mulis lieber gewesen, aber Auguste Chouteau hatte auf Pferden bestanden. So würden sie schneller vorankommen, hatte er argumentiert, und wenn sich dieser Vorteil am Ende auf einige Tage summierte, mochte dies den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ihres Unternehmens ausmachen, den Unterschied zwischen Leben und Tod für Hannah Billings und ihre Begleiter.
Jed hatte es schulterzuckend hingenommen. Pferde waren nicht so genügsam wie Mulis, doch falls es nötig wurde, würden sie sich bei den Indianern besser gegen Informationen, Nahrung oder freies Geleit tauschen lassen.
Der Beginn ihrer Landexpedition stand unter keinem guten Vorzeichen. Kapitän Crittenden hatte sie ein wenig nördlich von der Einmündung des Platte River in den Missouri an Land gesetzt. Crittenden hatte einen Abschnitt gewählt, an dem eine Sandbank vom Ufer aus bis zur Flussmitte reichte. Die Pferde mussten nur wenige Meter schwimmen, um das Schwemmland zu erreichen. Auf der Sandbank ritten sie ans westliche Ufer und trieben die Reittiere die flache Böschung hinauf in ein Waldstück, wo Jed abrupt Halt machte.
„Verdammt!“
Die anderen sahen ihn verwundert an, doch dann dämmerte ihnen, in welchen Schlammassel sie hier geraten waren.
Das üppige Grün des Waldstücks wurde immer wieder von toten Bäumen durchbrochen, die wie silbrige Schlangen himmelwärts strebten. Auf den ersten Blick war dies nur ein verwilderter Wald. Allmählich aber wurde ein verhängnisvolles Muster erkennbar.
Abgestorbene Bäume verteilten sich normalerweise kreuz und quer im Dickicht: Aufrecht stehende Stümpfe, halb umgestürzte Stämme, die sich an andere Stämme lehnten und Totholz, das am Boden verrottete. Die toten Bäume in diesem Wald waren jedoch ausnahmslos nach oben gerichtet und ballten sich zu skelettartigen Pyramiden zusammen. Dies war Menschenwerk. Kein toter Wald, sondern Gerüste. Gerüste mit Plattformen aus Ästen und Zweigen, auf denen Ballen aus Decken und Büffelhäuten lagerten. Eine Begräbnisstätte.
„Ein verdammter Indianerfriedhof“, knurrte Jed.
„Oui, aber die Toten werden kaum heruntersteigen und uns den Durchgang verweigern“, sagte Breton. Doch er war erfahren genug, um das Problem zu erkennen. Falls die Sioux, denen dieser Friedhof gehören musste, einen Trupp weißer Männer an dieser heiligen Stätte erwischte, mussten sie sich um die Blackfeet keine Sorgen mehr machen, weil sie deren Jagdgründe niemals erreichen würden.
„Langsam im Schritt“, zischte Jed. „Und bleibt verdammt noch mal hinter mir.“
Er suchte nach einem Weg zwischen den Stangengerüsten, der sie möglichst rasch aus diesem Wald herausbringen würde. Doch das war nicht einfach. Immer wieder tauchten neue Hochgräber zwischen den Bäumen auf. Die Pfähle knarrten leise im Wind, der vom Missouri herüberwehte. Es klang, als würden die Toten mit den Zähnen knirschen.
Fasziniert starrte Mel nach oben und versuchte, die Bündel auf den Plattformen zu zählen. Es gelang ihm nicht, denn die Anordnung der Grabstätten war chaotisch. Hier mussten Hunderte Indianer bestattet liegen, der Größe der Bündel nach zu urteilen nicht nur Erwachsene, sondern auch viele Kinder. Mel fragte sich, woran sie gestorben waren. Entbehrungen? Seuchen? Oder waren sie Opfer feindseliger Auseinandersetzungen zwischen den Stämmen?
Jed schien seine Gedanken zu erahnen. „Ich habe mal von einer Pawnee-Horde gehört, die durch Büffel ausgelöscht wurde“, sagte er leise. „Die Krieger ritten zur Jagd, ihre Familien bereiteten sich darauf vor, die Büffel zu zerlegen. Irgendwer machte einen Fehler, die Herde floh in die falsche Richtung und trampelte alle Pawnee, die im Dorf geblieben waren, nieder, Alte, Frauen und Kinder.“
„Dann waren die Krieger ja noch am Leben, die Horde also überhaupt nicht ausgelöscht“, wandte Breton ein.
Jed zuckte nur mit den Schultern, und André, der die Stangengerüste nicht aus den Augen ließ, erklärte: „Der mächtigste Krieger ist nichts ohne seine Familie.“
„Genau“, sagte Jed, und Breton gab ein genervtes Knurren von sich. Mel musste schmunzeln.
Sie erreichten den Rand des Indianerfriedhofs und ritten aus dem Waldstück hinaus in die Prärie. Es war als würde eine Last von ihren Schultern genommen. Die Schwüle wich einer zunehmend klarer werdenden Luft. Weit und breit war kein Sioux zu sehen. Sie hatten Glück gehabt.
Aber ihr Glück hielt nicht an. Stattdessen mehrten sich die düsteren Omen.
Zwei Meilen vom Indianerfriedhof entfernt fanden sie Loomis und seine Trapper. Zumindest nahmen sie an, dass es sich bei den Toten um die Fallensteller handelte, auf die der Clerk in der Handelsstation am Missouri vergebens wartete.
*
Die Toten mussten seit vielen Tagen hier liegen, denn die Fliegen hatten ihre Herrschaft über die Leichen bereits an die Käfer und Ameisen verloren, die auf den verwesenden Körpern nun ihre eigenen Kämpfe ausfochten.
Wie die Trapper ihr Leben verloren hatten, war nicht zu übersehen. Die sieben Männer hatten ein Lager aufgeschlagen, ein Kochfeuer errichtet, und dann waren sie von Indianern überrumpelt worden. Ihre Leichen wiesen zahlreiche Speer- und Pfeilwunden auf, und kein einziger hatte seine Haare behalten. Zusammen mit den Skalpen hatte man den Toten die Ausrüstung, die Pelze und die Pferde abgenommen. Im niedergetrampelten Gras lagen nur noch die verstümmelten Körper.
„Sioux?“, fragte Breton.
„Anzunehmen“, erwiderte Jed. Die Angreifer hatten ihre Pfeile eingesammelt und mitgenommen, denn die Schäfte waren in der baumlosen Prärie zu wertvoll, um sie zusammen mit den Leichen der Feinde verrotten zu lassen. Es gab nichts, was Jed die Herkunft der Angreifer verriet, aber da sie sich in den Jagdgründen der mächtigen Sioux befanden, lag der Schluss nahe, dass Angehörige dieses Volks für den Überfall auf die Pelzjäger verantwortlich waren.
„Yankton-Sioux vielleicht, oder Oglala“, meinte Jed. „Ehrlich gesagt, kann ich die vielen Sioux-Stämme kaum auseinanderhalten. Ich hatte bisher so gut wie nie mit ihnen zu tun. Vielleicht waren’s sogar Pawnee. Deren Gebiet liegt hier auch irgendwo.“
Mel hielt das Eingeständnis seines Partners für bemerkenswert. Wann hatte Jed jemals zugegeben, dass er über irgendeine Sache, die das Leben im Westen betraf, nicht Bescheid wusste?
„Bei den Kosaken in Russland wusste man auch nie, von wo sie kamen“, brummte Breton. „Vom Don oder vom Dnjepr oder aus dem Ural, das war völlig egal. Wenn man sie sah, konnte man bloß noch eins tun.“
„Fliehen“, vermutete André.
Breton schüttelte den Kopf. „Schießen. Laden und immer wieder Schießen. Zum Fliehen hatte man keine Zeit, und wer es dennoch versuchte, kam nicht weit, bis er einen Kosakensäbel im Nacken spürte.“ Der Sergeant lachte plötzlich. „Aber wir von der Garde haben ihnen den Arsch aufgerissen. Wir sind keinen Meter gewichen und haben tausende Kosaken getötet. In den russischen Steppen weinen Mütter noch heute, wenn sie an die Alte Garde denken.“
Mel hielt Bretons Gerede für Prahlerei, und er fragte sich, mit welcher Geschichte Jed dagegenhalten würde. Aber sein Partner blieb stumm und blickte sich aufmerksam um.
„Wenn die Sioux auf dem Kriegspfad sind, wie groß sind dann unsere Chancen, an Land durchzukommen?“, fragte Breton. Ihm war anzumerken, dass er seine Zustimmung, den Landweg zu nehmen, inzwischen bereute.
„Ich glaube nicht, dass alle Sioux auf dem Kriegspfad sind“, sagte Mel. „Der Clerk sprach nur von diesem einen Kerl, Grauer Wolf. Vielleicht können wir ihm ein paar von unseren Tauschwaren überlassen, falls wir ihm begegnen.“
„Glaubst du?“, fragte Breton.
„Finden wir’s raus“, sagte Jed. Er deutete auf einen Hügel im Grasland, der eben noch leer gewesen war. Jetzt war eine Gruppe Indianer dort aufgetaucht. Ein Dutzend Krieger mit Lanzen, an denen Adlerfedern flatterten. Der Mann in der Mitte trug einen Kopfputz aus Wolfsfell.
Grauer Wolf.
*
Breton übernahm sofort das Kommando. „Waffen überprüfen und schussbereit machen. McGruder, du deckst unsere rechte Flanke, Jones nach links. André, bleib direkt neben mir und denk daran, dass deine Schrotflinte nur auf kurze Distanz wirksam ist. Also warten, bis ich dir den Feuerbefehl gebe.“
Mel nahm zögernd den ihm zugewiesenen Platz ein und machte seine Forsyth-Rifle scharf, indem er den Hahn spannte und den Flakon drehte, damit eine Prise Knallquecksilber in die Zündkammer fiel. Jed jedoch machte keine Anstalten, den Weisungen des Sergeants Folge zu leisten. „Was soll das werden?“, fragte er.
„Wir kämpfen, was sonst“, meinte Breton unwirsch. „Wir schießen, sobald wir das Weiße in ihren Augen sehen. Auf mein Kommando!“ Er wandte sich noch einmal an André. „Du nicht. Du wartest, bis wir nachladen müssen und holst den ersten Bastard vom Pferd, der durchbricht. Wenn du es richtig anstellst und sie dicht nebeneinander kommen, kannst du vielleicht mehrere auf einmal erwischen. Alles klar? Gut. Haltet eure Pistolen bereit, falls es zum Nahkampf kommt.“
Jed schüttelte den Kopf. „Warten wir doch erst mal, was sie zu sagen haben.“ Er deutete zu den Indianern, die fast dreihundert Meter entfernt warteten, ein bedrohlicher Pulk aus Pferden, federgeschmückten Kriegern und Lanzen, von denen jede so lang wie anderthalb Männer war.
Der Krieger mit dem Wolfsfell löste sich aus der Menge, hob gut sichtbar seine linke Hand zum Zeichen des Friedens und kam im Schritt herübergeritten. Zwei seiner Männer folgten ihm im Abstand von einigen Pferdelängen.
Grauer Wolf kam zum Palaver.
„Wir sollten ihn erschießen“, knurrte Breton. „Wenn ihr Anführer tot ist, wird der Kampfgeist der ganzen Horde brechen. Auf mein Zeichen.“ Er spannte den Hahn seiner Muskete. „Wartet, bis ihr das Weiße in seinen Augen seht.“
„Nein“, sagte Jed mit fester Stimme. „Das ist keiner von deinen Kosaken. Das ist ein Kriegshäuptling der Sioux.“
„Wo ist der Unterschied?“
Jed schnaufte. Er machte keine Anstalten, seine Baker-Rifle zu spannen. „Womit haben diese Kosaken auf dich geschossen?“
„Was?“ Breton blinzelte. „Manche hatten Reiterpistolen“, sagte er dann. „Ein paar hatten Musketen. Vor allem aber Säbel und Lanzen. Wie die da.“ Er wies auf die drei Sioux, die sich mit überlegener Gelassenheit näherten.
„Von hier aus sehen wir nur die Lanzen“, erklärte Jed. „Du kannst aber Gift drauf nehmen, dass sie auch Bogen dabeihaben. Bei den Rothäuten gibt es ein Spiel. Dabei geht es darum, möglichst viele Pfeile gleichzeitig in der Luft zu haben. Sie schießen einen Pfeil nach dem anderen ab, solange, bis der erste den Boden berührt.“
„Na und?“ Bretons Schnurrbart bebte. Der alte Soldat hatte keine Angst, erkannte Mel. Er spürte die Erregung vor einem Kampf. Aber dieser Kampf würde ein Gemetzel werden.
„Ich habe Crow gesehen, die hatten sieben oder acht Pfeile in der Luft, ehe sich der erste in den Boden bohrte“, sagte Jed. „Mit einem Jagdbogen können sie auf hundert Meter genau schießen. Wenn diese Krieger dort angreifen, werden Pfeile wie aus einem Wolkenbruch auf uns regnen. Und wie schnell können wir wohl zurückfeuern?“
Breton zuckte die Schultern. „Schnell genug. Ich beherrsche meine Waffe.“
Breton besaß eine französische Militärmuskete, dieselbe, die er in der Alten Garde getragen hatte. Das Holz war nachgedunkelt und wies zahlreiche Schrammen auf, aber die Waffe war gut gepflegt. Sie reichte dem Sergeanten beinahe bis zur Schulter. Auf dem Dampfboot hatte er den anderen seine Muskete voller Stolz vorgeführt. Er hatte das Zündloch vergrößert, wodurch er schneller laden konnte. Man musste nur Pulver in den Lauf schütten und den Kolben dann hart auf den Boden stampfen. Das bewirkte, dass ein wenig Pulver aus dem Lauf durch das vergrößerte Zündloch in die Pfanne rieselte. Auf diese Weise sparte man sich ein paar Handgriffe. Ein schneller Musketenschütze konnte zwei oder drei Schüsse pro Minute abgeben. Bretons Modifikationen erhöhten die Feuerrate auf vier Schuss. Trotzdem war das lächerlich wenig im Vergleich zu einem indianischen Bogen. Zumal die Muskete höchstens auf fünfzig Meter treffsicher war. Nur Jed und Mel besaßen Gewehre mit höherer Reichweite.
Diese Berechnungen sprachen deutlich zu ihren Ungunsten, das musste inzwischen auch Breton klar geworden sein. Brummend nahm er seine Muskete herunter, ließ den Hahn aber gespannt und ging den Grenadiersäbel lockern, der am Sattel seines Pferdes hing.
Die drei Sioux waren fast bei ihnen. In dreißig Schritt Entfernung hielten sie ihre Reittiere an. Sie trugen Leggings aus Wildleder, ihre Oberkörper waren nackt und wirkten wie gemeißelt. Alle drei hatten Bogen und prall gefüllte Pfeilköcher dabei. Jed hatte Recht behalten.
„Ich bin Grauer Wolf“, sagte der Anführer. Sein Gesicht wirkte wie gegerbtes Leder, in seinem schwarzen Haar, das zu zwei straffen Zöpfen geflochten war, zeigten sich graue Strähnen. Grauer Wolf war ein alternder Häuptling. Dem Clerk im Handelsposten zufolge hatten die Händler ein gutes Auskommen mit ihm gehabt. Wenn er sich in seinem Alter gegen den leichten Weg und für den Kriegspfad entschied, hieß das, dass er sich einen Namen machen wollte oder dass er die Weißen hasste. Beides machte ihn gefährlich.
„Was willst du?“, knurrte Breton feindselig, aber Jed schnitt dem alten Soldaten das Wort ab.
„Wir haben von dir gehört. Grauer Wolf ist ein großer Krieger. Seine Feinde fürchten ihn.“
„Ihr habt das Land der Sioux ohne Erlaubnis betreten“, sagte Grauer Wolf.
„Wir sind Reisende“, erklärte Jed „Wir wollen weder eure Büffel jagen, noch eure Biber fangen. Wir wollen in die Berge, ins Land der Crow. Mein Name ist Jedediah Jones. Ich habe viele Freunde bei den Krähen.“
„Deine Freunde leben weit von hier. Bei den Sioux hast du keine Freunde. Ich habe noch nie von dir gehört.“
„Ich habe keine Freunde bei den Sioux“, bestätigte Jed. „Aber auch keine Feinde. Meine Feinde sind die Blackfeet. Vor einigen Monden tötete ich Hunting Coyote, einen der tapfersten Krieger der Blackfeet. Ich stahl seinem Stamm den Iniskim, den heiligen Büffelstein.“
Die drei Sioux sahen einander an, gutturale Wortfetzen flogen hin und her. Wenn die Vermutungen des Clerks zutrafen, hatten die Sioux von den Ereignissen gehört.
„Der Iniskim befindet sich in den Händen der Schwarzfüße“, sagte Grauer Wolf. „Bloody Buffalo führt sein Volk in den Krieg gegen fremde Büffeljäger. Der Iniskim hat alle Krieger der Blackfeet geeint.“
„Ich kenne Bloody Buffalo. Er ist nicht mein Feind. Ich habe ihm den Iniskim geschenkt.“
Falls der Sioux-Häuptling beeindruckt war, so zeigte er es nicht. „Werdet ihr auch uns beschenken?“ Allmählich kam er zur Sache.
„Wenn wir durch euer Land ziehen dürfen, ja.“
„Was werdet ihr uns geben?“
Jed drehte sich zu Breton um, welcher der Unterhaltung mit verkniffenem Gesicht gelauscht hatte.
„Was können wir entbehren?“
„Nichts“, knurrte der Franzose. „Wir brauchen das Zeug, um Rothäute zu bestechen, die uns zu Mademoiselle Hannah führen können. Vielleicht benötigen wir Lösegeld.“
Jed wandte sich wieder an den Häuptling. „Fünf gute Messer und Glasperlen für eure Squaws.“
„Pah“, machte der Sioux.
Jed zuckte mit den Schultern. „Fünf Messer und fünf Äxte. Und die Perlen.“ In ihrem Gepäck führten sie dreißig Messer und zwanzig Äxte aus zähem Stahl mit sich. Den Sioux ein Fünftel dieser begehrten Tauschobjekte zu überlassen, wäre ein immenser Wegzoll. Breton wollte aufbegehren, aber Jed brachte ihn mit einer Geste zum Schweigen.
„Diese Männer wollten uns auch Messer schenken“, sagte Grauer Wolf, indem er auf die Leichen der Trapper zeigte.
„Was wollt ihr?“, fragte Jed scharf.
„Eure Pferde, eure Waren und eure Gewehre.“
„Dann bleibt uns nichts mehr.“
„Ihr behaltet eure Skalpe.“
„Nett“, sagte Jed. „Aber ohne unsere Gewehre sehe ich dafür keine Garantie.“
Der Sioux blickte ihn fragend an. Er beherrschte die Sprache des Weißen Mannes, aber die Bedeutung der letzten Worte war zu kompliziert für ihn gewesen.
„Das heißt Nein“, wurde Jed deutlicher.
„Dann werdet ihr heute sterben.“ Mit diesen Worten zog Grauer Wolf sein Pferd um die Hand und machte sich auf den Weg zurück zu seinen Kriegern. Die beiden Sioux an seiner Seite folgten ihm.
„Was jetzt?“, fragte Breton.
„Jetzt erschießen wir ihn.“
„Ich hatte also Recht, oui, Monsieur?“
„Nein, es wäre ehrlos gewesen, ihn unter dem Zeichen des Friedens zu töten. Wir hätten ihn erwischt, aber danach hätten uns seine Krieger niedergemacht.“
„Wir hätten sie zurückgeschlagen“, behauptete Breton. Er legte seine Muskete an, aber Jed hielt ihn zurück.
„Noch nicht. Noch gilt die Waffenruhe. Seine Krieger würden uns jagen, bis die Rechnung beglichen ist.“
„Ach, und wann ist der richtige Zeitpunkt?“
„Noch nicht.“ Jed wandte sich an Mel. „Bereit? Du könntest mir ein bisschen helfen, falls sie die Botschaft nicht gleich verstehen.“
Mel ahnte, was Jed vorschwebte, und nickte. Er war ein leidlich guter Schütze mit der Forsyth-Rifle, aber was Jed vorhatte, war Wahnsinn.
Die drei Sioux kamen bei den anderen Indianern an. Sie trieben ihre Pferde die Anhöhe hinauf und reihten sich ein. Ein Dutzend roter Krieger, bereit zum Kampf.
„Und nun?“, knurrte Breton. „Sie sind zu weit entfernt. Man kann das Weiße in ihren Augen nicht sehen.“
„Müssen wir auch nicht“, sagte Jed. „Wir machen ein bisschen Medizin.“
Während sie gewartet hatten, war er zu seinem Pferd gegangen und hatte seine Schlafdecke abgeschnallt. Nun riss er ein paar Grashalme aus der Erde, ließ sie zu Boden rieseln und prüfte den Wind. Dann legte er sich auf den Bauch und platzierte die Decke unter dem Lauf der Baker-Rifle. Er spannte den Hahn, atmete flach und zielte.
Auf dem Hügel stieß Grauer Wolf seine Lanze zum Himmel. Seine Krieger stießen Kampfgeheul aus.
Jed feuerte. Pulverdampf wölkte auf. Grauer Wolf ließ die Lanze fallen und fiel vom Pferd.
Die Kriegsschreie der Sioux verstummten. Sie waren völlig verdattert. Keiner von ihnen hatte je einen Dreihundert-Meter-Schuss erlebt. Ein solcher Treffer musste ihnen wie große, böse Medizin vorkommen, wie Zauberei, gegen die sie sich keine Chancen ausrechnen konnten.
Einer der Krieger hob hastig die Leiche des Häuptlings auf das Pferd eines anderen und griff sich die Zügel von Grauer Wolfs Reittier. Dann machten die Sioux kehrt und verschwanden hinter dem Hügel.
Mel stieß erleichtert Luft aus. Wäre Jeds Kugel danebengegangen, hätte er diesen fast unmöglichen Schuss versuchen müssen. Er war nicht sicher, ob es ihm gelungen wäre. Falls nicht, hätten sie sich den Lanzen und Pfeilen von zwölf wild entschlossenen Kriegern stellen müssen.
„Nun werden sie uns in Ruhe lassen“, meinte Jed.
Breton und André starrten ihn an.
„Wie schon gesagt, das sind keine Kosaken.“
*
„Ein erstaunlicher Schuss“, sagte Breton, während sie weiterritten. Nirgendwo zeigte sich ein Sioux.
„Ich kenne keinen besseren Schützen als Jed“, erklärte Mel.
Sein Partner reagierte nicht auf das Lob. Er ritt ein paar Schritte vor ihnen, die Baker-Rifle quer über dem Widerrist seines Pferdes. Bevor sie aufbrachen, hatte er das Gewehr sorgfältig nachgeladen. Im Lauf steckte eine in gefettetes Leder gehüllte Kugel. Als Treibladung hatte Jed nicht das Pulver aus den Papierpatronen genommen, sondern feineres Pulver aus dem Horn. Sollte es Ärger geben, wäre er bereit für einen weiteren Meisterschuss.
„Ich habe noch nie einen Mountain Man mit einer Baker-Rifle gesehen“, sagte Breton. „Die meisten Jäger, die zu Chouteau kommen, haben Gewehre aus St. Louis, aus Kentucky oder Pennsylvania. Aber eine Baker? Das ist ein britisches Armeegewehr, die Rifles benutzen sie.“
Jed sagte nichts dazu. Seitdem Breton versucht hatte, vor dem Kampf gegen die Sioux das Kommando an sich zu reißen, und nach ihrer Auseinandersetzung über die Erschießung von Grauer Wolf, strafte er den Franzosen mit Nichtachtung. Mel fühlte sich unbehaglich.
„Das ist eine lange Geschichte“, sagte er zu Breton. „Jed hatte ein anderes Gewehr. Er verlor es im Kampf gegen die Blackfeet. Die Baker hat er in einem Fort der Hudson’s Bay Company bekommen.“
„Hudsons’s Bay, he?“, machte Breton. „Verdammte Briten. Verdammte Grünjacken. Im Krieg haben uns diese Bastarde ganz schön zugesetzt. Sie schossen weiter und präziser als unsere Voltigeure. Alles wegen dieser Baker-Rifles. Es war ungerecht! Der Mut eines Soldaten sollte entscheidend sein.“
„In Frankreich werden doch ebenfalls sehr gute Jagdbüchsen hergestellt“, meinte Mel.
„Aber nicht für die Armee! Der Kaiser mochte keine Gewehre. Sie sind zu langsam zu laden. Wir durften nur mit Musketen kämpfen.“
„Und so habt ihr gegen die Baker-Rifles verloren.“
„En réalité“, räumte Breton ein. „Aber nicht die Garde! Wir haben nie gegen die Grünjacken verloren.“
Sie redeten noch eine Weile über den Krieg und darüber, wie er wohl ausgegangen wäre, hätte der Kaiser seiner Armee erlaubt, gezogene Gewehre statt Musketen mit glatten Läufen zu verwenden. Wahrscheinlich hätte Frankreich gewonnen, erklärte Breton. „Eigentlich hätten wir das auch so, wenn wir nicht nach Russland gegangen wären oder wenn Marschall Grouchy den Kaiser bei Waterloo nicht verraten hätte.“ Grouchy hatte damals ein Drittel von Napoleons Armee befehligt, doch statt aufs Schlachtfeld zu eilen, war er ins Leere marschiert, und die Franzosen waren geschlagen worden. Breton, der an jenem Tag mit der Garde kämpfend untergegangen war, hasste Grouchy auf das Innigste.
„Er ist ein Bastard“, erklärte er. „Ein Hundsfott.“
Mel wechselte das Thema. „Warum führst du keine Kentucky Rifle? Weshalb diese Muskete?“
„Das ist Mademoiselle Marie. Sie ist seit zwanzig Jahren bei mir. Nicht mal Russland konnte uns trennen. Sie aufzugeben, käme mir wie Verrat vor.“
Mel musste schmunzeln. Breton hatte seiner Waffe einen Namen gegeben. Ein Soldat durch und durch. Andererseits hatte er auch schon von Mountain Men gehört, die so etwas taten. Wenn man Jahre in der Wildnis zubrachte und sich nur auf sein Gewehr verlassen konnte, war das nicht einmal merkwürdig, fand Mel. Man ging mit seiner Waffe schlafen wie mit einer Frau. Wenn man auf eine Bedrohung stieß, galt der erste Griff dem Gewehr, und falls man das Bedürfnis hatte, mit jemanden zu reden, war die Büchse der Gegenstand, der einem am nächsten war.
„Du hast eine ungewöhnliche Waffe“, sagte Breton. „Ein solches Gewehr habe ich noch bei keinem Mountain Man gesehen.“ Er meinte das eigenwillige Zündschloss der Forsyth-Rifle, das ohne Feuerstein und Pulverpfanne auskam.
„Es ist ein geschlossenes System“, erläuterte Mel. „Regen kann mich nicht an Feuern hindern.“ Er erklärte Breton das Prinzip der Schlagzündung. Der flakonförmige Behälter mit dem Knallquecksilber enthielt ausreichend Zündmittel für dreißig Schüsse.
„Bemerkenswert“, fand Breton.
„Es ist die Erfindung eines schottischen Reverends, Alexander Forsyth.“
„Ein Schotte, wie? Kein britischer Bastard, das ist gut.“
*
Wellig und grün erstreckte sich die Prärie vor ihnen. Es war fast windstill, doch wann immer sich ein Lufthauch regte, begann das Gras zu wogen und gaukelte ihnen Bewegung vor, wo keine war. Schlichen sich dort Sioux an, die doch noch auf Rache für ihren gefallenen Häuptling sannen?
Jed schien es nicht gänzlich auszuschließen, denn er ritt ein gutes Stück vor den anderen und ließ anscheinend keinen Augenblick in seiner Wachsamkeit nach.
„Was hat er für ein Problem?“, knurrte Breton, dem Jeds abweisende Haltung nicht entgangen war.
„Nichts Besonderes“, sagte Mel. „Aber ihr solltet vielleicht mal darüber reden, wer das Sagen hat.“
Breton spuckte aus. „Merde! Monsieur Chouteau bezahlt diese Expedition, und ich bin sein Vertrauter.“
„Natürlich. Aber Mister Chouteau hat uns angeheuert, weil wir uns im Westen auskennen. Ich halte mich nicht für wichtig, aber Jed ist es. Er ist unsere beste Chance auf Erfolg.“
„Ich suche keinen Streit“, brummte Breton. „Aber ich weiß, wie man kommandiert.“ Er wandte sich an André. „Was hältst du davon?“
Der große Sklave genoss die Reise. Sein Blick schweifte ständig über den Horizont, als erwarte er, dass auf der schmalen Trennlinie zwischen Himmel und Erde jeden Augenblick ein Wunder erscheinen würde. „Sie sind ein guter Soldat, M’sieur Breton“, sagte er jetzt.
„Genau“, machte Breton.
„Das hier ist ein riesiges Land“, setzte André hinzu.
„Was soll das nun wieder heißen?“
„Vielleicht“, meinte Mel, „will er sagen, dass wir nicht auf einem Schlachtfeld sind.“
Er zwang sein Pferd in einen leichten Galopp, um zu Jed aufzuschließen. „Du solltest dich mit Breton aussöhnen.“
„Mmh?“, brummte Jed. Mel sah, dass er kurz zuckte und die Augen öffnete. Hatte Jed etwa die ganze Zeit über im Sattel geschlafen und Wachsamkeit nur vorgetäuscht? Zuzutrauen wäre es ihm. Manchmal begnügte sich sein Partner damit, einen bestimmten Eindruck zu erwecken. Ein Mountain Man mit einer weittragenden Zauberbüchse würde die Indianer lange genug auf Distanz halten, selbst wenn er sich ein Nickerchen gönnte, oder?
„Ach, Jed.“ Mel schüttelte den Kopf. „Ihr solltet Frieden schließen, du und Breton.“
„Wir haben keinen Krieg.“
„Du weißt, was ich meine. Wenn wir Erfolg haben und Miss Hannah finden wollen, müssen wir an einem Strang ziehen. Jemand muss das Sagen haben. Das solltest du sein, Jed.“
Im letzten Winter, als sie mit Bear Hopkins auf Biberfang in den Bergen waren, hatte es so funktioniert. Bear war ein erfahrener Bergläufer gewesen, doch er hatte Jed unausgesprochen die Führung überlassen.
„Was sagt der Franzose dazu?“, brummte Jed.
„Ich denke, das wird er dir sagen, wenn du ihn fragst.“
Mel ließ sich wieder zurückfallen und ritt für den Rest des Tages neben den anderen her. Fast unmerklich verringerte auch Jed die Distanz. Als die Sonne auf den Horizont herniedersank und es Zeit wurde, ein Lager aufzuschlagen, hielt er sein Pferd an. Breton kam neben ihm zum Stehen.
„Was denkst du?“, fragte Jed. „Wo sollen wir lagern?“
„Woher soll ich das wissen?“, erwiderte der Sergeant. „Ich sehe nur Gras. Du bist als Führer angeheuert worden, oder etwa nicht?“
„Scheint so.“
Sie nahmen den Pferden Ausrüstung und Sättel ab und pflockten sie an. Eines der Tiere war mit Brennholz beladen, das sie von der Paulette mitgenommen hatten. André schichtete ein Lagerfeuer auf und brachte es in Gang. Beim Essen sagte Breton: „Ich bin hier, um sicherzustellen, dass wir Mademoiselle Hannah gesund nach Hause bringen. Deshalb denke ich, dass ich so etwas wie der Leiter dieser Expedition bin. Wenn es um grundsätzliche Entscheidungen geht, so sind diese meine Sache.“
Er blickte in die Runde und fuhr fort: „Aber ich war noch nie so weit im Westen. Deshalb unterwerfe ich mich in allem, was unser Fortkommen hier draußen angeht, eurem Urteil.“ Er blickte kurz Mel an und suchte dann Jeds Blick.
„Auch was Indianer angeht?“, fragte Jed.
„Insbesondere, was Indianer angeht. Ist das akzeptabel?“
„Klar“, sagte Jed. „Warum nicht?“
Damit war der Streit vom Morgen vergessen. Sie aßen und richteten ihr Lager her. Jed teilte die Wachen ein. Breton kramte in seinem Gepäck und brachte schließlich ein schwarzes Fell zum Vorschein, das er als Kissen benutzte.
„Von welchem Tier stammt das?“, wollte Mel wissen.
Breton reichte es ihm. Es war kein bloßes Fell, sondern eine Kopfbedeckung, eine hohe Bärenfellmütze mit einem roten Federbusch und einer Messingplatte an der Stirnseite. Eine Grenadiermütze der Alten Garde.
„Für den Fall, dass wir in die Schlacht ziehen“, erklärte Breton. „Wenn ich diese Mütze getragen habe, habe ich nie verloren.“
„Außer bei Waterloo“, entfuhr es Mel.
Breton verzog das Gesicht. „Nein. Dort habe ich die Mütze zu Beginn der Kampfhandlungen verloren. Eine verirrte britische Kugel. Vielleicht von einer Baker-Rifle.“ Er schnitt eine Grimasse.
Jed, der die erste Wache übernommen hatte, wandte sich zu ihnen um. „Ich habe heute ein bisschen gelauscht, als ihr über den Krieg in Europa geredet habt. Wenn ich es richtig behalten habe, wurde euch in Spanien der Arsch von den Briten aufgerissen.“
„Wir haben nicht gewonnen“, bestätigte Breton widerwillig.
„Na ja, ich habe nachgedacht. Wir Amerikaner haben den Briten den Arsch aufgerissen. So um 1783 war das.“
„Ja, und?“
„Ach, ich frage mich bloß, was das für einen Krieg zwischen Amerikanern und Franzosen bedeutet.“
Breton hüllte sich in beleidigtes Schweigen.
Mel sagte: „Lafayette.“
„Wer?“, fragte Jed.
„Der Marquis de Lafayette. Er war Franzose. Er hat in der Kontinentalarmee mit George Washington gegen die Briten gekämpft. Es gibt also keinen Grund, weshalb Amerikaner und Franzosen gegeneinander in den Krieg ziehen sollten.“
„Exactement“, schnaubte Breton.
„Amen“, sagte Jed.
Kapitel 2
Sie zogen mit den Tagen dahin durch ein Land voller Extreme. Mal brannte die Sonne vom Himmel, als wolle sie die Männer verdampfen. Dann wieder gingen Wolkenbrüche mit einer Heftigkeit nieder, die dazu angetan war, die Eindringlinge über den Rand der Welt zu spülen, den sie freilich niemals erreichten. Wann immer sie einen Punkt am Horizont fixierten, einen Hügel oder einen der seltenen Bäume, und ihn nach stundenlangem Ritt erreichten, fanden sie dahinter nur Endlosigkeit.
Das Holz ging ihnen aus, und sie nährten ihr Feuer mit Büffeldung. Das Wasser wurde knapp, und Jed befahl ihnen, den Morgentau von den Halmen zu lecken. Mit traumwandlerischer Sicherheit fand er immer wieder ein Wasserloch, einen See oder einen Bach.
Der Platte River lag mehrere Tagesritte südlich. Jed verriet nicht, weshalb er den Fluss mied, doch anscheinend hatte er ihre Begegnung mit dem seltsamen Kielboot auf dem Missouri nicht vergessen. Immer wieder trieb er sein Pferd auf eine Anhöhe und spähte übers Land.
„Werden wir verfolgt?“, fragte Mel.
Jed zuckte die Schultern. „Schwer zu sagen. Ich sehe nichts, aber das ist ja der Sinn einer heimlichen Verfolgung.“
So flach die Prärie auch dalag, sie war durchzogen von Buckeln und Senken, und ein Verfolger, der einen Tagesritt zurückblieb, hatte gute Chancen, unentdeckt zu bleiben. Er selbst jedoch konnte der Spur aus niedergetretenem Gras folgen, die sie mit ihren sechs schwerbeladenen Pferden gut sichtbar hinterließen.