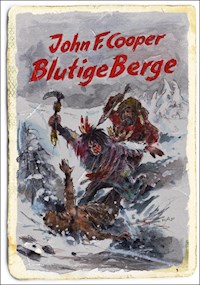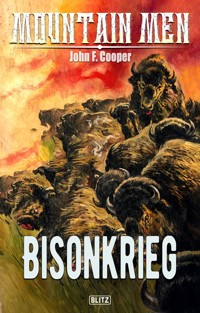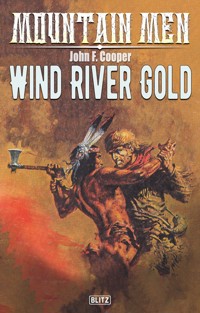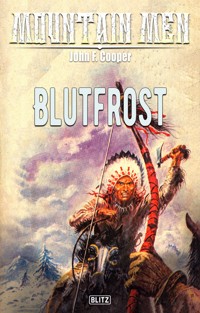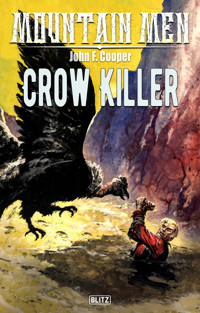Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Mountain Men
- Sprache: Deutsch
Frühjahr 1823. Der junge Mountain Man Malcolm McGruder ist noch immer mit Hannah Billings, der Tochter des Pelzhändlers Auguste Chouteau, auf der Flucht vor den Hommes du Nord und deren rachsüchtigem Anführer Gael Prevost. Seit Wochen haben sie nichts von ihrem Freund Jed gehört. Da sich ein Handelsposten am Yellowstone River als Todesfalle entpuppt, kann nur noch ein Wunder die Freunde retten. Dritter Teil der Blutfrost-Trilogie. Die Printausgabe des Buches umfasst 238 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mountain Men
In dieser Reihe bisher erschienen
4501 John F. Cooper Wind River Gold
4502 John F. Cooper Der goldene Fluss
4503 John F. Cooper Stadt der Pelze
4504 John F. Cooper Bisonkrieg
4505 John F. Cooper Das alte Volk
4506 John F. Cooper Camp des Todes
4507 John F. Cooper Blutfrost
4508 John F. Cooper Die Belagerung
John F. Cooper
Die Belagerung
Dritter Band der Blutfrost-Trilogie
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Alfred WallonTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-358-2
Was bisher geschah ...
Die Mountain Men Jedediah Jones und Malcolm McGruder begleiten Hannah Billings, die Bastard-Tochter des großen Auguste Chouteau, zusammen mit einer Trapper-Brigade in die Berge am Wind River. Hannah will sich einen Namen als Bourgeoise einer Pelztierjäger-Brigade machen. Doch das Unternehmen steht unter keinem guten Stern. Sabotage und Verrat greifen um sich. Als Jed und Mel begreifen, dass hinter all dem Gael Prevost, der Anführer der härtesten Mannschaft der Northwest-Company steckt, ist es schon zu spät.
Prevost glaubt, dass die Trapper seinem Vater das Tal, in dem sie jagen, gestohlen haben. Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein, doch die Rachsucht des jungen Prevost kennt keine Grenzen, und seine Männer sind berüchtigt dafür, dass sie niemals Gnade gewähren. Auf ihrer Flucht durch die frostklirrenden Rocky Mountains erhalten Hannah und Mel Hilfe von Bill Tyler und Henry Frapp, zwei Legenden des Fernen Westens. Dank der Unterstützung der beiden knorrigen Mountain Men verlieren die Hommes du Nord die Spur von Hannah und Mel. Doch ihr Freund Jed ist noch immer verschollen, und die Flüchtlinge wissen nicht, ob sie in Sicherheit sein werden, sobald sie ihr Ziel, einen Handelsposten am Yellowstone-River erreichen.
Kapitel 1
Yellowstone-River, Frühjahr 1823
Mel und Hannah erreichten den Handelsposten am Yellowstone an einem Tag Mitte März, im Jahre des Herrn 1823. Sie kannten weder das genaue Datum noch die Woche, denn auf ihrer Flucht durch die Berge hatten sie anderes im Sinn gehabt, als Sonnenaufgänge zu zählen oder Kerben in einen Stock zu schnitzen. Überleben richtete sich nicht nach dem Kalender.
Doch vor dem Überfall durch Prevosts Horde hatte Hannah die Bücher ihrer Expedition geführt, und sie erinnerte sich daran, dass ihr letzter Eintrag vom 12. November 1822 datierte, einem Dienstag, dem Tag nach Sankt Martin. Tags zuvor hatten zwei deutsche Trapper aus ihrer Mannschaft sie darum ersucht, auf die Jagd gehen zu dürfen, um Gänse zu schießen, die in ihrer Heimat eine Art Pflichtessen am Martinstag waren. Wegen der Bedrohung durch die Voyageure hatte Hannah ihnen nicht erlaubt, das Camp zu verlassen, und die beiden Deutschen zogen Gesichter, als würde es Unglück bringen, wenn es an diesem besonderen Feiertag Hirschsteak und Bannockbrot gab. Sie hatten Recht behalten.
Ausgehend vom 12. November, dem Tag des Unheils, rechneten Hannah und Mel aus, wie lange sie durch die Berge geirrt waren. In ihrer Kalkulation ging es mehr um Gefühl als um gesichertes Wissen, aber das Bestimmen des Datums wurde ihnen auf dem Weg zum Yellowstone zu einem intellektuellen Zeitvertreib.
„Wir waren vier Wochen bei Tyler und Frapp“, sagte Hannah. „Sind wir uns da einig?“
„Mehr oder weniger. Es können auch fünf gewesen sein.“ Mel hatte den Aufenthalt in der Hütte der Trapper genossen, ohne die Tage zu zählen. Seitdem er mit Jed im Westen war, kam es ihm immer seltener in den Sinn, die Zeit zu messen. Das war eine Sitte, die im Osten nützlich sein mochte. In der Wildnis achtete man stattdessen auf den Zug der Vögel und die Länge des Schattens, den ein Baum bei Sonnenuntergang warf.
„15. März“, sagte Hannah. „Ich denke, heute ist der 15. März.“
„Ist es nicht ein wenig vermessen, den genauen Tag kennen zu wollen? Es ist doch alles nur eine Schätzung.“
„Mag sein. Aber wir sollten den Mut haben, uns festzulegen.“
Das zwang Mels Gedanken in eine andere Richtung. Wie stand es um ihre Beziehung? Sie hatten Strapazen und das Lager miteinander geteilt. Doch was zählte das? In den zurückliegenden Nächten hatten sie stets eng beieinandergelegen, aber nicht mehr miteinander geschlafen, nicht im körperlichen Sinn. Hannah schien sich nicht festlegen zu wollen, ob sie ein Paar waren oder nicht. Diesen Mut brachte sie nicht auf, und Mel fehlte die Courage, sie zu fragen.
„Also, was glaubst du, welchen Tag wir haben?“, wiederholte Hannah.
„Das sage ich dir in einer Stunde.“
„Wieso nicht jetzt? Brauchst du noch Zeit, um dich zu entscheiden?“
„Nein, aber wir benötigen ungefähr eine Stunde, um dorthin zu kommen und zu fragen.“ Mel deutete voraus, wo aus dem Morgendunst die Umrisse einer Wand hervorschienen.
Die Palisade des Händlerforts.
*
Der Handelsposten lag auf einer Anhöhe über dem Fluss, was eine gute Wahl der Erbauer war, falls der Yellowstone zur Zeit der Schneeschmelze über die Ufer treten würde. Als sie näherkamen, sahen sie zwei Kielboote, die vertäut am Ufer lagen. Die Transportschiffe waren nutzlos, solange der Flusslauf gefroren war, doch sobald das Eis aufbrach, konnten sie rasch zu Wasser gelassen werden, um beladen mit der Pelzausbeute des Winters die lange Heimreise nach St. Louis anzutreten.
Der Posten war von einer Palisade aus gut mannshohen Baumstämmen umgeben. Sie bot ausreichend Schutz gegen Angreifer, die zu Fuß kamen, doch ein Reiter konnte sich auf den Rücken seines Pferdes stellen und in den Hof springen. Bloß, dass ihm das nicht bekommen würde, wenn drinnen Männer mit schussbereiten Gewehren auf ihn warteten. Die Pfosten waren eng genug nebeneinandergestellt worden, damit sich weder ein Mensch noch ein Wiesel hindurchzwängen konnte, aber hier und da gab es Spalten, durch die der Wind pfiff, und man konnte wohl auch einen Büchsenlauf hindurchstecken. Darüber hinaus befanden sich auf jeder Seite der Palisade mehrere Schießscharten, durch welche die Besatzung nach draußen feuern konnte.
Mel schätzte, dass sich ein Dutzend Männer im Posten aufhielten. Er schloss es aus der Zahl der Gebäude sowie aus deren Größe. Neben einem Langschuppen, der vermutlich das Pelzdepot und die Ställe beherbergte, stand ein weiteres Langhaus. Dort waren vermutlich Schlafkammern und Werkstätten untergebracht. Ein drittes Blockhaus war nur halb so groß. Mel nahm an, dass sich dort die Unterkunft des Chief Traders, die Küche und der Speiseraum befanden. Die Gebäude waren U-förmig angeordnet.
Die Erbauer hatten sich weder bei ihrer Palisade noch bei den Häusern der Mühe unterzogen, die Stämme zu schälen. Mittlerweile löste sich die Rinde, sodass der ganze Posten an einen Aussätzigen erinnerte, dessen Haut in Fetzen vom Körper fiel. Aber für Mel war es ein erhebender Anblick. Eine Oase in der Wildnis! Hier waren sie so sicher wie seit Langem nicht mehr, und von hier aus würden sie bald den Weg in die vollkommene Sicherheit von St. Louis antreten können.
Vor den Palisaden stand ein halbes Dutzend Spitzkegelzelte im Schnee. „Rothäute!“, sagte Hannah misstrauisch. Seitdem ein Irokese ihre Tochter erschlagen hatte, erwartete sie von den Ureinwohnern nichts Gutes mehr.
Mel nahm nicht an, dass es mit den Indianern Probleme geben würde. Sie waren gewiss hier, um Handel zu treiben. Vielleicht verdingten sie sich auch als Jäger. Pelze und Fleisch: Im Fort würden sie dafür dankbare Abnehmer finden, während sie selbst an der Quelle so begehrter Schätze wie stählerner Messer, Glasperlen und Zinnoberfarbe lagerten. Außerdem stand das Tor des Handelspostens weit offen. Auf dem Hof war ein großes Feuer zu erkennen, an dem sich jeder, der herkam, die Hände wärmen konnte. Nichts deutete darauf hin, dass es Ärger geben würde.
Mel und Hannah mobilisierten die letzten Kräfte und stapften auf ihren Schneereifen in Richtung des Feuers, wie Motten, die es zum Licht zieht. Mel beachtete die Indianerzelte kaum. Hannah hingegen blickte argwöhnisch nach rechts und links.
Deshalb war sie es, die plötzlich wie angewurzelt stehenblieb.
Im nächsten Augenblick ertönte ein Schrei, gefolgt von einer Springflut indianischer Worte.
*
Mel fuhr herum, die Forsyth-Rifle schussbereit.
Aber dann hielt er inne. Was er gehört hatte, war kein Kriegsschrei. Es war der Ruf einer Frau, ein Laut der Freude.
Eine schlanke Indianerin flog auf sie zu. Sie trug einen Mantel aus Winterhermelin. Als sie sich Hannah in die Arme warf, rutschte ihr die Kapuze vom Kopf und gab einen Sturzbach rabenschwarzen Haars frei. „Freundin!“, rief sie, und Hannah wehrte sich nicht gegen den Überfall. Überrascht sah Mel, wie sie die Umarmung erwiderte.
Dann erkannte er, wen sie vor sich hatten: Kimimela, eine junge Sioux, die zusammen mit Hannah und weiteren Frauen beim Volk der Alten gefangen gehalten worden war. Mel und Jed hatten sie gemeinsam mit den anderen befreit. Kimimela war eine zierliche Schönheit. In ihrem Mantel aus weißen und silbergrauen Pelzen sah sie wie eine Schneeprinzessin aus.
„Mister Mel!“ Freudig erregt wandte sich Kimimela Mel zu und fiel auch ihm um den Hals. Überwältigt von ihrer Herzlichkeit fand Mel keine Worte. Dann fiel ihm ein, mit wem Kimimela unterwegs war.
„Steinmagen. Ist er hier?“
Die junge Indianerin blickte ihn verständnislos an, und Mel erkannte seinen Fehler. „Chankoowashtay?“
Kimimela nickte, zog Mel und Hannah zu einem der Zelte und schob sie hinein. Und da saß er: Chankoowashtay, Mels Freund, den die weißen Männer in ihrer Gruppe Steinmagen getauft hatten, weil er ständig am Essen war und scheinbar alles in sich hineinstopfen konnte, was er fand. Ob tagealten Eintopf oder angeschimmeltes Brot: Steinmagen vertrug alles.
Auch jetzt schien er wieder mit Essen beschäftigt zu sein. Er saß im Schneidersitz neben dem Feuer und schnitzte an einer schmutzigen Rübe herum. Als sie hereinwehten, blickte er unwirsch auf, blinzelte, blinzelte noch einmal und ließ dann verblüfft das Messer sinken.
„Regenbüchse“, sagte Steinmagen, und Mel begriff, dass er die Forsyth-Rifle meinte, die auch bei nassem Wetter keine Ladehemmungen kannte. Das Gewehr hatte Steinmagen schon immer fasziniert, so sehr, dass er es einmal gestohlen hatte. Als er es wiederbrachte, hatte er so getan, als habe er die Waffe für Mel aufbewahren wollen, und in gewisser Weise war das auch so, denn ohne Steinmagen wäre die wertvolle Waffe in die Hände der Blackfeet gefallen.
Steinmagen hatte die Männer in ihrer Gruppe damals mit Kriegsnamen bedacht. André, den hünenhaften Schwarzen, nannte er Büffelmann. Louis Breton, der grimmige Kriegsveteran im Dienste Auguste Chouteaus, der sich vor dem Kampf seine Grenadiermütze aufzusetzen pflegte, wurde bei ihm zu Langer Hut. Bei Jed hatte sich Steinmagen einen neuen Namen verkniffen, vielleicht weil er den knurrigen Mountain Man fürchtete und weil der Name Jones unter Indianern ohnehin einen bedeutsamen Klang hatte. Obwohl sie Freunde waren, hatte Steinmagen Mel niemals beim Namen genannt, weder Mel noch irgendetwas anderes. Insgeheim aber war er für den Sioux offenbar Regenbüchse.
Sie fielen einander in die Arme, klopften sich gegenseitig auf den Rücken und lachten.
„Mein Freund“, sagte Mel. „Es tut gut, dich zu sehen.“
„Auch du gut zu sehen“, erwiderte der junge Indianer. Er verstand die Sprache des weißen Mannes, sprach sie aber nur holperig, was immer wieder zu komischen Formulierungen führte.
Steinmagen war Anfang zwanzig, für einen Krieger eher klein und trotz seines enormen Appetits schmächtig. Aber er war drahtig und wusste, wie man seinen Mann stand, wenngleich er, untypisch für einen stolzen Sioux, Auseinandersetzungen lieber aus dem Weg ging. Als damals eine überlegene Streitmacht der Blackfeet auf dem Weg gewesen war, hatte Steinmagen das Weite gesucht. Doch später war er Mel und Jed mit einem Trupp Kitfox-Warriors zu Hilfe geeilt und hatte alles wiedergutgemacht.
Steinmagen hatte Kimimela befreien wollen, und nun lebte er mit der jungen Schönheit zusammen. Sie besaßen ein gut ausgestattetes Zelt, es schien ihnen an nichts zu fehlen. Das Schicksal hatte es gut mit ihm und seiner jungen Frau gemeint.
Neben dem Feuer lag eine Kopfbedeckung aus Fell mit der schmalen Schnauze des im Westen häufigen Kitfuchses. Früher hatte Steinmagen eine zerrupfte Kappe aus Otterfell getragen, die er jetzt offenbar gegen diese hier eingetauscht hatte.
„Du bist ein Kitfox-Warrior?“, fragte Mel. Die Aufnahme in den berühmten Kriegerbund war Steinmagens Traum gewesen. Sein Bruder Akecheta war ein Kitfox, und durch den siegreichen Kampf in den Bergen des Alten Volks musste sich auch Steinmagen für die Elitekämpfer empfohlen haben.
Für einen Herzschlag wich die Freude aus Steinmagens Gesicht. Er machte eine wegwerfende Geste. „Aaach, nicht Kitfox. Ich besser! Ich ... wie sagt man ... ich Tauschmann!“
„Tauschmann?“ Mel war verwirrt.
„Er Händler“, half Kimimela aus.
Händler, das war etwas Neues. Anscheinend machte Steinmagen Geschäfte mit den Weißen, was seine Anwesenheit vor diesem Handelsposten erklärte.
„Bitte! Setzen, wärmen!“ Mit einer Handbewegung lud Kimimela sie ans Feuer ein. Mel und Hannah kamen der Aufforderung nur allzu gerne nach. Angenehme Wärme kroch unter ihre Kleider und vertrieb die Kälte, die seit Wochen wie ein hartnäckiger Ausschlag auf ihrer Haut lag. Kimimela reichte ihnen Tonbecher, die mit einem warmen Kräutersud gefüllt waren. Aus einer Vorratsgrube vor dem Zelt holte sie frische Fleischstücke, die Mel als Elchsteaks identifizierte. Sie spießte sie auf angespitzte Stöcke und hielt sie übers Lagerfeuer. „Essen bald gut“, sagte Kimimela.
„Du arbeitest als Jäger für die weißen Pelzhändler?“, wandte sich Mel an seinen Freund.
„Pah, Jäger!“ Steinmagen rümpfte die Nase. „Tiere da draußen. Da draußen viel kalt! Steinmagen Händler!“
„Dann bringst du ihnen also Pelze?“
Steinmagen zuckte mit den Schultern.
„Die Pelztierjagd ist bei der Kälte auch nicht gerade angenehm“, sagte Mel.
„Pah, Jagd!“, machte Steinmagen.
Mel wurde aus seinem Freund nicht schlau. Er hatte ein stattliches Zelt, eine schöne Frau und genug zu essen, aber er war weder Jäger, noch fing er Biber oder Marder, und ein respektierter Krieger war er offenbar auch nicht.
„Warum bist du kein Kitfox-Warrior?“, fragte Mel. „Du hast es dir verdient. Du hast tapfer gekämpft, damals in den Bergen.“
Steinmagen nickte ernst. „Großer Kampf! Guter Kampf! Aber Häuptlinge sagen, ich noch kein Sonnentanz.“ Er spuckte ins Feuer, um zu zeigen, was er von den Häuptlingen hielt.
„Das verstehe ich nicht.“ Mel hatte natürlich von dem Ritual gehört, bei dem die Indianer sich Holzpflöcke oder Knochennadeln durch die Brust bohrten und in der sengenden Sonne tanzten, bis die Haut riss und sie blutüberströmt zu Boden sanken. Aber er verstand nicht, was der Sonnentanz mit Steinmagens Leistungen als Krieger zu tun hatte.
Sein Freund schien nicht die richtigen Worte zu finden, doch Kimimela sprang ihm bei. „Chankoowashtay noch nie Sonnentanz gemacht. Sonnentanz ist Zeremonie, um Krieger zu werden. Häuptlinge sagen, Chankoowashtay kann nicht Kitfox sein ohne Sonnentanz.“
Steinmagen wischte mit der Hand durch die Luft, wie um das Argument der Häuptlinge zu zerstreuen, und widmete sich dann demonstrativ seiner Schnitzarbeit an der Rübe, die Mel beim Eintreten gesehen hatte.
Mel war verblüfft. Sein Freund hatte also noch nie am Pfahl getanzt. Den Definitionen der Indianer gemäß war er somit nicht vom Jungen zum Erwachsenen geworden, und einer, der kein Krieger war, konnte natürlich erst recht kein Kitfox-Warrior sein, egal als wie tapfer er sich im Kampf erwies. Mel musste es sich verkneifen, laut aufzulachen. Bürokratie bei den Indianern! Wer hätte damit gerechnet?
„Du hättest das Ritual nachholen können“, sagte er.
„Ging nicht“, erwiderte Steinmagen.
„Warum?“
„Keine Sonne am Himmel an Tag von Zeremonie. Wolken, viele Wolken.“ Er nickte bekräftigend. „Sehr viele Wolken!“
Mel hatte noch nie gehört, dass der Sonnentanz wegen schlechten Wetters ausfallen musste. Falls es regnete oder sich die Sonne rar machte, konnte man doch einfach auf einen besseren Tag warten. Irgendetwas stimmte hier nicht. Er argwöhnte, dass sich sein Freund vor der schmerzhaften Erfahrung des Sonnentanzes gedrückt hatte. Vielleicht war er deshalb allein unterwegs gewesen, als sie ihm das erste Mal begegnet waren. Für einen Eigenbrötler war Steinmagen eigentlich ein viel zu geselliger Typ. Außerdem hätte er das Ritual doch jederzeit vollziehen können, um seinen Traum von der Zugehörigkeit zu den Kitfox-Warriors wahrwerden zu lassen. Dass er dies nicht getan hatte, verstärkte Mels Verdacht, und ein vielsagender Blick, den Kimimela ihm zuwarf, bestätigte seine Vermutung.
Aber Mel wollte seinen Freund nicht in Verlegenheit bringen, weshalb er nach einem anderen Thema suchte.
Sein Blick blieb an dem Fuchsfell hängen, das neben Steinmagen zwischen den Decken lag. Nein, das war keine Kitfox-Haube, auch wenn sie dem Kopfputz der Elitekrieger ähnlichsah. Das Fell wirkte räudig, als habe Steinmagen nur einen kranken Fuchs erwischen können. Mel erinnerte sich, dass sein Freund nicht der geschickteste Jäger war, obwohl er immer behauptete, alles zu können, und am Ende auch meist bekam, was er wollte.
Er überlegte, wie Steinmagen sich als wenig begnadeter Jäger genügend Felle in ordentlicher Qualität beschaffen konnte, um gute Geschäfte mit den weißen Händlern zu machen, die ihm seinen Wohlstand ermöglichten. Ihm fiel nichts ein, doch dann sah er wieder die Rübe. Steinmagen hatte jetzt ein Stück abgeschnitten und bearbeitete es mit der Spitze seines Messers, das er mit Daumen und Zeigefinger ganz vorne an der Klinge hielt, als wolle er jemandem einen Dorn aus der Haut operieren.
„Was wird das?“, wollte Mel wissen.
„Große Medizin“, murmelte Steinmagen, während seine Stirn vor Konzentration Falten warf.
Inzwischen war das Fleisch gar, und Kimimela reichte Mel und Hannah jedem ein Elchsteak, das sie auf Holzbrettern servierte.
„Was macht er da?“, fragte Mel.
Kimimela holte einen Lederbeutel aus einer Ecke des Zelts. „Ist für gute Tausch“, sagte sie.
Mel nahm den Beutel in die Hand. Er war prall gefüllt, wog aber kaum etwas. Er löste den verknoteten Strick und schüttete den Inhalt auf den Boden. Es waren lauter dünne Holzscheiben mit aufgedruckten Tieren darauf. Er sah Biber, Otter, Bisons, Marder und Bären.
„Indianer bringen Fell zu Händler. Bekommen das da.“ Kimimela wies auf die Holztäfelchen. „Dann Indianer gehen zu andere Händler in Lager. Machen gute Tausch.“ Sie deutete auf die Ausstattung ihres Tipis. „Chankoowashtay machen bessere Geschäft.“ Sie lächelte glücklich, während Steinmagen breit grinsend von seiner Schnitzarbeit aufsah und Mel zuzwinkerte.
Mel fragte sich, ob Kimimela glaubte, dass die Pelzhändler ihre Waren für bedruckte Holztäfelchen hergaben, weil sie diese schön fanden. Es handelte sich jedoch offenbar um Wertmarken für den Warenverkehr in einem Handelsposten. Die Indianer gaben ihre Felle hin, für die sie vom Aufkäufer im Austausch solche Holzstücke erhielten. Mit denen kauften sie dann nebenan im Warenlager ein. Brauchten sie gerade nichts, konnten sie die Wertmarken sammeln und sie später gegen mehr oder teurere Waren eintauschen. Auf diese Weise wollten die Händler die wankelmütigen Eingeborenen an sich binden, die sonst immer nur dann mit Fellen auftauchten, wenn sie gerade etwas benötigten.
Steinmagen nutzte das System aus, indem er die Wertmarken fälschte. Woran er schnitzte, war ein primitiver Stempel. Mel nahm an, dass Kimimela die Farbe für sein Fälscherunternehmen mischte. Indianerfrauen waren großartige Künstlerinnen, wenn es darum ging, aus Beeren oder Erden Pigmente herzustellen.
„Also, was wird das?“ Mel zeigte auf das Rübenstück.
„Vielfraß“, sagte Steinmagen. „Schwer! Aber ganz große Medizin.“
Das stimmte wohl. Das Abbild eines Vielfraßes zu schnitzen, war in der Tat schwierig, doch ein Vielfraßfell besaß wegen seiner Widerstandsfähigkeit gegen Schnee und Eis gewiss eine Menge Tauschwert.
Mel betrachtete sich die Holztäfelchen genauer. Oben links befand sich auf jeder Wertmarke eine Ziffer. Mel vermutete, dass sie für die Anzahl der abgegebenen Felle stand, denn anderenfalls hätten die Aufkäufer endlos viele Täfelchen vorrätig haben müssen. Es war effektiver, einem Jäger, der zehn Biberpelze brachte, statt zehn einzelnen Marken nur eine zu geben, die für zehn Felle stand.
Steinmagens Täfelchen wiesen alle dieselben Zahlen auf. Mel sah Biber mit einer Zwei, Marder mit einer Eins und Bären ebenfalls mit einer Eins. Die Wertmarke für Otter hatte eine Drei. Höhere Zahlen gab es nicht. Mel nahm an, dass Steinmagens Fälschungen alle bei nur einem Original abgekupfert waren, und dass sein Freund das Zahlensystem nicht verstanden hatte.
„Zeig mal her.“ Er nahm den Rübenstempel entgegen. Tatsächlich, da stand eine Eins. Weil Vielfraße selten waren, gab es vermutlich nicht viele Originaltäfelchen mit höheren Werten.
„Du bekommst mehr dafür, wenn du so etwas schnitzt.“ Mel zeigte auf die Bibermarke, auf der eine Zwei zu lesen war. „Bei Vielfraßfellen musst du dich zurückhalten, denn Vielfraße sind selten und schwer zu erlegen. Aber wenn du eine neue Marke für Biber machst, kannst du in die Vollen gehen und größere Zahlen nehmen.“ Ihm war klar, dass Steinmagen mit arabischen Ziffern nichts anfangen konnte, und so suchte er nach einem Beispiel. Ihm fiel die Messingplakette auf seinem Gewehr ein, in die das Herstellungsjahr der Büchse graviert war: 1810.
„Siehst du, hier!“ Mels Finger strich über den hinteren Teil der Jahreszahl. „Das ist eine Zehn. Nimm die für Biber.“ Er war nicht sicher, ob Steinmagen verstanden hatte. Deshalb fügte er hinzu: „Ganz gewaltige Medizin!“
Die Augen seines Freundes leuchteten.
Mel überlegte, ob es falsch war, Steinmagens Gaunerei zu unterstützen, aber dann sagte er sich, dass er dem jungen Sioux mehr schuldete als den weißen Händlern im Fort. Da auch Hannah keine Einwände erhob, obwohl sie natürlich verstanden hatte, worum es ging, machte er sich keine Gedanken mehr darüber. „Das Fleisch ist köstlich“, sagte Hannah zu Kimimela.
*
Eine Stunde später verließen sie das Tipi und gingen zum Fort. Das Tor stand noch immer offen, und so marschierten sie über den Hof und an dem Lagerfeuer vorbei direkt zum kleinsten der drei Blockhäuser, in dem sie das Büro des Bourgeois vermuteten.
Ein paar Männer blickten ihnen neugierig hinterher, machten jedoch keine Anstalten, sie aufzuhalten. Ihre Kleidung wirkte getragen, aber nicht abgerissen. Mel schätzte, dass sie es mit Angestellten des Handelspostens zu tun hatten, die jeden Abend zwischen die Decken in ihrer Kammer krochen und noch nicht viele Tage in der echten Wildnis zugebracht hatten.
Das offene Tor und die Tatsache, dass zwei Neuankömmlinge einfach so zum Büro des Bourgeois gelangen konnten, verriet Mel, dass die Bewohner der Station noch keinen Ärger mit Indianern erlebt hatten. Das war gut. Er freute sich auf ein paar Tage der Ruhe, ohne dass ihnen die Gefahr im Nacken saß.
Die Räume des Bourgeois bestanden aus einer Schlafkammer und einer Wohnstube, die gleichzeitig als Büro diente. Mel fiel auf, dass es zwei Schreibtische gab, und als sein Blick durch die offene Tür in den Schlafraum fiel, sah er dort auch zwei Betten. Zu seiner Überraschung stellte sich heraus, dass die Niederlassung zwei Chefs hatte. Sie stellten sich als Olivier Laplanté und Zacharias Kershaw vor. Beide agierten gleichberechtigt als Bourgeois. Sie waren Pelzhändler aus St. Louis, die ihre Mittel zusammengelegt hatten, um diesen Posten im Indianerland zu errichten und reich zu werden.
„So reich, wie Ihr Herr Vater, wenn wir es geschickt anstellen“, sagte Laplanté und ergriff Hannahs Hand, um einen angedeuteten Kuss darauf zu hauchen. Er war ein fülliger Mann mit leutseligem Wesen.
Mel und Hannah hatten zur Begrüßung ihre Namen genannt, und Laplanté hatte Hannah sofort erkannt. „Wer in St. Louis wüsste nicht Bescheid über die großartige Miss Hannah?“, sagte er süßlich.
Laplanté trug einen Frack mit fadenscheinigen Ärmeln sowie einen fettigen Biberhut. Sein Gesicht war fast so dunkel wie das eines Indianers. Er war ein Kreole, der von Franzosen abstammte, zu dessen Blutlinie aber auch die eine oder andere schwarze Sklavin etwas beigetragen haben musste. In St. Louis gehörte er zu den unbedeutenden Händlern, mit denen sich die Chouteau-Familie kaum im selben Salon aufhalten würde, aber hier draußen in der Einsamkeit des Westens wirkte er wie der vollendete Gentleman.
Sein Partner Kershaw war aus einem anderen Holz geschnitzt. Sein schmales Gesicht mit dem Spitzbart erinnerte Mel an die Klinge eines Klappmessers. Die vom Trinken geplatzten Äderchen waren die Rostflecken auf dem Stahl. Kershaw hatte Glubschaugen, die ihn jedoch keinesfalls tölpelhaft erscheinen ließen, weil sie ihr Gegenüber kalt taxierten. Der erste Vergleich, der Mel bei Kershaws Augen in den Sinn kam, waren daher keine Frösche, sondern Brenngläser.
„Warum seid ihr hier?“, fragte Kershaw unverblümt. „Hat Auguste Chouteau euch geschickt, um uns auszuspionieren? Oder sein umtriebiger Neffe?“ Er meinte wohl Pierre Chouteau, der sich seit ein paar Jahren mehr und mehr zur bestimmenden Figur innerhalb der Händlerdynastie entwickelte.
„Nein, Sir“, sagte Mel, ehe Hannah aufbrausen konnte. Er wollte es auf die besonnene Art versuchen, denn sie waren auf die Hilfe dieser Leute angewiesen. „Wir wollen uns ein paar Tage ausruhen. Wenn der Frühling kommt, hoffen wir, eine Passage auf einem Ihrer Boote nach St. Louis zu bekommen.“
„Gewiss, gewiss“, murmelte Laplanté, aber es klang nicht nach einer Zustimmung, sondern deutete lediglich an, dass er gewillt war, ihnen zu glauben. Doch ohne seinen Partner würde er keine Entscheidung fällen.
„Ich weiß nicht“, sagte Kershaw.
„Glaubt ihr wirklich, mein Vater, der große Auguste Chouteau, würde euch zwei halb verhungerte Spione wie uns schicken?“, fragte Hannah spöttisch.
„Die Chouteaus sind gerissen“, erklärte Kershaw. „Besonders Pierre.“
„Wie können wir euch überzeugen?“, wollte Mel wissen.
„Wo ist eure Ausrüstung?“ Das war natürlich eine Fangfrage, aber Mel hatte keine Ahnung, worin der Trick bestand. Also blieb er einfach bei der Wahrheit.
„Ihr seht sie vor euch. Alles, was wir haben, tragen wir bei uns.“
Es schien die falsche Antwort gewesen zu sein, denn Kershaw wirkte jetzt noch misstrauischer. „Wie wir hörten, seid ihr im Sommer mit einer wohlausgerüsteten Brigade ins Felsengebirge gezogen. Hundert gute Männer. Wo sind diese Leute?“
„Es waren sechzig Männer“, sagte Hannah. „Lernt, zu zählen.“
Kershaw zuckte gleichmütig mit den Schultern. „Nicht jeder hat so gute Spione wie die Chouteaus.“
„Wir sind keine Spione“, sagte Mel. „Was sollten wir Ihrer Meinung nach denn hier in Erfahrung bringen?“
„Oh, mal sehen. Vielleicht wollt ihr wissen, wie viele Pelze wir auf Lager haben. Vielleicht wollt ihr diese Pelze für euch selbst, weil ihr Pech in den Bergen hattet. Oder ihr wollt unsere Tauschwaren stehlen, um Geschäfte mit den Indianern zu machen. Vielleicht habt ihr keine Transportboote und seid nun hinter unseren her. Habt ihr es nicht selbst gesagt?“
„Wir wollen bloß eine Passage. Zwei Plätze, mehr nicht.“
„Was uns zur Ausgangsfrage zurückbringt: Wo sind eure Männer?“
Mel wusste nicht, ob es klug war, aber was hatten sie schon zu verlieren. „Tot“, sagte er.
Das brachte Kershaw aus dem Konzept. „Was?“
„Unsere Männer sind tot, alle. Wir wurden in den Bergen überfallen. Wie es aussieht, sind nur Miss Hannah und ich entkommen.“
„Hundert Männer tot?“, fragte Laplanté schockiert.
„Sechzig Männer und eine Frau“, sagte Hannah. Dann, als sie an Hope dachte, korrigierte sie sich: „Sechzig Männer, eine Frau und ein unschuldiges Mädchen, und wenn ihr euer Misstrauen nicht begrabt, werden Sie beide es sein, die die Mutter auf dem Gewissen haben.“
„Unter diesen Umständen ...“, murmelte Laplanté. Ihm schienen viele Dinge gleichzeitig durch den Kopf zu gehen. Sechzig Männer tot, eine ganze Trapperbrigade ausgelöscht! Wer mochte das getan haben? Und dann das Kind, das erwähnt worden war: Offenbar war Auguste Chouteaus Tochter die Mutter. Also stimmten die Gerüchte, dass Hannah Billings bei ihrer Abreise aus St. Louis ein Kind in ihrem Leib getragen hatte. Wessen Frucht mochte das gewesen sein? Doch es war unhöflich, einer unglücklichen Mutter mit unangenehmen Fragen nahezutreten, und so brachte Laplanté nur Gestammel heraus: „Ich glaube, unsere, äh, Christenpflicht gebietet es, dass wir ... nun, ihr könnt bleiben, so lange ihr wollt.“ Nachdrücklich nickend blickte er seinen Partner an.
„Meinetwegen“, sagte Kershaw zögerlich. Ihm war nicht anzumerken, ob er mit den Antworten, die er bekommen hatte, zufrieden war oder ob er die Sache nur fürs Erste auf sich beruhen ließ. Vermutlich Letzteres, denn die Antworten hatten neue Fragen aufgeworfen.
„Folgt mir, wir werden sehen, dass wir eine Kammer für euch finden“, sagte Laplanté. Er zögerte. „Leider haben wir nicht genug Räume, um für jeden eine ...“ Verlegen verstummte er.
„Das geht schon in Ordnung“, sagte Hannah.
Sie gingen über den Hof, wo Schnee und Lehm sich zu hellbraunem Matsch verbunden hatten, der an Stiefeln und Mokassins klebte, so wie in einer der zwielichtigeren Gassen von St. Louis Unrat an feinem Schuhwerk haften würde. Doch da sie nun einen Schritt in die Zivilisation getan hatten, spürte Mel eine Art Vorfreude aufkeimen, weil er die Stadt der Pelzhändler bald wiedersehen würde. Er wünschte nur, er könnte mit seinem Partner Jed durch die Gassen stapfen, aber von Jed hatten sie seit Monaten kein Lebenszeichen erhalten. Lebte er überhaupt noch?
Ihre Kammer war ein Bretterverschlag in einem der Langhäuser, kaum größer als eine Hundehütte. Laplanté sagte, dass er ihnen leider nichts Besseres anbieten könne, aber Hannah winkte ab.
„Danke, Monsieur. Ihr tut genug. Mein Vater wird Euch dafür danken und sich erkenntlich zeigen.“
Das schien Laplanté zu gefallen, nur Kershaw wirkte noch immer missmutig, und als sie wieder ins Freie traten, sagte er: „Wie können wir gewiss sein, dass eure Männer nicht irgendwo da draußen auf der Lauer liegen?“
Mel ging der Argwohn dieses kleingeistigen Mannes auf die Nerven, und er war nahe dran, Kershaw stehen zu lassen und auf die Passage zu verzichten. Lieber Matsch am Mokassin als Hundescheiße am Schuh, dachte er. Aber ehe er etwas Unbedachtes sagen konnte, kam ihm jemand zuvor.
„Dieser Mann lügt nie!“
Die Stimme kam von hinten, und als sie sich nach dem Sprecher umwandten, stand da ein hochgewachsener Indianer neben dem Lagerfeuer, an dem er sich die Finger wärmte.
„Da soll mich doch der Teufel holen“, murmelte Mel.