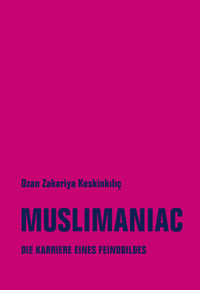
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Muslimaniac steht für europäische Fantasien und Sehnsüchte nach Homogenität und Kontrolle, die sich am Feindbild Islam ausbilden. Aber genauso für die Gefühlswelt von Musliminnen und Muslimen selbst. Dafür, was es heißt, in ein Integrationskorsett gezwängt zu werden und sich ununterbrochen beweisen zu müssen. Es steht für die Diskrepanz zwischen Fremd- und Selbstbild. Dafür, sich in Debatten, die über den eigenen Kopf hinweg geführt werden, nicht mehr erkennen zu können. Die Anfeindungen und Anschuldigungen, die Stereotype und Verschwörungsmythen – sie stecken wie ein Kloß im Hals. Es ist schwer, unter der Last der Fremdbilder ein selbstbestimmtes Ich auszubuchstabieren. Muslimaniac – in diesem Wort mischt sich die Fremdkonstruktion mit dem Geist des Ausbruchs aus Stereotypen. Ozan Zakariya Keskinkılıç erzählt in "Muslimaniac" vom Phänomen des antimuslimischen Rassismus in unserer Gesellschaft anhand von Fakten, persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen, historischen Bezügen und Analysen der Gegenwartsdebatten. Die Besonderheit seines Buches macht der sachliche, empathische und geradezu poetische Ton aus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Muslimaniac steht für europäische Fantasien und Sehnsüchte nach Homogenität und Kontrolle, die sich am Feindbild Islam ausbilden. Aber genauso für die Gefühlswelt von Musliminnen und Muslimen selbst. Dafür, was es heißt, in ein Integrationskorsett gezwängt zu werden und sich ununterbrochen beweisen zu müssen. Es steht für die Diskrepanz zwischen Fremd- und Selbstbild. Dafür, sich in Debatten, die über den eigenen Kopf hinweg geführt werden, nicht mehr erkennen zu können. Die Anfeindungen und Anschuldigungen, die Stereotype und Verschwörungsmythen – sie stecken wie ein Kloß im Hals. Es ist schwer, unter der Last der Fremdbilder ein selbstbestimmtes Ich auszubuchstabieren.
Muslimaniac – in diesem Wort mischt sich die Fremdkonstruktion mit dem Geist des Ausbruchs aus Stereotypen.
Ozan Zakariya Keskinkılıç erzählt in »Muslimaniac« vom Phänomen des antimuslimischen Rassismus in unserer Gesellschaft anhand von Fakten, persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen, historischen Bezügen und Analysen der Gegenwartsdebatten. Die Besonderheit seines Buches macht der sachliche, empathische und geradezu poetische Ton aus.
Ozan Zakariya Keskinkılıç ist Politikwissenschaftler, freier Autor und Lyriker. Er forscht und lehrt an Berliner Hochschulen u. a. zu (antimuslimischem) Rassismus, Antisemitismus, Orientalismus sowie zu Erinnerung und widerständiger Kunst- und Kulturproduktion. 2021 wurde er als Mitglied in die Berliner Expert*innenkommission gegen antimuslimischen Rassismus berufen, seit 2020 ist er Beiratsmitglied am Museum für Islamische Kunst. Regelmäßig publiziert er zu gesellschaftspolitischen Themen, u. a. auf Zeit Online und zdf heute. Neben wissenschaftlichen Texten schreibt er Essays, Prosa, Hörstücke und Lyrik. Im Herbst 2022 erschien sein Gedichtband »prinzenbad« im Elif Verlag.
Ozan Zakariya Keskinkılıç
MUSLIMANIAC
Die Karriere eines Feindbildes
Erste Auflage
Verbrecher Verlag Berlin 2023
www.verbrecherei.de
© Verbrecher Verlag 2023
Druck und Bindung: CPI Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-95732-553-2
eISBN 978-3-95732-562-4
Printed in Germany
Der Verlag dankt Johanna Barrett, Sylvana Brauer und Vanessa Cwiklinski.
INHALT
Einleitung: Unter Verdacht
Koloniale Diagnosen
Kanak Attak Reloaded
Die Verwandlung zum islamischen Schreckgespenst
Orientalika. Über Exotismus und Barbarei
Geschlechterfeindbilder
Queer Dschihad
»Nichts als deutsch redende Orientalen«? – Sprache, Kunst und das Märchen der Leitkultur
Poetischer Islam
Anmerkungen
Quellennachweis Interventionen
Für Marwa El-Sherbini(2009–1977)
Alles schien darauf angelegt, mich zum Schweigen zu bringen und von dem abzulenken, der ich war, mich zu jemand anderem zu machen. Damit begann mein lebenslanger Kampf gegen die Launenhaftigkeit und Heuchelei einer Macht, deren Autorität sich ausschließlich auf ihre ideologische Selbstdarstellung stützte, der zufolge sie moralisch handele, im guten Glauben und mit den besten Absichten.
— Edward W. Said, Am falschen Ort
EINLEITUNG: UNTER VERDACHT
Auf meinem Rechner sammele ich seit einigen Jahren Zuschriften »besorgter Bürger:innen«, die in mir so etwas wie den Pressesprecher der »islamischen Welt« sehen. Anders kann ich mir die Vielzahl von Nachrichten nicht erklären, die mich regelmäßig per E-Mail, über Social-Media-Kanäle, manchmal sogar traditionell auf dem Postweg erreichen. Da ist zum Beispiel Herr A. Er schickt mir eine selbst erstellte Excel-Liste diverser Gräueltaten, die von Muslim:innen weltweit begangen wurden oder begangen worden sein sollen, penibel sortiert nach Datum, Ort und Ausmaß der Brutalität. Er bittet mich um Stellungnahme bis zur kommenden Woche.
Meistens sind die Nachrichten kurz und knackig. »Ich werde dir 9/11 niemals verzeihen«, schrieb mir ein Unbekannter auf Facebook. Bis dato wusste ich noch nicht, dass ich höchstpersönlich für die Anschläge auf das World Trade Center verantwortlich war und erschrak für einen Moment über die Hinterlistigkeit, mit der ich sogar mich selbst betrog. Einige Zeitgenossen fordern mich auf, das Land zu verlassen, am besten bis morgen. Anderen reicht das nicht, sie wünschen mir gleich den Tod.
Zum Glück gibt es mitunter kreative und einfallsreiche Zuschriften, die mich manchmal sogar zum Lachen bringen. Vor einigen Jahren erreichte mich in meinem Hochschulpostfach ein handschriftlich verfasster Brief von Herrn F., der sich als FDP-Mitglied vorstellte. Er begann den Brief damit, mehrfach zu betonen, dass er Afghan:innen Deutschunterricht gibt und zwar kostenlos. Herr F. schrieb, dass er weltoffen ist. Dass Hass und Gewalt durch nichts zu rechtfertigen sind. Das klang alles sehr schön. Doch meine langjährige Erfahrung als unbezahlter Pressesprecher der »islamischen Welt« lehrte mich, dass nach der Mitteilung solch aufopfernder Gesten am Anfang eines Briefes das Aber nicht weit entfernt sein kann.
Und tatsächlich, da kam die Einschränkung schon im nächsten Satz. Die Grenzen der Toleranz des Herrn F. waren nämlich jetzt erreicht. Er störte sich generell an den Muslim:innen. In seinem Brief beklagte er, dass das Kopftuch Alltag geworden sei und dass die Liste an Gewalttaten, die diese Menschen begehen, gar nicht in seinen Brief passen würde. Dafür hätte er auch keine Zeit. Mir ein Bild zu malen, dafür jedoch schon. Dem Brief war eine selbst gemalte Zeichnung beigelegt. Sie zeigt eine Person, einmal in Nikab und einmal in Burka. Dunkle Wassermalfarben auf DIN A4. Die Notiz zum Kunstwerk lautete: »Diese Dame hätte ich so nicht gewählt – es ist Frau Bundeskanzlerin Merkel.«
Das Bild habe ich eingerahmt und über meinen Schreibtisch gehängt. Es erinnert mich daran, dass die »Islamisierung Deutschlands« ganz nach Plan verläuft. Den Eindruck haben jedenfalls nicht wenige Menschen im Land. Einmal abgesehen von PEGIDA, den Patriotischen Europäern gegen die Islamisierung des Abendlandes, und der Alternative für Deutschland (AfD), fühlt sich fast die Hälfte »durch die vielen Muslime hier (…) manchmal wie ein Fremder im eigenen Land«1. 23,6 Prozent – in Ostdeutschland sogar 46,6 Prozent − plädieren dafür, Muslim:innen die Zuwanderung nach Deutschland zu verbieten. Der Vorwurf lautet Unterwanderung und Überfremdung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Einwanderungsverbot, weil muslimisch.
Zwanzig Jahre nach der Geburtsstunde der »Leitkultur-Debatte« und zehn Jahre nach der Veröffentlichung von Thilo Sarrazins Hetzschrift, Sie wissen welche, steht die Warnung vor »dem« Islam als Gefahr für Gesellschaft, Demokratie und Rechtsstaat auf der Tagesordnung. Über die Kultur und Religion der Anderen wird leidenschaftlich debattiert und gestritten, in der medialen Berichterstattung und auf Demonstrationen gegen Migration und Asyl, in Polit-Talkshows über Terror und Gewalt, in wissenschaftlichen Studien über vermeintlich integrationsunwillige muslimische Jugendliche oder ganz beiläufig auf der familiären Weihnachtsfeier und in der Supermarktschlange.
Der Islam weckt Misstrauen. Er symbolisiert das Fremde, mit ihm ist eine Liste unzähliger Defizite assoziiert, die es zu korrigieren oder abzuwehren gilt. Er funktioniert wie eine Mülltonne, in die Probleme entsorgt werden können, um den Rest der Gesellschaft von seiner Verantwortung freizusprechen und das eigene Gewissen reinzuwaschen. Die Sozialpädagogin und Rassismusforscherin Iman Attia spricht deshalb von einer »Muslimisierung« gesellschaftlicher Probleme und Debatten. Sie schreibt: »Indem politische, gesellschaftliche und soziale Phänomene zunehmend mit ›der Religion‹ der anderen verknüpft werden, können eigene Anteile an diesen Phänomenen und am problematischen Verhältnis zueinander geleugnet werden. […] Die Lage der Anderen wird mit deren ›Kultur‹ begründet, die wesentlich durch ›ihre Religion‹ geprägt sei, ›der Islam‹ sei für desolate Zustände verantwortlich und gefährde darüber hinaus ›uns‹.«2
Kein Wunder also, dass einige meinen, sie würden Sexismus, Queerfeindlichkeit, Antisemitismus, Gewalt und Terror abschaffen, indem sie gegen »den« Islam auf die Barrikaden gehen und die Einwanderung von »den« Muslim:innen und »den« Geflüchteten ablehnen. Oder indem sie Frauen mit Kopftuch die Ausübung des Lehrerinnenberufs untersagen und gegen den Bau einer Moschee in ihrem Stadtviertel protestieren. Nicht gerade überzeugende Maßnahmen für mehr Demokratie, Freiheit und Sicherheit.
Der Islam ist ein Sündenbock, er ist wie ein verzerrtes Spiegelbild, in dem sich Europa selbst idealisiert: rational, modern, egalitär und entwickelt.
Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob der Islam zu Deutschland gehört, ohne zu verstehen, dass die Leidenschaft, mit der das geschieht, bereits beweist, wie abhängig das Land von »seinen Fremden« geworden ist. Ohne Islamdebatte kein Deutschland mehr. Und wer dazugehören will, betreibt »Islamkritik«. Das gehört zum guten Ton. Mich hat das Wort schon immer irritiert. Es klingt so, als gäbe es »den« Islam als absolute Kategorie, eine Art Bauklotz mit klaren Ecken und Kanten, in eindeutiger Farbe und immer gleichem Muster. Er muss kritisiert und korrigiert werden, dieser Islam, weil er sonst nicht zu den restlichen Bauklötzen passen würde, weil das Haus andernfalls zusammenbricht. Islamkritik, das heißt: Kritik am Islam ist überlebensnotwendig.
Während Islam und Kritik wie Pech und Schwefel aneinanderkleben, genießt das Christentum ein unsichtbares Privileg. »Das« Christliche verkörpert Menschenwürde und Nächstenliebe. Es wird mit Europa und Demokratie verknüpft. »Der« Islam bildet seine Antithese. Dem positiven Christlich-Europäischen steht das negative Islamisch-Orientalische gegenüber. Deshalb muss es offensichtlich das Wort Islamkritik geben, genauso wie den Pauschalverdacht »politischer Islam«3, mit dem man alle über einen Kamm scheren kann, die die gesellschaftliche und politische Bühne als Muslim:innen betreten.
Wenige Tage nach dem islamistischen Angriff in Wien im November 2020 forderte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz einen gleichnamigen Straftatbestand, »um gegen diejenigen vorgehen zu können, die selbst keine Terroristen sind, aber den Nährboden für solche schaffen«. Als im selben Twitter-Thread von der »Einführung eines Imame-Registers« die Rede war,4 lief mir ein eiskalter Schauer über den Rücken. Das klang nach Gesinnungsstrafrecht für Muslim:innen. Da hätten doch Alarmglocken läuten müssen. Ich will mir nicht vorstellen, wie leicht ein Straftatbestand »Politischer Islam« missbraucht werden könnte.
Manch ein Experte behauptet, dieser ominöse politische Islam, ein Begriff ohne jegliche definitorische Trennschärfe, wäre eine viel gefährlichere Ideologie als der Wahabismus oder der Salafismus.5 Gefährlicher deshalb, weil seine Anhänger:innen sich tarnen, Integration nur vorspielen, sich bewusst distanzieren, sich nett und freundlich geben, aber in Wirklichkeit andere Pläne verfolgen würden. Wer so etwas sagt, lädt die Gesellschaft dazu ein, in allen Muslim:innen heimliche Islamist:innen zu vermuten.
Und tatsächlich: Im Juni 2021 stellte die umstrittene »Dokumentationsstelle Politischer Islam« in Österreich eine »Islam-Landkarte« vor. Über 600 Moscheen, islamische Gemeinden und Einrichtungen wurden kartografiert. In den Kurzbeschreibungen werden u. a. auch ethnische Zugehörigkeiten und weltanschauliche Ausrichtungen verzeichnet. Das alles sollte angeblich Transparenz schaffen, förderte aber nur Misstrauen. Rechtsextreme nutzten das Serviceangebot für ihre Zwecke. Sie montierten Warnschilder vor mehreren Moscheen in Wien mit der Aufschrift »Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe«. Und an die Tür einer Moschee in Salzburg schmierte jemand: »Der Führer ist wieder zurück«. Trotzdem hält die österreichische Regierung weiterhin an diesem Projekt fest. Um die Sicherheit von Muslim:innen geht es wieder einmal nicht.
Längst wird der Begriff »politischer Islam« instrumentalisiert, um Muslim:innen pauschal zu beschuldigen. Unter ihm kann all das zusammengeführt werden, was Islamkritiker:innen an Muslim:innen im Allgemeinen und an ihren kulturellen und religiösen Praktiken im Speziellen verdächtig und nicht kompatibel mit »dem westlichen Leben« finden. Diese Debatten gehen nicht über das plakative, sogenannte islamkritische Vokabular hinaus. Darauf sind »islamkritische« Populist:innen angewiesen, das zieht im Wahlkampf, nicht nur ganz weit rechts, sondern bei allen, die sich von Islamthemen von Herzen gern gruseln lassen.
»Bei der Besessenheit mit muslimischen Menschen und dem Islam habe ich die Befürchtung, dass Sebastian Kurz das Kalifat in Österreich ausrufen möchte«, amüsierte sich die Journalistin Nour Khelifi über den Fall. Auch sie fordert Bekenntnisse zu Demokratie und Rechtsstaat – und das zur Abwechslung einmal von Seiten österreichischer Parteien und Politiker:innen, deren Nähe zu rechter Ideologie, Rassismus, Antisemitismus und Burschenschaften gerne unter den Teppich gekehrt wird. »Und da frage ich mich mal ganz ungeniert: Respektieren ÖVP und FPÖ die österreichische Verfassung?«6
Das ist eine gute Frage, die sich ebenso auf Deutschland beziehen lässt. Und das nicht nur mit Blick auf die AfD und ihre Unterstützer:innenkreise. Die wenigsten würden hierzulande einen Straftatbestand »Politisches Christentum« einführen wollen, und ebenso wenig überraschend existiert dieser Begriff in unserem Sprachgebrauch nicht. Dabei streben christliche Fundamentalist:innen politische Macht an. In Polen wollen sie Abtreibungen verbieten und ziehen LGBTQI+-Aktivist:innen vor Gericht, weil sie auf einem Protestplakat den Heiligenschein der Madonna in Regenbogenfarben dargestellt haben. In den USA erklären radikale christliche Prediger:innen die Linke zum satanischen Bösen, das bekämpft werden müsse. Auch in Deutschland bieten christliche Fundamentalist:innen sogenannte Konversionstherapien an, um Homosexuelle zu »heilen«.7 Der norwegische Attentäter Breivik, der Anschläge in Oslo und Utøya beging und 77 Menschen ermordete, sah sich als moderner Kreuzritter. Von der sagenumwobenen Nächstenliebe ist jedenfalls nichts zu spüren, wenn Rechtsextreme auf christliche Symbolik zurückgreifen. Zum Beispiel auf die Reconquista Spaniens 1492, als jüdische und muslimische Menschen von der iberischen Halbinsel nach Nordafrika vertrieben wurden. In ihrer Bezeichnung »Reconquista Germanica« griff eine rechtsextreme Gruppe derartige Vertreibungsfantasien explizit auf.
So tief ist die hiesige Gesellschaft vom Feindbild Islam durchdrungen, dass sie Muslim:innen erst gar nicht als gleichberechtigte Bürger:innen mit legitimen politischen Forderungen nach Teilhabe und Schutz, etwa vor rechter Gewalt, wahrnehmen kann. Weder im Inland noch im Ausland. In Guantánamo wird von Folter an muslimischen Gefangenen berichtet. Im neuseeländischen Christchurch wurden Moscheen angegriffen und Muslim:innen ermordet. Auch in Indien erfährt die muslimische Minderheit Hetze und Anfeindungen auf offener Straße bis hin zu brutalen Pogromen. Die Verfolgung der Rohingya in Myanmar und der Uigur:innen in China nimmt genozidale Ausmaße an, und auch der Völkermord an bosnischen Muslim:innen, den Bosniak:innen mitten in Europa ist gar nicht so lange her. Das alles erregt hierzulande keineswegs die gleiche Aufmerksamkeit wie jene Fälle, in denen die Tatpersonen Muslim:innen sind.
Das Problem hat einen Namen. Es heißt: Antimuslimischer Rassismus. Unter dem Begriff lassen sich unterschiedliche Diskurse und Praktiken zusammenfassen, die Muslim:innen und als solche wahrgenommene Menschen als Andere konstruieren, sie ausgrenzen und zur Zielscheibe von Anfeindungen, Beleidigungen und Gewalt machen. Es handelt sich um eine spezifische Rassismusform, die auf Religion und Kultur zurückgreift, um »den« Islam zu dämonisieren und »die« Muslim:innen unter den Generalverdacht zu stellen, ihrer Herkunft nach fremd, illoyal, antidemokratisch, rückständig und gefährlich zu sein.8 Ausschlaggebend ist nicht, ob die Betroffenen tatsächlich Muslim:innen sind oder sich als solche verstehen, sondern wie sie von außen wahrgenommen werden. In diesem Zusammenhang wird auch von »Rassifizierung« gesprochen, einem Konstruktionsprozess, bei dem Menschen erstens entlang phänotypischer und herkunftsbezogener Merkmalszuschreibungen als Muslim:innen markiert und homogenisiert werden: Sie werden betrachtet, als wären alle gleich. Zweitens werden sie von »uns Deutschen« und »uns Europäer:innen« dualistisch getrennt – als wären sie anders als »wir«. Und drittens werden ihnen (negative) Merkmale als wesenhafte Eigenschaften, die als genuin islamisch verstanden werden, zugeschrieben – demnach wären sie also ihrer Kultur und Religion nach »einfach so«. Dadurch wird die Ungleichbehandlung der Anderen gerechtfertigt und »unsere« Privilegien gesichert. Antimuslimischer Rassismus ist also identitätsstiftend und produziert zugleich ein überlegenes Selbstbild. Antimuslimischer Rassismus kann sich in der Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungssystem und in allen Gebieten des Alltags ausdrücken, durch Racial Profiling, Hatespeech im Netz sowie die Verwendung von Stereotypen in medialer Berichterstattung und politischen Debatten, über Verschwörungsmythen einer Überfremdung, Unterwanderung und »Islamisierung« Europas bis hin zu Angriffen auf Moscheen und körperlicher Gewalt. Und trotzdem wird antimuslimischer Rassismus immer wieder geleugnet oder kleingeredet.
Dabei ist das Problem real, und es kann tödlich enden. Auch in Deutschland. Das hat der Mord an Marwa El-Sherbini am 1. Juli 2009 aufs Schrecklichste gezeigt. Sie saß im Dresdener Landgericht, um gegen den Angeklagten auszusagen, der sie auf einem Spielplatz als Terroristin und Islamistin beschimpft hatte. Im Laufe der Strafverhandlung warf sich der Angeklagte plötzlich auf die im dritten Monat schwangere Frau und ermordete sie mitten im Gerichtssaal mit 18 Messerstichen. Elwy Ali Okaz, der Ehemann, eilte ihr zur Hilfe, wurde von einem Polizisten mit dem Täter verwechselt und angeschossen.
Der Fall hat sich mir tief ins Bewusstsein gegraben. Hier war eine Mitbürgerin, die in Sicherheit und Würde leben wollte. Die es nicht duldete, beschimpft und gedemütigt zu werden. Sie setzte sich zur Wehr. Wer hätte gedacht, dass sie ausgerechnet dort ermordet werden würde, wo sie Gerechtigkeit durch den Rechtsstaat einforderte? Zu wenigen in diesem Land sagt der Name Marwa El-Sherbini etwas. Oft vergessen wir die Namen der Opfer, während sich die Täter medial verewigen und so ihren Weg in die Köpfe Gleichgesinnter finden, ihnen zeigen, dass es möglich ist, zu töten, und sie dazu ermutigen, es ihnen nachzutun.
Den 1. Juli hat der Rat muslimischer Studierender & Akademiker (RAMSA) zum Tag gegen antimuslimischen Rassismus ausgerufen. An diesem Datum finden bundesweit Veranstaltungen statt, um auf diesen paradigmatischen Fall aufmerksam zu machen und die Stimme gegen den grassierenden Hass auf Muslim:innen zu erheben. Denn Anschläge auf Moscheen und Unterkünfte, genauso wie Beschimpfungen und körperliche Angriffe auf offener Straße sind für viele muslimische Menschen, besonders für Frauen mit Kopftuch, an der Tagesordnung. Allein im Jahr 2020 zählte die Kriminalstatistik 1026 islamfeindliche Straftaten.9 Dies bedeutet einen Anstieg von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders die Zahl der durch Gewalttaten Verletzten nahm zu. 2019 starben zwei Menschen in Folge eines Übergriffes.
Antimuslimischer Rassismus kann töten. Doch der gesellschaftliche Aufschrei bleibt aus, obwohl die Gefahr von rechts hoch ist und das Leben von Muslim:innen ebenso wie das von Schwarzen Menschen, von Jüdinnen und Juden, Sinti:zze und Rom:nja und vielen anderen People of Color bedroht. Für ihre Bedürfnisse, ihre Sorgen und Ängste, ihre Forderungen nach Repräsentation und gleichberechtigter Teilhabe gibt es kaum Gehör. Stattdessen überschatten Misstrauen, Islamismusvorwürfe und eine Integrationsdebatte nach der anderen das alltägliche Leben.
Sobald Muslim:innen davon berichten, dass sie Rassismus erfahren, macht sich Genervtheit breit. Da wird relativiert, bagatellisiert und geschimpft, was das Zeug hält. Wer es wagt, antimuslimischen Rassismus beim Namen zu nennen, der wird belächelt und als ideologisch verblendet dargestellt. Dem wird vorgeworfen, Fürsprecher des Islamismus zu sein. Der wird aufgefordert, sich selbst von Gewalt und Terror zu distanzieren. Als wäre die Tatsache, dass man die Diskriminierung von muslimischen Menschen beanstandet, ein Beweis dafür, dass man Gewalt, die von Muslim:innen ausgeht, ganz wunderbar finden würde. Oder als könnten sie gar keine »echten« Opfer sein.
Es muss doch möglich sein, das, was muslimische und als solche wahrgenommene Menschen an Hass und Ausschluss erfahren, konsequent zu verurteilen, ohne reflexhafte Abwehr und kulturelle Vorurteile. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn wir es nicht schaffen, Rassismus ohne Wenn und Aber zu kritisieren und Opfer zu unterstützen?
»Seit ich denken kann«, habe ich einmal in einem Gastbeitrag auf Zeit Online geschrieben, »fühle ich mich in diesem Land wie ein Problem. Ich muss erklären, woher ich komme, woher meine Eltern kommen, die Großeltern und die Urgroßeltern. Ich muss beweisen, dass ich kein böser Muslim bin, sondern die freiheitlich-demokratische Grundordnung achte. Immer wieder stehe ich unter dem Druck, meine Zugehörigkeit unter Beweis zu stellen. Aber das Integrationsversprechen löst sich einfach nicht ein. Egal, wie gut Deutsch man spricht, wie sehr man sich gesellschaftlich einbringt, man wird nicht als einer von hier gesehen.«10 Ich habe viele Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das Problem nicht bei mir liegt. Es ist der Blick, der mich zum Fremden macht. Es sind die Schimpfnamen, die mir das Gefühl der Unzulänglichkeit geben und mein Leben einengen, die meiner Existenz nur einen kleinen begrenzten Rahmen zugestehen. Dieser Platz, auf den ich verwiesen werde, und die Debatten, in die ich gefangen genommen werde, verwehren mir zu sein, wer ich bin. Das Vokabular der Dämonisierung, mit dem ein Mensch aufwächst, hinterlässt Spuren im Bewusstsein, im Handeln und Denken über sich und die Welt.
Dafür steht der Titel dieses Buches: »Muslimaniac«. Darunter verstehe ich eine jahrhundertealte Diagnose, die Muslim:innen zum Problem erfindet – sexuell, gesundheitlich, kulturell, religiös, politisch. Sie werden beobachtet, erforscht, inspiziert, korrigiert, abgewehrt. Sie gelten als Außenseiter:innen und Eindringlinge, als gewalttätige Fremdlinge. Sie werden in kolonialhistorischen und zeitgenössischen Debatten misstrauisch beäugt und pathologisiert, mit Krankheit und Gefahr in Verbindung gebracht, herabgewürdigt und deklassiert.
Die Figur des Muslimaniac steht für eine strukturelle Paradoxie: Muslim:innen sollen Loyalität unter Beweis stellen, sich integrieren und anpassen, sich zu Rechtsstaat und Demokratie bekennen, den »Schritt aus der Tradition in die Moderne machen« und sich »nach westlichem Vorbild weiterentwickeln«. Die Liste der Forderungen ist lang, doch das miteinhergehende Versprechen von Gleichheit und Gerechtigkeit als Gegenleistung der Mehrheitsgesellschaft wird nicht eingelöst. Es besitzt nur eine Alibifunktion. Das Idealbild eines »guten«, »integrierten« Muslims dient einzig dazu, »böse« Muslime ins Visier zu nehmen. Doch wer »gut« und wer »böse« ist, das zu bewerten liegt in der Hand der mehrheitsdeutschen Autorität.
Die Karriere dieses Feindbildes reicht weit zurück. Sie steht im Zusammenhang mit anderen Feindbildern und Diskursen über »die« Ausländer, »die« Migranten, »die« Geflüchteten, über »die« Gastarbeiter, »die« Asiaten und »die« Afrikaner, über »die« Menschen mit Migrationshintergrund. Und sie ist identitätsstiftend. Die Anderen werden herabgewürdigt, »wir Deutsche (Österreicher, Franzosen, Niederländer, Europäer …)« idealisiert. Den Anderen werden Rechte verwehrt, »unsere« Privilegien gesichert.
Muslimaniac − in diesem Wort mischt sich die Fremdkonstruktion mit dem Geist des Ausbruchs aus den Stereotypen. Es steht für europäische Fantasien und Sehnsüchte nach Homogenität und Kontrolle, die sich am Feindbild Islam ausbilden. Aber genauso für die Gefühlswelt von Muslim:innen. Dafür, was es heißt, in ein Integrationskorsett gezwängt zu werden und sich ununterbrochen beweisen zu müssen. Es steht für die Diskrepanz zwischen Fremd- und Selbstbild. Dafür, sich in den Debatten, die über den eigenen Kopf hinweg geführt werden, nicht mehr erkennen zu können. Die Anfeindungen und Anschuldigungen, die Stereotype und Verschwörungsmythen – sie stecken wie ein Kloß im Hals. Es ist schwer, unter der Last der Fremdbilder ein selbstbestimmtes Ich auszubuchstabieren.
»Wenn ich, eine sichtbare Muslimin, bei Rot über die Straße gehe, gehen mit mir 1,9 Milliarden Muslim*innen bei Rot über die Straße«, schreibt die Autorin Kübra Gümüşay. »Eine ganze Weltreligion missachtet gemeinsam mit mir die Verkehrsregeln.«11 Muslim:in in Deutschland und Europa zu sein bedeutet, für die Fehler anderer zur Rechenschaft gezogen zu werden. Es heißt, niemals ich, immer die Anderen zu sein. Es heißt, sich unerwünscht zu fühlen und zum Gegenbild deutscher Identität und Tugend erfunden zu werden. Zum Schreckgespenst Europas, zur »Gefahr der Islamisierung«, einem hartnäckigen Gerücht.
Das passiert nicht ohne einen Funken irrwitziger Paradoxie, denn blickt man genauer auf die Debatten, müsste einem die Absurdität direkt ins Auge stechen. Wie Schrödingers Katze12 trotzen auch muslimische Menschen allen physikalischen Grenzen. In islamfeindlichen Weltbildern heißt es einerseits, »die« Muslim:innen seien »den« Deutschen unterlegen: sie hätten ein niedriges Bildungsniveau, würden nicht richtig Deutsch lernen und sich weiter in ihrer rückständigen Kultur abschotten. Andererseits betreten Muslim:innen die Bühne im Zeichen von Übermacht und List: Sie würden den Rechtsstaat bedrohen, wird behauptet, öffentliche Institutionen infiltrieren und Deutschland abschaffen. Das setzt schon eine gewisse Intelligenz oder wenigstens strategisches Kalkül und auch Macht voraus – und das ausgerechnet von Angehörigen einer Kultur, die doch der europäischen Zivilisation gar nicht gewachsen sein soll.
Schrödingers Muslime können also, folgt man den widersprüchlichen Stereotypen, mehrere Dinge zur gleichen Zeit sein: Über »die« muslimischen Männer heißt es, sie würden Frauen den Handschlag verweigern, weil sie auf das andere Geschlecht herabblicken und für sie die Berührung anderer als der eigenen Ehefrau sexuell und sündhaft wäre, gleichzeitig wird davor gewarnt, dass »die« muslimischen Männer Frauen begrapschen und sexuell belästigen – beides liege in ihrer Religion und Kultur begründet. Ebenso heißt es, »die« Muslim:innen würden sich nicht integrieren und sich stattdessen in »Parallelgesellschaften« isolieren – aber gleichzeitig wird beklagt, dass muslimische Frauen mit Kopftuch Lehrerinnen werden wollen. Dabei ist das doch ein Beruf, der für gesellschaftliche Teilhabe und sozialen Aufstieg steht. Dann lieber doch als Putzkräfte engagieren, da verletzt die religiöse Kleidung offenbar keine Neutralitätsgefühle. Im Übrigen ist es skurril genug, dass Frauen mit Kopftuch Berufsverbote erteilt werden oder der Ausbildungsplatz verweigert wird, sie auf offener Straße bespuckt und angegriffen werden und ihnen der Hijab gewaltsam heruntergerissen wird, weil der Islam sie unterdrückt und gar nicht zu Deutschland passt. Das ist eine merkwürdige Art, Frauen zu befreien.
Natürlich sind Schrödingers Muslime wie andere »ausländische« Menschen ebenso dafür bekannt, »den« Deutschen die Arbeitsplätze wegzunehmen – gleichzeitig plündern sie die Sozialkassen und leben von Hartz IV, sie reisten im Grunde deshalb hierher, um Leistungen für sich und die zehn-, nein, zwanzigköpfige Familie zu erschleichen. Aus Kriegsgeflüchteten und politisch Verfolgten werden »Wirtschaftsflüchtlinge« gemacht; aus Menschen, die z. B. aus der Türkei migriert sind, werden »Gastarbeiterinnen« und »Gastarbeiter«, die einfach nicht zurückgehen; aus ihren Nachkommen werden Menschen mit Migrationshintergrund in zweiter, in dritter, in vierter, wenn es so weitergeht, in zehnter oder zwanzigster Generation.
Das Prinzip sollte klar geworden sein: Die Anderen sind ein hoffnungsloses Problem, immer und überall, vor allem wenn es sich um Muslim:innen handelt. Sie werden als Übeltäter:innen diskreditiert und »die« Deutschen als ihre Opfer imaginiert, als geknechtetes Volk im »eigenen« Land. In Konsequenz erscheint die Ausgrenzung von muslimischen Menschen, ihre Kontrolle und Beobachtung, ihre Verdrängung und Bestrafung wie eine Art Selbstverteidigung. Das ist die subtile und perfide Argumentationsstrategie antimuslimischer Verschwörungstheorien.
Für mich als Muslim in Deutschland und Europa bedeutet das, damit irgendwie klarkommen zu müssen. Es bedeutet, mich nach Normalität und Akzeptanz zu sehnen und mir schmerzhafte Fragen zu stellen, auf die es nicht immer Antworten gibt. Ich frage mich zum Beispiel, wer ich heute wäre, wer ich hätte sein können und wie ich schreiben würde, wenn es diese klischeebeladenen Debatten um Migration und Integration nicht gäbe, wenn »der« Islam nicht ständig für »das Böse« herhalten müsste. Und wenn ich nicht damit beschäftigt wäre, Antworten zu finden auf Fragen, die tagein, tagaus wie Regen auf einen herunterprasseln. Denn egal wie oft ich die Klamotten wechsele und wie regenfest sie zu sein scheinen – ich stehe nass in der Kälte.
Es gibt im Leben Augenblicke, da die Frage, ob man anders
denken kann, als man denkt, und anders wahrnehmen kann,
als man sieht, zum Weiterschauen oder Weiterdenken unentbehrlich ist.
— Michel Foucault
Und trotzdem sind wir diesen Zumutungen und Zuschreibungen nicht völlig ausgeliefert. Es gibt Möglichkeiten politischer Interventionen und künstlerischer, auch literarischer, ja poetischer Wege, die althergebrachte Architektur der Sprache über Muslim:innen und Migrant:innen, über Islam und »Orient« zu öffnen, sie zu brechen und zu sprengen und neue Utopien zu schaffen.
Davon erzählt dieses Buch: Es geht mir darum, den Rassismus zu entlarven, der sich unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit und Religionskritik tarnt. Doch hierbei will ich nicht aufhören. Ich möchte die notwendigen Räume öffnen für Stimmen, Biografien und Wirklichkeiten fremdgemachter Menschen, sie würdigen und danach befragen, wie andere Erinnerungen die Karriere des Feindbildes unterlaufen können, wie sie Sehnsüchte nach Reinheit und Homogenität durchkreuzen, wie die Grenzen irritiert, verwirrt und verwischt werden können.
Das ist der Versuch, am Fundament der deutschen Islamdebatte zu rütteln und sie in einen größeren historischen und politischen Zusammenhang zu stellen. Der Wunsch, die gewohnten (Ein-)Ordnungen abzuschütteln und stattdessen ein produktives Chaos zu schaffen. Die Hoffnung, als Gesellschaft zu lernen, Veränderungen mit Offenheit und Gelassenheit zu begegnen. Denn das sind die Voraussetzungen, um miteinander in Solidarität leben zu können, um uns gegenseitig zu sehen und zu hören und um werden zu können, wer wir sein wollen.
Dafür muss ich zurückblicken, und zwar Schritt für Schritt; ich muss die Geschichte befragen, um zu verstehen, wie alles begonnen und sich entwickelt hat. Ich möchte das Setting erweitern und zeigen, in welchem breiten Kontext Debatten über Muslim:innen stehen, was ihre Vorläufer sind und worin die Verwandtschaft zu anderen Diskriminierungsformen besteht. Ich muss die historischen Koordinaten abstecken und das Geschehen verorten. Wo liegen die Schnittstellen zu Gender und Sexualität? Wer sind »die« muslimische Frau und »der« muslimische Mann? Was hat es mit den Projektionen auf sich, den sexualisierten Fantasien, den gewalttätigen Bildern? Wie wurde und wird über »Orient« und Islam geschrieben, gedacht und gesprochen, wie werden sie gemalt, fotografiert und ausgestellt? Und welche Rolle spielen Religion, Migration, Kultur, Kunst, Medizin, Wissenschaft und Politik im Umgang mit Menschen, die zum Gegensatz europäischer Lebensart befunden werden?
Ich muss schreiben über die Geburt meiner Tochter, die Erstuntersuchung, die Diagnose »Mongolenfleck«, über den Hintergrund des »Migrationshintergrundes«, über migrantische Kämpfe in der Vergangenheit und die aktuellen Widerstände. Ich muss schreiben über meine Verwandlung vom Gastarbeiterenkelkind zum islamischen Schreckgespenst. Über alte und neue Interventionen. Ich muss schreiben über die verschütteten Erinnerungen in diesem Land, die darauf warten, von uns allen aufgewirbelt zu werden. Und über eine poetische Vision, die uns als Gesellschaft lehrt, mit Pluralität, mit Widersprüchen und Ambivalenzen umgehen zu können.
KOLONIALE DIAGNOSEN
An einem warmen Septembermorgen ging ich mit einem neugeborenen Kind, eingewickelt in ein weißes Leinentuch, zur Kinderärztin nebenan. Die Mutter lag erschöpft von der mehrstündigen Hausgeburt im Bett, während ich nervös die Untersuchung in der Praxis abwartete. Wenige Minuten nach der Anmeldung war es so weit. Die Ärztin beglückwünschte uns zur Geburt dieses Wunders und begann mit geschulten Händen das Kind zu inspizieren. Sie zählte Finger und Zehen ab, wog das Kind und legte ein Messband an. Die Gesellschaft beginnt sehr früh mit der Normvermessung, es muss ja schließlich alles seine Ordnung haben, nicht wahr? Zehn Finger, zehn Zehen. Reflexe scheinen okay zu sein. Aber siehe da. Die Ärztin legte das Kind auf den Bauch, strich mit dem Finger über den Nacken bis hinunter zum winzigen Po. Dort blieb der Finger stehen. »Sehen Sie diesen blauen Fleck, Herr Keskinkılıç?«, fragte sie mich. »Das ist der Mongolenfleck.« − »Ein Mongolen-was?«, fragte ich verwirrt. »Keine Sorge«, antwortete sie. »Das ist eine harmlose Ansammlung von Pigmentzellen, eine Pigmentstörung sozusagen. Sie verschwindet nach ein paar Jahren. Das ist so bei turkvölkischen und asiatischen Menschen, ja, das ist typisch für alle Menschen, die ursprünglich aus Asien kommen.«
Eigentlich kam das Kind ja gestern aus dem Bauch der Mutter. Und ich übrigens aus Hessen. »Ja, aber nicht wirklich«, konterte die Expertin völlig unbeeindruckt. »Sie wissen doch, was ich meine«, sagte sie und griff nach dem Stethoskop.
haymat ist enşöligensi
ih möhte şiş köfte
enşöligensi
ih essı kaynı şinkın
enşöligensi
ih şprehe doyç zer şön
enşöligensi
fiştehin zi mih?
enşöligensi /
aynwanderunk – nix sürük.
— Tunay Önder, Enşöligensi
Zuhause angekommen, legte ich das frisch vermessene Kind mit zertifiziertem MH (Migrationshintergrund) wieder sanft neben die schlafende Mutter, goss mir einen Pfefferminztee ein und schaltete den Computer an. Und während ich mich eigentlich über unseren süßen Nachwuchs freute, tauchte ich ein in die Geschichte des »Rassendenkens«.
Googelt man »Mongolenfleck«, erscheinen in Sekundenbruchteilen über 6.000 Ergebnisse. Das Online-Wörterbuch Duden.de fasst sich kurz. Der Mongolenfleck: »bläulicher oder bräunlicher, meist im Kreuz auftretender, später verblassender Fleck in der Haut von Neugeborenen besonders des mongoliden Menschentypus«.13 Das eröffnet aber mehr Fragen, als es Antworten gibt. Was soll bitte ein »mongolider Menschentypus« sein?
Auch bei Wikipedia fällt die Antwort eindeutig aus. Der »Mongolenfleck«, auch »Asiatenfleck« oder »Hunnenfleck« genannt, trete bei 99 Prozent der Kinder von Chinesen, Japanern, Koreanern, Vietnamesen, Mongolen, »Turkvölkern«, »Indochinesen« und indigenen Gruppen der Amerikas auf.14
Schnell stoße ich auf ein medizinisches Handbuch von 2006, Pädiatrische Dermatologie. Darin heißt es, der Fleck komme bei ca. 90 Prozent aller asiatischen und nicht-weißen Neugeborenen und bei bis zu 10 Prozent »weißhäutiger« Säuglinge vor. Ausgelöst werde der Fleck durch eine »unvollständige Migration der Melanozyten von der Neuralleiste in die Haut«.15
Der »Mongolenfleck« − eine aberwitzige Sammelbezeichnung also, die Menschen mit blauem Fleck ihrer Unterschiede zum Trotz in eine Gruppe zusammenwürfelt und von Menschen ohne blauen Fleck abgrenzt, den sogenannten Europäer:innen. Obwohl von diesem Fleck keine gesundheitliche Gefahr ausgeht, er im Grunde überhaupt keine medizinische Relevanz hat, wird er relevant gemacht. Der zehnte Treffer meiner schnellen Onlinesuche führte mich auf ein sehr suspektes Forum namens Genealogy.net. Holli, eine unregistrierte Nutzerin, schrieb am Mittwoch, dem 27. September 2006 um 11:58 Uhr: »Unser jüngster Sohn hat einen Mongolenfleck. Und wir wüssten doch allzu sehr woher …«16 Sie sind nicht die Einzigen, die die deutsche Abstammungslinie ihrer Familie nach dem Befund in Frage stellen und auf biologische Spurensuche gehen wollen. Gaby, eine andere Userin aus Hessen, antwortete darunter: »Es wäre schon interessant, wenn man mit einem Gentest feststellen könnte ob der Fleck von der Mutter oder dem Vater vererbt wurde. Mich würde das schon interessieren. Auch ob wirklich mongolisches Blut in den Adern meiner Tochter fließt oder ob es von der französischen Linie meines Mannes. […] Allerdings hat auch meine Nichte solch einen Fleck. Das hilft jedoch nicht sehr viel, denn ihre Mutter ist Thailänderin und der Fleck kommt ja gerade in asiatischen Ländern sehr häufig vor. Meine Tochter darf ich darauf allerdings nicht ansprechen, sie will nichts davon hören.«17
Ich verstehe nicht ganz: Wenn der Fleck typisch für Menschen aus »asiatischen Ländern« ist, was hat er dann mit der französischen Linie von Gabys Ehemann zu tun? Das hat meine Neugier geweckt. In mehreren Internetforen diskutieren besorgte Eltern über ein Überbleibsel der Hunnen im Genpool Europas. Besonders in Frankreich soll es Regionen geben, wie in der Champagne, wo Ärzt:innen überdurchschnittlich oft auf den »Mongolen-« oder eben »Hunnenfleck« treffen. Denn nach der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern 451 hätten sich Attilas verwundete Hunnen dort niedergelassen. 1570 Jahre – da hält sich ein Migrationshintergrund mal richtig lang …





























