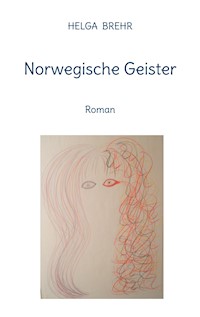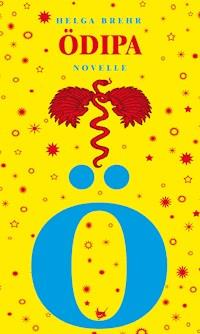Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Helga Brehr: Romane
- Sprache: Deutsch
In jeder Familie gibt es Geheimnisse. Sollte man sie lieber ruhen lassen? Stefanie macht sich im Jahr 1980 beharrlich auf die Suche nach der Wahrheit über ihre Vorfahren, besonders über die Frauen in den letzten beiden Generationen. Kann sie sich dadurch von ihren diffusen Ängsten befreien und endlich ihr Leben und ihre Beziehungen in Ordnung bringen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
In jeder Familie gibt es Geheimnisse. Sollte man sie lieber ruhen lassen? Stefanie macht sich im Jahr 1980 beharrlich auf die Suche nach der Wahrheit über ihre Vorfahren, besonders über die Frauen in den letzten beiden Generationen. Kann sie sich dadurch von ihren diffusen Ängsten befreien und endlich ihr Leben und ihre Beziehungen in Ordnung bringen?
Die Autorin
HELGA BREHR studierte Bibliothekswesen sowie Sprach- und Übersetzungswissenschaften. Sie lebte u.a. in Freiburg, Berlin, Athen, Saarbrücken und Odense/Dänemark. Heute arbeitet sie als Sprachlehrerin und Autorin in Schleswig-Holstein.
Bisher erschienen: »Ödipa« 2014, »Mutter, was hast du mir verschwiegen?« 2016, »Opfern am Mittag« 2017, »Begegnung in Eckernförde« 2018, (2.Aufl.: »Dreifach gesichert und doch…« 2022), »Elevtheria - Die Frau und die Freiheit« 2020. »Unfassbare Nähe« 2022.
www.helga-brehr.de
Inhalt
Kapitel 1: Stefanie 1980
Kapitel 2: Julia 1947
Kapitel 3: 1913-1931
Kapitel 4: 1932-1936
Kapitel 5: 1947
Kapitel 6: 1980
Kapitel 7: 1947
Kapitel 8: 1980
Kapitel 9: Erna und Wolfgang
Kapitel 10: 1955-1956
Kapitel 11: 1980
Kapitel 12: 1956
Kapitel 13: 1980
Kapitel 14: 1980
Kapitel 15: 1983
Dank
Stammtafel
Bibliographie
Für meine Schwester Erika
Erstes Kapitel: Stefanie - 1980
Ein merkwürdig flaues Gefühl, eine dunkle Vorahnung befällt mich, dass ich mit meinem spontanen, aus einer Laune heraus geborenen Einfall eine Lawine lostreten könnte.
Ich bin nach Hannover geflogen und habe mir am Flughafen einen Leihwagen genommen, befinde mich jetzt auf einer wenig befahrenen Landstraße mit Ziel Kerningsburg in der Lüneburger Heide.
Diese Landschaft habe ich nie zuvor gesehen. Oder doch? Eine unerklärliche Sehnsucht verbindet mich mit der Region. Ist es nur wegen der Erzählungen meiner Mutter?
Lange schon hatte ich mir vorgenommen, mal in die Heide zu fahren, doch erst heute, kurz nach meinem 33. Geburtstag, mache ich mich auf den Weg nach Kerningsburg.
Ich weiß, dass meine Eltern einmal hier gewohnt haben, lange vor meiner Zeit. So dachte ich jedenfalls bis vor kurzem, bis mir meine Mutter neulich zufällig sagte, dass es so lange doch nicht her war, ja dass ich sogar noch hier „entstanden“ sei und im Bauch meiner Mutter die ersten drei Monate meiner Existenz in Kerningsburg verbrachte, bevor wir nach Westfalen umzogen, in die Heimat meiner Eltern, wo ich dann geboren wurde.
Ich rolle das Seitenfenster herunter. Würzige Luft dringt ins Auto. Links von der Straße weidet eine große Schafsherde.
Noch weiß ich nicht genau, was ich in Kerningsburg tun will. Nur das eine Ziel sehe ich vor Augen: Das kleine Häuschen, das ich auf Fotos gesehen habe. Die Haustür aus Holz, in einem Fischgrätenmuster, mit einem kleinen Fenster in der oberen Mitte. Davor meine junge Mutter – damals noch gar nicht Mutter – auf einem Foto zusammen mit ihrer Nachbarin, auf einem anderen mit ihrem Schwager Stephan, Pappas Bruder. Fotografiert hatte sicher mein Vater, deshalb ist er auf keinem der Fotos zu sehen. Aus Erzählungen meiner Mutter kenne ich den Namen der Straße, in der meine Eltern damals wohnten, während des Zweiten Weltkriegs und kurze Zeit danach. Lupinenweg.
Als ich endlich in Kerningsburg angekommen bin, fahre ich durch das kleine, ziemlich verlassen wirkende Dorf. Die wenigen Menschen, die ich auf den Straßen oder in den Gärten sehe, recken neugierig die Hälse und schauen meinem Auto hinterher. Es dauert nicht lange, bis ich das Straßenschild „Lupinenweg“ entdecke. Langsam fahre ich den Weg hinunter, schaue die Häuser an. Sie ähneln einander sehr.
Ich biege in eine Querstraße ein und parke das Auto am Wegrand. Dann gehe ich zu Fuß zurück in den Lupinenweg, betrachte aufmerksam alle Häuser, erst auf der einen, auf dem Rückweg auf der anderen Straßenseite. Enttäuscht stelle ich fest, dass es keine Haustür mit Fischgrätenmuster gibt. Wie konnte ich auch so naiv sein? Die Fotos mussten mitten im Krieg aufgenommen worden sein. Wie sollte sich eine hölzerne Haustür bis ins Jahr 1980 gehalten haben? Unmöglich wäre es vielleicht nicht, aber unwahrscheinlich. Die kleinen Siedlungshäuschen wirken renoviert und frisch gestrichen, sie haben moderne Türen.
Ratlos gehe ich Richtung Dorfmitte. Unter einer großen Kastanie finde ich eine Telefonzelle. Ich wähle die Nummer meiner Eltern. Zum Glück ist mein Vater am Telefon. Mit meiner Mutter telefoniere ich mehr aus Pflichtgefühl. Es interessiert mich wenig, was sie – stets in epischer Breite – zu erzählen hat. Wenn ich ihr zuhöre – denn zum Reden komme ich selten bei diesen Telefonaten – habe ich immer das Gefühl, dass sie mir die Zeit stiehlt. Nur wenn sie von früher erzählt, von den alten Zeiten, von meiner Kindheit und den Jahren davor, von unserer Familie, über die ich relativ wenig weiß – dann höre ich ihr gerne zu.
Mit meinem Vater spreche ich lieber, aber leider ist er, wenn ich ihn schon mal erwische, immer viel zu schnell bereit, an die Mutter abzugeben, die dann schon ungeduldig im Hintergrund wartet.
Jetzt lasse ich es nicht dazu kommen, indem ich ihm gleich signalisiere, dass ich in einer Telefonzelle stehe und nicht viel Kleingeld habe.
„Wo bist du denn?“ fragt er, daran gewöhnt, dass ich immer wieder mal aus fremden Städten anrufe, ich bin beruflich viel unterwegs.
„In Kerningsburg.“
Ich höre nur seinen Atem, er sagt lange nichts.
„Ich bin zufällig hier in der Gegend“, lüge ich „und da wollte ich doch mal sehen, wo ihr früher gewohnt habt. Den Lupinenweg habe ich gefunden. Aber welches Haus war es?“
„Nummer vier“ kommt die prompte Antwort. Er hat es nicht vergessen.
„Wo liegt Nummer vier? Mehr zur Dorfmitte hin oder hinten an dem Wäldchen?“
„Vom Wäldchen aus das zweite Haus auf der linken Seite.“
„Die Haustüren sehen alle anders aus als eure auf den Fotos. Weißt du noch? Mit dem Fischgrätenmuster.“
„Es ist lange her.“ - „Willst du noch mit Mutter sprechen?“
„Nein, die Münzen sind alle.“
„Es ist Stefanie …“ höre ich ihn in den Raum rufen, wo meine Mutter etwas Unverständliches schreit, „sie ist in Kerningsburg … sie hat kein Kleingeld mehr…“
„Was?“ schallt es zurück „was macht sie denn dort?!“
Sofort beeile ich mich, das Gespräch zu beenden.
„Ich muss Schluss machen, tschüss Pappa.“
Rasselnd fallen vier einzelne Markstücke in das Rückgabefach. Ich nehme sie heraus und gehe langsam zurück in den Lupinenweg. Fast andächtig nähere ich mich dem Haus Nummer vier, dem vorletzten auf der rechten Seite. Um nicht direkt vor dem Haus zu stehen, habe ich die Straßenseite gewechselt, bewege mich auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig. Dann stehe ich still.
Hier also haben sie gelebt. Hier waren vielleicht auch einmal meine Großeltern zu Besuch gewesen, die leider so früh verstarben, dass ich sie nie gekannt habe. Ich war wohl zwei Jahre alt, als Pappas Vater, Opa Wolfgang starb, kann mich also nicht an ihn erinnern. Oma Erna war schon lange vor meiner Geburt tot. Warum so früh? Ich beschließe, meinen Vater einmal danach zu fragen. In meiner Erinnerung verblieben sind nur die Eltern meiner Mutter. Großvater Gottlieb, den ich nicht mochte, starb als ich sieben war. Ich ging damals mit zu seiner Beerdigung. Und Großmutter Elisabeth ist erst vor elf Jahren gestorben.
Während ich das Haus betrachte, sehe ich wieder das Foto vor mir: Mein verehrter Onkel Stephan neben meiner Mutter – vor diesem Haus.
Onkel Stephan fiel im Krieg, zwei Jahre bevor ich geboren wurde. Er ist der Einzige aus der Familie, von dem meine Mutter immer positiv spricht. Nein, das stimmt nicht, auch über ihren Vater Gottlieb erzählt sie nur Gutes, obwohl zwischen den Worten durchdringt, dass er sehr streng war, ein richtiger Feldwebel. An allen anderen Familienmitgliedern, besonders an sämtlichen Frauen, lässt meine Mutter kein gutes Haar.
„Du bist wie deine Oma Erna“, hat sie mir oft gesagt, wenn sie mich kritisieren wollte. Manchmal sagt sie es heute noch. Der negative Ton hat mich nie davon abgehalten, Oma Erna, über die ich sonst nicht viel erfuhr, in einem guten Licht zu sehen. Ich bin ihr ähnlich, also fühle ich mich mit ihr verbunden und bedaure sehr, dass sie so früh verstarb und ich sie niemals kennen lernen konnte.
Da ich ein wesentlich besseres Verhältnis zu meinem Vater habe als zu meiner Mutter, fühle ich mich zu seiner Familie hingezogen, nicht zu Mutters.
Opa Wolfgang soll mich sehr gern gehabt haben, heißt es. Auch ihn halte ich in Ehren, ebenso wie Onkel Stephan. Er muss ein wundervoller Mensch gewesen sein. Meine Mutter lobt ihn in den höchsten Tönen. Mein Vater spricht wenig von den Familien, hat sich aber auch niemals schlecht über seinen Bruder geäußert, sondern stets mit Achtung.
Das Klavier, auf dem ich anfing zu spielen, stammt von Onkel Stephan. Alle die vielen Notenbände, die zu Hause in den Regalen standen, sind von Onkel Stephan. Ein Ölbild, das ihn als etwa Sechzehnjährigen zeigt, hängt im Wohnzimmer meiner Eltern. Und es gibt viele Fotos von ihm, auf denen er vor allem als Offizier in den Kriegsjahren zu sehen ist, schlank und hochgewachsen, eine Brille mit kreisrunden Gläsern auf der Nase, aufrecht, aber mit einem melancholischen Blick, der nicht so recht zu der stolzen Haltung passen will.
So sehe ich ihn vor der Tür dieses Hauses stehen, neben meiner Mutter, die ihr strahlendstes Lächeln aufgesetzt und sich bei ihrem Schwager eingehakt hat.
Eine leichte Bewegung in der Gardine eines Fensters schreckt mich aus meinen Gedanken und macht mir klar, dass ich viel zu lange hier stehe und das Haus auf der anderen Seite anstarre. Es ist mir peinlich, dass die Bewohner auf mich aufmerksam werden. Wer mag jetzt dort leben? Warum fühle ich mich wie ein Verbrecher, nur weil ich hier stehe und die Fassade anschaue? Warum habe ich das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, als ich schnell meine kleine Kamera aus der Tasche hole und das Häuschen fotografiere? Einen zweiten Schnappschuss wage ich nicht, stecke den Apparat in die Jackentasche und beeile mich, davonzukommen. Hoffentlich ist die Aufnahme etwas geworden.
Ich gehe schnell, als würde mich jemand verfolgen, schließe eilig das Auto auf, fahre los, ohne zu wissen wohin.
Nach einer Weile halte ich bei einer Lichtung an. So weit mein Auge reicht, schimmert lila das Heidekraut, mittendrin lassen einige mächtige Birken ihre dünnen Zweige im Wind flattern. Die Blätter glänzen silbrig und die weißen Stämme leuchten in der Sonne. Am Rande der Lichtung stehen einzelne Kiefern und Weiden, dahinter rings herum dichter Mischwald. Ein paar Vögel lassen sich gerade auf den Ästen einer Birke nieder. Ich steige aus, schließe das Auto ab und gehe ein bisschen herum. Die Mittagssonne scheint angenehm warm für einen Septembertag. Ich ziehe meine Jacke aus, lege sie an einer sandigen Stelle auf den Boden und setze mich darauf, lehne mich dann zurück, bis ich mit dem Kopf im schwach duftenden Heidekraut liege. Die Füße aufgestellt, ruhe ich so und schaue in den Himmel. Ein paar leichte, weiße Wolken ziehen über den hellblauen Hintergrund.
Ich denke an Michael. Eigentlich hatte ich diese Tour mit ihm gemeinsam machen wollen. Aber dann war er wieder einmal verhindert, wie schon früher so oft, wenn ich eine gemeinsame Fahrt plante. Erst sagte er begeistert zu, dann kam etwas dazwischen.
„Gut so“, überlege ich jetzt, während ich den ziehenden Wolken nachschaue.
„Lass ihn gehen. Es ist Zeit, Schluss zu machen. Und überhaupt: Das hier ist meine Geschichte, meine Familie. Er hat nichts damit zu tun, es geht ihn alles nichts an.“
Michael. Ich sehe ihn vor mir, groß, schlank, sehe seine blauen Augen, die vollen Lippen, das blonde Haar, seine wundervollen schmalen Hände - Pianistenhände. Ich sehe, wie er, etwa einen Kopf größer als ich, sich herabbeugt, um mich zu küssen, spüre seine Lippen auf meinem Mund, seine Arme um meinen Rücken.
Michael. Welche unergründliche Anziehungskraft hat er auf mich? Warum fühle ich mich so schwach, so ausgeliefert, sobald ich den Duft seiner Haut rieche, seine Hände in meinem Gesicht spüre und in seine Augen eintauche, wie in einen tiefen See? Was verbindet uns so stark, dass ich ihm nicht widerstehen kann?
Die Musik, oh ja. Wenn er sich ans Klavier setzt und zu spielen anfängt, versinkt die ganze Welt um mich herum. Wenn wir miteinander Musik von einer Platte anhören und uns dabei in die Augen sehen, ist mir klar, warum dieser Mann mich so verzaubert. Wenn wir nebeneinander im Konzert sitzen, Schulter an Schulter, Arm an Arm und die Hände ineinandergelegt, dann weiß ich nicht, was ich lieber möchte: So für ewig mit ihm sitzen und der Musik lauschen – oder sofort mit ihm aus dem Saal laufen, um einen Platz zu finden, wo wir allein und ungestört uns einander hingeben können.
Michael spricht mein Herz an, meine Seele und alle meine Sinne – mit einer Heftigkeit, die ich früher nie für möglich gehalten hätte.
Mein Verstand dagegen sagt mir, dass ich mich von ihm fernhalten soll, dass er mir nicht gut tut, dass er nicht aufrichtig ist.
Wenn mein Verstand gewinnt und ich in klaren Momenten von Michael Abstand nehme, setzt Michael alles daran, mich wieder zu verführen, wieder die alte Macht über mich zu gewinnen. Und wie gerne gebe ich nach! Schieße alle guten Vorsätze und Bedenken in den Wind, bin wieder ganz die Seine, mit Haut und Haar. Dann dauert es ein paar selige Wochen lang, und Michael beginnt sich zu distanzieren, hat viel Arbeit, wenig Zeit, Familienangelegenheiten, Krankheiten und so weiter.
Ich leide. Ich vermisse seine Nähe. Weiß nicht, ob ich ihm glauben soll, dass er mich allein liebt, aber nun gerade Verpflichtungen hat, die keinen Aufschub dulden. Immer schlimmere Geschichten passieren in seinem Umfeld: Unfälle, Katastrophen, Tod naher Angehöriger.
Ich zweifle. Ich verzweifle. Ich sehne mich nach ihm. Ich glaube ihm.
Wie soll das weiter gehen?
Ein Vogel krächzt laut von einer der großen Birken herunter. Ich schaue auf die Uhr. Schon gleich drei. Mein Magen knurrt, ich habe seit dem Frühstück nichts gegessen. Und ich sollte Rudolf anrufen. Er wartet sicher auf eine Nachricht von mir. Gestern, als er mich zum Flughafen brachte, sagte er: „Melde dich, damit ich weiß, dass es dir gut geht.“
Er ist daran gewöhnt, dass ich beruflich oft unterwegs bin, viel in Westdeutschland und Frankreich herumreise, während er immer in Westberlin zurück bleibt.
Einmal im Jahr verbringen wir einen Sommerurlaub gemeinsam, an der Nordsee, in Schweden, im Fichtelgebirge oder in Griechenland. Drei Wochen im Jahr sind wir rund um die Uhr unzertrennlich. Die übrige Zeit gehen wir in unserer großen Wohnung ein und aus, treffen uns eher zufällig oder verabreden uns, essen und schlafen gemeinsam oder allein, je nachdem. Oft hängen Zettel an der Pinnwand. „Bin bei … Komme spät.“
Rudolf kann gut allein sein. Trotzdem freut er sich immer sehr, wenn ich von einer Dienstreise zurückkomme. Dass viele dieser Dienstreisen nicht in dieser Länge – oder manchmal auch gar nicht – notwendig wären, weiß er ebenso wenig, wie mein Chef darüber im Klaren ist. Erst recht wissen sie beide nicht, dass ich auf diesen Dienstreisen meistens mit Michael zusammen bin, dass die Reisen oft zu diesem Zweck arrangiert und in die Länge gezogen werden. Wenn Michael dann in letzter Minute absagt, muss ich trotzdem fahren, sonst wäre mein Arrangement unglaubwürdig – und schließlich sind die Kunden schon benachrichtigt.
Dann bin ich wütend über die verpasste Gelegenheit, fliege trotzig alleine los, und meistens überfällt mich abends in den einsamen Hotelzimmern eine grauenvolle Traurigkeit. An solchen Abenden ist es mir nicht einmal möglich, Rudolf anzurufen. Der Verrat erschiene mir noch fürchterlicher als in den Zeiten, die ich mit Michael verbringe.
Mit Micha kann ich grundsätzlich nur telefonieren, wenn er an seinem Arbeitsplatz ist, also tagsüber. Ihn zuhause, in seiner Familie zu stören, ist absolut tabu, ebenso wie es ihm verboten ist, bei Rudolf und mir anzurufen.
Wir sind verheiratet, Micha und ich – aber nicht miteinander. Und die ehelichen Bande sind uns unantastbar, nicht etwa aus religiösen Gründen, das überhaupt nicht. Warum aber dann? Vielleicht weil wir genau wissen, dass wir niemals miteinander leben könnten? Dass unsere Liebe nur ein Phantom ist, das sich in Heimlichkeit und Verborgenheit ausbreiten kann, das aus versteckten Quellen seine Leidenschaft und Unwiderstehlichkeit speist, sich aber bei klarem Alltagslicht sofort verflüchtigt?
Als ich geschäftliche Termine in Hannover vereinbarte – weil es für Micha so auch passte – hatte ich unter anderem daran gedacht, in die Heide zu fahren. In irgendeinem Fernsehfilm hatte ich Bilder von blühender Erika gesehen. „Heideschulmeister Uwe Karsten“ – ein Buch, das ich als Kind gelesen habe, war mir in den Sinn gekommen und ich erinnerte mich daran, dass ich mir damals vorgenommen hatte, diese Gegend zu erforschen, wenn ich älter wäre, dieser unerklärlichen Sehnsucht nachzugehen nach einer Landschaft, die ich niemals gesehen hatte.
Lange Zeit hatte dieser Vorsatz unbeachtet in mir geschlummert. Plötzlich war er wieder da – das Zusammentreffen vom Termin in Hannover und Heidekraut im Fernsehen hatte ihn hervorgelockt.
Zunächst stellte ich es mir reizvoll vor, mit Micha auf den Spuren der Vergangenheit zu wandeln. Jetzt bin ich froh, allein hier zu sein. Ich will Zeit zum Nachdenken haben.
Eine Weile liege ich noch in der Sonne, dann treibt der Hunger mich zum Auto zurück. Ich fahre ziellos durch die Gegend, bis ich vor einem kleinen Gasthaus ankomme.
„Mittagessen iss nich mehr“, sagt die behäbige Wirtin. „Kaffee und Kuchen könnse jetz ham.“
Spiegeleier und Bratkartoffeln wären mir lieber gewesen, aber die Wirtin lässt sich nicht erweichen. „Küche iss zu.“
So bekomme ich ein großes Stück Pflaumenkuchen mit viel Sahne und einen starken Kaffee dazu. Ich schaufle einen Teil der Schlagsahne in die Kaffeetasse und lasse mir den leckeren Kuchen schmecken. Am liebsten würde ich heute in so einem Landgasthof übernachten. Aber ich habe meinen ersten Termin morgen um neun Uhr in Hannover. Also ist es sinnvoller, dort ein Zimmer zu nehmen. Morgen Nachmittag soll ich in Dortmund sein, ich fliege also von Hannover nach Düsseldorf und fahre von dort mit dem Zug. Morgen ist Freitag. Ich habe mit Absicht zwei weitere Termine arrangiert: Montagnachmittag in Freiburg und Dienstagvormittag in Frankfurt, von wo aus ich wieder nach Berlin zurückfliegen werde. Natürlich könnte ich das Wochenende zu Hause verbringen. Aber für Rudolf gehen meine Termine bis Freitagabend spät und beginnen Montag wieder ganz früh. Auf diese Art habe ich meine Reisen mit Micha immer arrangiert: Ein Wochenende musste dabei rausspringen. Statt von Donnerstag bis Dienstag hätten sich die Termine auch zwischen Montag und Freitag verabreden lassen. Aber ich schaffe es jeweils, dieses Wochenende für uns herauszuholen, seit Jahren gelingt es mir, allen Beteiligten klar zu machen, dass sich die Termine nicht anders legen lassen als gerade so. Als Spezialistin im Bereich Büro- und Computertechnik bin ich sowohl in meiner Firma als auch bei den Kunden sehr gefragt. Wer kennt sich schon so gut aus mit den empfindlichen neuen Geräten, die auf lange Sicht viel Personal einsparen können, wenn erst mal die wenigen Mitarbeiter, die verbleiben sollen, wissen wie man mit der Technik umgeht. Das Personal muss geschult werden, die Geräte gewartet. Noch bin ich ein seltener Vogel, der beides kann, ich weiß, dass sich die Lage schnell ändern wird.
Mein Chef hat erfahren, dass ich Abwerbungsangebote großer westdeutscher Firmen abgelehnt habe, weil ich vorerst – wie ich immer betone: vorerst! – in Berlin bleiben will. Er verwöhnt mich mit Gehaltserhöhungen, flexiblen Arbeitszeiten und großzügigen Reisespesen. Und mit der Freiheit, mir meine Reisen nach Wunsch zusammenzustellen, wobei ich dringliche Kundenanfragen natürlich berücksichtige. Die Kunden sind immer froh, wenn ich vorbeischaue, auch wenn sie nicht angefragt haben. Mein Angebot, wenn es in meine Pläne passt, wird von den Firmen niemals abgelehnt. Irgendein technisches Problem gibt es immer zu beheben oder irgendeine Wissenslücke zu füllen oder Schulungsbedarf für die Mitarbeiter. Noch ist die Kombination von Techniker, Informatiker und Pädagoge nicht allzu häufig anzutreffen.
Die Fächer, mit denen ich in der Schule glänzte, waren Mathe und Physik. Und erstaunlicherweise auch Musik. Mit Deutsch und Fremdsprachen hatte ich nichts im Sinn, las, als ich älter wurde, selten Romane, verschlang dafür alle technischen und naturwissenschaftlichen Sachbücher und hörte gerne klassische Musik, vor allem Bach.
Als ich das Abitur bestanden hatte – mit eins in Mathe, Physik, Chemie und Musik, drei in Deutsch, vier in Englisch und fünf in Französisch – wusste ich zunächst nicht, was ich anfangen sollte. Mathematik studieren? Wohin sollte das führen? Ich wollte auf keinen Fall Lehrerin werden. Physik – das würde wohl bedeuten, in die Forschung zu gehen, das war mir wiederum zu abstrakt. Ich wollte gerne etwas Handfestes machen, Geräte oder Maschinen herstellen. Ein Mädchen, das Maschinenbau studiert, war Ende der 60er Jahre noch recht exotisch. Eine Lehre als Elektrotechnikerin allerdings auch. Aber in Westberlin war der Bedarf damals so groß, dass ich eine Lehrstelle fand und dafür gerne umzog. Nachdem ich die Lehre erfolgreich abgeschlossen hatte, war ich schon Feuer und Flamme für die neue Computertechnik, fasziniert von Bits und Bytes und den komplizierten Programmen, die sich auf die einfachen Zustände „Strom“ oder „nicht Strom“ zurückführen ließen. Für mich hieß es „Sein oder Nichtsein“. Ich erkämpfte mir ein Informatikstudium, das erst vor kurzem an wenigen Unis eingeführt war. Dass ich auch hier unter den Besten abschnitt, hatte nicht so sehr mit Fleiß zu tun, nicht einmal mit der Tatsache, dass die wenigen weiblichen Studenten die männlichen um Längen übertreffen mussten, um anerkannt zu werden. Es fiel mir einfach leicht, mich mit klaren und logischen Abläufen zurechtzufinden. Zahlen, Formeln, technische Zusammenhänge erschlossen sich mir ohne Schwierigkeiten. Sie waren verlässlich und beweisbar. Formulierungen, Begriffe, das Verfassen von Texten – das alles fiel mir ungleich schwerer.
Es war mir aber gegeben, praktisches Wissen, das anhand von Geräten oder Beispielen gezeigt werden konnte, klar und verständlich anderen weiter zu vermitteln. In Arbeitsgruppen half ich bereitwillig meinen Mitstudierenden, wenn ich mit einer Aufgabe fertig war und sah, dass andere sich schwer taten. Es freute mich, wenn ich jemandem in klaren, nachvollziehbaren Schritten deutlich machen konnte, was ihm bis dahin völlig schleierhaft gewesen war.
Das war einem meiner Professoren aufgefallen, und nachdem ich ein gutes Examen abgelegt hatte, bot er mir eine Stelle als Assistentin an, mit der Aufgabe, die praktischen Arbeitsgruppen seines Kurses zu leiten. Ich nahm gerne an, zumal mir der auf 20 Wochenstunden begrenzte Job Zeit ließ, weiterhin halbtags als Elektrotechnikerin in der Firma zu arbeiten, in der ich gelernt hatte. Diese Arbeit hatte mich durch mein gesamtes Studium begleitet und meinen Lebensunterhalt finanziert, so dass ich weder von den Eltern noch von einem Stipendium abhängig gewesen war. Die Firma hatte inzwischen expandiert, begann mit dem Vertrieb von Bürocomputern und wollte mich als Mitarbeiterin für ihren Kundenservice in Westdeutschland und Frankreich ganztags engagieren. Ich behielt aber zunächst die Assistentenstelle an der Uni und nahm erst nach zwei Jahren die gut bezahlte Ganztagsstelle in der Industriefirma an. Als eine, die in dem Betrieb „von der Pike auf“ gelernt, dann studiert und an der Uni als Assistentin gearbeitet hatte, genieße ich jetzt sowohl die Achtung der Akademiker als auch der Facharbeiter und Meister. Als einzige Frau im technischen Bereich – weibliches Personal gibt es sonst nur in den Büros – bin ich ein bunter Vogel, aber durch die kumpelhafte Art, die ich mir angewöhnt habe, komme ich mit Chef und Kollegen gut zurecht.
Nachdem ich mit einem Intensivkurs meine mangelhaften Französischkenntnisse aufgebessert habe, kann ich auch in Frankreich eingesetzt werden.
„Ich bin fest im Sattel, habe meinen Alltag gut im Griff“, denke ich, während ich wieder im Auto sitze und Richtung Hannover fahre.
Auch mein Leben mit Rudolf ist im Grunde ganz in Ordnung. Wir haben uns gern, auch wenn da nicht mehr die große Leidenschaft brennt nach zwölf Jahren Ehe. Wir lassen uns Spielraum. Er macht seinen Job als Verwaltungsbeamter bei der BVG (Berliner Verkehrsgesellschaft), spielt gerne Tischtennis und Schach, angelt in der Havel mit seinen Kumpels. Rudolf ist ehrlich, solidarisch, gutmütig und wohlwollend. Er versucht nicht, mit mir zu konkurrieren, er tut mir nicht mit Absicht weh.
Aber Rudolf geht davon aus, dass es keine Heimlichkeiten gibt. Er wäre entsetzt, wenn er wüsste …
„Ich verdiene einen Mann wie Rudolf nicht“, denke ich, während ich den Schildern zum Hauptbahnhof folge.
Ich parke vor dem Bahnhof und gehe zur Touristeninformation. Kurze Zeit später habe ich ein Zimmer für die Nacht gefunden, in einem Hotel, das in der Nähe der Firma liegt, die ich morgen besuchen soll. In der Hand halte ich einen kleinen Stadtplan, auf dem der Weg zum Hotel eingezeichnet ist. Ich bringe im Hotel mein Gepäck aufs Zimmer und nehme dann die Straßenbahn zum Zentrum zurück. Es ist kurz vor Ladenschluss, ich lasse mich treiben in dem Strom der Menschen, die eilig ihre Besorgungen erledigen, bis ich vor einem Supermarkt stehe. Hier kaufe ich meinen Proviant für den einsamen Abend ein: Etwas Brot und Käse, ein paar Äpfel, eine Flasche Mineralwasser und eine Flasche Rotwein.
In den Fällen, in denen Micha mich im Stich lässt, versuche ich, mittags ein warmes Essen zu bekommen und versorge mich für den Abend mit Kleinigkeiten, die ich auf dem Zimmer zu mir nehmen kann.
Ich bin nicht zu schüchtern, um abends allein im Hotelrestaurant zu essen. Aber mir würde dort Michas Abwesenheit nur noch schmerzlicher bewusst werden.
Diesmal ist es der Autounfall eines Schwagers, von dem ich nie zuvor gehört habe. Er liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Stuttgarter Krankenhaus. Micha muss heute mit seiner Frau dorthin und mindestens über das Wochenende bleiben. Es kann sich sonst niemand um den Schwager kümmern, der ein Bruder von Michas Frau ist.
Ich habe mich gefragt, ob sie wohl den Flieger nach Stuttgart nehmen – und um welche Zeit. In Tegel kam mir kurz der Gedanke, wir könnten uns vor dem Abflug begegnen. Ich habe seine Frau noch nie gesehen. Und er kennt Rudolf nicht. Es ist besser so.
Mit meiner Tüte aus dem Supermarkt gehe ich die belebte Straße entlang. Straßenbahnen quietschen in den Gleisen, dazwischen Autohupen und Musik, die durch ein geöffnetes Autofenster dringt. Vor einem Kaufhaus steht ein Verkaufswagen mit gebrannten Mandeln. Der Duft steigt mir verführerisch in die Nase. Aber ich halte mich zurück. Ich betrachte im Vorübergehen die Auslagen in einem Modegeschäft. Ein neuer Hosenanzug wäre fällig, aber die Läden schließen bald, ich will nicht in Hektik anprobieren.
Als ich auf einem kleinen Platz eine Telefonzelle entdecke, gehe ich hinein, wähle unsere Nummer in Berlin und freue mich, Rudolfs Stimme zu hören.
„Wo bist du, Stefanie-Schatz?“
„In Hannover. Ich habe ja hier morgen einen Termin.“ Ich erwarte nicht, dass Rudolf meine Terminpläne im Kopf hat, nein ich will es gar nicht, denn oft müsste ich lügen.
„Schade, dass du heute schon losmusstest. Vorhin war Hannes mit seiner Frau da. Sie hätten sich gefreut, dich zu sehen.“
„Ja, wirklich schade. Aber du weißt ja, selbst mit dem frühesten Flieger hätte ich den Termin morgen nicht geschafft.“
„Was hast du gemacht den ganzen Tag? War dir nicht langweilig?“
„Ich hab mir ein Auto gemietet und bin in die Heide gefahren. Stell dir vor, ich hab das Haus gefunden, in dem meine Eltern früher gewohnt haben!“
„Das ist ja toll. Musst du mir mehr drüber erzählen, wenn du zurück bist. Es klingelt gerade, das ist Martin, der zum Schachspielen kommt. Mach`s gut, Stefanie-Schatz, melde dich wieder!“
Ein bisschen traurig lege ich auf, hätte gerne noch länger geplaudert. Aber was will ich? Ich habe Rudolf an kurze Telefonate gewöhnt, an knappe Bescheide aus Telefonzellen. Manchmal hatte er mich früher nach der Nummer des Hotels gefragt, um zurückzurufen. Selten hatte ich sie ihm gegeben, hatte mich herausgeredet mit Kundeneinladungen zum Abendessen oder Müdigkeit nach anstrengender Arbeit oder einfach behauptet, es gäbe kein Telefon auf dem Zimmer.
Als ich aus der Telefonzelle komme, haben sich die Straßen wie auf Kommando geleert. Die Ladentüren sind verschlossen, in der Fußgängerzone schlendern drei Jugendliche, bleiben ab und zu stehen, lachen. Sonst kein Mensch weit und breit. Doch als ich um die Ecke biege, sehe ich Leute mit Einkaufstüten an der Straßenbahnhaltestelle stehen.
Die Straßenbahn kommt, ich kann bis kurz vor das Hotel fahren. Bald sitze ich in meinem kleinen, schmucklosen Zimmer.
Ich habe mich nicht informiert, ob es am Abend ein interessantes Konzert oder Theaterstück gibt. Wenn ich mit Micha zusammen bin, versäumen wir nie, uns einen Veranstaltungskalender zu besorgen. Aber ohne ihn macht es mir keinen Spaß.
Ich setze mich auf den einzigen Sessel im Raum, hole mein Taschenmesser, kombiniert mit Korkenzieher, aus der Tasche und schneide den Käse in Streifen, die ich auf zwei Scheiben Brot verteile. Dann öffne ich die Rotweinflasche. Auf dem Tisch steht ein Glas mit Stil neben einer kleinen Flasche Mineralwasser. Ich gehe mit einem Apfel ins Bad, wasche ihn, spüle das Zahnputzglas aus und nehme es mit. Ich öffne die kleine Flasche Mineralwasser, schütte das Wasser ins Zahnputzglas und den Wein in das Glas, das auf dem Tisch stand.
Durstig, in großen Schlucken, trinke ich das Mineralwasser, fülle das Glas gleich wieder auf. Während ich abwechselnd vom Käsebrot und vom Apfel abbeiße, gehe ich in dem kleinen Raum herum. Die Mahlzeit ist schnell vertilgt. Danach hole ich meine Aktentasche, der ich einige Mappen entnehme. Draußen dämmert es bereits. Ich knipse den Schalter der Leselampe an, die neben dem kleinen Tisch steht und ziehe die Vorhänge zu. Dann vertiefe ich mich in meine Arbeit, die Vorbereitungen für die Treffen mit den Kunden am nächsten Tag. Etwa eine Stunde arbeite ich konzentriert, dann schließe ich die Mappe und verstaue sie wieder in der Aktentasche.
Erst Viertel nach neun. Im Hotel ist es ruhig. Nur hin und wieder höre ich gedämpfte Schritte auf dem Flur. Der dicke Teppich schluckt den Schall.
Ich mache den winzigen Fernseher an, der in einer Halterung an der Wand hängt. Schüsse knallen durch den Raum, Geschrei und Polizeisirenen folgen. Ich schalte schnell weiter. Unterhaltungsshow, ein Heimatfilm, Fußball – ich mache den Fernseher wieder aus. Jetzt würde ich mir ein Buch wünschen, einen Roman von der anspruchsvolleren Sorte. Aber ich habe nicht einmal ein Fachbuch bei mir. Was habe ich gedacht, als ich gestern gepackt habe? Wie habe ich mir vorgestellt, diesen einsamen Abend zu verbringen? Wollte ich an ein Wunder glauben, dass Micha schließlich doch auftauchen würde, wie schon öfter? Ja, es hat solche Situationen gegeben, wo er ein Treffen abgesagt hatte aber dann doch plötzlich am Flughafen stand oder am Bahnsteig – oder sogar mitten auf der Strecke im Zugabteil auftauchte. Er wusste ja immer sehr gut, wann ich an welchen Orten war.
Aber heute ist nun einer der Tage, an denen er weder mitgeflogen noch nachträglich aufgetaucht ist. Auch solche Tage habe ich schon mehrmals erlebt. Doch ich will mich nicht gern an sie erinnern. Da folgten nämlich Nächte, von denen ich heute nicht mehr recht weiß, wie ich sie überlebt habe. Tief in mir spüre ich noch das Grauen und das Gefühl von Verrat, das sie hinterlassen haben. Nein, ich will nicht mehr daran denken.
Ich ziehe einen Vorhang zurück und schaue hinaus. Es ist stockdunkel, ein Stück weiter die Straße hinunter sehe ich im Schein einer Laterne leichten Nieselregen fallen.
Ich lege mich aufs Bett. Neben mir, auf dem Nachttisch, sehe ich das Telefon.
Wen könnte ich anrufen? Rudolf sitzt mit Martin beim Schach und würde sich sehr wundern, um diese Zeit einen Anruf von mir zu bekommen, wo ich ihm immer erzähle, um halb zehn sei ich längst im Bett, wenn ich auf diesen anstrengenden Geschäftstouren bin.
Ich sehe Micha mit seiner Frau an einem Krankenbett sitzen. Wenn ich jetzt sterben müsste, ich könnte ihn nicht erreichen, könnte ihm nicht mal ein letztes Lebewohl sagen.
Niemand weiß, dass ich mich in diesem Hotel befinde. Wenn mir etwas passieren würde – niemand ahnte, dass ich hier bin, hier in diesem kleinen unpersönlichen Raum.
Die Stille in dem Hotel kommt mir plötzlich erdrückend vor. Ist hier überhaupt ein Mensch? Wenn ich Hilfe brauchte, könnte mich jemand hören?
Wieder schaue ich das Telefon an. Ein kleines Informationsblatt liegt davor. Die Vorwahlnummern verschiedener Länder stehen darauf. Die Nummer der Rezeption. Bis 22.00 Uhr besetzt, steht dahinter. Und später? Was mache ich, wenn ich nach 22.00 Uhr etwas brauche? Für eine Amtsleitung die 0 wählen. Das klingt tröstlich. Zumindest kann ich hinauswählen in die weite Welt. Auch wenn hier im Haus kein Mensch mehr erreichbar ist.
Ich stehe wieder vom Bett auf. Mir ist schwindlig. Ich atme schwer, bekomme schlecht Luft. Mein Herz klopft schnell.
Was mache ich nur hier? Alleine in diesem Zimmer? Warum bin ich heute schon nach Hannover geflogen? Ich hätte den morgigen Termin auf 10.00 Uhr verschieben können – gar kein Problem. Dann hätte ich mit dem ersten Flieger von Tegel rechtzeitig beim Kunden sein können. Warum habe ich mir das angetan, diese Nacht allein im Hotel? Allein, ohne Micha! Den Termin in Dortmund hätte ich noch früher in den morgigen Tag quetschen können und dann mit der letzten Maschine wieder zurückfliegen. Freiburg und Frankfurt hätten warten können – oder ich hätte beides am nächsten Montag geschafft, ohne Übernachtung. Und am Wochenende wäre ich zu Hause gewesen, zusammen mit Rudolf, der sich bestimmt gefreut hätte.
Warum habe ich an der ursprünglichen Planung festgehalten? Nur um wieder einmal zu sehen, dass Micha mich im Stich lässt? Um mir klar zu machen, dass Micha nicht zu mir gehört, dass er andere Verpflichtungen hat und immer haben wird? Dass sich aus den wenigen gestohlenen Stunden niemals wird ein Leben zusammenflicken lassen?
Wenn seine Frau mal allein verreist ist, was sehr selten geschieht, nutzen wir die sturmfreie Bude, um bei ihm den Spätnachmittag zu verbringen. Wir lieben uns auf dem Sofa, und danach sitzt er am Klavier und spielt für mich. Das ist erst dreimal geschehen in den vier Jahren, seit unsere heimliche Beziehung besteht. Diese drei Male, die er für mich Klavier spielte, haben mich für vieles entschädigt. Nur nicht für die einsamen Nächte in Hotels, die ich für uns gemeinsam gebucht hatte. Wir nahmen immer Einzelzimmer. Gemeinsam logieren - das wäre wegen unserer Spesenabrechnungen nicht in Frage gekommen. Wenn wir unsere Zimmer bezogen hatten, entschieden wir, welches sich besser für die Nacht zu zweit eignen würde. Am Morgen zog sich der Besucher wieder in sein Zimmer zurück.
Ich schaue mich um. Das Bett ist recht schmal, aber das hatte uns noch nie gestört. Wir lieben es, eng umschlungen einzuschlafen. Wir haben uns ja viel zu selten.
Wieder setze ich mich in den Sessel und halte nun das Glas Wein in der Hand. Ich nehme kleine Schlückchen, nebenher trinke ich Wasser aus dem Zahnputzglas. Der Bahnhof von Stuttgart taucht vor meinen Augen auf. Auch dort hatten wir uns mal getroffen, vor zwei Jahren etwa. Ich war von Berlin direkt dorthin geflogen, Micha hatte vorher in München zu tun gehabt und war mit dem Zug nach Stuttgart gefahren, wo ich ihn am Bahnhof erwartete. Was für eine Freude, als wir uns sahen! Ich rannte auf ihn zu, er breitete die Arme aus und fing mich auf. Wir bummelten die Schlossstraße herunter, aßen früh zu Abend und hörten später ein Konzert in der Liederhalle. In einer kleinen Pension übernachteten wir. Wie glücklich war ich in dieser Nacht! Als könnte uns nie wieder etwas trennen!
Aber die Trennungen kamen, immer wieder und immer grausamer. Je mehr ich ihn liebte, je bedingungsloser ich mich ihm hingab, desto härter wurde das Auseinandergehen.
In Berlin treffen wir uns nur selten. Mal eine Stunde in einem entlegenen Café oder einer Pizzeria nach Dienstschluss. Mal ein Spaziergang im Botanischen Garten, wenn das Wetter nicht so gut ist und dort keine Bekannten zu befürchten sind. Wir müssen vorsichtig sein.
Wie satt ich dieses Versteckspiel habe! Wie ich mich hasse für die Lügen, die ich Rudolf auftische, die Lügen, die schon so selbstverständlich geworden sind und die doch schwer auf meiner Seele lasten. Und wie ich Micha hasse für die Lügen, mit denen er sich von mir fernhält. Ich weiß es, ich spüre es. Er belügt mich. Die vielen Katastrophen – es kann einfach nicht sein, dass die Hälfte seiner Familie in den letzten zwei Jahren ausgelöscht wurde! Dass er selbst sowohl von Herzinfarkten als auch Zahnwurzeleiterungen und Leberentzündungen heimgesucht wurde. Ich denke, dass nicht einmal die Hälfte von dem, was er mir erzählt, der Wahrheit entspricht. Aber wo verlaufen die Grenzen? Wie kann ich beurteilen, verurteilen? Was ist, wenn ich ihn kalt abfahren lasse und es ist wirklich gerade etwas Entsetzliches passiert?
Was war in dem halben Jahr, als ich gar nichts mehr von ihm hörte? Er hat es mir nie erklärt.
Warum habe ich mir diese Fragen überhaupt zu stellen? Warum sitze ich hier und grüble über ihn nach? Warum verabrede ich mich noch mit ihm? Warum kann ich ihn nicht endlich ziehen lassen? Warum beende ich diese Beziehung nicht – und sei es nur, um in Zukunft nichts mehr mit Lügen zu tun zu haben?
Inzwischen trinke ich den Wein in großen Schlucken, habe das zweite Glas eingeschenkt und fast geleert. Schon spüre ich die Wirkung des Alkohols, mir wird warm und noch schwindeliger als zuvor. Ich weiß, dass ich nicht viel vertrage. Trotzdem trinke ich weiter. Der Raum wirkt wie in Watte gehüllt. Wieder frage ich mich, was ich hier mache. Aber es ist mir schon alles etwas gleichgültiger.
Als der Wein soweit seine Wirkung getan hat, dass ich glaube, einschlafen zu können, ziehe ich mich aus und lege mich ins Bett.
Ich erwache von Granateneinschlägen und grellen Blitzen. Furchtbare Schreie gellen in meinen Ohren. Ich will auch schreien, kann aber nicht.
Hektisch taste ich nach dem Schalter der Nachttischlampe. Endlich erhellt ein schwacher Lichtschein den Raum. Ich setze mich im Bett auf, lausche. Nichts. Es ist alles still. So still wie in einem Grab. Die Uhr zeigt kurz vor drei. Wieder einmal! Wie oft bin ich schon um diese Zeit aus Albträumen erwacht! Zu Hause laufe ich dann über den Flur und krieche zu Rudolf ins Bett. Wir haben getrennte Schlafzimmer, aber er hat mich gerne bei sich im Bett. Ich bin diejenige, die im Prinzip lieber allein schläft. Nur nicht, wenn die schlimmen Träume kommen …
Wenn ich an Michas Seite schlafe, habe ich nie böse Träume. Doch ohne ihn in einem Hotelzimmer, wenn kein Mensch in der Nähe ist, zu dem ich hin flüchten könnte, wenn sich außerdem das Gefühl, verraten zu sein, breit macht, ist die Wahrscheinlichkeit schrecklicher Traumbilder sehr groß, ich weiß es wohl.
Ich stehe auf, mache alle Lichter an. Jetzt ist an Schlaf nicht mehr zu denken für die nächsten Stunden. Ich versuche, die Kriegsbilder zu verscheuchen, es gelingt mir nicht. Der Traum zieht noch einmal an mir vorbei. Wieder sehe ich das Schlachtfeld vor mir, Granaten, die überall einschlagen, helle Blitze in der Dunkelheit, Erde, die hoch spritzt und dröhnendes Krachen, grässliche Schreie, die von allen Seiten zu mir dringen. Angestrengt versuche ich, in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Im Schein der nächsten Granatenexplosion sehe ich einen Mann, blutüberströmt, mit wankendem Schritt auf mich zukommen. Es ist Michael, groß und schmal. Er kann sich kaum auf den Beinen halten. Auf dem Arm hält er ein kleines Kind. Unser Kind?
Ich will ihm entgegenlaufen, das Kind zu mir nehmen, es in meinen Armen schützen. Da spüre ich einen furchtbaren Schlag und sinke zusammen.
„Du bist schuld!“ höre ich eine Stimme rufen. Ich will schreien, aber ich kann nicht. Ich sterbe.
Warum träume ich immer wieder von diesen schrecklichen Kriegsszenen? Ich habe keinen Krieg erlebt, selten Kriegshandlungen in Filmen gesehen, mein Vater hat wenig erzählt, auch selber kaum Gewalt erlebt, weil er nie an der Front eingesetzt war.
Warum sehe ich immer wieder Panzer, Granaten, Maschinengewehre? Warum liege ich in Schützengräben, renne durch zerstörte Häuser, verkrieche mich in Wäldern? Warum stehe ich auf Brücken, die gesprengt werden? Warum sehe ich mich im Traum absichtlich auf feindliche Linien zu laufen, spüre den Wunsch, den Tod zu finden?
Ich gehe im Hotelzimmer auf und ab. Wenn es wenigstens ein Radio gäbe! Eine Stimme zu hören, die Musikstücke ansagt, das könnte beruhigend wirken. Mir fallen vor Müdigkeit fast die Augen zu. Aber ich will nicht schlafen, habe Angst, auf die Schlachtfelder zurückzukehren, gejagt zu werden, zerfetzte Körper zu sehen – und immer wieder in den Kugelhagel zu rennen und erschossen zu werden.
Nur nicht ins Bett legen, wo mich der Schlaf packt und in die Hölle herunterzerrt! Wach bleiben um jeden Preis. Aber wie?
Ich suche die Schublade des Nachtschränkchens durch. Manchmal liegt da eine vergessene Zeitschrift, ein Taschenbuch. Nein, ich finde nur die obligatorische Bibel, eine Ausgabe in drei Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch. Die Bibel interessiert mich nicht, ich war nie christlich orientiert. Aber ich schlage den französischen Teil auf, versuche mit meinen inzwischen verbesserten Kenntnissen etwas von dem Zusammenhang zu verstehen. Die Konzentration lenkt mich ab und hält mich eine Weile beschäftigt.
Es wird kalt im Zimmer. Ich hole mir die Bettdecke und kuschle mich damit in den Sessel, die Beine angezogen. Immer wieder nicke ich kurz ein, schrecke dann wieder hoch. Heiße Adrenalinschübe strömen durch meinen Körper. Angst - wilde, nicht zu bändigende Todesangst. Vier Uhr, halb fünf, fünf. Gegen halb sechs dringt schwaches Licht durch die dünnen Vorhänge, ich kann es erkennen, obwohl im Zimmer noch alle Lampen brennen. Ich öffne die Vorhänge, lösche die Lichter und lege mich endlich wieder ins Bett. Anderthalb Stunden habe ich noch, bis der Wecker klingelt. Es ist hell, ich bin gerettet, es kann mir nichts mehr passieren. Beruhigt schlafe ich ein.
Am nächsten Vormittag erledige ich pünktlich und effektiv meine Aufgaben bei den beiden Kunden. Ich bin zeitig am Flughafen, gebe den Leihwagen zurück und gönne mir ein üppiges Mittagessen. In einem Kiosk kaufe ich einen Roman in weiser Voraussicht auf die kommende Nacht.
Auf dem Flug nach Düsseldorf schlafe ich ein wenig, als ich gegen 14.00 Uhr dort ankomme, fühle ich mich müde und schlapp. Am Bahnhof, während ich auf den Zug nach Dortmund warte, rufe ich Rudolf im Büro an.
„Alles in Ordnung?“ fragt er.
„Ja, alles o.k.“
„Du klingst müde?“
„Ach ja, das viele Rumfahren. Und in den Hotelbetten schläft man nicht so gut.“
„Wann bist du Dienstag zurück?“
„Ich habe den Flieger um 18 Uhr ab Frankfurt gebucht. Mal sehen, wenn ich früher fertig bin, kann ich vielleicht umbuchen.“
„Sag Bescheid. Ab etwa 16.30 Uhr könnte ich dich in Tegel abholen.“
„Das ist lieb. Wenn nicht, nehme ich ein Taxi.“
„Pass auf dich auf, Stefanie-Schatz.“
„Du auch. Tschüss.“
Die Arbeit in Dortmund ist schnell erledigt. Was soll ich tun an einem späten Freitagnachmittag in einer fremden Stadt?