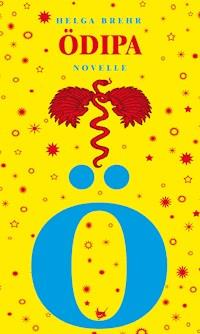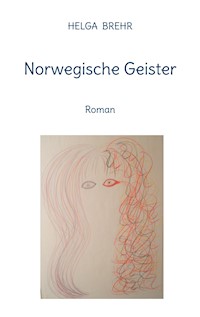
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Helga Brehr: Romane
- Sprache: Deutsch
Das Reaktorunglück in Tschernobyl ist im Jahr 1986 ein spontaner Anlass für Karin, sich auf den langen Weg nach Norwegen zu machen, in ein Land ohne AKWs. Doch mit ihr reist auch der Schmerz einer zerbrochenen Beziehung. Vom hohen Norden zieht es sie noch einmal nach Spanien zu ihrem feurigen Liebhaber - und wieder zurück in eine einsame Hütte im norwegischen Wald. Hier begegnen ihr merkwürdige Geister, die sich aber als hilfreich erweisen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Das Reaktorunglück in Tschernobyl ist im Jahr 1986 ein spontaner Anlass für Karin, sich auf den Weg nach Norwegen zu machen, in ein Land ohne AKWs. Doch mit ihr reist auch noch die Last einer zerbrochenen Beziehung. Vom hohen Norden zieht es sie noch einmal nach Spanien, zu ihrem feurigen Liebhaber - und wieder zurück in eine einsame Hütte im norwegischen Wald. Hier begegnen ihr merkwürdige Geister der Vergangenheit, die sich aber als hilfreich erweisen.
Die Autorin
HELGA BREHR studierte Bibliothekswesen sowie Sprach- und Übersetzungswissenschaften. Sie lebte u.a. in Freiburg, Berlin, Athen, Saarbrücken und Odense/Dänemark. Heute arbeitet sie als Sprachlehrerin und Autorin in Schleswig-Holstein.
Bisher erschienen: »Ödipa« 2014, »Mutter, was hast du mir verschwiegen?« 2016, »Opfern am Mittag« 2017, »Dreifach gesichert und doch…« 2022, »Elevtheria - Die Frau und die Freiheit« 2020. »Unfassbare Nähe« 2022.
www.helga-brehr.de
"Denkst du nicht, dass es eine Art kollektives Bewusstsein gibt, sozusagen einen Speicher von allen Taten, Gedanken und Gefühlen der gesamten Menschheit?"
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: NORWEGEN / Anfang Juni 1986
Kapitel 2: NORWEGEN / Juni 1986
Kapitel 3: MÁLAGA / Februar 1986
Kapitel 4: NORWEGEN / Juni 1986
Kapitel 5: MÁLAGA / Februar 1986
Kapitel 6: NORWEGEN / Juli 1986
Kapitel 7: MÁLAGA / März 1986
Kapitel 8: NORWEGEN / Juli 1986
Kapitel 9: MÁLAGA / März 1986
Kapitel 10: HEIDELBERG / März 1986
Kapitel 11: NORWEGEN / Juli 1986
Kapitel 12: HEIDELBERG / Juli-August 1986
Kapitel 13: MÁLAGA / August 1986
Kapitel 14: HEIDELBERG / August 1986
Kapitel 15: NORWEGEN / September 1986
Kapitel 16: NORWEGEN / September 1986
Nachwort: NORWEGEN / 1988
Kapitel 1
NORWEGEN / Anfang Juni 1986
Ein herrliches Gefühl von Freiheit. Ich konnte fahren, wohin ich wollte. Mein Auto fraß Kilometer auf der A 7 Richtung Norden. Den Elbtunnel hatte ich endlich hinter mir. Es machte Spaß, auch mal etwas zu rasen, soweit mein altes Gefährt mithielt.
Mir war es egal, wann ich wo ankam. Ich hatte vier Wochen und die gehörten allein mir. Mein Vorrat an Musikkassetten lag neben mir auf dem Beifahrersitz. Soweit ich mich erinnere, gab es noch keinen CD-Player im Auto – jedenfalls nicht in meinem. Auch Handys kannte man nicht. Es war das Jahr 1986, sechs Wochen nach dem Unfall im Atomkraftwerk Tschernobyl.
Die Reaktorkatastrophe hatte mich tief verunsichert. Ich begann, mich eingehender über AKWs zu informieren und fühlte mich durch die Tatsache, dass Deutschland voll davon war, in Gefahr.
Mein Ziel war: Erst mal weg aus Deutschland, vielleicht sogar für immer? Eine Perspektive suchen, ein Land ohne Atomkraftwerke, ein Land in dem nicht radioaktive Wolken über die Landschaft zogen, während kleine Kinder ungeschützt im Sandkasten spielten.
Natürlich war mir klar, dass radioaktive Wolken keine Grenzen kannten. Tschernobyl ist überall, hieß es damals. Obwohl ich mir in diesen Tagen keinen Begriff davon machte, dass Tschernobylwolken ganz besonders nach Skandinavien gezogen waren, ging es mir nicht nur darum, der Strahlengefahr zu entfliehen, sondern ich war auf der Suche nach einem Land, in der Atomkraft nicht befürwortet wurde. Ich wollte nicht länger Teil einer Gesellschaft sein, die bewusst oder unbewusst die Atomlobby mittrug oder zumindest duldete.
Norwegen schien mir eine Alternative zu sein. Grandiose Natur, freie und offene Gesellschaft, Demokratie, Gleichberechtigung – diese Schlagworte prägten sich mir ein, als ich mich näher über das Land informierte. Und ich setzte meinen Urlaub dafür ein, dieses Land zu erkunden.
Dass es mir außerdem wichtig war, dieses Mal nicht in den Süden zu reisen sondern bewusst in die andere Richtung, hatte noch mit anderen Fluchtgedanken zu tun.
Ich hatte keinen festen Plan, keinen Ort, den ich unbedingt besuchen wollte. Natürlich würde ich die Hauptstadt nicht links liegen lassen. Ansonsten interessierte ich mich eher für ruhige Gegenden.
Der Schock vom Kraftwerkunfall saß mir tief in den Knochen. Ich konnte nicht verstehen, dass die meisten Menschen in Deutschland so gelassen blieben, so desinteressiert. Natürlich: man sah nichts, hörte nichts, roch nichts und fühlte nichts von einer Bedrohung. Das machte mir die Sache noch unheimlicher. Ich hatte mich informiert, Bücher gelesen und ein paar Fakten zusammengezählt. Vielleicht ist es manchmal besser, nicht so viel zu wissen. Aber es lag mir nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich hatte mich mit den kritischen Menschen in Heidelberg zusammengetan, um über die Lage zu diskutieren. Auch sie waren besorgt. Doch viele andere wollten sich nicht beunruhigen lassen. Tschernobyl war weit weg, man schätzte alles nicht so schlimm ein und außerdem: Unsere Kernkraftwerke waren sicher! Da könnte so etwas nicht passieren. Die Leute mochten sich nicht aus ihrer vermeintlichen Sicherheit in Angst und Sorge begeben. Was durchaus verständlich war. Ich aber, in meiner rasenden Betroffenheit, verstand es nicht.
Das lange, eintönige Fahren auf der Autobahn erlaubte mir, meinen inneren Dialog zu führen. Flüchten oder standhalten? Auf was für einen Weg machte ich mich? Was erwartete ich im hohen Norden? Reichte es, zu wissen, dass dort keine AKWs standen, um mich heimisch zu fühlen?
Mit solchen Fragen schlug ich mich herum, während ich durch die Rhein-Main-Gegend fuhr. Im Ruhrgebiet drehte ich mich noch immer im Kreis. Im Elbtunnel eingeschlossen wegen Stau, spürte ich Klaustrophobie. Autoabgase riecht man zumindest. Aber was, wenn es in Krümmel oder Stade einen Störfall gegeben hätte?
Kurz hinter Hamburg verließ ich die A 7 und fuhr Richtung Westen. Ich wollte die geliebte Nordsee wiedersehen und den Weg durch Dänemark auf der Westseite hinter mich bringen, auch wenn es auf der Ostseite, auf der Autobahn, schneller gegangen wäre. Es gab keine Eile. Auch die Fahrt wollte ich schon genießen.
In St. Peter-Ording hielt ich endlich an, nach über Tausend Kilometern Fahrt, auf der ich nur zweimal kurz zum Tanken und Toilettenbesuch Pause gemacht hatte.
Ich fand ein Zimmer in einer kleinen Pension und legte mich sofort aufs Bett, zu erschöpft zum Essen. Im Schlaf raste noch der graue Asphalt unter mir davon, das Brummen des Motors dröhnte in meinen Ohren.
Am Morgen, nach einem kräftigen Frühstück mit Vollkornbrot, Käse, Quark und Obst, ging ich an den Strand, empfing mit Wiedererkennungsfreude die Nordseeluft. Jetzt erst kamen die Bilder in mein Bewusstsein, die ich gestern nur flüchtig gestreift hatte: Ewig weite, saftig grüne Wiesen, dazwischen strahlend gelbe Rapsfelder. Strahlend – ja, die trüben Gedanken tauchten wieder dazwischen – alles verstrahlt, tickende Zeitbombe, bei der nächsten Panne könnte diese herrliche Landschaft unbewohnbar sein. Staunend musste ich feststellen, wie wunderschön doch dieses Deutschland war, dem ich jetzt vielleicht den Rücken kehren wollte. Wegen der AKWs.
Oder hatte diese Fahrt auch mit meiner unglücklichen Liebe zu Pacco zu tun? War die fluchtartige Abreise aus Spanien im März noch nicht genug gewesen? Wollte ich immer mehr Abstand zwischen ihn und mich legen?
Fest stand: In den wenigen Tagen der Leidenschaft und der Enttäuschung war ich mir – meinem inneren Kern – näher gekommen und hatte gleichzeitig Schleusen für tiefer liegende Gefühle geöffnet – Gefühle aus meiner Kindheit. Wie hing mein Verhalten Pacco gegenüber mit diesen Kindheitserlebnissen zusammen? Warum hatte dieser Mann mich so tief berühren und so tief verletzen können? Gab es noch Hoffnung für die Beziehung oder würde ich während meiner einsamen Erkundungstour durch Norwegen – aber auch durch meine kindliche Seele – zu dem Entschluss kommen, ihn nie mehr zu sehen?
Ich lief dem Wasser entgegen, hörte Möwen über mir lachen, der salzige Wind wehte mir ins Gesicht. Die Sonne schien sehr kräftig für einen Tag Anfang Juni. Am Wassersaum knirschten Muscheln unter meinen Schuhen. Die Wellen rauschten sanft herein und zogen sich wieder zurück. Ich war fast allein, in der Ferne liefen ein paar Menschen. Eine Weile sah ich dem Kommen und Gehen des Meeres zu, dann zog ich Schuhe und Strümpfe aus und planschte im Wasser herum.
Als Fünfjährige hatte ich zum ersten Mal die Nordsee gesehen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Obwohl ich noch nicht schwimmen konnte, tummelte ich den ganzen Tag in den Wellen herum oder baute Burgen aus Sand. Der würzige Duft, das Kreischen der Möwen, der feine, warme Sand unter den Füßen – das alles hatte sich tief eingeprägt, zumal die Eindrücke in den folgenden drei Jahren wiederholt wurden. Als ich später im Südwesten Deutschlands lebte, gab es immer eine leise Sehnsucht in mir – nach dem Meer, nach dem Norden, nach Sand, Salzwasser und Möwengeschrei, nach dem klaren Licht und dem warmen Wind. Nie habe ich diese Wochen an der Nordsee vergessen können.
Nun lief ich wie ein Kind im kalten Nordseewasser herum, sprang, wie die Wellen, vor und zurück, warf die Arme hoch und quietschte vor Vergnügen. Dann ging ich gebückt im feuchten Sand, nach Muscheln und Steinchen suchend, die ich in meine Jackentaschen stopfte. Lange lief ich am Wasser entlang, um mich schließlich Richtung Dünen zu wenden, wo ich mir einen Platz zum Ausruhen suchte. Ich lag eine Weile und las in einem Buch, als sich plötzlich Stimmengewirr vernehmen ließ. Eine Gruppe, offenbar aus einem Kinderheim, näherte sich. Zwei erwachsene Frauen und ein Gewimmel von kleinen Kindern ließen sich in einiger Entfernung nieder. Zunächst fühlte ich mich sehr gestört. Ich wollte in Ruhe mein Buch lesen. Es enthielt endlich mal keine Informationen über die atomare Bedrohung. Alles, was mit AKWs zu tun hatte, lag zuhause. Für diese Reise hatte ich mir ganz bewusst andere Literatur mitgenommen.
Missmutig sah ich den Kindern aus der Distanz zu. Ein kleines Mädchen, vielleicht vier Jahre alt, sonderte sich von der Gruppe ab und setzte sich zu mir. Erst war ich voller Widerstand, fand aber dann Interesse an ihr und wir redeten miteinander.
Sie weint immer so viel, weil es ihr hier nicht gefällt. Wo sie her kommt, weiß sie nicht. Später finden wir gemeinsam heraus: Wahrscheinlich aus Berlin. Sie hat zwei kleinere Schwestern.
»Der Papa ist weggezogen. Die Mutti hat immer so viel geschimpft. Da ist der Papa weggezogen und kommt nicht mehr. Ich und meine Schwestern haben viel geweint.«
Sie fragt auch mich aus: »Wo wohnst du? Wie heißt du?«
Ich erzähle, dass ich mich hier nur ein bisschen ausruhe und dann weiterfahre.
»Wohin?«
»Nach Norwegen«. Ich bezweifle, dass sie weiß, was damit gemeint ist. Doch ihr Interesse gilt nicht meinem Reiseziel.
»Ganz allein?« Sie blickt mich angstvoll an, löst ganz sacht auch in mir Bedenken aus.
»Ja«, antworte ich knapp, unfreundlicher als ich möchte.
»Hast du keinen Papa?« Warum fragt sie nicht nach meiner Mutter, überlege ich und sage zögernd: »Doch.«
»Warum fährt der nich mit dich?«
»Er ist schon alt und bleibt lieber zuhause.« Ich erzähle ihr nicht, dass mein Vater vor sechs Jahren gestorben ist.
»Bist du neu?«, fragt sie.
Ich weiß nicht, was sie damit meint und erkläre ihr, dass ich nicht alt aber auch nicht mehr jung bin. Dann wird mir klar, dass sie mit »neu« meint: Erst kürzlich hier angekommen, wie sie und einige andere Kinder im Heim.
Allzu lange halte ich es nicht mit ihr aus. Ist es Angst, dass sie sich zu sehr an mich klammern könnte?
Ich stehe abrupt auf und sage: »Ich gehe jetzt essen und fahre dann weiter«.
»Kommst du bald wieder?«, bettelt sie und sieht mich flehend an.
»Nein, ich fahre weg und komme nicht mehr hierher. Ich wünsche dir noch schöne Ferien und viel Spaß mit den anderen Kindern und viel Sonne.«
Ich streichle ihre Wangen und sie gibt mir spontan ihr Geflecht aus Seegras.
»Da, für dich«.
Kaum bin ich gegangen, denke ich, ich hätte ihr viel mehr Trost geben müssen, ihr sagen, dass ihr Papa sie lieb hat und immer an sie denkt und dass sie ihn später besuchen kann.
Überall achte ich jetzt auf solche kleinen Mädchen. Am Deich ruft eines enttäuscht und ärgerlich zu ihrer Mutter hoch: »Warum kommst du nicht? Immer kommst du nicht! Immer wenn ich sage ´komm!`, dann kommst du nicht!«
Ihre Mutter gibt ihr die Hand, nimmt sie auf den Arm und das Mädchen schmiegt ihren Kopf müde und beruhigt an Mutters Schulter.
Ich sehe mich als Fünfjährige in den Ferien am Meer. Mein Vater hat viel Arbeit und kommt nur an den Wochenenden. Auf die zwei Tage, die er mit uns verbringt, freue ich mich die ganze Woche. Die übrige Zeit beschäftige ich mich mit dem Wasser, den Muscheln und dem Sand. Meine Mutter liegt im Strandkorb, hat Leute kennen gelernt, mit denen sie sich zum Kaffee trifft und auch nach dem Abendessen, wenn ich schon in meinem Zimmer im Bett liegen muss. Es ist mir unheimlich, so allein in einem fremden Zimmer. Warum darf ich nicht bei Mama schlafen?
»Aber Kind, wo soll denn der Papa schlafen, wenn er Samstag und Sonntag hier ist?«
»Aber solange er nicht hier ist?«
»Nein, du bleibst in deinem Zimmer, bist ja schon groß«.
Es gibt eine Verbindungstür zwischen dem Elternzimmer und meinem. Aber meistens ist sie abgeschlossen. Nur, wenn Mama zu mir hereinkommen will, schließt sie auf. Oft sitze ich lange in meinem Bett und schaue auf das Schlüsselloch in der gegenüberliegenden Tür. Wenn von drüben ein Lichtstrahl herüberdringt, dann weiß ich, dass Mama zurückgekommen ist und kann endlich einschlafen. -
Ich fuhr über Husum bis Schlüttsiel. Ein endlich mal deutlicherer Blick auf die Skandinavienkarte hatte mir gezeigt, dass der Weg durch Dänemark gar nicht so kurz war. 350 Kilometer kurvige Landstraße. Und das wollte ich gerne bis morgen Vormittag geschafft haben, obwohl ich nicht wusste, ob ich dann einen Platz auf einer Fähre bekommen würde. Plötzlich fühlte ich mich müde und mutlos. Ich besorgte mir ein Quartier direkt am Verladehafen nach Amrum. Mich lockte der Gedanke, erst noch mehrere Tage in deutschsprachiger Umgebung zu bleiben, bevor ich Dänemark, die Fähre und Norwegen in Angriff nahm. Aber dann überzeugte ich mich selbst davon, dass langes Zögern noch mutloser machen würde und dass ich am nächsten Tag mit Entschlossenheit losfahren sollte.
Am Morgen saß ich um sieben Uhr beim Frühstück. Die Sonne strahlte schon. Auf dem grünen Deich entdeckte ich Schafe, dahinter das Meer, Schiffe und eine Hallig in der Ferne.
Dann war ich wieder on the road. Dänemark, flaches Land, grüne Wiesen, grauer Himmel. Müdigkeit und Trübsal machten sich breit, als ich nach vier Stunden eine Pause einlegte. Noch fast die Hälfte der Strecke hatte ich vor mir und die Ungewissheit, wann ich aufs Schiff kommen könnte.
Glaubte ich wirklich daran, mit dieser kräftezehrenden Reise meine angeschlagenen Nerven heilen zu können und mich von Atomangst und Liebeskummer zu erholen? Im Moment schien es ganz anders auszusehen.
Aber dann ging alles ganz glatt. Um 15 Uhr stand ich am Hafen von Hirtshals, hatte eine Bordkarte in der Hand und wartete auf die Einschiffung. Selbst der Regen hatte bis jetzt gewartet. Im Rückspiegel des Autos sah ich mein Gesicht, das frisch und erholt wirkte. Man merkte mir die Strapaze der Fahrt nicht an.
Nun viereinhalb Stunden Überfahrt und ich versprach mir, das nächste vernünftige Hotel für diese Nacht anzusteuern.
Der Seegang im Skagerrak zeigte beträchtliche Ausschläge. Ich hatte mich gemütlich in einem bequemen Sessel eingerichtet, einen Becher Kaffee in der einen und ein Buch in der anderen Hand. Kaum hatten wir das Hafengebiet verlassen, schwappte der Kaffee über und an lesen war gar nicht zu denken. So döste ich ein bisschen und lief später ein paar Runden auf dem Deck.
Als die Lautsprecher die Autofahrer zu ihren Fahrzeugen riefen, ging ich zum tiefsten Deck hinunter. Ich geriet ein bisschen in Panik, als ich dort nur Lastwagen stehen sah und nirgends einen roten Polo. Wo war mein Auto geblieben? Von allen Autofähren, die ich bisher erlebt hatte, kannte ich nur ein Fahrzeugdeck – und das war immer das unterste. Ich versuchte es eine Treppe höher, dort standen Pkws, zwischen denen ich wieder erfolglos herumlief. Mein Auto fand ich schließlich noch ein Deck höher und es war höchste Zeit, andere Autofahrer hinter mir wurden schon ungeduldig.
Ich rollte an Land, meine Papiere griffbereit, aber es gab keinerlei Einreisekontrolle. Dabei hätte ich doch so gerne einen Stempel in meinem Pass gehabt.
Zwanzig Uhr vorbei – und noch taghell, aber ich fühlte mich erschöpft. Nur schnell ins Bett! Ich fand das Hotel in Kristiansand, das ich mir im Reiseführer ausgeguckt hatte – aber es war kein Zimmer frei. In vier, fünf anderen Hotels sowie in der Jugendherberge dasselbe. Ach Gott, sollte ich die Nacht etwa im Auto verbringen?
Ich erlebte mein Traumland kalt und ungastlich, fluchte enttäuscht vor mich hin. Gegen 22 Uhr machte ich mich, dem Rat einer Hotelfrau folgend, auf den Weg nach Arendal, 70 Kilometer entfernt Richtung Osten – wo ich doch geplant hatte, von Kristiansand aus am nächsten Tag nach Westen zu fahren. Auf den schmalen Serpentinen zwischen Felsen eingezwängt, herrschte noch relativ viel Verkehr.
Um 23 Uhr erreichte ich Arendal, fand sofort das gesuchte ADAC-Hotel und konnte – oh Wunder! – ein Zimmer haben. Ich füllte den ausgesprochen neugierigen Fragebogen zur Anmeldung aus und erkundigte mich nicht mal nach dem Zimmerpreis, war nur froh, nicht im Auto die Nacht verbringen zu müssen. Dann ein Schreck vor dem Einschlafen. Zahnschmerzen! Leichte Schwellung an einem Backenzahn. Das hatte mir noch gefehlt! Ach, morgen würde es wieder vorbei sein, versuchte ich mich zu beruhigen. Doch ein Rest Verzagtheit blieb, als ich mich fest in die Bettdecke einrollte.
Nach tiefem Schlaf und ausgiebigem Frühstück überdachte ich am nächsten Morgen meine Lage. Sollte ich weiterfahren? Und in welche Richtung?
Ich hatte mir ein Verzeichnis von »vandrehjemme« mitgenommen, eine Art Jugendherbergen, die aber in Norwegen von jedermann benutzt wurden und recht komfortabel sein sollten. Sie entsprachen meinem Geldbeutel weit besser als dieses Hotel, das pro Nacht umgerechnet 160 Mark kostete, wie ich jetzt erfahren hatte. Das vandrehjem in Kristiansand war zwar am Abend vorher ebenso ausgebucht gewesen wie die Hotels, doch die Hafenstadt Kristiansand musste ich nicht unbedingt mit anderen Orten gleichsetzen.
Ich beschloss, mir noch einen zweiten Tag Ruhe im ADAC-Hotel zu gönnen, auch wenn die Übernachtung so viel kostete, wie zehn Nächte im vandrehjem.
Eine Stunde wanderte ich in dem Städtchen herum, lief ziellos durch die Straßen, mein berühmter Orientierungssinn ließ mich im Stich. Irgendwann entdeckte ich am Straßenrand ein Auto, das wie meines aussah und erschrak fast, als es tatsächlich meines war.
Erschöpft und durchgefroren kam ich ins Hotel zurück. Die Zahnschmerzen hatten nicht nachgelassen. Wollte mir dieser elende Zahn den ganzen Urlaub versauen?
Ich versuchte, am Nachmittag einen Gesundungsschlaf zu halten. Aber eine idiotische Band, die irgendwo Schlagzeug übte, machte mir einen Strich durch die Rechnung. So viel Geld für ein Hotel, in dem ich nicht zur Ruhe kam! Der Zahn pochte weiter. Aber ich wusste: Es war nicht nur die körperliche Anstrengung, sondern auch die psychische Strapaze, das Gefühl des Verlorenseins, das mir zu schaffen machte.
Nein, es war doch keine idiotische Band, sondern ein defekter Ventilator. Insofern hatte mein Anruf bei der Rezeption schon Sinn gemacht. Nun war ich in einem anderen Zimmer, mit tausend Entschuldigungen, aber zur Straße hinaus, was in Bezug auf Ruhe auch nicht viel besser sein würde. Ich versuchte einen neuen Schlaf-Anlauf. Vielleicht sollte ich lieber hinausgehen, da jetzt die Sonne schien? Nein, davon ließ ich mich auch nicht drängen. Ich hatte mir einen Kuschelnachmittag im Bett versprochen, keinen kalten Wind.
Eine grandiose Planung war das gewesen! Es zeigte sich, dass die meisten vandrehjemme bis Mitte oder Ende Juni geschlossen hatten. Als ich trotzdem einen Anruf in Kragerø wagte, lief dort ein Band, das ich nicht verstand. Aber ich gab nicht auf. Von der turistinform hatte ich am Vormittag einen Prospekt mitgenommen von einem kleinen Gasthaus auf der Insel Tromøy, gegenüber von Arendal gelegen. Dort rief ich an und mietete mich für zwei bis drei Nächte ein. Ganz zufrieden mit mir fiel mir erst hinterher ein: Ich hatte wieder nicht nach dem Preis gefragt. Nun ja, so schlimm würde es hoffentlich nicht werden, in dem Prospekt hieß es »billig«. Und eine Insel! Da könnte ich doch wenigstens am Wasser herumlaufen und mich etwas erholen. Nach einer wirklich äußerst kurzen Anfahrt!
Nur kein Leistungszwang in Bezug auf Kilometerfressen! Wenn ich das Land kennen lernen wollte, konnte weniger mehr sein. Vom Durchfahren allein erfuhr man noch nicht viel.
Abends im Restaurant spielte ich grande dame, mit warmem Essen – gerade, dass ich mir den Wein noch verkniff.
Ich bestellte Schollenfilet und bekam drei ganze Schollen, Kartoffeln, Salat und viel Remoulade. Wer kann so viel essen? Ein fröhlichfreundliches Mädchen bediente. Ihr Lächeln tat mir gut, jede nette Geste tat mir jetzt gut – wie auch die der Frau im Auto vorher, die mich über die Straße gewunken hatte.
Die Sprachschwierigkeiten machten ein kleines Kind aus mir: Unsicher war ich, ängstlich, nicht verstanden zu werden. Gleichzeitig versuchte ich, mit meinen wenigen Brocken Norwegisch zu kokettieren, lobheischend.
Vor Beginn der Reise hatte ich mir einen kleinen Sprachkurs gekauft, sowie Wörterbuch und Sprachführer. Ich wollte nicht einfach wie selbstverständlich englisch sprechen – obwohl hier fast alle fließend mit der Sprache umgingen, wie ich bisher erfahren hatte – sondern zumindest die Bereitschaft zeigen, mich ein wenig in der Landessprache zu versuchen. Aber die spärlichen Fähigkeiten gaben mir ein Gefühl von Unzulänglichkeit. In anderen Sprachen sehr flüssig, war ich es nicht gewohnt, durch mangelnden Wortschatz so behindert zu sein.
Nach einem kleinen Spaziergang in der milden Abendsonne war ich zufriedener gestimmt. Die Luft wirkte frisch und sauber, hätte noch sauberer sein können, wenn es nicht so viele Autos gegeben hätte. Unglaublich, dieser dichte Verkehr! Und ein Gewühl im Ort, zumindest so lange die Geschäfte noch geöffnet waren. Ich fragte mich, wie so viele Menschen und Autos sich zusammen knäulen konnten in diesem angeblich so schwach besiedelten Land. Na ja, es war wieder mal die Küste, die es in sich hatte, wie überall.
Der Himmel zeigte sich jetzt fast wolkenlos und die Sicht auf die umliegenden Hügel und Häuschen schien mir so viel klarer, als bei uns, ein Unterschied wie das Sehen mit oder ohne Brille (ich war leicht kurzsichtig damals).
Am späteren Abend kroch doch wieder etwas Verunsicherung in mir hoch. Was machte ich eigentlich hier, ganz allein in einer völlig fremden Umgebung? Schließlich rief ich meinen großen Bruder Michael an. Er war sofort am Telefon. Ich erzählte ihm, wie verlassen ich mich fühlte. Der Trost meines Bruders tat gut und auch die Zusicherung, ihn jederzeit anrufen zu können. Wie war das erleichternd, zu wissen, dass auf jeden Fall jemand da war. Jemand, der mich gern hatte. Das Telefon als Rettungsaktion – eine ungeheure Beruhigung.
In der Nacht träumte ich:
Ich bin auf der Flucht aus einem verseuchten Land. Es ist finster, bedrohliche Wolken hängen am Himmel. Viele Menschen hasten durch die Straßen, alle wollen zum Bahnhof. Dort sehe ich aus der Ferne Züge bereitstehen. Einige setzen sich schon in Bewegung, Menschentrauben hängen an ihnen, stehen auf den Trittbrettern, sitzen sogar auf dem Dach. Die Leute um mich herum rufen: »Es sind die letzten Züge, nach ihnen fahren keine mehr!« Sie alle schleppen, genau wie ich, schwere Bündel mit ihrem Hab und Gut mit sich. Ich habe das alte Porzellan meiner Eltern eingepackt und das Silberbesteck. An meiner Hand zerre ich ein kleines Mädchen mit mir. Es kann kaum noch laufen, stolpert immer wieder und droht zu fallen. Einen Zug nach dem anderen sehe ich abfahren. Die Flüchtlinge um mich herum sind verschwunden, sie haben alle einen Zug erreicht. Ich renne über die Gleise. Mir wird klar, dass wir es nicht schaffen können, denn der letzte Zug pfeift, stößt Dampf aus und beginnt langsam zu rollen. Da werfe ich das Bündel mit den Habseligkeiten meiner Eltern weg, nehme das Kind auf den Arm und laufe mit letzten Kräften, springe auf das Trittbrett des Zuges, das Mädchen auf dem Rücken, der Zug zischt und fährt schneller – wir sind gerettet!
Am nächsten Tag saß ich in einer einsamen Bucht am Meer bei strahlendem Sonnenschein, hinter mir grüne Bäumchen und Wiesen, vor mir das endlose Wasser.
Das Tief war überwunden, die Nacht überlebt. Wegen Verkehrslärm und betrunkenen Jugendlichen auf der Straße hatte ich zwar wenig geschlafen, fühlte mich aber ganz gut. Und als am Morgen die Sonne so schön schien, ging es mir gleich besser. Die Zahnschmerzen hatten aufgehört.
Im Hotel bezahlte ich die horrende Summe von 1.200 Kronen, dann tankte ich und fuhr los nach Tromøy, der größten Insel der Südküste. Dort wohnte ich in einer gemütlichen Pension, bei netten Leuten, hatte ein hübsches Zimmer mit Blick auf Wiesen und Meer, zum günstigen Preis von 185 Kronen.
Und endlich konnte ich mich in der Ruhe der Natur fallen lassen, in einer äußeren Einsamkeit, die im Gegensatz zur inneren Einsamkeit in den betriebsamen Städten sehr wohltuend wirkte.
Ich ließ meine Gedanken zurückfliegen in meine Kindheit, staunte, als ich mir klar machte, wie es mir als Kind gelungen war, mein häufiges Gefühl von Verlassensein mit Fantasien zu kompensieren. Wenn mich niemand beachtete, malte ich mir aus, die Königin eines fremden Landes zu sein, von vielen Menschen umringt. Die Gesellschaft, die mir fehlte, erschuf ich mir vor meinem inneren Auge. Als Königin hatte ich Rechte und Pflichten, musste kluge Entscheidungen treffen, vielen Menschen helfen und für Gerechtigkeit sorgen. Ich war beliebt, die Leute kamen in Scharen zu mir.
In einem anderen Tagtraum war ich eine Räuberin, die wie Robin Hood mit einer Schar in den Wäldern lebte, reiche Leute überfiel, um den Armen die Beute zu geben.
In wieder einer anderen Fantasie lebte ich auf einer einsamen Insel mit vielen Tieren zusammen, die meine ständigen Begleiter waren.
Schon immer war ich leicht verführbar gewesen, wenn mir jemand Zuneigung und Anteilnahme zeigte. Dann ließ ich mich gerne locken und fühlte mich hinterher umso wertloser, wenn das Interesse des anderen nachließ. Vermutlich ging es vielen Kindern ähnlich, sagte ich mir. Oder musste nur ich mich immer wieder zwingen, allein mit bedrohlich wirkenden Situationen fertig zu werden?
Versonnen stand ich in meinem Zimmer auf Tromøy und beobachtete verrückte Wetterverhältnisse. Vom Fenster aus sah ich bis zum Meer hinüber nur blauen Himmel, über dem Haus ein paar Wolken. Plötzlich brach ein Hagelschauer los. Eine schwarze Katze rettete sich mit großen Sprüngen in eine leere Hundehütte. Es hagelte weiter, der Himmel blieb blau.
Ich stellte mir schon wieder die Frage nach dem Sinn dieses Urlaubs. Wollte ich aus dem Atomland Deutschland fliehen? Wollte ich zu mir finden? Wollte ich körperlich fit werden und mich erholen? Wollte ich Norwegen kennen lernen und einen Platz finden, wo ich heimisch werden könnte? Wollte ich Pacco vergessen? Oder alles zusammen?
Wenn ich nur in meinem Zimmer saß und las, hatte ich schon ein schlechtes Gewissen. Wozu dieser Leistungszwang? Andere Leute machten doch in ihrem Urlaub auch nicht weiß Gott was.
Und nach den Strapazen der letzten Tage musste ich mich erst mal wieder aufpäppeln. Es ging ja nicht nur um die letzten Tage, sagte ich mir dann. Die Wochen nach Tschernobyl hatten an meinen Nerven gezerrt. Auch das war noch nicht alles. Ich zwang mich, weiter zu denken, auch wenn es schmerzte. Der Störfall hatte etwas verdeckt, woran ich schon vorher fast zerbrochen wäre. Pacco … Nein, ich sollte mich jetzt nicht mit den Erinnerungen an ihn beschäftigen. Abrupt drehte ich mich um, wandte mich zur Tür.
Unten im Restaurant hatte ich eine Gruppe jüngerer Leute gesehen und ihre fröhlichen Stimmen drangen bis zu meinem Zimmer hoch. Ich fühlte mich zu sehr alleine, hatte Bedenken, hinunter zu gehen und mich zu den Leuten zu gesellen. Bedenken, dass mir dort mein Alleinsein noch bewusster würde, Angst vor dem Angestarrtwerden, Angst vor dem Ausgeschlossensein. Die Alternative wäre, mit bohrenden Fragen und brennenden Wunden konfrontiert im stillen Zimmer zu sitzen.
Entschlossen öffnete ich die Tür, raffte mich auf, nach unten zu gehen. Niemand starrte mich an, der Ober bediente mich freundlich. Und die Wirtin versicherte mir auf meine Frage, ob es gefährlich sei, in dieser Gegend alleine herumzuwandern: »Not at all!«
Wieder eine Nacht hatte ich gut überstanden. Es wurde tatsächlich kaum dunkel, höchstens dämmerig. Daran musste ich mich erst gewöhnen.