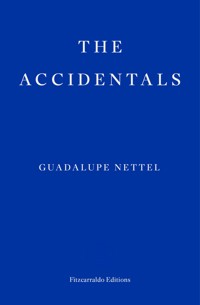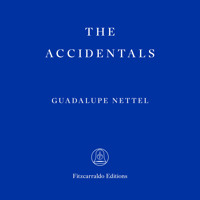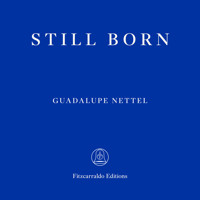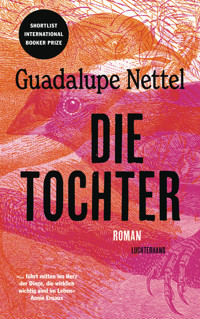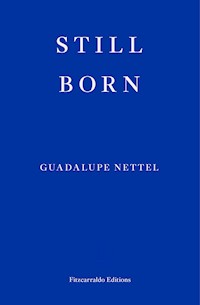19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Claudio ist Lektor in einem Verlag und lebt seit vielen Jahren in New York, nachdem ihn der tragische Verlust seiner ersten großen Liebe aus seiner Heimatstadt Havanna vertrieben hat. Cecilia studiert in Paris. Seit ihrer Kindheit in Mexiko hat sie ein besonderes Faible für Friedhöfe und liebt es, zwischen den Gräbern des Père-Lachaise spazieren zu gehen. Als Claudio und Cecilia sich über gemeinsame Freunde in Paris kennenlernen, verlieben sie sich ineinander, obwohl sie beide in andere Beziehungen verwickelt sind. Über die Distanz hinweg tauschen sie E-Mails, Gedanken, selbst zusammengestellte Musikcompilations aus. Doch als Cecilia nach New York fliegt, um Claudio zu besuchen, entwickelt sich ihre Beziehung ganz anders als erwartet ...
Auf intensive, manchmal humorvolle, manchmal beklemmende Weise beleuchtet Guadalupe Nettel die vorsichtige Annäherung ihrer Protagonisten und erschafft so ein tiefschürfendes Bild zweier Menschen, die sich nach Nähe sehnen, doch Schwierigkeiten haben, sich aufeinander einzulassen. Ein berührender Roman über die heilende Kraft der Liebe und die Chancen, die Enttäuschungen für die eigene Liebesfähigkeit sein können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Claudio ist Lektor in einem Verlag und lebt seit vielen Jahren in New York, nachdem ihn der tragische Verlust seiner ersten großen Liebe aus seiner Heimatstadt Havanna vertrieben hat. Cecilia studiert in Paris. Seit ihrer Kindheit in Mexiko hat sie ein besonderes Faible für Friedhöfe und liebt es, zwischen den Gräbern des Père-Lachaise spazieren zu gehen. Als Claudio und Cecilia sich über gemeinsame Freunde in Paris kennenlernen, verlieben sie sich ineinander, obwohl sie beide in andere Beziehungen verwickelt sind. Über die Distanz hinweg tauschen sie E-Mails, Gedanken, selbst zusammengestellte Musikcompilations aus. Doch als Cecilia nach New York fliegt, um Claudio zu besuchen, entwickelt sich ihre Beziehung ganz anders als erwartet …
Auf intensive, manchmal humorvolle, manchmal beklemmende Weise beleuchtet Guadalupe Nettel die vorsichtige Annäherung ihrer Protagonisten und erschafft so ein tiefschürfendes Bild zweier Menschen, die sich nach Nähe sehnen, doch Schwierigkeiten haben, sich aufeinander einzulassen. Ein berührender Roman über die heilende Kraft der Liebe und die Chancen, die Enttäuschungen für die eigene Liebesfähigkeit sein können.
Guadalupe Nettel, 1973 geboren in Mexico City, hat an der Universidad Nacional Autónoma Hispanistik studiert und an der École des Hautes Études in Paris promoviert. Sie arbeitete als Journalistin für verschiedene spanischsprachige Zeitschriften, ihr schriftstellerisches Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und in zehn Sprachen übersetzt. Nach dem Winter ist der erste Roman der Autorin, der auf Deutsch erscheint. Guadalupe Nettel lebt in Mexico City und ist Herausgeberin des renommierten Literaturmagazins La Revista de la Universidad de Mexico.
Roman
Aus dem Spanischen von
Carola Fischer
Blessing
Für Ian, in memoriam.
Und für meinen Vater, der so viel gekämpft hat.
Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme; l’Espoir,
Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique,
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.
Charles Baudelaire, Spleen, LXXVIII
Vögeln ist das Einzige, was sich die, die bald sterben werden, wünschen.
Roberto Bolaño, Der unerträgliche Gaucho
I
CLAUDIO
Meine Wohnung befindet sich in der siebenundachtzigsten Straße, Upper West Side, New York City. Ein steinerner Gang, der einer Gefängniszelle ähnelt. Pflanzen habe ich keine. Alles Lebendige löst ein unerklärliches Grauen in mir aus, so wie andere sich vor einem Spinnennetz fürchten. Lebendiges ist für mich eine Bedrohung, man muss sich darum kümmern, oder es stirbt. Kurz gesagt, es raubt mir Zeit und Aufmerksamkeit, und weder das eine noch das andere habe ich zu verschenken. Manchmal gelingt es mir, mich an dieser Stadt zu erfreuen, aber wenn man nicht aufpasst, kann sie einen wahnsinnig machen. Deshalb habe ich im Alltag eine Reihe strenger Regeln und Restriktionen eingeführt. Dazu gehört, dass mein Schlupfwinkel absolute Privatsphäre ist. Seit ich hier eingezogen bin, ist niemand außer mir über die Türschwelle getreten. Allein bei der Vorstellung, dass irgendjemand seinen Fuß auf diesen Boden setzen könnte, verliere ich die Fassung. Ich bin nicht immer stolz darauf, dass ich so bin, wie ich bin. Manchmal sehne ich mich nach einer Familie, nach einer stillen, zurückhaltenden Frau und einem – vorzugsweise stummen – Kind. In meiner ersten Woche hier habe ich mit allen Hausbewohnern – größtenteils Immigranten – gesprochen, um die Regeln deutlich zu machen. Ich bat sie, höflich, mit einem leicht drohenden Unterton, nach neun Uhr abends absolut keinen Lärm mehr zu machen. Um diese Zeit komme ich gewöhnlich von der Arbeit nach Hause. Bis jetzt wurde meine Anweisung befolgt. In den zwei Jahren, die ich nun in diesem Haus wohne, hat noch keine einzige Party stattgefunden. Aber meine Forderung bedeutet auch für mich selbst gewisse Verpflichtungen. So habe ich es mir zum Beispiel zur Regel gemacht, Musik ausschließlich über Kopfhörer zu hören und nur im Flüsterton zu telefonieren. Den Apparat habe ich auf lautlos gestellt, ebenso den Anrufbeantworter. Einmal am Tag höre ich auf niedrigster Lautstärke die Nachrichten ab. Das sind im Übrigen recht wenige. Die meisten Nachrichten hinterlässt Ruth, obwohl ich sie mehrmals gebeten habe, mich nicht mehr anzurufen, sondern zu warten, bis ich mich bei ihr melde.
Ich habe diese Wohnung aus gutem Grund gekauft: dem Preis. Als die Immobilienmaklerin während des ersten Besichtigungstermins die Summe nannte, spürte ich ein Kribbeln im Bauch: Endlich würde ich mir etwas in Manhattan leisten können. Allein die Angst, mich lächerlich zu machen – sie verlässt mich nie –, hielt mich davon ab, mir die Hände zu reiben, und so konzentrierte sich mein Glücksgefühl schließlich in meinen Eingeweiden. Über nichts kann ich mich mehr freuen als darüber, etwas Neues günstig zu erwerben. Erst als der Kauf abgeschlossen war, stellte ich leicht enttäuscht fest, dass die Wohnung kein Fenster zur Straße hin hat. Die einzigen beiden Fenster dürften ungefähr dreißig Quadratzentimeter groß sein und gehen auf eine Mauer hinaus.
Mir über diese Wohnung Gedanken zu machen ist mir zuwider, und dennoch tue ich es die ganze Zeit. Das ist genauso wie mit dieser Frau, die sich in mein Leben gedrängt hat, ohne dass ich es verhindern konnte. Ruth ist so wachsam und hartnäckig wie ein Reptil; droht mein Absatz sie zu zerquetschen, schafft sie es, zu entkommen und zu warten, bis ich sie wiedersehen will. Sobald meine Gelassenheit zurückkehrt, gleitet sie erneut auf mich zu, glatt und geschmeidig. Ruth intelligent zu nennen wäre übertrieben. Ihre Fähigkeiten sind, meiner bescheidenen Meinung nach, eher ihrem Überlebensinstinkt geschuldet. Es gibt Tiere, die in der Wüste existieren können, und zu dieser Spezies gehört auch sie. Wie ließe es sich sonst erklären, dass sie mich erträgt? Ruth ist fünfzehn Jahre älter als ich. Sie sieht immer so aus, als würde sie gleich anfangen zu weinen, und das verleiht ihr eine gewisse Anziehungskraft. Stilles Leid hat etwas Erhabenes. Die Falten, gemeinhin Krähenfüße genannt, verleihen ihr das Aussehen einer orthodoxen Ikone. Diese märtyrerhafte Aura ersetzt bei ihr die objektiv fehlende Schönheit. Einmal in der Woche gehen wir zusammen aus, meistens am Freitag. Wir gehen essen oder ins Kino. Ich übernachte in ihrer Wohnung, und wir vögeln bis zum Morgengrauen. Das bedeutet: Ich kann meinen Säbel schleifen und mein Wochenpensum an sexuellen Bedürfnissen befriedigen. Ich will die Vorzüge meiner Freundin gar nicht bestreiten. Sie ist attraktiv und elegant. Ein Spaziergang mit ihr grenzt schon fast an Prahlerei, als hätte man eine Schaufensterauslage untergehakt: Handtasche von Lagerfeld, Brille von Chanel. Kurz gesagt, sie hat Geld und Stil. Es versteht sich von selbst, dass so eine Frau einem in der Stadt, in der ich lebe, alle Türen öffnet. Sie ist wie ein Orisha, ein Gott der Santería, der alle Wege freiräumt. Nur dass sie so sehr Frau ist, das verzeihe ich ihr nicht. Es wäre mir unmöglich, mich öfter mit ihr zu treffen. Ich habe ihr schon häufiger erklärt, dass ich es nicht ertragen würde, mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Ruth sagt, dass sie das verstehe, und dennoch bleibt sie beharrlich. So sind die Frauen, sage ich mir und habe mich beinahe schon damit abgefunden, mein Leben mit einem Menschen zweiter Klasse zu teilen.
Jeden Morgen öffne ich die Augen, und wenn der Wecker um sechs Uhr klingelt, weiß ich nicht, wie lange ich schon aus dem Fenster schaue, als hätte ich nie etwas anderes getan. Die graue Mauer von gegenüber kann ich kaum erkennen, denn die Fensterscheibe ist mit einer Art Gitter gesichert. Ich vermute, früher hat hier ein Kind gewohnt oder ein Selbstmordgefährdeter. Ich habe die Angewohnheit, in Embryonalstellung auf meiner rechten Seite zu schlafen, sodass ich beim Aufwachen als Erstes dieses Fenster sehe, durch das zwar Licht fällt, aber vor dem kein einziges Bild auftaucht, abgesehen von dem der Mauerrisse, die ich bereits auswendig kenne. Durch die Glasscheibe dringt das Rauschen der Stadt. Einen Moment lang stelle ich mir vor, dass diese Mauer nicht da ist und ich von meinem Fenster aus die Menschen auf der Straße zur Arbeit oder zu Geschäftsterminen eilen sehe, wie sich windende Würmer in einem Goldfischglas. Dann bin ich dankbar, dass der Zufall eine Barriere zwischen meinem Körper und dem Chaos draußen errichtet hat, die mir beim Aufwachen das Gefühl gibt, sauber, abgeschottet und beschützt zu sein. Nur wenige Menschen entkommen dieser gleichförmigen Masse, deren hektisches Geschrei an meine Ohren dringt, nur wenige Menschen sind wirklich so klar, selbstständig, einfühlsam, unabhängig wie ich. Ein paar davon habe ich im Laufe meines Lebens über ihre Bücher kennengelernt. Da wäre zum Beispiel Theodor Adorno, mit dem ich mich stark identifiziere. Die gewöhnlichen Menschen haben Fehler, und es lohnt sich nicht, mit ihnen in Kontakt zu treten, es sei denn, es ergeben sich daraus Vorteile. Jeden Morgen, sobald der bedrohliche Lärm der Welt durch mein Fenster dringt, stelle ich mir dieselben Fragen: Wie schütze ich mich vor Ansteckung? Wie kann ich mich unter die Masse zu mischen, ohne von ihr korrumpiert zu werden? Wenn mir das bisher gelungen ist, dann aufgrund einer Reihe von Gewohnheiten, ohne die ich gar nicht auf die Straße gehen könnte. Jeden Tag führe ich eine Routine aus, die ich schon vor vielen Jahren entwickelt habe und auf die sich meine gesamte Existenz stützt. »Ausführen« ist eines meiner Lieblingswörter. Ein Beispiel: Wenn ich aus dem Bett steige, setze ich beide Fußsohlen gleichzeitig auf. So fühle ich mich sicher, unerschütterlich. Ich gehe sofort ins Bad und nehme eine kalte Dusche, um munter zu werden. Beim Abtrocknen achte ich darauf, die raue Seite des Handtuchs zu benutzen, und ich frottiere meine Haut, bis sie rot wird, denn das regt den Kreislauf an. Manchmal schaue ich unabsichtlich in den Spiegel – wodurch ich kostbare Sekunden verliere – und stelle mit Erschrecken fest, dass meine Brust, genau wie meine Arme und Beine, vollkommen behaart ist. Es gelingt mir nicht, mich mit dem hohen Prozentsatz an Animalischem abzufinden, der den menschlichen Körper ausmacht, Instinkte, Impulse, körperliche Bedürfnisse verdienen unsere ganze Verachtung, denke ich, während ich mich zur Darmentleerung auf die Toilette setze, die sich an einer strategisch günstigen Stelle befindet, wo keine Spiegel sind. Das Papier werfe ich nie in die Schüssel, allein bei der Vorstellung, dass die Toilette eines Tages verstopft, packt mich blankes Entsetzen. Jeden Morgen halte ich den Hebel der Spülung so lange mit einem Finger gedrückt, bis die Ausscheidung für immer im antiseptischen Strudel des vom Desinfektionsmittel blau gefärbten Wassers verschwunden ist. Meine Nahrung nehme ich schnell im Stehen zu mir, und zwar vor dem anderen Fenster, das, wie ich schon erwähnte, ebenfalls auf eine Mauer zeigt. Von hier blickt man auf das gegenüberliegende Gebäude, wo von Zeit zu Zeit ein Nachbar mit einem dämlichen Lächeln im Gesicht seine Balkonpflanzen gießt. Sobald dieser Nachbar auftaucht, verzichte ich lieber auf mein Frühstück, als das Risiko einzugehen, einen Gruß erwidern zu müssen. Wenn ich zulasse, dass meine Höflichkeit als Einladung verstanden wird, könnten die Nachbarn unter irgendeinem Vorwand bei mir vor der Tür stehen oder, schlimmer noch, mich um einen Gefallen bitten. Das ist wirklich bedauerlich, denn theoretisch scheint mir die Höflichkeit etwas sehr Schönes zu sein. Es gefällt mir, wenn fremde Menschen nett zu mir sind. Ich genieße das sehr und würde mich gern erkenntlich zeigen. Leider reagieren nicht alle Menschen auf die gleiche Weise. Höflichkeit kann auch die Tür zur Privatsphäre öffnen, und es versteht sich von selbst, dass die Schmarotzer in der Überzahl sind.
CECILIA
Es gab Zeiten in meinem Leben, da haben mir Gräber Schutz geboten. Als ich noch klein war, begann meine Mutter heimlich eine Beziehung mit einem verheirateten Mann, und wenn sie sich mit ihm treffen wollte, brachte sie mich zu meiner Großmutter. In Oaxaca, oder zumindest in meiner Familie, war es nicht gern gesehen, wenn die kleinen Kinder, noch bevor sie in die Grundschule kamen, zur Betreuung weggegeben wurden. Wenn die Mutter sich nicht selbst um das Kind kümmern konnte oder wollte, sollte sie ihre vierjährige Tochter tagsüber lieber bei den Schwiegereltern lassen, als sie in den Kindergarten zu schicken. Meine Großmutter lebte in einer alten Villa mit einem Innenhof und einem Springbrunnen. Dort wohnten auch die noch unverheirateten jüngeren Brüder meines Vaters. Meine Großmutter, die Hausmädchen und auch meine Onkel überschütteten mich mit Aufmerksamkeit, und deshalb machte mir die Abwesenheit meiner Mutter nicht allzu viel aus. Ich habe nur noch verschwommene Bilder dieser Zeit im Kopf, aber an ein paar Dinge erinnere ich mich gut. Zum Beispiel daran, dass die Küche sehr groß war und einen Holzofen hatte. Jeden Morgen schickte meine Großmutter das Mädchen auf den Markt, wo es Rohmilch für mich kaufen sollte, und wenn die Milch auf dem Herd überkochte, wurde es streng zurechtgewiesen. Im Hinterhof züchtete meine Großmutter Hühner, aber es war mir verboten, ihn zu betreten. Eines Morgens stand die Küchentür, die auf den Hof hinausging, offen, und ich schlich mich hinaus, um diesen Ort nach Belieben auszukundschaften. Eine Weile lief ich im Hof umher und achtete nicht auf die verängstigten Rufe meiner Verwandten, die im Haus nach mir suchten. Ich wollte noch nicht wieder hinein, deshalb versteckte ich mich hinter einem Pflaumenbaum, wo sich ein Erdhügel mit einem Kreuz erhob. Obwohl ich noch sehr jung war, begriff ich sofort, dass es sich dabei um ein Grab handeln musste. Ich hatte schon einige Gräber entlang der Landstraße gesehen und auch aus der Ferne, wenn wir im Auto am Friedhof vorbeifuhren. Aber sooft ich auch fragte, ich konnte nicht herausbekommen, wessen Überreste im Hof begraben waren. Meine Großmutter gab meinen Bitten, mir etwas darüber zu erzählen, nie nach, und schließlich wurde das Grab – wie es bei verbotenen Dingen häufig der Fall ist – für mich zu einer fixen Idee.
Am Ende jenes Jahres verließ uns meine Mutter und ging mit ihrem Geliebten in eine Stadt im Norden des Landes. Papá und ich zogen in das Haus meiner Großmutter. Ich wuchs mit dem Stigma auf, von meiner Mutter verlassen worden zu sein. Die einen verspotteten, die anderen behüteten mich deswegen allzu sehr. Um mich vor dem Urteil und dem Mitleid der Leute zu schützen, flüchtete ich mich in die Bücher der Schulbibliothek und in das Kino unseres Viertels, eines der wenigen, die es damals in der Stadt gab. So vergingen die Jahre. Ich erhielt Zutritt zu dem verbotenen Hinterhof, blieb stundenlang unter dem Pflaumenbaum sitzen und betrachtete den Grashügel. Insgeheim beschloss ich, den Hügel als das Grab meiner Mutter anzusehen. Wenn ich weinen musste oder allein sein wollte, kam ich an diesen Ort, wo die Hühner frei herumliefen. Hier setzte ich mich hin, um zu lesen oder Tagebuch zu schreiben. Und ich begann, mich auch für andere Grabstätten, auf dem Friedhof oder in Kirchgärten, zu interessieren. Am zweiten November, wenn die Familien ihrer Verstorbenen gedachten, bat ich meinen Vater, mit mir zum Friedhof zu fahren. Und mit der Zeit machten wir es uns zur Gewohnheit, dort jedes Jahr gemeinsam hinzugehen. Wenn man noch nie erleben musste, dass ein geliebter Mensch stirbt, fällt es leicht, sich für die Toten zu begeistern. Seit Mamá weggegangen war, hatte ich niemanden mehr verloren, der mir nahestand. Der Tod traf die anderen, und manchmal konnte ich ihn aus der Nähe betrachten, aber mit mir legte er sich nie an, zumindest nicht während meiner Kindheit und Jugend. Ich muss schon acht Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten Mal an einer Totenwache teilnahm. An diesem Nachmittag brachten meine Nachbarn eine schwarze Schleife an der Haustür an und ließen sie, wie es auf dem Dorf und in Kleinstädten üblich ist, offen stehen, damit jeder, der wollte, ihnen sein Beileid aussprechen konnte. Ich trat ins Haus und streifte im Zimmer umher, ohne dass mich jemand beachtete. Der Verstorbene war ein Greis, ein alter Patriarch, der schon seit mehreren Jahren an Alzheimer gelitten hatte. An diesem Tag begriff ich, dass sein Ableben den Angehörigen, auch wenn sie unendlich traurig waren, Erlösung und Befreiung gebracht hatte. Der Duft nach Kerzen, nach dem Kopal und den Chrysanthemen der Trauerkränze prägte sich mir für immer ein. Einige Jahre später – ich war etwa zwölf – kamen Zwillinge, Klassenkameraden von mir, auf der Rückreise aus dem Urlaub bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Als die Direktorin uns den Tod unserer Mitschüler mitteilte, bat sie uns, eine Schweigeminute einzulegen. Ich erinnere mich an das Entsetzen, das uns mehr als eine Woche lang nicht losließ, eine Mischung aus Mitleid und Angst um uns selbst: Das Leben war zerbrechlicher geworden, und die Welt war bedrohlicher, als es bisher den Anschein gehabt hatte. In dieser Zeit vermachte der Maler Francisco Toledo der Stadt seine Bibliothek, und in einem alten Klostergebäude, das überraschenderweise sehr gemütlich war, wurde ein Lesesaal eröffnet. Dieser Ort, nur wenige Häuserblocks entfernt, wurde zu meiner Zuflucht. Dort entdeckte ich die wichtigsten lateinamerikanischen Autoren, aber auch Übersetzungen aus anderen Sprachen, die meisten aus dem Französischen. Voller Eifer las ich Balzac und Chateaubriand, Théophile Gautier, Lautréamont, Huysmans und Guy de Maupassant. Mir gefielen die fantastischen Erzählungen und Romane, vor allem wenn ein Friedhof darin vorkam.
Mit ungefähr fünfzehn Jahren lernte ich eine Gruppe Jugendlicher kennen, die sich auf der Plaza de la Constitución traf. Ihre Kleidung unterschied sie von den anderen Bewohnern der Stadt: Sie war dunkel, verschlissen, mit Totenkopfmotiven bedruckt; sie trugen schwere Boots, schwarze Lederjacken. Auf den ersten Blick hatte ich nichts mit diesen Jugendlichen gemeinsam, außer dass ihr Lieblingstreffpunkt das Panteón San Miguel war. Ich nutzte die erste Gelegenheit, die sich mir bot, um dieser Gruppe zu beweisen, dass ich alle ihre Schlupfwinkel kannte. Der Hang dieser Jugendlichen zur Morbidität erinnerte mich an meine Lieblingsautoren. Ich fing an, ihnen von den Büchern zu berichten, die ich gelesen hatte, ich erzählte ihnen Geschichten von Erscheinungen und Gespenstern, und schließlich wurde auch ich ein Mitglied ihrer Gruppe. Durch sie lernte ich Tim Burton kennen und Philip K. Dick, in dessen Romane ich mich sofort verliebte, und auch andere Autoren wie Lobsang Rampa, für den ich mich aber nie richtig begeistern konnte. Mein Vater sah diesen Umgang gar nicht gern. Er hatte Angst, dass mich meine neuen Freunde mit einer bestimmten Art Literatur bekannt machen würden, mit Drogen und natürlich auch mit Sex, ein Gedanke, der ihn empörte, solange er nicht in einem institutionellen Rahmen wie der Ehe oder dem Bordell stattfand. Er schien nicht zu bemerken, dass ich extrem schüchtern war und meine Treue zu ihm stärker als jegliche Neugier oder Unabhängigkeitsbestrebungen. Das sexuelle Erwachen, ganz normal in diesem Alter, war für mich wie ein Tornado, den man aus der Ferne beobachtet. Mein Verhalten war alles andere als verführerisch und sicher nicht sexy. Der einzige Grund, warum ich an diesen Jugendlichen Interesse fand, waren die gemeinsamen spätnachmittäglichen Spaziergänge zwischen den Grabsteinen und die haarsträubenden Geschichten, die sie erzählten. Doch dann, es war etwa zur selben Zeit, verlor ich auf einmal das Interesse an dieser Welt, auch an den Romanen und meinen neuen Freunden. Hatte ich vorher wenig geredet, so flüchtete ich mich jetzt in eine Schweigsamkeit und allgemeine Apathie, die meine Familie noch mehr erschreckten als meine exzentrischen Bekannten. Statt das Ende meiner Pubertät abzuwarten, schickte mich mein von Zweifeln geplagter Vater zum Psychiater. Der Arzt empfahl mir, einige Monate lang eine Mischung aus Serotonin und Lithium einzunehmen, um die Chemie in meinem Gehirn wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ich begann also mit der Behandlung, aber mein Zustand verschlechterte sich zusehends: Ich blieb nicht nur weiterhin extrem verschlossen, sondern ich schlief überall, wo ich saß und stand, ein. Selbst der Arzt meinte, dass die Tabletten bei mir die gegenteilige Wirkung hätten, und ordnete Laboruntersuchungen an, deren Ergebnisse mein Vater glücklicherweise nicht sehr ernst nahm. Danach gingen wir nie wieder zum Arzt. Ich durfte so bleiben, wie ich war. Die Straßen von Oaxaca sind voller Geistesgestörter, die ungeniert Passanten ansprechen. Ein an Mutismus leidendes Mädchen konnte die Ehre der Familie nicht allzu sehr schmälern, solange es keusch und enthaltsam war. Anders als die Eltern vieler meiner Kommilitonen hatte mein Vater nichts gegen mein Literaturstudium – im Gegenteil. Er hatte es übernommen, mich an der Universität von Oaxaca für Französische Literaturwissenschaft einzuschreiben, und als ich das Studium mit Auszeichnung abschloss, half er mir, ein Stipendium für Paris zu bekommen. Der plötzliche Umgebungswechsel fiel mir nicht leicht. Bisher war ich immer von meiner Familie und meinen Lehrern beschützt worden. Alles, was ich über das Leben wusste, hatte ich aus Büchern gelernt und nicht auf der Straße, weder von meinen Gothic-Freunden noch auf dem Campus der Universität.
RUTH
Ich wurde Ruths Liebhaber, weil ich überzeugt davon war, in Sachen Liebe behindert zu sein. Anfangs gefiel sie mir nicht einmal. Es waren vor allem ihre Eleganz, ihre teuren Schuhe, ihr Duft nach Parfüm, die mich anzogen. Ich lernte Ruth bei einem Abendessen kennen, zu dem mich meine Freundin Beatriz, eine Schwedin, die zur gleichen Zeit nach New York emigriert war wie ich und die in zwei Galerien in Soho ausstellt, eingeladen hatte. Beatriz wohnt in einem Loft in Brooklyn, eingerichtet mit Siebziger-Jahre-Möbeln aus den Garagenverkäufen, zu denen sie regelmäßig geht. Vielleicht hatte ich an diesem Abend das Gefühl, dass etwas in der Luft lag, vielleicht war ich auch einfach nur besonders einsam, und dieser Umstand begünstigte, dass ich mich mit Leuten abgab, die ich normalerweise meide. Künstler scheinen mir generell frivole Menschen zu sein, deren einziges Interesse darin besteht, ihre Egos aneinander zu messen. Während des Essens sprachen sie fortwährend von ihren Projekten und wie sie die Anerkennung der Kritiker erlangen konnten. Unter den Gästen war auch Ruth, eine Frau über fünfzig, die sich damit begnügte, den anderen von einer Zimmerecke aus zuzuhören. Neben ihr saß ein Kakadu der besonderen Art, in schrillen Farben gekleidet und eine gelbe Brille auf der Nase, und beschrieb die neueste Ausstellung von Willy Cansino als Wunderwerk, das sämtliche lateinamerikanische Künstler aus Chelsea vor Neid erblassen ließe. Ruths Schweigsamkeit gefiel mir, und ich konnte darin nur eine Geste des Mitgefühls sehen: Ruth war erwachsener und gelassener als der Rest der Runde, sodass ich Lust bekam, mich zu ihr in diese Ecke zu setzen. Vor allem verspürte ich den Wunsch, an ihrer Seite zu schweigen, mich in ihrer Nähe auszuruhen, und genau das tat ich dann auch. Sobald die Frau mit der glänzenden Brille aufstand, um sich einen weiteren Whisky einzuschenken, war ich so unverschämt, mich auf ihren Platz zu setzen. Ich lächelte Ruth mit aufrichtiger Sympathie an, und für den restlichen Abend vermochte keine Menschenseele, nicht einmal meine Freundin Beatriz, mich von dort fortzulocken. Das war der Beginn unserer Liebesbeziehung. In ihren Gesichtszügen, die die Wunder der Kosmetik gut erhalten hatten, entdeckte ich eine faszinierende Müdigkeit. Ich erahnte – und ich denke, ich habe mich nicht getäuscht –, dass Ruth eine kraftlose Frau war. Ihre Anwesenheit war so leicht, dass sie nicht die geringste Bedrohung für mich darstellte. Mehr als eine Viertelstunde lang sah ich sie an, ohne ein Wort zu sagen, und anschließend versicherte ich ihr, ohne Umschweife und ohne mich ihr vorzustellen, dass ein Mund wie ihrer meine ganze Bewunderung verdiente, dass der Anblick eines solchen Mundes genügte, um für den Rest meines Lebens in Anbetung vor ihr niederzuknien. Ruth hat große, volle Lippen, aber das war es nicht, was mich an jenem Abend zu dieser Bemerkung veranlasste, und auch nicht der rote Lippenstift, sondern diese vollkommene Art zu schweigen. Ich fragte sie nach ihrer Telefonnummer. In der folgenden Woche, ich weiß nicht mehr, ob am Samstag oder Sonntag, lud ich sie ins Kino ein. Ein französischer Film, Herbstgeschichten von Eric Rohmer, ein Film, in dem nichts passiert, so wie in allen meinen Lieblingsfilmen. Es gab nicht viel zu sagen, als wir das Kino verließen, aber ich nutzte die Gelegenheit, um Ruth mit meinem Französisch zu beeindrucken. Sie hatte die Sprache in der Schule gelernt, aber nur wenig davon behalten. Ruth suchte die Bar in Tribeca aus, wo wir den einzigen Drink des Abends nahmen, einen ausgezeichneten Wein für fünfundvierzig Dollar das Glas. Mir gefiel, wie maßvoll Ruth alkoholische Getränke zu sich nahm. Die Frauen, die ich in dieser Stadt kennengelernt habe, tranken entweder gar nicht, oder sie überließen sich vollkommen dem Alkohol, was meist in sehr peinlichen Auftritten endete. Ruth hingegen trank fast immer nur ein Glas, allenfalls zwei, aber niemals mehr, und dieses Verhalten schien mir ein Beweis ihrer Vernunft zu sein. Sie bestand darauf zu bezahlen, und diese Großzügigkeit überzeugte mich nicht nur von ihrer Herzensgüte, sondern war auch verlockend, die schützende Aura reicher Frauen, an die ich mich nach und nach gewöhnt habe. Zwei Wochen später rief ich sie an, genug Zeit, um in ihr etwas Angst und Sehnsucht zu wecken. Im April werde ich immer romantisch und verführerisch; bei Ruth wandte ich meine wirksamste Methode an: eine wechselnde Mischung aus Gleichgültigkeit und Interesse, Zärtlichkeit und Verachtung, die die Frauen in die Knie zwingt. Diese unerschütterliche Frau blieb dennoch ruhig und resigniert. Anscheinend war es ihr gleich, ob ich den Drang verspürte, sie zu küssen, ob ich sie für frivol oder für reizlos hielt. Ihre Liebenswürdigkeit machte mich neugierig.
Einmal rief Ruth mich im Büro an. Ich war länger geblieben, weil ich noch ein Geschichtsbuch für die Oberstufe redigierte, und war inzwischen der Letzte im dreiundvierzigsten Stock. Ich nahm ihren Anruf mit Erleichterung entgegen, weil ich wusste, dass niemand mithörte. Sobald jemand in meiner Nähe ist, kann ich am Telefon kaum einen Satz sagen, ohne das Gefühl zu haben, der ganze Verlag würde gespannt mithören. An dem Tag genoss ich es, vollkommen allein auf dem Stockwerk zu sein, und setzte mich direkt vor die Fensterfront des Büros. Die Stadt gab schon ihr nächtliches Gemurmel von sich. Die Lichter von Manhattan lagen mir zu Füßen. Beim Anblick der Penn Station, deren Bau mir absolut vertraut ist, geriet ich ins Schwärmen, als ob ich nicht mit einer mir fast unbekannten Frau telefonierte, sondern der Stadt selbst ins Ohr flüsterte, dieser unpersönlichen Stadt, die ich für die Freiheit, die sie mir gibt, so liebe. Ich erzählte ihr von meinem Tag, wo und mit wem ich zu Mittag gegessen hatte und welches Buch ich gerade redigierte. Ich erwähnte das Fitnessstudio, in das ich nach der Arbeit gehe, und beschrieb ihr die Freude, die es mir bereitete, die Geschwindigkeit des Laufbands zu erhöhen.
»Wann sehen wir uns?«, fragte Ruth, und ihre rauchige Stimme holte mich wieder in die Realität zurück. New York lag mir gegenüber, aber da war noch jemand am anderen Ende der Leitung. Beinahe hätte ich den Hörer aufgelegt. »Möchtest du zum Abendessen kommen?«, hakte die Stimme nach. »Meine Kinder übernachten heute nicht zu Hause, wir wären ganz für uns.« Das Wort children hallte in meinen Ohren wider. Mich überraschte die Selbstverständlichkeit, mit der Ruth es aussprach. Diese Frau, die mir bis zu diesem Moment durchscheinend, zittrig vorgekommen war wie ein Blatt Seidenpapier, auf das man nur durchpausen, aber nicht schreiben oder malen konnte, offenbarte eine ganz unvermutete Seite. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass Ruth eine Geschichte, eine Familie, ein Leben haben könnte.
»Du hast mir gar nicht gesagt, dass du Kinder hast.«
»Ich sage es dir jetzt«, erwiderte sie so ruhig und gelassen wie immer.
Ich kam mit einem Wein für drei Dollar nach Tribeca, den meine einfühlsame Gastgeberin in die Speisekammer brachte und unauffällig gegen einen qualitativ besseren austauschte. Meine Flasche hat Ruth aufgehoben wie ein kostbares Andenken an jenen Besuch; sie steht neben den Weinen Saint-Émilion und Château de Lugagnac aus ihrem Keller.
Das erste Mal vögelte ich mit Ruth in ihrer Küche. Sie hatte sich auf Zehenspitzen gestellt, um irgendein Gewürz im Speiseschrank zu suchen. Ich hob ihren Seidenrock hoch und besorgte es ihr wie keiner zuvor, denn sie war noch nie mit einem Latino zusammen gewesen und erst recht nicht mit einem Mann, wie es sie nur auf der Insel gibt, wo ich geboren wurde. Mit ihren über fünfzig schreit Ruth noch wie eine Katze, wenn mein Schwanz ihre Eierstöcke durchrüttelt. An diesem Abend landeten wir schließlich unter pfirsichfarbenen Laken in ihrem Bett und schliefen zusammen ein. Am nächsten Morgen verließ ich lautlos ihre Wohnung und kam verschlafen und mit einer Alkoholfahne zur Arbeit. Keiner meiner Kollegen sagte etwas dazu. Sie kennen mich gut genug, um zu wissen, dass ich keine Indiskretion dulde. Doch auch wenn mir klar war, dass es im gesamten Büro nicht eine Menschenseele gab, die mein Vertrauen verdiente, hatte ich Lust, jemandem von meinem Abenteuer zu erzählen. Deshalb entschied ich in der Mittagspause, Mario anzurufen, meinen engsten Freund, der seit unserer Kindheit in El Cerro alles von mir weiß, nur von den jüngsten Ereignissen meines Lebens ahnte er nichts. Unser letztes Gespräch war mehr als ein Jahr her, und seitdem hatte keiner von uns beiden den Kontakt gesucht.
Als ich meine Geschichte zu Ende erzählt hatte, leidenschaftlich, beinahe romantisch, schwieg Mario, was ich als Zeichen des Respekts deutete. Wahrscheinlich wollte er meine Geschichte noch eine Weile auf sich wirken lassen.
»Die arme Frau«, stieß er schließlich mit leiser Stimme aus. »Was hat sie nur getan, dass sie dich verdient?«
Er meinte es vollkommen ernst.
Als ich den Hörer auflegte, wurde mir klar, warum wir uns voneinander distanziert hatten. Die Höflichkeit zwischen Mario und mir war von einer unerbittlichen Aufrichtigkeit zerquetscht worden. Wieder sah ich Ruth vor mir, an die Wand ihrer Speisekammer gelehnt, halb entblößt von meiner wilden Zärtlichkeit. Ich hatte wieder ihren Ausdruck der Verlassenheit vor Augen, den eines Menschen, dem es Vergnügen bereitet, sich einem anderen hinzugeben, auch wenn der ein Fremder war, die blonden Haare am Spülbecken, die Sommersprossen auf der Schulter. Dieser schlanke Körper, der sich auf vermeintlich unschuldige Weise erobern ließ, glich dem einer naiven Fünfzehnjährigen. Mir wurde übel, warum, weiß ich nicht. Einen Monat lang rief ich Ruth nicht mehr an.
PARIS
Das idyllische Paris, das Paris aus den Filmen, das der Tourist zu entdecken hofft, beginnt im Mai und dauert, mit etwas Glück, bis Anfang September. In diesen Monaten scheint die ganze Stadt entschlossen, eine Amnestie, eine Pause von ihrer Hysterie, ihrer Raserei zu machen. Es duftet nach Blumen, die Pariser trällern vergnügt ein Liedchen, wenn sie die Straße entlanggehen, Kellner und Kioskverkäufer sind freundlich, die gute Laune liegt in der Luft wie eine wohltuende Wolke. Ich kam zu dieser Zeit in die Stadt und verbrachte meine ersten Monate dort in einer Postkartenidylle. Mit fünfundzwanzig betrachtete ich glückliche Menschen mit einem gewissen Argwohn. Ich dachte, dass intelligente Menschen, die mutig genug waren, um sich der Realität zu stellen, im Leben nur tieftraurig sein konnten. Diese frühlingshafte Freude erschien mir nicht nur aufgesetzt, sondern enttäuschte mich auch. Ich hatte mein Land verlassen, um dem Gedudel der Leierkastenmänner von Oaxaca zu entkommen. Den mexikanischen Geräuschpegel fand ich bedrückend. Ich stellte mir Paris nicht als eine Stadt vor, in der sich unzählige Pärchen jeden Alters in Parks und auf Metro-Bahnsteigen küssten, sondern als einen regnerischen Ort, wo die Menschen Cioran und La Rochefoucauld lasen, während sie mit spitzen, sorgenvollen Lippen ihren Espresso ohne Milch und Zucker tranken. Wie viele andere Ausländer, die dann für immer bleiben, kam auch ich in der Absicht oder, besser gesagt, unter dem Vorwand, ein Postgraduiertenstudium zu absolvieren. Die französische Regierung hatte mir ein Stipendium gegeben, und ich hatte mich für ein Aufbaustudium im Bereich Literaturwissenschaft am Institut des Hautes Études de l’Amérique latine eingeschrieben. Es war Juni und Prüfungszeit, und die meisten Professoren waren nicht erreichbar, meiner auch nicht. Ich hatte keine Freunde in der Stadt. Von den vier Millionen Parisern kannte ich keinen einzigen. In meinem Adressbuch standen nur zwei Namen: David Dumoulin und Nicole Loeffler. Diese beiden, entfernte Bekannte meines Vaters und meiner Onkel, waren meine einzigen Anknüpfungspunkte. Obwohl ich es mehrmals versuchte, gelang es mir nicht, Scheu und Scham zu überwinden und sie anzurufen, um zu fragen, ob ich bei ihnen wohnen könne. Stattdessen war es mir lieber, mir in einem billigen Hotel in der Rue Saint-Jacques ein Zimmer mit einer jungen Rumänin zu teilen, die keine Sprache außer ihrer eigenen beherrschte.
Eines Nachmittags, als ich in der Warteschlange stand, um die Einschreibung an der Universität zu bezahlen, begann ich ein Gespräch mit einem Mädchen französisch-kubanischer Herkunft namens Haydée. Die Schlange war lang, und während wir vorrückten, nutzte Haydée die Zeit, um mir in atemberaubender Geschwindigkeit aus ihrem Leben zu erzählen. Sie erklärte mir, dass sie schon seit vier Jahren Visuelle Anthropologie studiere und ihre Doktorarbeit über religiöse Riten der Karibik schreiben wolle. Als ich ihr meine Lage geschildert hatte, bestand sie darauf, dass ich bei ihr wohnte. Obwohl ich sie kaum kannte, war mir Haydée bei Weitem lieber als die Rumänin. Wenigstens konnten wir uns unterhalten. Deshalb verließ ich noch am selben Nachmittag das Zimmer in dem kleinen Hotel in der Rue Saint-Jacques und zog in die Wohnung meiner neuen Freundin, die im sechsten Stock eines Altbaus im XVII. Arrondissement lag. In Paris ist die Wohnfläche sehr wichtig. Die Leute reden meist als Erstes über die Quadratmeterzahl ihres Zuhauses, bevor sie auf die Lage oder die Anzahl der Zimmer zu sprechen kommen. Die Wohnung, in der Haydée und ihr Freund lebten, hatte dreiundfünfzig Quadratmeter, die sich auf eine amerikanische Küche mit einem Tresen, der als Esszimmer diente, ein Wohnzimmer, ein kleines Zimmer und ein noch kleineres, ein Bad und einen Balkon verteilten. Haydée war ein herzlicher Mensch und eine Frohnatur. Von dem Nachmittag an, als ich mit fünf Koffern in ihrer Wohnung erschien, brachte sie mir eine übertriebene Liebenswürdigkeit entgegen, die mich anfangs verwirrte, bis ich irgendwann begriff, dass sie ein Ausdruck lateinamerikanischer Solidarität war. Nachdem ich dort eingezogen war, meinte ich meine Dankbarkeit am besten zeigen zu können, indem ich Haydées Leben so wenig wie möglich störte, mich unauffällig verhielt und selbstverständlich Geld zum Haushalt beisteuerte. In den ersten Tagen versuchte ich, zu anderen Uhrzeiten zu frühstücken und zu essen als Haydée und ihr Freund, aber das ließen sie nicht zu: Vor jedem Essen klopften sie an meine Tür, um mir zu sagen, dass ich mich zu ihnen setzen könne. Mit der Zeit war ich, allein aufgrund der Tatsache, dass ich dort wohnte, Teil ihres Beziehungsalltags. Es war genau das passiert, was ich, aus Rücksicht auf die anderen, hatte vermeiden wollen.
Der Freund von Haydée studierte Visuelle Kunst. Er hieß Rajeev und war in Indien geboren. Sie bewohnten gemeinsam das größere Zimmer und boten mir das Atelier an. Im Unterschied zu Haydée ging Rajeev nie auf Partys. Die Vorlesungen und Seminare an der Uni hatte er bereits abgeschlossen und versuchte nun, seine Magisterarbeit zu schreiben. Jeden Morgen verließ er so gegen sechs Uhr das Schlafzimmer, duschte und setzte sich sofort auf den Wohnzimmerteppich, um irgendein Atemritual zu vollführen. Sobald er damit fertig war, legte er Sitarmusik auf und bereitete einen Vanilletee zu, den er mehrere Minuten lang ziehen ließ und dessen Duft sich in der ganzen Wohnung verbreitete. Er öffnete sein Laptop auf dem Küchentresen und schrieb bis halb zehn, dann stand gewöhnlich Haydée auf.
Die meiste Zeit verbrachten wir beim Frühstück miteinander. Wir tranken den starken Tee von Rajeev und aßen dazu Baguette mit Marmelade, während Haydée uns von ihrer nächtlichen Tour durch die Bars der Stadt berichtete. Wenn Markttag war, nutzte Rajeev die Zeit, die seine Freundin mit Baden und Anziehen verbrachte, und ging einkaufen. Wenn er zurückkam, kochte er das Mittagessen. Die Gänge zum Markt, zur Post und zur Bibliothek waren die einzigen Gelegenheiten, bei denen Rajeev die Wohnung verließ. Gegen zwei ging Haydée aus dem Haus, und wir sahen sie den ganzen Nachmittag nicht mehr. Diese dreiundfünfzig Quadratmeter große Wohnung war ein guter Ort, um in der französischen Hauptstadt anzukommen, mich mit den Menschen, ihren Sitten und Gebräuchen vertraut zu machen. Wenn ich draußen war, kam mir die Stadt fremd und irgendwie bedrohlich vor. Einen Großteil meiner Zeit verbrachte ich mit bürokratischen Angelegenheiten, in der Präfektur und in der Universität. Meine Tage verliefen für gewöhnlich ruhig, und dennoch ließen mich Angst und Ungewissheit nachts nicht schlafen, und ich wälzte mich im Bett herum. Ich hörte Rajeev nebenan atmen, sehr viel ruhiger als am Morgen, den Straßenlärm, der mich aufschreckte, das Surren des Fahrstuhls … Haydée und ich waren sehr verschieden, und vielleicht haben wir uns gerade deswegen so gut verstanden. Trotz des großzügigen Angebots, bei ihr zu wohnen, wurden wir nicht gleich Freundinnen. Wir brauchten ein paar Wochen, um einander zu entdecken, aber als uns das gelungen war, fassten wir eine Zuneigung zueinander, die bis heute besteht. Ich erinnere mich an einen Nachmittag, als ich erschöpft nach Hause kam. Ich hatte den ganzen Tag lang Einwanderungsformalitäten erledigt und wollte mich gerade hinlegen, als Haydée fragte, ob sie hereinkommen dürfe. Ich dachte, sie suche etwas im Schreibtisch oder in ihren Studienmappen, und wenn sie mich im Bett sähe, würde sie nicht lange bleiben. Doch sobald sie im Zimmer war, setzte sie sich auf die Bettkante. Ganz offensichtlich hatte sie die Absicht, sich mit mir zu unterhalten. Sosehr ich es auch versuchte, es gelang mir nicht, ihr zuzuhören. Ihre Stimme schläferte mich ein, und ich hatte große Mühe, die Augen offen zu halten. Aber wer kann schon eine Kubanerin zum Schweigen bringen, die reden will? Bis heute kenne ich niemanden, dem das je gelungen wäre. Von diesem Nachmittag an wurden solche Gespräche zur Gewohnheit. Jedes Mal, wenn Haydée Lust zu reden hatte und ich die Zimmertür nicht rechtzeitig schloss, kam sie herein, um mir den Blödsinn zu erzählen, der ihr gerade durch den Kopf ging. Manche Gespräche waren interessant, andere überhaupt nicht. Letztendlich gewöhnte ich mich an ihre ungelegenen Besuche, ich verspürte sogar ein ehrliches Interesse an ihren Alltagsgeschichten.
Während ich in ihrer Wohnung lebte, nahm Haydée mich genau in Augenschein. Sie musterte meine Kleidung und meine Schuhe, als ob meine Art, mich anzuziehen, ein schwer entzifferbarer Code wäre. Nach ein paar Tagen wagte sie es, sich Gewissheit zu verschaffen, und fragte mich mit sichtlicher Ungeduld: »Sind deine fünf Koffer etwa voller Lumpen wie die da?« Ich war nicht beleidigt, mich überraschte mehr ihre Unverfrorenheit. Sofort bot sie an, mich in ein paar Geschäfte in der Nähe der Metrostation Alésia zu begleiten, wo ich Sachen finden würde, »in denen ich nicht wie ein Schulmädchen aussähe«. Ich nickte, denn ich wollte ihr nicht widersprechen, aber ich achtete darauf, dass es nie dazu kam. Im Gegensatz zu Haydée war mir Kleidung nicht wichtig. Für mich war und ist eine Hose nichts anderes als ein Stück Stoff und kein gesellschaftliches Statement. Aber Haydée beharrte, was das anging, sehr auf ihrer Meinung.
»Als Erstes musst du dir ein Fahrrad kaufen«, sagte sie eines Tages mit dem für sie typischen Taktgefühl. »Damit du deine ganzen überflüssigen Kilos loswirst.«
Bald wurde mir klar, dass diese Besessenheit vom eigenen Körper nicht allein Haydées Charakter zuzuschreiben war, sondern eine typisch französische Haltung darstellte. Die Werbeplakate in der Metro priesen unaufhörlich die schlanke Linie, ganz zu schweigen von den Zeitschriften, die an den Kiosken auslagen. Die gesamte Stadt schien die Schönheit zu kultivieren, als wäre das eine Frage von Leben oder Tod. Haydées Badezimmer zum Beispiel verriet viel darüber, wie die Werbung sich eines Teils ihres Gehirns bemächtigt hatte. Im Badezimmerschrank häuften sich die Schönheitsprodukte, die meisten dienten dazu, die Haut zu straffen. Vichy, Galénic, Decléor, sämtliche Marken, die es in den Apotheken der Stadt zu kaufen gab, standen auf ihren Regalen, und es war kein Platz mehr für weitere Flaschen. Jedes Mal, wenn ich mit dem Handtuch meine stämmigen Oberschenkel genau dort abtrocknete, wo sie ihren Körper mit diesen Luxuslotionen eincremte, fragte ich mich mit aufrichtiger Neugier, ob diese Produkte Wirkung zeigten und ob es sich lohnte, ein Vermögen dafür auszugeben.
Selbst wenn es so klingt, Haydée war keine oberflächliche Person. Sie las die Tageszeitungen und bildete sich eine Meinung zu Politik und Kunst. Unter diesem dichten Lockenkopf versteckten sich unzählige Fragen, über die sie gern laut nachdachte. Mit einem kubanischen Vater und einer marokkanisch-jüdischen Mutter französischer Staatsangehörigkeit, aber lateinamerikanischem Nachnamen fühlte Haydée Cisneros sich als Teil fast aller Kontroversen, die in dieser Stadt entbrannten. Nie habe ich jemanden kennengelernt, der schneller beleidigt war als sie. Sie konnte weder über das Embargo gegen Kuba noch die Konflikte in den banlieues oder den Krieg in Israel sprechen, ohne sich persönlich betroffen zu fühlen. Wenn die anderen Fidel Castro verteidigten, nahm sie das Exil und die Verfolgung der Intellektuellen und Schwulen auf sich, als wäre es ihr eigenes Schicksal. Sobald aber jemand Castro kritisierte, verteidigte sie vehement die Erfolge und Errungenschaften der Revolution im Bildungs- und Gesundheitsbereich, die, verglichen mit dem durchschnittlichen Niveau von Lateinamerika, unbestreitbar waren.
Nachdem ich lange darüber nachgedacht hatte, beschloss ich eines Tages, Haydées Rat zu befolgen, und kaufte in einem Laden in Saint-Michel ein Fahrrad. Aber ich wusste nicht, wie ich auf dem Rad nach Hause fahren sollte. Mit äußerster Anstrengung gelang es mir, das Rad zu tragen und damit in die RER zu steigen. Damals fürchtete ich nichts mehr, als mich zu verlaufen, deswegen ging ich in diesen ersten Monaten nie allein spazieren. Damit ich das Fahrrad benutzte, fing ich an, Haydée in die Bibliothek des Centre Georges Pompidou zu begleiten, wo sie höchstens zwei Stunden lang für ihre Prüfungen lernte. Den restlichen Nachmittag verbrachten wir in einem Café-Brasserie in der Rue Vieille du Temple mit Namen Le Progrès, das Haydée aber nur »der Kommunist« nannte. Hier traf sie sich jeden Tag mit den Kommilitonen ihres Instituts und allen anderen, die sie sehen wollten. Rasch gewöhnte ich mich an Haydées Tagesrhythmus und an ihr Leben, das so anders war, als meines gewesen wäre, hätte ich sie nicht kennengelernt.
Während ich bei ihr wohnte, nahm Haydée mich mit in einige Nachtklubs von Paris. Das waren Le Nouveau Casino, La Locomotive, das 9 Billards, das Satellit Café, die fast alle auf dem rechten Seine-Ufer lagen. Wir gingen immer erst spätnachts hin, nie vor zwei Uhr, wenn die meisten Bars zumachten. Mein Lieblingsklub hieß Le Bateau Phare. Das war ein in der Seine verankertes Schiff, auf der Höhe der Bibliothèque nationale de France, wo Jazz, Reggae und Latinomusik gespielt wurde. Dort fanden die besten Partys dieses Sommers statt, Kostümpartys, bei denen es galt, eine besonders exotische und humorvolle Verkleidung zu finden. Einige Gäste verkleideten sich als Transvestiten, andere wie die Jackson Five, mit Schlaghosen und Afroperücken; es gab auch Frauen mit Bananenröcken wie Josephine Baker. Wo wir auch hingingen, der Abend lief mehr oder weniger nach demselben Programm ab: Um reinzukommen, mussten wir zunächst in einer Schlange vor der Tür warten – etwa zwanzig bis sechzig Minuten –, anschließend gingen wir zur Garderobe, wo wir unsere superschwere Tasche abgaben, in der sich alles Mögliche befand, von Videokassetten und Schminkutensilien über Wechselkleidung bis hin zu einer Flasche, die meine Freundin gewöhnlich mit sich herumschleppte. Sobald wir drinnen waren, machten wir eine Runde durch den Laden und begrüßten alle, die wir kannten. Auf diese Weise erkundete Haydée das Terrain. Sobald diese Phase abgeschlossen war und einer ihrer Lieblingssongs lief, begab sie sich auf die Tanzfläche.