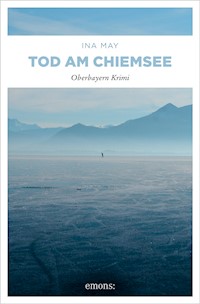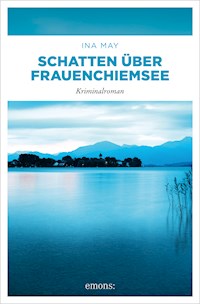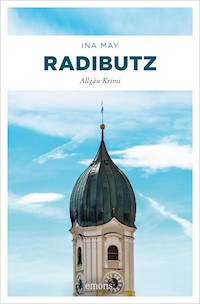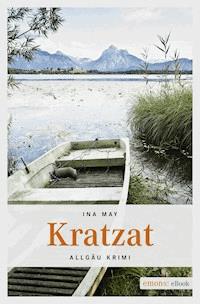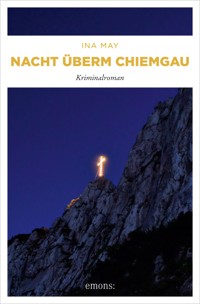
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Spritzig, witzig, giftig Der ehemaligen Kommissarin Juliane Leitermann bekommt der Ruhestand so gar nicht – um beschäftigt zu bleiben, hütet sie nun Häuser. Doch auch das ist ihr nicht genug, deshalb mischt sie sich in den Vermisstenfall ein, der die Region in Unruhe versetzt. Und plötzlich hat Juliane mehr zu tun, als ihr lieb ist: Ein verurteilter Mörder wird aus dem Gefängnis entlassen, und sie ahnt, dass er ihr auf den Fersen ist. Denn sie hat damals in seinem Fall ein Beweisstück unterschlagen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ina May wurde im Allgäu geboren und verbrachte einen Teil ihrer Jugend in San Antonio/Texas. Nach ihrer Rückkehr in die bayerische Heimat absolvierte sie ein Sprachenstudium und arbeitete als Fremdsprachen- und Handelskorrespondentin für amerikanische Konzerne. Heute ist sie freie Autorin und lebt mit ihrer Familie im Chiemgau.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Stefan Sassenrath
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Uta Rupprecht
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-548-0
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Geschichte schreiben ist eine Art,sich das Vergangene vom Halse zu schaffen.
Johann Wolfgang von Goethe
Erster Teil
Das Rätsel vor dem Tode
1
Des gähd af koa Kuahaut.Das übertrifft alles.
Der letzte Gedanke vor dem Einschlafen sollte sich nicht darum drehen, dass ein Mörder seine Strafe abgesessen hat.
Und der erste am Morgen besser nicht darum, dass ebenjener, nämlich Benno Seitlein, mir, der ehemaligen Kriminalkommissarin, die Hand an die Kehle legen könnte.
Ich hatte nicht den geringsten Zweifel, dass Benno ein zutiefst unglücklicher Mörder war. Einer, den ich nicht überführt hatte, weil er das selbst vollbrachte. Ich mochte nicht darüber nachdenken, dass sein Unglück ein Grund für Vergeltung an der damaligen Ermittlerin sein könnte.
Eine halbe Ewigkeit – gut fünfzehn Jahre – lag zwischen dem Damals und dem Heute. Ich hatte es nicht eilig damit gehabt, ihm die Tötung der Schwester zu beweisen. Großzügig überließ er mir die Spuren, doch mein Instinkt sagte mir, dass da etwas überhaupt nicht passte. Die gnadenlose Neugier, die ich sonst an den Tag legte, war Benno nicht zum Verhängnis geworden. Denn bis ich gewusst hatte, was nicht stimmte, war einige Zeit ins Land gegangen.
Im Grunde würde es keinen Sinn machen, wenn er sich rächen wollte. Doch was ein Mensch hinter Gittern erlebt hatte, konnte sein weiteres Leben bestimmen.
Und dieses Leben hatte jetzt begonnen …
Mein gegenwärtiges Problem war jedoch ein anderes – oder vielleicht auch keines: Ich hatte zugestimmt, für Maximilian Felder, der mit seiner Frau Mauritius bereisen wollte, das Haus zu hüten. Das Haus und einen Hund. Natürlich hätte ich fragen sollen, welcher Rasse. Ich hatte es nicht getan. Der Mann würde mir doch wohl kein Riesenviech überlassen wollen?
Juliane, du hast Ja gesagt, rief ich mir in Erinnerung.
Ich hatte schon öfter Ja gesagt und daraufhin auch einmal ein »Hä?« von meinem Enkel gehört, nämlich, als ich am Telefon verkündete, ich bräuchte eine Webseite. Seine Oma wolle ihre Dienste anbieten. Homesitting. Er wusste, was gemeint war, aber er wusste nicht, wie Oma das meinte.
Matthias das zu erklären hatte sich als zeitaufwendiger herausgestellt, als seinerzeit einen Verdächtigen zur Kooperation zu bewegen. Wie erklärte man einem Siebzehnjährigen, dass einem die Decke auf den Kopf fiel, man Handarbeiten nicht sonderlich mochte, Kaffee-und-Kuchen-Orgien auch keine Dauerlösung waren, die Nachbarn zu beobachten nach Observation aussah und die Zeit totzuschlagen sich eher nach einer Straftat anhörte?
»Ich möchte mich nützlich machen, und solange mein Hirn mitspielt, ich fabelhaft sehe, gut höre und noch immer schnell ziehe …« Er konnte mein Zwinkern nicht sehen, aber ich hörte ihn nach Luft schnappen.
»Omaaa! Du hast abgedankt, du bist über siebzig. Und du darfst keine Waffe mehr tragen.«
Er hatte mir mein Alter hingeworfen. Bengel!
Natürlich durfte eine ehemalige Kriminalkommissarin keine Waffe tragen. Ich trug auch keine. Ich hatte sie gut verwahrt, an einem Ort, an den ich jederzeit herankam.
Der nächste Hinweis meines Enkels war sogleich gefolgt. »Wir sind in Bayern. Homesitting ist total unbayerisch.«
Aber der richtige Begriff. Ich blieb anstelle einer Person, die etwas anderes vorhatte, zu Hause. In deren Zuhause. Ein Angebot zu einem fairen Preis.
Matthias fand meine Idee »ziemlich mutig«, und bevor ich mir noch ein paar Umschreibungen anhören musste, fragte ich ihn: »Hilfst du mir und kümmerst dich um meine Seite, oder ist dir das zu blöd und ich kann dich mal …?«
»Hm, wir denken ganz lässig. Ich. Und ich weiß auch schon, was da zu deiner Biografie stehen soll«, bekam ich zu hören.
Schließlich hieß es auf meiner Webseite:
Juliane Leitermann, eine bayerische Homesitterin – gewissenhaft, gründlich und verlässlich. Die Kriminalkommissarin a. D. kümmert sich um Ihr Anwesen, gerne auch um Ihre Haustiere und die Pflanzen.
Das Foto, das Oma in Bewegung zeigte und mich noch dazu ganz gut aussehen ließ, gefiel mir wirklich. Jugendlicher als über siebzig wirkte ich in jedem Fall.
Und in der Tat hatte ich Besseres zu tun bekommen, als mich mit dem Älterwerden auseinanderzusetzen und die Herrschaften auf dem nahen Friedhof heimzusuchen.
Mein erster Auftrag hatte mich in den Schwarzwald geführt, wo die Uhren tatsächlich anders gingen, danach machte ich mich in Salzburg nützlich. Ein wenig international.
Die Pflanzen hatten meine Fürsorge überlebt, Herr Pinkel nur knapp. Herr Pinkel war überhaupt nicht fein gewesen. Der Kater war verwöhnt, abgebrüht und hatte mir sein Hinterteil gezeigt, wenn er fand, ich hätte es verdient. Ich drohte ihm mit Diät. Herr Pinkel hatte zügig begriffen, dass ich am längeren Hebel saß.
Vielleicht war jetzt ich diejenige, die zu schnell geschossen hatte, weil mir der Ausblick von der breiten Terrasse der Felders auf die Burg Marquartstein so gut gefiel. Es gab kein Bild vom Hund.
Mit Maximilian Felder hatte ich vereinbart, dass ich heute am Spätnachmittag mein neues Quartier beziehen würde. Heute Abend würde für ihn und seine Frau der Flieger von München aus direkt zur Insel im Indischen Ozean starten.
Das Zeitfenster war knapp, fand ich, oder andersherum, Maximilian Felder war risikofreudig. Was, wenn ich zu dem Schluss kam, dass mir zwar das Heim, nicht aber der Hund sympathisch war?
»Wir kommen schon irgendwie zurecht«, sagte ich mir und wollte mir zu gern vertrauen. Wer da wohl risikofreudiger war?
Herr Pinkel hatte sich zunächst auch manierlich gezeigt. So etwas hatte fast gar nichts zu bedeuten, das wusste ich.
Jetzt sollte ich noch jemanden organisieren, der vierzehn Tage lang meinen Japanischen Schmuckfarn, eine silberweiße Schönheit mit dunkelblauem Mittelstreifen, gießen würde. Ich wollte nicht dran denken müssen, auch noch meinen eigenen Haushalt zu versorgen.
Der Jemand lief mir buchstäblich in die Arme, als ich mit meinem Koffer hantierte. Angelika, meine Nachbarin in der Hochplattenstraße, zwanzig Jahre jünger und allen Ernstes Schürzenkleidträgerin, winkte und wartete an meinem Gartentor.
Sie fand es »sooo spannend«, was ich machte. »Wohin geht’s diesmal?« Ein neugierig-fragendes Gesicht, die Unterlippe mit den Zähnen eingefangen. Dieser eindringliche Blick könnte es schaffen, eine Gießkanne leer zu saugen.
Sie erfuhr von mir nie, wohin es ging, ich bin eine ehemalige Kriminalkommissarin. Zu viel zu erzählen konnte einem das Genick brechen. Und das war nicht bloß die Erkenntnis des gesuchten Bankräubers, der seine Mutter anrief, sie müsse sich keine Sorgen machen, er sei für die nächsten Tage im Gartenhaus seines besten Freundes untergeschlüpft.
Angelika erzählte ich: »Nicht so weit diesmal, fast nur einen Steinwurf. Ich hoffe, das Wetter ist dort ein wenig besser.«
Soweit das Wetter keine zehn Kilometer weiter im Nachbarort Marquartstein besser sein konnte. Von dort aus sah ich auch auf den Hochgern, die Kampenwand und das Kaisergebirge. Obwohl, heute war es trüb, Wolkenberge am Himmel, die vor den Bergen hingen wie ein alter Vorhang. Allgemein schwenkte gerade der Spätsommer ein. Die Blätter an den Bäumen färbten sich so dezent wie ein betretener Halbwüchsiger nach einer Rüge.
Pflanzen! Fast hätte ich versäumt, sie zu fragen, es hätte mir leidgetan.
»Würdest du dich um mein Schmuckstück kümmern?«, erkundigte ich mich.
»Ach ja, Jos Geburtstag.« Angelika nickte wissend. »Soll ich ihm etwas bringen? Vielleicht Blumen? Das mache ich gern.«
Kurz senkte ich die Augen, wie hatte ich denn … meinen Mann vergessen können?
Kriminaloberrat Jo Leitermanns Lachen konnte ich freilich nicht hören. Meinen verstorbenen Ehemann hatte ich nie »mein Schmuckstück« genannt. Angelika dachte wahrscheinlich, ich wollte sie darum bitten, ihm ein Gesteck aufs Grab zu stellen.
Nein, wollte ich nicht. Jo bestimmt auch nicht.
Ich saß an seinem Geburtstag für gewöhnlich mit einer Decke im Gras neben der Grabumfassung, packte die Zigarillos aus und schenkte uns ein Glas Cognac ein. Wir tranken den Hennessy schon seit … Ich weiß nicht mehr, wie lange. Er war fast unbezahlbar gewesen, und umkippen, also verderben, sollte er nicht.
An diesem Geburtstag war ich vielleicht verhindert, aber das würde man sehen. Angelika sollte in jedem Fall glauben, ich wäre es.
Ich schüttelte den Kopf, flüsterte meiner Nachbarin ein leises »Danke, nein« zu und erklärte, der Farn auf meinem Wohnzimmerfensterbrett wäre dankbar, wenn man ihn nicht vergessen würde.
»Du hast doch mal in der Branche gearbeitet«, platzte Angelika plötzlich heraus, als ich im Begriff war, meine Tasche zum Koffer ins Auto zu hieven. In der Branche. Das klang ziemlich leichthin. Gerade eben hatte sich das Gespräch noch um »etwas oder nichts vergessen« gedreht. Was zum Teufel meinte sie?
Mein Schweigen verlangte jetzt wahrscheinlich, dass sie etwas sagte.
»Vor fünf Tagen ist doch diese nette junge Frau verschwunden.«
Als würde man sich kennen. »Hast du sie gekannt?«, fragte ich, gar nicht neugierig. Das war nie meine Branche, für Vermisstenfälle war ich nicht zuständig gewesen.
»Ich glaube, wir sind uns mal in der Eisdiele begegnet.«
Ah. Ich erwiderte nichts, ich hatte von dem Fall schon am ersten Tag erfahren, als ein Münchner Kollege anrief und allen Ernstes wissen wollte, wie das auf dem Land ginge, wenn jemand plötzlich weg war. Ich hatte ganz ernsthaft zurückgefragt, wie es denn in der Landeshauptstadt ginge. Ob man in der Stadt verschwand oder auf dem Land – vermisst wurde man überall.
»Anscheinend geht man jetzt davon aus, es könnte sich auch um ein Tötungs…dings handeln.«
»Um Totschlag oder Mord«, übersetzte ich. Erst mal handelte es sich aber um nichts in dieser Richtung. Es gab keine Leiche. Oder?
»Wer hätte gedacht, dass so was bei uns im Chiemgau passiert.« Ein Aufseufzen. Da klang Aufregung mit, aber ich konnte nicht unbedingt Anteilnahme heraushören.
Ich machte den Kofferraum zu. Bei uns im Chiemgau passierte so einiges, hätte ich ihr sagen können, ich war nämlich auch Zeitungsleserin und hörte die Regionalnachrichten im Radio. Und diese Meldung war heute rauf und runter gelaufen. Es tat mir leid, wie das immer so ist.
Opfer waren meist auch Täter. Zumindest musste das irgendjemand so sehen, nur so erklärte sich, wie eine Person für eine andere den Tod beschließen konnte.
Ich nahm das ein wenig persönlich, ich hatte Benno Seitlein vor Augen. Ein Münchner, der vielleicht beschlossen hatte, ins Chiemgau zu kommen, um sich die ehemalige Kommissarin vorzuknöpfen?
Gewappnet war ich nicht unbedingt. Ich sollte vielleicht …
Meine Waffe, an die ich jederzeit herankam. Hm. Sie war jedenfalls gut bewacht, bildete ich mir ein. Ich hatte sie in eine Dose gepackt und meinem Mann ans Herz gelegt.
Sollte ich sie mitnehmen? Daran hätte ich früher denken müssen, vielleicht letzte Nacht, denn auf dem Friedhof ließ man sich besser nicht dabei beobachten, wie man etwas ausgrub.
»Du fährst weg und kriegst womöglich den Schluss nicht mit. Wo kann Antonia Olberding sein, warum ist sie weggelaufen, oder ist da was passiert?«, spekulierte Angelika munter drauflos. »Da geht irgendwas Spanisches vor sich!« Mit wichtiger Miene hob sie den Zeigefinger.
Etwas kam ihr spanisch vor?
»Im Radio haben sie gebracht, dass Familie, Freunde, sogar ihr Arbeitgeber sich nicht vorstellen können, dass Antonia ohne ein Wort verschwindet. Tja, wäre da nicht …«, an dieser Stelle machte meine Nachbarin eine Sprechpause, sicher der Spannung wegen, »die Sache mit so einem Päder…dings. Dem hat man einige Fragen gestellt.«
Meine Nachbarin hatte sich verzettelt, und ich verzog das Gesicht. Sie wollte »Pädagoge« sagen. Warum bezeichnete sie ihn nicht als Lehrer?
Ich hatte es so gehört: Antonia trug alle möglichen Geschichten in und um Marquartstein zusammen, neue und alte. Konstantin Kohlschreiber, ihr ehemaliger Lehrer, half ihr bei den Recherchen. Es sollte ein »Heimatbuch« werden. Ob da jetzt noch etwas draus wurde?
Ich machte den Mund auf, aber Angelika übernahm auch noch den Abspann: »Das nimmt uns doch alle irgendwie mit. Stell dir vor, jemand will sogar einen Geist gesehen haben!« Sie schlug sich eine Hand vor den Mund.
Sicher auch das, vielleicht hatte er einen guten Grund für sein Auftauchen. Und wenn nicht, den Leuten würde schon einer einfallen.
»Du verpasst einen richtigen Krimi«, sagte Angelika.
Verpassen. Mein Termin. Maximilian Felder, Frau und Hund und Flieger.
Ich sollte mich ein wenig beeilen. Pünktlichkeit war meine Zier, denn der Kunstsammler war an eine ganz andere Verabredung gebunden.
Zehn Minuten später musterte er mich ausgiebig. Ich stand vor der Tür der Felders wie bestellt und nicht hereingebeten. Wolkig war es auch hier, ins gute Wetter war ich wirklich nicht gebraust.
»Ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen«, brummelte der auffällig herausgeputzte Mann in halblangen Hosen und einem Hemd, das er vorne andeutungsweise in die schmale Hose gestopft hatte und das ihm rücklings heraushing. Er strich sich die Frisur locker nach hinten. Mein Auftraggeber wollte doch nicht mit einer über Siebzigjährigen flirten? Wobei er mein Alter nicht kannte. Egal. Felder war knapp über vierzig.
»Gretel!« Ein befehlender Pfiff, dann zeigte er auf eine Stelle neben seinen Füßen, und ich hatte Mühe, ihm den Auftrag nicht genau dorthin zu werfen, wohin er gerade deutete.
Und ich hatte mir tatsächlich Gedanken gemacht, ob ich wohl den Hund sympathisch fand.
»Maximilian, lass doch den Unsinn«, sagte da eine Frauenstimme. Eine schlanke Hand streckte sich mir entgegen. »Ich bin Verona Felder.«
Seine Frau war eine schicke Mittdreißigerin. Angenehm, ganz anders als ihr Mann. Ich ergriff die dargebotene Hand.
»Schön, dass Sie sich kümmern«, begrüßte sie mich. »Unser Haus ist Ihr Haus. Ich zeige Ihnen gleich noch alles. Oh, und hier ist unsere Gretel.« Sie grinste, beugte sich hinunter und hob den Hund hoch.
Gretel war klein, ihr Fell einen Hauch apricotfarben – sie sah aus, als hätte jemand sie gestrickt. Ich wollte sie anfassen, ließ es bleiben und hörte mir an, dass die Hundedame munter und verspielt und noch einiges andere sei. Empfindlich, das hatte ich mir ungewollt gemerkt.
Es gab Katzen, die waren größer. Wie nannte sich die Rasse? Na ja, wenigstens kein Riesenvieh.
»Ich habe Ihnen einen Ortsplan hingelegt. Wenn es nötig ist, es gibt einige Hundetoiletten im Gemeindebereich.«
Der Herr des Hauses sah nicht aus, als würde er spaßen, und ich wollte nicht sagen, dass ich nicht wusste, wie ich mir eine Hundetoilette vorzustellen hatte. Ein Katzenklo – damit war ich, dank Herrn Pinkel, einigermaßen vertraut.
»Frau Leitermann braucht sicher keinen Ortsplan«, rügte Verona ihren Mann. »Frau Leitermann kommt aus Grassau.«
»Ein Plan kann nicht schaden«, sagte ich, und wäre es die Landeshauptstadt, in der ich für jemanden das Haus hütete, dann würde ich das tatsächlich auch meinen.
»Grassau ist anders strukturiert«, behauptete Maximilian, zuckte kurz mit den Schultern und lachte mich an. »Immer herein mit Ihnen. Diese Türsteherei macht ja einen blöden Eindruck.«
Wollte man die Nachbarn informieren, dann hatte die Türsteherei durchaus was. Fünf Minuten später war ich schon ins Wohnzimmer vorgedrungen, in den nächsten fünf hatte ich in Erfahrung gebracht, was Gretel speiste und welche Pflanzen es zu versorgen gab, und ganz zum Schluss – denn es eilte allmählich – zeigte man mir mein Zimmer. Die Wände in einem sanften Cremeton mit einem Blumenmuster, eine Handbreit unter der Decke in Blaugrau abgesetzt.
Die Flügel der Balkontür öffneten sich zum Wald am Hang mit Fichten und Laubbäumen, die sich über den Felsen festhielten.
Maximilian gönnte mir nur einen schnellen Blick auf das sich anschließende Bad. Stattdessen durfte ich ein wenig länger mein Barockbett bestaunen.
Im Alter trennten uns immer noch mehr als zweihundertfünfzig Jahre. Ich versagte mir, mich kurz zu setzen, um es zu prüfen. Vielleicht war es doch eine Nachbildung. Eine ungefähr einen Meter sechzig breite Liegefläche, das geschwungene Kopfteil in Graublau und Gold, auf das der morgendliche Blick leider nicht fallen würde. Schade, denn es war wirklich einen wert. Zwei dazu passende Nachtschränkchen. Pompös.
Schrank, Kommode und ein Schminktisch traten angesichts dessen in den Hintergrund. Gemeint ist, sie erschienen der Betrachterin dezenter. Jemand hatte unterschiedliche Stilrichtungen zusammengewürfelt. Schön, nicht schlicht. Ich würde mich vermutlich wohlfühlen.
»Gefällt’s Ihnen?«, fragte Verona, und ich nickte. Sie erklärte, die Putzfrau käme zwei Mal die Woche, und die Nachbarn seien informiert, dass eine ehemalige Kriminalkommissarin im Haus sein würde.
Ja, wenn das nicht interessant war. Mein Lächeln fiel wahrscheinlich eher mickrig aus. Aber Maximilian achtete nicht auf mich, der knuffte die Hundedame hinterm Ohr und verkündete: »Gretel, halt die Ohren steif, wir rufen an.«
Hatte ich komisch geschaut? Wahrscheinlich. Ausgerechnet das hatte er jetzt gesehen.
»Sie freut sich, wenn sie meine Stimme hört«, erklärte er überzeugt. »Wundern Sie sich also nicht, wenn ich eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlasse.«
»Wie schön«, erwiderte ich. »Und Ihre Sammlung?« Er hatte sie erwähnt, als wir telefonierten.
Maximilian schnippte mit den Fingern, zog die Hose am Bund hoch, machte kehrt. Ich trottete hinter dem Mann her, gefolgt von Verona und Gretel. Der stolze Hausherr schaute sich um und brachte mich dazu, es ebenfalls zu tun.
Sicherheitsglas über die Länge einer Wand, an deren Ende es seitlich blinkte. Dahinter waren kleine Rahmen angebracht, darin einzelne Buchseiten, wie es aussah. Unauffälliger hieße vermutlich sicherer.
Die Alarmanlage war scharf. Ich dachte an stürmische Zeiten und ein Gewitter und fragte, wie man sie ausbekam. Gretel und mir würden die Ohren wegfliegen, wenn das Ding loslegte.
»Den Code eingeben.« Er fummelte etwas mit den Fingern, dann hatte er es geschafft. »Der steht auf dem Aufkleber am Telefon. Einen Wachdienst gibt es nicht. Gretel ist unsere Versicherung«, sagte er schlicht.
Oje! Nicht der Gedanke, dass niemand ein wachsames Auge drauf hatte, sondern dass er tatsächlich davon ausging, der kleine Hund wäre abschreckend und könnte etwas ausrichten.
»Gut, dass Sie Kriminalpolizistin waren, denn es wurde schon versucht, einzubrechen, aber wo jetzt jeder weiß, dass Sie da sind …« Dieses Bewusstsein schien ihn freudig zu stimmen. Ich hätte gern eine Grimasse geschnitten.
Maximilian Felder hatte sämtliche Bekannte eingeweiht, aber ich verschwieg meiner Nachbarin Angelika, wohin ich fuhr.
Er wandte sich den eingekerkerten Seiten hinter Glas zu. »Hier geht es um …«
»Maximilian …« Veronas Ton klang eine Winzigkeit genervt.
»Ich weiß, was Sie hier ausstellen«, erwiderte ich, bevor er loslegen konnte. Exlibris. Ich habe Latein nie sonderlich gemocht. Es klingt mächtig, alt und schwer, wie eine Verantwortung, der man sich allzu bewusst wird. Aus den Büchern von … wem auch immer; der Stempel, die Zeichnung, das Initial dienten zur Kennzeichnung des Eigentümers. Interessant, schön anzuschauen, selten, oft eigenwillig.
Ein Sammler dachte vielleicht anders.
Tat es gut, zu wissen, dass man etwas Besonderes besaß? Etwas besonders Teures?
Kaufen war nicht direkt eine Kunst, fand ich. Aber gerade erinnerte ich mich mit einem Lächeln an einen, den ich nicht Verbrecher nennen wollte, weil er das irgendwie nicht war. Er malte Geldscheine. Das beherrschte er so perfekt, dass er damit seine Rechnungen im Café und im Restaurant bezahlen konnte. Und er war so ehrlich gewesen zu sagen: »Den hab ich gerade gemalt.« Meist war es nur mit einem Lächeln quittiert worden.
Ich schnitt die Erinnerung ab, nahm die schmale Glasfront ins Visier. Alles temperiert, es gebe eine Lüftung, ließ Maximilian mich wissen.
»Und sonst …?« Mit welchen plötzlichen oder handstreichartigen Ereignissen hatte ich außerdem zu rechnen? Ich wollte dem Mann nicht alles aus der Nase ziehen.
»Sonst nichts«, behauptete er, und ich sah Verona die Augen verdrehen.
»Sollte etwas Unvorhergesehenes sein, ich habe Ihnen den Namen und die Telefonnummer unseres Hotels aufgeschrieben«, sagte sie.
Maximilian achtete nicht auf seine Frau. »Sagen Sie, haben Ihre Kollegen Antonia schon irgendwo gefunden?«
Dazu hatte ich heute schon einmal den Mund aufgemacht. Ich wusste keine Einzelheiten zum Fall der verschwundenen Antonia Olberding, stattdessen hatte man von mir eine Antwort gewollt. Dabei hatte ich auch nur Zeitung gelesen und Radio gehört. Die Leute empörten sich, wie sie es immer taten, wenn sie keine Informationen hatten. Bevor ich mir etwas überlegt hatte, redete er schon weiter.
»Ich kann mir nicht denken, dass Konstantin etwas damit zu tun hat, aber gefragt haben ihn die Beamten.« Vage wies er ein Stück die Straße hinauf. »Wir sind seit Jahren Nachbarn«, erläuterte er.
»Maximilian.« Jetzt hatte Verona die Spur gewechselt. Sie klang richtig ungehalten.
Ich verschloss für einen Augenblick meine Ohren.
»Gefragt haben ihn die Beamten …« Mir fiel ein, dass es so vorher auch zwischen Angelika und mir über den Gartenzaun hin und her gegangen war. Antonia Olberding und die Sache mit so einem Päder…dings.
»Und bloß, weil sie zusammen an dem Heimatbuch arbeiten, also … Wenn wir wieder zurück sind, hat sich das sicher aufgelöst.«
Oder Schlimmeres, dachte ich und warf ein: »Ich will nicht hoffen, dass Antonia irgendwo gefunden wird.« Das würde Tragisches bedeuten, Unumkehrbares. »Sicher wird alles unternommen und jeder kleinsten Spur nachgegangen.« Wie oft hatte ich diese Worte schon gesagt. Nicht auf ein Verschwinden bezogen, sondern wenn es galt, einen Täter festzunageln. Wie oft hatten wir uns buchstäblich ein Bein ausgerissen. Wie oft hatten wir Ermittler feststellen müssen, dass nicht alles so war, wie es den Anschein hatte.
»Jetzt müssen Sie sich aber wirklich auf den Weg machen«, erklärte ich fest.
Was Verona und Maximilian schließlich taten. Die Türen des BMW klappten zu, ein Fenster fuhr herunter, Verona hob eine Hand, der Wagen rollte den Hügel hinab.
»Jetzt gibt es nur noch uns beide«, sagte ich zu Gretel. Das mit der Toilette würde ich sicher noch herausfinden.
Als ich die Tür hinter mir schloss, schien Gretel genauso erleichtert wie ich, wir seufzten beide auf, jede auf ihre Art. Der Geist, der angeblich gesehen worden war, hatte sich längst wieder aus meinen Gedanken geschlichen, und da war auch noch kein eigenartiges Gefühl, dass mir jemand auf den Fersen war …
2
Wer ko, der ko. Wer ned ko, mechad aa ganz gean.Wer kann, der kann. – Ein Stück bayerische Respektlosigkeit. Wer nicht kann, würde auch ganz gern. – Eine nicht nur bayerische Wahrheit.
Im Gasthof Eber läutete die Küche die letzte Runde ein. Wer noch etwas Warmes zu essen bestellen wollte, der musste es gleich tun, anschließend gab es nur noch eine kalte Platte, denn dann war die Küche verwaist.
An eine letzte Runde konnte Mini vielleicht in zwei Stunden denken.
Mini Meierhofer war mit zweiundsiebzig Jahren eine der dienstältesten Bedienungen. Sie war flink, hatte einen wachen Verstand, gehörte noch nicht zum alten Eisen und nahm sich Freiheiten.
»Ich glaub, es geht schon wieder los«, tönte Roland Kaiser dezent im Hintergrund.
Mini musste nichts glauben, denn der Sparkassen-Heini, wie Heinrich Zoller genannt wurde, hob die Hand. »Die Karten.« Er hatte nicht vor, etwas zu essen zu bestellen, das wusste Mini, der Heini orderte Spielkarten.
Mini verzog das Gesicht. »Herrschaften, spielts lieber ›Mensch ärgere Dich nicht‹ und macht dann das Gegenteil!«
»Minerva, dein feiner Humor ist uns immer einen Holundergeist wert.«
Wenn es mit dem Schnaps losging, war ihre Schätzung mit den zwei Stunden allerdings dahin. Wenn der liebe Herrgott den Herrn Pfarrer im Blick hatte – au, au, au. Karten und Hochprozentiges. Alois Kurzer nickte und machte eine Handbewegung, die »Fahr rüber« bedeutete.
»Pfff«, schnaubte sie. Auf sprechende Hände reagierte sie höchst allergisch, auf ihren vollständigen Vornamen auch – eine »Minerva« war sie nie gewesen.
Die maßgebenden, ganz wichtigen, alles bestimmenden »Fünf Marquartsteiner« fielen einmal die Woche im Gasthof Eber ein. Der Bürgermeister Rudolf Braune, dessen Frau nie mitkam, dafür aber seine Sekretärin. Der Pfarrer, der offiziell keine Frau zu haben hatte. Kurt Sacher, der Besitzer des »Autosalons«, dessen Angetraute Mitte zwanzig war und dessen Geschäft mehr sein wollte als ein simples Autohaus. Der Sparkassen-Heini, der sich nur bei seiner von ihm glücklich geschiedenen Frau gscheit verrechnet hatte. Und der Polizeihauptmeister der Inspektion Grassau, Patrick Eschenbach, der immer Block und Stift dabeihatte, weil er über Polizeiangelegenheiten offiziell nicht reden durfte.
Ganz harmlos hatte es angefangen. Es begann immer ganz harmlos, denn da waren ja die Frauen noch dabei. Bis sie sich dann verabschiedeten.
Die Männer hatten sich im Verlauf des Beisammenseins über so ungefähr jedes Thema ausgelassen, abgesehen von einem … Mini fiel auf, dass offenbar niemand über die Verschwundene reden wollte, Antonia Olberding wurde nicht erwähnt. Gab es einen Grund? Sie tippte sich auf die Lippe und ließ seufzend die Schultern fallen.
Einer verstand das als Hinweis. »Wir bleiben noch ein bisserl. Ältere Leute brauchen doch nicht mehr so viel Schlaf, heißt es.« Gemeint war zweifelsfrei sie, der Einwurf war von der Seite gekommen.
»Wen nennst du hier ein älteres Leut, Heini?« Mini schnappte sich eine Zeitung, rollte sie und zog sie dem schnippischen Sparkassendirektor über die Hinterkopfglatze.
Am Tisch amüsierte man sich.
Mini schickte sich an, sich um die lautlos erteilte Bestellung zu kümmern, und brachte ihnen auch die zwei Pakete zu jeweils zweiundfünfzig französischen Karten, denn die Herrschaften spielten Rommé.
Ein kluges, ein schwieriges Spiel. Vielleicht sah es für Mini auch nur so aus, weil sie es nicht verstand und weil die Regeln sich änderten? Weil die Spieler sie nach drei Schnäpsen jedes Mal anders auslegten. Da konnte man unmöglich noch mitkommen.
»Was ist mit der Antonia? Kurti, das Dirndl arbeitet doch bei dir. Weil gar niemand was dazu sagt, sag ich was«, verkündete der Bürgermeister.
»Du hast aber auch nichts gesagt«, gab der Autohändler Kurt Sacher zurück, der in der Runde Kurti genannt wurde. »Ich habe euch …«, er präzisierte, »ich hab Antonia und dich letzte Woche gesehen. Schaute vertraut aus.«
Mini sah, wie sich die breite Brust des Bürgermeisters hob. »Das war offiziell«, erwiderte er. »Fürs Heimatbuch.« Er legte den Kopf ein wenig schief, wartete.
»Du hast angefangen. Brauchst jetzt nicht empfindlich reagieren«, fand Kurt.
Eine heiße Kartoffel wäre ebenso schnell hinuntergefallen wie dieses Thema. Verdächtigen die sich gegenseitig, dass einer etwas angestellt hat?, argwöhnte Mini.
Der Gasthof Eber leerte sich allmählich, es blieben ihre »Marquartsteiner«, und die gaben sich ungewöhnlich leise. Sonst wurden die Karten auf den Tisch gepfeffert, heute legten die Spieler ihre Sequenzen unheimlich ruhig auf. Die Stimmung schien nicht bloß eine andere zu sein, sie war es.
Der Polizeihauptmeister legte einige Karten vor sich aus, schrieb dann etwas auf seinen Block und riss das Blatt ab.
Mini spürte die plötzlich eingetretene erwartungsvolle Spannung. Jeder versuchte, an den Zettel zu kommen, während der schlaue Polizist sich an einem der Kartenpakete zu schaffen machte. Er hatte vor, zu schummeln.
Auch Mini interessierte sich brennend dafür, was da auf dem Papier stand. Sie beugte sich zu einem der Fenster hinüber und öffnete es, dann nahm sie die Zeitung zu Hilfe und wedelte damit herum. Das Blatt segelte zu Boden, sie bückte sich danach. Da stand nur ein Satz. Mini schluckte.
»Was wird das?«, wollte der Sparkassen-Heini es genau wissen. Mini hatte keine Zeit, dem Mann ins Gesicht zu schauen. »Stoßlüften«, erklärte sie trocken, deponierte den Zettel wieder in der Tischmitte und legte die Zeitung zurück.
Wir finden wahrscheinlich bald eine Leiche.
Sie schloss das Fenster wieder. Vielleicht sollte sie sich hinsetzen. Vielleicht sollte sie sich auch einen Holundergeist einschenken. Weil du es ja unbedingt wissen wolltest!, schimpfte sie mit sich.
Mini ging hinter die Theke, achtete darauf, dass niemand sie sah, goss sich einen kleinen Schluck aus der großen Flasche ein und stürzte das brennende Gebräu hinunter. Dann holte sie tief Luft und ließ den Atem stoßweise wieder entweichen.
Und sie hatte geglaubt, dass nur die Meldung, Julianes Benno Seitlein sei auf freiem Fuß, ihr eine Gänsehaut bescheren konnte. Mini kam der spontane Gedanke, ihre Freundin anzurufen. Wenn es hier um eine Leiche ging, die bald gefunden würde, dann um die von Antonia Olberding. Und wenn man davon in der Polizeiinspektion Grassau wusste, hatte die ehemalige Kommissarin vielleicht mehr als bloß eine Ahnung.
Mini hatte stets ihr Notfallhandy dabei, auch wenn so ein Fall wohl nie eintreten würde, denn ihr Heimweg führte lediglich über die Straße und die Brücke, dann war sie im alten Teil von Marquartstein und schon ein paar Häuser weiter zu Hause.
Sie drapierte sich und ihr Dirndl auf dem Stuhl in der Damentoilette, zog das Telefon aus der versteckten Tasche des Kleids und wählte Juliane Leitermanns Nummer.
»Kannst du nicht schlafen? Es ist fast Mitternacht«, grummelte Juliane am anderen Ende, was hieß, Mini hatte sie wahrscheinlich aus dem Bett geholt.
»Ich bin noch im Eber«, beeilte sie sich zu sagen. »Die speziellen fünf sitzen beim Rommé und lesen nebenbei Polizeinachrichten. Mein Mund ist ganz trocken, und mir ist das Herz schwer.«
»Hast du getrunken?«, fragte Juliane. »Mädel, du hast noch nie was vertragen.«
Mini wiegte ihren Kopf hin und her. »Ja, ja.« Pause am anderen Ende.
»Ich zieh mich an. Gretel und ich kommen dich abholen«, vernahm sie dann.
Ein halber Schnaps, und Mini meinte, doppelt zu hören. »Mädel« nannte die Freundin, die einen Monat älter war, Mini schon seit der gemeinsamen Schulzeit. Aber wer war jetzt diese Gretel? Die Information war wahrscheinlich zu einem früheren Zeitpunkt an ihr vorbeigerannt. Hatte Juliane nicht etwas von einem neuen Auftrag erzählt?
»Guter Gedanke, glaub ich«, pflichtete ihr Mini bei. »Ich musste auch an dich und an deinen Mörder denken.«
»Ich will nicht an mich und meinen Mörder denken«, gab Juliane zurück. »Zehn Minuten … Ich kassiere gern deine Gäste ab, und du hältst dich aufrecht. Bis gleich.«
Juliane hatte die Verbindung unterbrochen, aber Mini schimpfte: »Aufrecht. Ich will bloß hier sitzen!«
Wieso war Juliane noch da, wenn sie einen Auftrag hatte? Mini schüttelte sich. Benno Seitlein – das war eine ganz eigene Gschicht, die sie sicher nicht im Detail kannte. Was sie wusste, war das Ende – eines jedenfalls. Das des Opfers.
Eine Frau saß im Englischen Garten in München an einen Baum gelehnt, auf ihrem Schoss ein aufgeschlagenes Buch, neben ihr eine Tasse mit Inhalt. Aufgefallen war sie, weil keine Hand die Fliegen zu verscheuchen versuchte und es komisch roch. Die Würgemale am Hals sah man erst, als man ihr den Pulli auszog. Wer sie war und vor allem, wessen Finger sich um ihre Kehle gelegt hatten, war lange nicht bekannt gewesen.
Benno Seitlein hatte mit der Kommissarin Schnitzeljagd gespielt. Die wollte die Hinweise einfach nicht verstehen. Als er fand, es reichte, ging er in die Ettstraße Nummer 2, ins Kriminalfachdezernat 6, ließ sich zu Juliane Leitermann bringen, streckte die Arme aus, legte die Handgelenke aneinander und sagte: »Ich bin Ihr Mann! Mein Name steht sogar vorne in dem Buch, das Sie bei der Toten im Englischen Garten gefunden haben.«
Mini hatte ihren eigenen Verdacht, warum sich die Festnahme von Seitlein so eigenartig in die Länge gezogen hatte, Juliane gegenüber nie ausgesprochen.
Draußen in der Gaststube wurde es jetzt lauter, Mini saß noch immer auf dem Stuhl in der Toilette.
»Minerva!«, rief jetzt jemand aus voller Brust.
Waren die zehn Minuten schon vorbei, war ihre Freundin mit Gretel – wer auch immer das war – schon da? Mini gönnte sich noch ein paar Sekunden, schaute in die Luft, wo ihr Blick nur auf die grünlich cremefarbenen Fliesen fiel, rief: »Gleeeich!« und drückte sich in die Höhe.
Beim Eintreten hielt Mini sich die Hand vor den Mund, um ein Gähnen zu verbergen. Die Herrschaften standen bereits an der Theke, die Brieftaschen gezückt. Sie hatten sogar ihren Tisch im Gastraum abgeräumt. »Wir haben heute keinen Kopf«, erklärte der Bürgermeister, ebendiesen schüttelnd. Es hörte sich entschuldigend an.
»Und was du für einen hast!«, hielt Mini dagegen. Nicht selten wollte er damit durch die Wand.
Der Pfarrer verkündete: »Wir müssen mit einer Hiobsbotschaft rechnen.«
»Wir, die Polizei. Dann erst folgt die Kirche«, präzisierte der Polizeihauptmeister.
»Zahlen bitte«, verlangte der Sparkassen-Heini.
Die fünf waren sich selten so einig wie an diesem Abend. Sie wirkten wie Verschwörer.
»Bezahlen heißt abschließen«, bemerkte jemand hinter ihr. Juliane streckte die Hand aus, eine Aufforderung an Mini, ihr die Geldtasche zu geben. Aber alle Blicke, auch Minis, richteten sich auf das Fellknäuel mit der Leine um den Hals, das da am Boden saß.
»Die Kriminalkommissarin außer Dienst«, stellte der Bürgermeister anstatt eines Grußes fest. »Die Beamtenbesoldung im öffentlichen Dienst war schon immer miserabel«, er lachte über seinen Witz, »aber dass es nicht für einen größeren gereicht hat …« Sein Zeigefinger und die Augen senkten sich in Richtung Hund.
»Größer«, Juliane grinste, tat, als würde sie am Gürtel ihrer Hose ziehen, bewegte die Hand in die Schrittmitte und klopfte mit den Fingern, »das ist immer so eine Sache, gell?«
Man verbiss sich das Lachen, nur der Pfarrer meinte: »Da hörst du’s«, worauf er sich sagen lassen musste: »Du kennst dich da gar nicht aus!«
»Ich hab doch bloß Spaß gemacht«, sagte der Bürgermeister, aber nicht an den betreten dreinschauenden Alois Kurzer, sondern an Juliane gewandt. »Das Hunderl schaut ganz nett aus. Ist ein Bichon Frisé, oder?«
Juliane lächelte komisch.
Über das Hunderl würde Mini sich hinterher Gedanken machen oder Juliane fragen, woher es so plötzlich kam. In ihrem Kopf herrschte wieder einigermaßen Ordnung, die Wirkung des halben Schnapses war in den Sog des Redeflusses dieser fünf geraten und mit ihm weggeschwemmt worden.
»Lasst den Spaß in der Tasche und eure Vermutung, dass etwas passieren wird, auch«, lautete ihre Empfehlung. Sie öffnete die Geldtasche und rechnete jedem vor, was er gegessen und getrunken hatte. Die Herrschaften zückten Geldscheine und Münzen und zogen von dannen.
»Lass schauen, um wie viel du dich betrogen hast«, sagte Juliane.
»Nein!«, gab Mini hitzig zurück. Dann musste sie lachen, über die Situation und über sich. Sie vergewisserte sich, dass die Kerzen auf den Tischen ausgepustet und die Fenster geschlossen waren, und streckte die Hand nach dem Schlüssel am Bord aus.
»Der kleine Kerl sieht müde aus. Den werden wir wohl tragen müssen?«, erkundigte sie sich.
»Ich habe Gretel den ganzen Weg getragen, sonst ergäbe die Strecke, multipliziert mit dem Hundetempo, eine ganze Tagesreise.« Juliane verdrehte die Augen, hob Gretel auf und drückte sie Mini in den Arm.
»Seit wann trinkst du bei der Arbeit?«, wollte sie erst wissen und erkundigte sich dann wie nebenbei: »Die Herrschaften haben sich heut doch nicht schlimmer benommen als sonst, oder?«
»Ach, die sind jedes Mal anders schlimm«, gab Mini zurück. »Ich trinke nicht bei der Arbeit. Es war nicht mal ein Glas Holundergeist, aber den hab ich wirklich gebraucht.« Und sie erzählte der Freundin von der Notiz.
»Es ist von einer Leiche die Rede? Ich rate jetzt nicht, wer davon angefangen hat«, sagte Juliane, »weil ich weiß, dass du dichthältst. Das tust du seit jeher.« Sie knuffte Mini, schaltete die Lichter aus, nahm ihr den Schlüssel ab und versperrte die Tür. Den Schlüssel versenkte sie in Minis Dirndltasche.
»Du traust dich, wo Benno Seitlein dir an der nächsten Ecke auflauern könnte …« Mini wandte den Kopf. »Tut er aber vielleicht gar nicht. Du hast erzählt, er sei ein schlauer Kerl. Dann ist er bestimmt inzwischen draufgekommen, dass du damals seinen Fall absichtlich verschleppt hast.« Jetzt hatte sie doch davon angefangen und Juliane ihren Verdacht geradewegs vor die Füße geworfen.
»Du solltest den Schnaps sein lassen«, erwiderte die. »Das wird sonst im Eselsgalopp zum Ortsgespräch, Minerva: Die Bedienung vom Eber schenkt sich ein.« Kein Lachen begleitete die Bemerkung, jedenfalls nicht Julianes. Mini fand, die Stimme ihrer Freundin hatte sich nachdenklich angehört. Juliane schwieg und fuhr dann fort: »Diesen fünfen hat heute offenbar etwas anständig die Lust am Zusammenhocken verhagelt. Deine heiteren Bemerkungen waren es sicher nicht. Warum könnte jemand denken, dass Antonia Olberding tot ist?«, überlegte sie.
Ein Warum, auf das Mini nicht den Ansatz einer Antwort wusste; sie glaubte allerdings auch nicht, dass Mord sich so einfach erklären ließ. Über die Familie Olberding ging im Dorf einiges herum.
»Der Großvater saß in der Irrenanstalt, der Vater benimmt sich seit dem Tod der Mutter recht komisch. Obendrein kann niemand sich vorstellen, dass Antonia den kleinen Bruder alleinlassen würde. Na ja, in mancher Familie gilt noch immer: ›Solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, tust du, was ich dir sage.‹ Wenn Antonia nicht so wollte wie ihr Vater, dann … wäre denkbar, dass etwas passiert ist.« Mini fügte hinzu, dass so etwas derzeit tatsächlich erzählt werde, hinter vorgehaltener Hand im Supermarkt.
»Das war einmal, mit den Füßen unterm Tisch«, kommentierte Juliane. »Gibt es das wirklich immer noch? Schauderhaft.«
Und ob. Eine Bedienung erfuhr so einiges. Eine Bedienung, deren Ehemann für das Heimatbuch so manche Geschicke und Geschichten zusammengetragen hatte, erfuhr noch mehr.
Das Informationsbedürfnis war groß, weil dieses »Dirndl« in der Runde fehlte und natürlich jemand die Schuld dafür bekommen musste.
Der Schatten der steinernen Brückenpfeiler fiel auf sie, unter ihnen rauschte der Fluss. Die Tiroler Ache fragte nicht danach, was ihr anvertraut wurde, aber sie hielt auch nicht dicht, sie reichte es weiter. Oder legte es irgendwo ab.
Mini hatte keine Lust darauf, sich Antonia Olberding tot zu denken. »Wohin müssen wir denn … Kann es sein, dass der auch mal muss?«, erkundigte sie sich. »Ein Bichon Frisé …« Sie schüttelte den Kopf, hielt den Hund zur näheren Betrachtung ein Stückchen von sich weg und meinte: »Was unser Bürgermeister alles weiß.«
»Hast du eine Ahnung, wie diese Hundetoiletten funktionieren?«, wollte Juliane wissen. Das schien eine ernsthafte Frage, ein dringendes Anliegen zu sein. »Ich weiß nicht, ob ich schon mal irgendwo eine gesehen hab«, ergänzte Juliane. Dabei ging es weniger ums Sehen, sie hatte schlicht keinen Schimmer, wie so etwas aussah.
»Schwierig, Juliane, wo ich doch hundlos glücklich bin.« Mini lachte. »Es sollten aber die moosgrünen Standrohre mit den Beuteln und den Abfallbehältern sein«, gab sie Auskunft. Vermutlich stimmte das auch. Wozu wären diese Teile sonst gut?
»Standrohre«, prustete Juliane. »Ich bring dich heim und muss noch ein kleines Stück weiter, ich wohne derzeit bei Verona und Maximilian Felder.«
Mini spitzte die Lippen, was Juliane nicht sehen konnte. »Du hast einen Auftrag in Marquartstein angenommen«, sagte sie. »Felder, das ist der Seltsame mit dem seltenen Geschmack, dem der Hund gehört, der nicht an der Leine laufen kann, weil du so rennst.«
Mini würde ihrem Ehemann den Tipp geben, über diesen Felder etwas herauszufinden, es lohnte vielleicht.
»Es ist spät, ich habe mir Gedanken gemacht, weil du am Telefon so aufgelöst klangst. Ich war schon im Bett, als du selbst angefangen hast, über seltsame Menschen zu reden. Maximilian Felder ist auf Mauritius, da kann er ganz ausgelassen seltsam sein.«
Irgendwo ging ein Fenster auf, und eine bissige Stimme rief: »Ruhe, sonst werf ich was.«
Mini schob den Hund unter einen Arm. Als wären sie wieder zehn, hielt sie Juliane den Mund zu, und Juliane hielt Mini den Mund zu. Unter den Händen tobte Gelächter.
»Entschuldigung!«, riefen sie dann einmütig zum Fenster hinauf.
Zwei Häuser weiter an der alten Dorfstraße öffnete sich eine Tür, ein älteres Semester im Schlafanzug streckte seine Hand aus.
»Spatzl, komm rein. Guten Abend, Juliane, noch so spät unterwegs?«
»Ich war grad eine Runde mit dem Hund spazieren«, sagte Juliane und schob Mini in Richtung Tür.
»Hund?«, fragte Loy Meierhofer, Minis geliebter Ehemann.
Mini küsste ihn, wirbelte herum und übergab das Fellknäuel an Juliane.
»Du könntest mich zum Kaffee einladen – morgen, auf dieser tollen Terrasse des Felder’schen Haushalts«, schlug sie ihr vor. Sie hörte Juliane etwas murmeln und vermutete, es könnte Zustimmung gewesen sein.
Die Freundin machte sich mit ihrer kleinen Gefährtin wieder auf den Weg.
3
Wenn ’s Lebn zuaschlogd, dann schlog zruck!Wenn das Leben zuschlägt, schlag zurück!
Mit ihrem schmalen Hinterteil saß Tessa halb auf dem großen Stein am Ufer der Tiroler Ache, den Kopf bis knapp über die Knie gesenkt. Sie überlegte nicht, ob es unbequem war. Wenn man erst nachdachte, dann wurde es das.
Am ersten Tag von Antonias Verschwinden hatte sie ernsthaft daran gedacht, richtig sauer zu werden. Sie waren Freundinnen, da sollte man meinen, eine winzige Nachricht zu tippen wäre nicht zu umständlich.
Am zweiten Tag hatte Antonias Vater Tessa mit rauer Stimme gefragt, ob sie etwas wisse. Denn wenn … »Ich mache mir ernsthafte Sorgen. Bitte. Auch wenn du versprochen hast, nichts zu sagen. Rede. Mit. Mir.« Es war keine richtige Drohung, weil Gerhard Olberding keine aussprach, aber der Tonfall ließ Tessa alles Fehlende ahnen. Das und seine Augen.
Er war nicht dazu gekommen, die Hand auszustrecken, denn sie hatte den Kopf geschüttelt, sich schnell weggedreht und ihre Schritte beschleunigt, ohne ihn noch einmal anzusehen.
Der Mann war ihr nicht geheuer; von Antonia wusste sie, dass es ihr hin und wieder auch so ging. »Mal wirbelt er herum wie ein Tornado, dann zieht er sich zurück und sagt wenig. Aber liebevoll kriegt er selten hin. Und wir brauchen ihn doch.«
Am dritten Tag wusste Tessa, dass nichts mehr so war wie vorher. Die Polizei hatte sich eingeschaltet, Antonias Verschwinden war offiziell geworden.
Am vierten Tag hatte die Polizei eine informatorische Befragung gestartet. Man sprach mit der Familie, mit Freunden – auch mit ihr –, mit Nachbarn und allen anderen, die mit Antonia zu tun hatten. Angeblich verschaffte man sich »einen allgemeinen Überblick«.
Noch hieß es nicht »zu tun gehabt hatten«, aber das konnte nicht mehr lange dauern.
Am fünften Tag, heute, spekulierten auch die überregionalen Sender über Antonias Verschwinden im schönsten, hintersten Winkel des Chiemgaus. Toll. Ein »Landei« hatte vielleicht das Weite gesucht? Es klang so, als glaubte man es.
Aber so war Antonia nicht! Dieses Landei hatte sich für ein Heimatbuch starkgemacht, ihre Freizeit geopfert … mit Konstantin Kohlschreiber gevögelt! Das wollte Tessa nicht denken, trotzdem blitzte es einen Moment zornig auf.
Antonia hatte mit vielen Leuten geredet, um Fotos gebeten, sich alte und neue Geschichten erzählen lassen. Sie war mitfühlend, sicher hatte sie auch einige Tränen getrocknet. Was ist mit deinen eigenen Tränen, weil Kohlschreiber dich glauben ließ, er liebt dich? Tessa biss sich auf die Lippe.
Es tat einfach weh, musste sie zugeben, darum die komischen Gedanken. Es tat weh, weil Antonia ihr so ein blödes Selfie geschickt hatte, auf dem der Lehrer sie im Arm hielt. Es tat weh, weil Tessa nicht einmal ahnte, ob Antonia zuletzt mit dem Lehrer zusammen gewesen sein könnte. Tessa hätte ihre Faust gern gegen etwas gerammt, aber Steine und Sand waren so was von unnachgiebig. Sie wusste nicht haarklein, wie Antonia fühlte, was die Freundin dachte, ob sie nun mit Kohlschreiber zusammen war oder es sich nur schön vorstellte.
Aber Tessa wusste genau, so etwas passte überhaupt nicht zu den Eigenwilligkeiten der Freundin, zu ihrem »Ich lache mir nur einen Mann mit einem tollen Auto an«. Und mit Autos kannte sie sich aus.
Dann verknallte sie sich in einen Lehrer, der einen Oldtimer fuhr. Wirklich toll!, dachte Tessa ätzend.
Wenn Antonias Smartphone gefunden würde … dann war sie nicht mehr am Leben, glaubte Tessa. Das Ding war so etwas wie Antonias Notizbuch, sie hatte damit Tonaufnahmen und Fotos gemacht, sie konnte es immer bei sich haben. Während das Notebook zu Hause aufgeklappt auf ihrem Schreibtisch lag – darin gab es sicher keine geheimen Ordner, schon wegen ihres Vaters nicht, der für alles eine Erklärung wollte und auf keinen Fall, dass im Ort über die Familie geredet wurde.
Ausgerechnet das Heimatbuch, in dem die Marquartsteiner ihrer Vergangenheit begegnen würden, diese gesammelten Geschichten, das war Antonias Sache. Tessa hatte sich nie vorstellen können, was daran spannend war. Sie war nicht neugierig gewesen.
Sie hätte es sein sollen.
Gefühlt hatte sie schon an jedem Fleckchen nachgeschaut, das ihr einfallen wollte. Sie suchte nach irgendeiner Spur. Tessa war zur Hütte am Agersgschwendt gelaufen, sogar zur kleinen Kapelle auf dem Schnappen. Die Freundin mochte die Legende, wie dort oben ein Hirsch während eines Unwetters in der Kapelle Zuflucht suchte, der Sturm die Tür zuschlug, das Tier gefangen war und an den Glockenseilen herumfraß, um nicht zu verhungern. Ein Jäger hörte das Läuten und befreite es.
Antonia saß gern auf einer Decke am Hang. Tessa hatte sich ebenfalls mit einer Decke dort oben hingesetzt, weit unter ihr schimmernd der Chiemsee. Aber kein Wunder, auch kein Jäger, der mit Antonia im Arm zwischen den Bäumen hervorkam. »Und wenn man glaubt, es geht nichts mehr …« Schon als Kinder hatten sie ihre Hände aufeinandergelegt und zusammen gerufen: »… kommt von irgendwo ein Lichtlein her.« Wo blieb denn das verdammte Lichtlein?
Mit zweiundzwanzig war man erwachsen. Zuerst fühlte es sich auch so an, aber etwa fünf Minuten später spitzte die Verantwortung um die Ecke und wollte wissen: »Hast du’s dir gut überlegt?«
Nicht immer, konnte Tessa von sich sagen, es fiel einem schon mal lästig, sich erklären zu müssen. Sich rausreden war vorgestern gewesen.
Tessa hätte von Antonia gesagt, sie sei diejenige, die das mit der Verantwortung weitgehend hinbekam, auch wenn sie hin und wieder über die Stränge schlug und sicher oft das Gegenteil von dem tat, was gut für sie war.
Sie war nicht nach Hause gekommen, sie war nicht zur Arbeit im Autosalon erschienen, sie antwortete nicht auf Nachrichten, sie war still, sie war …
Tessa schluckte. Auch wenn sie über eine endgültige Stille nicht nachdenken wollte, hatte sie jetzt doch absolut gar keine Idee mehr. Fünf Tage. Zu viele Stunden, um sie irgendwo schweigend zu verbringen.
Sie erzählten sich einiges. Tessa hatte immer gewusst, dass einiges längst nicht alles war, aber das war schon in Ordnung. Ein Geheimnis brauchte jeder.
Gerade fand sie es extrem scheiße! Über ihre Wangen rollten dicke Tränen, zitternd holte sie Luft, klaubte ein Taschentuch aus ihrer Hosentasche.
Heulen war keine Lösung – ihre eigenen Worte, wenn Antonia wieder einmal das Unglück nur für sich gepachtet hatte, wie Tessa fand.
»Wo steckst du?« Sie schickte den Blick in jede Himmelsrichtung, rundherum, als würde sich so die Antwort zeigen. Es dämmerte, das erste Stück Dunkelheit kam über den Himmel gekrochen. Tessa beugte sich nach unten, hob ein paar Steine auf und schleuderte sie aus dem Handgelenk in den Fluss. Sie sollte heimgehen.
Himmel, ich hab Angst, gestand sie sich.
Morgen war wieder Theaterprobe angesagt. »Die Hebamme« war ein lustiges Stück, aber lustig fiel ihr im Moment schwer.
Es gab noch einen, dem gar nicht spaßig zumute war: Antonias kleiner Bruder Stefan, Bazi genannt, weil er ein echter Schlingel war. Einer, den Tessa gern eingetauscht hätte, wie sie der Freundin einmal zwinkernd gesagt hatte, sie hatte bloß niemanden zum Tausch anbieten können. »Den geb ich nicht her!«, hatte Antonia erwidert.
Bazi war elf, Antonias Mutter hatte ihn mit achtunddreißig bekommen. Er war nicht vorgesehen gewesen, aber dann war er plötzlich da. Sie hatte so gestrahlt, Antonia hatte anfangs bloß gemurrt. Doch schließlich lenkte sie den Kinderwagen, und Tessa lief nebenher und sang für Bazi.
Stefan Olberding war ein Goldstück. Undenkbar, dass Antonia sich ohne eine Erklärung aus dem Staub gemacht hätte. Nicht, nachdem sie beide schon die Mutter vermissen mussten, die an einer schweren Grippe gestorben war.
Tessa ließ den unbequemen Felsen allein, klopfte sich die Hose ab, packte ihr Smartphone aus und schaltete die Taschenlampenfunktion ein. Sie hatte das Dunkelwerden übersehen und auch nicht auf den Akku geachtet, knapp fünfzehn Prozent; sie sollte sich beeilen und bekam doch keinen Fuß vor den anderen.
Erinnerung. So hieß doch alles, was vor dem Jetzt noch blieb. Tessa mochte das Wort nicht. Es passte zu ihrer Oma, nicht zu ihr, nicht zu dem, was sie und Antonia miteinander erlebt hatten. Wenn sie die Erinnerung nicht zuließ, gab sie damit das Erlebte verloren. Tessa zwickte sich. Zweiundzwanzig. Erwachsen. Verantwortungsvoll und soooo wütend.
»Weinen wir um die Wette.« Tessa hatte wieder Bazis Stimme im Ohr, als sie nach Antonia gesucht hatten und aufgeben mussten, weil die Nacht hereinbrach. Sie hatte ihm über die Wange gewischt, während ihr selbst die Augen schwammen und sie genau wusste, lange würde sie die Tränen nicht mehr zurückhalten können.
Bazis Vater war vor dem Elfjährigen wieder zurück gewesen, es brannte Licht im Haus. »Da drin wartet die Dunkelheit«, hatte Bazi angedeutet. So was sollte er nicht mal denken! Tessa hatte geschluckt. Wie es sich anfühlte, war sie noch immer mit Hinunterschlucken beschäftigt. Gerade würgte sie an einer unheimlichen Traurigkeit.
Sie verstand es nicht. Es musste einen Grund geben, zu verschwinden, und das musste ein verflucht guter Grund sein. Tessa blies gegen die Ponyfransen. Sie lief am Ufer entlang, nahm die kleine Erhöhung, wandte den Kopf und rannte, begleitet vom zuckenden Schein ihrer Handytaschenlampe, zum Ortsausgang Richtung Unterwössen. Sie nahm den Linksknick und bog auf die alte Dorfstraße.
Ein Hupen ließ sie zusammenfahren, ein Wagen stoppte auf ihrer Höhe, die Scheibe wurde heruntergefahren und eine meckernde Stimme schimpfte: »Das war knapp. Mit deiner Funzel übersieht man dich.«
Tessa richtete den Strahl direkt auf das Gesicht der Meckerfrau. »Ich bin jedenfalls kein Geist.«
4
Wer lang frogd, gäd lang irr.Wer lange fragt, geht lange irr.
Mini war in die Arme ihres Mannes gesunken, Gretel und ich hatten uns aufgemacht – hinauf auf unseren Hügel.
Ich ließ die Hundedame ein Stückchen laufen, dann knickte sie plötzlich ein. Als ich mich hinunterbückte, verdrehte Gretel ein wenig schwachsinnig die Augen. »Du mimst hier nicht die Erschöpfte.« Ich war gerade offenbar nicht die Überzeugungskraft in Person.
Gretel kippte zur Seite. Wollte sie mir sagen, Laufen auf kürzeren Beinen sei anstrengender?
Konnten Hundedamen in Ohnmacht fallen? Jetzt hör aber auf, ermahnte ich mich und kam mir richtig, richtig albern vor. Konnten Hundedamen so tun, als ob … aus Berechnung? Ich verzog den Mund.
Wahrscheinlich war Gretel nur hundemüde, genau wie ich. Ich hob sie auf und zockelte mit ihr weiter.
Gegenüber vom Wehrhaus führte der Weg den Hang hinauf. Der Fluss klang zu dieser späten Stunde nicht die Spur müde. Meine Lider dagegen waren schwer. Doch …
Es war ein Gefühl, das mir schauerartig über den Nacken huschte. Der Moment, in dem ich nicht länger allein war? Ich glaubte, im Schatten einen noch dunkleren Schatten gesehen zu haben. Ungebeten drängte sich Benno Seitlein in meine Gedanken. Mini war schuld, sie hatte mich angesteckt mit ihrem »Du traust dich, wo Benno Seitlein dir an der nächsten Ecke auflauern könnte …«. Als wäre eine Empfindung wirklich übertragbar wie eine Krankheit.
Gretel hatte ihren Kopf vertrauensvoll in meine Armbeuge geschmiegt, sie schien selig, gab keinen Laut von sich. Ich traute ihr nicht unbedingt Großartiges zu, aber sollte sie nicht wenigstens eine Gefahr wittern? Tat sie nicht.
Der Schein der Straßenbeleuchtung war orangefarben, wie sollte man da irgendetwas erkennen? Ich schaute hinter mich. Nichts. Ich lief ein paar Schritte weiter, drehte mich um. Nichts. In der spärlichen Helligkeit begegnete mir nur mein eigener Schatten, der sich auf dem Weg ausgestreckt hatte.
Gretel und ich erreichten die Felder’sche Haustür, der Bewegungsmelder sprang an, der war richtig hell, ich schaute noch einmal zurück. Baum und Strauch und Gras hielten sich ruhig. Konnte mich mein Gefühl, das ich einmal meinen Instinkt genannt hatte, wirklich so täuschen?
Dann hielt ich den Hund vor die Tastatur der Alarmanlage und stellte fest: Ich musste zuerst auf meinen Zettel schauen, natürlich kannte ich den Code nicht auswendig. Ein Griff in meine Jackentasche, das Aufklappen des Zettels. Himmel, hatte ich winzig geschrieben. Ich musste Gretel absetzen.
Wie viele Vertipper man sich leisten konnte, bis womöglich die Kavallerie anrückte, hatte ich Maximilian zu fragen vergessen. Ich leistete mir keinen, obwohl ich dabei mit einem Auge auf Gretel schielte.
Als ich endlich die Tür hinter uns zumachen und den Hund in sein Bettchen bringen konnte, fühlte es sich nach einem sehr langen Tag und einer unterbrochenen Nacht an.
Der Korb war unauffällig klein und das Stofftier darin größer als die Bewohnerin. Die Hundedame schlief mit einer Giraffe ein. »Gute Nacht, Kleine«, wünschte ich ihr.
Wach gerüttelt wurden wir beide, als ich jetzt die blinkende Anzeige des Anrufbeantworters registrierte und ganz automatisch die Taste drückte. »Hallooo, hier sind die Felders, wir sind gut angekommen. Gretel, sei anständig und mach uns keine Schande.«
Mein Gott! Während Gretel im Korb noch einmal hochschreckte, hämmerte ich auf das Gerät ein, dass es bitte wieder leise sein sollte. Der Hund schaute mich verdattert an, legte die Schnauze auf den Korbrand und sah beleidigt aus. Ich zuckte mit den Schultern.
Der Rest der Nacht sollte uns gehören.
»Ich werde deinem Herrchen nicht erzählen, dass du dich kein bisschen gefreut hast, seine Stimme zu hören«, erklärte ich.
Was mich darauf brachte, mein Telefon auszuschalten. Jetzt sollte niemand mehr etwas wollen.
Ungezählte Minuten später.
Ich hatte die nötigen Handgriffe vor der Nachtruhe schon samt und sonders hinter mich gebracht. Die Bettdecke war zurückgeschlagen. Ich schlüpfte aus den Sachen und in mein Baumwollnachthemd, schaltete die Lampe auf dem Nachtschränkchen ein und lief zur Tür, um sie einen Spalt aufzumachen – falls die Hundedame sich schlecht fühlte. Hoffentlich Unsinn.
Noch mehr Unsinn war, dass ich meinte, ich müsste einen Blick nach draußen werfen. Wirklich bloß einen Blick. Das Gästezimmer lag seitlich zum Garten hin, ich konnte über die Sträucher hinwegsehen, auf ein Stück Straße dahinter; der letzte Knick, bevor der Asphalt ungemütlicher, durch Kies und Sand ersetzt wurde und die Wander- und Radwege begannen.
Im Dunkel hinter dem Saum des Waldes rief irgendwo ein Käuzchen. War da auch eine Stimme? Ich hatte die Balkontür gekippt, was mir aber nicht verriet, woher die Stimme kam.
Einen Moment überlegte ich noch, ob ich wirklich nachschauen sollte. Im nächsten lief ich schon zum breiten Küchenfenster, das auf den Burgweg hinausging. Wer jetzt noch unterwegs war, hatte mit Sicherheit ein Geheimnis. Dieses teilten sich zwei, der nächtliche Schall trug weit.
Das wollte ich genauer wissen. Auf der Terrasse stand ich hoffentlich nicht auf dem Präsentierteller. Ich schlich hinaus, achtete darauf, mich kleiner zu machen, wagte kaum, laut zu schnaufen, und spitzte die Ohren, obwohl das nicht nötig war, solange ich mich nicht durch einen Laut verriet – oder Gretel das übernahm.
Eine junge Frau zog an einem vielleicht noch jüngeren Kerl. Einem Kind, wenn meine Augen und die Straßenlaterne nicht trogen. Entrüstet dachte ich daran, dass das doch nicht ging, in dem Alter gehörte man um die Zeit längst ins Bett.
»Bazi, überleg doch – sie ist bestimmt nicht bei ihm! Der Lehrer ist verheiratet, da kann man nicht machen, was man will und mit wem man es will. Nicht zu jeder Zeit.«
»Weiß ich doch, aber ich kriege schon die ganze Zeit ein Bild nicht aus dem Kopf.« Eine Tränenstimme, obwohl ich es nicht sehen konnte. Ich horchte und hoffte, sie würde ihn fragen, was für eins. »Was für ein Bild?«, kam es auch prompt. »Was sollen wir hier oben, mitten in der Nacht?«
»Kohlschreiber fährt einen Jaguar. James Bond hatte mal so einen, Antonia findet ihn edel.« Der Junge unterbrach sich, lachte kurz auf. »Das Auto. In Filmen liegt die Leiche im Kofferraum.«
Um Himmels willen, wie kam er denn darauf? Dieses Bild war zum Einschlafen wirklich alles andere als ganz großes Kino!
Ich schüttelte den Kopf und sah die junge Frau den ihren schütteln.
»Wir denken uns was aus, aber wir können nicht einfach irgendwo einbrechen – außer wir brechen ganz woanders ein.«
Der nachfolgende Vorschlag wurde geflüstert, ich konnte nicht hören, wo eingebrochen werden sollte. Aber es klang nicht nur so dahingesagt.
Seine Stimme war wieder lauter, als er fragte: »Sie ist nicht freiwillig weg, oder?« Er zog die Nase hoch. Ich hatte längst begonnen mitzufühlen.
»Antonia hätte sich gemeldet, ganz sicher. Da ist etwas passiert.« Sie war zu ihm so offen, wie sie konnte, dachte ich mir. Es ging um die Verschwundene.
»Wir finden es doch raus?«, wollte er wissen.
Seine Angst war mit Händen zu greifen.
»Und ob!«, lautete die Erwiderung. Ein Versprechen. Sie hatte sicher nicht weniger Angst. »Ich bring dich heim.«
»Lieber nicht, ich bin durchs Fenster.« Der Junge umarmte sie, rannte los, drehte sich im Laufen noch einmal um und winkte ihr zu.
Sie stand einige Augenblicke fast reglos da. Und dann, als hätte jemand sie aus der Erstarrung gerissen, schien sie wieder zu sich zu kommen, setzte sich in Bewegung, lief die Straße hinunter und verschwand schließlich aus meinem Blickfeld.
Etwas stupste mir ans Bein. Ich hielt mich an der Balustrade fest und schnappte nach Luft. »Gretel.« Erleichtert, zuerst. Schlief denn heute niemand, war jeder damit beschäftigt, einem anderen seine Begleitung anzubieten?
Ich ging wieder hinein.
Gretel folgte, sprang in ihren Korb und legte sich die Giraffe zurecht. Ihr Blick zu mir herüber konnte doch sicher kein Zwinkern sein?
Wieder ließ ich die Zimmertür einen Spaltbreit offen stehen und hoffte, Ruhe würde einkehren, draußen wie drinnen.
Ich ließ mich aufs Bett sinken und fragte mich, was dieses »Wir denken uns was aus« bedeuten mochte. Und vor allem, wo dieser Einbruch stattfinden sollte, wenn nicht beim Besitzer des James-Bond-Filmautos.
Ich war noch nicht so weit, ich wollte mir nichts ausdenken und zu gern glauben, dass ich mir den Schatten an den Rändern der Nacht vorhin wirklich eingebildet hatte. »Fürchten tu ich mich nicht!«, erklärte ich und zog mir die Decke bis zum Kinn.
»Gemütlich«, flüsterte ich frühmorgens vor mich hin, grinste und drehte mich noch einmal um. Etwas gab Laut. Unbekannt, nie gehört. Es wollte nicht aufhören.
Ich musste mich erst auf die Umgebung einstellen, ich war nicht zu Hause, ich war bei den Felders in Marquartstein, und der Laut war die Türklingel. Was wollte jemand um diese Zeit?
Gretel bellte, sauste den Gang entlang, schob meine Tür auf. Die Aufforderung war unmissverständlich: Raus aus den Federn!
»Wer ist denn so gemein?«, fragte ich sie ernsthaft.
Ich würde gleich auch denjenigen fragen, beschloss ich, schälte mich aus der Decke und trabte ungeachtet meines Aussehens zur Tür. Ich konnte öffnen, ohne den Code einzugeben.
»Minerva.« Ich wusste, ich hörte mich ungnädig an.
»Sei nicht so griesgrämig, sonst bin ich gleich wieder weg.« Ein Schwenk mit der Tüte in ihrer Hand. Eine Drohung?
»Du gehst nicht ans Telefon.« Ein Vorwurf? »Und ich hab was fürs Frühstück eingekauft.« Ein Köder? »Wer weiß denn schon, ob die Leute was im Kühlschrank haben.« Eine Tatsache.
Gretel legte den Kopf schief, erkannte offenbar die Frau von gestern, was mich zum Lachen brachte, denn ich steckte noch irgendwo im Vorgestern. »So früh sind die Läden schon auf?«
»Juliane.« Mini schaute mich an, als würde mir etwas fehlen. Die Zeit?
»Es ist Viertel nach neun, da hast du normalerweise längst gefrühstückt.« Sie schob sich an mir vorbei. Kopfschüttelnd. »Ich finde die Küche.«
Sie fand die Küche.
Die Sonne schien von einem klaren Himmel, der Herbst habe heute Altweibersommer-Temperaturen im Gepäck, sagte Mini, weshalb ich ihrem Drängen nachgab, für unser Frühstück auf der Terrasse zu decken. »Da schaut man so schön in die Welt hinein«, meinte sie. Irgendwie hatte sie recht.
Während ich mich frisch machte und anzog, werkelte Mini. Ich hörte das Radio laufen, das ich am Vortag gar nicht bemerkt hatte. Sie schimpfte mit dem Moderator, führte Selbstgespräche, und ich hörte sie lachen – ihr waren wahrscheinlich die Sammlerstücke aufgefallen, die alle irgendwo einen netten Platz gefunden hatten. Die hatte ich gestern tatsächlich auch schon bemerkt. Das Nudelholz war mir ins Auge gestochen. Womit rollte man eigentlich heutzutage den Teig? Ich wollte keinen rollen, ich musste das nicht wissen.
Als ich ein Kind war, hatte meine Mutter diese Gerätschaften benutzt, und heute gab es sie wieder. In Neu.
Ein fremder Haushalt war immer eine nervige Umstellung. Was man suchte, fand man erst, wenn man es nicht mehr suchte. Ich fand keine Tischdecke, dafür Servietten, Teller und Besteck und tat die Semmeln, die Mini mitgebracht hatte, in den kleinen Tischkorb. Brezen hatte sie auch dabei, und ich träumte von einer knusprigen Butterbreze.
»Kannst du uns Kaffee machen? Die Felders haben irgendwo so ein sauteures, hoch kompliziertes Gerät.« Ja, genau. Es war rot und stand direkt vor uns. Mini hatte an Kaffeebohnen gedacht. »Falls wir nicht wissen, wie das geht.« Sie hielt ein Päckchen Pfefferminzteebeutel in die Höhe. So unwahrscheinlich war das nicht.
»Wie sieht dein Plan für den Tag aus? Hast du einen?«, fragte mich Mini.
»Wie denn, wenn du mich aus dem Bett läutest?«, beklagte ich mich und lenkte ein, als sie lachte. »Ich weiß noch nicht, wahrscheinlich schauen Gretel und ich in den Ort«, sagte ich.
Die Hundedame hatte einen Plan, sie schob eine kleine Schüssel vor sich her – sie wünschte auch zu frühstücken. Verona hatte mir gezeigt, was und wie viel es für sie geben sollte.
»Goldig«, fand Mini.
Als der Hund versorgt war, begaben wir uns auf die Terrasse. Ich bekam den Kaffee hin – das Menü des Kaffeeautomaten gab die Anweisungen. Lesen konnte ich.
»Was sagen die Regionalnachrichten?« Die Frage stellte ich ungern, nur hatte ich heute noch keine gehört.