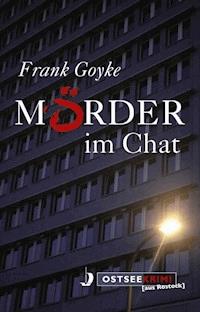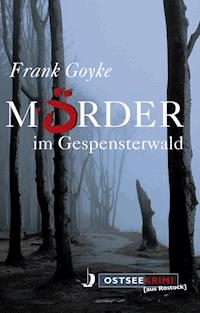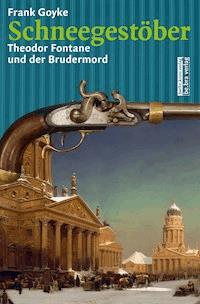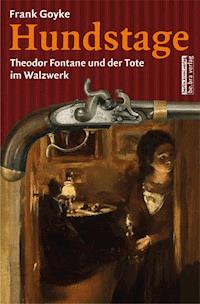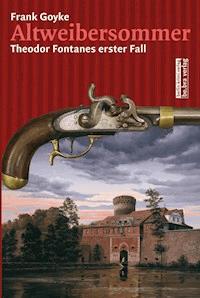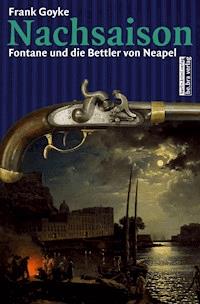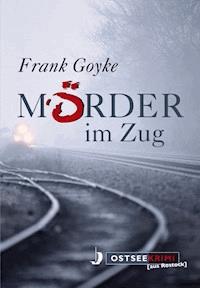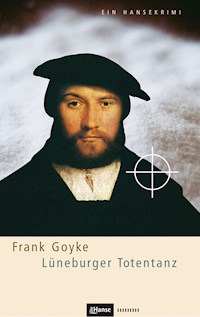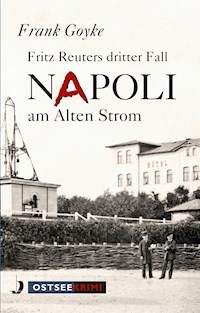
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hinstorff Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im dritten Fall von Fritz Reuter als Privatermittler wird der Leser in das Warnemünde von 1860 entführt. Im Zuge eines Umtrunks anlässlich der Verabschiedung des Universitätsprofessors Karl Türk kommt es zu einem Mordfall. Fritz Reuter nimmt die Ermittlungen im Milieu der Universität auf. Doch findet sich hier wirklich der Täter?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Goyke
Fritz Reuters dritter Fall
NAPOLI
am Alten Strom
Der dritte Fall des norddeutschen Schriftstellers Fritz Reuter – »Napoli am Alten Strom« – ist wie die beiden Vorgängerkrimis eine fiktive Geschichte. Viele der handelnden Personen haben zwar tatsächlich zu Reuters Zeiten in Warnemünde und Rostock gelebt, spielten jedoch wohl keine Rolle in einer »Criminal-Angelegenheit«. Einige Protagonisten, ihre Lebensumstände und Verwandtschaftsbeziehungen sind rein literarische Erfindungen. So hat es in Warnemünde tatsächlich einen Gasthof Burmeister gegeben (heutiges Hotel Am Alten Strom), aber der Reeder und der Privatdozent Burmeister sind erdachte Figuren und haben mit dem Hotelier gleichen Namens nichts zu tun.
Der Roman enthält Zitate aus dem »Radetzkymarsch« von Joseph Roth, aus »Der Gattopardo« von Giuseppe Tomasi di Lampedusa, aus »Garibaldi« von Émile Tersen, aus der Autobiografie »Aus meinem Leben« von Julius Wiggers sowie aus »Franz Ludwig Catel – Italienbilder der Romantik«. Da es sich um ein belletristisches Werk handelt, wurden die Zitate nicht gekennzeichnet.
Die Nachdichtung des Gedichtes von Giacomo Leopardi stammt vom Autor. Die Übersetzung der Textstellen von Lamartines »Graziella« nach der deutschen Ausgabe des Manesse-Verlags.
Dank gilt dem vom Museumsverein Warnemünde e.V. betriebenen Heimatmuseum Warnemünde für die Bereitstellung des Covermotivs sowie der historischen Karte Warnemündes.
Inhalt
Erstes Kapitel
Fritag, 22. Juni 1860
Zweites Kapitel
Sonnabend, 23. Juni 1860
Drittes Kapitel
Sonntag, 24. Juni 1860
Viertes Kapitel
Montag, 25. Juni 1860
Fünftes Kapitel
Dienstag, 26. Juni 1860
Sechstes Kapitel
Mittwoch, 27. Juni 1860
Siebentes Kapitel
Sonntag, 1. Juli 1860
Achtes Kapitel
Montag, 2. Juli 1860
Neuntes Kapitel
Mittwoch, 4. Juli 1860
Zehntes Kapitel
Donnerstag, 5. Juli 1860
Elftes Kapitel
Freitag, 6. Juli 1860
Zwölftes Kapitel
Sonntag, 8. Juli 1860
Dreizehntes Kapitel
Montag, 8. Juli 1860
Vierzehntes Kapitel
Mittwoch, 9. Juli 1860
Verzeichnis der wichtigsten existierenden und fiktiven Personen des Romans
Der Autor
Erstes Kapitel
Freitag, 22. Juni 1860
›Immer mehr dampfende Ungetüme drängen in unser Leben‹, dachte der Mann und verzog den Mund zu einem spöttischen Lächeln. Er hatte den Blick flussabwärts gerichtet, zur Mündung, aber weder sie noch das Meer, in das sich der recht breite Strom ergoss, konnte er sehen. Mit der Personenpost und der Eisenbahn war er von Dassow gekommen, dem Flecken an der Grenze zum Fürstentum Ratzeburg, wo sein Schwiegervater vom Ruhegeld lebte und immer hinfälliger wurde. Die Postwagen wurden dort noch von Pferden gezogen, die wieherten und Hafer fraßen, die Eisenbahnwaggons hingegen von Dampfrössern, die Kohle verzehrten. In einer illustrierten Zeitschrift hatte der Mann bereits Dampfmaschinen für die Chaussee gesehen; der menschliche Erfindergeist brütete immer wieder etwas Neues aus und nannte es Fortschritt.
Dieser Fortschritt ächzte und fauchte, er stieß Rauchschwaden aus und klapperte metallisch, auch auf der Warnow – hier in Gestalt des Raddampfers PHÖNIX. Der kam aus Warnemünde und befand sich gerade auf Höhe der Schiffswerft und Maschinenfabrik von Wilhelm Zeltz und Albrecht Tischbein, die von einer rauchenden Esse überragt wurde. Über das Wasser drang das Geräusch von Hämmern, die auf Metall niedersausten, denn auf der Werft wurden auch eiserne Dampfschiffe gebaut.
An der Koßfelderbrücke, einer Landungsbrücke am Hafen, warteten an die drei Dutzend Personen auf den Dampfer. Es handelte sich um Männer, Frauen und Kinder verschiedener Stände: Bürgerliche und Dienstboten, Kaufleute und Badegäste, Familien und Einzelpersonen. Die Kinder waren aufgeregt. So eine Dampferfahrt war nichts Alltägliches, vor allem nicht für Sprösslinge aus Gegenden, in denen die Landratten siedelten. Eine Familie, die zu Badeferien nach Warnemünde fuhr, stammte wohl aus Berlin – die Eltern und die Söhne von vielleicht sieben und neun Jahren bemühten sich um ein betontes Hochdeutsch, aber das Dienstmädchen, das sie begleitete, berlinerte so waschecht und laut, dass es die Aufmerksamkeit der Einheimischen auf sich zog. Auch diese beiden Knaben waren in ständiger Unruhe, obwohl es in der ungeliebten Hauptstadt des ungeliebten Preußens ebenfalls Dampferfahrten gab.
Etwas abgesondert von der wartenden Menge und näher an der Kaikante standen vier bürgerlich gekleidete Herren, bei denen es sich anscheinend um Freunde oder gute Bekannte handelte. Alle trugen dunkle Jacketts sowie Westen, die goldene Uhrketten zierten, wobei man der Wahrheit die Ehre geben muss: Jede dieser Ketten bestand aus vergoldetem Messing. Trotzdem machten sie etwas her. Außerdem hatten sie enge Hosen aus ebenfalls schwarzem oder grauem Tuch an, an den Füßen schwarze Schuhe oder Stiefelletten und auf dem Kopf schwarze Bowler, auch Melone genannt. Die Herren waren also durchaus gewählt, aber nicht zu elegant gekleidet, sodass sie nicht aus dem Rahmen fielen, denn auch andere Männer unter den Wartenden ähnelten ihnen in ihrem Aufzug.
»Wann warst du zum letzten Mal in Rostock, Fritz?«, fragte einer der Herren den neben ihm stehenden Mann, den er um Haupteslänge überragte. Auch er war schlank, während sich der Bauch des Kleineren beachtlich wölbte.
Fritz Reuter, ein Freund aus Studienzeiten, der es inzwischen zu einigem literarischen Ruhm gebracht hatte, schaute ihn von der Seite an. »Im vergangenen Jahr«, erwiderte er, »aber nur auf der Durchreise. Ich habe im Hotel Sonne übernachtet und nicht viel von der Stadt gesehen.«
Der größere und schlankere nickte. Reuter fand ihn vor der Zeit gealtert. Nicht nur war sein dünnes, über den Kopf gekämmtes Haar ergraut, sondern auch der Backenbart und der üppige, nach unten gezwirbelte Schnurrbart, der ihm ein melancholisches Aussehen verlieh. Aber war das ein Wunder? Julius Wiggers, inzwischen gewesener Theologieprofessor, hatte mehrere Jahre im Kerker verbracht, weil er angeblich an einer Verschwörung teilgenommen hatte; eine Anklage, über die man inzwischen in ganz Deutschland den Kopf schüttelte. Darüber hinaus hatte er seine bürgerliche Existenz verloren, schlug sich mit Artikelschreiberei durch und war doch noch nicht einmal 50 Jahre alt.
»Rostock und seine Industrien wachsen im Schneckentempo, aber sie wachsen«, bemerkte ein weiterer Herr aus der Gruppe. Es war der jüngere Bruder von Julius, der Advokat Moritz Wiggers, ebenfalls ein Opfer des Rostocker Hochverratsprozesses, der ihm viel Lebenszeit und den Beruf geraubt hatte. Auch er war, zumindest aus Reuters Perspektive, relativ hochgewachsen. Sein Haupthaar war nicht so licht wie das seines Bruders, wenn auch die hohe Denkerstirn und andere Attribute recht schnell erkennen ließen, das es sich um Geschwister handelte. Sein Schopf und der ebenfalls breite und dichte Schnurrbart waren noch schwarz, wenn sich auch bereits graue Strähnen zeigten.
»Man könnte es auch so ausdrücken«, sagte der vierte im Bunde, der ebenfalls ein Angeklagter und Verurteilter im Hochverratsprozess gewesen war. »Während die Universität sinkt, steigt die Industrie. Und seit wann sinkt die Universität, die bald im Tal der Bedeutungslosigkeit versunken sein wird? Seitdem sie allein dem Landesherrn untersteht. Und wem verdanken wir das allmähliche Steigen der Industrie? Dem bürgerlichen Gewerbefleiß. Nicht nur unsere Stadt, sondern unser Vaterland sinkt infolge der faulen Fürstenmacht und steigt durch den bürgerlichen Geist. Daraus ergibt sich leicht, was geschehen muss, damit es nur noch steigt.«
Reuter war überzeugt, dass diese kleine Rede nicht verbittert wirken sollte, und doch klang sie so. Auch dies kein Wunder: Der Mann, der gesprochen hatte, war Karl Türk, und seinetwegen hatte sich das Quartett überhaupt versammelt. Türk war viele Jahre ordentlicher Professor für Geschichte an der Universität gewesen, zuvor hatte er an der Juristischen Fakultät gelehrt. Reuter, der inzwischen selbst zugab, ein Bummelstudent gewesen zu sein, hatte in den Jahren 1831 und 32 bei ihm Vorlesungen in Juristischer Enzyklopädie gehört, wobei die in seinem Geist hinterlassenen Spuren nicht sehr tief gewesen waren. Karl Türk war der älteste der Anwesenden. Die Jahre im Gefängnis mussten ohne Zweifel schrecklich gewesen sein, vor allem die Ungewissheiten der jahrelangen Untersuchungshaft in Bützow. Viel tiefer getroffen hatte auch ihn das unwiderrufliche Ende der Karriere. Der leidenschaftliche Hochschullehrer war nicht nur aus dem Universitätsdienst entlassen, ihm war auch die Pension gestrichen worden.
Seitdem ist er ein toter Mann, hatte Julius Wiggers in einem Brief an Reuter geschrieben. Äußerlich lebendig, aber innerlich vernichtet!
Professor Türk sah in Rostock keine Zukunft mehr und würde die Stadt demnächst verlassen, um zu seinem Sohn nach Lübeck zu ziehen. Noch einmal wollte er einen Kreis von Freunden um sich scharen, um Lebewohl zu sagen. Reuter stand also eine traurige Abschiedsfeier bevor, zum Glück war es aber keine Totenfeier. Wobei – nach Wiggers’ Worten zu urteilen, in gewisser Weise doch. Zu allem Überfluss befanden sich auch die beiden Brüder unter einem finsteren Himmel, hatten sie doch am 4. Mai, also vor etwa sechs Wochen, ihren Vater verloren, der an jenem Tag im 83. Lebensjahr verstorben war. Dies war zweifellos ein beachtliches Alter, aber der Tod kam fast immer zu früh.
Der Raddampfer schickte sich an, am Kai des Rostocker Hafens anzulegen. Das Klappern der Maschine war ohrenbetäubend.
»Das Geräusch des PHÖNIX ist allen Warnemünder Badegästen wohlbekannt«, meinte Moritz Wiggers mit einem Schmunzeln. »Sie schwören Stein und Bein, der Dampfer würde ›Tellerlecker, Tellerlecker‹ sagen – oder vielmehr scheppern.«
Drei Dutzend Passagiere verließen das Schiff. Einige von ihnen mochten die erwähnten Badegäste sein, die sich die Hansestadt anschauen wollten: Bei ihnen trugen die Männer häufig helle Jacketts und Hüte, die Frauen Sommerkleider und die Kinder weiße Kleidchen; Strohhüte zeigten, dass man sich nonchalant gab. Aber es waren auch Männer dabei, die offenbar Geschäfte in Rostock hatten und die auf das seriöse Schwarz nicht verzichten mochten. Zwei von ihnen, die wie Kaufleute oder Ratsherren aussahen, trugen sogar Zylinder. In wenigen Minuten war der Dampfer von Reisenden entblößt. Der Einstieg begann.
Reuter und seine Freunde gingen als Letzte über die Planke. Der Dampfer gab ein langgezogenes Signal von sich, Reuter schaute auf die Uhr. In zwei Minuten würde es 2½ sein. Halb drei sollte der PHÖNIX den Hafen verlassen. Und tatsächlich, die Planke wurde eingezogen, und pünktlich nahm der »Tellerlecker« Kurs auf Warnemünde.
Der Warnemünder Landungssteg des Dampfers befand sich unmittelbar gegenüber der Vogtei. Auf dem Platz vor diesem steinernen Zeichen für die Herrschaft Rostocks über den Seeort standen zwei lange hölzerne Tische, umgeben von Klappstühlen. Zwei Stellwände aus Latten teilten den Bereich nicht nur von der Nachbarschaft ab, sondern schützten auch vor Wind. Reuter wusste noch aus seiner Studienzeit, dass der Vogt für die Badegäste nicht nur ein Logis, sondern auch eine offene Wirtstafel unterhielt, allerdings war das Mittagessen längst vorbei. Die Bedienungen hatten schon die Tischtücher entfernt und begannen, die Stühle auf die Tische zu stellen, während ein einzelner Mann am Rande saß und auf jemanden zu warten schien.
Zwei Matrosen legten die Planke aus, die ersten Reisenden gingen von Bord, der Mann erhob sich. Er war nicht sehr groß und hatte die leicht gebückte Körperhaltung jener Menschen, die entweder an einer Erkrankung der Wirbelsäule leiden oder sich häufig über etwas beugen müssen, etwa wie der Uhrmacher über seine Arbeit oder ein Gelehrter über seinen Schreibtisch. Letzteres schien den Nagel auf den Kopf zu treffen, denn Reuters Begleiter schienen ihn zu kennen.
»Was macht denn Doktor Burmeister hier?«, fragte Julius.
»Auch er möchte mich verabschieden«, sagte Türk, bevor er die Planke betrat. Vielleicht täuschte sich Reuter, aber er glaubte, einen säuerlichen Unterton zu vernehmen.
Doktor Burmeister kam näher. Angetan war er mit einem längst aus der Mode gekommenen Gehrock, einem hochgeschlossenen grauen Zweireiher. Seine Hose, ebenfalls grau, aber etwas heller, war mit schwarzen Streifen versehen, die schwarzen Lackschuhe sahen staubig aus. Reuter empfand die ganze Erscheinung als irgendwie staubig – oder besser wohl als glanzlos. Sowohl den umgebundenen weißen Kragen als auch den verwaschenen Binder, den graumelierten Backenbart, das kaum vorhandene Haupthaar, sogar den Blick aus seinen grauen Augen. Burmeister hatte den Hut abgenommen und den Gehstock mit dem vergilbten Elfenbeingriff unter den Arm geklemmt. So begrüßte er zunächst Professor Türk und dann die Übrigen. Er wurde Reuter vorgestellt, und Reuter ihm. Burmeister war Historiker wie Türk und hatte eine Stelle als Privatdozent an der Universität inne.
Türk übernahm die Führung, wofür es keiner überragenden strategischen oder taktischen Fähigkeiten bedurfte, da Warnemünde nur über zwei Häuserreihen verfügte und man sich vom Landungssteg entweder nach links oder nach rechts wenden konnte – der durch angeblichen Machtmissbrauch seiner Stellung enthobene Professor ging nach links. Er lenkte seine und damit die Schritte der kleinen Festgesellschaft dem Rostocker Enn entgegen, wie man die Häuserzeile am Südende des Ortes nannte.
Dort befand sich das Etablissement des ehemaligen Kapitäns Hagedorn, wo der Abschied gefeiert werden sollte. Nicht, dass es in Rostock nicht auch Gasthäuser gegeben hätte – natürlich gab es welche, und ganz gewiss mehr als im Vorort. Hagedorns Haus war nicht einmal ein richtiger Gasthof, obwohl er auch an Badegäste vermietete, sondern er hatte die gute Stube kurzerhand für Ess- und Trinklustige geöffnet und stellte in der Saison ein paar Tische vor das Haus. Trotzdem hatte Karl Türk diesen Ort nicht ohne Grund gewählt. Alle Welt – respektive die bessere Gesellschaft – strömte zu Hagedorn, seitdem dieser von einer seiner letzten Fahrten einen Italiener mitgebracht hatte, der die Küche versah. Für Rostock und vermutlich für ganz Mecklenburg war das eine Sensation. Die Belesenen oder die Vielgereisten wussten natürlich, dass die langen dünnen Fäden aus Hartweizen Makkaroni hießen, und fast alle Fahrensleute kannten sie auch, schließlich nannten sie die Italiener Makronifräters. Allerdings hatte man sie bisher nirgendwo in einem Gasthaus essen können. Inzwischen kannten auch Angehörige der niederen Schichten das Wort, auch wenn sie sich einen Besuch bei Hagedorn kaum leisten konnten. Man sprach davon, und auch in der Rostocker Zeitung hatte man darüber geschrieben. Allerdings sagten die Platt sprechenden Arbeiter, Dienstboten, Fischer, Bauern und Tagelöhner in der Regel Mackeronies. Oder eben Makroni – manchmal noch mit einem S am Ende, also Makronis.
Den Weg begrenzte linker Hand die Warnow, rechter Hand die Häuserreihe des I. Quartiers. Kaum zweihundert Meter hatten die Männer zurückgelegt, als er sich zu einem kleinen dreieckigen Platz erweiterte. Von diesem Platz ging eine breite, gepflasterte Chaussee in südwestlicher Richtung ab. Reuter hatte als Student manchen Tag an der Ostsee verbracht, um dem öden Jurisprudenz-Studium zu entfliehen; damals, vor mittlerweile allerdings fast 30 Jahren, hatte es diese moderne Straße noch nicht gegeben. Daher wandte er sich an Moritz Wiggers, der auf seiner Höhe ging, während sein Bruder neben Türk und Burmeister vorausschritt.
»Vor einem Jahr eröffnet«, sagte Moritz.
»Der Fortschritt ist wirklich unaufhaltsam«, meinte Reuter – übrigens nicht ganz ernst.
Karl Türk blieb stehen und drehte sich um. »Der Fortschritt der Industrien vielleicht«, sagte er. Ihm war Reuters leise Ironie entgangen. »Aber was unser politisches System angeht … Die Fürsten und ihre Knechte verhindern selbst allerkleinste Schritte!«
»In beiden Mecklenburg gibt es noch Zünfte wie im Mittelalter«, fügte Julius Wiggers hinzu.
»Aber in Preußen existiert die Gewerbefreiheit bereits seit 1810«, warf Fritz Reuter ein. »Und seit zwei Jahren gibt es dort die Politik der Neuen Ära …«
»… unter einem Regenten, der als Kartätschenprinz in die Geschichte der Revolution von 1848 eingegangen ist«, meinte Türk verbittert. »An dessen Händen das Blut von Aufständischen klebt. Aber ich räume ein, dass er die schlimmsten Auswüchse der Reaktion unter seinem Bruder beseitigt hat. Die Geisteskrankheit des Königs soll ja weit fortgeschritten sein. Auch ein Fortschritt!« Er grinste böse. »Ich kann nicht behaupten, dass mich sein Siechtum mit Mitgefühl erfüllt.«
Bei diesen Männern musste man immer damit rechnen, dass von jedem beliebigen Gegenstand rasch zur Politik übergegangen wurde. Das überraschte Reuter nicht im Geringsten. Ihm fiel auf, dass Doktor Burmeister nichts sagte. Vielleicht war er ein Stubengelehrter, die ja oft schüchtern sind.
Nur wenige Schritte hinter dem Platz und dem Gasthof Wöhlert hatten sie ihr Ziel erreicht. Auch vor das Haus des ehemaligen Kapitäns war eine Markise gespannt, die dem Schutz vor der Sonne diente, aber auch Regen abhalten konnte. Diese Schirmdächer gab es überall in Warnemünde, namentlich vor den Häusern, die vermietet wurden; viele Gäste verbrachten unter ihnen ganze Tage. Oftmals wurden sie mittels Seitenwänden und Vorhängen zu Zelten gestaltet, wie es auch bei Hagedorn der Fall war. So wurde quasi ein weiterer Raum geschaffen, den die Badegäste extra mieten mussten. Es war wie immer und überall: Mit dem Badewesen war Geld in den Fischerort gekommen, mit dem Geld der Geschäftssinn, mit dem Geschäftssinn die Raffgier.
Es empfahl sich, bei Hagedorn zu reservieren. Türk hatte es getan. Unter dem »Vorzelt« war bereits gedeckt. Allein ein Tisch für fünf Personen war aufgestellt und mit einem blütenweißen Tischtuch versehen worden, auf dem sich die Teller, die Bestecke und zweierlei Sorten Kristallgläser befanden. Eine junge Frau von Mitte dreißig war gerade dabei, auf dem Tisch ein Blumenbukett zu arrangieren. Sie trug die typische Warnemünder Tracht – ein langes Kleid, darüber eine Schürze und eine Haube auf dem Kopf – und wurde rot, als die Männer unter die Markise traten, so als hätte man sie bei etwas Verbotenem erwischt. Nach einem raschen Knicks entfernte sie sich in die Richtung, aus der die Gäste gekommen waren.
Kapitän im Ruhestand Gustav Hagedorn erschien. Er war weit in den Fünfzigern, aber noch eine stattliche Erscheinung, großgewachsen und schlank. Haar- und Barttracht folgten der Mode der Zeit, aber sein aschfarbenes Haupthaar glich eher einer kaum zu bändigenden Löwenmähne, der er nur mit Wasser und Haarfett einigermaßen Fasson zu geben vermochte. Der Blick seiner grünlichblauen Augen kündete von einer gewissen Härte, und seine Bewegungen ließen spüren, dass er zu befehlen gewohnt war. Seine Gäste jedoch begrüßte er untertänig, da er in ihnen wohl hochgestellte Persönlichkeiten vermutete. Davon sprach auch das Kärtchen mitten auf dem Tisch: Reservation Herr Professor Thürk. Über den Schreibfehler sah der Gastgeber gnädig hinweg.
Man nahm Platz. Hagedorn bediente selbst. Er schlug vor, zunächst eine italienische Gemüsesuppe zu sich zu nehmen, was auf Zustimmung stieß. Auch riet er zu einem leichten Weißwein von der Mosel, da er mit Weinen aus Italien noch nicht dienen könne. Auch hier erhob sich kein Widerspruch, allerdings wurde auch frisches, klares Wasser verlangt. Hagedorn runzelte die Stirn. »Sie bekommen selbstverständlich das Geforderte«, sagte er, »aber frisch und klar kann man unser Wasser nicht nennen. Es ist durch Eisenoxid und Humussäuren gelb gefärbt und riecht nach faulen Eiern – besonders bei Kindern verursacht es Leibweh und Diarrhöe, die sogenannte Warnemünder Krankheit.«
»Aber wenn die Kinder der Badegäste krank werden, kommen sie eines Tages nicht mehr«, sagte Reuter.
»Wir erhalten das Wasser jetzt in Tankwagen aus Rostock. Natürlich nur im Sommer, denn die Mägen der Einheimischen halten viel aus. Aber frisch und klar kann man dieses Wasser auch nicht nennen, höchstens frischer und klarer. Ich empfehle stets eine Magenreinigung mit Koem. Aber Aquavit habe ich auch, direkt aus Dänemark importiert.«
Reuter wurde es warm ums Herz, doch Karl Türk wünschte die Branntweine und Liköre erst nach dem Essen.
Hagedorn brachte die Suppe, die er schwungvoll mit einem die Sprachen mischenden »Voilà, il minestrone!« servierte. Mit einer großen Schöpfkelle tat er auf. Reuter wusste, dass diese großen Schöpflöffel an Bord der Windjammern Politicus genannt wurden, er wusste aber nicht, aus welchem Grund. Die Herren banden sich die Servietten um, Reuter beugte sich über seinen Teller. In der rötlichen Brühe schwammen Kartoffeln, Bohnen, Karotten, Sellerie und Zwiebeln, anscheinend auch ein paar Knoblauchzehen. Keines dieser Gemüse war typisch italienisch, sondern sie kamen auch in Mecklenburg vor. Und selbst die kleinen Nudeln kannte Reuter, schließlich tischte ihm seine Frau auch hin und wieder eine Nudelsuppe mit Rindfleisch auf. Er probierte einen Löffel voll und wurde sofort den Unterschied gewahr: die Schärfe. Sie trieb einem nicht die Tränen in die Augen, aber sie wich doch erheblich ab von der bescheidenen Art, wie man die heimischen Speisen würzte.
Der Wirt ließ die Gäste eine Zeit lang allein. Alle aßen schweigend. Reuter warf einen verstohlenen Blick auf Doktor Burmeister, der bisher noch nichts gesagt hatte. Er hatte sich tief über den Teller gebeugt, was nicht gerade zu den guten Umgangsformen zählte, nahm nur wenig Suppe auf den Löffel und schien sich unbehaglich zu fühlen – mochte er die Suppe nicht? Oder galt seine Aversion gar der ganzen italienischen Küche? Die man doch hierzulande kaum oder gar nicht kannte …
Hagedorn kehrte mit einer Flasche Wein in der rechten Hand zurück, die er zunächst auf das Fensterbrett stellte. In der Linken hielt er ein Buch. Es war ein recht dünner Band, den er mit einiger Verlegenheit neben Moritz Wiggers’ Gedeck auf den Tisch legte. Noch schwerer fiel ihm, seine Bitte auszusprechen, der Herr Doktor möge bitte ein paar freundliche Worte in das Werk schreiben.
Nun war es an Moritz Wiggers, verlegen zu sein. »Kein Doktor«, sagte er mit leiser Stimme. Dann bat er um Tinte und Feder, die der Wirt sofort zu holen versprach.
Alle schauten Moritz eine Erklärung heischend an, auch Burmeister.
»Soeben erschienen«, meinte der leicht bestürzte Verfasser, bevor er das Büchlein an Reuter reichte, der es aufschlug. Die Nothwendigkeit einer gründlichen Reform der wirthschaftlichen Zustände in dem Hafenorte Warnemünde. Eine Vertheidigung der Rechte der Warnemünder Bürgerschaft vom geschichtlichen, staatsrechtlichen und volkswirthschaftlichen Standpunkte, so lautete der Titel.
»Es betrifft ja Warnemünde«, sagte Reuter, dann gab er es an Türk weiter.
»Wohl deswegen möchte Hagedorn eine Dedikation«, vermutete Julius Wiggers.
»Wer schreibt, der bleibt.« Mit dieser Plattitüde meldete sich Burmeister erstmals zu Wort.
»Tja«, Julius schmunzelte, »dann bleibe ich wohl noch einige Zeit.«
»Sie schreiben derzeit an …?«
»… einem Buch über meine Haftzeit.«
Erstaunlicherweise hatte Burmeister wieder nur Augen für seinen – inzwischen leeren – Suppenteller.
»Vierundzwanzig Monate Untersuchungshaft. Ein Beitrag zur Geschichte des Rostocker Hochverratsprozesses, so soll es heißen«, erklärte Julius. »Wenn meine Spannkraft anhält, wird es nächstes Jahr bei Springer in Berlin erscheinen.«
Burmeister war erstarrt. Was hatte dieser Mann nur? Hatte er auch Schlimmes im Gefängnis erlebt?
»Und Sie?«, wandte sich Türk an den versteinerten Gast. »Woran arbeiten Sie, mein lieber Burmeister?«
Ein winziges Lächeln huschte über sein verbittertes Gesicht.
»Damit auch Sie bleiben?«
Der Angesprochene belebte sich. »Im Moment schreibe ich einen Aufsatz über Konradin von Staufen.«
»Ja, ich erinnere mich.« Türk klopfte Burmeister sacht auf die Schulter. »Sie forschen schon lange über die Staufer. Wie viel Zeit ist vergangen, seit ich Ihren Artikel über Friedrich Barbarossa las?«
Burmeister lächelte geschmeichelt. »Oh, wohl schon 15 Jahre.«
»So lange befassen Sie sich damit?«, wollte Moritz wissen.
»Ach, länger schon.« Das bleiche Gesicht des Privatdozenten bekam rote Flecke. »Wir sind doch alle für ein einig deutsches Vaterland«, erklärte er. »Glänzende, herrliche Zeiten … Träumt nicht jeder davon? Nun, es gab sie schon.« Vor Begeisterung überschlug sich seine Stimme.
Reuter hatte nicht erwartet, dass dieser Mann so leidenschaftlich werden könnte.
»Konradin …«, murmelte Julius Wiggers.
»… der in Neapel enthauptet wurde«, fügte sein Bruder hinzu.
Inzwischen war Hagedorn mit Tintenfass, Schreibfeder und einem Blatt Löschpapier aus den Tiefen seines Hauses zurückgekehrt. Wenigstens den Namen der Stadt hatte er vernommen, denn er sagte: »Mein Koch ist in Neapel gewesen.«
»Nein!« Burmeister machte große Augen.
»Oh, doch. Sie müssten sich mal seine Geschichte erzählen lassen. Wenn wir wenig Gäste haben, lässt er sich manchmal dazu herbei. Es ist eine Geschichte … wie ein Roman. Das meinen auch die Gäste. Wirklich unglaublich!«
»Wir sind gern bereit, sie zu hören«, sagte Karl Türk.
»Das geht nicht.« Hagedorn legte die Schreibutensilien auf den Tisch.
»Aber warum nicht?«
»Er muss doch kochen!«
Das Hauptgericht bestand aus den erwarteten »Makronis« mit einer ebenfalls recht scharfen roten Soße, in der Speck, Knoblauchstückchen und Zwiebeln schwammen. Zu dieser Mahlzeit wurde ein roter Malvasier gereicht, und nach der Mahlzeit waren frische Servietten nötig.
Unter dem Einfluss des genossenen Weines taute Doktor Burmeister endgültig auf. Er kondolierte den Wiggers-Brüdern zum Verlust ihres Vaters, den er aus der Universität gekannt hatte: Oberkonsistorialrat Professor Gustav Wiggers war immerhin eine Institution der universitären Theologie und auch mehrmals Rektor gewesen.
Julius Wiggers schluckte heftig. Der Alkohol schien eine in ihm schlummernde Wut geweckt zu haben, denn auffahrend sagte er: »Ich danke Ihnen. Mein Vater könnte zweifellos noch leben und meine arme Mutter müsste nicht ohne Gattenliebe sein, wenn er nicht vor Gram um uns, seine Söhne, gestorben wäre.«
›Nun ja‹, dachte Reuter, ›aber im 83. Lebensjahr!‹
»Sie meinen …?« Burmeister senkte schnell den Blick.
»Unser Schicksal hat seine letzten Jahre überschattet! Auch die unserer Mutter natürlich. Seine Kinder unschuldig im Gefängnis – Sie verstehen, was das in ihm ausgelöst haben muss. Er hat sich ja auch an das Großherzogliche Ministerium gewandt …«
»Die Traueradresse des Ministers von Schröter empfinden wir als besonderen Hohn«, sagte Moritz. »Dieser Mann, der als heimlicher Drahtzieher hinter dem Prozess steckte, hat sich herausgenommen, zum Ableben unseres Vaters zu kondolieren!«
»Minister von Schröter!« Karl Türk schüttelte traurig den Kopf. Reuter fand, dass er mit seinem linksgescheitelten Haar und dem hohen Haaransatz wie ein älterer Bruder von Julius und Moritz Wiggers aussah – aber dieser Eindruck war wohl vor allem dem Wein geschuldet. Auch sein Haar war ergraut, allerdings trug er nur einen Schnurrbart. Obendrein war er furchtbar mager und wirkte – was sollte man sagen – etwas vertrocknet. »Der härteste Hund unter Mecklenburgs Reaktionären! Wenn man bedenkt, dass er einmal der Jenenser Urburschenschaft angehört hat!«
»Vom Tyrannenfresser zum Tyrannenknecht, eine deutsche Karriere«, bemerkte Moritz sarkastisch.
Vermutlich hätte man sich noch weiter über den Großherzoglich Mecklenburg-Schwerinschen Justizminister Wilhelm von Schröter verbreitet, dem auch die geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten unterstellt waren, wenn Hagedorn nicht den Nachtisch serviert hätte. Auch Reuter hatte seine Erfahrungen mit dem jetzigen Minister machen müssen, als Student in Jena nämlich, wo er im Sommersemester 1832 bei von Schröter Römisches Privatrecht gehört hatte. Zunächst hatte ihm der Professor Aufmerksamkeit und Fleiß testiert, doch im Wintersemester hatte Reuter die Collegia über die Pandekten nur selten besucht. Oberappellationsrat von Schröter hatte ihn brieflich zum Vorlesungsbesuch aufgefordert und sich schließlich an Reuters Vater in Stavenhagen gewandt, dem er mitteilte: Das Semester sei für den Studiosus iuris Heinrich Ludwig Christian Friedrich Reuter verloren. Diese Denunziation hatte ihm Reuter lange übelgenommen, obgleich sie wohl wirklich gutgemeint war; der ehrlich besorgte von Schröter hatte dem Bummelstudenten auf die Sprünge helfen wollen.
Beim Dessert handelte es sich um eine eiskalte Süßspeise von körniger Konsistenz, die Hagedorn als eine Art sizilianisches Sorbet namens Granita bezeichnete. Sie wurde in beschlagenen Kelchgläsern kredenzt, aber viel wichtiger fand Reuter, was der Wirt noch brachte: die Spirituosen. Zunächst stellte er eine Flasche des Doppelkümmels aus der Brennerei Lorenz, der unter dem Namen Rostocker Koem weitbekannt war, auf den Tisch, dann folgte eine viereckige dänische Aquavitflasche. Beide Flaschen waren ebenfalls beschlagen, Hagedorn musste also einen Eiskeller haben.
Reuter wollte danach fragen, wurde aber abgelenkt, da Doktor Burmeister einen Toast auf den Emeritus Türk ausbringen wollte. Dazu hob er ein mit Aquavit gefülltes Glas.
Alle folgten seinem Beispiel.
Das Lebenswasser wärmte Reuter Brust und Magen und ließ recht schnell, zumal nach den bereits genossenen Weinen, einen angenehmen Nebel im Hirn aufsteigen, aber das hätte ein Koem natürlich auch bewirkt.
Interessanterweise wollte Burmeister gleich einen hinterher trinken, um den dänischen und den deutschen Kümmelschnaps miteinander zu vergleichen.
Reuter war es nur recht. Er spürte, dass sich hinter Burmeisters Ansinnen das antidänische Ressentiment verbarg, das viele Deutsche teilten und das sich an der Zugehörigkeit von Schleswig-Holstein zu Dänemark entzündete. Im Übrigen fand er am Koem Gefallen …
Die Spirituosen lösten die Zungen, vor allem die Zunge des Privatdozenten. Und was tat er mit gelöster Zunge? Er begann zu dozieren. Salbungsvolle Worte über die Staufer, sein Steckenpferd, entströmten seinem Mund, wobei seine Hingabe vor allem Friedrich Barbarossa galt. Er sprach vom Urbild des deutschen Kaisertums und von der Reichsidee, von deutscher Größe und deutschem Glanz. Er zitierte voll Emphase den Kölner Erzdichter: »Kaiser Friedrich, in der Welt bist du Herr der Herren, daß Posaunen dir des Feindes Burgen niederzerren. Wir verneigen uns vor dir, Ameise wie Tiger, Busch und Zeder Libanons beugen sich dem Sieger.«
Reuter bediente sich bereits selbst am Kümmel, doch trotz dichter werdendem Nebel wurde ihm dieses Pathos zunehmend peinlich, zumal Burmeister immer mehr die Stimme hob und inzwischen halb Warnemünde belehrte. Er wandte sich vom Tisch ab und schaute sich um. Vor ihm die Warnow, hier auch Warnemünder Strom genannt. Der Blick nach Norden ging zu den Landungsplätzen, aber auch die Vogtei konnte er sehen, dahinter den Kirchturm und, wenn er die Augen zusammenkniff, sogar die Ballstange, die sich bereits nahe am Strand befand: Die Höhe des Balles zeigte den ansegelnden Schiffen die Wassertiefe der Warnow an. Das Leuchtfeuer indes, das 1836 installiert worden war, wurde von Gebäuden verdeckt.
Wie erwartet, löste Burmeisters Rede ein heftiges Politisieren aus, an dem sich Reuter nicht beteiligen mochte. Hagedorn war inzwischen wieder einmal unter die Markise gekommen, um nach weiteren Wünschen zu fragen; Reuter nutzte die Gelegenheit, den dringend notwendigen Kaffee zu ordern. Allerdings blieb der Wirt zunächst, um zuzuhören. Es ging um die Kaiserkrone und den mittlerweile umnachteten Preußenkönig. Hier ereiferte sich insbesondere Karl Türk, der Friedrich Wilhelm IV. sehr zu hassen und den dessen Geisteskrankheit mit hämischer Freude zu erfüllen schien – was dem angesäuselten Reuter zu weit ging, ebenso auch Burmeister. Es hatte den Anschein, als ob Türk überhaupt keinen Kaiser an der Spitze eines einigen deutschen Vaterlandes wollte, sondern dass sein Trachten nach einer Republik ging; Julius Wiggers versuchte ihn zu beschwichtigen und zu bremsen. Eine konstitutionelle Monarchie, meinte er, sei wohl die beste Lösung – Reuter hatte aber den Eindruck, er sage dies nur in Richtung Burmeisters und vielleicht auch Hagedorns, die er nicht oder kaum kannte und denen er daher nicht vertrauen konnte.
Wirt Hagedorn erwies sich ebenfalls als Patriot. Er meinte, es werde sicher ein deutsches Kaisertum geben, wenn man Schleswig und Holstein heimgeführt und dem anmaßenden Österreicher aufs Haupt geschlagen haben werde. Alle Zeiger der Politik, sagte er, wiesen in diese Richtung. Wer dann aber Kaiser werde, das sei die Frage. Der preußische Regent vielleicht, Prinz Wilhelm? »Der war ja mal in Warnemünde«, berichtete Hagedorn, als sei das der entscheidende Grund, ihn zum Kaiser zu krönen. »Im Jahre 1834, im August, will ich meinen. Damals war man noch jung.« Er lächelte geheimnisvoll, so als hätte sich in jenem Sommer 1834 noch etwas anderes ereignet, das etwas mit der Jugend zu tun gehabt hatte. »Der Erbgroßherzog, die Erbgroßherzogin, Wilhelm von Preußen und seine Gemahlin kamen nach Warnemünde – und ich habe sie gesehen! Im Vogteisaal haben sie dann gespeist und getrunken. Der Erbgroßherzog wurde später unser Großherzog Paul Friedrich, Gott sei seiner Seele gnädig, denn alt wurde er nicht. Und der Prinz wird bald preußischer König und seine Gemahlin Augusta Königin. Erhalte Gott lange die Gesundheit der Königlichen Hoheiten!« Nicht nur Patriot war Hagedorn also, sondern auch Royalist, wie es schien. »Und ich habe sie gesehen«, wiederholte er stolz. Dann kümmerte er sich um den Kaffee.
Burmeister begann nun sogar ein Gedicht zu zitieren, das allen wohlbekannt war, das Barbarossa-Gedicht von Friedrich Rückert: »Der alte Barbarossa/Der Kaiser Friederich,/Im unterird’schen Schlosse/Hält er verzaubert sich.«
Reuter widmete sich wieder seinen Beobachtungen. Am südlichen Ende des Rostocker Enn wohnten etliche Fischer, die vor ihren Häusern Netze aufgespannt hatten, und auch Wäsche wogte sacht im leichten Wind. Inzwischen hatte die Dämmerung eingesetzt, aber es war noch hell genug, um alles genau erkennen zu können; die einzige Trübung des Bildes kam vom Schnaps.
Inzwischen waren auch die Wiggers-Brüder eingefallen: »Er ist niemals gestorben,/Er lebt darin noch jetzt;/Er hat im Schloß verborgen/Zum Schlaf sich hingesetzt.«
›Ja, die alte Barbarossasage‹, dachte Reuter träge, während er bemerkte, dass die Fischer und ihre Frauen, aber auch Kinder aus den Häusern getreten waren und sich anschickten, die Netze von den Stangen zu nehmen. Man konnte sich kaum wehren gegen Rückerts einprägsame Worte, und so sprach er in Gedanken mit: ›Er hat hinabgenommen/Des Reiches Herrlichkeit,/Und wird einst wiederkommen/Mit ihr, zu seiner Zeit.‹
Der Kaffee kam. Er war sehr stark, ein Mokka. Reuter spürte seine belebende Wirkung, und sie war bitternötig, denn auch eine neue Flasche Koem stellte Hagedorn auf den Tisch. Reuter drehte sich noch einmal um. Die Fischersfrauen hatten begonnen, die Wäsche abzunehmen und in große geflochtene Körbe zu legen, die von den Kindern ins Haus getragen wurden. »Wird Sturm erwartet?«, fragte er den Wirt.
Hagedorn schüttelte den Kopf.
»Aber warum nehmen die Leute Netze und Wäsche ab?«
»Heute ist der 22. Juni«, erwiderte Hagedorn. »Die Sonne geht in das Zeichen des Krebses über. Die Warnemünder glauben, dass der Krebs umgeht und alles zerschneidet, deswegen werden Netze und Wäsche im Haus verwahrt.«
Der Volksglaube also! Das war etwas, dass dem Dichter Reuter außerordentlich gefiel – mehr als die Sage vom schlummernden Barbarossa, der eines Tages erwachen und irgendeine alte Reichsherrlichkeit wiederherstellen wird.
Es gab eine neue Runde Schnaps. Burmeister insistierte nun darauf, den Italiener und seine Geschichte kennenzulernen, wobei er von allen Anwesenden unterstützt wurde.
Hagedorn stimmte zu. Giovanni müsse nur noch die Küche säubern, dann möge er sich zu den Herren gesellen und ihnen seine Abenteuer erzählen.
Reuter war ebenfalls neugierig, hatte aber auch Sorge, überhaupt nichts zu verstehen, da er des Italienischen nicht mächtig war.
Wirt Hagedorns italienischer Koch war eine herbe Enttäuschung. Obwohl Reuter nicht sagen konnte, was er eigentlich erwartet hatte, so jedenfalls nicht das, was er zu sehen bekam. Und es schien auch den anderen Männern so zu gehen, Doktor Burmeister ausgenommen, dessen Gesicht einen verklärten Ausdruck annahm.
Giovanni war rothaarig. Es war nicht das Rot, das man von den Menschen aus Nordwestdeutschland und Jütland kannte und das man vielleicht als Rotblond bezeichnen konnte, sondern es war ein eher bräunliches Rot – aber von einem Italiener erwartete man schwarze Haare und einen leidenschaftlichen Blick aus unergründlich tiefen schwarzen Augen. Und natürlich einen dunklen Teint. Giovanni hatte aber eine helle Hautfarbe, die Augen waren braun und konnten auch nicht als besonders unergründlich bezeichnet werden. Seine Haut war zart, beinahe mädchenhaft, und er war nicht einmal von kleinem Wuchs, wie in den Vorstellungen der Anwesenden ein Italiener zu sein hatte. Obwohl er bartlos war, musste er Burmeister einfach an Barbarossa gemahnen. Hagedorn nannte auch den Nachnamen: Frattini.
Frattini brachte zwei Kerzenständer aus Messing mit und grüßte mit einem nahezu akzentfreien »Guten Abend, meine Herren!«
Reuter atmete auf.
Die Kerzenständer bildeten ein Paar: Je eine barbusige Karyatide hielt zwei weiße Kerzen. Hagedorn nahm eine Schachtel Schwefelhölzer vom Fensterbrett und zündete die Lichter an. Dann fragte er Türk, ob er sich an den Tisch setzen dürfe. Natürlich war Türk einverstanden, und auch Frattini sollte Platz nehmen. Der Italiener holte zwei Stühle. Man setzte sich. Türk schenkte ihnen vom Doppelkümmel ein.
Burmeister fiel sofort mit seinen Belehrungen über Frattini her. Da er in Neapel gewesen sei, wisse er sicher, dass die dortige Universität vom deutschen Kaiser Friedrich II., dem Staufer, gegründet worden sei.
Frattini, der italienische und deutsche Worte vermischte, wusste es nicht. Friedrich II. aber kannte er: Er nannte ihn »lo svevo«, den Schwaben.
Glücklicherweise beherrschten sowohl die Wiggers-Brüder als auch der Privatdozent die italienische Sprache, sodass sie von Fall zu Fall als Dolmetscher fungieren konnten.
Frattini, den die Aufmerksamkeit zunächst beschämte, begann seinen Bericht mit seinem Geburtsort Calimera, wo er 1829 das Licht der Welt erblickt haben wollte. Es war zu sehen, wie alle rechneten: Er war 30 oder 31 Jahre alt. Jung also aus der Sicht dieser Männer. Reuter kannte Calimera nicht, noch wusste er, in welchem Teil des Stiefels es sich befand, aber Burmeister wurde sofort wieder zum Dozenten: »Der Name stammt vom griechischen Καλημέρα, was ›Guten Morgen‹ heißt. Eine süditalienische Ortschaft griechischen Ursprungs, möchte ich annehmen.« Er fragte Frattini etwas auf Italienisch und erhielt eine Bestätigung.
Allmählich ging Reuter der allwissende und belehrende Ton auf den Geist, den der Mokka etwas von den Nebeln befreit hatte, doch da es weiter Branntwein gab, stiegen sie erneut in die Höhe. Obwohl weder bibelfest noch übermäßig religiös, fiel ihm plötzlich ein Bibelvers ein, nämlich Matthäus 12,36: ›Ich sage euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben am Jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben.‹ An diesen Vers sollte man Burmeister einmal erinnern …
Im Alter von zehn Jahren war Frattini nach Cavallino gekommen, wo sein Vater das Pferdegestüt des Markgrafen von Cavallino geleitet hatte.
Burmeister nickte wissend.
Für Reuter war Cavallino ein böhmisches Dorf. Aber es war ein apulisches, wie er sogleich erfuhr. Das Kind war seinem Vater als Pferdejunge zur Hand gegangen, und später – als unreifer und aufbrausender Jüngling – hatte er sich in Lecce am Aufstand gegen die bourbonische Monarchie beteiligt. Damit konnte jeder wie auch immer gesonnene deutsche Zeitungs- oder Illustriertenleser etwas anfangen, ebenso auch wenig belesene Stammtischpolitikaster: wenn nicht mit dem Aufstand von Lecce, so doch mit dem Kampf gegen die bourbonischen Herrscher von Neapel und Sizilien.
Hier mischte sich plötzlich Hagedorn ein. Garibaldi, sagte er nicht ohne Stolz, sei auch Seemann gewesen, und er behauptete sogar, ihn im Mai 1854 im Hafen von Genua gesehen zu haben, wo der Haudegen und Revolutionär mit einer Fracht Kohle von Newcastle gelandet sei; wenn man wolle, könne er in seinem Logbuch aus jenem Jahr nachsehen, wann genau es gewesen sei.
Burmeister, der ganz in seinem Element war, reagierte gar nicht auf diesen Einwurf und nutzte oder missbrauchte die Gelegenheit, um die Sprache auf Tancred von Lecce zu bringen, einen offenkundigen Bösewicht aus dem 12. Jahrhundert. Das war nun alles herzlich lange her, aber für diesen Besessenen immer noch ein Grund, Tancred zu hassen.
Moritz Wiggers berichtete, dass er früher mit seinem älteren Bruder im Elternhaus bisweilen das Duett aus der Oper »Tancredi« von Rossini vierhändig geklimpert hätte, was bei Burmeister sofort mimische Missfallensäußerungen auslöste.
Reuter kippte schnell einen doppelstöckigen Aquavit. Der Mann war doch mall! Die Staufer waren lange tot und verschimmelt, basta!
Frattini konnte seinen Bericht fortsetzen: Irgendjemand müsse ihn bei den Behörden angezeigt haben, denn gegen ihn sei ein mandato di arresto erlassen worden, ein Verhaftsbefehl. Der Schreiber, der den mandato ausgefertigt hatte, verkaufte sein Wissen an Frattinis Vater, der seinen Sohn warnen konnte, und so begab sich der junge Mann umgehend auf die Flucht vor den bourbonischen Schergen. Sie führte ihn kreuz und quer durch das Königreich beider Sizilien, immer auf der Hut vor den Verfolgern und auf der Suche nach Arbeit. Für einige Zeit endete die Flucht in Palermo, wo es aber keine Arbeit gab. Diese fand er nach langer Odyssee schließlich in der ersten Lokomotivfabrik Italiens, der Königlich-Bourbonischen Werkstätte in Pietrarsa bei Neapel. Dort wurden Arbeiter gebraucht, und man fragte nicht, wer man war, wenn man nur schuften konnte wie ein Pferd. Aber Giovanni Frattini konnte von der Politik nicht mehr lassen. Er wiegelte die lavoratori gegen den Fabrikbesitzer auf, mithin gegen den König und seinen Staat, wurde schließlich in Haft genommen und auf der Golf-Insel Procida eingekerkert. Hier konzentrierte die königliche Justiz anscheinend die politischen Gefangenen.
Diese Insel, von der Reuter noch nie gehört hatte, bot dem Privatdozenten sofort wieder einen Anlass, seine Kenntnisse auszubreiten.
›… Kenntnisse breitzutreten‹, dachte Reuter.
Burmeister redete, schwadronierte, quasselte von einem Giovanni da Procida, ebenfalls irgendeine längst zerfallene historische Größe aus dem 13. Jahrhundert, aber ein Guter, denn er stand in Diensten der Staufer.
Fritz Reuter schwirrte der Kopf. Das war doch ein Aufstand der Sizilianer gegen die Franzosen gewesen – nur, was hatten die Franzosen eigentlich auf Sizilien zu suchen? Gold? Sklaven? Frauen? Reuter kicherte. Und natürlich gab es auch eine Oper. In Italien schien es zu jedem Ereignis der Geschichte eine Oper zu geben. Diese hieß, wenig überraschend, »Les vêpres siciliennes« und stammte aus der Feder von Giuseppe Verdi, den Reuter natürlich kannte – nur den Namen, nicht seine Werke. Der französische Titel erklärte sich, weil das Opus 1855 in Paris uraufgeführt worden war, während der Weltausstellung. Dort hatte der Weltmann Burmeister, wie er krähte, sie gesehen.
Das waren genug Erklärungen für diesen Abend. Obwohl es nicht besonders höflich war, füllte Reuter sein Glas, stürzte den Kümmel hinunter und wandte sich ab. Der Italiener redete weiter, Reuter hörte nicht mehr zu. Die Nacht war angebrochen, und da es in Warnemünde keine Straßenbeleuchtung gab, hatten manche Hausbesitzer Laternen vor die Häuser gehängt, große Windlichter mit Kerzen, aber ebenso Petroleumlampen. Auch Hagedorn hatte es getan. Reuter schaute am Strom entlang, den Fluss auf- und abwärts. Alle Netze und alle Wäschestücke waren verschwunden, ja selbst die Wäscheleinen hatte man abgenommen. Der Italiener sprach zum Glück nicht laut. Reuter gähnte.
Von Zeit zu Zeit hörte er die Wachstränen der Kerzen mit sachten Schlägen auf das Messing tropfen. Von der Landungsbrücke näherte sich ein Mann, der ein helles Jackett und helle Hosen trug, einen hellen Strohhut und schwarze Schuhe. Der gestärkte Hemdkragen war zum Abend etwas traurig geworden und hatte seine Spannkraft verloren, der dunkle Binder hing melancholisch herab. Der Mann schien müde zu sein, denn er ging langsam und klammerte sich an den Spazierstock, aber es war ja auch spät.
Er kam näher und lüftete den Hut zum Gruß. Reuter glaubte sich vom Schlag getroffen. Oder hatte er eine Halluzination? Den Mann kannte er doch.
Hagedorn grüßte nicht nur, sondern erhob sich sogar.
Niemand sprach, außer Burmeister, der wieder irgendetwas erklärte.
Der Mann verschwand in einem der Nachbarhäuser.
Reuter wandte sich an Hagedorn: »Das war doch …?«
»John Brinckman, der berühmte Dichter«, sagte der Wirt.
Reuter hatte das Gefühl, ihm würde ein glühendes Messer in die Brust gerammt. Brinckman also, ein berühmter Dichter. Berühmter wohl als er? Reuter griff zur Flasche.
Zweites Kapitel
Sonnabend, 23. Juni 1860
Der Vater stand mit einem Brief in der Hand hoch über ihm, also musste er auf einen Stuhl gestiegen sein. Der Sohn senkte den Blick. Die väterlichen Beine berührten den Boden. Aber er war riesig, überragte den Sohn um zwei oder gar drei Ellen. »Fritz!«, sagte er mit strenger Stimme. Der Brief in seiner Hand stammte von Professor von Schröter aus Jena. »Fritz, wach auf!« Der Vorwurf, dass der Sohn seine Studienzeit verschlief, schwang mit. »Wach doch auf, Fritz!« Jemand packte ihn am Arm. Es war Professor von Schröter, der neben ihn getreten war. Mit vereinten Kräften versuchten sie, Fritz endlich dazu zu bewegen, sich ausschließlich seinem Studium zu widmen, sich von den Studentenverbindungen zurückzuziehen und vom Bier zu lassen. »Wach auf, Fritz! Komm zu dir!«
Fritz Reuter konnte nichts erwidern, denn eine zu einem riesigen Ballon geschwollene Zunge stopfte ihm den Mund. Sie war mit einem dichten Pelz überzogen, der Mund war vollkommen ausgetrocknet. In diesem Moment wurde er gewahr, dass er gerade aus einem Traum erwachte.
Reuter schlug die Augen auf. Das Zimmer, in dem er zu sich kam, war ihm vollkommen fremd. Zunächst konnte er nur die Decke und ein Stück des Fensters sehen. Die Vorhänge kannte er nicht. Als er den Kopf hob, begannen die Ameisen, die sich in seinem Hirn eingenistet hatten, wie wild zu krabbeln. Sein Blick fiel auf eine Waschkommode mit einem Spiegel, der zu großen Teilen blind war. Eine Schüssel und ein Krug standen auf der marmorierten Platte. Das Möbel gehörte ihm nicht. Auch im Besitz seines Schwiegervaters befand sich kein solches Stück.
Er hielt den Kopf etwas seitlich. Nun sah er den Mann, der ihn geweckt hatte. Ihn erkannte er sofort: Es war Julius Wiggers. Schräg hinter ihm stand noch jemand. Reuter kniff die Augen zusammen. Das war ja – John Brinckman! Wie kam denn Brinckman hierher? Er lebte doch in Güstrow. Und wie schrecklich, dass er Reuter in einem solchen Zustand sah.
Er erinnerte sich. Er befand sich in Warnemünde, weil man einen Abschied gefeiert wie bedauert hatte. Damit wusste er aber noch nicht, was es mit diesem Zimmer auf sich hatte, das nicht sehr groß war. Außer dem Bett, in dem er lag, und der Kommode gab es noch einen Tisch vor dem Fenster, daneben einen Stuhl und an der Wand neben der Tür und somit hinter Brinckman einen Bauernschrank. »Wo bin ich?«, hauchte er.
»In Warnemünde.«
»Das weiß ich. Aber wo genau?«
»Nicht weit von Hagedorns Etablissement.« Wiggers schaute zu Brinckman.
Der sagte: »II. Quartier, Nr. 6.«
Damit konnte Reuter nichts anfangen, aber er schwieg.
Wiggers erklärte weiter: »Wir alle konnten gestern Abend nicht mehr nach Rostock zurück. Der letzte Dampfer geht halb acht, und ein Fuhrwerk wäre auch nicht zu bekommen gewesen. Außerdem … unser aller Zustand …«
›Besonders meiner‹, dachte Reuter und wünschte, dass John Brinckman endlich verschwinden möge. Aber der war natürlich neugierig und genoss es außerdem, auf seinen Dichterkollegen hinabblicken zu können – jedenfalls vermutete es Reuter.
»Karl ist bei Hagedorn selbst untergekommen, mein Bruder und ich konnten beim Vogt Rudloff Quartier nehmen – bei ihm habe ich mich bereits 1857 nach der Entlassung aus der Haft erholt. Dich musste Hagedorn in diesem Zimmer unterbringen.«
»Eher wohl eine Kammer.« Reuter richtete sich auf. Ihm wurde sofort schwindlig. Außerdem fühlte er sich wie zerschlagen.
Da er sein Ziel erreicht hatte, trat Wiggers einen Schritt zurück. Nun stand er neben Brinckman.
»Da war doch noch dieser Doktor, der andauernd über die Staufer dozierte, als wäre er selber einer.« Reuter versuchte es mit einem Lächeln. Das Lächeln spannte in den Mundwinkeln.
»Doktor Burmeister.«
»Ja.« Reuter ließ die Beine aus dem Bett baumeln. Er war in Leibwäsche und fühlte sich Brinckmans indiskreten Blicken geradezu ausgeliefert. Würde man ihn auch beim Waschen beobachten?
»Doktor Burmeister ist tot«, sagte Brinckman.
»Was ist er?« So ganz konnte Reuter das Gesagte nicht begreifen. Tot? Wieso tot? Gestern war er noch quicklebendig gewesen, da konnte er doch jetzt nicht tot sein.
»Er ist in der Nacht … gestorben.«
»Hat ihn der Schlag getroffen?«
Wiggers schüttelte betrübt den Kopf. »Er wurde erstochen.«
Fritz Reuter sprang sofort aus dem Bett. Das war ein Fehler. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten und taumelte zum Stuhl, auf den er sich fallen ließ. Es war unmöglich, dass in dem friedlichen Warnemünde ein Mensch erstochen wurde, noch dazu ein harmloser Mensch, der vielleicht besessen von einer Idee war, aber sich doch nur mit Personen beschäftigte, die selbst schon lange tot waren.
»Mach dich frisch und komm zu Hagedorn!«, sagte Wiggers. »Er hat einen Kaffee gekocht, der Tote aufweckt.«
›Hoffentlich nicht die Staufer‹, dachte Reuter, der ein wenig munterer geworden war, vielleicht bereits durch das Wort Kaffee.
John Brinckman begleitete ihn die wenigen Schritte zu Hagedorns Etablissement, was Reuter nicht sonderlich behagte. In der Zeit kurz vor den revolutionären Ereignissen des Jahres 1848 hatte Reuter sich dem Reformverein seiner Heimatstadt Stavenhagen angeschlossen und war zu einem Treffen der Mecklenburger Reformvereine, dem Reformtag, nach Güstrow gefahren. Das war im April gewesen. Auf dem Reformtag war er Brinckman begegnet, gegen den er sofort eine herzliche Abneigung empfand. Von Güstrow ging es zum außerordentlichen Landtag nach Schwerin, wo er aber nicht zum Politisieren kam, weil ein schwerer Trunksuchtanfall zu seiner Einweisung in die Irrenanstalt Sachsenberg geführt hatte. Dafür konnte Brinckman nichts. Aber für seine schlechten plattdeutschen Texte war er voll verantwortlich.
An dem Tisch vor Hagedorns Haus saßen Moritz Wiggers und Karl Türk, beide sehr blass, und zwei weitere Männer, die Reuter nicht kannte. Ein dritter, ihm Unbekannter, stand. Hagedorn stellte vor, zunächst den Vogt Rudloff, den Vertreter der Rostocker Obrigkeit in Warnemünde, und dann eine saloppen Mittdreißiger, der noch den Vollbart trug, der einstmals als Zeichen von Demagogie gegolten hatte. Er hieß Ackermann und war Mediziner, allerdings kein praktischer Arzt, sondern außerordentlicher Professor an der Alma mater Rostochiensis, wo er Pharmakologie lehrte. Sein Interesse gelte aber praesertim der Pathologie, wie er sagte, – noch ein Universitätslehrer mit Steckenpferd! Er war Badegast und hatte auf Bitten des Vogtes den Toten untersucht.
Der Hegediener Wilhelm Heyden stand schräg hinter seinem Vorgesetzten und schwieg, da er in einem solchen Kreis nichts zu sagen hatte. Reuter hielt ihn für eine Art Gendarm oder Polizist oder Stadtsoldat. Auch Hagedorn stand, während sich Julius Wiggers mit verschränkten Armen an das Fensterbrett gelehnt hatte.
»Tja«, sagte der Vogt, »das sind nun alle Herren, die gestern gefeiert haben … mit dem …?«
»Ich nicht«, sagte Brinckman mit einem schiefen Lächeln – schief war es zumindest in Reuters Wahrnehmung. »Mich hat nur der Duft des Kaffees angezogen.«
›Vor allem wohl die Neugierde‹, dachte Reuter.
»Sie waren also nicht dabei, Herr Brinckman?«, vergewisserte sich Rudloff. Sein Ton kam Reuter ehrfürchtig vor, was ihn ärgerte. Zunächst aber nahm er einen Schluck Kaffee. Der Türkentrank war wirklich sehr stark.
»Unter diesen Umständen muss ich Sie leider bitten …!«
»Ich verstehe.« Brinckman verzog keine Miene. »Trotz der bitteren Umstände wünsche ich einen guten Tag.« Er nahm seinen Gehstock und begab sich zum Strom, wo er sich auf eine der unlängst aufgestellten Bänke setzte und den Fischern dabei zusah, wie sie Netze flickten.
Reuter schaute auf seine Uhr. Es war kurz nach zehn. Da er sich an das Ende des gestrigen Abends nicht zu erinnern vermochte, konnte er nichts zur Beantwortung all der Fragen beitragen, die der Vogt stellte. Dafür erfuhr er, wie es weitergegangen war. Giovanni Frattini hatte seine Geschichte erzählt, immer wieder unterbrochen durch Burmeister, was den Italiener allmählich irritiert hatte, wenn nicht gar in Wut versetzt. Was Frattini noch erzählt hatte, wusste Reuter nicht; nicht einmal Bruchstücke tauchten auf. Aber das war auch nicht wichtig, jedenfalls nicht so wichtig wie der Umstand, dass der Italiener verschwunden war. »Verschwunden?«, vergewisserte sich Reuter.
»Jedenfalls ist er nicht hier«, sagte Hagedorn.
Irgendwann gegen Mitternacht hatten Frattini und Hagedorn den betrunkenen Reuter auf seine Kammer geschafft, aber das Gespräch war ohne ihn noch einige Zeit weitergegangen, wenn auch nicht länger als eine halbe Stunde. Alle waren müde gewesen, Burmeister auch vom Alkohol so angegriffen, dass Hagedorn entschied, ihn von Frattini begleiten zu lassen. Der Privatdozent hatte abgelehnt, weil es zu seiner Unterkunft nicht weit war: Er wohnte in der Krimm nur ein paar Schritte jenseits des kleinen Platzes, in den die Rostocker Chaussee mündete. Trotzdem stellte der Weg für einen Betrunkenen eine Herausforderung dar, und als Burmeister beinahe gestürzt wäre, befahl ihm Hagedorn regelrecht, dass er Frattini als Begleitung akzeptiere. »Als ich keine Veranlassung zur Sorge mehr sah, bin ich auch zu Bett gegangen«, sagte Hagedorn.
»Wie spät war es da?«, wollte Rudloff wissen.
»Fünf Minuten nach halb eins. Ich habe auf die Wanduhr geschaut.«
»Kann Ihr Koch zunächst zurückgekehrt sein?«
Hagedorn hob die Schultern und öffnete die Arme. »Es war ein anstrengender Tag. Ich muss sofort eingeschlafen sein.«
Vogt Rudloff nickte. Auf jeden Fall war Doktor Burmeister in seinem Quartier angekommen. Die Krimm war vor allem als Tanzdiele bekannt, aber es wurden auch ein paar Zimmer vermietet, weil Geld nicht stank. Auch die Wirtsleute der Krimm waren längst zu Bett gegangen und hatten von der Rückkunft ihres Gastes nichts gehört. Sie mussten nicht wachbleiben, um auf späte Heimkehrer zu warten, denn in Warnemünde waren die Haustüren nicht verschließbar.
»Ist das nicht leichtfertig?«, wollte Karl Türk wissen.
»I wo«, entgegnete der Vogt, »hier passiert nichts. Diebstähle kommen nicht vor. Fast nicht. Vor drei Jahren sind einmal ein paar Kleidungsstücke verschwunden. Das war vielleicht eine Aufregung! Aber es stellte sich heraus, dass ein Knecht aus Elmenhorst der Dieb gewesen war.« Rudloff lächelte flüchtig. »Die Warnemünder beruhigten sich sofort und sagten: ›Natürlich, ein Elmenhorster!‹ Niemand baute ein Türschloss ein.«
»Paradiesische Zustände«, meinte Türk.
»Oh, so paradiesisch ist es nicht«, widersprach Rudloff. »Die Warnemünder sind ein eigenes Volk. Als Vogt bekomme ich das oft zu spüren. Sie hassen Rostock.« Er seufzte. »Außerdem haben wir nun einen Mord. Ich weiß nicht, wann es hier zuletzt einen gegeben hat. Ich möchte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der Mörder kein Warnemünder ist.«
Wie sich weiter herausstellte, hatte man in der Krimm irgendwann in der Nacht einen Streit gehört, oder wollte ihn gehört haben. Erregte Stimmen seien aus dem Zimmer des Privatdozenten gedrungen, so laut, dass sie die Frau des Wirtes aus dem Bett trieben. Sie war ans Fenster getreten und hatte jemanden weglaufen sehen.
»Hagedorns Italiener, so sagt sie«, erklärte Rudloff.
»Giovanni hat sich also mit Burmeister gestritten?«, wollte Hagedorn wissen. Das schien ihn sehr zu überraschen.
»Sagt die Frau«, wiederholte Rudloff.
»Warum sollte er sich mit Doktor Burmeister streiten? Er kennt ihn doch gar nicht.«
»Das frage ich Sie. Was wissen Sie über den Toten?«
Die Frage war an alle gerichtet und führte zu wenig ertragreichen Antworten. Man wusste nicht viel über den Mann, mit dem man mehrere Stunden gemeinsam verbracht hatte. Er war Privatdozent für Geschichte an der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock gewesen und hatte sich mit den Staufern befasst – das war fast schon alles. Hatte er Frau und Kind? Niemand wusste es. Gab es Feinde? Allgemeines Achselzucken. Nicht einmal seine Rostocker Adresse war bekannt. Nur dass sein Bruder ein wohlhabender, wenn nicht gar reicher Rostocker Reeder war, das wussten alle außer Reuter – sogar der Vogt. Reeder Burmeister war sozusagen eine Rostocker Instanz, nicht wegen überragender Leistungen, sondern weil in einer Stadt von der Größe Rostocks nahezu jedermann die Vertreter der Oberschicht kannte, zumindest diejenigen, die seit Jahr und Tag hier wirkten.
»Der Bruder hat es mit dem Transport von Auswanderern nach Amerika und Australien zu einem erklecklichen Vermögen gebracht«, sagte Moritz Wiggers.
Reuter dachte sofort an die Geschwister seiner Frau. Er warf einen Blick zu Brinckman, der noch immer auf der Bank saß und bestimmt zu lauschen versuchte. Der Herr Kollege war auch einmal für zwei oder drei Jahre in den Vereinigten Staaten gewesen, wobei das bereits fast zwei Jahrzehnte zurücklag. Er war enttäuscht zurückgekehrt und hatte seine Erlebnisse in einem Flugblatt unter dem Titel »Fastelabendspredigt för Johann« verarbeitet, in der er die Mecklenburger Tagelöhner eindringlich vor der Auswanderung nach Amerika warnte – dieses Flugblatt war lange nach seinem Amerika-Aufenthalt erschienen, ungefähr vor vier, fünf oder sogar sechs Jahren.
»Vor zwei Jahren ist eines seiner Schiffe verunglückt«, meldete sich der Hegediener erstmals zu Wort.
»Verunglückt ist gut«, sagte Julius Wiggers, »es ist mit Mann und Maus gesunken.«
Reuter hatte seine raue, pelzige Zunge in eine Engelszunge verwandelt und so lange auf den Vogt eingeredet, bis dieser eingewilligt hatte, dass er sich – allerdings begleitet von dem Hegediener und Professor Ackermann – in Burmeisters Zimmer umsehen durfte. Dazu hatte er sich jenes Vorwandes bedient, den er immer in petto hatte, nämlich seine journalistische Tätigkeit, die er gar nicht mehr ausübte: Er wolle Burmeisters Nachruf schreiben und müsse sich daher ein Bild von den Umständen seines Todes machen. Rudloff hatte natürlich wissen wollen, für welche Blätter er schreibe, und Reuter hatte die Neu-Brandenburger Zeitung sowie das Unterhaltungsblatt für beide Mecklenburg und Pommern genannt, dessen Redakteur er einst gewesen war, das aber gar nicht mehr existierte. Er hatte also gelogen, doch Rudloff schien es nicht zu bemerken. Allerdings wollte er wissen, ob das Unterhaltungsblatt nicht im Verlag eines gewissen Carl Lingnau erschienen sei, was Reuter überrascht bejahte. Daraufhin hatte Rudloff zunächst die Wiggers-Brüder und Türk, dann aber auch Reuter selber mit einem irgendwie wissenden Blick bedacht, ohne ein Wort zu sagen. Hätte der Vogt mehr Erfahrungen mit Kapitalverbrechen gehabt, er hätte Reuter sicher verweigert, sich am Ort des Mordes umzusehen.
Die Tanzdiele Krimm befand sich nach den Worten des Hegedieners im Haus Numero 12 des I. Quartiers, aber auch ohne diese Auskunft hätte Reuter sie gefunden, denn schon von Weitem war der Auflauf zu sehen, den die Nachricht vom Mord verursacht hatte. Zunächst gingen die drei Männer zu dem dreieckigen Platz und Reuter fragte: »Wie ist denn die Polizei in Warnemünde organisiert?«
»Als ständiger Vertreter des Rostocker Gewetts hat der Vogt natürlich auch Polizeibefugnisse«, sagte Ackermann.
Heyden nickte und sagte: »Un ik bün sin Gehilfe.«
»Also sind Sie einem Polizeibeamten ebenbürtig?«
»Bün ik nich«, erwiderte Heyden, während sie die ersten Häuser des I. Quartiers erreichten, die von der Nummerierung eigentlich die letzten waren, denn das Haus an der Ecke zum Platz trug die Nr. 20. »Ich bin zwar Aufsichtsperson, aber auch Bote. Ich muss die Weisungen des Vogtes ausrufen und die Steuerabrechnungen der Quartiere prüfen.«
»Gibt es denn gar keine richtige Polizei?«, wollte Reuter wissen.
»Natürlich gibt es die«, erwiderte Heyden. Sie waren gerade ein einem jener Gänge angelangt, die Vorder- und Hinterreihe miteinander verbanden. In Warnemünde grenzte kein Haus an das andere, sondern zwischen ihnen bestand ein sechs Fuß breiter und mit einer Holztür verschlossener Durchgang, der das Überspringen eines Feuers verhindern sollte und auch als Mittel gegen den Tropfenfall diente. Diese schmalen Öffnungen nannte man Tüschen. Im Abstand von mehreren Häusern, zwischen zehn bis zwanzig, gab es breitere Verbindungsgänge, die Wuhrten, und eine solche Wuhrt hatten sie soeben erreicht.
»In Warnemünde bestimmt der Vogt je zwei Polizeimänner aus den vier Quartieren«, fuhr der Hegediener etwas gereizt fort, vermutlich weil Reuter ihn nicht für einen richtigen Polizisten hielt. »Sie achten auf die rechtzeitige Schließung der Wirtschaften und helfen mir bei schwierigen Verhaftungen. Dort sehen Sie die beiden Polizeimänner des I. Quartiers.« Er deutete zu dem Haus, vor dem sich der Auflauf gebildet hatte und bei dem es sich um das vierte Gebäude nach der Wuhrt handelte, das Tanzhaus Krimm.
Zum ersten Mal las Reuter den Namen und war irritiert: Handelte es sich um einen Familiennamen? Oder war der Name der Halbinsel im Schwarzen Meer, die wegen des dortigen Krieges bis vor vier Jahren in aller Munde war, einfach nur so mit doppeltem M geschrieben worden?
Ungefähr drei Dutzend Personen hatten sich vor dem Gasthaus eingefunden, darunter Fischer, Matrosen und auch ein paar Badegäste, außerdem Frauen in den typischen Warnemünder Alltagstrachten – die sonntäglichen würden sie morgen anlegen – und vor allem Kinder aller Altersklassen. Erregt debattierten die Einheimischen in ihrem schwer verständlichen Platt, während die Badegäste nur zusahen, wenig verstanden und auch etwas pikiert wirkten angesichts ihrer derben Nachbarschaft. Bei den von Heyden genannten Polizeimännern musste es sich um die beiden Wachtposten vor der Tür des Etablissements handeln, die weder eine Uniform trugen noch wenigstens eine Armbinde; das war sicher nicht nötig, weil die Warnemünder sie kannten. Alltäglich wie die anderen Ortsansässigen sahen sie aus. Allerdings bemühten sie sich um einen würdigen Gesichtsausdruck und eine betont aufrechte Haltung, die anzeigten, dass sie hier die Obrigkeit repräsentierten. Dass sie die Tür bewachten, war unverkennbar.
Wilhelm Heyden, Fritz Reuter und Professor Ackermann schritten auf sie zu. Die Polizeimänner salutierten. Der militärische Gruß sah wenig überzeugend aus, eher wie eine Karikatur. Dann öffneten sie die doppelflügelige Tür.
Zum Tanzboden diente der Krimm vor allem ein mit Steinen ausgelegtes Geviert vor dem Haus, aber bei Regen konnte man auch innen tanzen. Dazu hatte man zwei Wände des ursprünglich zweifellos wie alle anderen Häuser geschnittenen Bauwerks entfernt und auf diese Weise einen Saal geschaffen, wobei der Diminutiv zur Bezeichnung des Raumes eher angebracht war. Aber immerhin zwanzig Personen mochten das Tanzbein schwingen können, vielleicht auch mehr, wobei sich Reuter mit einem gewissen Schauder die dabei entstehende Stallwärme vorstellte, vor allem jedoch den Stallgeruch. An die Hofseite hatte man ein paar Kammern angebaut, die sommers vermietet wurden, und auch im Obergeschoss gab es entsprechende Gelasse.
Das Wirtsehepaar saß an einem Tisch in einer düsteren Ecke des Gastraumes und ließ – im übertragenen Sinne – die Köpfe hängen. Neben ihnen standen zwei jüngere Leute, die Heyden als Sohn und Schwiegertochter vorstellte. Zu viert betrieben sie die Krimm.
Reuter unterdrückte den Impuls, nach der Schreibweise zu fragen, da dies nicht wichtig war, nicht jetzt. Stattdessen ließ er sich noch einmal berichten, was in der Nacht geschehen war.
Man habe gestern keinen Tanz gehabt und sei daher gegen elf zu Bett gegangen, sagte die Wirtsfrau, die anscheinend die Wortführerin der Familie war. Ihr Mann nickte, Sohn und Schwiegertochter zeigten keine Reaktion. In der Nacht sei sie dann aufgewacht, weil sie ein Poltern im Saal und wenig später auf der Treppe gehört habe, was sie zunächst beunruhigt hatte, aber als sie Burmeisters Stimme erkannte, habe sie sich nur im Bett umgedreht. »Er hat aber Italienisch gesprochen«, meinte sie. »Mit ziemlich … ach herrjeh … ziemlich schwerer Zunge.«
Ackermann fragte: »Vermögen Sie die italienische Sprache denn zu erkennen?«
»Na, man weiß doch, wie Hagedorns Koch redet«, sagte die Wirtin in einem etwas feindseligen Ton.
»Woher? Es gibt doch meines Wissens keinen anderen Italiener in Warnemünde, mit dem er sich in seiner Muttersprache unterhalten könnte.«
Der Schwiegersohn mischte sich ein: »Wir haben ihn manchmal gebeten, für unsere Gäste ein paar Sätze zu sagen. Die mögen das. Sie sagen dann oft: ›Warnemünde ist ja fast schon die Riviera.‹«
»Und das Poltern?«, fragte Reuter die Wirtin. »Was haben Sie gedacht, als Sie es poltern hörten?«