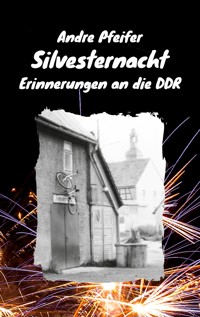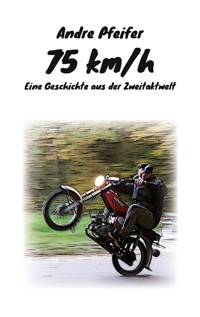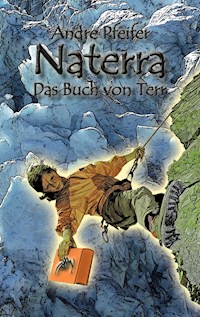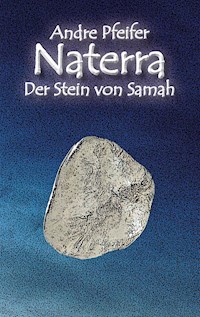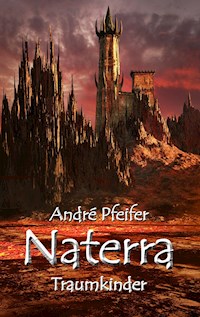Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Im Krieg gegen einen Dämon schuf ein mächtiges Volk magische Schwerter, die die Macht der vier Elemente entfesseln konnten. Aber eine Katastrophe hinterließ ein verwüstetes Land voller Geheimnisse. Verfolgt von riesigen Schlangen und dunklen Kriegern sind Enola und Wyn auf der Suche nach dem Schwert des Wassers. Seine Magie könnte das Land wieder erblühen lassen. Am Ende ihres Weges steht dem Mädchen und dem Jungen ein Kampf bevor, der unvermeidlich scheint. Verzweifelt trifft Enola eine folgenschwere Entscheidung Ein Dämon voller Hass auf die Menschheit. Ein Mädchen im Bemühen um Frieden. Eine Burg mit dunkler Vergangenheit. Ein Junge im Drachenfeuer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andre Pfeifer wurde 1968 in Weimar geboren und ist seiner Heimat treu geblieben. Auf zahlreichen monatelangen Reisen von Alaska bis Australien entdeckte er seine Liebe zu Natur und Abenteuer, die auch in seine Romane einfließt.
www.andre-pfeifer.de
Naterra – Die Schwerter der vier Elemente (2009)
Naterra – Das Buch von Terr (2011)
Naterra – Die Schwerter von Terr (2015)
Es gibt kein Rechts ohne Links.
Es gibt kein Vorn ohne Hinten.
Es gibt kein Oben ohne Unten.
Es gibt kein Licht ohne Schatten.
Und es gibt kein Gut ohne Böse, oder …?
Liebe Leser,
im Jahr 2004 begann ich, einen Fantasyroman zu schreiben, in dem Zauberschwerter die Kraft der vier Elemente entfesseln konnten. Obwohl sie damals erst zwei und vier Jahre alt waren, nahmen meine Kinder großen Anteil an meiner Schreiberei. Deshalb versuchte ich, für sie eine Kurzfassung der Schwertergeschichte zu Papier zu bringen, die letztlich so gut war, dass daraus ein eigenständiges Buch entstand:
„Naterra – Die Schwerter der vier Elemente“.
Dieses Buch wurde 2009 erstmalig im Verlag Wieselflink verlegt und der Fantasyroman von den Zauberschwertern geriet über anderen Büchern fast in Vergessenheit.
Nun endlich ist der Roman, den ich 2004 begann, fertiggestellt. Ein Mädchen namens Enola ist die Hauptfigur, dieselbe Enola, die in „Naterra – Die Schwerter der vier Elemente“ und auch in „Naterra – Das Buch von Terr“ vorkommt. Und natürlich gibt es viele weitere Parallelen zu „Naterra – Die Schwerter der vier Elemente“, da jenes Buch ja dem hier vorliegenden entsprang.
Mancher mag sich daran stören, andere wieder werden begeistert sein, die Zauberschwerter noch einmal ganz anders zu erleben. Wie auch immer, ich finde, dass die Geschichte es auf jeden Fall wert ist, hier erzählt zu werden. Sie schließt an „Naterra – Das Buch von Terr“ an, kann aber auch gelesen werden, ohne jenes Buch zu kennen.
Die Fotos im Text habe ich von meinen Reisen in viele Länder unserer Erde mitgebracht. Sie sollen ein wenig die Quellen meiner Inspiration offenbaren. Aber letzten Endes entspringt die ganze Geschichte meiner Fantasie und wird sich vor euch, so hoffe ich, in den wunderbaren Bildern entfalten, die eure Fantasie zeichnet.
Herzlichst!
Andre Pfeifer
August 2015
andre-pfeifer.de
Inhalt
Einleitung
Unglück
Nebel
Magie
Schlangen und Spinnen
Rettung
Legenden
Das Schwert
Verzweiflung
Ödland
Wasser und Feuer
Wyntragon
Beute
Unerwartet
Freunde
Krieg
Die Festung
Abgrund
Gefährten
Luft und Erde
Drachenfeuer
Wyntragons Plan
Rhima
Freiheit
Der Dämon
Fotos
Danksagung
Einleitung
In Akragas, einem Teil des alten Griechenland, lebte vor zweieinhalbtausend Jahren ein Gelehrter namens Empedokles. Er vertrat die Meinung, dass alles auf der Welt miteinander im Zusammenhang stehe und dass alles auf vier Elemente zurückzuführen sei.
Wasser, Feuer, Luft und Erde.
Und alles entstehe oder vergehe durch die Wirkung von Liebe und Hass auf diese vier Elemente.
*
Manche glauben, viele Kinder sind wiedergeborene Menschen vergangener Zeit, und es heißt, sie besitzen die Weisheit ganzer Generationen. Allerdings erinnern sie sich nicht daran, außer in ihren Träumen.
Aber wo sind sie in ihren Träumen?
In anderen Welten! Es gibt Abertausende davon, und es scheint, als wären einige von ihnen verwandt mit unserer Welt.
Wenn Kinder dort sind, in ihren Träumen, können sie anders sein als zu Hause. Mutiger, tapferer, stärker, klüger. In jenen Welten können sie über sich selbst hinauswachsen und Fähigkeiten entwickeln oder Entscheidungen treffen, von denen sie eben nur zu träumen wagen.
*
Eine der Traumwelten heißt Naterra. Dort gibt es dieselben zauberhaften Landschaften, die einst unsere gesamte Erde bedeckten. Glühend heiße Wüsten, endlose Grasebenen, tiefe dunkle Wälder, und Gebirge, deren schneebedeckte Berge den Himmel berühren.
Manch seltsames Tier durchstreift jene Welt und Wesen, die uns fremdartig erscheinen würden, sind in ihr zu Hause. Magie durchdringt Erde, Sand und Stein und liegt wie ein Schleier über der Landschaft. Die Menschen, die dort leben, können diesen Zauber fühlen und mitunter beherrschen.
Und auch die Zeit folgt ihrem eigenen Fluss. Ein paar Stunden Schlaf können Tage oder Wochen in der Traumwelt sein. Oder auch umgekehrt.
Unglück
Ein Habicht kreist über einer verschneiten Landschaft. Er spürt die Morgensonne auf seinem Gefieder. Seine scharfen Augen suchen nach Beute. Er schwebt über lichtem Wald und weißen Wiesen und einem kleinen gefrorenen Fluss, der die Wiesen teilt. Der Habicht sieht die Brücke der Menschen, die sich über den Fluss spannt und den schmalen zugeschneiten Weg, der zum Wald führt. Er entdeckt einen Hasen.
Im selben Moment wird die Stille des Wintermorgens gestört. Der Habicht vernimmt die Rufe von Menschen. Die Stimmen werden lauter. Sie schrecken den Hasen auf.
„Heya, hey!“ Enola treibt die vier Huskys an, die ihren Schlitten ziehen. Ihre Augen leuchten und mit ungeheurem Spaß sieht sie die Hunde durch den Pulverschnee fegen, der sich vergangene Nacht über ihre Piste gelegt hat. Wie weißer Staub wird der Schnee durch die Hunde und den dahinfliegenden Schlitten aufgewirbelt.
Lisann folgt mit ihrem Hundeschlitten Enolas Spuren. Sie sieht mit Freude ihre Stieftochter am Heck ihres Schlittens stehen. Die Füße sicher auf den Kufen, die Hände fassen die Griffe an der Lehne. Enola federt die Unebenheiten des Bodens aus, während sie ihren Körper nach rechts oder links bewegt, um den Schlitten in seiner Richtung zu halten. Ihr langes blondes Haar schaut unter ihrer Mütze hervor und bewegt sich im Fahrtwind wie ein Schleier. Eingehüllt in einen Nebel aus Pulverschnee dreht sie sich ein wenig um und winkt Lisann kurz zu.
Seit Lisann mit Enola, ihrem Bruder und ihrem Vater lebt, haben sie Huskys und die Hunde sind ihre Leidenschaft geworden. Im Winter warten sie auf den Schnee, um dann mit ihren Hundeschlitten in der Wunderwelt verschneiter Wälder unterwegs zu sein. Es ist ein riesen Spaß, mit den Hunden durch den Wald zu fahren und die Freude zu spüren, mit der sie den Schlitten über den Schnee ziehen.
Bäume huschen rechts und links vorbei. Ihre weit ausladenden Äste ragen nah an Enolas Schlitten heran. Der Weg wird schmaler, aber der Schlitten bleibt schnell. Enola kennt sich aus. Sie weiß, dass gleich, wenn die Bäume auseinandertreten, eine scharfe Rechtskurve kommt. Der Weg führt dann zu einer Brücke über den Fluss und weiter bis auf einen Hügel. Von dort wird sie ihr Haus sehen können.
„Langsam, Akela, langsam!“
Der Leithund kennt ihre Stimme und ihre Befehle und die anderen Hunde folgen ihm. Aber diesmal ist alles anders. Akela sieht den Hasen. In der Kurve rennt der Hase auf die Piste und flieht über die Brücke. Die Hunde toben los. Huskys sind wie Wölfe. Sie haben noch etwas Wildes. Sie haben ihren Jagdtrieb.
„Langsam, Akela, langsam!“
Aber Akela bleibt schnell. Die Hunde sind jetzt ein Rudel und hetzen ihre Beute. Das ist schon oft vorgekommen und kein Grund zur Panik. Die Hunde haben während dieser kurzen Verfolgungen nie die Piste verlassen. Wenn das Wild rechts oder links des Wegs im Wald verschwunden war, ging es ruhig geradeaus weiter. Doch nun sind da die Kurve und die Brücke. Der Schlitten driftet nach außen. Er ist zu schnell, viel zu schnell. Er kippt, fährt nur noch auf einer Kufe. Die Brücke hat kein Geländer und kommt rasend schnell näher. Die Hunde hetzen über die Brücke, dem Hasen hinterher. Bald ist auch der Schlitten auf der Brücke.
„Akela, halt an!“ Enola kann nur noch schreien. Sie hat noch nie solche Angst gehabt wie jetzt, als der Abgrund, über den die Brücke führt, auf sie zurast. Vier, fünf Meter tiefer fließt ein Fluss, der von dünnem Eis überzogen ist, das sie niemals auffangen wird. Sie wird hineinfallen in das eisige Wasser. Und dieser Gedanke lähmt all ihre Bewegungen. Sie hört nicht Lisanns Rufe hinter sich.
„Die Bremsmatte, Enola! Nimm die Bremsmatte!“
Das ist eine Gummimatte, die an zwei Seilen mit dem Schlitten verbunden ist und die vor ihr an der Lehne hängt, eine Matte, die Lisann längst ausgehängt hat, und auf ihr stehend, ihren Schlitten zum Halten bringt. „Spring ab, Enola! Du musst abspringen!“
Aber Enola kann nichts hören. Eine unheimliche Stille hüllt sie ein, als der Schlitten über die linke Kufe kippt und sie den Halt verliert. Lautlos fliegt sie vom Schlitten und prallt auf die Brücke.
Enola ist hellwach. Sie ist nicht im Wasser, sie ist auf der Brücke. Festhalten, irgendwo festhalten! Aber da ist nichts zum Festhalten, es gibt kein Geländer. Enola wirbelt weiter. Die Welt dreht sich um sie, der Schnee im Gesicht, der Schmerz in der Schulter und am Kopf und dann die Leere unter ihren Beinen.
„Halt aus! Halt dich fest!“
Aus der Ferne ist Lisann zu hören. Enola sieht nach oben und spürt ihre Unterarme auf dem Rand der Brücke im Schnee. Aber sie findet keinen Halt. Nicht mit den dicken Handschuhen. Nicht in dem Schnee, der auf der Kante liegt. Sie spürt, wie sie rutscht, den letzten Halt verliert und fällt.
Plötzlich ist da ein Ziehen im Arm.
Lisann liegt mit dem Gesicht im Schnee und hält Enola mit beiden Armen über der Brückenkante. Nicht loslassen! Einfach hochziehen! Aber sie spürt, wie Enolas Gewicht sie langsam über die Kante zieht. Sie hat keinen Griff mit ihren Fäustlingen. Lisann greift nach, packt zu mit aller Kraft. Enolas Ärmel rutscht zwischen ihren Händen. Sie hält ihren Handschuh, doch sie spürt wie Enola aus dem Handschuh herausrutscht. Sie kann sie nicht halten. Voller Entsetzen sieht sie Enola in die Tiefe fallen.
Erneut ist alles still. Dann hört Enola, wie sie durch das Eis bricht, und entsetzliche Kälte lähmt ihren Körper. Sie kämpft nicht dagegen an, hat keine Kraft mehr, keinen Willen, bis alles um sie herum dunkel wird, tiefschwarz und völlig still.
Enola spürt nicht, wie das Wasser eine Hülle um sie bildet und sich aus ihren Kleidern zurückzieht, und wie sie völlig trocken vom Fluss mitgerissen wird. Sie bekommt auch nicht mit, wie Lisann an der Böschung entlang hastet und an einer geeigneten Stelle in das eiskalte Wasser springt, um sie an Land zu ziehen.
Lisann hat keine Zeit, sich zu wundern, dass Enola noch atmet, dass sie so trocken ist. All ihr Handeln läuft ab wie im Rausch, ohne dass sie darüber nachdenkt. Sie legt Enola über ihre Schulter. Mit einer Hand am Boden Halt suchend, kämpft sie sich den Hang hinauf, zurück zur Brücke, zu den Hunden, die dort im Schnee liegen, als sei nichts gewesen. Am Ende ihrer Kräfte stolpert Lisann zu ihrem Schlitten, legt Enola hinein und deckt sie notdürftig zu.
Schon laufen die Hunde los. „Heya, heya!“ Es geht heimwärts, zu einem Haus, dessen Wärme Lisann noch nie so herbeigesehnt hat wie jetzt, als sie in klitschnassen Kleidern im eisigen Fahrtwind ihres Schlittens steht. Enolas Hunde folgen ihr. Dass der Schlitten, den sie ziehen, noch immer auf der Seite liegt und über den Schnee geschleift wird, nimmt Lisann nicht wahr. Nur noch nach Hause!
*
Akela knurrt leise und bleibt neben Enolas Bett stehen.
„Okay, schon klar.“ Enolas Vater wollte den großen Husky nach draußen bewegen, spürt aber, dass Enolas Lieblingshund nicht von ihrer Seite weichen wird. Hans streicht noch einmal mit der Hand über Enolas Kopf und geht dann zu Finn und Lisann hinüber, die an der Zimmertür stehen. Er hört das Scharren auf dem Dielenboden, als Akela sich wieder niederlegt.
Enolas Hund versteht viel von dem, was hier vorgeht. Er wird bei Enola bleiben, was auch geschieht. Müde legt er den Kopf auf seine Pfoten, aber seine Augen blicken wachsam.
Lisann macht sich Vorwürfe und flüstert Enolas Vater zu. „Sollen wir wirklich keinen Arzt holen?“
Hans nimmt Lisann in den Arm. „Keine Angst. Sie ist nicht verletzt, auch wenn es mir wie ein Wunder vorkommt. Ich denke sie braucht nur Ruhe. Schlaf war seit jeher die beste Medizin. Wir haben das immer so gemacht.“ Dann wendet er sich an Finn. „Bleibst du eine Weile bei deiner Schwester?“
„Klar.“
Hand in Hand gehen Hans und Lisann aus dem Haus. Nach einer kurzen Winterwanderung stehen sie am Fluss.
Lisann schüttelt den Kopf. „Ich kann es nicht glauben. Sie war trocken, völlig trocken.“ Dann erzählt sie, wie alles geschehen ist. Trotz ihrer Erklärungen bleibt der Vorfall rätselhaft: Ein Kind fällt im Winter in einen zugefrorenen Fluss, wird von der Strömung mitgerissen, teilweise unter dem Eis, dann trocken an Land gezogen und nach Hause gebracht, als ob es nie hineingefallen wäre.
Hans und Lisann denken an die Erlebnisse, die sie vor anderthalb Jahren in den Alpen hatten. Ein seltsames Buch hätte sie beinahe ins Verderben gestürzt. Enola entwickelte damals eine unheimliche Verbindung zum Wasser. Dann war das Buch verschwunden und sie redeten sich ein, dass all ihre haarsträubenden Erlebnisse irgendwie erklärbar wären.
Beginnt jetzt alles von neuem?
Nebel
Dunkelheit. Völlige Schwärze hüllt Enola ein. Dann sieht sie ein Leuchten, das näherkommt und die Dunkelheit vertreibt. Enola taucht in einen hellen Nebel ein. Der Nebel ist überall. Sie scheint zu schweben. Sie sieht sich um und ihr Blick bleibt an einer Unregelmäßigkeit im Nebel haften. Etwas bewegt sich auf sie zu. Es ist eine Gestalt, eine Gestalt, wie aus Nebel selbst, leuchtend und freundlich. Ein weibliches Wesen mit langem, rötlichem Haar und einem weiten Gewand. Haare und Gewand bewegen sich, als wehe ein leichter Wind.
„Enola, komm mit mir!“
Enola wundert sich. „Woher kennst du meinen Namen? Wer … wer bist du? Bist du ein Engel und bin ich jetzt tot?“
„Ich bin eine Fee und du bist nicht tot. Folge mir und hab keine Angst.“
Aber Enola hat Angst. Alles ist so wirklich. „Ich möchte nach Hause, ich … ich will zurück!“ Gedanken jagen ihr durch den Sinn: ihr Zuhause, ihr Vater, ihr Bruder, Lisann, die Hunde. Aber dann ist da die Fee, die vor ihr in der Luft schwebt und zu leuchten scheint. Enola blickt in die Augen der Fee. Sie schauen so freundlich und sind freudig auf sie gerichtet, sodass Enola langsam ihre Angst verliert. Die Fee strahlt Ruhe und tiefes Vertrauen aus, ohne ein Wort zu sagen, allein durch ihre Anwesenheit. Die beiden schauen sich in die Augen und nach einer kleinen Ewigkeit weicht das unbehagliche Gefühl, das Enola gefangenhielt. Sie schwebt neben der Fee durch den Nebel. Unzählige Lichter tauchen in der Ferne auf. Enola bewegt sich auf eines der Lichter zu.
„Du wirst in deine Welt zurückkehren.“ Die Fee schaut Enola an. „Aber ich möchte, dass du uns vorher hilfst.“
Enola ist erstaunt. „Helfen, wobei, und wieso ich?“
„Du wirst es erfahren. Hab Vertrauen in die Natur und folge deinem Gefühl.“ Die Fee deutet auf ein Licht, ganz in der Nähe. „Dort ist das Tor in unsere Welt …“
Wie die Stimme sich im Nebel verliert, so löst sich auch die Gestalt der Fee in gleißendes Licht auf und im selben Moment verblassen Enolas Erinnerungen an ihre Vergangenheit. Es gibt keine Vergangenheit mehr. Es gibt nur noch die Zukunft, die hinter dem Nebel liegt, im Licht jener Welt.
*
Zuerst spürt Enola den weichen Boden. Sie kennt das Gefühl, weiß aber nicht woher. Es ist Waldboden, der an vielen Stellen von Moos überzogen ist. Sie schaut nach unten und betrachtet ihre Füße, die in einfachen halbhohen Lederschuhen stecken, die von einer derben Schnur zusammengehalten werden. Sie blickt an ihrer Leinenhose nach oben. Diese ist gerade geschnitten und mit aufgesetzten Taschen versehen.
Sie trägt ein weites Leinenhemd, das um die Taille mit einer geflochtenen Schnur zusammengehalten wird.
Enola schaut auf. Der Nebel zieht sich zurück und gibt den Blick frei auf riesige Bäume. Die Baumkronen leuchten hellgrün. An vielen Stellen finden Sonnenstrahlen einen Weg durch das Blätterdach. Enola kann sich kaum rühren. Sie ist wie gebannt von dieser außergewöhnlichen Schönheit. Die Augen nach oben gerichtet beginnt sie, sich langsam auf der Stelle zu drehen. „Wunderschön …“ Ihr Blick gleitet an einem der Bäume herab. Sie sieht leuchtende Blätter und mächtige Äste. Der Stamm ist mit Moos und Flechten bedeckt. Oft finden kleine Pflanzen und Blumen Halt an der groben Borke. Selbst mit ausgestreckten Armen könnte sie seinen Stamm nicht einmal zur Hälfte umfassen. Enola atmet tief ein und schaut wieder nach oben. Unzählige blaue Blüten schmücken die Krone dieses Baumes und verströmen einen bezaubernden Duft, der Schmetterlinge, Hummeln und Bienen anzieht. Dann nimmt sie die Vögel wahr und lauscht ihren wunderbaren Melodien.
Ohne Ziel läuft Enola vor sich hin. Zwischen den Bäumen liegen mächtige Steine, auf denen Flechten fantastische Bilder malen. Ab und zu versperren riesige Farne die Sicht und doch ist der Wald so licht, dass Enola zwischen allem ungehindert hindurchgehen kann. Soweit sie schauen kann, reicht dieser Wald. Was für ein Paradies.
Magie
Eine junge Frau sitzt auf dem Fußboden in der Mitte ihres Hauses. Sie öffnet die Augen, streicht sich einige Strähnen ihres roten Haares aus dem Gesicht und atmet tief aus. Sie hat es geschafft. Auf ihren Wanderstab gestützt, der noch immer leuchtet, als würde die Sonne in ihm scheinen, erhebt sie sich und geht zur Tür.
Ein alter Mann sieht die Zauberfrau, wie sie in den Walddörfern genannt wird, aus ihrer Hütte treten. Lange hat er warten müssen. Jetzt geht er ihr gespannt entgegen.
„Sie ist da.“ Die Frau lächelt den Alten an und nickt in Zuversicht.
„Was müssen wir tun?“
„Nichts. Der Junge wird sie finden.“
Der Mann senkt den Kopf, als betrachte er seinen langen weißen Bart. „Aber wenn er sie nicht … wenn es vorher dunkel wird, wenn sie ihm zuvorkommen? Die Schlangen sind verflucht, sie sind böse.“ Der Alte sieht die Frau sorgenvoll an.
„Was sie hier tun soll, kann sie nur schaffen, wenn sie das ist, was ich glaube. Sie wird es aber auch nur schaffen, wenn der Junge ihr hilft. Sie braucht ihn. Er muss sie finden und gemeinsam werden sie ihren Weg gehen. Ich habe sie gerufen. Das ist alles was ich tun konnte. Das Schicksal unserer Welt liegt nun in ihrer beider Hände.“
„Was ist mit dem Schwert?“
„Der Junge wird sie hinführen. Er war schon so oft dort und hat es vergeblich versucht, er wird sie es versuchen lassen. Hab Vertrauen, noch lebt diese Welt. Richte bitte allen anderen meine Grüße aus.“
Der Alte ergreift die Hand der jungen Frau und blickt ihr hoffnungsvoll in die Augen. „Hab Dank und leb wohl.“ Er wendet sich ab und macht sich auf den langen Weg zurück zu seinem Dorf. Nach einigen Schritten blickt er sich um, als hätte er etwas gespürt. Er sieht Büsche und Bäume und hohe Farne. Die Frau und ihr Haus kann er nicht mehr entdecken. Aber er war doch noch gar nicht so weit gegangen. Er lächelt und schüttelt den Kopf. Es ist wirklich wahr, was man sich erzählt. Niemand, der bei der Zauberfrau war, kann sich erinnern, wo sie wohnt.
Schmunzelnd beobachtet die junge Frau, wie der Alte seinen Kopf schüttelt und dann seinen Weg durch den Wald fortsetzt. Sie geht zu einer riesigen Schlange, die hinter dem Haus zusammengerollt zwischen den Bäumen liegt. Die Schlange züngelt und hebt den Kopf ein wenig. Die Frau muss nach oben schauen, um ihr in die Augen zu blicken.
Die Schlange kann nicht verstehen, was die Frau ihr sagt, aber Bilder tauchen in ihrem Kopf auf. In Gedanken sieht die Schlange, was sie tun soll. Dann spürt sie, wie die Frau mit ausgestrecktem Arm über die beiden alten Narben auf ihrem schwarz-gelb gemusterten Rücken streicht. Menschen hatten die Schlange vor langer Zeit gejagt. Die Frau fand sie im Wald und pflegte sie gesund. Seitdem sind sie Freunde. Die Schlange neigt ihren Kopf als Geste der Zustimmung und kriecht zwischen den Bäumen davon.
Die Frau folgt einem plätschernden Bach in ein sonniges Tal. Bald hat sie die beiden kleinen Kinder entdeckt, die sorglos am Ufer des Baches spielen. Auch sie sind angekommen. Zufrieden setzt sich die Frau mit dem Rücken an einen Baum und schaut dem Spiel der Kinder zu. Irgendwann werden die beiden sie schon entdecken. Sie wird viel von den Kindern verlangen müssen, aber es scheint der einzige Weg zu sein …
Schlangen und Spinnen
Das Reh hebt langsam den Kopf aus dem Gras des Waldes und schaut den Jungen an. Es sieht ihn neben einem der riesigen Bäume stehen, in zerrissenen schmutzigen Kleidern, umgeben von hohem Farngras. Er ist noch ein Junge, aber in seinen großen freundlichen Augen spiegeln sich Wissen und Erfahrung eines Menschen wider, der draußen in den Wäldern lebt. Das Reh sieht den Pfeil, der in dem gespannten Bogen des Jungen liegt. Es weiß nicht, dass der Pfeil gleich von der Sehne schnellen und ihm den Tod bringen wird.
Aber nichts passiert. Der Blick des Jungen schweift nach oben. Die Spannung des Bogens schwindet. Der Junge lässt ihn sinken und schaut über das Reh hinweg, zwischen den Bäumen hindurch, in die Ferne. Er spürt ein Mädchen, das ganz allein in diesem riesigen Wald steht. Er kennt dieses Mädchen, obwohl er ihm nie begegnet ist. Und er spürt, dass er zu ihm muss. Er muss es finden. Er weiß nicht wieso, versteht nicht die Magie, die sich über allem entfaltet. Es ist nur ein Gefühl, aber es ist überwältigend und setzt ihn in Bewegung. Er verstaut den Pfeil im Köcher und zieht den Gurt fest, der sein Holzschwert auf dem Rücken hält. Dann rennt er los. Er muss zu diesem Mädchen.
Der Junge kennt den Wald und spürt den Ort, an dem es sich befindet. Er weiß, wie weit es ist und fürchtet, dass die Nacht hereinbricht, bevor er das Mädchen erreicht. Ob es weiß, dass sie kommen, wenn es dunkel ist? Nein. Es weiß gar nichts, es war noch nie hier. Aber er kennt die Bewohner des Waldes. Sie werden kommen und das Mädchen fressen, erbarmungslos. Er selbst hat viel Glück gehabt, den dunklen Schlangen bei der ersten Begegnung zu entkommen. Das Glück des Mädchens muss sein, dass er es rechtzeitig erreicht.
Bäume fliegen an ihm vorbei, Farne schlagen ihm ins Gesicht. Er hetzt durch die Wildnis wie ein gejagtes Tier, über Steine hinweg mit gekonnten Sprüngen. Seine Bewegungen sind fließend, als ob er ein Teil des Waldes sei. Eine Hand hält den Bogen, die andere schlägt Zweige aus dem Weg.
Der Wald endet an einem Abhang, der zu einer Schlucht führt. Der Junge rennt ihn hinab. Dabei verliert er die Kontrolle auf dem losen Geröll. Um ein Haar entgleitet ihm der Bogen. In einer Wolke aus Staub rutscht der Junge den Hang hinunter. Dann gelingt ihm eine schnelle Drehung auf den Bauch, sein rechter Arm taucht in den Schotter ein und die Gerölllawine kommt zur Ruhe.
Er schnellt auf und hetzt am Rande einer gewaltigen Schlucht entlang. Roter Fels wurde in Tausenden von Jahren von einem mächtigen Fluss geteilt. Der Fluss donnert in schwindelerregender Tiefe dahin. Das Tosen der Wassermassen ist so laut, dass der Junge es hier oben hören könnte, wenn er stehenbliebe. Aber er bleibt nicht stehen, er rennt auf einen Baumstamm zu, der eine natürliche Brücke über die Schlucht bildet. Der Junge muss klettern, um auf den Stamm zu gelangen, der doppelt so dick ist, wie er groß. Der Baum bietet einen sicheren Weg über die Schlucht. Trotzdem muss sich der Junge konzentrieren, da er hinüberrennt. Er verpasst die wunderbare Aussicht, die der Blick nach Norden bietet und erreicht bald die andere Seite.
Die Krone des riesigen Baumes liegt auf festem Grund. Die unteren Äste sind zerborsten. Bei dem gewaltigen Aufprall haben sie sich teilweise in die Erde gegraben. Der Junge hat keinen Blick dafür. Er klettert durch die Krone des Baumes, balanciert über die Äste nach außen und springt in das Laub hinunter, das einst diesen Baum schmückte. Die Blätterschicht reicht ihm bis zu den Knien. Er watet hindurch und stürzt wieder in den Wald. Erneut schlagen ihm Äste ins Gesicht. Die Wedel mannshoher Farne schneiden in seine Haut. Er nimmt das kaum wahr. Seine Gedanken sind bei dem Mädchen. Er läuft wie im Rausch. Aber als er einen kleinen Fluss erreicht, ihn entlang watet, über Steine springt, abrutscht, sich wieder fängt und weiter hastet, wird ihm die Dämmerung bewusst, die sich über den Wald legt.
„Schneller, lauf schneller, lauf!“ Er spricht zu sich selbst, während er den Fluss hinter sich lässt. Seine Füße sind nass, seine Kleidung ist getränkt vom Schweiß, der ihm auch von der Stirn in die Augen läuft. Er wischt ihn mit dem Ärmel ab und verschmiert dabei das Blut der kleinen Farnschnitte im Gesicht.
Es ist fast dunkel, als er des Mädchens Angst spürt. Er zieht im Lauf einen Pfeil aus dem Köcher, legt ihn in den Bogen und bleibt stehen. Er fühlt, wo das Mädchen ist. Er zieht den Bogen aus, soweit er kann. Das Holz knarrt, als er ihn nach oben richtet. Sein Blick ist nach innen gekehrt. Nicht denken. Fühlen! Und frei von allen Gedanken, geführt vom Geist der Welt, gleiten seine Finger von der Sehne, die den Pfeil beschleunigt und dann freigibt. Mit einem Zischen saust der Pfeil durch das Blätterdach des Waldes. Der Junge schaut ihm nicht nach. Er muss weiter.
*
Enola bleibt stehen. Ihr stockt der Atem. Alles war wunderschön. Die Ruhe, der tiefe Frieden über dem Wald, die vielen Tiere um sie herum. Vögel sangen in den Bäumen. Eichhörnchen sprangen von Ast zu Ast. Schmetterlinge tanzten im Sonnenlicht. Libellen schwebten lautlos dahin. Mäuse und Echsen huschten über den Boden. Jetzt ist nichts mehr davon da. Mit der Dämmerung hat sich der Wald verändert. Er ist dunkel und bedrohlich geworden. Die Bäume sind mächtige graue Säulen, die sich in der Schwärze der Nacht verlieren.
Enola steht ganz still. Voller Entsetzen starrt sie eine riesige Schlange an, die auf sie zukriecht. Die Schlange ist so dick, dass sie ihr über die Knie reicht. Die Länge kann Enola kaum abschätzen, da sich die Schlange in der Dunkelheit des Waldes zwischen Farngras verliert. Angst befällt sie. Enola spürt ihre Beine nicht, ist wie gelähmt. Sie ist unfähig, einen Schritt zu machen, geschweige denn zu laufen. Die Schlange kommt züngelnd näher. Alles, was Enola ihr entgegenbringen kann, ist eine hilflose Bewegung ihrer Arme, die sie vor dem Körper nach unten hält. Ihre Hände sind geöffnet, die Handflächen zur Schlange gekehrt, als wolle sie sagen: Sieh, ich tue dir nichts.
Aber das schwarze Ungetüm bleibt gefühllos. Die Augen sind schmale Schlitze, dunkel und leer. Die Schlange hebt den Kopf und züngelt erneut. Sie ist nur wenige Schritte entfernt. Enola beginnt zu zittern. Sie starrt die Schlange an. Gleich ist alles aus. Die Fee hatte von einer Aufgabe gesprochen, von Hilfe. Wie sollte sie dieser Welt helfen? Enola beginnt zu lachen, zu weinen. Ihre Gefühle spielen ein Spiel mit ihr.
In diesem Moment hört sie ein Zischen. Es kommt jedoch nicht von der Schlange, sondern aus dem Blätterdach des Waldes. Ein Pfeil saust auf Enola zu, an ihr vorbei, blitzschnell. Sie erschrickt und fährt herum. Wenige Schritte entfernt liegt eine andere Schlange, von der sie gar nicht wusste, dass sie da war, mit dem Pfeil im Leib leblos am Boden. Als es noch einmal zischt, schaut sie wieder nach vorn, um gerade noch zu sehen, wie der Kopf der ersten Schlange zu Boden sinkt.
„Lauf, Enola, lauf weg!“ Ein Junge stürzt aus dem Dunkel des Waldes heraus. Er legt einen weiteren Pfeil in seinen Bogen ein, bleibt vor ihr stehen und verharrt in eigenartiger Ruhe.
Dann saust der Pfeil an Enola vorbei. Als sie sich umdreht, fällt ihr Blick erneut auf eine tote Schlange.
„Lauf, Enola! Es sind zu viele, es werden immer mehr! Dort entlang, den Pfad bis zum See! Sie fürchten das Wasser. Lauf zum See, na los!“ Er stößt sie sanft in die richtige Richtung.
Enola spürt ihre Beine wieder, spürt, wie das Leben in ihren Körper zurückkehrt. Sie rennt, stetig schneller werdend, den Pfad entlang. Gedanken jagen ihr durch den Sinn. Wer ist dieser Junge und woher kennt er ihren Namen? Der Pfad ist schwer zu erkennen. Es ist dunkel. Sie kann kaum etwas sehen und rennt einfach dort entlang, wo keine Zweige und Farne den Weg versperren. Wo ist sie hier hineingeraten? Was ist das für eine Welt und wieso kennt der Junge ihren Namen? Enola läuft ohne zu schauen, ohne über ihren Weg nachzudenken. Sie denkt an den Jungen, an die Schlangen, an die Fee …
In diesem Moment wird ihr Lauf von einem übergroßen Spinnennetz gebremst, das quer über den Weg gespannt ist. Klebrige Fäden treffen ihr Gesicht und ihre Hände. Sie wird federnd aufgefangen und zurückgeworfen. Aber sie fällt nicht aus dem Netz heraus, sondern klebt an Dutzenden von dünnen Fäden fest.
Die Wucht des Aufpralls holt ihre Gedanken zurück. Enola spürt, wie hilflos sie ist. Ihr ganzer Körper ist mit diesem klebrigen Zeug überzogen. Sie kann sich kaum rühren, fängt an zu ziehen, zu zerren und letztlich zu toben. Es ist ein wilder Tanz, den sie aufführt, ein Kampf gegen klebrige Fäden. Sie dreht und windet sich und verfängt sich mehr und mehr im Netz einer riesigen Spinne. Herbeigerufen von Enolas panischen Bewegungen kommt die Spinne auf sie zu.
„Wyn, hilf mir! Wyn!“ Enola weiß nicht, woher sie den Namen des Jungen kennt. Sie hat nur Angst, schon wieder.
Auf acht Beinen überquert das Ungeheuer das Netz. Schon spürt Enola die Schwingungen in den Fäden, die sie gefangen halten. Dann ist die Spinne über ihr und beißt zu. Enola spürt den Schmerz im Arm. „Wyn, Hilfe! Wyn!“ Ihre Augen suchen den Wald ab. Aber Wyn kommt nicht und Enola kann nur noch schreien. Dann versagt ihre Stimme. Das Gift der Spinne breitet sich in ihren Körper aus. Sie verliert jedes Gefühl und Dunkelheit hüllt sie ein.
Rettung
Es sind zu viele Schlangen. Wyn muss sie ablenken, um dem Mädchen einen Vorsprung zu verschaffen. Er dreht sich im Kreis, springt auf Steine und wieder herab, läuft zwischen den Schlangen hindurch, weicht ihren riesigen Mäulern aus, in denen große, spitze Fangzähne sitzen. Manchmal springt er auf ihren dicken Leibern von einer Schlange zur anderen. Die Schlangen sind sich dann selbst im Weg und fauchen sich an. Er spürt in diesen Momenten ihren Hass, ihre Unzufriedenheit mit sich selbst, mit ihrem Dasein, mit der ganzen Welt. Die Schlangen sind verflucht. So wird in alten Legenden berichtet. Alles scheint wahr zu sein …
Dann hört er Enola schreien. Wyn schaut auf. Ist Todesangst in ihrer Stimme? Was ist mit ihr passiert? Sie müsste fast am See sein.
Plötzlich stößt eine der Schlangen zu. Wyn kann mit einem Sprung hinter den nächsten Baum dem Maul der Schlange entgehen. Die Borke des Baumes zerstiebt unter der Wucht ihres Stoßes. Dann rennt der Junge los. Er lässt die Schlangen hinter sich. Trotz ihrer Größe sind sie nicht so schnell wie er.
Im letzten Licht der Dämmerung sieht er Enola im Netz hängen. Die riesige Spinne ist über ihr. Wyn weiß, dass die Spinnen nicht bösartig sind. Sie spannen nachts ihre Netze auf und hoffen auf Beute. Am Morgen verzehren sie die Netze wieder und verbringen den Tag in hohlen Bäumen in Ruhe oder Schlaf. Sie sind friedliebende Tiere, die nur auf die Signale ihrer Netze reagieren und ihrem Instinkt folgen, wenn sie jemanden betäuben und einspinnen.
Wyn sieht, wie die Spinne den bewegungslosen Körper des Mädchens in einen klebrigen Faden wickelt. Er wirft seinen Bogen zu Boden und greift nach dem Schwert, das er auf dem Rücken trägt. Es ist aus Holz. Die Menschen, die hier leben, haben nur die Rohstoffe des Waldes zur Verfügung. Es gibt Holzarten, die hart wie Stein sind und sich schwer bearbeiten lassen. Die Waldbewohner haben eine erstaunliche Handwerkskunst entwickelt, die sich auch im Schwert des Jungen widerspiegelt. Es ist zweischneidig und für ein Holzschwert erstaunlich scharf. Das Heft ist mit einer Lederschnur umwickelt, so dass Wyn es trotz seiner feuchten Hände fest im Griff hat. Er stürzt auf die Spinne zu. „Geh fort, weg da! Sie gehört mir!“
Die Spinnen sind scheu. Sie fürchten andere Tiere oder Menschen und gehen ihnen aus dem Weg. So weicht die Spinne zurück, während der Junge beginnt, mit dem Schwert das Mädchen freizuschneiden. Wyn muss sich in Acht nehmen, nicht selbst an den Fäden haften zu bleiben.
Der Spinne scheint es nichts auszumachen, ihre Beute zu verlieren. Sie schaut zu, wie das eingesponnene Mädchen zu Boden fällt und der Junge versucht, es zu befreien. Sie sieht seine schnellen Bewegungen, sieht seinen Blick zu ihr wandern, dann zurück in den Wald, als erwarte er irgendetwas von dort. Seine Bewegungen werden ungeduldig, hektisch. Er zerrt an den Fäden, die oft mit einem plötzlichen Ruck zerreißen, so dass er rücklings zu Boden fällt. Es sind nur kleine Stücke, die er nach und nach lösen kann, doch endlich ist der Kopf des Mädchens frei.
Wyn sieht Enolas geschlossene Augen und den friedlichen Ausdruck auf ihrem Gesicht, als ob sie schliefe. Er beugt sich zu ihr hinunter und spürt ihren gleichmäßigen Atem. Sie lebt. Was für ein Glück!
Die Spinne kauert auf ihrem Netz. Es scheint ihr, als würde ein eigenartiges schwaches Leuchten von dem Ort ausgehen, an dem der Junge mit dem Mädchen in seinen Armen auf dem Boden sitzt. Plötzlich ist das Leuchten weg und der Junge starrt in den Wald. Die Spinne verschwindet in ihrem Baum, als die ersten dunklen Umrisse der Schlangen zu erkennen sind. Auch sie kennt diese Ungeheuer.
Wyn will nicht weiterkämpfen, will nicht noch mehr töten. Er kennt die alten Legenden von dem Fluch, der auf den Schlangen liegt. Dass sie keine Schlangen sind, sondern … Keine Zeit für Überlegungen. Er muss fort, zum See. Wyn nimmt seinen Bogen und packt das eingesponnene Mädchen. Er schleift es zum See, zum Wasser. Die Schlangen sind hinter ihnen her. Sie kommen näher und er kommt kaum voran. Wyn geht rückwärts, stemmt die Füße Schritt für Schritt in den weichen Boden. Schon sieht er die ersten Schlangen. Sie lösen sich aus dem Dunkel des Waldes. Dann zögern sie und verharren züngelnd. In diesem Augenblick tritt er rücklings ins Wasser. Es ist kühl und fast so klar wie die Luft. Mächtige alte Bäume stehen im Wasser. Hier und da haben sich im Laufe der Zeit kleine Inseln um die Bäume gebildet.
Wyn schwimmt mit dem Mädchen zur nächsten Insel hinüber. Immer wieder taucht es unter. Die Fäden der Spinne saugen sich langsam mit Wasser voll. Es fällt Wyn schwer, mit seiner Last zu schwimmen. Sie drückt ihn wieder und wieder unter Wasser. Er ist am Ende seiner Kräfte, aber er darf das Mädchen nicht verlieren.