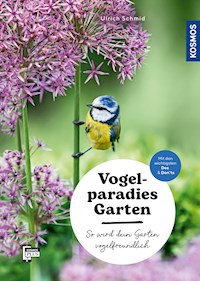14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein ganz besonderer Naturführer über die 30 bekanntesten Vögel, zu denen wir Menschen eine ganz besondere Beziehung haben. Oft ist es deren Lebensweise, die uns Menschen fasziniert und um die sich Sagen und Brauchtum gebildet haben. Neben den Bestimmungsmerkmalen und detailreichen Zeichnungen werden besondere Geschichten, Begegnungen und der Bezug der jeweiligen Art zu uns Menschen unterhaltsam und emotional erzählt. Die Natur ist kostbar – dieser bibliophil mit Halbleinen und offenem Papier ausgestattete Band für Naturliebhaber ist es auch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Statt dessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
AMSEL
BLAUMEISE
BUCHFINK
EISVOGEL
ELSTER
FELDLERCHE
FITIS UND ZILPZALP
GELBKOPFAMAZONE
GRÜNSPECHT
HAUSROTSCHWANZ
HAUSSPERLING/SPATZ
KIEBITZ
KORMORAN
KRANICH
KUCKUCK
MÖNCHSGRASMÜCKE
NACHTIGALL
NILGANS
RABENKRÄHE
RAUCHSCHWALBE
ROTKEHLCHEN
ROTMILAN
SPERBER
STAR
STOCKENTE
STRASSENTAUBE/HAUSTAUBE
URVOGEL
WACHTELKÖNIG
WALDKAUZ
WANDERFALKE
WEISSSTORCH
ZAUNKÖNIG
„Folg ich der Vögel wundervollen Flügen …“
GEORG TRAKL
Vögel faszinieren. Sie sprechen Herz und Hirn an, beflügeln Kunst und Wissenschaft gleichermaßen. Vögel sind überall, wo auch wir sind. Wir begegnen ihnen im Großstadtdschungel ebenso wie im Urwald, im heimischen Garten ebenso wie im Urlaub am Meer. Und wenn wir sie nicht sehen, dann hören wir sie. Jeder kennt den Kuckuck (obwohl ihn nur wenige gesehen haben). Sein Ruf – oder, ornithologisch korrekt: sein Gesang – schallt uns aus Kinderliedern ebenso entgegen wie aus der berühmten 6. Symphonie von Ludwig van Beethoven, zu deren zweitem Satz sich der Komponist im Sommer 1807 am Wiener Schreiberbach Anregungen holte:
„Hier habe ich die Szene am Bach geschrieben, und die Goldammern da oben, die Wachteln, Nachtigallen und Kuckucke ringsum haben mitkomponiert.“
Ebenso inspirierend wie die Lieder der Vögel sind ihre Farben. Unsere nähere Verwandtschaft, die Säugetiere, ist in dieser Beziehung eher lahm, was damit zusammenhängt, dass Farben im Tierreich in erster Linie der Kommunikation dienen und fast alle Säuger Farben nur eingeschränkt wahrnehmen. Warum sollte man bunt sein, wenn das Gegenüber das nicht sieht? Um sich zu verständigen, setzen die meisten Säugetiere deshalb eher auf die Nase als aufs Auge. Ausnahmen sind viele Primaten, unter ihnen wir Menschen – wir sehen die Welt bunt, ein Glück, denn ohne diese Fähigkeit wäre das Leben für uns um vieles ärmer. Aber so wie wir bedauernd auf andere Säuger schauen, blicken die Vögel vermutlich auf uns. Sie können über das für uns wahrnehmbare Spektrum hinaus auch das für uns unsichtbare UV-Licht sehen, ihre Welt muss noch bunter sein als unsere. Deshalb sind auch die Vögel selbst bunt: Wo Farbe wahrgenommen wird, wird Farbe auch eingesetzt. Werbung wird mit Farbe erst richtig wirkungsvoll. Viele Vogelmännchen sind deshalb echte Hingucker, nicht wenige auch wahre Meister darin, die optischen Signale bei der Balz durch auffälliges Verhalten richtig in Szene zu setzen.
Vögel sind wie Menschen „Augentiere“ und als solche überwiegend tagaktiv – ein weiterer Grund, weshalb wir uns ständig begegnen. Dass wir Menschen inzwischen nicht mehr mit den Hühnern aufstehen und mit ihnen zu Bett gehen, ist eine Folge des technischen Fortschritts, der uns ermöglicht, unseren Sehsinn auch nachts einzusetzen. Jeder Stromausfall führt aber schnell vor Augen, wie schlecht wir für die Dunkelheit gerüstet sind und dass die Nacht eigentlich dem Schlaf gehört.
Hätte ich drei Wünsche frei, wäre mein erster: sehen wie ein Vogel. Der zweite: fliegen wie ein Vogel.
Der Traum vom Fliegen, die ewige Sehnsucht. Störche und Geier, die ohne einen einzigen Flügelschlag stundenlang kreisen, Wanderfalken, die bei ihren atemberaubenden Sturzflügen jeden Formel-1-Piloten hinter sich lassen würden, Streifengänse, die des Himalayas höchste Gipfel von oben anschauen können, Eulen, die den lautlosen Flüsterflug beherrschen – auch jenseits solcher Ausnahmetalente gibt der „ganz normale“ Vogelflug Grund zur Bewunderung und zum Staunen. Nachahmung ist zwecklos, obwohl bereits früh und immer wieder versucht. Sagenhaft bei Dädalus und Ikarus, die sich ihrer Gefangenschaft auf Kreta mithilfe von aus Vogelfedern gefertigten Flügeln entziehen wollten. Wissenschaftlich bei Leonardo da Vinci in seinem um 1505 entstandenen „Codice sul volo degli uccelli“ (Kodex über den Vogelflug). Sein Assistent brach sich beim Testen die Knochen und hatte dabei noch Glück, im Gegensatz zu vielen weiteren Flugpionieren, die ihr Leben ließen beim Versuch, es den Vögeln gleichzutun. Gleiten können wir inzwischen zwar mithilfe verschiedener Hilfsmittel wie Gleitschirmen einigermaßen gefahrlos, aber den eigentlichen Flug, den Schlagflug, werden wir nie beherrschen.
Vögel sind in vieler Hinsicht fürs Fliegen optimiert. Das geht einher mit Einschränkungen an anderer Stelle. Man denke zum Beispiel daran, was wir (und andere Säugetiere) mit den Händen (oder Pfoten) machen können. Dieses Handicap haben Vögel aber ziemlich ausgeglichen. Der Schnabel ist ein geniales Multifunktionswerkzeug zum Nahrungserwerb und zur Gefiederpflege.
Fliegen kostet viel Energie. 13.000 Liter Kerosin verbraucht ein Jumbojet pro Stunde, über 200 Kubikmeter umfassen die Tanks. Auch Vögel haben „Tanks“ für Langstreckenflüge, Fettdepots an der Körperunterseite nahe dem großen Brustmuskel, ihrer Flugmaschine. Die Kehrseite: Wer energiesparend fliegen will, sollte möglichst leicht sein. Vögel können also nicht grenzenlos Reserven bunkern, wie das viele Säugetiere tun, wenn sie sich zum Beispiel Winterspeck anfressen. Sie können sich deshalb keine langen Auszeiten bei der Nahrungssuche leisten und sind fast ständig aktiv – wieder ein Grund, warum sich Vögel so viel leichter beobachten lassen als die meisten andere Tiere. Besonders einfach geht das im Garten, wo Vögel ihren Energiehunger an Futterstationen stillen können.
Dort hat auch manche Forscherkarriere begonnen. Mit dem Beobachten kommen die Fragen. Am winterlichen Futterhäuschen zum Beispiel die offensichtliche: Wo sind die Sommervögel? Unglaublich, welche Fortschritte die wissenschaftliche Erforschung der Vögel hier gemacht hat. Der große Philosoph Immanuel Kant (1724-1804), der auch zahlreiche Werke zur Naturgeschichte und Geographie verfasst hat, schreibt in einem Kapitel „Vom Überwintern der Vögel“ zwar ganz richtig:
„Man bildet sich gemeiniglich ein, daß diejenigen Vögel auf den Winter in wärmere Länder und weit entfernte Klimate ziehen welche ihr Futter in unserm nördlichen Klima nicht haben können“, fällt aber wenige Zeilen später in vor-wissenschaftliche Vorstellungen zurück: „Die mehrsten Vögel verbergen sich des Winters in die Erde und leben wie die Dachse und Ameisen ohne Futter. Die Schwalben verstecken sich in das Wasser. Die Störche, Gänse, Enten usw. werden in den abgelegenen Brüchen von Polen und anderen Ländern in Morästen, da es nicht friert, bisweilen gefunden. Man hat auch in Preußen des Winters einen Storch aus der Ostsee gezogen, der in der Stube wieder lebendig ward.“
250 Jahre später können wir den Zug der Störche, Adler oder Kuckucke in ihre afrikanischen Winterquartiere im Internet verfolgen. Aufgeklebte Sender melden punktgenau, wo sie sich befinden. Auch das Rätsel der Orientierung und Navigation auf ihrer weiten Reise wird allmählich entschlüsselt (wenn auch bei Weitem nicht alles).
Entzaubert solche wissenschaftliche Erkenntnis die Vögel? Ich denke nicht. Ganz im Gegenteil: Sie werden immer faszinierender. Das Staunen über ihre unglaubliche Fähigkeiten, ihre Anpassungen und Lebensstrategien wächst mit dem Wissen.
Vogelkunde als Wissenschaft ist untrennbar verbunden mit frühen Naturforschern wie Johann Matthäus Bechstein (1757-1822) oder Johann Friedrich Naumann (1780-1857), beide Verfasser vielbändiger Werke zur Natur- und Vogelkunde. Sie verweisen Vorstellungen wie die von Immanuel Kant bereits im frühen 19. Jahrhundert in das Reich der Fabel. Ich bin immer wieder beeindruckt, welchen Wissensschatz vor allem Naumann in seiner dreizehnbändigen „Naturgeschichte der Vögel Deutschlands“ zusammengetragen hat, vieles auf eigener Erfahrung beruhend. Naumann zu lesen ist Genuss. Exakte, akribische Beschreibungen sind kombiniert mit anekdotischen, aber gleichwohl aussagekräftigen Beobachtungen, die Deutungen durchaus auch emotional gefärbt – eine Quelle, aus der ich manches Zitat geschöpft habe. Das ist mit der heutigen Literatur kaum möglich, zu dürr ist die standardisierte Sprache der Wissenschaft. Umso spannender sind dagegen die Ergebnisse der aktuellen Forschung, von denen viele in die Vogelporträts in diesem Buch eingeflossen sind.
Porträtiert werden 32 Arten, darunter häufige und seltene, auffällige und heimliche, wertgeschätzte und solche, denen das Etikett „Problemvögel“ anhaftet, Alteingesessene und Neubürger. Natürlich stehen alle Kapitel zunächst einmal für die Titelart. Zusammengenommen aber spannen sie einen weiten Bogen über die gesamte Biologie der Vögel – über Federn und Farbe, Flug und Zug, Balz und Brut, Auge und Ohr, Sex and Crime.
Zwei Bereiche liegen mir dabei besonders am Herzen. Der eine ist mit einem Bonmot des Biologen Theodosius Dobzhansky treffend umrissen: „nothing in biology makes sense except in the light of evolution“ (nichts in der Biologie ist sinnvoll, es sei denn, man betrachtet es im Licht der Evolution). Viele der Geschichten, die ich erzähle, drehen sich um das Thema Evolution im Großen wie auch im Kleinen, um Anpassung und Veränderung und darum, wie Vögel es schaffen, Nachkommen zu produzieren und damit ihren Lebenserfolg sicherzustellen. Das ist eng verknüpft mit dem zweiten Bereich: dem dramatischen Rückgang der meisten unserer Vogelarten in einer sich schnell verändernden Umwelt. Im Jahr 1962 rüttelte die amerikanische Biologin Rachel Carson die Menschen weltweit mit dem Bestseller „Der Stumme Frühling“ wach, ein Fanal und die Initialzündung für den globalen Umwelt- und Naturschutz. Vieles, vor dem sie gewarnt hat, ist inzwischen Wirklichkeit. Stumm ist der Frühling zwar noch nicht, aber er ist deutlich leiser geworden. Wo sich früher Dutzende Lerchen über den Feldern in die Luft schwangen, singt heute nur noch eine einzige. Das Vogelkonzert ist ausgedünnt, und manche Stimmen fehlen ganz. Die Gründe sind klar, am Handeln hapert es. Zu spät? Lassen wir uns dabei nicht entmutigen – Sie finden hier auch einige Erfolgsgeschichten des Naturschutzes, die zeigen, dass es geht. Die Vögel sind es wert.
AMSEL
Turdus Merula
„Alle Gegenden … wo es Waldungen mit dichtem Gebüsch giebt, mögen sie aus Laub- oder Nadelholz bestehen, oder ebenen, sumpfigen, oder gebirgigen Boden haben, gewähren ihnen einen Aufenthalt; besonders lieben sie solche Laubwälder, welche unter andern viel dichtes Unterholz und hohes Dorngebüsch haben und an Flüssen liegen, oder die Dickichte, welche junge Nadelbäume in den Schwarzwäldern bilden … Dies ist ein kluger, vorsichtiger und äußerst mißtrauischer Vogel; immer auf seiner Huth, entgeht nichts, was ihm gefährlich werden könnte, seiner Aufmerksamkeit, selbst in der Nacht nicht. Mit hellgellender Stimme begleitet er seine schnelle Flucht … Man sieht sie fast immer nur im düstern Gebüsch, und müssen sie ja einmal eine kurze Strecke übers Freie, über eine Waldwiese, oder sonstigen von Holz entblößten Platz fliegen, so sieht man es ihnen an ihrer Eile an, wie ängstlich sie dabei sind.“
Keiner käme auf die Idee, dass es sich bei dem so charakterisierten scheuen Waldvogel um die Amsel handelt, heute in jedem Garten unterwegs und in Dörfern und Städten neben Straßentaube (siehe hier) und Haussperling (siehe hier) eine der häufigsten Vogelarten. Vor 200 Jahren war das ganz anders. Der wunderschöne, ebenso laute wie melodische Gesang der Amsel erklang ausschließlich in Wäldern, vorgetragen von der hohen Warte eines Baumgipfels, und nicht von Dachfirst oder Straßenlaterne.
Die neue Entwicklung bahnte sich just an, als Johann Friedrich Naumann im Jahr 1822 in seiner „Naturgeschichte der Vögel“ die oben zitierten Zeilen schrieb. Um das Jahr 1820 wurde die erste Stadtbrut einer Amsel aus Bamberg gemeldet. Um 1850 hatten Stuttgart und Frankfurt nachgezogen. Kurz darauf waren Amseln schon in vielen Städten Deutschlands eine alltägliche Erscheinung, etwas später eroberten sie auch die Dörfer. Inzwischen sind sie wahre Allerweltsvögel und mit 7,34 bis 8,9 Millionen Revieren knapp nach dem Buchfink (siehe hier) die Nummer zwei unter den Brutvögeln Deutschlands.
VOM LANDEI ZUM STADTVOGEL
An den unmöglichsten Stellen kann man ihre aus kleinen Zweigen und gröberen Halmen gebauten, innen mit Lehm ausgeschmierten und anschließend gepolsterten Nester finden. Selbst in Laternenpfählen, fahrenden Kränen, Eisenbahnwagen oder im Motorraum eines Autos wurden schon Amselnester entdeckt. Lieblingsbrutplätze im Siedlungsbereich sind begrünte Fassaden und immergrüne Gehölze. Gerne werden auch Simse und Nischen am Haus genutzt. Das Amselnest auf dem Balkon wenige Meter vom Kaffeetisch entfernt ist keine Ausnahme. Selbst wenn es dort mal hoch hergeht, sitzt die Amsel tief in ihr napfförmiges Nest gedrückt fest auf ihren Eiern. Kein anderer Vogel ist so hart im Nehmen und zeigt so wenig Scheu.
Woher kommt diese Wandlung vom ängstlichen Waldvogel zum unerschrockenen Stadtbewohner?
Eine Frage, die Ornithologen brennend interessiert, die aber kaum wirklich schlüssig zu beantworten ist. Welcher „Schalter“ wurde umgelegt, der den Charakter der Amsel so änderte, dass diese sich aufmachte, ihr Glück in der Stadt zu suchen (und zu machen)? Sobald die Entwicklung am Laufen ist, können wir ihren Fortgang plausibel machen, den Anfang zu fassen ist dagegen schwierig.
Wie auch immer: Die Eroberung der Stadt durch die Amsel ist eine Erfolgsstory. Und sie bietet Ornithologen reichlich Stoff zum Nachdenken und Forschen. Weil es die scheue Waldamsel nach wie vor gibt, können sie auch die nötigen Vergleiche ziehen, um herauszufinden: Was macht die Stadt für die Amsel so attraktiv?
Mehr Nachwuchs für Städter
Beginnen wir mit dem Nachwuchs, dem wichtigsten Erfolgsmaßstab der Evolution. Erfolgreich ist, wer möglichst viele Gene in die nächsten Generationen bringt. Und da haben die Stadtamseln die Nase (oder den Schnabel) vorn. Wenn die Waldamseln ab Mitte März anfangen, Eier zu legen, sind die Kolleginnen in der Stadt schon lange dabei. Sie beginnen meist schon im Februar mit der Brut und schaffen es dann, innerhalb eines Jahres drei oder gar vier Bruten großzuziehen. Waldamseln brüten in der Regel nur zweimal. Die Städter produzieren also mehr Nachwuchs. Ausschlaggebend ist aber natürlich nicht, wie viele Kinder man hat, sondern wie viele überleben und sich ihrerseits fortpflanzen.
Städte sind für Vögel ein gefährliches Pflaster. Junge Amseln verlassen das Nest schon, bevor sie flügge werden. Durchdringend piepsend sitzen sie auf dem Boden, um den futterbringenden Eltern ihren Standort zu signalisieren. Andere hören das leider auch. Für Katzen ist eine junge Amsel leichte Beute und ein gefundenes Fressen; angesichts von sieben Millionen Katzen in Deutschland ist die Gefahr nicht eben gering. Scheibenanflug ist ebenfalls häufig, und auch der Verkehr fordert Opfer. Betroffen sind neben den unerfahrenen Jungvögeln vor allem Männchen, die während der Zeit der Reviergründung und -verteidigung im Frühjahr im Rausch der Hormone oft blindlings über die Straßen schießen. Wer Glück hat, überlebt den Unfall: In Wien wies die Hälfte aller daraufhin untersuchten Amseln (inzwischen wieder verheilte) Knochenbrüche auf. Wer ein bisschen aufpasst, kann Unfälle auch vermeiden. Amseln und andere Vögel fliegen an Schnellstraßen bereits in größerer Entfernung zu einem sich nähernden Fahrzeug auf als dort, wo nicht gerast werden darf – unabhängig von der tatsächlichen Geschwindigkeit des sich nähernden Autos. Die Vögel verlassen sich auf ihre ortsabhängigen Erfahrungswerte.
Städtischer Luxus: sicher und satt
Das alles sind Gefahren, aber das Stadtleben hat auch Vorteile. Viele Nesträuber meiden die Nähe des Menschen, sodass es in Siedlungen zu weniger Plünderungen kommt als im Wald. Die Städte bieten dem Allesfresser auch reichlich Nahrung. Die Amsel gehört zu den wenigen Vögeln, die kurzen Rasen schätzen, weil sie dort leicht an Würmer kommen. Oft folgt sie auf dem Fuß, sobald man mit dem Rasenmäher anrückt. In Gärten wachsen auch Früchte in allen Variationen, von der Kirsche über den Holunder bis zum Efeu.
Kennzeichen der Stadt ist verdichtetes Wohnen. Das gilt für Menschen wie für Amseln. In Waldgebieten brüten gewöhnlich etwa 10 bis 30 Amselpaare auf einem Quadratkilometer. Die Siedlungsdichte steigt (wieder ähnlich wie die der Menschen) vom flachen Land über die Dörfer, die Vorort- und Wohnsiedlungen mit Kleingärten bis in die innerstädtischen Parks, Friedhöfe und Grünanlagen an. Dort können auf zehn Hektar 50 Reviere kommen, also 500 auf den Quadratkilometer.
Schließlich scheinen auch die Überwinterungsbedingungen in Siedlungen besser zu sein. Jedenfalls sind die Amselbestände im Winter, wenn keine Reviere verteidigt werden, noch wesentlich größer als zur Brutzeit. Die Städter selbst sind großenteils Standvögel, während viele Waldamseln ihre Brutplätze verlassen und entweder die Städte oder (häufiger) weiter südlich gelegene Winterquartiere aufsuchen.
Stadtluft macht frei?
Alles in allem gibt es viele Gründe, in die Stadt zu ziehen. Die Stadt verändert aber auch ihre Bewohner. Sie schläft nicht, sie ist laut und sie ist nie wirklich dunkel. Sonnenauf- und Sonnenuntergang sind wichtige biologische Zeitgeber. Sie eichen die innere Uhr, die in jedem Lebewesen läuft und seinen Biorhythmus bestimmt. Die innere Uhr misst die Zeit nicht so exakt wie eine Quarzuhr, sondern muss täglich neu justiert werden.
Während die Landamseln mit den Hühnern aufstehen und zu Bett gehen (also genau bei Sonnenaufgang bzw. -untergang), sind Stadtamseln früher wach und schlafen später ein. Zwar suchen sie dazu dunkle Plätzchen auf und nächtigen nicht direkt unter der Straßenlaterne, aber die höhere Grundhelligkeit genügt schon, um im Frühjahr einen Monat früher in den Fortpflanzungsmodus zu gehen (von den Forschern erfasst über das Wachstum der Hoden und den Testosteronspiegel) und morgens eine Stunde früher zu singen als die Waldamseln. Um gegen den Verkehrslärm anzukommen und auch gehört zu werden, heben Amseln die Stimme, singen also höher als auf dem flachen Land. In diesem Frequenzbereich können sie lauter singen und sich besser Gehör verschaffen.
Merlot ist ein Rebsorte mit besonders dunklen Trauben. Ob die Amsel (französisch le merle) namensgebend war, weil sie schwarz ist oder weil sie auf die Trauben steht, ist umstritten.
Für uns Menschen sind Städte anregend, aber auch stressig. Wie gehen Amseln damit um? Das kann man messen, indem man die Amseln im Labor einer Stresssituation aussetzt und anschließend den Level des Stresshormons Kortikosteron im Blut bestimmt.
Das Ergebnis: Bei Jungvögeln gab es keine großen Unterschiede zwischen Stadt- und Landamseln, aber die älteren, erfahrenen Stadtamseln reagierten auf Stress, verglichen mit den Artgenossen vom Land, ziemlich cool.
Bei so vielen Unterschieden taucht natürlich die Frage aus: Erleben wir hier Evolution live? Ist die Stadtamsel genetisch noch das, was sie vor 200 Jahren war, bevor sie aufbrach, die Stadt zu erobern? Hinweise auf Unterschiede gibt es, aber handfeste Beweise fehlen noch.
Orange Schnäbel machen attraktiv
„Der Schnabel und das Augenliedrändchen im Frühlinge einfarbig, brennend hochgelb, eine zu dem kohlschwarzen Gefieder ungemein schön abstechende Farbe, welche sich dem Orangegelb nähert“, so beschreibt, offensichtlich beeindruckt, Naumann die Schnabelfarbe des Amselmännchens. Und sie soll auch beeindrucken, allerdings nicht die Ornithologen, sondern die Weibchen. Amselweibchen stehen auf Männchen mit orangefarbenen Schnäbeln. Gelb finden sie weniger attraktiv. Warum? Der Schnabel verdankt seine Färbung der Einlagerung von Carotinoiden. (Zu dieser Stoffgruppe gehören auch die Farbstoffe, die die Karotte orange machen.) Diese spielen eine Rolle bei der Immunabwehr; sie binden bei der Immunreaktion entstehende freie Radikale, die Zellen schädigen können. Wird ein Vogel krank, ist er zum Beispiel von Parasiten befallen, zieht er die Carotinoide aus dem Schnabel ab. Er braucht sie jetzt zur Krankheitsbekämpfung. Der Schnabel wird blass und das Weibchen skeptisch.
Amselmännchen reagieren auf orangegelbe Schnäbel – sie gehören normalerweise einem Rivalen, der attackiert und vertrieben werden muss. Groß differenziert wird nicht, auch schnabelgelbe Krokusse werden nicht geduldet und deshalb zerpflückt.
Die Farbe des Schnabels ist für die Weibchen ein ebenso unübersehbares wie ehrliches Signal, das Auskunft über den Gesundheitszustand des Kandidaten gibt. Schließlich brauchen sie einen fitten Partner, um die Brut erfolgreich großzuziehen. Tatsächlich haben Weibchen, die mit einem Männchen mit satt orangem Schnabel verpaart sind, mehr Nachwuchs – das Maß aller Dinge, siehe oben.
Stimme je nach Stimmung
Als Sänger ist die Amsel hoch begabt. Die lauten Flötentöne, mit denen sie die einzelnen Strophen einleitet, sind individuell verschieden. Für alle, die wie die Zeitungsausträger schon in der Dämmerung unterwegs sind, verschönern sie bereits im Spätwinter die frühen Morgenstunden. Tagsüber geht es oft weniger melodisch zu: „In grellem Gegensatze zu der vollendeten Klangschönheit und oft geradezu feierlichen Stimmung, die aus dem Gesange spricht, steht das Geschrei, mit dem zankende Amseln durch die Gärten jagen“, vermerkt der Vogelstimmenexperte Alwin Voigt vor über 100 Jahren. Amseln haben ein interessantes und sehr vielfältiges Lautrepertoire für verschiedene Situationen. Ein bisschen „amselisch“ kann man leicht lernen. Nervöse oder unsichere Amseln lassen oft ein einfaches oder wiederholtes „tack“ hören. Entdecken sie einen Bodenfeind, steigert sich das zu scharfen „tix“-Rufen. Hören Sie dieses Tixen, schleicht meist eine Katze durch den Garten. In Nestnähe steigert sich die Frequenz, und macht die Katze dort Siesta, kann sich die Amsel kaum mehr beruhigen. Ganz anders reagiert sie, wenn Gefahr aus der Luft droht, zum Beispiel durch einen Greifvogel. Dann ertönt ein hohes gepresstes „ssiieh“.
BLAUMEISE
Cyanistes caeruleus
Die Bestimmung ist einfach: Kein anderer heimischer Vogel zeigt diese auffällige Kombination von Gelb mit verschiedenen Blautönen. Besonders apart ist die Kopfzeichnung mit dem leuchtend blauen Scheitel und dem schmalen schwarzen Augenstrich, der sich von dem feinen Schnabel bis zum breit schwarzblau gefärbten Nacken zieht. Jungvögel sehen deutlich anders aus; sie sind matter gefärbt und haben gelbe Wangen. Männchen und Weibchen lassen sich dagegen kaum unterscheiden – von Menschen zumindest.
DAS UNSICHTBARE SEHEN
Wir sollten uns aber nicht dazu verleiten lassen, die Welt nur mit unseren eigenen Augen zu sehen. Die Signale, die im Gefieder versteckt sind, gelten ja nicht uns, sondern den Artgenossen. Und Vögel sehen tatsächlich anders als wir: Sie nehmen auch ultraviolettes Licht (UV-Licht) wahr, das für uns unsichtbar ist. Von Insekten ist das schon länger bekannt, für Vögel erst seit den 1970er-Jahren. Inzwischen ist es für hunderte von Arten nachgewiesen. Für die Blaumeise führte das im Jahr 1998 zu einem wissenschaftlichen Artikel mit der Überschrift „Blue tits are ultraviolet tits“ (Blaumeisen sind Ultraviolett-Meisen) und zu einem kleinen Forschungsboom rund um diese Beobachtung.
Tatsächlich reflektieren viele Gefiederpartien der Blaumeise UV-Licht, und Männchen und Weibchen unterscheiden sich darin deutlich. Haben sie die Wahl, fühlen sich die Weibchen zu den Männchen mit den leuchtendsten Federhäubchen hingezogen. Und weil bei den Blaumeisen (wie bei den meisten Vogelarten) die Weibchen die Partnerwahl treffen, hat das klare Konsequenzen für die Chancen der Männchen auf dem Heiratsmarkt.
Nun springen die Weibchen nicht auf „Schönheit“ an. Evolutionsbiologen gehen davon aus, dass solche Signale in erster Linie die Qualität eines Männchens widerspiegeln, seine „Fitness“. Sich mit einem solchen Männchen zu verpaaren steigert den eigenen Fortpflanzungserfolg, um den sich letztlich alles dreht. Ganz so einfach scheint es aber bei den Blaumeisen nicht zu sein, sie verhalten sich jedenfalls nicht immer lehrbuchmäßig. Manche Beobachtungen legen nahe, dass ältere (und damit erfahrenere) Männchen für die Weibchen die bessere Wahl zu sein scheinen, selbst wenn ihre Scheitel nicht ganz so intensiv leuchten wie die mancher jüngerer Konkurrenten.
SOZIAL MONOGAM, SEITENSPRUNG NICHT AUSGESCHLOSSEN
Blaumeisen sind im Prinzip monogam, jedenfalls für eine Brutsaison, nicht selten aber auch über diese hinaus. Nun wissen wir vom Menschen, dass Monogamie Seitensprünge keinesfalls ausschließt. In diesem Sinne: Blaumeisen sind auch nur Menschen – sozial monogam, aber Abenteuern durchaus nicht abgeneigt. Bei einer über vier Jahre laufenden Studie mit Blaumeisen kam ans Licht, dass in einem Drittel bis der Hälfte der Nester neben den Eiern des „Ehepaars“ auch solche lagen, die auf einen Seitensprung des Weibchens zurückgingen. Auf diese Weise hatten gut zehn Prozent der Nachkommen einen fremden Vater. Diese hatten tatsächlich eine größere Überlebenschance, ein Zeichen dafür, dass das Weibchen eine gute Wahl im Hinblick auf die Verbesserung des eigenen Fortpflanzungserfolgs getroffen hatte. Wenn man bedenkt, dass es grade einmal 15 Prozent der Jungvögel bis ins nächste Frühjahr schaffen, ist das durchaus entscheidend.
Ein attraktiver Nachbar bedeutet für ein Männchen also grundsätzlich ein Risiko, für ein Weibchen Verlockung und Chance zugleich. Noch interessanter für das Weibchen sind weiter entfernt brütende Männchen; bei ihnen ist das Risiko kleiner, dass es sich um nahe Verwandte handelt – Blaumeisen sind nämlich recht ortstreu. Wie sich zeigte, waren Jungvögel mit solchen Vätern genetisch vielfältiger, was grundsätzlich von Vorteil ist.
Ergebnisse wie diese werden mit modernen genetischen Methoden erzielt, mit Vaterschaftstests bei Nestlingen. Direkt ertappen lassen sich die Meisenweibchen nämlich kaum. Sie passen sehr gut auf, dass sie nicht gesehen werden. Wobei ihnen die menschlichen Beobachter vermutlich egal sind, das eigene Männchen sicher nicht.
Wie finden die Weibchen unter diesen Umständen einen attraktiven außerehelichen Partner? Einen wichtigen Hinweis gibt der Gesang: Ältere, erfahrene Blaumeisenmännchen, die besonders begehrt sind, beginnen morgens früher zu singen als jüngere – was das alte Sprichwort bestätigt: „Der frühe Vogel fängt den Wurm.“
GÄRTEN FÜR BLAUMEISEN
Ursprünglicher Lebensraum der Blaumeisen sind lichte alte Laub- und Mischwälder. Die höchsten Dichten werden in Auwäldern erreicht. Im Garten gehört sie zu den häufigsten Brutvögeln. In der vom Naturschutzbund Deutschland (NABU) seit vielen Jahren organisierten „Stunde der Gartenvögel“, einer Art Volkszählung, an der sich an einem Wochenende im Mai Zehntausende Vogelbegeisterte beteiligen, landet die Blaumeise regelmäßig auf den vorderen Plätzen, meist auf Rang 4 oder 5 hinter Spatz, Amsel und Kohlmeise. Bei der „Stunde der Wintervögel“ im Januar schneidet sie gewöhnlich noch etwas besser ab und muss sich meist nur von Haussperling und Kohlmeise geschlagen geben. Die hübschen Meisen lassen sich also mit einiger Berechtigung zu den typischen Gartenvögeln zählen, und wir können einiges tun, damit sie sich dort auch wirklich wohlfühlen.
NISTKÄSTEN ZIEHEN PARASITEN AN
Blaumeisen brüten bevorzugt in Baumhöhlen. Nistkästen werden sehr gerne angenommen. Hängt man Nistkästen mit einem Flugloch-Durchmesser von 27 mm auf, werden größere Konkurrenten wie Kohlmeise oder Feldsperling ausgesperrt. Für sie bietet man Fluglöcher mit 32 mm Durchmesser an. Das Nest wird vom Weibchen gebaut. Das bevorzugte Baumaterial ist Moos.
Nach Gebrauch sind die Nester so stark von Parasiten besiedelt, dass es den Fortpflanzungserfolg im Folgejahr deutlich einschränken kann. Auch das brütende Weibchen leidet unter den Blutsaugern. Neubau ist auf jeden Fall besser. In Naturhöhlen geht das nicht unbedingt, und dass Höhlen meist so knapp sind, dass viele von ihnen jedes Jahr genutzt werden müssen, freut die Parasiten. Wer Nistkästen aufhängt, sollte gegensteuern und die Nester im Winter entfernen.
Blaumeisen auf Korsika verbauen im Nest auch Teile aromatischer Pflanzen, wie sie im Mittelmeergebiet häufig wachsen. Die Vermutung, dass die ätherischen Öle gegen blutsaugende Parasiten helfen, bestätigte sich allerdings nicht. Einen positiven Effekt haben sie aber: Sie hemmen bakterielle Infektionen bei befallenen Nestlingen.
Schneller Brüter
Mit bis zu 17 (im Durchschnitt sieben bis 13) Eiern sind Blaumeisen ungewöhnlich produktiv. Gebrütet wird etwa zwei Wochen lang, im Alter von knapp drei Wochen verlassen die Jungen die Bruthöhle, zwei bis drei Wochen später sind sie selbstständig. Den Nestbau mit eingerechnet, der ungefähr eine Woche dauert, ist das komplette Brutgeschäft also innerhalb von etwa zwei Monaten erledigt.
Im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung zeigen sich deutliche Änderungen. Im Verlauf von drei Jahrzehnten hat sich der Brutbeginn um elf bis zwölf Tage nach vorne verschoben, und die Jungvögel fliegen – von der ersten Eiablage gerechnet – zwei bis drei Tage früher aus, anscheinend vor allem deshalb, weil die Legeintervalle kürzer werden. Die Vögel brüten nicht vom ersten Ei an, sonst würden bei der Blaumeise die ersten Küken schon schlüpfen, wenn das letzte Ei eben erst gelegt ist.
Schlüpft die Brut, folgen anstrengende Tage für die Eltern. Um die kinderreiche Familie mit Insekten zu versorgen sind die Altvögel in pausenlosem Einsatz. Gut, wenn man zwischendurch nicht nur Blattläuse oder winzige Larven von Gallmücken erbeutet, sondern auch ein paar ordentlich satt machende Raupen. Aber gerade an diesen hapert es in den Gärten, vermutlich ein Grund dafür, weshalb hier auch der Bruterfolg deutlich geringer ist als im Wald. Viele der Raupen sind auf heimische Gewächse spezialisiert. Zum blaumeisenfreundlichen Garten gehört also unbedingt auch eine Bepflanzung „made in Germany“.
GERINGE LEBENSERWARTUNG
Wenn die Jungvögel auf sich gestellt sind, beginnt für sie die schwierigste Zeit: Sie müssen nun selbst Nahrung suchen, sichere Schlafplätze finden, Feinden wie Krähen, Sperbern und Katzen entgehen, schlechtem Wetter und schließlich auch noch dem Winter trotzen. In Mastjahren der Buche, wenn reichlich Bucheckern zur Verfügung stehen, haben die Meisen Glück. Winter mit lang andauerndem strengem Frost kosten dagegen vielen das Leben. Insgesamt ist die Sterblichkeit hoch. Pro Brut erlebt kaum mehr als ein Jungvogel das nächste Frühjahr und hat damit Chancen, sich selbst fortzupflanzen. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist also gering. Das Maximalalter von zwölf Jahren zu erreichen, ist äußerst unwahrscheinlich.