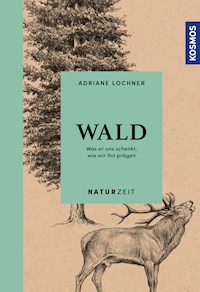
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Naturzeit – ein ganz besonderer Naturführer über den Sehnsuchtsort Wald. Waldbaden und Waldkindergarten, Waldsterben und Abholzung – kaum ein Naturraum bewegt den Menschen so intensiv und emotional wie der Wald. Adriane Lochner behandelt in diesem "Naturzeit"-Band den Wald sowohl aus kulturgeschichtlicher wie aus forstwissenschaftlicher Perspektive. Sie führt ein in die Geschichte des Waldes, zeigt verschiedene Arten der Waldnutzung und erläutert Kreisläufe, Ökosysteme und Bedrohung. In gut lesbarer, unterhaltender Sprache erzählt sie, wie wir den Wald prägen und dieser uns. Ein informativer Naturführer, fesselndes Lesebuch und ein wunderbares, wertiges Geschenk. Die Natur ist kostbar – dieser aufwändig in zweierlei offene Papiere gebundene, mit Lesebändchen und farbigem Kapitalband ausgestattete Band für Naturliebhaber ist es auch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dieses E-Book ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei E-Books aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Statt dessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
1
EINLEITUNG
2
WIE VIELE BÄUME MACHEN EINEN WALD?
3
KLEINE WALDGESCHICHTE
4
DER WALD ALS ETAGENWOHNUNG
5
WALD IST NICHT GLEICH WALD
6
MODERNE WALDWIRTSCHAFT
7
LITERATURHINWEISE,AUTOREN,IMPRESSUM
„Wenn in Wäldern Baum an Bäumen
Bruder sich mit Bruder nähret,Sei das Wandern, sei das Träumen Unverwehrt und ungestöret;
Doch, wo einzelne Gesellen Zierlich miteinander streben, Sich zum schönen Ganzen stellen,Das ist Freude, das ist Leben.“
Johann W. von Goethe
Der Geruch von frisch gesägtem Holz bringt mich immer wieder zurück in meine Kindheit, in unseren Wald, wo im Schatten der alten Fichten mein Großvater mit der Motorsäge hantierte. Mit Hut, Janker und Cordhose stand er über einem gefällten Baum und entfernte mit behänden Schwüngen die Äste. Meine Großmutter, mit Kopftuch und Strickjacke, räumte die Äste weg oder hielt den Zollstock, wenn die Meterstücke gesägt werden mussten. Am Ende eines solchen Waldtages wurden Holz, Kinder und Motorsäge auf den kleinen Traktoranhänger gestapelt und die Heimreise angetreten. Im Winter, wenn draußen der Schnee rieselte und mein Großvater in der Scheune mit der Axt das Holz spaltete, saßen wir in der warmen Stube. Die trockenen Scheite knisterten im alten Holzofen. Auf der Ofenplatte, in einem Töpfchen, wärmte meine Großmutter frische Kuhmilch für den Kakao. Irgendwann schickte sie uns mit dem Weidenkorb hinaus in die Kälte, um neues Feuerholz aus der Scheune zu holen. Das waren die 1980er- und 90er-Jahre im Frankenjura, einer bis heute ländlichen Region im Norden Bayerns.
Nicht aus pädagogischen Gründen, sondern aus Ermangelung von Kitas beziehungsweise generell des Konzepts der Ganztagesbetreuung, nahmen Eltern und Großeltern uns Kinder damals mit in den Wald. Während die Erwachsenen Bäume fällten und aufarbeiteten, wurden wir möglichst weit weg gescheucht, um nicht bei der gefährlichen Arbeit zu stören – unser Glück, denn bei der weniger riskanten Feldarbeit, etwa der Kartoffel-, Rüben- oder Maisernte, mussten wir immer mit anpacken. Also verwandelten wir den Wald in unseren Abenteuerspielplatz, spielten Verstecken, sammelten „Buzelkühe“ – so heißen in der fränkischen Mundart die Zapfen von Nadelbäumen –, bauten Forts aus Ästen oder kletterten auf Jägersitze. Darüber, ob das dem Jäger gefiel oder nicht, machten wir uns keine Gedanken. In einer besonders kreativen Stunde kamen wir sogar auf die Idee, aus Rinde, Hölzern und Blättern kleine Schiffchen zu basteln, die wir dann zu Hause im Bach schwimmen ließen. Das Spielen im Wald war für uns damals nichts Besonderes, das, was man eben machte, wenn kein Fernseher verfügbar war. Auch unsere Eltern sahen darin eher ein notwendiges Übel, stellte so ein Naturraum doch eine große Gefahr für unseren Sauberkeitszustand dar. Für zerrissene Hosen oder mit Harzflecken übersäte T-Shirts gab es in der Regel Schelte.
Heute freut man sich über ein matschverschmiertes Kind, ähnlich wie über ein matschverschmiertes Auto, beides Zeichen großer Naturnähe. Auch die Waldpädagogik läuft heutzutage – wie soll man sagen – etwas organisierter ab, heute wird begleitet, angeleitet und nebenher auch noch gebildet. Auf der einen Seite ist das ein Verlust von Freiheit – eine archaische Freiheit, die ich gelegentlich vermisse –, auf der anderen Seite ist es auch ein Fortschritt. Zwar kann ich sagen, dass ich im Kindergartenalter öfter im Wald war als in der Stadt, aber Naturverständnis hatte ich trotzdem kaum. Der Wald war einfach da, eine Selbstverständlichkeit, etwa so, als ob man seine Muttersprache spricht, ohne sich je über die Grammatik Gedanken zu machen. Die kam erst später. Baumarten zu unterscheiden lernte ich in der Schule, Pflanzenphysiologie im Biologie-Studium und die Lebensgewohnheiten von Rehen und Wildschweinen während der Jägerausbildung. Das Wissen um die heimische Tier- und Pflanzenwelt fand ich interessant, aber viel interessanter waren die Landschaften und Lebensräume, die ich noch nicht kannte – Gebirge, Ozeane, Savannen und Wüsten. Ich reiste viel und schrieb über alle möglichen Umweltthemen, angefangen von Schneeleoparden im kirgisischen Hochgebirge über Wildpferde in den Steppen der Mongolei bis zu Humboldt-Kalmaren vor der kalifornischen Küste.
Erst als ich wieder in die Heimat zurückkehrte und begann, für lokale Tageszeitungen zu schreiben, traf ich ihn wieder, meinen alten Freund aus Kindertagen, den Wald. Doch er war nicht mehr derselbe. Zwar sah er noch genauso aus, doch die Art, wie ich ihn wahrnahm, hatte sich verändert. Mit etwas Bedauern musste ich feststellen, dass der Wald der Erwachsenenwelt ein anderer ist als der der Kinderwelt. Mehr und mehr lernte ich die Konflikte kennen, die es rund um den Wald gab. Ich sprach mit Förstern, denen der Borkenkäfer bis zum Hals stand, mit Privatwaldbesitzern, die Waldbau nur noch als zeitaufwendiges Hobby betrachteten, mit Jägern, die durch zu hohe Abschussvorgaben in Bedrängnis gerieten und mit Naturschützern, die die Waldnutzung am liebsten ganz verbieten würden. Allesamt brachten sie gute Argumente vor, aber einig werden sie sich bis heute nicht.
Mir fällt es schwer, für eine Seite Partei zu ergreifen. Das wird mir manchmal vorgeworfen, denn schließlich gehöre es zum Berufsbild des Journalisten, die Gesellschaft bei der Meinungsbildung zu unterstützen. Ein altgedienter Redakteur einer bekannten deutschen Tageszeitung klagte einmal sein Leid über den viel zu objektiven Nachwuchs: „Die jungen Leute haben keine Meinung mehr. Sie schreiben ohne Leidenschaft.“ Dem gegenüber stehen die Worte des verstorbenen Tagesthemen-Moderators Hanns Joachim Friedrichs: „Einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache – auch nicht mit einer guten Sache; dass er überall dabei ist, aber nirgendwo dazugehört.“ Ist Objektivität wirklich das Fehlen von Leidenschaft? Der Naturraum Wald ist genauso komplex wie die Themen, die um ihn herum evolvieren. Muss ein Journalist tatsächlich eine Lösung parat haben oder ist es eher seine Aufgabe, ein Vermittler zu sein, einer, der komplexe Sachverhalte und menschliche Beweggründe verstehen und erklären kann. Ist man nicht durch Objektivität der beste Anwalt für die Natur? Und den braucht sie heute mehr denn je, denn mit dem Klimawandel liegt nun eine weitere Karte auf dem Tisch, eine neue Herausforderung und ein Beschleuniger für Konflikte. Gerade jetzt ist es dringend, über den Wald und seine Zukunft zu reden und schnell zu handeln. Nur durch eine vorurteilsfreie Darstellung der Spannungsfelder kann es unter den Akteuren zu einem Dialog auf gleicher Augenhöhe kommen, nur so lassen sich Lösungen finden. Aber stellen wir das Schwierige erst mal hinten an und widmen uns der Natur der Sache.
„Man liebt nur, was man kennt, und man schützt nur, was man liebt.“ Das wusste bereits der berühmte Zoologe Konrad Lorenz. Unsere Absicht mit diesem Buch ist es, den Wald ein Stück weit erlebbar zu machen, beim Leser ein Bewusstsein zu schaffen für die kleinen und großen Naturwunder, die sich darin verbergen. Was macht einen Wald aus und warum sind wir so stark mit ihm verbunden? Anschauliche Beschreibungen und Illustrationen vom Großen und ganz Kleinen sollen diesen wunderbaren Naturraum erklären und neue Sichtweisen eröffnen. Für Tiere und Pflanzen ist der Wald eine Etagenwohnung, deren Stockwerke unterschiedliche Lebensräume darstellen. Für den Menschen ist Wald viel mehr als eine Rohstoffquelle oder ein grünes Fitnessstudio, Wald kann auch ein spiritueller Sehnsuchtsort sein, eine Kurklinik oder ein Bildungsort. Wald beschützt uns, Wald versorgt uns und einst schenkte er uns sogar eine nationale Identität. Begleiten Sie uns auf eine Entdeckungstour in Deutschlands Wälder, entdecken Sie ihre Geheimnisse und sehen Sie sie einmal mit anderen Augen. Bei den Recherchen habe auch ich den ein oder anderen neuen Aspekt lernen dürfen. Daher möchte ich meinen stets hilfsbereiten und unerschöpflichen Quellen der Inspiration danken, ohne die dieses Buch sicher nie in dieser Form zustande gekommen wäre, den Förstern Klaus Wagner, Gerhard Lutz, Peter Hagemann und Fabian Kowollik, der Biologin Dr. Kristina Schröter sowie dem Leiter des Botanischen Gartens der Universität Bayreuth, Dr. Gregor Aas, und auch meinem ehemaligen Deutschlehrer Helmut Hanisch. Sie alle haben beraten, offene Fragen geklärt, Literatur empfohlen und mich so bei der Recherche unterstützt.
Mein herzlichster Dank geht an meinen verstorbenen Großvater Michael Lochner. Ihm möchte ich dieses Buch widmen. Schon in frühen Kinderjahren hat er mich an seiner Leidenschaft für Wald und Holz teilhaben lassen. Nicht nur nahm er mich mit zu den Waldarbeiten, sondern er nahm sich auch die Zeit, gemeinsam mit mir an langen Winterabenden zu malen und zu basteln. In seiner Werkstadt schreinerte er mit viel Herzblut und einem unerbittlichen Auge für Details die schönsten Bauernhöfe, Puppenhäuser und Weihnachtskrippen, die man sich vorstellen kann. Auf diese Weise ist der Wald für mich – ganz persönlich und subjektiv – zu einem Stück Erinnerung geworden, zu einem wichtigen Bestandteil meiner Vergangenheit, der mein späteres Leben und meine Einstellung zur Natur entscheidend prägte.
WIE VIELE BÄUME MACHEN EINEN WALD?
Die Frage lässt erahnen, dass die Antwort keine einfache ist. Sicher glauben die meisten, einen Wald zu erkennen, wenn sie davor oder darin stehen. Doch was definiert einen Wald? Und warum ist diese Frage überhaupt wichtig?
Vor allem in einem Land wie Deutschland, das auf einem soliden Fundament aus Bürokratie gebaut ist, existiert ein sachliches Regelwerk für beinahe jede Lebenssituation. Nichtsdestotrotz, am Waldbegriff beißt sich der Amtsschimmel die Zähne aus. Weder Gesetze noch Richtlinien schaffen es, eine klare Definition zu liefern. Natur lässt sich eben ungern in Schubladen stecken.
Ob es sich bei einer Ansammlung von Bäumen um Wald handelt oder nicht, ist immer eine Einzelfallentscheidung. Und weil sich die Natur hartnäckig da breitmacht, wo der Mensch alle Fünfe gerade sein lässt, stehen Förster bundesweit immer wieder vor neu bewachsenen Flächen, kratzen sich am Kopf, runzeln die Stirn und grübeln, ob sie dieses Stückchen bebaumte Erde nun als Wald deklarieren sollen oder nicht.
So geschah es beispielsweise vor einiger Zeit in einer kleinen Ortschaft am Südrand des Fichtelgebirges. Das nordbayerische Mittelgebirge liegt zwischen den Städten Bayreuth, Hof und Weiden i. d. Oberpfalz. Die östlichen Ausläufer reichen bis zum tschechischen Cheb. Das „Hohe Fichtelgebirge“, der westliche Teil des Naturparks, umfasst etwa 520 Quadratkilometer und ist damit größer als Köln. Insgesamt etwa 80 Prozent dieser Fläche sind bewaldet. Der höchste Punkt ist der Schneeberg mit 1.051 Metern über dem Meeresspiegel. In solchen Höhenlagen wachsen hauptsächlich Fichte und Tanne, während in tiefer gelegenen Regionen Buchenwälder dominieren. In den Flussauen von Naab, Saale, Eger, Main und ihren Nebenflüssen gedeihen Erlen, Weiden und Birken.
Im Fichtelgebirge scheint der Waldbegriff eindeutig. Der Mensch mit seinen künstlich angelegten Ortschaften, Gärten und Äckern ist flächenmäßig unterlegen. Wald ist hier allgegenwärtig. Still und heimlich scheint er darauf zu lauern, jeden Flecken Boden zu besiedeln, den der Mensch vergisst freizuhalten. Das zeigt sich an einer alten Handtuchfabrik am Ortsrand von Sophienthal. Seit fast einem halben Jahrhundert steht sie leer, das Grundstück unberührt von Menschenhand.
EIN NEUER WALD ENTSTEHT
Der ein oder andere Autofahrer, der seinen Wagen die Serpentinen hinaufscheucht, registriert im Rückspiegel vielleicht die roten Mauerziegel, die durch das Unterholz schimmern. Vielleicht wundert er sich sogar kurz über das seltsame Bild, vergisst es aber gleich wieder. Dabei wäre die Ruine durchaus einen zweiten Blick wert. Denn sie ist Schauplatz eines Naturspektakels, das so langsam vor sich geht, dass es für die menschliche Wahrnehmung wie ein Stillleben wirkt.
Vom Fabrikgebäude ist kaum mehr geblieben als die nackten Außenwände. Die Stämme junger Bäume drängen sich provokant ans Mauerwerk, als wollten sie sagen: „Dieser Platz gehört mir. Du musst weichen.“ Das Gebäude ist umstellt. Man sieht ihm seine Jahre an. Das Mauerwerk bröckelt, die großen Industriefenster sind zerbrochen oder mit Brettern verschlagen. Wann genau das Dach eingestürzt ist, kann niemand mehr sagen. Eine Absperrung weist darauf hin, dass eine Besichtigung keine gute Idee wäre. Einsturzgefahr. Aus dem dachlosen Inneren ragen Baumkronen, die bestätigen: „Die Festung ist eingenommen.“ Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört.
Lichtbaumarten der Gattungen Erle, Birke und Weide waren die Ersten vor Ort, die Pioniere. Die leichten, teils geflügelten Früchte und Samen trug der Wind herbei. Birken und Weiden sind genügsam, sie haben relativ geringe Ansprüche an den Boden. Erlen mögen es feucht. Am Ufer der Warmen Steinach, einem Nebenfluss des Roten Mains, der sich an der alten Handtuchfabrik vorbeischlängelt, konnten sie leicht Fuß fassen. Auf sandigen Böden hätten Kiefern und Lärchen eine gute Chance gehabt, die Ersten vor Ort zu sein. Auch Eichen gedeihen gut im Sonnenlicht, allerdings sind ihre Früchte, die Eicheln, zu schwer, um vom Wind getragen zu werden. Sie haben eine andere Strategie entwickelt und lassen sich vom Eichelhäher helfen. Der Vogel legt Vorräte an, indem er die Eicheln auf Lichtungen oder an Waldrändern versteckt, in Löchern, Spalten oder in der Bodenstreu. Da er seine Verstecke nicht alle wiederfindet, hilft die sogenannte Hähersaat dem Baum bei der Ausbreitung. Ebenfalls auf Vögel verlässt sich die Eberesche, auch Vogelbeere genannt. Die kleinen roten Früchte werden gefressen, passieren den Verdauungstrakt und finden dann – gut gedüngt – eine neue Heimat. Die Vogelbeere ist ein sehr anspruchsloser Baum und verträgt viel Sonne. Daher gehört auch sie zu den Pionieren, die neues Territorium für den Wald besiedeln.
Sobald die ersten Bäumchen wachsen, spenden sie Schatten. Damit schaffen sie optimale Bedingungen für sogenannte Halbschattbaumarten wie Bergahorn, Fichte oder Douglasie. Ganz zum Schluss, wenn es am Boden bereits richtig dunkel wird, siedeln sich Schattbaumarten wie Weißtanne, Rot- oder Hainbuche an. Und voilà, schon hat man eine richtige Gesellschaft teils dicht gedrängter Bäumchen unterschiedlichen Alters und verschiedener Wuchshöhen.
Rund um die alte Fabrikruine ist in Sophienthal ein wildromantisches Bild entstanden, das bereits sehr verdächtig nach Wald aussieht. Irgendwann fällt der zuständigen Forstbehörde auf, dass es hier etwas zu klären gibt. Sie schickt einen Förster, der entscheiden muss, ob er das neu bewachsene Stück Land als Wald einstuft oder nicht.
IST DAS WALD ODER KANN DAS WEG?
Die Entscheidung des Försters wird Konsequenzen haben für die Zukunft der Fläche und den Geldbeutel ihres Eigentümers. Sobald eine Ansammlung von Bäumen nämlich zum „Wald im Sinne des Gesetzes“ wird, ist es nicht mehr ohne Weiteres möglich, sie zu roden oder anderweitig zu nutzen, etwa als Acker, Weide, Garten oder neuen Baugrund.
„Wald darf nur mit Genehmigung der nach Landesrecht zuständigen Behörde gerodet und in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden …“
Soheißt es im Paragraf 9 des Bundeswaldgesetzes. Nicht jeder freut sich über diese Regelung. Einem Pressesprecher des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zufolge gibt es bei Baumfällungen im Siedlungsbereich oft Streit darüber, ob es Wald ist oder nicht:
„Die Gemeinden möchten lieber, dass es nicht Wald ist, da man dann keine Waldumwandlungsgenehmigung der Unteren Forstbehörde braucht.“
Auch die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau will wissen, ob es sich bei Flächen mit Baumbestand um Wald, Garten oder Acker handelt. Danach richten sich nämlich die Beiträge für die gesetzliche Unfallversicherung bei der Bewirtschaftung.
Die Frage, ob es sich um Wald handelt oder nicht, ist also durchaus wichtig. Eine Münze werfen sollte der Förster besser nicht, sondern reiflich überlegen. Vom Gesetzgeber bekommt er dabei allerdings wenig Unterstützung. Paragraf 2 des Bundeswaldgesetzes fasst die Walddefinition recht großzügig:
„Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche …“
Das Bundeswaldgesetz ist ein Rahmengesetz. Die Bundesländer haben alle eigene Landeswaldgesetze entwickelt, zusammen mit jeder Menge Zusatzmaterial. Was Forstpflanzen sind, findet man beispielsweise in Bayern nicht im Bayerischen Waldgesetz, sondern im Kommentar zum Bayerischen Waldgesetz von Zerle, Hein, Brinkmann, Foerst und Stöckel. Dieser üppige Gesetzeskommentar enthält konkrete Richtlinien und ist ein umfangreiches Nachschlagewerk, sozusagen die Bibel für den bayerischen Förster. Gleich auf den ersten Seiten des Wälzers findet sich eine lange Liste mit den im Freistaat anerkannten Waldbäumen (Erläuterung Nr. 2 zu Artikel 2 BayWaldG). Darunter sind 18 Nadelbaumarten von Fichte und Weißtanne über Japanlärche und Bergkiefer bis zu Coloradotanne und Hemlocktanne und 46 Laubbaumarten von Stiel- und Traubeneiche über Edelkastanie und Bergulme bis zu Spitzahorn und Robinie.
Obstbäume sind generell keine Waldbäume, es sei denn, es handelt sich um wilde Verwandte wie Holzbirne oder Holzapfel.
Typische Zierbäume wie die rotblättrige Blutbuche, die Platane, Götterbaum, Eschenahorn oder diverse Lebensbaumarten haben es nicht auf die Liste der bayerischen Waldbäume geschafft.
Zurück zum Bundeswaldgesetz. Man hofft, dass auf den ersten Satz mit den Forstpflanzenspezifische Kriterien folgen. Fehlanzeige. Es geht lediglich mit der Tatsache weiter, dass auch baumlose Flächen zum Wald gehören können:
„Als Wald gelten auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen.“
Mit „dem Wald dienende Flächen“ ist gemeint, dass beispielsweise eine Baumschule, eine Anpflanzung junger Bäumchen, allein noch keinen Wald macht. Allerdings kann ein solcher Pflanzgarten Teil des Waldes sein, sofern er im Wald liegt und die jungen Pflänzchen für ebendiesen Wald bestimmt sind. Ähnlich verhält es sich mit einer Kiesgrube im Wald, solange ihr Inhalt zur Pflege der im Wald befindlichen Wege verwendet wird.
Alles schön und gut, aber was genau macht einen Wald denn nun aus? Eine richtige Definition sucht man im Bundeswaldgesetz vergebens. Nach dem Ausschlussprinzip nennt es lediglich alles, was Bäume hat und kein Wald ist. Im Folgenden einige Beispiele.
PARKANLAGEN – ZUR ERHOLUNG GEMACHT
Mehr als 50.000 Bäume stehen im Englischen Garten in München. Mit 375 Hektar ist er eine der größten Parkanlagen der Welt. Trotzdem: Ein Wald ist er nicht. Das liegt nicht an den Baumarten, denn es handelt sich überwiegend um klassische Forstpflanzen wie Buche, Ahorn, Esche, Birke, Kiefer oder Fichte. Die Krux ist, dass der Englische Garten eine wichtige ökologische Eigenschaft des Waldes nicht erfüllt.
Das „Kosmos Wald- und Forstlexikon“ definiert den ökologischen Waldbegriff so:
„Wald ist ein vernetztes Sozialgebilde und Wirkungsgefüge seiner sich gegenseitig beeinflussenden und oft voneinander abhängigen biotischen, physikalischen und chemischen Bestandteile, das praktisch von der obersten Krone bis hinunter zu den äußersten Wurzelspitzen reicht. Kennzeichnend ist die konkurrenzbedingte Vorherrschaft der Bäume. Dadurch entsteht auch ein Waldbinnenklima, das sich wesentlich von dem des Freilandes unterscheidet. Dieses kann sich nur bei einer Mindesthöhe, Mindestfläche und Mindestdichte der Bäume entwickeln.“
Wenn nämlich Bäume auf einer großen Fläche dicht beieinanderstehen, entwickelt sich ein charakteristisches Mikroklima. Im Wald ist es im Sommer kühler als im Freiland und im Winter wärmer. Generell ist die Luft auch etwas feuchter. Das schafft einen besonderen Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Moose, Farne und Kräuter bedecken den Waldboden wie ein Teppich. Immer wieder sorgen Sträucher wie Brombeere, Himbeere oder Schlehe dafür, dass manche Bereiche für Menschen schwer zugänglich werden.
In der Land- und Forstwirtschaft rechnet man mit dem Flächenmaß Hektar. Das entspricht 10.000 Quadratmetern, beziehungsweise einer quadratischen Fläche, die 100 Meter lang und 100 Meter breit ist. Damit ist ein Hektar in etwa anderthalbmal so groß wie ein Fußballfeld.
Der Englische Garten besteht aus Einzelbäumen beziehungsweise einer Vielzahl kleiner Gehölzflächen, die als Landschaftselemente zusammen mit Bachläufen, Seen, kleinen Bauten und Wegen angelegt wurden. Sinn und Zweck ist es, Besuchern etwas fürs Auge zu bieten und ihnen den Zugang zur Natur so einfach wie möglich zu gestalten. In einer typischen Parkanlage überwiegen die Offenlandflächen. Ein Waldbinnenklima und der damit verbundene Bodenbewuchs können nicht entstehen, zum einen weil regelmäßig gemäht und getrimmt wird, zum anderen weil die Bäume nicht dicht genug beieinander stehen.
Nun ist im „Kosmos Wald- und Forstlexikon“ von einer „Mindesthöhe, Mindestfläche und Mindestdichte der Bäume“ die Rede. Von Zahlenangaben keine Spur. Wald in Zahlen zu definieren, wagt kaum jemand. Einige wenige trauen sich und machen Nägel mit Köpfen. Beispielsweise steht im Landeswaldgesetz der Rheinland Pfalz: „Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Waldgehölzen bestockte zusammenhängende Grundfläche ab einer Größe von 0,2 Hektar und einer Mindestbreite von 10 Metern.“ Des Weiteren müssen neu bewachsene Flächen mindestens zu 50 Prozent von Baumkronen überschirmt sein, um als Wald zu gelten.
Ach, wenn es nur so einfach wäre. Denn über Zahlen kann man sehr gut streiten. Die Food and Agriculture Organization (FAO) der Vereinten Nationen beispielsweise hat eine andere Definition. Ihr zufolge muss Wald eine Mindestfläche von 0,5 Hektar haben. Diese Fläche braucht nur zu einem Zehntel von Baumkronen überschirmt zu sein. Der bayerische Förster hat während seiner Ausbildung gelernt, dass der Versuch, Wald in Zahlen zu fassen, in der Regel verschwendete Liebesmüh ist. In der Försterbibel, dem Kommentar zum Bayerischen Waldgesetz, steht: „Eine in Flächeneinheiten ausgedrückte Mindestgröße für einen Wald kann nicht angegeben werden.“ (1.4 BayWaldG Erl 7 zu Art. 2 7) Die Verhältnisse seien zu vielfältig. Ein wichtiger Faktor sei die Umgebung. Wenn nämlich eine kleine Ansammlung von Waldbäumen nahe einer großen Waldfläche steht und wenn diese räumliche Nähe „ein typisches Waldgepräge zu geben vermag“, dann kann sie Wald im Sinne des Gesetzes sein. Aber nicht alle Baumgruppen sind einen Steinwurf von großen Wäldern entfernt.
FELDGEHÖLZE – INSELN DER ARTENVIELFALT
Man sieht sie oft inmitten ausgedehnter Getreidefelder. Wie grüne Inseln ragen sie aus dem goldenen Ährenmeer. Feldgehölze sind kleinflächige Bestände von Bäumen, Sträuchern und krautigen Pflanzen wie Gräsern, die auf landwirtschaftlichen Nutzflächen liegen. Sie können Überreste eines gerodeten Waldes sein oder durch natürliches Anwachsen auf ungenutzten Flächen entstehen. Besonders gerne siedeln sich Arten wie Stiel- und Traubeneiche, Hainbuche, Esche, Vogelbeere, Sandbirke, Sommer- und Winterlinde sowie Feld-, Berg- und Spitzahorn in weiter Feldflur an. Als Sträucher gesellen sich Schlehe, Hasel, Weißdorn oder Heckenrose dazu. Kleine Baumbestände schließt das Bundeswaldgesetz vom Waldbegriff aus. In Paragraf 2, Artikel 4 heißt es:
„Kein Wald im Sinne dieses Gesetzes sind … in der Flur oder im bebauten Gebiet gelegene kleinere Flächen, die mit einzelnen Baumgruppen, Baumreihen oder mit Hecken bestockt sind …“
Da sich Feldgehölze meist deutlich vom nächstgelegenen Wald absetzen, müssen nun auch die Bayern Farbe bekennen und sich an die Zahlenschusterei machen. In der Försterbibel steht:
„Als Baumgruppe gilt eine Ansammlung von Bäumen nur dann, wenn ihr Durchmesser nicht größer ist als die Höhe, die die betreffenden Waldbäume erreichen können. Mit Waldbäumen bestockte Flächen in Feld und Flur, die einen größeren Durchmesser als etwa 20 bis 25 Meter haben, werden daher regelmäßig Wald im Sinne des Gesetzes sein.“
In Bayern sowie einigen anderen Bundesländern werden Feldgehölze als Baum- und Strauchbestände mit einer Fläche von mindestens 50 und maximal 2.000 Quadratmetern definiert. Als „Nichtwald“ unterstehen sie dem Bundesnaturschutzgesetz beziehungsweise den zuständigen Naturschutzbehörden. Die weisen Feldgehölze gerne als „geschützte Landschaftsbestandteile“ aus, da sie – ähnlich wie He-cken – wertvolle Lebensräume sind. Reh, Fuchs, Igel und Feldhase verstecken sich darin, Singvögel finden dort geschützte Brutplätze und jede Menge Nahrung. Denn auch zahlreiche Insekten, kleine Reptilien und Amphibien tummeln in den Bauminseln der Feldflur. Die größte Artenvielfalt findet man im Randbereich, in den Übergangszonen zwischen Gehölz und Feld beziehungsweise Wiese. Die Naturschutzakademie Hessen, eine Einrichtung des Landes Hessen und des Naturschutz-Zentrums Hessen e. V., bezeichnet Feldgehölze als „Inseln des Lebens“, in denen 900 verschiedene Arten nachgewiesen wurden. Die größte Tiergruppe bilden Insekten wie Schmetterlinge, Käfer, Wildbienen und Ameisen. Sie sind die Nahrungsgrundlage für kleine Säugetiere wie die Spitzmaus sowie für Singvögel wie den Zaunkönig. Greifvögel wie der Mäusebussard nutzen die Bäume als Ansitzwarte um auf dem Feld nach Beute Ausschau zu halten.
Anders als Inseln im Meer dürfen Feldgehölze nicht isoliert sein. Zusammen mit Wegrändern, Hecken und anderen natürlichen Strukturen der Kulturlandschaft stellen sie sogenannte Trittsteinbiotope dar. So ermöglichen sie vielen Tieren zu wandern und eine große Auswahl an Paarungspartnern zu finden. Das sorgt für genetische Vielfalt und die brauchen Arten unbedingt, um langfristig zu bestehen. Das gilt nicht nur für Tiere, sondern auch für Pflanzen. Darüber hinaus nützen Feldgehölze auch den Landwirten, indem sie ihre Felder vor Wind und Bodenerosion bewahren. Wenn die kleinen Bauminseln in der Feldflur auch kein Wald sind, so spielen sie dennoch eine wichtige Rolle für Natur und Landschaft.
WALDWEIDE – VIEHWIRTSCHAFT UNTER BÄUMEN
„Die besten Schinken wachsen unter Eichen.“ Das wussten die Menschen bereits im Mittelalter. Bis spät ins 18. Jahrhundert war es gang und gäbe, Schweine im Herbst in den Wald zu treiben, damit sie sich an Eicheln kugelrund fressen. Eine solch extensive Viehwirtschaft ist zwar heute kaum mehr von wirtschaftlicher Bedeutung, doch beispielsweise in den großen Eichenwäldern Unterfrankens, haben Landwirte die Waldmast wiederentdeckt. In sogenannten Hutewäldern leben Schweine von einer ausgewogenen Diät aus Eicheln, Würmern, Schnecken, Käfern und Waldkräutern. Zusammen mit frischer Luft und viel Bewegung entsteht auf diese Weise ein Schinken, der wegen seines einzigartigen Geschmacks und seiner Exklusivität als Delikatesse gehan-delt wird.
Die Bezeichnung Hutewald kommt ursprünglich von „hüten“ und meint eine Viehweide im Wald. Das bezieht sich nicht nur auf Schweine, sondern auch auf andere Tiere wie Rinder, Schafe, Ziegen oder Pferde – und mittlerweile auch auf Lamas und Alpakas. Grasende Viehherden nehmen Einfluss auf das Aussehen des Waldes. Ein klassischer Hutewald zeichnet sich durch großkronige Altbäume aus, die in der Regel weit voneinander entfernt stehen, ähnlich einer Parklandschaft. Durch die Beweidung haben es Gräser und Sträucher schwer, eine dichte Bodenvegetation auszubilden. Jungbäume können kaum Fuß fassen. Ihre Knospen werden sofort vom Vieh abgefressen, genauso wie die unteren Äste der großen Bäume. Die Baumkronen setzen daher relativ weit oben an, können sich aber aufgrund der „Ellenbogenfreiheit“ weiträumig ausbilden. Im Hutewald fällt genug Licht auf den Boden, damit eine Grasschicht wachsen kann, ähnlich einer Wiese. So entstehen offene Haine beziehungsweise baumdurchsetzte Weidelandschaften. Diese bieten Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten. Etwa profitieren der Gelbe Enzian und manche Orchideenarten vom Eintreten der Samen durch die Tiere. Vogelarten wie der Ziegenmelker sind auf lichte, insektenreiche Wälder angewiesen.
Ob eine Waldweide noch immer Wald ist oder nicht, lässt sich schwer sagen. Im Bundeswaldgesetz steht: „Flächen mit Baumbestand, die gleichzeitig dem Anbau landwirtschaftlicher Produkte dienen (agroforstliche Nutzung)“ sind kein Wald im Sinne des Gesetzes.Was man unter agroforstlicher Nutzung versteht, ist Definitionssache. Die Kombination aus Wald und Feldbau spielt in Deutschland kaum eine Rolle. In tropischen Ländern ist das sogenannte Alley Cropping weit verbreitet. Dabei werden Feldfrüchte zwischen Baumreihen angebaut. Die Baumwurzeln lockern den Boden auf und schützen ihn gleichzeitig vor Erosion. Zusätzlich steigen die Ernteerträge, da die Baumkronen Wind- und Sonnenschutz für die Feldfrüchte bieten.
Ob eine Waldweide in das Konzept der agroforstlichen Nutzung fällt oder nicht, dürfen die Bundesländer selbst entscheiden. In Bayern bedarf es beispielsweise einer Rodungsgenehmigung, um in einem Waldstück Vieh zu halten. Aber: keine Regel ohne Ausnahme. Die Waldweiden der traditionellen Almwirtschaft, im Bayerischen Hochgebirge und im Bayerischen Wald, gelten trotz saisonalem Viehbestand noch immer als Wälder.
KURZUMTRIEBSPLANTAGEN – ENERGIEWALD AUF DEM ACKER
Eine Kurzumtriebsplantage ähnelt optisch einem Maisfeld, nur dass anstatt Maispflanzen hier Bäume in Reih und Glied wachsen. Hintergrund ist folgender: In den vergangenen Jahren hat der Begriff „Energieholz“ Einzug gehalten. Manche halten das vielleicht für einen „weißen Schimmel“, denn Holz war ja schon immer ein Energieträger, der älteste Brennstoff seit Menschengedenken von der steinzeitlichen Feuerstelle bis zum modernen Kamin. Allerdings ist das Heizen mit Scheitholz aus Platz- und Zeitgründen umständlich. Deshalb geht der Trend zu modernen, holzbasierten Heizstoffen, etwa Hackschnitzel oder aus Holzspänen gepresste Pellets. Auch stromerzeugende Heizungen mit Holzvergaser sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Das Verlangen der Bevölkerung nach dem nachwachsenden Energieträger steigt. Das führt dazu, dass die Holzindustrie mehr Material benötigt, zusätzlich zu den horrenden Mengen, die ohnehin schon für Zell- und Werkstoffe verarbeitet werden. Künftig könnte es sein, dass die heimischen Wirtschaftswälder die große Nachfrage nicht mehr bedienen können und eine „Holzlücke“ entstehen. Eine Möglichkeit, diese zu schließen, bieten – neben zusätzlichen Importen – Kurzumtriebsplantagen.
Dazu eignen sich schnellwachsende Baumarten mit einer sehr kurzen Umtriebszeit – so nennt man die Zeit vom Pflanzen bis zum Ernten. In der Praxis haben sich Pappel- und Weidensorten aufgrund ihrer hohen Erträge etabliert. Sie wachsen deutlich schneller als die meisten anderen Waldbäume. Bereits innerhalb von drei bis fünf Jahren erreichen sie eine Höhe von etwa acht Metern und können mit einem Mähhäcksler geerntet werden. Das Prinzip ähnelt dem der Maisernte.
Nun haben diese Baumarten eine weitere, sehr angenehme Eigenschaft: Sie sind stockausschlagfähig. Das heißt, die zurückgebliebenen Stöcke treiben schon im nächsten Frühjahr wieder aus. Man muss nur einmal pflanzen und kann mehrmals ernten. Nach einem ähnlichen Konzept funktioniert die jahrhundertealte Niederwald-Wirtschaft. Diese fand allerdings in den Wäldern statt, mit Axt und Säge. Moderne Kurzumtriebsplantagen gelten nicht als „Wald im Sinne des Gesetzes“, sondern als landwirtschaftliche Nutzflächen. Nach 20 bis 30 Jahren, wenn die Wuchsleistung der Bäume abnimmt, können die Flächen ohne Weiteres wieder in konventionelles Ackerland umgewandelt werden.
WEIHNACHTSBAUMKULTUREN – WARTEN AUF DEN GROSSEN TAG





























