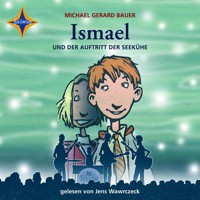Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Hausaufgaben, Mobbing, Liebeskummer - mal abgesehen von diesen üblichen Schulproblemen trifft Ismael ein besonderes Schicksal: Sein Vorname macht ihn zum Gespött der Mitschüler. Zu allem Übel kann sein Vater nicht oft genug betonen, wie ihn die Lektüre von Moby Dick auf diesen Namen gebracht hat. Ismaels Reaktion: Abtauchen! Das ändert sich, als James Scobie in die Klasse kommt. Er hat seine ganz eigene Waffe gegen Klassenrowdys: die Sprache. James gründet einen Debattierclub. Auch Ismael soll mitmachen. Doch der hat panische Angst. Wären da nicht seine Debattier-Kollegen, würde das vermutlich auch so bleiben. Mit Hilfe ihres Einsatzes steht Ismaels verbalem Aufstand bald aber nichts mehr im Wege. Und die Tür für ein Gespräch mit der bezaubernden Kelly Faulkner ist so offen wie nie ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Hausaufgaben, Mobbing, Liebeskummer — mal abgesehen von diesen üblichen Schulproblemen trifft Ismael ein besonderes Schicksal: Sein Vorname macht ihn zum Gespött der Mitschüler. Zu allem Übel kann sein Vater nicht oft genug betonen, wie ihn die Lektüre von Moby Dick auf diesen Namen gebracht hat. Ismaels Reaktion: Abtauchen! Das ändert sich, als James Scobie in die Klasse kommt. Er hat seine ganz eigene Waffe gegen Klassenrowdys: die Sprache. James gründet einen Debattierclub. Auch Ismael soll mitmachen. Doch der hat panische Angst. Wären da nicht seine Debattier-Kollegen, würde das vermutlich auch so bleiben. Mit Hilfe ihres Einsatzes steht Ismaels verbalem Aufstand bald aber nichts mehr im Wege. Und die Tür für ein Gespräch mit der bezaubernden Kelly Faulkner ist so offen wie nie ...
Michael Gerard Bauer
Nennt mich nicht Ismael!
Aus dem Englischen von Ute Mihr
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Dank
Für Greg, Keith und Anne, weil es um Freundschaft, Liebe und Lachen geht … und weil ich eure Drohungen ernst genommen habe.
Teil 1
Nennt mich Ismael.
Herman Melville, Moby Dick
1
Bürgermeister von Versagerhausen
Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, deshalb sage ich es einfach geradeheraus — es wird Zeit, sich der Wahrheit zu stellen: Ich bin vierzehn Jahre alt und leide am Ismael-Leseur-Syndrom.
Heilung ausgeschlossen.
Soweit ich weiß, bin ich weltweit der einzige schriftlich belegte Fall von Ismael-Leseur-Syndrom. Wahrscheinlich hat der Berufsstand der Ärzte bislang nicht einmal vom Ismael-Leseur-Syndrom gehört. Aber es existiert, glaubt mir. Doch genau da liegt das Problem: Wer glaubt mir schon?
Eine Weile habe ich es einfach ignoriert, aber in diesem Schuljahr waren die Symptome so schrecklich schmerzhaft, dass ich sie zur Kenntnis nehmen musste. Und ich übertreibe nicht, nicht im Geringsten: Das Ismael-Leseur-Syndrom macht aus einer völlig normalen Person eine wandelnde Katastrophe, die auf der nach oben offenen Idioten-Skala mindestens den Wert neun Komma neun erreicht.
Deshalb habe ich beschlossen, alles aufzuschreiben. Jetzt werden endlich alle die Wahrheit begreifen. Statt mich zum Bürgermeister von Versagerhausen zu wählen, werden sie einfach nachsichtig lächeln und nicken: »Okay, alles klar. Der arme Junge leidet am Ismael-Leseur-Syndrom. Er kann nichts dafür.«
Aber ich greife vor, statt am Anfang zu beginnen und die Dinge gründlich zu durchleuchten. Vermutlich muss ich die Sache wissenschaftlich angehen, wenn ich euch davon überzeugen will, dass dies alles wahr ist.
Also der Reihe nach: Ich heiße Ismael Leseur.
Stopp, ich weiß, was ihr sagen wollt: Ich habe denselben Namen wie meine Krankheit. Wahrscheinlich meint ihr, ich hätte die Krankheit nur erfunden, damit ich eine Entschuldigung habe, wenn ich mich mal wieder komplett zum Narren mache. Aber da seid ihr schief gewickelt. So einfach ist das nicht. Ihr müsst euch klarmachen, dass mein Name die Krankheit ist, zum Teil jedenfalls. Wie das im Einzelnen funktioniert, weiß ich nicht genau. Schließlich bin ich kein Wissenschaftler, sondern das Opfer der Krankheit, aber ich habe so meine Theorien:
THEORIE EINS: Das Ismael-Leseur-Syndrom wird von einem tödlichen Virus ausgelöst, das aus der Verbindung von »Ismael« und »Leseur« entsteht.
Über diese Theorie habe ich sehr viel nachgedacht, deshalb möchte ich euch gern meine Schlussfolgerungen darlegen. Die einzelnen Buchstaben sind meiner Ansicht nach für sich selbst genommen völlig harmlos. Auch die Bildung der Worte »Ismael« und »Leseur« aus diesen Buchstaben scheint noch einigermaßen unverfänglich zu sein. Zum Beweis verweise ich auf meine engsten Verwandten: und zwar meinen Vater Ron Leseur, Versicherungsvertreter und Mitbegründer der 80er-Jahre-Rockband »Dugongs«, meine Mutter Carol Leseur, Stadträtin und Hauptorganisatorin der Familie, und meine 13-jährige Schwester Prue Leseur.
Wie ihr seht, tragen alle den Namen Leseur, aber ich versichere euch, dass keiner auch nur an einem einzigen der schrecklichen Symptome leidet, die ich euch gleich näher beschreiben werde. Ich muss sogar sagen, dass meine Mutter und mein Vater fast immer einen außerordentlich glücklichen und zufriedenen Eindruck machen. Meine Schwester ist, was die Sache noch schlimmer macht, nach Ansicht jedes Freundes, Verwandten und Fremden, der sie jemals zu Gesicht bekommen hat, einfach »hinreißend«. Außerdem hat sie einen IQ, der sich im Bereich »Genie« bewegt. Wenn Gehirne Autos wären, dann wäre Prue ein Rolls Royce, ich dagegen ein aufgebocktes Goggomobil, dem der halbe Motor fehlt. Und wie fühle ich mich wohl dabei? Ich will es euch sagen: Wie der einzige Mensch, der den Job des Dorftrottels nicht bekommen hat, weil er hoffnungslos überqualifiziert ist. Oder wie Prue mir einmal nachdenklich erklärte: »Menschen nutzen nur zehn Prozent ihres Gehirns, aber bei dir, Isy, scheint das bei weitem nicht auszureichen.«
Da habt ihr es. Dass meine Familie immun ist gegen das Syndrom, lässt nur eine Schlussfolgerung zu: Das Syndrom wird einzig und allein durch die fatale Kombination der Wörter »Ismael« und »Leseur« ausgelöst.
So wie ich das sehe, erzeugt die Verbindung dieser besonderen Laute eine chemische Reaktion, die ein Virus hervorbringt, das die Zellen des Körpers verändert und eine Vermehrung tödlicher Toxine zur Folge hat. Diese tödlichen Toxine greifen das Gehirn und das Nervensystem an, so dass der Erkrankte Dinge sagt und tut, die sogar einem kompletten Vollidioten peinlich wären. Bislang ist es mir noch nicht gelungen, diese Theorie wirklich zu beweisen: Biologie und Chemie sind nicht gerade meine besten Fächer. In Englisch bin ich viel besser; aber wer wäre das nicht, mit einer Lehrerin wie Miss Tarango? Doch das ist eine andere Geschichte, und Miss Tarango ermahnt mich immer, dass ich beim Schreiben meine Gliederung im Auge behalten muss. Offenbar habe ich die Neigung abzuschweifen.
Also, die Sache ist die: Ich entwickelte nicht deshalb das Ismael-Leseur-Syndrom, weil diese beiden Wörter zufällig verbunden wurden. Nein, eine vorsätzliche Handlung hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Leider kenne ich die Umstände, wie es zu meinem Namen kam, bis ins letzte peinliche Detail, und ich weiß genau, wer dafür verantwortlich ist.
Ich nenne die Namen der Verantwortlichen in diesen Aufzeichnungen, damit alle sie lesen können.
Ja, meine Eltern haben mir die Bürde dieses unseligen Namens auferlegt. Ganz richtig, die vorgenannten (ein ausgezeichnetes Wort für einen so ernsten Text wie diesen, Miss Tarango würde es gutheißen) Ron und Carol Leseur. Man darf es ihnen nicht zum Vorwurf machen. Eltern müssen ihren Kindern einen Namen geben. Was geschehen ist, war nicht ihre Schuld. Sie hatten keine Ahnung, was sie anrichteten.
Allerdings würde es mir vielleicht ein bisschen leichter fallen, es zu akzeptieren, wenn sie nicht hysterisch gelacht hätten, als sie es taten.
2
Kaum zu glauben!
Die Geschichte, wie ich zu meinem Namen kam, ist die Lieblingsgeschichte unserer Familie. Na ja, zumindest die Lieblingsgeschichte meines Vaters. Jedes Familienmitglied reagiert einen Tick anders auf sie. Mein Vater erzählt sie für sein Leben gern. Mutter hört sie gern an. Prue liebt es zuzuschauen, wie ich mich winde, wenn sie erzählt wird. Und ich? Ich winde mich.
Ich habe die Geschichte, wie Ismael zu dem Namen Ismael gekommen ist, so oft gehört, dass ich das Gefühl habe, selbst dabeigewesen zu sein. Und in gewisser Weise war ich das ja auch. Allerdings schwebte ich die meiste Zeit wie ein pummeliger Alien in meinem Fruchtwassersee und hatte keine Ahnung, dass dort draußen — außerhalb der gemütlichen Wärme im Schoß meiner Mutter — Menschen waren, die mein Leben für immer verändern sollten.
Nichts und niemand kann meinen Vater davon abhalten, die Geschichte zu erzählen, wie Ismael zum Namen Ismael kam, wenn er sie erzählen will. Und dabei spielt es keine Rolle, ob das vorgesehene Publikum sie schon einmal gehört hat oder nicht. O nein, keineswegs. Unzählige Male habe ich den folgenden Dialog gehört:
Dad: Habe ich dir eigentlich schon erzählt, wie Ismael zu seinem Namen gekommen ist?
Opfer: Ja, ich glaube schon. Deine Frau war doch im Krankenhaus … und sie war überfällig …
Dad: Richtig, sie war längst überfällig. Ich werde es nie vergessen. Eine großartige Geschichte. Ich besuchte sie nach der Arbeit …
Opfer: Ja. Ich erinnere mich. Du hast es mir erzählt. Eine tolle Geschichte — wie deine Frau ein bisschen verstört war und sagte, sie komme sich vor wie ein …
Dad: Verstört! Das kann man wohl sagen. Du hättest sie sehen sollen. Als ich sie gleich nach der Arbeit besuchte, hat sie geheult …
Opfer: Jaja, und sie sagte, sie sei so dick, dass sie sich vorkomme wie …
Dad: Sie hatte wirklich gewaltige Ausmaße! Es war ja unser erstes Kind, und weil der errechnete Geburtstermin schon verstrichen war, machte sie sich Sorgen und war müde. War ziemlich schwer für sie. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, als ich sie nach der Arbeit besuchte …
Ungefähr an diesem Punkt bemerken Dads Opfer normalerweise, dass Widerstand zwecklos ist. Auf ihr Gesicht legt sich dann ein schwaches Lächeln, das gelegentlich von einem Kopfschütteln oder Heben der Augenbrauen begleitet wird. So signalisieren sie an geeigneter Stelle, dass sie angemessen erstaunt oder beeindruckt sind. Selten versuchen sie zu unterbrechen und dann allenfalls, um Brocken wie »Wirklich?«, »Kaum zu glauben!« oder »Was du nicht sagst« einzuwerfen. Und in der Zwischenzeit poltert Dad vorwärts wie ein außer Kontrolle geratener Lastwagenanhänger, der nicht aufzuhalten ist, bis er seine endgültige Ruhestätte in einem arglosen Wohnzimmer gefunden hat.
Mein Vater mag zwar eher harmlos wirken, die Ismael-Geschichte ist aber immer da. Sie lauert am Grund eines jeden Gesprächs wie ein gewaltiges Krokodil, von dem nur die Augen die Wasseroberfläche durchbrechen, immer bereit zuzuschlagen, sobald das ahnungslose Opfer zu dicht ans Wasser tritt.
»Ismael? Das ist ja ein interessanter Name.«
Und weg ist es. Jeder Gedanke an Rettung ist sinnlos. Mein Vater ist längst aus dem flachen Wasser eitlen Geplauders geschnellt, hat seine verblüffte Beute geschnappt und zerrt sie, um sich schlagend, in die schattigen Tiefen seiner Erinnerungen.
Das führt mich zu meiner zweiten Theorie:
THEORIE ZWEI: Der am Ismael-Leseur-Syndrom erkrankte Patient kann beunruhigendes Verhalten in anderen auslösen.
Zunächst dachte ich, dieses Phänomen betreffe ausschließlich meinen Vater, aber das war, bevor ich Barry Bagsley begegnete. Ich erkannte, dass die Symptome bei meinem Vater sogar eher schwach ausgeprägt waren und dass der Name Ismael Leseur das absolut Schlimmste in einem Menschen zu Tage fördern konnte. Doch Barry Bagsley muss noch ein bisschen warten. Jetzt ist es Zeit für die Lieblingsgeschichte der Familie. Habe ich euch je erzählt, wie ich zu meinem Namen gekommen bin?
3
Da bläst sie!
Nach Ansicht des Arztes hätte ich Ende Juli längst auf der Welt sein sollen. Am ersten August lag meine Mutter schon eine Woche lang im Krankenhaus und neigte nach einigen Fehlalarmen zu Gefühlsausbrüchen.
»Ich komme mir vor wie ein Wal!«, stöhnte sie immer wieder und hielt sich den prallen Bauch mit beiden Händen, als wollte sie verhindern, dass er platzte. Dad fand, dass sie mit dem hervorstehenden Bauchnabel aussah, als würde sie von einer Riesenbrust attackiert. Offenbar sah sich Mum damals außer Stande, den Witz dieser Bemerkung zu würdigen, und warf eine Bettpfanne nach ihm. Wie ich bereits bemerkte, sie neigte zu Gefühlsausbrüchen. Jedenfalls fand mein Vater, dass meine Mutter ein bisschen Aufmunterung gebrauchen konnte. Oder wie er es ausdrückte: »Ich musste etwas tun, damit sie aufhörte zu jammern und sich wie ein Wal zu fühlen.«
Doch was dann geschah, war kein Spaß mehr für mich. Dad verließ unter dem Vorwand, er müsse Familie und Freunde über die Fortschritte informieren, das Krankenzimmer meiner Mutter. Zwanzig Minuten später kehrte er wieder zurück. Aber als meine Mutter zur Tür blickte, sah sie nicht ihren Ehemann, sondern eher eine Kreuzung aus einem verstörten Piraten und einem entlaufenen Irren.
Dad hatte die Schwestern beschwatzt, ihm zu helfen, den Unterschenkel des rechten Beins an den Oberschenkel zu binden und dann eine leere Papprolle an seinem Knie zu befestigen, die aussah wie ein Holzbein. Außerdem rüsteten sie ihn mit einer hölzernen Krücke aus, einer medizinischen Augenklappe, die sie mit einem Filzstift schwarz angemalt hatten, und einem Kopftuch aus Mull, unter dem sich Dads rote Locken wie Schlangen hervorkringelten. Ein kleiner blauer Teddybär, der anstelle eines Papageis mit Klebeband auf der Schulter meines Vaters befestigt war, rundete seine Erscheinung ab.
Die Hände in die Hüften gestemmt und leicht schwankend, blieb Dad in dramatischer Pose unter dem Türsturz stehen: »Arrrrr«, stieß er hervor und starrte mit irrem Blick auf Mums riesigen, bleichen Bauch. »Ich bin Kapitän Ahab, und ich suche den weißen Wal!«
Damit hätte Dads verrückter Auftritt vorbei sein können, wenn, ja wenn Mum nicht genau in diesem Moment getrunken und den Schluck Wasser noch im Mund gehabt hätte. In der Version meines Dads vergingen ein oder zwei Sekunden, in denen meine Mutter ihn nur mit aufgeblasenen Backen anstarrte wie ein »verfetteter Goldfisch«. Dann kam ein merkwürdiges Gluckern und Brummen aus ihrem Mund. Kurze Zeit später begann ihr Bauch zu zittern wie ein Wackelpudding, und weil sie ihre Lippen so angestrengt aufeinanderpresste, sahen ihre Augäpfel aus, als wollten sie sich demnächst aus ihrer Verankerung lösen und ihre Höhlen verlassen.
Schließlich war der Druck einfach zu groß. Ein kurzer scharfer Wasserstrahl schoss aus den geschürzten Lippen meiner Mutter, passierte ihren gewölbten Leib und traf genau in die Mitte des Krankenblatts am Fußende ihres Bettes.
Dads Augen weiteten sich vor Vergnügen, und er rief triumphierend: »Arrrrrr-Arrrrrr! Da bläst sie!«
Und in der Tat: Sie blies.
Dad beschreibt die Fontäne, die aus Mums Mund spritzte, als »die Niagarafälle an einem guten Tag«. Zwischen Prusten, Spucken und Luftschnappen lachte Mum so sehr, dass ihre Fruchtblase platzte. Die Wehen setzten ein und kamen gleich richtig auf Touren.
Als Dad merkte, dass Mum ebenso sehr vor Schmerzen schrie wie vor Lachen, schritt er zur Tat. Er stieß die Krücke beiseite und wollte schwungvoll in den Raum stürmen. Leider hatte er sein »Holzbein« völlig vergessen. Die Papprolle knickte unter seinem Gewicht ein, er taumelte und griff verzweifelt nach dem Vorhang, der zusammengerafft am Fußende des Bettes hing: Explosionsartig wurden die Vorhangringe in die Luft geschleudert, sie prallten von Wand und Decke ab und prasselten auf den Boden wie Hagelkörner aus Plastik. Inzwischen heulte meine Mutter vor Lachen, hielt sich den Bauch und kreischte hysterisch: »Nein, bitte, aufhören! Aufhören! Bitte! Ich kann nicht mehr! Aufhören!«
Dad meint, er wisse genau, wie Mum sich damals fühlte. Wegen des hochgebundenen Unterschenkels war er ungebremst mit dem Knie auf das harte Linoleum geprallt. Dort lag er jetzt auf dem Rücken, krümmte sich vor Schmerzen und bekam kaum Luft vor Lachen. Dieser Zustand hielt jedoch nicht lange an, denn ein neues Geräusch breitete sich in dem Raum aus, nämlich ein tiefes Brummen und mühsam unterdrücktes Stöhnen.
Und dann … Na ja, ich denke, ihr wisst, was dann passierte. Dankenswerterweise ersparten meine Eltern mir die grausigen Details. Ich kann nur sagen, dass Mum und Dad schon kurze Zeit später liebevoll ihr erstgeborenes Kind bestaunten. Wir waren eine glückliche, kleine Familie. Alles war perfekt, bis …
»Ein Junge, ein wunderschöner Junge«, sagte Mum und wischte sich die Tränen von der Backe. »Aber wie soll er heißen? Wir haben immer noch keinen Namen für ihn.«
Wenn Dad die nächste Szene beschreibt, spielt er alle Handlungen ganz genau nach, so dass mir die Episode so vertraut ist, als würde ich mich tatsächlich selbst daran erinnern. Dad runzelt die Stirn, beugt sich vor und legt sein Ohr knapp über den Mund seines neugeborenen Sohnes, dem gurgelnde Laute entweichen. Er lauscht angestrengt, während seine Augen hin und her schießen, als würde er gerade ein wunderbares Geheimnis erfahren.
»Was sagt der kleine Kerl?«, will Mum wissen.
Dad hebt den Kopf und schaut sie verwundert an: »Er sagt … ›Nennt mich Ismael‹!«
Als die Ärztin schließlich an jenem schicksalsträchtigen Tag vor ungefähr vierzehn Jahren in Mums Zimmer hastete, lachten meine Eltern, ihren kleinen Sohn zwischen sich, hemmungslos und voller Freude. Ich dagegen lachte nicht, ich »kreischte wie eine Motorsäge«, sagt mein Vater.
Vielleicht wusste ich schon damals, was mein Vater mir angetan hatte.
4
Vielen Dank, Herman!
Natürlich gäbe es ohne Herman Melville überhaupt kein Ismael-Leseur-Syndrom. Genau genommen trägt er die Schuld.
Wirklich. Wenn nämlich Herman Melville nicht vor rund 150 Jahren seinen Roman über Kapitän Ahab und dessen wahnhafte Suche nach Moby Dick, dem weißen Wal, geschrieben hätte, dann hätten sich Ron Leseur (mein Vater) und Carol McCann (meine Mutter) nicht an der Universität im Grundkurs »Amerikanische Literatur« mit diesem Text beschäftigt. Und wenn Herman Melville Moby Dick nicht geschrieben und meine Eltern den Roman nicht untersucht hätten, dann hätte sich mein Vater nicht sieben Jahre später, nachdem sie geheiratet hatten und ihr erstes Kind erwarteten (mich), als Kapitän Ahab verkleidet, nur weil meine Mutter sagte, sie komme sich vor wie ein Wal. Denn dann hätte es keinen Kapitän Ahab gegeben, nach dessen Vorbild er sich hätte verkleiden können, und auch keinen weißen Wal, über den er sich lustig machen konnte. Deshalb hätte er meine Mum niemals so zum Lachen bringen können, dass meine Wenigkeit laut schreiend in die Welt gepresst wurde, bevor ich bereit dazu war. Und (das ist der Knackpunkt) Dad hätte in hundert Jahren nicht den Namen Ismael ausgesprochen, denn er hätte nicht gewusst, dass Ismael der Name des Erzählers und Helden von Moby Dick ist. Wenn Herman Melville das Buch nicht geschrieben hätte, dann hätte mein Vater es nicht gelesen und genau das herausgefunden. Und meine Mutter hätte nicht gelacht, selbst wenn mein Vater aus irgendwelchen komischen Gründen den Namen Ismael vorgeschlagen hätte. Denn das hätte für sie keinen besonderen Sinn ergeben, wenn sie das Buch nicht gelesen hätte, was sie ja auch nicht gekonnt hätte, denn es hätte kein Buch zum Lesen gegeben, wenn Melville es nicht geschrieben hätte. Und wenn es nicht mein schreckliches Schicksal gewesen wäre, als Ismael Leseur zu enden, dann wäre keine der Katastrophen meines Lebens eingetreten, und ich wäre heute ein normaler, glücklicher Teenager wie jeder andere meines Alters.
So einfach ist das.
Wenn ihr jetzt nicht glaubt, dass dies alles der Wahrheit entspricht, dann könnt ihr es nachprüfen. Los, kauft euch eine Ausgabe von Moby Dick. Ihr müsst sie gar nicht ganz lesen. Eigentlich müsst ihr gar nicht viel lesen, kein ganzes Kapitel, nicht einmal eine Seite. Alles, was ihr lesen müsst, sind drei Worte. Drei Worte! Na los. Schlagt Kapitel eins auf. Es trägt den Titel »Schemen«.
Schaut, da steht es auf der allerersten Seite. Lest die ersten drei Worte von Herman Melvilles Moby Dick. Diese Worte haben auch meine Eltern an der Uni gelesen. Und diese Worte ruhten tief vergraben im Gehirn meines Vaters, bis sie an jenem schrecklichen ersten August vor 14Jahren durch den Anblick des dicken Bauchs meiner Mutter zum Keimen gebracht und dann von den Lachtränen meiner Eltern gewässert wurden.
Los, lest. Lest die ersten drei Worte von Moby Dick. Kommt, ich helfe euch: »Nennt mich Ismael.«
Vielen Dank, Herman!
5
Ein scheißblöder Name!
Ich möchte nicht, dass ihr einen falschen Eindruck bekommt. Ich habe nicht mein Leben lang am ILS gelitten. Keineswegs. Die ersten zwölf Jahre meines Lebens zeigte ich gar keine Symptome. Aber dann kam ich auf die weiterführende Schule, und zwar auf das St Daniel’s Boys College.
Davor hatte ich an der Moorfield Primary sieben ereignislose Jahre mit Klassenkameraden verbracht, die sich nicht darum geschert hätten, wenn mein Name Slobo Bugslag gewesen wäre (zufällig hieß der beliebteste Junge der Schule so). Doch in Klassenstufe acht wurde alles anders. Nach der Grundschule verteilte sich unsere Klasse auf die verschiedenen weiterführenden Schulen in unserer Stadt, und nur eine Handvoll landete im St Daniel’s.
Dort veränderte sich meine Welt dramatisch. In der Moorfield Primary waren wir zu zwölft in der Klasse. Am ersten Tag im St Daniel’s wartete ich im Foyer mit über hundert anderen Achtklässlern darauf, dass wir auf vier Klassen verteilt wurden. Als ich dann in der Klassenliste nachschaute, stellte ich fest, dass ich von den einzigen beiden Jungen, die ich aus der Grundschule kannte, getrennt worden war. In der Klassenlehrerstunde ging unser Lehrer Mr Brownhill die Liste durch und überprüfte, ob wir alle da waren. Auf der Hälfte sagte er: »Ismael Leseur.«
Ich antwortete: »Ja, hier«, wie alle anderen vor mir.
»Ismael?«, wiederholte er und hielt zum ersten Mal während der Anwesenheitsüberprüfung inne. »Interessanter Name.«
Fünfundzwanzig Augenpaare richteten sich auf mich. Keines von ihnen schien mich auch nur im Geringsten interessant zu finden. Eines der Augenpaare gehörte Barry Bagsley. Erinnert ihr euch an meine zweite Theorie?
THEORIE ZWEI: Der am Ismael-Leseur-Syndrom erkrankte Patient kann beunruhigendes Verhalten in anderen auslösen.
Nun, Barry Bagsley war in dieser Hinsicht ein sehr extremer Fall. Den ersten zarten Hinweis darauf erhielt ich durch seine einleitenden Worte, die er an diesem ersten Tag im Pausenhof an mich richtete:
»Ismael? Was ist denn das für ein scheißblöder Name?«
Was sollte ich darauf sagen? Bis zu diesem Moment hatte ich nicht einmal geahnt, dass es ein scheißblöder Name war. Niemand hatte mich warnend darauf hingewiesen, dass ich einen scheißblöden Namen trug. Warum sollten meine Eltern mir überhaupt einen scheißblöden Namen gegeben haben? War Herman Melville sich im Klaren darüber, dass dies ein scheißblöder Name war? Ich konnte nur dastehen und blöd lächeln, während Barry Bagsley und seine Freunde lachten und mich im Vorbeigehen anstießen, als wäre ich eine Drehtür.
Ich stand da wie ein Vollidiot.
Und ich fühlte mich beschissen.
Am Abend betrachtete ich mich im Badezimmerspiegel. Irgendwie sah ich anders aus. Wie damals, als ein Freund mir gesagt hatte, mein linkes Ohr stehe weiter ab als mein rechtes. Zu Hause maß ich den Abstand nach und stellte fest, dass beide genau gleich weit von meinem Kopf abstanden. Trotzdem musste ich jedes Mal, wenn ich mein Spiegelbild sah, unwillkürlich daran denken, dass eines meiner Ohren wie ein Winker ein Zeichen zum Linksabbiegen gab. Ich fühle mich wie damals. Mein Spiegelbild kam mir irgendwie anders vor. Ich sah anders aus. Aber warum? Und dann wurde es mir schlagartig klar.
Ich sah aus wie ein Junge mit einem scheißblöden Namen. Und nicht nur das, ich schwöre, dass mein linkes Ohr abstand wie eine offene Autotür.
Als ich am nächsten Tag in die Klasse kam, wartete Barry Bagsley schon auf mich.
»Was stinkt hier? Ach ja! Piss-mael!«
Wie ich bereits sagte, irgendetwas in meinem Namen brachte das Schlechteste in Barry Bagsley zum Vorschein. Wie ein bösartiger Hund einen Schuh zerfetzt, riss und zerrte er an meinem Namen, bis er so verstümmelt und verdreht war, dass es selbst mir schwerfiel, mich daran zu erinnern, wer ich in Wirklichkeit war.
Ismael wurde zu Piss-mael verdreht. Piss-mael zu Küss-mal verballhornt und Küss-mal zu Fischmehl zermatscht. Nicht einmal mein Nachname war vor Verschandelung sicher. Aus Leseur (das eigentlich Le-sör ausgesprochen wird) wurde Schiss-eur, Piss-oir, Le Sau, Le Bauer, Le Tölpel und zuletzt Stinkstiefel, abgekürzt auch Stinki.
Am Ende meines ersten Schuljahres in der Highschool hatte Barry Bagsley meinen Namen auf wundersame Weise von Ismael Leseur in Fischmehl Stinkstiefel verwandelt.
Und das fasste in etwa zusammen, wie ich mich fühlte.
6
Stinki
Bald war allen Achtklässlern klar, dass es nur zwei Verhaltensweisen gab, wenn man seinen Aufenthalt im St Daniel’s Boys College halbwegs unbeschadet überstehen wollte: Entweder man ging Barry Bagsley unter allen Umständen aus dem Weg, wofür sich die Mehrheit entschied, oder man riskierte die seltener gewählte Variante und suchte die trügerische Sicherheit von Barry Bagsleys innerem Kreis von »Freunden«.
Für mich war Aus-dem-Weg-Gehen die einzige Option.
Ich begriff sehr schnell, dass alles in Ordnung war, solange ich größtmöglichen Abstand von Barry Bagsley hielt und nichts Dummes tat — etwa im Unterricht eine Frage stellen oder beantworten; ungewöhnliche Laute von mir geben, wie Rufen, Lachen oder Sprechen; mich freiwillig für etwas melden; meinen Namen auf eine Liste setzen; eine Sportart ausprobieren; einen Gegenstand an einem Ort lassen, wo er bewegt, beschrieben oder als Wurfgeschoss verwendet werden könnte; den Blick in die Nähe von Barry Bagsley oder seinen Freunden richten oder sonst etwas tun, das darauf hindeuten könnte, dass ich tatsächlich existierte.
Im Grunde war die wichtigste Lektion, die ich letztes Jahr lernte, ein möglichst kleines Ziel abzugeben. Ich entwickelte mich zum wahren Meister darin. Für Barry Bagsley und seine Kumpel wurde ich praktisch unsichtbar. Manchmal konnte ich mich selbst kaum mehr erkennen. Mein erstes Jahr an der weiterführenden Schule verbrachte ich also mehr oder weniger — in Deckung.
Wenn ich gelegentlich widerstrebend ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt wurde, weil ich zum Beispiel nicht umhinkonnte, die Frage eines Lehrers zu beantworten, stellte ich mich innerlich auf unvermeidliche Kommentare ein wie »Was stinkt hier nach Fischmehl?« oder »Wer hat Piss-mael gesehen?« oder »Mein Gott! Es ist Stinki aus dem Piss-oir«. Aber auch diese Beleidigungen verloren ihren Stachel. Vielleicht hatten sie ja auch recht. Vielleicht stank ich tatsächlich. Sagte das nicht schon mein Name?
Jedenfalls hielt ich irgendwie bis zum Ende des Schuljahres durch, floh dankbar in die Weihnachtsferien und kehrte dieses Jahr widerwillig zurück, denn ich erwartete auch in Klasse neun nichts anderes, als dass das Schulleben für mich genauso weitergehen würde wie bisher. Aber da irrte ich mich. Dieses Jahr würde anders werden.
Es würde das härteste, verrückteste, peinlichste, schrecklichste und das beste Jahr meines Lebens werden.
7
Moby wer?
Es war der erste Schultag in Klasse neun. Ein nagelneues Jahr. Ein nagelneues Klassenzimmer. Eine nagelneue Klassenlehrerin. Und ein neuer Anfang.
»He, Stinkstiefel — schmeiß mal einen roten Stift rüber. Du bist doch bestimmt gut im Sch-m-eißen, oder, Stinki?«
Immer noch der alte Barry Bagsley. Ich finde, man musste ihm einfach geben, was er verlangte. Auf seine Art hatte er einen recht kreativen Zugang zur Sprache. Natürlich tat ich so, als müsste ich dringend meine Bücher sortieren, und dabei hoffte ich inständig, dass unsere Lehrerin bald eintreffen würde. Und sie kam. Miss Tarango.
Man muss wohl erwähnen, dass keiner von uns je zuvor eine Lehrerin wie Miss Tarango hatte. Sie war jung. Sie war schön. Sie schien uns sogar gern zu unterrichten. Ich glaube, Mum hätte sie als »temperamentvoll« bezeichnet. Ich mochte sie auf Anhieb. Sie hatte kurzgeschnittene blonde Locken, Augen, die wirklich leuchteten, und Grübchen in ihren Backen, die wie von Zauberhand erschienen, wann immer sie lächelte. Und das war oft. Sie war fröhlich, freundlich und voller Enthusiasmus. Ich glaubte nicht, dass sie auch nur ein halbes Schuljahr überstehen würde.
»Guten Morgen, Jungs. Ich bin Miss Tarango. Ich bin euere Klassenlehrerin und unterrichte euch in Englisch. Dies ist mein erstes Jahr als Lehrerin, und ihr seid meine allererste Klasse.«
Das reduzierte ihre Überlebenszeit auf höchstens eine Woche. Ich hörte das erste Grollen aus der hinteren Ecke, wohin sich Barry und seine Kumpel verzogen hatten.
»Gut, dann seid mal ein bisschen leiser, damit wir die Klassenliste durchgehen können.«
»Ich würde lieber etwas anderes mit ihr durchgehen.« Unterdrücktes Kichern ertönte hinter mir.
Miss Tarango richtete ihren lächelnden Blick auf Barry Bagsley. »Tut mir leid, aber das habe ich nicht verstanden«, sagte sie liebenswürdig.
»Nichts, Miss«, meinte Barry Bagsley grinsend. »Ich sagte nur, dass es gut wäre, wenn wie jetzt die Liste durchgehen würden.«
Die Jungen neben ihm grinsten zurück.
Miss Tarango fixierte Barry Bagsley mit ihren hellen blauen Augen. Die anderen Schüler warteten. Die anderen Schüler warteten noch ein bisschen länger. Die anderen Schüler fragten sich unbehaglich, wie lange sie wohl noch warten müssten. Das Grinsen auf den Gesichtern der Jungen neben Barry Bagsley erstarb. Miss Tarango schwieg und lächelte wie das Covergirl einer Hochglanzillustrierten. Barry Bagsley rutschte ein bisschen auf seinem Stuhl hin und her.
»Danke für deine Unterstützung. Gut zu wissen, dass wir uns einig sind. Dann fangen wir an, was? Mal sehen, wen haben wir denn hier. Tom Appleby?«
»Hier, Miss.«
»Ryan Babic?«
»Hier, Miss.«
»Barry Bagsley?«
»Jap!«
Miss Tarango lächelte weiterhin liebenswürdig, aber ihre Augen schienen ein bisschen weniger zu leuchten. »Barry, ich denke, in der Zukunft ist ein einfaches ›hier‹ oder ›anwesend‹ angemessener und höflicher. Danke.«
»Tut mir leid, Miss«, grinste Barry Bagsley.
Sie setzte die Überprüfung der Anwesenheit ohne Zwischenfall fort, bis: »Ismael … ach, wie wird dein Nachname ausgesprochen, Ismael — Le-sör?«
»Ja, Miss.«
»Das stimmt nicht, Miss. Es heißt Le-sau. Pissmael Le Sau.«
Hinter mir wurde wieder gelacht.
Miss Tarango legte die Liste auf das Pult vor ihr. Sie sprach ruhig und mit Bedacht: »Barry, ich bemühe mich immer sehr, die Namen meiner Schüler zu lernen und sie richtig auszusprechen. Und das erwarte ich auch von dir und von allen anderen in der Klasse. Jeder von uns verdient es, respektvoll behandelt zu werden. Etwas anderes werde ich nicht tolerieren. Bitte denk in Zukunft daran. Okay?«
Barry Bagsley saß schweigend da. Miss Tarango wandte sich wieder ihrer Namensliste zu.
»Wo war ich? Ach ja … Ismael.«
Dann hielt sie inne, sah von ihrem Blatt auf und lächelte mich an. »Du weißt, dass Ismael ein sehr berühmter Name in der englischen Literatur ist?«
Was? O nein. Sag es nicht. Bitte sag es nicht. Lies einfach den nächsten Namen auf der Liste. Vergiss es und mach weiter. Bitte.
»Wusstet ihr, dass Ismael der Name des Helden eines sehr berühmten Romans ist?« Miss Tarango strahlte ihre Schüler begeistert an.
Die Schüler schauten verständnislos zurück wie Kaninchen, die von einem blendenden Scheinwerfer erfasst werden und wie betäubt stehen bleiben. Ich überlegte verzweifelt, wie ich Miss Tarango vor fünfundzwanzig Augenzeugen so erwürgen konnte, dass es aussah wie ein Unfall.
»Kennt jemand den Titel des berühmten Romans, in dem eine Hauptfigur Ismael heißt?«
Nein, niemand kennt ihn, und er ist ihnen auch egal, lassen Sie uns also einfach weitermachen und die Anwesenheitsliste durchgehen.
»Niemand? Und wenn ich euch einen Tipp gebe? Der Roman spielt nicht in der Gegenwart … und eine der anderen Hauptfiguren ist Kapitän eines Schiffes.«
Stille. Dann hob sich zögernd eine Hand. »Ja?«
»Star Trek, Miss?«
Die Klasse brach sofort in Gelächter aus, prüfte aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Antwort richtig war, insgeheim zugleich Miss Tarangos Reaktion. Auch Miss Tarango lachte, als ob ihr der Scherz gefallen habe, aber als sie Bill Kingsley ansah, der die Antwort gegeben hatte, erkannte sie, dass ein Scherz leider nicht beabsichtigt gewesen war.
»Du bist Bill, nicht wahr? Nun, das war nicht schlecht, Bill. Sehr gut, für einen ersten Versuch. Vielleicht hätte ich euch verraten sollen, dass der Roman auf einem Segelschiff spielt und nicht auf einem Raumschiff.« Miss Tarango ließ den Blick noch einmal über die Klasse schweifen. »Hat noch jemand eine Idee? Nein? Wer hat schon einmal von Moby Dick gehört?«
»Moby wer, Miss?«
Gedämpftes Kichern. Wieder Barry Bagsley. So eine Gelegenheit konnte er sich nicht entgehen lassen.
»Moby Dick von Herman Melville, Barry«, sagte Miss Tarango beiläufig. »Wer von euch kennt die Geschichte von Kapitän Ahab und seinem wütenden Rachefeldzug gegen Moby Dick, den weißen Wal, durch den er ein Bein verloren hatte.«
Die meisten Schüler hoben mehr oder weniger sicher und begeistert die Hand. Bill Kingsley starrte in die Ferne, als ob er schon irgendwo weit weg in einer fernen Galaxie wäre.
»Aber warum hieß der Wal Moby Dick, Miss?«
Das Kichern wurde jetzt lauter. So leicht gab Barry Bagsley nicht auf.
Miss Tarango schien intensiv nachzudenken und antwortete dann sehr bedächtig: »Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, Barry. Namen in Büchern können sehr wichtig sein oder eine symbolische Bedeutung haben. Sie haben oft einen tieferen Sinn, aber ich bin mir einfach nicht sicher, ob das auch auf Moby Dick zutrifft. Vielleicht hatte Herman Melville den Namen von einem echten Wal, den er in historischen Quellen gefunden hatte, vielleicht fand er auch einfach nur, dass dieser Name genau passte. So wie deine Eltern dich vielleicht Barry genannt haben, weil sie dachten, dass du aussiehst wie ein Barry. Verstehst du?« Sie hielt inne und fügte dann als nachträglichen Einfall hinzu. »Genauso gut hätten sie denken können, dass du aussiehst wie ein Dick.«
Schlagartig herrschte erstaunte Stille im Klassenzimmer. Was? Was war das? Was hatte sie gesagt? Wenn Miss Tarango Barry absichtlich beleidigen wollte, ließ sie es sich nicht anmerken, sondern schien völlig ahnungslos angesichts der Wirkung ihrer Worte.
Bevor die Klasse reagieren konnte, fuhr sie in ihrer fröhlich lächelnden Art fort: »Auf jeden Fall ist das eine interessante Frage, Barry. Vielleicht könntest du als Hausarbeit ein bisschen nachforschen oder den Roman lesen. Möglicherweise findest du die Antwort dort. Und dann könntest du der Klasse in einem Referat von deinen Erkenntnissen berichten. Aber bevor uns die Zeit jetzt vollends davonläuft, gehen wir lieber die Anwesenheitsliste zu Ende durch und schauen uns das Merkblatt an.«
Es gibt nicht viel, was Barry Bagsley zum Schweigen bringt, aber das Bombardement mit Worten wie »nachforschen«, »Hausarbeit«, »lesen«, »berichten« und »Referat« schien ein echtes Patentrezept zu sein. Von da an verlief die Klassenlehrerstunde ohne Zwischenfälle. Miss Tarango erledigte energisch und geschäftig verschiedene administrative Aufgaben und widmete sich allem und jedem gleichermaßen begeistert, alldieweil die Klasse erstaunt zuschaute.
Aber niemand schaute und staunte mehr als Barry Bagsley.
8
Fünf erstaunliche Dinge über mich
Glücklicherweise hatten Barry Bagsley und ich nur wenige gemeinsame Unterrichtsstunden: die täglichen zwanzig Minuten Klassenlehrerstunde, Gemeinschaftskunde bei Mr Barker, dem Konrektor, und Englisch bei Miss Tarango. Verzwickt wurde es natürlich während der großen Pause und über Mittag.
»Ist das nicht Barbie Bimbos Lieblingsschüler, Fisch-Wal Le Dick!«
Ja, Barry Bagsley war schon ein Wortschmied, wie er im Buche stand.
»Ich hab ja immer gesagt, dass du ein Fisch-Wal bist, aber ich hatte keine Ahnung, wie berühmt du bist.«
An dieser Stelle hätte ich Barry Bagsley natürlich darüber aufklären können, dass Wale als Warmblüter, die ihre Jungen säugen, eigentlich zu den Säugetieren zählen und nicht zu den Fischen. Aber das wäre so gewesen, als würde ich einen wütenden Hai, der mit aufgerissenem Maul auf mich zuschwimmt, darauf hinweisen, dass ihm Seegras zwischen den Zähnen hängt.
»He, Leute, schaut mal, hier kommt der berühmte Fisch-Wal Le Dick. He, Le Dick, war das gestern deine Freundin, mit der ich dich gesehen habe, oder war es ein weißer Wal?«
Bumm-Bumm!
»Freundin? Stinki Le Sau hat doch keine Freundin. Er würde sie durch seinen Gestank vergraulen.«
Dieses sprachliche Juwel kam von Danny Wallace. Barry Bagsley unterwies ihn in der traditionellen Kunst, seine Mitschüler möglichst kreativ herabzusetzen. Er machte gute Fortschritte.
»Vielleicht war sie auch hinter einem Moby Dick her?«
Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, welchen Verlauf das Gespräch von da an nahm. Erst als sich die Pausenaufsicht näherte, verkrümelte sich Barry Bagsley mit seinem Kreis von Anhängern.
Zum nächsten Mal begegnete ich ihm an diesem ersten Tag in Klasse neun in der Stunde vor der Mittagspause — Englisch bei Miss Tarango.
Der Unterricht begann damit, dass Miss Tarango den Arbeitsplan für das Halbjahr vorstellte und es irgendwie schaffte, die Beurteilungen und sogar die Unterrichtseinheit Lyrik interessant erscheinen zu lassen. Sie redete viel davon, wie wichtig Sprache sei und wie viel Macht sie Menschen geben könne. Ich fragte mich, ob das tatsächlich stimmte. Könnte die Sprache mir die Macht geben, Barry Bagsley zu bezwingen? Vielleicht könnte ich aus großer Höhe ein dickes Wörterbuch auf ihn herabfallen lassen. Ich erfreute mich noch an dieser Vorstellung, als Miss Tarango jedem ein Blatt austeilte, das überschrieben war mit Fünf erstaunliche Informationen über mich.
»Schreibt, was euch in den Sinn kommt, aber es darf nicht langweilig sein. So etwas wie ›Meine Haare sind braun‹ oder ›Ich habe zwei Schwestern‹ möchte ich nicht lesen. Denkt nach, bevor ihr schreibt. Lasst euch was einfallen. Eure fünf erstaunlichen Infos können ernst oder lustig sein, bedeutsam oder banal oder was auch immer, aber sie müssen wahr sein. Vielleicht habt ihr einen Preis gewonnen. Oder ihr habt mal eine Kakerlake in eurem Kuchen gefunden oder, noch schlimmer, eine halbe, als ihr gerade hineinbeißen wolltet. (Die Schüler stöhnten.) Vielleicht kennt ihr eine berühmte Person oder habt sie gesehen. Oder vielleicht kommt ihr mit eurer Zunge an euren Ellbogen. (Viele versuchen es. Keiner schafft es. Bill Kingsley widmete dem Versuch die folgenden zwei Wochen.) Vielleicht seid ihr an einen interessanten Ort gereist oder habt eine ungewöhnliche Begabung.« (Quoc Nguyen verdreht seinen Daumen mit dem Doppelgelenk im rechten Winkel nach hinten und biegt ihn, bis er sein Handgelenk berührt. Gary Horsham stülpt seine Augenlider nach außen. Donny Garbolo rülpst die Nationalhymne.) Miss Tarango wird blass und bittet uns anzufangen.
Meine Liste der fünf erstaunlichen Informationen über mich.
Meine Schwester ist ein Genie.
Mein Vater spielte in einer Rockband namens Dugongs.
Meine Mutter ist Stadträtin.
Als ich in der vierten Klasse Messdiener war, bin ich während des Gottesdienstes immer ohnmächtig geworden.
Ich hasse meinen Namen.