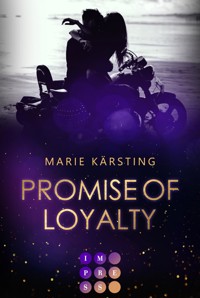
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
**Eine Krankenschwester, die alles verloren hat. Ein Biker, der sein Leben für sie geben würde.** Keine Wohnung, kein Job, aber jede Menge Pech. Aus purer Geldnot nimmt Kenna einen Job bei der Biker Gang Verdugos an und wird zur Krankenschwester eines der Mitglieder. Jared, ihr unfreiwilliger Patient, ist alles andere als erfreut, als ausgerechnet die Frau, für die er seit seiner Jugend schwärmt, bei ihm einziehen soll. Und die unleugbare Anziehung zwischen ihr und dem heißen verletzten Biker lässt auch Kenna nicht kalt. Als sie immer weiter in die gefährlichen Angelegenheiten des Clubs hineingezogen wird, muss sie sich entscheiden: Ist sie bereit ihr bisheriges Leben aufzugeben, um mit Jared zusammen zu sein? Ein gefährliches Spiel mit dem Feuer zwischen Liebe und Vernunft. Forced Proximity trifft auf heiße Friends to Lovers. //»Promise of Redemption« ist der zweite Roman der knisternden »Nevada Highways«-Reihe. Weitere Bände der nervenaufreibenden New Adult Romance bei Impress: --Nevada Highways 1: Promise of Redemption --Nevada Highways 2: Promise of Loyalty --Nevada Highways 3: Promise of Vengeance - erscheint im Oktober 2024 Alle Bände können unabhängig voneinander gelesen werden. Für die bessere Verständlichkeit empfiehlt es sich aber alle Bände in der Reihenfolge zu lesen.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Marie Kärsting
Nevada Highways 2: Promise of Loyalty
**Eine Krankenschwester, die alles verloren hat. Ein Biker, der sein Leben für sie geben würde.**
Keine Wohnung, kein Job, aber jede Menge Pech. Aus purer Geldnot nimmt Kenna einen Job bei der Biker Gang Verdugos an und wird zur Krankenschwester eines der Mitglieder. Jared, ihr unfreiwilliger Patient, ist alles andere als erfreut, als ausgerechnet die Frau, für die er seit seiner Jugend schwärmt, bei ihm einziehen soll. Und die unleugbare Anziehung zwischen ihr und dem heißen verletzten Biker lässt auch Kenna nicht kalt. Als sie immer weiter in die gefährlichen Angelegenheiten des Clubs hineingezogen wird, muss sie sich entscheiden: Ist sie bereit ihr bisheriges Leben aufzugeben, um mit Jared zusammen zu sein?
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Playlist
Danksagung
© privat
Marie Kärsting, geboren 1993, lebt mit Ehemann und zwei Hunden am Niederrhein. Obwohl sie schon als Kind vom Bücherschreiben träumte, stellte sie den Wunsch Autorin zu werden hinten an und studierte Betriebswirtschaftslehre. Nach erfolgreichem Abschluss fand sie trotz der vielen Zahlen ihre Liebe zu Wörtern wieder. Sie schreibt Romane und Kurzgeschichten quer durch den literarischen Gemüsegarten – immer mit einer Portion Feminismus.
Für alle, die das Gefühl haben, in ihren düsteren Gedanken zu ertrinken und trotzdem nach der Oberfläche greifen, auch wenn sie so weit entfernt wirkt.
Vorbemerkung für die Leser*innen
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die demzufolge Spoiler für den Roman enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du während des Lesens auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleib damit nicht allein. Wende dich an deine Familie, Freunde oder auch professionelle Hilfestellen.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Marie und das Impress-Team
Playlist
Pixies – Where Is My Mind?
Siouxsie and the Banshees – Spellbound
Flyleaf – All Around Me
Type O Negative – Anesthesia
Fear Factory – Invisible Wounds (Dark Bodies)
System Of A Down – ATWA
Sarah Hester Ross – Savage Daughter
Evanescence – Going Under
Lana Del Rey – Art Deco
Mitski – A Pearl
Lorde – Liability
Mazzy Star – Fade Into You
The Doors – Riders on the Storm
BLACKSHAPE – ITIIITIATIIHYLIHYL
Paramore – Decode
Two Feet – I Want It
Patti Smith – Dancing Barefoot
Bloc Party – Hunting for Witches
Metallica – One
Bad Omens – Just Pretend
Imogen Heap – Hide and Seek
The Enemy – We’ll Live and Die in These Towns
Kapitel 1
Ich lag schon vor dem Alarm wach. Wie jeden Morgen starrte ich die Decke an und maß im Kopf den Riss ab, der sich über meinem Bett auftat. Wieder ein Zentimeter mehr. Zu dieser Uhrzeit würde ich zur Arbeit aufbrechen, wenn ich Frühschicht hätte. Ich sehnte mich nach meiner eigenen Matratze, der kleinen Wohnung mit all meinen Habseligkeiten. Nach einem Fernseher, den allein ich kontrollieren konnte. Ich vermisste meinen Job. Vielmehr jeden Tag eine Aufgabe zu haben. Hier im Gefängnis war zwar auch alles durchgetaktet und wir mussten Tätigkeiten wie Saubermachen übernehmen, aber es war nicht dasselbe. Obwohl meine Aufseherin mittlerweile herausgefunden hatte, dass ich gelernte Krankenschwester war, und mich deshalb regelmäßig als Assistentin des Krankenhausarztes einsetzte, war das höchstens ein mickriger Schatten von dem, was ich eigentlich leisten konnte und wollte. Mir fehlten die Kolleginnen, meine Chefin und die Atmosphäre im Krankenhaus. Klar, die meisten verabscheuten es, denn es stand für Krankheit, Unfälle und Verlust. Doch für mich stellte dieser Arbeitsplatz unendliche Möglichkeiten dar, über mich hinauszuwachsen. Ich durfte Menschen helfen. Auch wenn die grauen Wände, der scheußliche, geschmacklose Gefängnisfraß und die Streitereien der Mitinsassinnen allmählich meinen Charakter auflösten wie eine Brausetablette in einer Pfütze Wasser … Der Wunsch, Gutes zu tun, blieb. Das Bedürfnis, mich um andere zu kümmern, war so tief in mir verwurzelt, dass selbst die amerikanische Justiz es nicht zu zerstören vermochte.
Das Kratzen in den Lautsprechern auf dem Flur ließ mich zusammenzucken. Obwohl es immer zur selben Zeit ertönte, stellten sich die Haare an meinen Armen auf. Ein klares Zeichen von absoluter Observation.
»Noch zehn Minuten bis zum Durchzählen. Seid deutlich auf euren Betten sichtbar. Wer um fünf Uhr nicht wie gewünscht auffindbar ist, erhält eine Verwarnung.« Die Stimme sprach so monoton wie jeden Morgen.
Ich zog die kratzige Decke höher an mein Kinn, denn ich fröstelte. Eine Verwarnung bedeutete, dass man keine Medienzeit und keinen Ausgang erhielt. Aber die Runde über den Innenhof und die Möglichkeit, eine E-Mail zu versenden, waren die einzigen Lichtblicke meiner Existenz. Vor allem waren sie aber notwendig, um Kontakt zur Außenwelt, insbesondere mit meiner Anwältin Victoria, zu halten und mit Hilfe der frischen Luft nicht vollends den Verstand zu verlieren.
»Jedes Mal dasselbe Gerede. Als wären wir Kinder«, beschwerte sich Caroline, meine Zellengenossin. Ich hörte, wie sie die Bettdecke wegtrat und aufstand. »Das dauert eh ewig, bis die bei uns sind. Ich geh pinkeln und danach Kaffee holen. Möchtest du einen? Vielleicht habe ich Glück bei der Schlange vor der Mikrowelle und kann ihn warm machen.« Sie sprach mit dem Rücken zu mir, weil sie sich einen Pullover überzog und die langen, schwarzen Haare zum Zopf band.
»Danke, das ist lieb von dir.«
»Gerne. Wer weiß, wann du mich das nächste Mal zusammenflicken musst.« Sie schenkte mir ein kurzes Lächeln, als sie sich umdrehte und in ihre Schlappen schlüpfte. An den Nachtwärter gewandt rief sie: »Hey, darf ich bitte raus? Ich möchte ins Bad.«
»Es ist gleich Zählzeit. Hast du doch gehört.«
Ich drehte mich auf die Seite, damit ich die beiden beobachten konnte.
»Ich beeile mich, versprochen. Außerdem ist es dringend.«
Er atmete hörbar ein und aus, klimperte jedoch mit seinen Schlüsseln. Kopfschüttelnd schloss er Caroline auf, die direkt auf den Gang huschte. Es war eine Geste der Nettigkeit, denn streng genommen stand uns eine Toilette und ein Waschbecken hier in der Zelle zur Verfügung. Wir hatten uns allerdings darauf geeinigt, dass wir diese intimen Momente nicht miteinander teilten, wenn es sich vermeiden ließ. Bevor der Wärter das Gitter wieder zugleiten ließ, nickte er in meine Richtung. »Was ist mir dir?«
»Passt schon.«
Er zuckte mit den Schultern, verriegelte die Tür und setzte sich zurück auf den Stuhl im Gang, um alles im Auge zu behalten. Es war nicht selten, dass es in den Zellen zu Schlägereien oder anderen Auseinandersetzungen kam. Die Gefängnisleitung nannte diese galant Zwischenfälle. Naiverweise war ich davon ausgegangen, dass es in einem Frauengefängnis gesitteter zuging als bei Vollzugsanstalten, in denen nur Männer saßen – aber weit gefehlt. Meine Mitgefangenen konnten ebenso brutal und eiskalt agieren, deshalb hielt ich mich meistens im Hintergrund auf. Bisher war ich kaum aufgefallen und wenn doch, eher positiv, weil ich ihnen bei Verletzungen, Periodenkrämpfen oder anderen Problemen half. Ich wurde toleriert und so sollte es bleiben. Der heutige Morgen war ruhig. Fast zu ruhig. Irgendetwas war immer los. Heute lag eine eiserne Ruhe über den Zellen, die ein weiteres Mal von einer Durchsage unterbrochen wurde.
»Das Durchzählen startet jetzt. Alle Gefangenen haben sich sichtbar auf ihren Betten aufzuhalten. Bei Nichtbeachtung droht eine Abmahnung.« Die Lautsprecher knarzten, als die Dame den Knopf betätigte und damit verstummte.
Ich drehte mich zur Wand. Auch hier waren Risse. Man könnte meinen, dass dieser ganze Bau in der nächsten Zeit zusammenbrach. Den Waschraum, den Caroline und ich uns mit rund vierzig anderen Frauen teilten, durchzogen sie ebenfalls. In der Küche, wo wir regelmäßig unsere Koch- und Säuberungsdienste ableisteten und in den Büroräumen der Gefängnisleitung bröckelte der Putz von den Wänden und dunkle Flecken bildeten sich in den Ecken. Aus medizinischer Sicht konnte ich das nicht gutheißen. Das Leben im Gefängnis als Gesamtkonzept nicht. Ich gehörte hier nicht hin. Mit keiner Faser meines Seins.
»Guten Morgen«, grüßte der Wachmann.
»Hey Ben«, erwiderte eine weibliche Stimme.
Ich schloss die Augen, denn ich wollte etwas Schlaf nachholen. Es fiel mir schwer in dieser ungewohnten Umgebung zur Ruhe zu finden. Immer wieder sah ich Belas Gesicht in meinen Träumen. Oder wenn ich wach war und in den Spiegel sah. Er schien immer hinter mir zu stehen. Mich zu beobachten. Das Einzige, was mich beruhigte, war, dass er ebenfalls im Gefängnis saß. Somit war dieser Bunker nicht nur eine Bürde, sondern eine Barriere zwischen seinen möglichen Komplizen und mir. Alice hatte zwar versichert, dass sie alles im Griff hatte und Bela in Schach gehalten wurde, aber die Angst ließ sich nicht eindämmen. Ich hatte ihn beinahe umgebracht und dafür würde er sich rächen. Immer wieder spielte sich die Szene vor meinem inneren Auge ab. Das Blut an meinen Händen. Nicht wie sonst, weil ich einem Menschen half, sondern weil ich das Gegenteil tat. Ich hatte ihm fast das Leben genommen. Jede Nacht träumte ich davon. Ich wachte schweißgebadet auf und bekam keine Luft mehr. Auch nach einem Monat noch. Deshalb schlief ich tagsüber ein. Das sahen manche Wärter nicht gerne und weckten einen dann mit einer besonders hellen Taschenlampe, einem Eimer Wasser oder dem Schlagen der Schlüssel gegen die Stäbe. Und das wiederum erzeugte Unruhe im ganzen Block. Krawall ergab Verletzte und für mich bedeutete das mehr Arbeit. Nein danke.
»Eine Person in der Zelle. Korrekt.«
Es raschelte. Ein Stift schrieb auf Papier.
»Hier sollen aber zwei Personen inhaftiert sein«, gab der Wachmann zu bedenken. »Gefangene Nummer 276 hat sich bei mir abgemeldet und kurz vor der Zählung die Zelle verlassen.«
»Und wer liegt dann da im Bett, wenn nicht Gefangene Nummer 276?«
Kurz herrschte Stille. Ich verzog die Brauen und drehte mich um.
»Das ist Gefangene Nummer 333.«
Wieder Stille. Ich biss mir auf die Lippe und richtete mich auf. Eine Frau im mittleren Alter stand neben dem Wachmann. Ihre blonden Haare waren zu einem kurzen, lässigen Bob frisiert und ihr gesamtes Erscheinungsbild fiel dadurch auf, dass sie keine Uniform, sondern normale Bürokleidung trug. Gemeinsam sahen sie und der Wärter auf das Klemmbrett. Sie flüsterten.
Caroline war selbst schuld, wenn sie jetzt Ärger bekam. Der Zähltrupp war früher bei uns angelangt als üblich. Vielleicht hatten sie die Richtung, in der sie vorgingen, geändert. Trotzdem hatten wir eine klare Anweisung erhalten. Normalerweise dauerte der Zählprozess eine halbe Stunde bis vierzig Minuten, in denen wir nicht von unseren Betten aufstehen durften. Caroline überging diese Vorgabe immer wieder. Irgendwann würden sie ihr noch ganz verbieten, einen Hofgang zu machen oder an den Computer zu gehen.
»Gefangene 333, vortreten!« Der Wachmann stand auf.
Ich rutschte mit gerunzelter Stirn an die Bettkante und stieg von dem Etagenbett herab. »Gibt es ein Problem? Ich habe hier die ganze Zeit gelegen. Mit Miss Browns Verfehlungen habe ich nichts zu tun.«
»Sie sind nicht Miss Brown?«
Mit verschränkten Armen trat ich an das Gitter. Die Fremde nahm dieselbe Position ein.
»Nein, mein Name ist Kenna O’Brian.«
»O’Brien? Wie kann das sein?« Sie blickte auf ihr Klemmbrett, dann zu ihrem Kollegen und zuletzt zu mir.
Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, deshalb zuckte ich mit den Schultern.
»Geht es da gleich weiter? Ich will aus der Zelle!«
»Ja, was dauert das so lange?«
Die Rufe ertönten aus den umliegenden Kammern. Ich trat von einem Bein auf das andere. Na super. Würde ich jetzt deshalb in der Gunst der anderen Häftlinge sinken, weil ich den Prozess aufhielt? Genau genommen tat das ja indirekt Caroline … oder?
»Miss O’Brian, ich bitte um Entschuldigung. Wir sind heute etwas unterbesetzt …« Sie verstummte, schüttelte den Kopf und blätterte. Ihr Kollege ging zu den anderen Zellen und sprach mit den aufgeregten Frauen, die darauf warteten, endlich in den Tag starten zu können.
»Was ist denn los?« Meine Stimme war belegt von der schlaflosen Nacht. Ich hielt mir die Hand vor den Mund und räusperte mich.
»Sie wurden entlassen. Werden entlassen … Ich habe Sie von meiner Liste gestrichen, weil für Sie eine Kaution hinterlegt wurde. Laut meinen Unterlagen befinden Sie sich gar nicht mehr hier.«
Ich starrte sie nur an. Die Worte sickerten nur langsam in meinen Verstand. Ich öffnete den Mund, schloss ihn aber sofort wieder.
»Ich kläre das. Geben Sie mir einen Moment.« Sie wandte sich von mir ab und nahm das Walkie-Talkie, das an ihrem Gürtel befestigt war.
Ich nickte nur.
»Sorry! Sorry! Ich bin da! Hallo!« Caroline tauchte vor unserer Zelle auf, in beiden Händen einen Pappbecher mit dampfender Flüssigkeit.
»Und wer sind Sie jetzt?« Die Frau bedeutete Caroline anzuhalten. Die deutete nur mit dem Kinn zu ihrer Brust, auf der das Patch mit der Gefangenennummer aufgenäht war. Dieses elendige Orange machte mich krank.
»Gefangene 276. So so. Sie werden verwarnt und erhalten eine Disziplinarstrafe. Ich brauche hier Hilfe!« Ihr Walkie-Talkie rauschte.
Mir war das alles zu viel. Ich kam mir vor wie in einem Film. Oder einer Fernsehshow. Wo war die Kamera? Meine Kaution wurde bezahlt? Aber von wem denn? Alice hatte sich mehrmals dafür entschuldigt, dass sie die Summe momentan nicht aufbringen konnte. Das war bitter gewesen, aber verständlich. 25.000 Dollar. Niemand von uns war reich. Keiner in Truckee hatte so viel Geld einfach auf dem Bankkonto liegen. Vielleicht der Krankenhausleiter, einer der Chefärzte oder der Autohändler an der Pioneer Street, aber meine Freunde sicherlich nicht.
»Kenna, was geht hier vor sich?« Caroline sah mich mit gerunzelter Stirn an. Die Pappbecher hatte sie vor sich auf den Boden gestellt und rieb sich die Hände.
»Ich habe absolut keine Ahnung«, murmelte ich und setzte mich auf den Stuhl. Er und der Schreibtisch waren, abgesehen von unserem Etagenbett, die einzigen Möbel in unserer Zelle. Ich legte meine Arme auf den Tisch und bettete meinen Kopf auf ihnen. Es war zu früh für so ein Chaos.
Der Wachmann kam zurück und schloss Caroline auf. Sie nahm die Kaffeebecher wieder an sich und stellte mir einen vor die Nase.
»Danke.«
»Keine Ursache. Warum sind die heute so früh da?«
Ich zuckte mit den Schultern. Vorsichtig griff ich nach dem Becher, um meine Hände an ihm zu wärmen. Meine Mitbewohnerin hatte es wirklich hinbekommen die kalte Plörre in der Mikrowelle aufzuheizen. Das war verboten luxuriös für unsere Umstände. Ich sog den Duft des Instantkaffees in die Nase und stellte mir vor, beim Coffee Bike vor dem Krankenhaus einen Latte Macchiato zu bestellen. Würde ich bald schon in den Genuss kommen? Ich stand auf. Genug mit der Verzweiflung. Das konnte meine Chance sein.
»Hören Sie, ich verlange –«, setzte ich an, doch die Geste der Beamtin brachte mich zum Schweigen. Sie steckte das Funkgerät wieder an ihren Gürtel und trat an die Gitterstäbe.
»Miss O’Brian, Sie packen jetzt ihre Sachen. Ich nehme Sie direkt mit zu der Gefängnisleitung.«
Caroline sog scharf die Luft ein. Ich drehte mich im selben Moment um, nahm meinen Waschbeutel, klemmte mir die wenige Kleidung unter den Arm und nickte Caroline zu. »Ich bin bereit.« Und nie hatte ich etwas mehr in meinem Leben gefühlt.
»Viel Glück, Kleine.« Caroline klopfte mir auf die Schulter.
»Danke, das kann ich brauchen.« In dem Moment wurde mir klar, dass ich mit dem Gefängnis auch meine höchstpersönliche Käseglocke verließ. Wieder ein Hindernis weniger zwischen Bela und mir.
Es war surreal der Beamtin und dem Wachmann durch die Gänge zu folgen. Die anderen Gefangenen riefen mir zu. Einige applaudierten sogar. Wo vorher Ruhe geherrscht hatte, brach durch die unvorhergesehene Unterbrechung der Zählung das Chaos aus. All das prallte jedoch an mir ab. Mir war nicht nach Freude zumute. Ich wollte hier raus, das stand außer Frage, aber ich machte mir auch Sorgen. Was hatte das für meinen Alltag und meine Zukunft zu bedeuten? Wie sollte ich dem unbekannten Gönner das Geld jemals zurückzahlen?
»Gehen Sie rein«, forderte mich die Beamtin auf, als wir vor dem Büro der Gefängnisleitung ankamen. »Ich werde in der Zwischenzeit Ihre persönlichen Dinge, die Ihnen bei der Verhaftung abgenommen wurden, aus dem Archiv holen.«
Der Wachmann nickte bei ihren Worten zur Tür.
Als ich diese öffnete, traute ich meinen Augen nicht. Dort am Schreibtisch saß nicht nur die Leiterin des Gefängnisses, auch Victoria lehnte am Tisch.
»Kenna, Liebes!«
»Victoria!« Mein erster Reflex war in ihre Arme zu laufen und sie nicht mehr loszulassen. Als wäre sie der letzte Rest, der mir von meiner Freiheit geblieben war. Doch wir standen unter Beobachtung und ich hatte ernsthaft Angst, dass das als tätlicher Angriff gewertet werden würde und ich einen der Elektroschocker zu spüren bekam. Darauf verzichtete ich gerne. Ich beließ es bei einem simplen: »Schön dich zu sehen.«
Doch Victoria gab nicht viel auf Konventionen. Sie stieß sich von dem massiven Holztisch ab, nickte dem Wachmann, der in meinem Rücken stand, zu und schloss mich in eine kurze Umarmung. Sie war das erste Gute, das ich seit Wochen roch. Ihr Parfüm umgab mich wie ein feiner Nebel aus Lavendel und Moschus. Selbst die Seife hier in diesem Bunker roch muffig. Meine Anwältin duftete nach Freiheit.
»Wir haben großartige Neuigkeiten«, verkündete sie und deutete auf den zweiten Stuhl gegenüber von Mrs Smith, die uns mit wachen Augen beobachtete.
»Eins nach dem anderen«, meinte die Leiterin.
Der Wachmann schloss hinter uns die Tür. Ich setzte mich neben Victoria. Meine Augen klebten förmlich an ihr. Sie war das Stück Heimat, das mir gefehlt hatte, um endlich wieder etwas zu fühlen. Dabei ging es nicht unbedingt im Speziellen um die Juristin, sondern vielmehr um das Vertraute, das sie verströmte.
»Sie werden heute entlassen, da die Kaution bezahlt wurde. Es gibt aber Auflagen, die sie einhalten müssen. Sie dürfen den Bundesstaat Kalifornien nicht verlassen. Beim Überqueren der Grenzen von Nevada County haben sie sich bei ihrer Anwältin zu melden.«
Ich nickte. Victoria zwinkerte mir zu. Sie hatte alles im Griff. Allmählich nahm die Anspannung ab.
»Zudem müssen Sie Ihren Job weiterhin ausüben. Sobald Sie arbeitslos werden, wird das als Verstoß gewertet. Das hat die Richterin mehr als deutlich gemacht. Sie wertet Ihren Job als Krankenschwester wie eine Wiedergutmachung am Volke. Sie müssen also einem Job im medizinischen Bereich nachgehen. Haben Sie das verstanden?« Die Leiterin sah mich an.
»Ja, das habe ich.« Meine Stimme wackelte. Neben Victoria zu sitzen und diese Worte zu hören, machte es endlich real. Ich würde gleich dieses immergraue Gebäude verlassen. Kein Haferbrei mehr. Keine Schikanen. Kein nächtliches Rumgeschrei.
»Ich werde das beaufsichtigen und darüber Protokoll führen. Wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit zu mir kommen. Außerdem werden wir deine Gerichtsverhandlung vorbereiten. Wir haben zwar noch keinen Termin, aber ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass es nicht mehr lange dauert. Dann können wir unter diese unerfreuliche Sache einen Schlussstrich ziehen.« In ihren Augen lag nichts als Zuversicht. Sie glaubte daran. Es gab mir so viel Hoffnung, dass ich nach Wochen ein Lächeln zustande brachte.
»Danke.« Zu mehr war ich nicht fähig. Ich hielt mich weiterhin an Victoria, auch als wir alle aufstanden.
»Auf Ihrem weiteren Weg alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder.«
»Vielen Dank. Das hoffe ich ebenfalls.« Ich nickte ihr nur zu. Zu allen wahrte ich gebührend Abstand, um meine Entlassung nicht auf den letzten Metern zu versauen.
Ich folgte Victoria und dem Wachmann in den Bereich, den ich bisher nur bei meiner Verlegung in dieses Gefängnis betreten hatte. Überall waren Sicherheitsschleusen besetzt durch bewaffnete Beamte. Ich sah immer zu Boden, wenn wir eine der fremden Personen passierten. Der Kontakt zu anderen Menschen war mir stets leichtgefallen, doch nun fühlte ich mich verändert. Tief in mir blieb die Schuld, auch wenn ich das Gefängnis hinter mir ließ.
Die fremde Beamtin tauchte in einem Durchgang auf und hielt einen Plastikbeutel hoch. »Ihre persönlichen Habseligkeiten, Miss O’Brian.« Sie übergab ihn nicht direkt an mich, sondern an den Mann hinter dem Tresen, der mich mit seinem Blick aufzuspießen schien. Um seiner Arbeit nachzugehen, brach er den Blickkontakt ab und leerte den Inhalt auf der glänzenden Oberfläche vor ihm. Ein blutverschmiertes Shirt, meine Armbanduhr, die ich von meinem Vater geschenkt bekommen hatte, mein Smartphone und die Geldbörse mit fünfzig Dollar Bargeld und allen Karten.
»Das hier ist das Aufnahmeprotokoll. Prüfen Sie Ihre Wertsachen bitte auf Vollständigkeit und unterschreiben Sie dann …« Er brach ab, denn ich war schon dabei den Kugelschreiber zu nehmen. Mit einer Hand reichte ich Victoria die Gegenstände, während ich mit der anderen das Schriftstück unterschrieb.
»So geht es auch«, witzelte sie, doch alle starrten uns an. Die Beamtin schüttelte den Kopf und ging.
»Können wir dann gehen?« Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, dass es kaum erwarten konnte, am Wochenende in den Freizeitpark zu fahren.
»Sie dürfen offiziell das Gebäude verlassen«, verkündete der Mann hinter der Plexiglasscheibe.
»Danke«, nuschelte ich. Das dreckige Shirt lag noch immer auf der Oberfläche. Meine Augen hingen förmlich daran fest. War es mein Blut oder seins? Ich hielt den Anblick nicht aus, aber es war wie bei einem Autounfall. Ich konnte nicht wegsehen. »K-Können Sie das entsorgen?«
»Ich nehme es«, ging Victoria dazwischen. Sie schnappte sich den Stoff und stopfte ihn in die teure Designerhandtasche. »Auf Wiedersehen!« Sanft schob sie mich Richtung Ausgang.
Jetzt, so kurz vor der Freiheit, sank mir das Herz in die Hose. »Soll ich mich erst umziehen? Ich habe noch die Gefängniskleidung an.« Ich deutete auf den Overall.
»Klar, dort ist eine Toilette.« Ich verzog das Gesicht, denn ich wollte nicht in die alte Kleidung schlüpfen. Sie würde mich wieder in die Situation zurückkatapultieren, die ich so sehr verdrängen wollte.
»Schau mal.« Victoria hatte mir meine Sorge vom Gesicht abgelesen. Aus ihrem übergroßen Shopper nahm sie einen gefüllten Baumwollbeutel und hielt ihn mir vor die Nase. Ich zupfte an dem Stoff, um hineinzuspähen. Eine saubere Jeans, ein Shirt und ein Kapuzenpullover. Kein Blut, nur der wohlige, mir kaum noch bekannte Geruch von Weichspüler.
Ich zog mich im Schneckentempo um. Dabei betrachtete ich mich mit zusammengezogenen Augenbrauen immer wieder im Spiegel. Alles an mir wirkte verändert. Mich zerrissen die verschiedenen Emotionen beinahe. Einerseits konnte ich es nicht erwarten, nach Hause zurückzukehren, und andererseits hatte ich Angst. Vor dem Alleinsein. Vor Bela und seinen Machenschaften. Vor meinem Alltag, an den ich mich nach all den Ereignissen kaum erinnern konnte, denn er wirkte wie aus einem anderen Leben.
»Kenna? Bist du so weit?« Victorias besorgte Stimme drang durch die geschlossene Tür.
Anstatt ihr zu antworten, legte ich endlich meine Hand auf die metallene Klinke und öffnete sie.
»Alles in Ordnung?« Ihre Stirn war gerunzelt und der Mund zu einem unsicheren Lächeln verzogen.
Ich nickte und folgte ihr endgültig aus dem Gebäude. Da ich nicht in der Lage war mein Innenleben in Worte zu fassen, stürmte ich nach draußen. Die Sonne schien. Strahlen trafen auf mein Gesicht. Ich blieb direkt vor dem Ausgang stehen und schloss die Augen. Frische Luft umspielte mich. Sie zog an der Kleidung, die Victoria mir von zu Hause mitgebracht hatte. Ich sog den Sauerstoff tief in meine Lungen und es war, als könnte ich nach einer Ewigkeit frei atmen. Und gleichzeitig begann jetzt die Paranoia einzusetzen. Ich riss die Augen auf und sah mich um. Doch da waren keine maskierten Männer, Angreifer oder Bela selbst. Ein paar Meter vor mir an einem Jeep lehnend stand eine Frau mit knallroten Haaren und einem frechen Grinsen auf den Lippen.
»Alice!« Dieses Mal lief ich los. Ich rannte auf sie zu und schmiss mich wie in einer kitschigen Komödie in ihre Arme.
»Mein Joker«, flüsterte sie in mein Ohr. Ihre Wange lag an meiner. Ich war einen Kopf größer, deshalb legte ich mein Kinn auf ihre Schulter. Alles, was sich in mir angestaut hatte, trat an die Oberfläche. In meinem Hals spürte ich die Tränen aufsteigen. Sie bahnten sich unbarmherzig einen Weg nach oben, bis sie mir stumm über das Gesicht liefen. Alice und ich sagten nichts. Es war nicht nötig. Das Einzige, was zählte, war, dass ich nicht mehr allein war. Ich lebte. Sie lebte. Wir hatten uns.
Kapitel 2
Die Landschaft zog rasant an mir vorbei. Ich hatte Mühe, alle Details aufzunehmen. Die Weite der Umgebung nahm mich gefangen. Ich betrachtete die vielen bodendeckenden Büsche, die ausgemergelten Grasflecken auf grau-braunem Sandboden und das Geröll, das Formen erahnen ließ. Ich hatte das alles schon zur Genüge gesehen, immerhin war ich hier aufgewachsen. Doch nach vier Wochen nur Betonstahl war ich über jeden Vogel am Himmel und jedes Sandkorn zwischen meinen Zähnen dankbar. Ich ließ die Fensterscheibe herunter und genoss, wie der Wind mit meinen strähnigen Haaren spielte. Die Vegetation änderte sich allmählich. Je näher wir Truckee kamen, desto bergiger und grüner wurde es. Wo vorher keine Bäume gewesen waren, reihten sich am Straßenrand Nadelgehölz und Buschwerk.
»Wie hast du das mit dem Geld geschafft?« Ich riss mich von der Landschaft los und blickte nach links. Alice hatte sich neben mich gesetzt, anstatt auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Wir waren uns nah. Ich hatte keine Ahnung, woher sie wusste, dass das genau das war, was ich brauchte, aber sie machte alles richtig. Sie ließ mich nicht allein. Sie gab mir Halt – wie früher, als wir beste Freundinnen gewesen waren. Zuletzt hatten erst Funkstille und dann verschiedene Unstimmigkeiten zwischen uns geherrscht, doch der heutige Tag gab mir Hoffnung, dass wir an das anknüpfen konnten, was mal gewesen war. Ich hatte ihr den Weggang verziehen. Schon lange, denn ich verstand, wieso sie es getan hatte. Alice war jetzt zurück. Und das stärker als je zuvor. Zumindest machte sie diesen Eindruck auf mich, als sie zu mir sah und ein breites Lächeln sich über ihr schönes Gesicht erstreckte.
»Das möchtest du nicht wissen«, meinte sie nur und nahm meine Hand. Kurz drückte sie sie. Ich drückte zurück.
»Nein, im Ernst. Ihr habt gesagt, dass ihr das Geld nicht beschaffen könnt. Das war vollkommen okay für mich. Ich habe das hier nicht von euch erwartet. Versteh mich nicht falsch, ich bin dankbar, aber … wenn es dich oder Blake oder Jared oder sonst jemanden in Gefahr gebracht hat, dann –«
»Es ist okay. Vertrau mir. Ich habe einen Deal gemacht und dafür Geld erhalten, das ich clever genutzt habe. Du bist meine Investition.« Sie grinste und sah dann zu Victoria, die uns durch den Rückspiegel beobachtete.
Mir verging das Lachen. Natürlich hatte die Sache einen Haken, was auch sonst. Ich würde den Verdugos erneut helfen, das stand außer Frage, aber ihre Worte erhöhten den Druck, der auf meiner Brust lag.
»Das war ein Scherz, Kenna. Du bist zu nichts verpflichtet. Wir sind dir nur unfassbar dankbar, dass du uns den Rücken gestärkt hast. Du hast uns den Arsch gerettet, wenn ich ehrlich bin. Blake und ich … wir werden dir das niemals vergessen und –«
»Ich habe nur das gemacht, was nötig war«, schnitt ich sie ab. Es kam mir nicht richtig vor, für eine Straftat derartiges Lob zu erhalten. Notwehr hin oder her, ich hatte ihn niedergestreckt.
»Nein, du hast dich geopfert. Das wäre nicht nötig gewesen und du hast es trotzdem getan.« Alice legte meine Hand auf ihre Brust. »Von Herzen danke. Und deshalb ist es vollkommen egal, was ich tun musste, um die Kohle zu besorgen. Und ich versichere dir, den Kideaks hat es Spaß gemacht.« Sie grinste wieder nach vorne. »Vic, du hast nichts gehört.«
»Natürlich nicht«, stimmte unsere Fahrerin zu.
Mein Herz schlug schneller und Hitze stieg in meine Wangen. Widersprüchliche Gefühle tobten in mir. Ich war gerührt von ihrer gnadenlosen Ehrlichkeit und gleichzeitig wollte ich jede Dankbarkeit und Zuneigung ablehnen, weil ich es nicht verdient hatte.
»Wie geht es Blake?« Ich räusperte mich.
Alice legte meine Hand sanft auf ihr Knie. »Ihm geht es super. Wir sind … es ist wunderschön.« Sie sah aus dem Fenster, aber der kurze Anblick ihrer Miene, den ich erhaschte, sprach für sich. Der Sturm legte sich in mir. Genau deshalb hatte ich das getan. Aus diesem Grund hatte ich Bela niedergeschlagen und die Konsequenzen in Kauf genommen. Er hätte Blake und Alice erschossen, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Und sie mussten leben. In Freiheit und miteinander. Blake und Alice gehörten zusammen. Das hatten sie schon immer. Und Bela hätte sie nur ein weiteres Mal auseinandergerissen. Ich hatte es unter keinen Umständen zulassen können, dass sie oder er ins Gefängnis gekommen wären. Und mehr Optionen hatte es nicht gegeben. Eine Stimme ganz hinten in meinem Kopf sagte, dass ich auch nichts anderes verdient hatte. Ein Teil von mir wollte, dass ich im Gefängnis versauerte.
»Mein Bein ist vollständig genesen. Ich kann endlich wieder mein Bike fahren.« Sie stieß mich an, doch ich war nicht im Stande meinen Gesichtsausdruck zu ändern.
»Wie geht es deinen Eltern? Wo sind sie?« Ich sah von ihr zu Victoria.
Alice folgte meinem Blick. »Ist okay, sie weiß Bescheid. Aus Sicherheitsgründen kann ich dir nichts verraten, nur so viel, dass es ihnen gut geht. Sie sind mit deinem Kontakt untergekommen und feilen im Moment an einer finalen Strategie. Dad wird behandelt. Mom vermisst uns, aber sie ist tapfer. Ich will seinen Namen reinwaschen, damit er zurückkehren kann.« Ihre Stimme verlor an Klang. Mit einem Mal wirkte sie ernsthafter.
»Dann besteht der Haftbefehl noch immer?«
Alice nickte. »Es ist komplizierter als gedacht.«
Ich seufzte. Nicht ein Tag war vergangen, an dem ich mir keine Gedanken um Lulu und Bix gemacht hatte. Besonders während seiner Krebsdiagnose hatte ich ihn begleitet und jeden Tag mit ihm gesprochen. Er war ein Freund von meinem Dad gewesen. Irgendwie hatte er mir als Ersatz gedient. Bix hatte seine Tochter gefehlt und ich hatte meinen Vater vermisst. Wir hatten uns ergänzt.
»Wenn ich helfen kann, dann gib mir Bescheid.« Eine konkrete Vorstellung hatte ich zwar nicht, aber ich war allseits bereit.
»Natürlich, mein Joker.«
»Nenn mich nicht so«, verlangte ich.
»O doch. Du warst schon zu oft mein Plan Z.«
Ich wechselte schnell das Thema. »Wie geht es Jared?« Ich versuchte, locker zu klingen, doch Spannung lag in meiner Stimme. Ich räusperte mich ein weiteres Mal, aber es lag nicht an einer trockenen Kehle. Betont interessiert sah ich aus dem Fenster und registrierte, dass wir das Ortsschild passiert hatten. Truckee mit den vielen, verwinkelten Straßen, alten Geschäften und hölzernen Fassaden erstreckte sich vor uns. Ein Kloß bildete sich in meinem Hals.
»Ihm geht es … Also es ist etwas schwieriger als angenommen.«
Ich wirbelte herum. »Alice, spuck es aus! Ist er noch im Krankenhaus? Was ist los?«
Sie hob beschwichtigend die Hände. »Er ist wieder zu Hause. Schon seit ein paar Tagen. Aber er ist nicht mehr der Alte. Es hat sich etwas verändert. Die Ärzte sagen, dass das nach einem so heftigen Trauma vorkommen kann. Es dauert.« Ihre Stirn lag in Falten und die Mundwinkel zeigten nach unten. Meine Freundin machte sich ernsthaft Sorgen.
»Seine Schulter ist noch immer nicht einsatzfähig. Es ist fraglich, wann sie das wieder sein wird …«
Oder ob, beendete ich ihren Satz in meinem Kopf. »Aber es war eine normale Pistole, mit der auf ihn geschossen wurde, oder? Aus welcher Entfernung? Ich meine Kaliber, Geschwindigkeit und Masse bestimmen die Schwere einer Schusswunde.« Ich redete mich in Rage. Alice sah mich an, als wäre mir ein zweiter Kopf gewachsen.
»Leider verstehe ich nicht viel davon. Ich weiß nur, dass es eine Schussfraktur war, die sehr kompliziert gewesen ist. Sie haben ihn mit Metallplatten, Schrauben und Drähten wieder zusammengeflickt. Das bedeutet aber auch, dass seine Bewegungsfähigkeit massiv eingeschränkt ist. Wir wissen nicht genau, ob …« Alice strich sich eine Strähne aus dem Gesicht. Ich schloss die Augen. Das war eine totale Katastrophe. Jared musste am Boden zerstört sein.
»Er hat Schmerzen, Kenna. Und er nimmt keine Mittel dagegen.«
»Wegen seiner Mom.«
»Ja.«
Wir sahen uns an. Es brauchte keine weiteren Worte. Wir kannten den Sachverhalt. Seine Kindheit mit einer drogensüchtigen Mutter hatte ihn geprägt. So stark, dass er nie Medikamente zu sich nahm und alle möglichen Substanzen kategorisch ablehnte. Was früher nur eine Eigenart von unserem gemeinsamen Freund gewesen war, stellte nun ein ernstzunehmendes Problem dar.
»Das ist nicht gut«, urteilte ich.
»Ich weiß. Unzählige Male habe ich das schon mit ihm diskutiert. Blake ebenfalls. Die Ärzte. Nael. Alle. Sogar mein Vater hat mit ihm am Telefon gesprochen. Da ist nichts zu machen. Jared macht komplett dicht. Vielleicht könntest du …« Sie kniff die Augen zusammen und biss sich auf die volle Unterlippe.
»Ich kann es versuchen. Klar. Ob er sich von mir etwas sagen lässt, bezweifle ich aber.« Ich wich ihrem Blick aus, weil ich keine Lust auf eine Diskussion hatte.
»Aber ihr –«, setzte Alice an, doch ich kam ihr zuvor.
»Ich versuche es, okay?« Meine Antwort kam schroffer raus, als ich beabsichtigt hatte. Alice nickte nur.
Wir fuhren durch die historische Altstadt und bogen auf die Old Brockway Road ab. Ich betrachtete die Nachbarschaft, die ich wie meine eigene Westentasche kannte. Ich war zwar auf der anderen Seite der Stadt aufgewachsen, trotzdem kannte ich jeden Winkel von Truckee. Um schnell auf der Arbeit zu sein, war ich nach dem Tod meines Dads auf die Rue Hilltop gezogen. Als ich das Dunkelbraun der Holzlatten meines winzigen Häuschens am Ende der Straße erblickte, schluckte ich schwer. Endlich zu Hause. Endlich wieder Normalität.
Victoria hielt auf der schmalen Einfahrt, die, außer wenn ich Besuch hatte, stets leer war, denn ich besaß kein Auto. Die Strecken innerhalb der Stadt waren überschaubar und zu Fuß zu erledigen. Wenn ich außerhalb Besorgungen machen musste, lieh mir meine Chefin oft ihren Wagen. Dafür passte ich im Gegenzug auf ihre beiden Töchter auf, damit sie zumindest einmal im Monat mit ihrem Mann Zeit zu zweit hatte.
Sobald das Auto stand, schnallte ich mich ab.
»Ich muss mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist, deshalb komme ich mit«, verkündete Victoria. Ich zuckte mit den Schultern.
»Kommst du klar?«, wollte Alice wissen.
»Natürlich, es ist alles wunderbar.« Bis zu ihrer Nachfrage war es das auch gewesen. Die Aufregung, endlich wieder in meinen eigenen vier Wänden zu sein, mich auf meine Couch zu legen, eine frische Mahlzeit nur für mich zuzubereiten und meine Haare mit dem teuren Shampoo zu waschen, das ich mir vor meiner Verhaftung gegönnt hatte, hatte kurzzeitig alle Zweifel und Sorgen überschattet. Nun waren da wieder Fragen in meinem Kopf. Die Angst saß mir förmlich im Nacken. Ich überspielte es mit einem Lächeln, so gut ich konnte.
»Wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir. Und besuche mich in den nächsten Tagen mal auf dem Hof, ja? Ich habe eine Sache mit dir zu besprechen.« Sie runzelte die Stirn.
»Kein Problem. Sei mir bitte nicht böse, aber ich brauche erst mal eine Dusche und etwas Ruhe. Du kannst dir nicht vorstellen, wie laut es dort rund um die Uhr war.«
Alice schloss mich in eine kurze Umarmung und gab mich dann frei. Das war mein Startschuss. Während ich aus dem Auto stieg, kramte ich meinen Wohnungsschlüssel aus dem Plastikbeutel mit meinen Habseligkeiten hervor. Ich ging an Victoria und den vertrockneten Büschen, die vermutlich durch meine Abwesenheit eingegangen waren, vorbei und blieb vor der weißen Tür stehen. Der Briefkasten war unfassbar voll. Ich zog die Umschläge, die oben hervorquollen, heraus und klemmte sie mir unter den Arm. Eines nach dem anderen. Ich wählte den richtigen Schlüssel vom Bund, trat näher an die Tür, legte die Hand an den Griff und …
Nichts. Es geschah nichts. Ich versuchte, den Schlüssel in das Schloss zu stecken, aber er blockierte im gleichen Moment. Ich gab einen Laut der Verwunderung von mir.
»Kenna?« Victoria stand direkt neben mir.
»Entschuldige bitte. Ich bin so verwirrt nach allem, dass ich wohl die Schlüssel vertauscht habe.« Noch während die Worte über meine Lippen kamen, war ich mir zu hundert Prozent sicher, dass das nicht der Fall war. Ich hatte den korrekten benutzt. Der eine war für den Hintereingang des Krankenhauses, der andere für meinen Spint in der Schwesternumkleide und der dritte ein emotionales Andenken an mein Elternhaus. Es war Nummer vier. Er musste passen. Ich ging trotzdem jeden Schlüssel durch … und es passierte nichts.
»Okay, das ist merkwürdig«, ließ ich Victoria wissen. Alice hatte sich mit erhobenen Brauen zu uns gesellt. Hilflos sah ich von einer zur anderen.
»Hast du alle ausprobiert?«
Ich nickte und schloss die Augen.
»Ist das auch wirklich dein Schlüsselbund? Nicht, dass die vom Gefängnis dir –«
»Es ist meiner, Alice!« Ich fasste mir an die Stirn. Es war nicht meine Art so aus der Haut zu fahren. Sie wich zurück und sah an mir vorbei.
»Ruf deinen Vermieter an. Das Problem kann sicherlich gelöst werden.« Victoria tätschelte mir die Schulter, dann steuerte sie den Wagen an. Auf den Gedanken mein Smartphone zu benutzen war ich gar nicht gekommen. Ich hatte es seit dem Verlassen des Gefängnisses überhaupt nicht beachtet, weil ich es nicht mehr gewohnt war unerschöpflichen Zugriff auf das Internet oder andere Kommunikationsmöglichkeiten zu haben.
»Gute Idee«, nuschelte ich. Mit klopfendem Herzen fischte ich das Smartphone aus meiner Hosentasche und wählte die Nummer von Mr Fitz. Es klingelte nur zwei Mal, dann wurde direkt abgehoben.
»Ja?«
»Mr Fitz? Hier ist Kenna. Kenna O’Brian. Rue Hilltop vier. Sie wissen schon …« Ich wich den Blicken von Alice aus.
»Miss O’Brian, ja«, bestätigte er mir schroff. Mein erster Instinkt war mich für die Störung zu entschuldigen, andererseits hatte ich nichts falsch gemacht. Ich verstand die Welt nicht mehr. Wieder nahm ich meinen Schlüsselbund. Mit schwitzigen Fingern versuchte ich ein letztes Mal die Tür aufzusperren.
»Ich komme nicht in die Wohnung. Mein Schlüssel … er passt nicht mehr. Keine Ahnung, es ist komisch und –«
»Natürlich passt ihr Schlüssel nicht mehr. Ich habe das Schloss austauschen lassen«, klärte er mich auf. Im Hintergrund rief ein kleines Kind. Töpfe klapperten und eine Tür wurde in die Angeln geknallt.
»Oh«, machte ich. Meine Gedanken rasten. »Wurde eingebrochen? Sie … Sie hätten mir Bescheid geben müssen.«
»Wie denn? Sie waren ja verhindert.« Das letzte Wort betonte er auf eine merkwürdige, aber eindeutige Art.
Ich überging den Seitenhieb. »Wurde etwas gestohlen?«
»Es gab keinen Einbruch, Miss O’Brian.«
»Aber … Das verstehe ich nicht. War das Schloss kaputt? Wann kann ich den neuen Schlüssel abholen?«
»Sie holen hier gar nichts mehr ab. Als Sie ins Gefängnis gewandert sind, habe ich Ihnen selbstverständlich die Wohnung gekündigt.«
Meine Atmung ging flach. Was mein Vermieter da sagte, ergab keinen Sinn.
»Ihre Möbel und der ganze Krempel wurden von einer Firma ausgeräumt und in einem Lagerraum verstaut. Die Kündigung mit Rechnung darüber und Adresse des Lagers liegt im Briefkasten. Wenn Sie den geleert haben, lassen Sie den Schlüssel unter dem Blumentopf direkt darunter liegen. Schönen Tag noch!«
»Mr Fitz!« Ich presste seinen Namen zwischen meinen zusammengebissenen Zähnen hervor. Der Laut erzeugte Aufmerksamkeit. Alice war wieder an meiner Seite und Victoria stieg aus dem Wagen.
»Lassen Sie mich und meine Familie in Zukunft in Ruhe. Wir wollen mit Straftätern nichts zu schaffen haben!« Damit legte er auf.
Ich sah mein Smartphone an. Es war unbegreiflich, was gerade geschehen war. Wie konnte er mir das antun? Warum behandelte er mich so? Und wieso bekam ich nicht mal die Chance mich zu erklären?
»Kenna?« Alice berührte sanft meinen Arm.
Ihre Augen suchten nach Antworten, zu denen ich nicht bereit war. Ich nahm den Schlüssel meines Briefkastens, öffnete ihn, riss die ineinander verkeilten Briefe heraus und ließ den Kasten offen stehen. Dann bog ich den Ring auseinander, entfernte den Wohnungsschlüssel und warf beide achtlos auf den Boden.
»Bringt mich hier weg«, bat ich Alice. Sie nickte sofort. Mit einer Hand zog sie mich vom Eingang weg. Sie öffnete mir die Tür und ich stieg zurück in den Wagen. In meiner Kehle bildete sich ein Kloß von der Größe eines Geröllbrockens, wie sie sich vor der Stadt türmten. Ich wusste nicht, weshalb ich noch nicht erstickt war, aber ich atmete. Auch wenn der Druck mich zu zerquetschen drohte.
»Victoria, fahr uns bitte zum Hof«, wies Alice die Anwältin an. Sie stieg neben mir ein.
»Was ist los?« Victoria drehte sich zu mir.
»Ich bin … obdachlos.« Bei dem Wort brach meine Stimme. Da war Wut in mir, keine Frage, aber die Erschütterung siegte. Victorias Augenbrauen schoben sich zu ihrem Haaransatz.
»Das kriegen wir hin. Keine Panik. Du kannst in der Casa schlafen. Oder bei mir und Blake im Haus meiner Eltern. Wir haben genug Platz. Es ist keine Vollkatastrophe, Kenna. Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß. Da ist immer ein Zwischenweg.« Sie tätschelte meine Schulter und wandte sich dann an Victoria: »Das geht doch, oder? Ist die Wohnungskündigung ein Problem?«
»Sie ist vor allem nicht rechtens. Man kann einen Mietvertrag nicht einfach so kündigen. Oder die Wohnung räumen lassen. Das geht nur unter bestimmten Umständen und nach einer Räumungsklage vor Gericht …« Victoria brach ab und strich sich eine verirrte Strähne aus dem Gesicht. Kurz schnaubte sie. Bereits jetzt hatte sie zu viel Arbeit mit mir. »Dieser Zwischenfall ist nicht günstig. Kenna muss bis zur Verhandlung auf einer Adresse gemeldet bleiben. Sie darf den Wohnort nicht wechseln und muss sich jeden Abend dort aufhalten.« Victoria strich sich eine Strähne aus dem feinen Gesicht. »Die Adresse, die ich am Tagesende an das Büro der Richterin übermittle, ist final. Versteht ihr das?«
Alice nickte, doch ich war bewegungslos. Noch immer rang ich um jeden Atemzug. War das eine Panikattacke, wie sie meine Patienten immer beschrieben? Oder zumindest eine Vorstufe davon? Niemals hätte ich vor zwei Monaten gedacht, dass ich selbst zur Patientin werden könnte.
»Vielleicht kann ich im Krankenhaus unterkommen. Bringt mich erst dorthin. Meine Chefin kann mir helfen.«
Alice verzog das Gesicht. Es passte ihr nicht, dass ich ihre Hilfe ablehnte. Dabei wollte ich sie einfach nur nicht belasten. Sie hatte das Geld gezahlt, mir eine Anwältin besorgt, für die ich bisher keinen Cent ausgegeben hatte, und mich abgeholt. Unter keinen Umständen wollte ich ihre Freundschaft ausnutzen oder die Nerven der Verdugos überstrapazieren.
»Ich muss eh mit der Krankenhausleitung sprechen und mich versichern, dass du einen festen Arbeitsplatz für die nächsten Monate hast«, stimmte Victoria meinem Plan zu und startete den Motor. Alices Hand lag zwar noch auf meinem Oberarm, aber sie sah aus dem Fenster. Wenn sie noch immer so temperamentvoll war wie früher, dann riss sie sich in diesem Moment immens zusammen, mich nicht zu belehren oder mir Vorschriften zu machen.
Ich erwachte aus meiner Schockstarre. Die einzelne Träne, die sich hervorgekämpft hatte, wischte ich mit dem Handrücken weg und legte dann die Briefe zwischen uns auf den mittleren Sitz. Mit zusammengebissenen Kiefern nahm ich den von Mr Fitz, den ich an seiner unsauberen Handschrift sofort erkannte. Der Mann hätte Arzt sein können, wenn es danach ging.
Er hatte nicht zu viel versprochen. Abgesehen von der offiziellen Kündigung und einem Schnipsel mit einer gekritzelten Adresse befand sich auch eine Rechnung über zweitausend Dollar einer Umzugsfirma in dem Umschlag. Ich grunzte. Alice sah mich an. Sie fragte nicht, aber ihre Augen sagten alles. Ich hielt ihr die Papiere entgegen. Sie riss sie mir förmlich aus den Händen und scannte sie mit einem professionellen Blick.
»Vic, das ist doch niemals rechtens, oder?« Sie hielt die Rechnung hoch, als könnte Victoria nur mit einem Blick durch den Rückspiegel erkennen, worum es ging.
»Ich sehe es mir später an, ja?«
Alice knirschte mit den Zähnen. Eine Eigenart, mit der sie als Schülerin begonnen hatte und bei der ich mir bis heute nicht sicher war, ob sie es überhaupt wahrnahm. »Klar.«
Ich ging meine Post weiter durch. Werbung, Telefonrechnung, ein Schreiben darüber, dass mir der Strom abgestellt worden war … und ein Brief vom Krankenhaus. Sicherlich meine letzte Abrechnung, bevor ich inhaftiert worden war. Ich riss das Papier auf und bemerkte sofort, dass der Aufbau des Schriftstücks anders war. Dieses Mal begriff ich die Schwere dessen, was sich vor mir ausbreitete, sofort. Ich griff nach Alices Knie und drückte es.
»Hm?«
Ich starrte weiterhin das Blatt an.
Sehr geehrte Mrs O’Brian,wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir Ihnen gemäß § 9 Ihres Arbeitsvertrages hiermit fristlos die Kündigung aussprechen.
Kündigung. Sie hatten mir gekündigt. Der Druck auf meiner Brust wurde unaushaltbar. Übelkeit stieg in mir auf. Ich schnallte mich ab, stieß die Autotür auf und lehnte mich heraus, weil ich damit rechnete, dass mir jeden Moment die Galle aufstieg.
Kapitel 3
Nachdem ich mir sicher war, dass mein Magen stabil blieb, waren wir losgefahren. Ich kannte den Weg im Schlaf. Noch bei Befahren des Parkplatzes löste ich den Gurt, nahm meine Kündigung und sprang aus dem Wagen, sobald Victoria gehalten hatte. Das Ganze musste ein Missverständnis sein. Etwas anderes war nicht denkbar. Meine Chefin hätte das niemals zugelassen. Sie würde, wie ich, aus allen Wolken fallen. Das Krankenhaus brauchte mich. Die Patienten waren auf mich angewiesen. Durch meine Haft war ich schon zu lange ausgefallen. Pflegepersonal gab es nicht wie Sand am Meer.
Ich rannte über den Parkplatz. Alice war direkt an meiner Seite, doch Victoria schritt uns allerhöchsten zügig hinterher. Sie sah nicht aus wie eine Frau, die rannte. Besonnenheit war ihr zweiter Vorname.
Das Zischen der aufgleitenden Glastür war Musik in meinen Ohren. Der Duft von Desinfektionsmittel stieg in meine Nase. Sofort überfiel mich das Gefühl von Heimat. Hier war ich am richtigen Ort. Ich gehörte hierhin. Meine Kolleginnen hatten oft gescherzt, dass ich bald eine Inventarnummer erhalten würde, so sehr war ich mit dem Krankenhaus verbunden. Ich lief am Empfangstresen vorbei.
»Hey Clark«, grüßte ich den Mann, der dahinter Zeitung las, weil es erstaunlich leer an diesem Vormittag war.
»Kenna?« Er sah mich über das Blatt an und runzelte die Stirn. »Ich dachte …«
»Später, ja?« Ich joggte weiter. Die Anstrengung lenkte mich etwas von dem Chaos in meinem Inneren ab. Es war gut, dass mein Herz schneller schlug, denn damit passte der Puls zu dem Cortisolspiegel in meinem Blut.
Immer wieder grüßten mich Kollegen. Manche waren begeistert und grinsten breit, als sie mich sahen, doch einige schienen auch irritiert zu sein oder flüsterten hinter meinem Rücken. Das ließ mich vollkommen kalt. Es interessierte mich lediglich eine Meinung.
»Ich wusste nicht, dass du so schnell rennen kannst«, ächzte Alice neben mir. Ihre Worte klangen gepresst zwischen Keuchen und tiefen Atemzügen.
»Als Krankenschwester muss man fit sein. Jederzeit bereit um schnell zu handeln«, erwiderte ich verständlicher. Gezielt steuerte ich das Büro meiner Chefin an. Victoria hatten wir mittlerweile vollkommen abgehängt, aber ich war mir sicher, dass sie bestens Bescheid wusste, wo Dr. Pham arbeitete, wenn sie nicht im OP stand.
Vor der Tür, die das entsprechende Namensschild aufwies, kam ich zum Stehen. Ich wartete einen Moment, damit sich meine Atmung regulierte. Immerhin bekam ich nach der sportlichen Einlage genug Luft. Und die Übelkeit war mit Betreten des Krankenhauses verschwunden. Ich war mir sicher, dass sich gleich alles zum Besseren wenden würde. Es konnte sich nur um ein paar Minuten und einen Anruf von Dr. Pham handeln. Ich klopfte an die Tür und wartete. Nach einigen Augenblicken wiederholte ich es. Eine Antwort blieb aus.
»Mist«, stöhnte ich und lief wieder los.





























