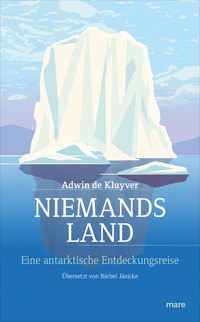
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mareverlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als Adwin de Kluyver auf die Geschichte des (leidenschaftlich) gescheiterten japanischen Antarktisfahrers Nobu Shirase stieß, erwachten seine Liebe zu den Antihelden der südpolaren Entdeckungshistorie wie auch sein Wunsch, selbst seinen Fuß auf den eisigen Kontinent zu setzen. In »Niemandsland« schildert er seine abenteuerliche Fahrt an Bord des Dreimasters Europa und schüttet zugleich in einer Zeitreise durch die Jahrhunderte ein Füllhorn von anrührenden, spannenden und oft komischen Antarktis-Erzählungen aus: Wir lauschen mit ihm den Mythen der Maori, treffen den mürrischen Biologen Johann Reinhold Forster, einen Begleiter James Cooks, Jennie Darlington, eine der ersten zwei Frauen auf dem südlichen Eis, und betrachten Antarktika aus völlig neuen Perspektiven, inklusive derjenigen eines Astronauten, der sie aus dem Weltraum fotografiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Adwin de Kluyver
NIEMANDSLAND
Eine antarktische Entdeckungsreise
Aus dem Niederländischen von Bärbel Jänicke
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Niemandsland.
Een Antarctische ontdekkingsreis bei Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv., Amsterdam.
Copyright © Adwin de Kluyver, 2021
Der Verlag dankt der Niederländischen Literaturstiftung für die Förderung der Übersetzung.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2024 by mareverlag, Hamburg
Covergestaltung Nadja Zobel, Petra Koßmann / mareverlag
Coverabbildung JDawnInk/iStock by Getty Images
Datenkonvertierung E-Book Bookwire
ISBN E-Book: 978-3-86648-845-8
ISBN Hardcover-Ausgabe: 978-3-86648-709-3
www.mare.de
Der Pinguin bin ich.
Andrej Kurkow,
Picknick auf dem Eis, 1999
*
Dort endet alles und endet es nicht:
Dort beginnt alles.
Pablo Neruda, »Piedras Antárticas«,
in: Las Piedras de Chile, 1961
*
Es war zweifellos die schlimmste Prüfung, die wir durchgestanden haben, seit wir den Bauch unserer Mütter verlassen hatten.
Nobu Shirase,
Nankyoku tanken, 1913
INHALT
REISENOTIZEN 1 – BANZAI
ENDERBY-INSEL, NEUSEELAND – EIN KANU
REISENOTIZEN 2 – ZUR UNTERSEITE
MONTE CAMPANA DE ROLDÁN, CHILE – EINE STRASSE
REISENOTIZEN 3 – LANDKRANK
SÜDLICHER OZEAN – NIHIL: NICHTS
REISENOTIZEN 4 – POESIE
CAVE COVE, SÜDGEORGIEN – EIN VOGEL
REISENOTIZEN 5 – BLUTROT
HAMILTON, VEREINIGTE STAATEN – ZWEI LÖCHER
REISENOTIZEN 6 – PUB
MOSKAU, RUSSLAND – EINE UTOPIE
REISENOTIZEN 7 – LANDSÄUGETIERE
DER SÜDPOL – DIE HUNDE
REISENOTIZEN 8 – EINSAM
ROSS-SCHELFEIS – DAS ZELT
REISENOTIZEN 9 – GESTANK
KAP ADARE – EIN MENSCHLEIN
REISENOTIZEN 10 – FOTO
DISCOVERY INLET – DIE JAGD
REISENOTIZEN 11 – FLAGGE
NEUSCHWABENLAND – EINE SWASTIKA
REISENOTIZEN 12 – DESILLUSION
STONINGTON ISLAND – EINE FRAU
REISENOTIZEN 13 – ZEIT
APOLLO 17 – EINE OBERSEITE
REISENOTIZEN 14 – NACHSCHRIFT
ANHANG
EIN AUSWAHLVERFAHREN
EINE BIBLIOGRAFIE
EIN BILDQUELLENVERZEICHNIS
EIN REGISTER
ÜBER DAS BUCH
REISENOTIZEN 1 BANZAI
Der Kapitän gibt eine Sturmwarnung aus. Alle Luken dicht und die Ventilatoren abschalten. Unter Deck ist das Schiff jetzt ein schwach beleuchteter segelnder Bunker. Die acht Meter hohen Wellen greifen, lecken und brechen über den Dreimaster. Immer wieder stürzt die Bark in ein Wellental, richtet sich auf und nimmt zuversichtlich den nächsten Anstieg in Angriff. Das Hauptdeck wird von einer wütenden Wassermasse überspült. Die Gangborde haben sich in einen wild wirbelnden Fluss verwandelt, der alles auf seinem Weg mit sich reißt. Nur auf den oberen Decks können wir noch stehen; ein Gurtgeschirr mit einem Haken verbindet mich mit dem Schiff. Der Horizont ist unauffindbar. Immer wieder schaue ich zu den Wasserwänden hinauf, die sich nähern und das Schiff gerade noch rechtzeitig anheben. Es ist Furcht einflößend und aufregend zugleich.
*
Am besten gestehe ich es gleich ein. Lange Zeit wollte ich gar nicht nach Antarktika. Zu weit weg, zu teuer, zu wenig Kultur. Von klein auf war ich vom hohen Norden fasziniert, nicht vom Süden. Ich stapfte an Steilküsten entlang und durch die Tundra, sauste mit Hundeschlitten durch ewig singende Wälder und pinkelte meinen Namen in den Schnee, während das Nordlicht über meinem Kopf tanzte. Nachdem ich Historiker geworden war, begann ich mich professionell in die Kulturgeschichte von Polreisen und Heldentum zu vertiefen. Was sagten all die Polhelden und Entdeckungsreisen eigentlich über die Zeit aus, in der sich diese Geschichten abspielten? Wie kamen diese spannenden Reiseberichte zustande, was machte jemanden zu einem Helden, und warum brauchten wir damals Polhelden? In derartige Fragen.
Durch den einen Pol kam ich mit dem anderen in Berührung. Mögen der Nordpol und der Südpol auch zwei Extreme sein, so sind der äußerste Norden und der tiefste Süden doch miteinander verbunden, und sei es nur, weil sich die Erde an beiden Orten um ihre eigene Achse dreht. Die scheinbar entlegensten Winkel der Welt sind eigentlich zwei Mittelpunkte. Schon die alten Griechen sahen diese Gegensätzlichkeit und diese Verbundenheit zwischen der Ober- und Unterseite der Erdkugel. Den Norden nannten sie arktikos, nach dem Sternbild des Großen Bären; der Süden hieß antarktikos, das dem »Land des Bären« Gegenüberliegende.
Die beiden Pole teilen eine Ideengeschichte der Spekulationen und Imaginationen. Die gefrorenen Enden der Welt erweisen sich bis heute als ein ideales unbeschriebenes Blatt, auf das Dichter und Denker, Wissenschaftler und Machthaber, Entdeckungsreisende und Glückssucher ihre Ideen, Ängste, Fantasien, Träume und Ideologien projizieren.
Aber es gibt auch viele Unterschiede: Das arktische Gebiet ist ein Ozean umgeben von Land, das antarktische Gebiet ist eine Landmasse umgeben von einem Ozean.
Im Norden wohnen rund um den 60. Breitengrad noch jede Menge Menschen. Dort liegen große Städte wie Oslo, Stockholm, Helsinki, Tallinn, Sankt Petersburg und Murmansk. Im hohen Norden leben mehrere indigene Völker – Inuit, Yupik, Aleuten, Nenzen und Sami –, jedes mit seiner eigenen Geschichte und Kultur. Und es gibt bis in hohe Breitengrade wirtschaftliche Aktivität; auf Spitzbergen wird Kohle abgebaut, oberhalb von Russland fahren Schiffe über die kürzeste, mittlerweile eisfreie Route nach Asien.
Nicht so im äußersten Süden. Dort liegen um den 60. Breitengrad nur unbewohnte Inseln. Mineralien werden dort nicht gewonnen. An der Küste des antarktischen Kontinents gibt es tierisches Leben, aber inmitten der Landmasse ist kein Mensch, kein Tier und keine Pflanze zu finden, abgesehen von ein paar Wissenschaftlern, die zeitweilig in der künstlichen Umgebung einiger gut geheizter Polarstationen überleben. Ansonsten ist es öde: Dort wächst nichts, es gibt keinen Schutz, keinen Brennstoff, kein flüssiges Wasser. Die antarktische Eiskappe ist eine Wüste, in der es wenig zu sehen gibt und es wesentlich kälter ist als im arktischen Gebiet. Ein Mensch hat dort wenig zu suchen.
Und doch kreuzte der Süden meinen Weg. Während meiner Recherchen über Polreisende stieß ich auf einen Entdeckungsreisenden, der eine unbedeutende Expedition unternommen hatte und in seinem Heimatland dennoch zu einem Polhelden geworden war. Nobu Shirase war sein Name, ein Japaner, der ebenso wie Roald Amundsen und Robert Falcon Scott in den Jahren 1911 und 1912 versucht hatte, den Pol zu erreichen, dem es aber, im Gegensatz zu dem Norweger und dem Briten, nie gelungen war, in den Kanon der antarktischen Geschichte einzugehen. Ich las seinen offiziellen Reisebericht. Mithilfe eines Übersetzungsprogramms studierte ich die Forschungsberichte zur Expedition. Ich starrte auf die eingezeichnete Landkarte, die die Japaner nach der Reise zur Royal Geographical Society in London geschickt hatten. Ich entdeckte sogar einige Haikus, die Nobu Shirase unterwegs in sein Notizbuch gekritzelt hatte.
Der Ton des offiziellen japanischen Expeditionsberichts und Nobu Shirases persönlicher Erinnerungen gefiel mir, er war zurückhaltender als die oftmals heroischen Reiseberichte aus dem Westen. Während die europäischen Polreisenden ihren eigenen Heldenmut in Superlativen besangen, staunte Shirase vor allem. Dass er letztlich nie den Südpol erreichte, tat für ihn und für das japanische Volk eigentlich nichts zur Sache. Die hellauf begeisterte Menge von Zehntausenden Menschen, die den neuen japanischen Polhelden am 20. Juni 1912 empfing, wollte von einem Scheitern nichts wissen.
*
Wer war dieser obskure Polreisende? Nobu Shirase wurde 1861 in dem kleinen Städtchen Konoura, dem heutigen Nikaho, im Nordwesten Japans geboren. Er war der älteste Sohn eines buddhistischen Priesters, der im Jorenji-Tempel seinen Dienst versah. Von klein auf war Nobu dazu bestimmt, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Doch der Junge hatte andere Pläne; die aufregenden Berichte von Nordpol-Expeditionen waren sogar bis in das Kloster im abgelegenen Konoura vorgedrungen. Sein Hausarzt Doktor Sessai Sasaki, der zugleich auch sein Lehrer war, erzählte ihm Geschichten über große Entdeckungsreisende. Der kleine Nobu lernte von seinem Schulmeister Sasaki, dass Mut, Beharrlichkeit und Geduld wichtige Eigenschaften sind.
Wie den jungen Roald Amundsen auf der anderen Seite der Welt faszinierte auch Nobu Shirase das mysteriöse Verschwinden der englischen Expedition unter John Franklins Leitung, die sich mit den Schiffen Terror und Erebus auf die Suche nach der Nordwestpassage – der Schifffahrtsroute über Kanada und Alaska – begeben hatte. Der angehende Mönch war fest entschlossen, selbst Polreisender zu werden. Er verließ das Kloster und trat in die Armee ein.
Japan erlebte zu dieser Zeit, im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert, eine Phase der Aufklärung. Der Shogun, der oberste militärische Führer des Landes, wurde abgesetzt und die Macht des Kaisers erneuert. Japaner durften nach einer Zeit der erzwungenen Isolation wieder ins Ausland reisen. Technologie und Wissenschaft wurden unter der Führung von Kaiser Meiji zu bedeutenden Pfeilern der modernen Gesellschaft.
Dank dieser neuen Offenheit konnte der Soldat Nobu Shirase zwischen 1893 und 1895 seine erste Polarerfahrung machen. Nach einem Abkommen mit den Russen waren die Chishima-Inseln in die Hände Japans gefallen. Diese Inselgruppe, heute wieder russisch und als die Kurilen bekannt, erstreckte sich vom äußersten Norden Japans bis zur Insel Kamtschatka im Nordosten Russlands. Eine kleine Armee-Einheit unter der Führung von Shirase erkundete die neuen Inseln mit einem Ruderboot, doch die Besatzung war dem subarktischen Klima unzureichend gewachsen. Im Lauf zweier Winter erlagen dreizehn Soldaten der Einheit ihren Erfrierungen und dem Skorbut. Nobu Shirase aß während der letzten Überwinterung seinen eigenen Hund und war einer der beiden Überlebenden der Expedition. Trotz der Entbehrungen wollte er noch einmal in den Norden.
Einige Jahre später heuerte Nobu Shirase, der inzwischen Reservist war, auf einem Schiff an, das in Alaska auf Seehundjagd ging. Er arbeitete ein Jahr lang als Jäger in Point Barrow, der nördlichsten Siedlung der Vereinigten Staaten und dem einst angestrebten Ziel der auf mysteriöse Weise verschollenen Expedition unter Leitung von John Franklin.
Porträt von Leutnant Nobu Shirase, veröffentlicht vor der Antarktis-Expedition
Shirase fand, dass er nun über genügend Polerfahrung verfügte, um selbst auf Expedition in den Norden zu gehen. Bis in den Zeitungen plötzlich nur noch über Frederick Cook und Robert Peary berichtet wurde, die beide behaupteten, 1908 und 1909 den Nordpol erreicht zu haben. Der Hauptpreis im Norden war also schon vergeben. Nobu Shirase fasste sich ein Herz und entschied sich, seinen Blick nach Süden zu richten. Robert Falcon Scott und Ernest Shackleton hatten zu Beginn des Jahrhunderts bereits einen Versuch gewagt, den 90. Grad südlicher Breite zu erreichen, waren aber gescheitert. Nun würde er, Nobu Shirase, dem japanischen Kaiserreich den Südpol hinzufügen.
*
Obwohl ich während meiner Recherchen zu Polreisen und Heldentum nur einen Blick auf den japanischen Antihelden erhascht hatte, schloss ich Nobu Shirase ins Herz; wegen seines Tatendrangs, seiner Schnitzer und seines tragischen Untergangs. Es war wie eine Verliebtheit in der Schulzeit. Ein einziger Moment mit Blickkontakt genügte, um eine jahrelange Obsession zu entfachen. Ich fasste den Entschluss, den Spuren der Expedition von Shirase-san zu folgen.
Doch wie kam ich nach Antarktika? Ich wandte mich an die Niederländische Organisation für Wissenschaftliche Forschung (NWO), die ein Labor auf dem Gelände der britischen Forschungsstation Rothera auf der Antarktischen Halbinsel unterhält. Diese Forschungseinrichtung heißt Dirck-Gerritsz-Labor, benannt nach einem niederländischen Kaufmann, der im 16. Jahrhundert die südlichen Meere befuhr. Ich hatte alle möglichen futuristischen Vorstellungen von einem Südpol-Labor, doch auf den Fotos auf der NWO-Website sah ich, dass die Anlage aus vier Seecontainern bestand. Von denen immerhin jeder einen eigenen Namen trug: Frohe Botschaft, Glaube, Liebe und Hoffnung.
Ich schrieb der NWO, dass ich als Historiker an einem Buch darüber arbeite, wie man sich Antarktika im Lauf der Jahrhunderte vorgestellt hat. Wäre es wohl möglich, das einzige Stückchen antarktischen Vaterlandes, in der Größe von vier Seecontainern, zu besuchen? Willem-Alexander, wohlgemerkt auch ein Historiker, war bereits dort gewesen. Als Forscher zur Entstehung des kulturhistorischen Bildes der Polarregionen könne ich dem, was unser König bereits geleistet hat, sicherlich noch etwas hinzufügen.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten:
Leider ist es aufgrund der hohen Kosten, die mit dem Zugang zu Rothera verbunden sind, nur möglich, Wissenschaftler zur Station zu entsenden. Auch im Rahmen der niederländischen Gesetzgebung zum Schutz von Antarktika kann außer Wissenschaftlern keinem Menschen Zugang zum Festland von Antarktika gewährt werden.
Ach ja, und viel Erfolg mit Ihrem Buch, fügte der Chef der Seecontainer noch hinzu. Ein Historiker war also offenbar mehr Mensch als Wissenschaftler? Ich rief an und erläuterte meinen Plan nun etwas detaillierter.
Ich wolle ein Buch schreiben, in dem ich die Kulturgeschichte von Antarktika anhand historischer Schlüsselfiguren skizzierte. In meinen historischen Porträts würde ich stets zwischen Intimität und Distanz hin- und herwechseln, sodass die Figuren sowohl eine persönliche als auch eine universelle Geschichte erzählten. Mit anderen Worten: Es war zwingend notwendig, dass ich, als Verfasser der Kulturgeschichte der Unterseite der Welt, meinen Gegenstand mit eigenen Augen zu sehen bekam. Ich musste und würde nach Antarktika kommen. Um die Leere zu sehen, um sie zu begreifen.
Zu guter Letzt stammelte ich noch etwas über das Generieren von Goodwill für die Polarforschung in der breiten Öffentlichkeit und positive Publicity für die NWO. Mit anderen Worten: Ich würde den Bürgern zeigen, was irgendwo sehr weit weg mit ihren Steuergeldern passierte.
Vergebens, an einem Chronisten bestand bei der NWO kein Bedarf. Die Naturwissenschaftler behielten die Antarktis lieber für sich. Rothera wirkte wie eine abgeschottete russische Stadt aus Sowjetzeiten.
Ich beschloss, andere Wege in den Süden zu suchen, und landete auf der Couch eines Polveteranen in einem Groninger Bungalow. Der Biologe war düsterer Stimmung. Nicht wegen der Zukunft der Erde, sondern wegen seiner Wissenschaftlerkollegen, die dieser Tage alle an Klimakummer litten. Einige brachen sogar über das Abschmelzen der arktischen oder antarktischen Eiskappen öffentlich in Tränen aus. Sah denn niemand, dass es schon immer Klimaschwankungen gegeben hatte? Ich hielt mich bedeckt und nickte wie ein entschiedener Klimawandelleugner; sonst würde ich es nie bis zum Südpol schaffen. Er werde mich einer auf Antarktis-Kreuzfahrten spezialisierten Reederei empfehlen, zu der er gute Beziehungen habe. Vielleicht könne ich als Wissenschaftler mitfahren und unterwegs Vorträge halten.
Nach langwierigem E-Mail-Verkehr meldete ich mich in der seeländischen Zentrale des betreffenden Kreuzfahrtunternehmens, wo mich der Reeder persönlich in seinem mit historischen Karten dekorierten Büro empfing. Er zeigte mir eine Karte der Magellanstraße aus dem 17. Jahrhundert, auf der eine niederländische Siedlung eingezeichnet war. Vielleicht wisse ich ja etwas über diese Landsleute? In der Hoffnung auf grünes Licht suchte ich nach unserem Gespräch mehrere Tage lang nach dem genauen Standort eines niederländischen Ankerplatzes in Patagonien. Der Ort auf der Karte erwies sich als Cordes-Bucht, eine Begräbnisstätte für 120 verstorbene Besatzungsmitglieder einer Ost-Expedition der Rotterdamer Compagnie. Diese Expedition war im Jahr 1598 mit den Schiffen Het Geloof (Der Glaube), De Hoop (Die Hoffnung), De Liefde (Die Liebe), De Trouwe (Die Treue) und De Blijde Boodschap (Die Frohe Botschaft) aus Rotterdam ausgelaufen; und an Bord war doch tatsächlich der Namensgeber des niederländischen Polarlabors – Dirck Gerritszoon. Der Reeder teilte mir mit, dass ich in zwei Jahren als Mitarbeiter an einer Antarktis-Expeditionskreuzfahrt zum Rossmeer teilnehmen könne. Mit einem Hubschrauber könne ich sogar die Eiskappe besuchen. An Bord solle ich dann Vorträge halten, aber es wurde auch erwartet, dass ich die kapitalkräftigen älteren Passagiere bei ihren Landgängen begleite. Wozu ich mir dann die noble Kunst des Zodiacfahrens aneignen müsse. In einer Bootsfahrschule in Scheveningen erkundigte ich mich schon einmal nach den Möglichkeiten, einen Zodiac-Führerschein für Polführer zu erwerben. Leider hörte ich danach nie wieder etwas von der Reederei. Auch andere Anbieter von Expeditionsreisen reagierten nicht auf meine Anfragen. Mir selbst ein Hin- und Rückfahrticket zur Eiskappe zu buchen – zu einem Preis in der Höhe eines durchschnittlichen Jahreseinkommens –, lag leider außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten.
Ich beschloss, meinen Plan über Bord zu werfen und zunächst nach Japan zu reisen, um in die Fußstapfen meines Polreisenden zu treten, der im Südpolgebiet auch schon nicht besonders erfolgreich gewesen war. Warum wollte er eigentlich zum Südpol, warum wollte ich nach Antarktika?
*
Ich erstellte einen Reiseplan. Ich würde Nobu Shirases Geburtshaus besuchen, das Kloster, in dem er aufgewachsen war, das Museum, das seiner Expedition gewidmet war, sein Grab. In Tokio würde ich in das japanische Polarinstitut und das Polarmuseum gehen. Und unterwegs würde ich mich in das Verhältnis der Japaner zu Eis, Schnee und Kälte vertiefen. Auf meinem Smartphone hatte ich schon eine App eingerichtet, die mithilfe der Kamera verschiedene Sushi-Typen erkennen konnte.
Dann erhielt ich völlig unerwartet eine Antwort auf eine E-Mail, die ich sechs Monate zuvor an eine andere Reederei geschickt hatte, ohne je eine Reaktion darauf erhalten zu haben. Wenige Tage später saß ich in einem Rotterdamer Hotel einem wettergegerbten Seemann gegenüber, der mich einer Musterung unterzog. Bei Interesse könne ich mit nach Antarktika, auf der Europa, einem Dreimaster, der einst als Leuchtschiff in der Elbmündung gedient hatte und nun die südlichen Meere befuhr. Die Bark war 1911 gebaut worden. Ich sprang auf, denn 1911 war das Jahr, in dem Nobu Shirase mit der Kainan-Maru, ebenfalls einem Dreimaster, Antarktika erreicht hatte. Eine passive Kreuzfahrt würde es nicht werden, betonte mein Gegenüber. Alle an Bord der Europa gehörten zur Besatzung, und auch von mir wurde erwartet, mit anzupacken. Es mussten immerhin fünfundzwanzig Segel gehisst werden. Die Bark sollte vom argentinischen Hafen Ushuaia aus in See stechen, und die Segel-Expedition würde gut drei Wochen dauern. Ich stieß einen japanischen Freudenschrei aus: »Banzai!« Wie Nobu Shirase würde ich mit einem Segelschiff nach Antarktika fahren.
ENDERBY-INSEL, NEUSEELAND EIN KANU
50°50' S, 166°28' 0
Es ist Montag, der 22. Juni 1998. Auf Enderby, der nördlichsten Insel des neuseeländischen Auckland-Archipels, weht ein stürmischer Wind, ab und zu hagelt es. Es ist der kürzeste Tag in der südlichen Hemisphäre. Vor der Küste liegt die Breaksea Girl vor Anker, eine stählerne Motorjacht mit zwei Masten. In den niedrigen Dünen, etwa 25 Meter von der Küstenlinie entfernt, knien vier Männer und eine Frau auf dem Boden. Fünf Spaten berühren vorsichtig den kargen Sandboden der Sandy Bay, der geschützten Bucht auf der Südseite der Enderby-Insel. Zehn Hände untersuchen den Boden in einer Tiefe von 35 Zentimetern. Dunkelgrauer Sand und Holzkohlereste wechseln sich ab. Die dunklen Holzkohleabdrücke weisen ein Muster auf. Je weiter sich die Schaufeln Schicht für Schicht vorgraben, desto mehr Kohlereste kommen zum Vorschein, und es zeichnet sich ein deutlicher Kreis ab. Hier muss früher eine große Feuerstelle gewesen sein, stellen die fünf Forscher fest. Kein spontaner Naturbrand, sondern ein Feuer, das regelmäßig von Menschenhand entzündet wurde, von Menschenmündern angefacht, um Mägen zu füllen und Körper zu wärmen. An den Rändern der Feuerstelle finden die Forscher Muschelschalen, den Schädel eines jungen Seelöwen und die zerbrochenen Knochen von Albatrossen, Sturmvögeln und Gelbaugenpinguinen.
Später, im Labor der Nationalen Universität von Australien in Canberra, analysieren sie die Holzkohlereste. Freudig stellen sie fest, dass die Brände viel älter sind als gedacht. Lange bevor sich weiße Gesichter vor den südlichen Küsten zeigten, waren dort, 500 Kilometer südlich von Neuseeland, wo die Antarktis beginnt, in prähistorischer Zeit Menschen gesegelt, hatten dort gewohnt und gejagt. Der Beweis ist erbracht.
*
Die Polynesier gaben es vom Vater an den Sohn, von der Mutter an die Tochter weiter: eine Karakia, eine gebetsartige Beschwörung, über die Reisen der Alten und die Wunder und Gefahren der Welt.
Unser Vorfahr erzählt vom tiefen Süden …
Unser Vorfahr erzählt von den vielen Reisen …
Tawhirimatea, der Gott der Winde, entbrannte nach dem erzwungenen
Abschied von seinen Eltern in heftigem Zorn und erschuf seine eigenen Nachkommen.
Und dann kam das Kind Papawaihau tutu, und es gab Eisstürme …
Und dann kam das Kind Papakawaipapa, und es gab Eis …
Und dann kam das Kind Papawaitoka, und es gab Eisblöcke …
Und dann kam das Kind Papawaikohatu, und es gab Felsen aus Eis …
Und dann kam das Kind Hukarerenui, und es gab Schlagschnee …
Und dann kam das Kind Hukarereroa, und es gab den langen Winterschnee …
Und dann kam das Kind Hukarerewhanui, und es gab aufwehenden Schnee …
Und dann kam das Kind Hukarereputuputu, und es gab aufgehäuften Schnee …
Und dann kam das Kind Paphuri iho, und es gab wieder gefrorenen Schnee …
Und dann kam das Kind Papawaipukupuku, und es gab Berge aus Eis …
Vor achtundvierzig Generationen – im Jahr 650, wie der weiße Mann es nennt – begann mit einem jungen Krieger die Ära der langen Reisen. Ui-te-rangiora war sein Name, oder »Er, der aus dem Himmel gekommen war«. Er war kein Gott, nicht einmal ein Halbgott, aber er war von ihnen gesandt worden, um die Welt zu entdecken.
Aber zunächst musste er Krieg führen. Um ein pāi – ein großes Kanu – zu bauen, brauchte er einen großen Baum. Auf der Insel Rarotonga ließ Ui-te-rangiora seinen Blick auf den heiligen Baum Te Tamoko-o-te-Rangi fallen. Er tötete die Anführer des Stammes, die den Baum verehrten; sie waren allesamt Nachkommen von Taakura und Ari. Um das besiegte Volk zu demütigen, verarbeitete er die Gebeine ihres Oberhaupts in einem Kiel.
Kriegskanu der Maori, Zeichnung von Herman Spöring, 1770
Seine Männer sangen und beteten vor dem Baum und fällten ihn. Dann rollten sie ihn über einen Pfad aus Baumstämmen zur Küstenlinie. Ein Jahr lang arbeiteten sie am Aushöhlen des Stammes. Ui-te-rangiora nannte das Kanu Te-ivi-o-Atea, die Gebeine von Atea, nach dem Häuptling, der über den heiligen Baum gewacht hatte.
Mit den Gebeinen ihrer besiegten Gegner schlugen fünfzig Männer hölzerne Trommeln, als sie sich unter der Führung von Ui-te-rangiora auf den Weg machten. Rarotonga sollte den Krieger nie wiedersehen. Den Gesängen und Geschichten der Polynesier zufolge besuchte er jeden Ort auf Erden.
Jahr um Jahr fuhr Ui-te-rangiora mit seinen Männern umher, den Wind im dreieckigen Segel, die Paddel in den Wellen. Er entdeckte Tangite-pu, Rara, Nu-pango, Avaiki, Uru-pukapuka-nui, Te-Rauao, Panipanima-ata-one-okotai, Tonga-pirita, Amama, Porapora und Rapa-nui. Wo all diese Inseln lagen und was ihre Namen bedeuteten, wussten die vielen Generationen nach ihm oft gar nicht mehr.
Die weißen Europäer würden den Inseln später Namen wie Neuseeland, Hawaii, Tonga, Samoa, Tahiti und Osterinsel geben. Westliche Kartografen würden dieses Tausende Kilometer lange und breite Gebiet das polynesische Dreieck nennen. Ein Gebiet, das sich im Stillen Ozean zwischen Asien, Amerika und Australien erstreckt.
Unterwegs aßen Ui-te-rangiora und seine Männer masi, eine aus Brotfrüchten gekochte Paste, und aus Pfeilwurzeln zubereiteten Kuchen. Trinkwasser nahmen sie in Bambusköchern mit. Kokosnüsse boten ihnen Nahrung und Flüssigkeit. Sie kauten auch Kokablätter, um Meerwasser trinken zu können. Aus trockenen Reisigbündeln machten sie auf den Inseln Feuer. Für sich selbst wiederholten sie die Abschiedsbotschaften, die ihnen die auf Rarotonga Zurückgebliebenen nachgerufen hatten: Lasst es euch wohl ergehen und kehrt zurück.
Zurück nach Hause kehrten Ui-te-rangiora und seine Mannschaft nicht mehr. Immer wieder gab es die Verheißung einer neuen Insel jenseits des Horizonts. An Bord des Kanus hielten zwei Seefahrer ihre Entdeckungen fest. Sie spannten Fäden auf einen Holzrahmen. Zweige und Muscheln markierten die Inseln, die Meeresströmungen und die Richtung der Passatwinde.
Ui-te-rangiora blickte empor. Die Sterne über dem tiefen Ozean änderten ständig ihre Position. Manchmal gab Hoku-paa, der nördliche Stern, die Richtung an, dann wieder folgte Ui-te-rangiora Newe, dem südlichen Stern. Manchmal schien das Firmament unter Newe des Nachts in Flammen zu stehen. Grüne Lichtblitze zogen über den Himmel. War das ein Zeichen dafür, dass ein Gott dort seinen Tempel hatte? Erstaunt starrte Ui-te-rangiora auf dieses Schauspiel göttlicher Pracht. Er zeigte auf Te Kahui, das Kreuz des Südens, und die Strömung und der Nordwestwind nahmen Te-ivi-o-Atea mit in kältere südliche Gewässer. Die bitteren Winde und beißenden Wellen peinigten die Männer im Kanu.
Ui-te-rangiora sah das lange Seegras. Auf dem Meeresgrund musste eine Frau leben, deren Flechten in den Wellen schwebten. Am Horizont erschienen völlig kahle Berge, deren Spitzen die Wolken durchbohrten. Im Meer trieben kalte weiße Felsen, die sich manchmal in zwei Teile spalteten. Um das Kanu herum schwammen Kreaturen, die in große Tiefen tauchten. Einige atmeten aus dem Rücken, andere hatten lange Zähne. Hier musste der Maraki-hau wohnen, der halb Mensch, halb Fisch war und mit seinen Elfenbeinspeeren kämpfte.
Ui-te-rangiora und seine Männer kamen an neblige und dunkle Orte, die nie ein Sonnenstrahl erreichte. Nur die grünen Flammen am Himmel erhellten diese Orte. Das sich bewegende Kreuz des Südens bewies, dass es die Zeit noch gab. Das Meer wurde kälter und kälter, bis das Wasser erstarrte und das pāi stoppte. Tawhirimatea, der Gott der Winde, hatte sie bis ans Ende der Welt geblasen. Ui-te-rangiora nannte den gefrorenen Ozean Te tai-uka-a-pia: Das Meer, das so weiß ist wie die abgeschabten Teilchen der Pfeilwurzpflanze.
Wegen des Eises konnten sie nicht weiterfahren, also kehrten sie um. Das Wasser wurde wärmer. Es gab wieder einen Tag und eine Nacht. Sie legten in einer sandigen Bucht an, schleppten das pāi den Strand hinauf und machten ein Feuer, um ihre steifen Glieder zu wärmen. Sie fingen Vögel, sammelten Muscheln und töteten einen Seelöwen. Und während sie wieder zu Kräften kamen, sprach Ui-te-rangiora. Wir haben die Wunder der Welt gesehen, sagte er, der Ozean gehört jetzt uns, von den warmen blauen Wellen bis zu der grimmigen Küste. Mögen andere uns zu den eisigen Felsen und den treibenden weißen Ländern folgen, wir haben den Weg gewiesen.
REISENOTIZEN 2 ZUR UNTERSEITE
Fin del Mundo nennt sich der Ausgangshafen Ushuaia, die südlichste Stadt Feuerlands, Argentiniens, der Welt. Gestern Morgen bin ich hier gelandet, nach einem 15000 Kilometer langen Flug. Das Ende der Welt – das ist eine passende Beschreibung für Ushuaia, eine Stadt, die sich als ein ziemlich trauriger Sammelplatz für etwas zu reiche Senioren mit einem letzten Wunsch herausstellt. Am Kai liegen die schwimmenden Kreuzfahrtstädte (mit gut 3000 Einwohnern), die Namen wie Star Princess und Celebrity Eclipse tragen, schon bereit, um Passagiere en masse zu Eisbergen und Pinguinen zu verschiffen.
Ich spaziere an den Kais entlang. Ein Stück entfernt sehe ich eine Gruppe von Poltouristen noch schnell in gemieteten Jeeps auf das raue Hinterland zurasen. Andere lassen sich mit Bimmelbahnen für Touristen zur Einkaufsstraße transportieren, die wie eine lang gestreckte Filiale eines Outdoor-Sportgeschäfts aussieht. Um die Zeit totzuschlagen, besuche ich das hiesige Meereskundemuseum, das in einem ehemaligen Gefängnis untergebracht ist. Die Ausstellung über Polreisen wird vom erstickenden Geruch der Junta überschattet, der aus den nicht restaurierten Teilen des Zellenkomplexes aufsteigt.
Nach einem letzten Teller Ceviche, rohem Fisch in Zitrusmarinade, melde ich mich am späten Nachmittag auf einem Pier am Rande des Hafens. Auf dem Rücken meine bleischwere Segeltasche, gefüllt mit gefütterten Stiefeln, Bergschuhen, einer Segelmontur mit Thermofutter, einer Sammlung von Mützen und Handschuhen, vielen Zwischenlagen aus Merinowolle und einem Stapel Bücher über meinen japanischen Polreisenden. Einigermaßen verschämt schaue ich auf all die neuen Gesichter mit den gleichen gelben Segeltaschen. Etwas unbeholfen steigen wir dann grüppchenweise in ein Zodiac, das mit Vollgas über die kurzen, kräftigen Wellen Richtung Dreimaster fegt, der in der Bucht vor Anker liegt. Wenig später stehe ich klatschnass und bibbernd an Deck und warte auf Instruktionen.
Am nächsten Tag tuckert die 56 Meter lange Bark Europa motorgetrieben durch den Beagle-Kanal, und die bewohnte Welt mit ihren weißen schwimmenden Palästen weicht schon bald der Wildnis. Links gleiten die schneebedeckten Gipfel Feuerlands vorbei, rechts die niedrigen, bewaldeten Hügel Chiles. Die siebzehn festen Besatzungsmitglieder nehmen sich die Zeit, uns, die achtunddreißigköpfige Gastbesatzung, in die Abläufe und Routinen einzuweisen, die den Dreimaster gut drei Wochen unter Segeln halten sollten.
Die Gastbesatzung ist ein wunderliches Sammelsurium von Nationalitäten. Viele Engländer und noch mehr Niederländer sowie einige Australier, Neuseeländer, Amerikaner, Schweizer, Deutsche, Belgier, Taiwanesen, ein Italiener und ein Österreicher. Die Motive mitzufahren sind, wie ich auf der Reise erfahren werde, nicht weniger vielfältig. Es gibt einige Briten, die sich die Reste ihres Weltreiches anschauen möchten, ein enorm reiches Paar, das sich nach der Anschaffung eines Privatjets nun den nächsten Traum erfüllen will, es gibt ein paar Fanatiker, die auch zuvor schon die Weltmeere auf historischen Segelschiffen erkundet haben, ein paar Menschen, die einen großen Kummer zu verarbeiten haben, einen kleinen Klub von Vogelbeobachtern mit gigantischen Apparillos an ihren Kameras, eine Handvoll Millennials mit einer exotischen Bucket List, einen eklektischen Wissenschaftler, der wirklich alles und vielleicht auch nichts erforscht, Liebhaber der Polarregionen und einige begeisterte Amateursegler.
Meine Segelerfahrung beschränkt sich lediglich auf möglichst schnelle und schräg liegende Fahrten mit einem unverwüstlichen Polyvalk in meinen Teenagerjahren. Eine knallorangefarbene Schwimmweste, ein gewisses Verständnis für die Funktionsweise von drei Schoten und einige Grundkenntnisse der Verkehrsregeln auf dem Wasser – Segel über Backbord geht vor Segel über Steuerbord – reichten damals, um auf dem Wasser zu überleben.
Hier warteten größere Herausforderungen auf uns. Meine Segelmontur mit einem Auftrieb von 28 Newton soll mich vor Kälte und Ertrinken bewahren. Die Stammbesatzung zeigt uns, an welchen Leinen wir uns die Finger einklemmen können, wo die Überlebensanzüge zu finden sind und dass man immer eine Hand frei haben muss, um sich festhalten und so unangenehme Stürze an Bord vermeiden zu können. Und wir lernen eine Enzyklopädie von Knoten: Palstek, Mastwurf, Flachknoten, Achtknoten, Schotstek, Würgestek, Augspleiß und Henkersknoten.
Mir wird aufgetragen, mich mit einem Gurtsystem, das mich im Schritt kneift, an eine Rah zu hängen, um eines der rechteckigen Segel loszumachen. Die Mündung des Beagle-Kanals ist erreicht, der argentinische Lotse verlässt das Schiff. Der Südliche Ozean lockt und droht. Wie die meisten Besatzungsmitglieder von Nobu Shirase habe ich überhaupt keine Erfahrung mit dem Segeln auf großen Gewässern und befürchte das Schlimmste.
*
In Tokio sandte Nobu Shirase 1910 einen Vorschlag an das japanische Parlament. Er schrieb: »Die Weltmächte machen sich über das Kaiserreich lustig. Sie sagen, wir seien Barbaren, die sich einzig in der Kriegsführung auszeichnen, doch wenn es um Wissenschaft gehe, seien wir Feiglinge. Im Namen unserer nationalen Ehre müssen wir diese beklagenswerte Situation korrigieren.« Er versprach, dass seine Expedition auf jeden Fall dazu beitragen würde, »Japans Territorium zu erweitern, um so eine reiche, mächtige Nation zu werden«. Sein Plan: Er wollte innerhalb von drei Jahren Japans kaiserliche Flagge am Südpol einpflanzen und große Gebiete für sein Land beanspruchen. Dass sowohl der Brite Robert Falcon Scott als auch der Norweger Roald Amundsen weit gediehene Pläne hatten, als Erste den 90. südlichen Breitengrad zu erreichen, wusste er noch nicht.
Shirase bat einen ehemaligen Premierminister, als Vorsitzender des Unterstützungskomitees der Expedition zu fungieren. Dieser einflussreiche Politiker, Shigenobu Ōkuma, half Shirase, die Aufmerksamkeit der Presse zu erlangen, und unterstützte ihn bei der Mittelbeschaffung. Ōkuma verkaufte die Exklusivrechte an den Reiseberichten an eine Zeitschrift und eine Filmgesellschaft. Die japanische Öffentlichkeit reagierte begeistert auf die Expeditionspläne. Hunderte von Männern bewarben sich als Expeditionsteilnehmer. Einige Bewerber unterschrieben ihre Briefe sogar mit Blut, um ihre Entschlossenheit zu demonstrieren.
Dennoch fehlt es dem Expeditionsteam an genügend Wissenschaftlern. Shirase selbst hatte keinerlei Erfahrung mit Messungen. Letztendlich wurde ein Kandidat angenommen, der nach eigenen Angaben über Kenntnisse in Meteorologie, Magnetismus und Biologie verfügte. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann, Terutaro Takeda, um eine technische Hilfskraft handelte, die einige Jahre als Aushilfslehrer an Mädchengymnasien gearbeitet hatte.
Ende November 1910 brach die siebenundzwanzigköpfige Expedition mit einem robusten umgebauten Fischereischiff in Richtung Antarktika auf. Die dreißig Meter lange Barkentine war mit Planken und Metallplatten verstärkt worden, die der Kraft des Eises standhalten sollten. Ein kleiner 18-PS-Motor sollte dem Schiff durch die windstillen Gebiete helfen. Der Dreimaster erhielt den Namen Kainan-Maru, wobei kai »offen«, nan »Süden« und maru »Schiff« bedeutete, es war mit anderen Worten »das Schiff, das den Süden öffnen würde«.
Das Leben auf See war für die Japaner nicht einfach. Das frühere Fischereischiff stank sieben Meilen gegen den Wind. Während der ersten Woche der Reise lag fast die gesamte Besatzung seekrank in den Kojen. Den Männern war sogar zu schlecht, um morgens ein wenig trockenen Reis bei sich zu behalten. In seinem Reisetagebuch schreibt Nobu Shirase, dass seine Hände so stark zitterten, dass er seine Essstäbchen nicht benutzen konnte.
*
Als Gastbesatzung der Europa werden wir in drei Gruppen eingeteilt, jede Gruppe arbeitet in Vierstundenschichten. Ich gehöre der Roten Wache oder der Rote-Armee-Fraktion an. »Nein, zu aggressiv«, sagen die britischen grannies in unserem Team, »wir nennen uns von nun an The Red Snappers.« Als Snappers sitzen wir auf dem Ausguck, mit dem Hintern auf einer Holzplanke am Vorderdeck, das Wasser spritzt uns ins Gesicht. Wir hissen oder reffen die Segel. Oder wir stehen am Ruder und vertrauen auf ein iPad, das über eine GPS-Verbindung den hell erleuchteten Kurs anzeigt – 155 Grad Süd, recht so, Kurs halten. Der Magnetkompass vor dem mannshohen Steuerrad zeigt manchmal eine Abweichung, der magnetische Pol zieht und ruft und verführt: Komm hierher, komm, komm, komm. Hier ist der wahre Süden.
Die dreißig Meter lange Barkentine Kainan-Maru
Wenn ich keine Wache schieben muss, esse oder schlafe ich. Ich tauche in meine Koje ab, in ein Bett, das durch zwei dicke Samtvorhänge von der chaotischen Männerwelt in der kleinen Vier-Personen-Kajüte getrennt ist. Hier manövrieren halb nackte über Fünfzigjährige mit Bauchspeck etwas unbeholfen umeinander herum, überall hängen dampfende Kleidungsstücke.
Draußen macht die Drake-Passage – der Meeresgraben zwischen Kap
Nacht auf der Drake-Passage
Hoorn und dem Finger der Antarktischen Halbinsel – ihrem Ruf alle Ehre. Ungehindert drehen sich die Winde hier in hoher Geschwindigkeit um den antarktischen Kontinent und stauen sich die Wellen zu großen Höhen. Wasser wirbelt durch die Gänge. Das Schiff bockt wie ein wildes Tier, das von Tauen und Leinen, Stangen und Blöcken im Zaum gehalten wird. Zitternd und seufzend verschlingt es Welle um Welle und verschluckt sich dabei manchmal. Das Schiff hat Schaum vor dem Mund. Bei Windstärke 10 beschließt der Kapitän, die wasserdichten Schotten vor Fenstern, Türen und Luken zu schließen. Bevor ich an Deck gehe, lege ich meinen Gurt an und klinke mich an der Europa fest. Ihr Schicksal ist mein Schicksal.
Ist heute Montag, Dienstag, Mittwoch? Zeit und Ort verschwinden. Land ist noch lange nicht in Sicht. Wir segeln nun schon tagelang in einem Paralleluniversum, in dem alles in einem 30-Grad-Winkel abfällt und wir Menschen die Unangepassten sind. Mit unseren gleich langen Beinen sind wir nicht dazu gerüstet, uns in dieser gekippten Welt fortzubewegen. Die Neigung lässt vermuten, dass wir buchstäblich auf die Unterseite des Globus zusteuern. Nur mein Mageninhalt bleibt zum Glück waagerecht. Dank eines hautfarbenen runden Pflasters hinter dem Ohr leide ich nicht unter Seekrankheit. Hätte Nobu Shirase gut ein Jahrhundert zuvor doch auch nur Zugang zu dem nautischen Wundermittel Scopolamin gehabt.
Es ist mitten in der Nacht. Ich sitze mit einem anderen Red Snapper auf dem Ausguck des Vordecks. Meine Mitstreiterin behält die Backbordseite im Blick, ich die Steuerbordseite. Jedes Mal, wenn der Bug in die Wellen eintaucht, besprüht eine salzige Dusche mein Gesicht. Wann immer ich etwas bemerke – ein anderes Schiff, eine Eisscholle, größer als ein Pkw, einen schwimmenden Container, Fischernetze, einen Wal –, muss ich es über das Walkie-Talkie an die Brücke melden. Seit einer halben Stunde sehe ich nur Schwarz vor meinen Augen, in der Dunkelheit gibt es keinen Anhaltspunkt. Ich starre, ich fokussiere, ich blinzle. Und dann projiziert mein Gehirn die Bilder, nach denen es sucht. Eine Reihe weißer Wellenköpfe verwandelt sich in eine Schule Delfine. In der Ferne taucht ein hell erleuchtetes Kreuzfahrtschiff auf. Ein blinkender Leuchtturm verheißt Land. Am Horizont sehe ich die Skyline einer Stadt. Gedanken treiben wie Eisschollen durch meinen Kopf. Warum fülle ich die Leere, und warum mache ich aus nichts etwas?
Erst viel später, als ich wieder zu Hause bin, lese ich auf dem Beipackzettel der Pflaster gegen Seekrankheit, dass die Einnahme von Scopolamin bei einem von hundert Menschen zu Halluzinationen führen kann. Die Wahnvorstellungen hören von selbst wieder auf, sobald das Pflaster entfernt wird.
MONTE CAMPANA DE ROLDÁN, CHILE EINE STRASSE
53°97' S, 71°78' W
Über das Trinken von Salzwasser. Über ein Meer, das wie ein Fluss aussah. Über Roeland Vergotes Suche nach einer Passage zwischen Amerika und dem Großen Südland.
Der Eimer schleifte durch das Wasser, und ich trank. Es war salzig, genau wie wir gehofft hatten. Ein paar Stunden später ließ ich den Kübel ein weiteres Mal hinab. Ich nahm einen Schluck. Salzig. Wieder einholen, wieder einen Schluck, wieder salzig. Und das war gut. Auf beiden Seiten des Gewässers ragten Berge empor. Die unteren Hänge waren mit Wäldern bedeckt, die Gipfel schneeverziert. Manchmal schienen sich die Ufer zu berühren, doch hinter jeder Enge kam wieder Wasser in Sicht. Weiter und weiter fuhren wir ins Landesinnere. Und Tag für Tag schmeckte ich das Salz. Was manchmal wie ein Fluss aussah, war noch immer ein Meer. Könnte dies die Passage sein, die wir suchten, die Straße zwischen Amerika und dem Großen Südland, das Wasser, das nach Ansicht meines Flottenkapitäns Magellan die Ozeane miteinander verband?
Über einen sterbenden Vater und eine tote Stadt. Über eine Reise nach Spanien und in die Neue Welt. Über Gefahren und Belohnung.
Mein Vater war einst ein angesehener Mann. Seht nur, da ist Joost Vergote, der Tuchfabrikant, sagten sie, wenn er in seinem auffälligen roten Mantel durch die Markthalle schritt. Aber Brügge um 1500 war nicht mehr Brügge. Die Zufuhr über das Zwin war versandet, der Handel war zusammengebrochen, die Stadt wurde hart bestraft, weil wir die Autorität des neuen Erzherzogs nicht anerkannten, die ausländischen Einkäufer suchten nach Drohungen des Herrschers anderswo Zuflucht. Mein Vater hatte Schulden und musste in den letzten Jahren seines Lebens sein Brot als einfacher Walker verdienen. Nackt stand er jeden Tag in einer Mischung aus heißem Wasser und Urin, um die Wolle in der Walkschüssel zu Filz zu stampfen. Und nun lag er keuchend auf seinem Sterbebett. Erschöpft, ausgebrannt, ohne einen einzigen Karolusgulden in seinem Beutel.
Entfliehe der Armut, mein Sohn, sagte er zu mir. Hier gibt es kein Leben. Geh nach Antwerpen, suche dir ein Schiff und entdecke die Gewässer jenseits der Flämischen Inseln, dort liegt die Zukunft.
Und ich ging. Nach Antwerpen, zur See, in die Neue Welt. Mit einer spanischen Karavelle verließ ich den Hafen von Sluis zunächst in Richtung Sevilla. Ich lernte, mit dem Schrot, der Zündschnur und dem Pulverfass umzugehen; ich war jetzt Kanonier.
In Sevilla meldete ich mich für ein gewagtes Unterfangen. Unter der Führung des portugiesischen Generalkapitäns Ferdinand Magellan würde eine spanische Flotte von fünf Schiffen über die Neue Welt zu den Gewürzinseln im Osten segeln. Eine Reise voller Gefahren stehe uns bevor, sagten alle. Wellen, so hoch wie flämische Pappeln, würden unser Schiff verschlingen wollen, magnetische Gesteine würden die Armada auf den Grund saugen wollen, Riesen, so groß und breit wie ein Donjon, würden mich und meine Reisegefährten zerquetschen wollen. Doch die Belohnung wäre dementsprechend. Unsere Heuer werde im Voraus bezahlt, der König werde uns eine Rüstung schenken, ein Drittel des gefundenen Goldes werde unter der Besatzung aufgeteilt, einen Teil der molukkischen Gewürze dürften wir nach unserer Rückkehr auf eigene Rechnung verkaufen.
In der Werft von Sevilla half ich mit, die vier Karacken und die eine Karavelle für die große Reise flottzumachen. Ich kalfaterte die Decks und füllte die Laderäume. Wir nahmen für zwei Jahre Lebensmittel mit: 6000 Pfund gepökeltes Schweinefleisch, 2 Tonnen Sardinen, 1000 Käselaibe, Mandeln, Zucker, Essig, Rosinen, Fässer voller Wein, 20000 Pfund Schiffszwieback und einige lebendige Kühe. Um Gewürze kaufen und die Eingeborenen besänftigen zu können, waren die Laderäume mit Tauschwaren gefüllt: kleine Spiegel, Kupferringe, geschliffene Kristalle, Ringe mit falschen Diamanten und 20000 Glöckchen. Nach einer letzten Messe im Kloster Santa Maria de la Victoria schwor ich dem spanischen König und Magellan den Treueeid. Am Montag, dem 10. August 1519, brach unsere Flotte mit 267 Mann an Bord zu den Molukken auf. Und ich, Roeland Vergote oder Roldan de Argote aus Brujes – wie ich auf der Musterrolle genannt wurde –, stand hinter meiner Donnerbüchse auf der Concepcion. Aus allen Mündungen der fünf Schiffe ertönte eine Abschiedssalve. Die Decks der Schiffe zitterten. Adiós, Alte Welt.
Über den spanischen Teil der Welt. Über Wälder aus Pfeffer. Über eine geheime Meeresstraße, die nur der Kommandant kennt. Über Länder aus Geschichten.
In Brügge hatte ich von meinem Vater etwas über die Flämischen Inseln gehört. Am Rande der bekannten Welt hatte der portugiesische König den Flamen 1451 den Nießbrauch an Terceira, Faial, Flores, Pico und São Jorge übertragen. Auf diesen Inseln bauten meine Landsleute Waid für die Tuchmacher in Brügge, Gent und Ypern an, sie hielten Vieh und suchten nach Silber und Zinn. Und nun sollte ich mit der spanischen Flotte die Linie überqueren, die 1494 westlich der Flämischen Inseln gezogen worden war. Damals hatte Papst Alexander IV. die Welt in zwei Hälften geteilt, als wäre er König Salomon selbst. Der Westen war für die Spanier, der Osten für die Portugiesen. Und irgendwo dort, wo der Westen wieder zum Osten wurde, sollten die Molukken liegen, die Inseln, auf denen Schlingpflanzen die Bäume überwucherten und Pfefferwälder wuchsen. Wir würden vom westlichen Teil der Welt über eine Meeresstraße quer durch Amerika dorthin reisen, flüsterte die Mannschaft. Flottenkapitän Magellan hatte die Passage auf den Globen von Martin Behaim und Johannes Schöner selbst gesehen. Globen, die die Portugiesen in ihren geheimen Kartenräumen vor dem Rest der Welt und besonders vor ihrem Erzfeind Spanien versteckt hielten.
Doch bevor wir die Laderäume unserer spanischen Flotte mit Pfeffer und Muskatnuss füllen würden, erwarteten uns auf unserer Reise viele Länder, die ich nur aus Erzählungen kannte. Dort wuchsen Bäume, die morgens aufkeimten, nachmittags Früchte trugen und abends wieder abstarben; dort konnten die Vögel sprechen; dort lebten Kannibalen, die zehnmal so groß wie ein Mensch waren; dort gab es Armeen weiblicher Krieger. Nun würde ich es mit meinen eigenen Augen zu sehen bekommen.
Über Menschen mit roter Haut. Über untiefe Gewässer. Über Rückschläge und Rebellion.
Wir fuhren auf See, von Sevilla aus zunächst in portugiesische Gewässer, auf dem Weg zu unserem spanischen Teil der Welt. Wo Himmel und Wasser sich berührten, sah ich schon eine Weile nichts mehr, alles war Ozean. Und erst nachdem der Polarstern verschwunden und das Kreuz des Südens erschienen war, kam neues Land in Sicht. Die Einwohner waren rothäutig und hatten keinen Glauben. Sie lebten wie Tiere. Sie liefen nackt herum, nur von ein paar Vogelfedern bedeckt. Die großen Familien lebten gemeinsam in einem Langhaus, in dem sie in Hängematten schliefen. Sie bewegten sich in Booten fort, die aus Baumstämmen gemacht waren, und ruderten mit Gerätschaften, die Schaufeln ähnelten. Wenn sie einen Feind besiegt hatten, aßen sie ihn auf. In ihrer Unterlippe befanden sich drei Löcher, aus denen längliche Steine herausragten. Die Brüste der Frauen waren unbedeckt und manchmal eine Brügger Elle lang. Ich habe dort ein paar Wörter gelernt. Mais bedeutete »Hirse«, und eine Pirame war eine Gabel. Unser Flottensekretär, der italienische Adlige Antonio Pigafetta, notierte alles, was wir sahen: die Tiere, die Pflanzen, die Menschen und die Worte.
Im Februar 1520 erreichten wir die Grenze des portugiesischen Gebiets, die Linie des Papstes. Wir hatten Brasilien passiert; von hier an würde die Welt spanisch werden. Ein breites Gewässer floss landeinwärts.
Sollte denn der Río de la Plata schon die geheime Passage nach Osten sein? Die Santiago, unser kleinstes Schiff, fuhr voraus. Nach wenigen Tagen kehrte sie zurück. Das Lot sank nicht tief, das Wasser war süß, der Boden leckgeschlagen.
Unsere Flotte fuhr weiter, entlang der Küste in Richtung des Großen Südlands. Wir fuhren in jede Bucht, die wir sahen, aber immer wieder endete der Weg in einer Sackgasse. Die Vorräte gingen zur Neige, der Winter hielt Einzug. Es wurde in Ohren geflüstert, es wurden Pläne geschmiedet, Waffen gesammelt, die Unruhe war allgegenwärtig. Unser portugiesischer Kommandant Magellan kenne den Weg nicht, sagten sie, er werde Spanien niemals die westliche Route zu den Molukken schenken. Wütend begannen Besatzungsmitglieder zu meutern, sie übernahmen die Kontrolle über zwei Schiffe. Magellan schlug erbarmungslos zurück. Sein Gesandter stieß dem Anführer der Rebellen einen Dolch in den Hals, als dieser vor ihm stand und ein Friedensangebot des Schiffskapitäns las. Mir wurde befohlen, auf das andere meuternde Schiff zu schießen. Meine Kugeln zerstörten die Takelage und die oberen Decks. Vierzig Meuterer wurden in Ketten gelegt.
Die hohen Offiziere sprachen ihr Urteil über die Rebellen und verurteilten sie zur Folter. Wir mussten mit ansehen, wie einige Gefangene mit auf dem Rücken gefesselten Armen am Mast emporgezogen wurden. Ich hörte, wie ihre Schultern brachen. Dann befestigten die von Magellan ernannten Inquisitoren schwere Gewichte an den Beinen einiger rebellischer Offiziere, die danach ebenfalls in die Höhe gehievt wurden. Unter grässlichem Geschrei rissen ihre Gliedmaßen ab und fielen als blutige Keulen aufs Deck. Andere Aufrührer wurden mit dünnen Seilen festgebunden, die immer strammer angezogen wurden, worauf sich die Seile ins Fleisch gruben und es bis auf die Knochen einschnitten. Den Mitläufern unter den Meuterern wurde ein Tuch über Nase und Mund gelegt, das mit Wasser übergossen wurde, woraufhin sie in äußerster Atemnot schreiend um Vergebung baten. Oder ihnen wurden die Fußsohlen mit Salz eingerieben, woraufhin ein gefangenes Lama ihnen stundenlang die Fußsohlen leckte, bis sich die Haut auflöste. Der Anführer des Aufstandes wurde geköpft; sein Körper wurde gevierteilt; danach ließ Magellan die Überreste auf Speere aufspießen und zur Schau stellen. Nach diesen Folterungen schlugen es sich doch alle Besatzungsmitglieder aus dem Kopf, sich gegen den Kapitän zu verschwören.
Über Schiffbruch. Über tanzende Riesen. Über Freundschaft und Gefangenschaft.
Den Winter verbrachten wir auf dem 49. Breitengrad, fischend und jagend in einer Bucht, die wir »Hafen von San Julian« nannten. Wir reparierten unsere Schiffe. Doch noch war das Elend nicht ausgestanden. Bei der Erkundung der Südküste erlitt die Santiago in einem Sturm Schiffbruch. Die vierunddreißig Überlebenden kehrten auf dem Landweg zu uns zurück.
Nachdem wir zwei Monate in der Bucht vor Anker gelegen hatten, tauchte ein Riese am Strand auf. Er war nackt, und sein Gesicht war rot bemalt. Er tanzte, sang und streute sich selbst Sand auf den Kopf. Eines der Besatzungsmitglieder ruderte an den Strand und tanzte mit ihm mit. Der Riese, der fast doppelt so groß war wie wir, ließ sich zu unserem Kapitän Magellan führen, der ihm zu essen und zu trinken gab. Als unser Kapitän ihm einen Spiegel vorhielt, sprang der Riese vor Schreck zurück.
Wir schlossen Freundschaft mit den Riesen und gingen in den folgenden Tagen mit ihnen auf die Jagd. Auf einer Insel fingen wir fette schwarzweiße Gänse, die nicht fliegen konnten und nur Fisch fraßen. Auch das Lamafleisch hat uns gut geschmeckt. Wir lernten etwas über die Sprache und die Bräuche der Riesen. Scachet bedeutete beispielsweise »Penis«, isse »Vagina« und iohoi die Vereinigung von Mann und Frau. Magellan schenkte den Riesen einen Rosenkranz und taufte sie, nach den spanischen Hunden mit den großen Füßen, Pathagonier.
Wir luden zwei Riesen auf das Schiff ein und gaben ihnen Schiffszwieback und lebendige Ratten zu essen. Als Präsente schenkten wir ihnen eiserne Bänder um Hand- und Fußgelenke, die sie freudig annahmen. Als sie kurz einmal nicht aufpassten, ketteten wir sie an. Damit hatten die Freundlichkeiten ein Ende. Die beiden Riesen entkamen und griffen uns vom Ufer aus mit giftigen Pfeilen an. Einer traf einen Matrosen in den Oberschenkel, woraufhin dieser qualvoll starb. Als Rache brannten wir ihr Dorf nieder.
Über eine Öffnung und ein Kap. Über ein Labyrinth aus Wasser. Über ein desertierendes Schiff.
Am Sankt-Ursula-Tag des Jahres 1520 fuhren wir wieder los. Unsere Vorräte hatten wir mit Trockenfisch aufgefüllt. Der Frühling brach an, die Stürme ließen nach, und wir fuhren an der Küste entlang, immer tiefer nach Süden. Auf Höhe des 52. Breitengrades sahen wir eine Einbuchtung, aus der ein kräftiger Wasserstrom floss. Das Wasser tobte. Auf der rechten Seite sah ich eine Sandbank mit Walgerippen. Der Geruch der verrottenden Tiere versprach dieses Mal etwas Gutes; die Öffnung könnte der Anfang oder das Ende einer Wanderroute der Tiere sein. Der vorspringenden Landspitze, die die Bucht markierte, gaben wir den Namen Kap der Elftausend Jungfrauen.
Wir nahmen Kurs auf die Bucht, die sich bald zu einem schmalen Durchlass verengte. Magellan bat einen Freiwilligen, einen Hügel zu besteigen, um einen Blick auf das Hinterland zu werfen. Ich meldete mich, aber ein älteres Besatzungsmitglied erhielt den Vorzug. Er kam mit der Nachricht zurück, dass das Wasser im felsigen Hochland versandete. Das war ein Rückschlag, doch Magellan wollte sich damit noch nicht abfinden, das Wasser schmeckte nach wie vor salzig. Ich durfte mit der Concepcion und der San Antonio mit auf Erkundungstour fahren.
Auf den ersten Durchlass folgten erneut eine Erweiterung und ein zweiter Engpass. Danach glich das Hinterland einer geborstenen Tonkugel. Zwischen den Bergen schlängelten sich zahlreiche Wasserläufe hindurch. Die Welt war ein Labyrinth. Immer wieder wählten wir einen neuen Wasserweg. Manchmal endete der Einschnitt in einer Sackgasse, dann wieder in einem Durchlass. Das Senkblei, die Strömung und der Salzgeschmack wiesen uns den Weg. Ein Ende fanden wir nicht. Es musste eine Passage geben, dachten wir. Nach fünf Tagen kehrten wir zu Magellan zurück, der mit der Trinidad und der Victoria auf uns wartete. Ich ließ die Flaggen aufziehen und feuerte mehrere Festsalven aus einer der Kanonen ab.
Unsere vier Schiffe richteten nun den Bug gen Westen, und wir fuhren in die Meerenge ein. Tastend suchten wir unseren Weg durch das Labyrinth aus Inseln, Schluchten, Kanälen, Fjorden, Gletschern und Bergen. Das Lot sank immer weit in die Tiefe hinab. Das Seegras, das sich in unseren Rudern und Leinen verhedderte, bewies, dass wir immer noch auf See waren. Die heftigen Winde, die von den Bergen herabfielen, erschwerten das Navigieren. Manchmal kamen wir kaum gegen die starke Strömung an. In den kurzen Nächten verdeckten die Wolken die Sterne.





























