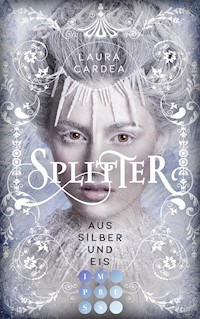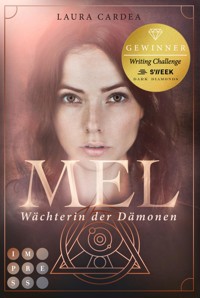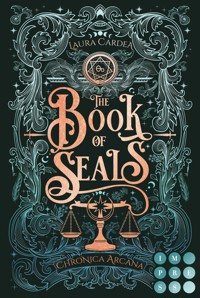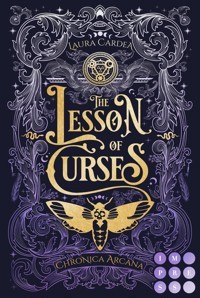9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Paris an der Schwelle zum 20. Jahrhundert: Während die Welt um sie im Wandel ist, stürzt sich die mittellose Odette als Mann verkleidet ins rauschhafte Pariser Nachtleben, wo sie ihre magischen Fähigkeiten entdeckt. Sie gehört zu einer kleinen Gruppe von Menschen mit nachtbezogenen Fähigkeiten, der Bruderschaft der Nachtschwärmer. Mehr noch, sie ist nicht nur die einzige Frau in diesem Männerbund, sondern auch die Einzige, die das Licht und nicht die Dunkelheit beherrscht. Gemeinsam mit dem reichen Schattenspringer Eugène kämpft sie gegen einen Orden, der es auf ihre Fähigkeit und Familie abgesehen hat – und für eine Liebe ohne Standesschranken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
Paris an der Schwelle zum 20. Jahrhundert: Während die Welt um sie im Wandel ist, stürzt sich die mittellose Odette als Mann verkleidet ins rauschhafte Pariser Nachtleben, wo sie ihre magische Kraft entdeckt. Sie gehört zu einer kleinen Gruppe von Menschen mit nachtbezogenen Fähigkeiten, der Bruderschaft der Nachtschwärmer. Mehr noch, sie ist nicht nur die einzige Frau in diesem Männerbund, sondern auch die Einzige, die das Licht und nicht die Dunkelheit beherrscht. Gemeinsam mit dem reichen Schattenspringer Eugène kämpft sie gegen einen Orden, der es auf ihre Fähigkeit und Familie abgesehen hat – und für eine Liebe ohne Standesschranken.
Liebe*r Leser*in,
wenn du traumatisierende Erfahrungen gemacht hast,
können einige Passagen in diesem Buch triggernd wirken.
Sollte es dir damit nicht gut gehen, sprich mit einer Person
deines Vertrauens. Auch hier kannst du Hilfe finden:
www.nummergegenkummer.de
Schau gern hinten nach, dort findest du eine Auflistung
der potenziell triggernden Themen in diesem Buch.
(Um keinem*r Leser*in etwas zu spoilern,
steht der Hinweis hinten im Buch.)
Für alle, die öfter die Nacht auskosten möchten.
Egal, ob zum Feiern, Schlafen oder Rebellieren.
Lasst sie euch nie nehmen.
Kapitel 1
Seit drei Jahren komme ich nach Hause, wenn meine Familie morgens aufsteht. Manchmal – so wie heute – bin ich so spät, dass mir in den dunstigen Gassen bereits die ersten Arbeiter entgegenkommen. Schlachter, Fabrikarbeiter, Tagelöhner, die Ärmsten der Armen. Ihr Tag beginnt, wenn die Menschen aus der reichen Bourgeoisie nach ihren ausschweifenden Nächten schlafen gehen. Niemand beachtet mich, weil ich längst meine Verkleidung gegen das von Mama geerbte Baumwollkleid getauscht habe, das schon nicht en vogue war, als sie es 1890 gekauft hat. Während ich versuche, den zerfetzten Rocksaum aus den Pfützen herauszuhalten, bin ich wieder eine von ihnen.
Nach einer Nacht mit viel schwerem Wein, blumigem Eau de Parfum und dem Duft nach Ausgelassenheit muss ich mich zusammenreißen, mir nicht die Nase zuzuhalten. Sind alle anderen gegen den Gestank aus den Fabrikschlöten und mangelhaften Abwasserkanälen immun? Eigentlich dürfte mich das nicht wundern. Die Regierung von Paris zählt unseren Häuserblock im Arrondissement L’Hadès nicht grundlos zu den heruntergekommenen îlots insalubres. In den windschiefen Baracken, die Handwerker vor Jahrzehnten ohne Stadtplanung und fließendes Wasser zusammengezimmert haben, sollte heute niemand mehr wohnen.
Und doch erklimme ich die schmale Treppe genau so eines Hauses, das am Rande von L’Hadès kauert. Früher habe ich versucht, die knarzende Tür zu unserem Appartement leise zu öffnen. Doch wie immer in den letzten Wochen schallt Papas Husten bis auf den Flur. Dem Lärm meiner kleinen Geschwister nach zu urteilen, war sein Anfall heute wieder heftig genug, um sie noch vor Morgengrauen zu wecken. Und tatsächlich, ich schließe die Tür auf, und mein Bruder Henri fällt mir fertig angezogen und halbwegs gekämmt in die Arme. Mit elf ist er ein wenig zu alt für diese Anhänglichkeit, und vor seinen Freunden würde er sich nie so zeigen. Doch ich bin froh, dass er die Zuneigung noch nicht gegen jugendliche Gleichgültigkeit ausgetauscht hat.
Ich umarme ihn fest, bis seine Füße vom Boden abheben. »Hast du deine Schulaufgaben erledigt?«
Henri stöhnt und windet sich aus meiner Umarmung. »Natürlich, Oberlehrerin Odette!«
»Nicht so frech!« Ich schließe die Tür und nehme dann Mamas Topf mit gefährlich brodelndem Haferschleim vom Herd, während sie versucht, meine kleine Schwester Joséphine in ihr Kleid zu zwängen. Ich knie mich neben sie, um sie im Kampf gegen die mit Wuttränen übergossene Jo zu unterstützen. Für ein sechsjähriges Mädchen entwickelt sie erstaunliche Kräfte, wenn es darum geht, sich gegen ihre Kleider zu wehren. »Sagt Henri die Wahrheit?«, flüstere ich Mama zu.
»Mathilde hat die Aufgaben kontrolliert.« Sie deutet mit dem Kinn auf die Zweitälteste von uns Geschwistern. Dann streicht sie eine dunkle Strähne, die sich aus ihrem notdürftigen Haarknoten gelöst hat, aus ihrem schmalen, immer sonnengeküssten Gesicht. »Glaube ich«, fügt sie ein wenig entschuldigend hinzu.
»Mama«, stöhne ich und richte mich auf, doch sie beachtet mich schon nicht mehr. Henri muss gute Noten bekommen. Meine Familie kann von fünf Geschwistern nur einen zur Université schicken. Und bei vier Mädchen und einem Jungen stellt sich die Frage nicht, auf wen die Wahl fällt. Für uns Schwestern ist das in Ordnung, denn Henri wird uns versorgen, wenn Papa … Ich kneife mir in den Unterarm. Nicht jetzt.
Ich geselle mich zu Mathilde, die wie immer in ihrer eigenen Welt lebt und, in die Ferne starrend, einen Apfel wäscht. Er glänzt so sehr, dass sie ihn sicherlich seit mehreren Minuten bearbeitet. Sanft streiche ich über ihre kastanienbraunen Locken, die so wie ihre Haut und ihre seegrünen Augen ein paar Nuancen heller sind als meine. Ich ernte ein verträumtes Lächeln und schneide die bereits gewaschenen Äpfel in Schnitze. »Mama sagt, du hast Henri beim Lernen geholfen?«
»Du siehst müde aus«, bemerkt sie stirnrunzelnd. Als ich nicht darauf eingehe, seufzt sie. »Ihm und Juliette. Nur dass Juliette meine Hilfe gar nicht braucht. Ehrlich, das Mädchen könnte man vor ihre Rechenaufgaben setzen, bis sie ein Loch in ihre Schiefertafel schreibt.«
»Und dann würde sie auf dem Tisch weiterschreiben«, ergänze ich trocken. Einen Wimpernschlag später hängen wir kichernd über den geschnittenen Äpfeln.
Wir sprechen nicht aus, dass Juliette intelligenter ist als Henri. Dass Juliette zur Université gehen sollte. Obwohl Mädchen dort mittlerweile zugelassen werden – wenn auch mit großem Widerwillen und noch größeren Hürden –, ist das nur wenigen aus Akademikerfamilien vorbehalten. Denen, deren Väter ihre Bildung fördern. Ein Mädchen aus unseren Verhältnissen würde zwischen den schnöseligen Kerlen aus der Bourgeoisie nicht eine Woche überstehen. Und selbst wenn sie einen Abschluss einsackt – Geld verdienen könnte sie damit nicht.
Mama deckt nun mit Mathilde und Juliette den Tisch, während Henri sich ein Herz fasst und unser Nesthäkchen Jo bespaßt. Weil endlich etwas Ruhe einkehrt und nichts mehr anbrennen kann, schlängle ich mich zwischen den ungemachten Betten von Jo, Henri und Juliette entlang zur winzigen Kammer, in die meine Eltern ihre Schlafstätte verlegt haben, um Papas Anfälle abzudämpfen. Doch schon vor der Tür erschüttert Papas Husten meine Knochen. Kurz presse ich die Augen zu und kämpfe gegen den Drang, umzukehren. Dann trete ich ein.
Papa klemmt die Hosenträger an seine Arbeitshose, die in den letzten Monaten immer mehr schlackert. Seit ich denken kann, war er ein drahtiger, aber robuster Mann. Unser Beschützer. Vor der Fragilität, die sich in seinen Körper schleicht, würde ich am liebsten die Augen verschließen. Doch das darf ich nicht. Ich fische seine Schieberkappe vom Holzschrank und halte sie ihm hin. »Warst du gestern endlich in der Pharmacie?«
Er schnaubt verächtlich. Ausweichend. Dann folgt trockener Husten, und rote Flecken erblühen in seinem fahlen Gesicht. Jahrelang habe ich ihm gepredigt, er solle sich eine bessere Arbeit als in der Papierfabrik mit all den chemischen Dämpfen suchen. Dafür ist es jetzt zu spät. Niemand stellt jemanden ein, der so krank ist.
Ich balle die Hände, doch zwinge mich, ruhig zu bleiben. Zu oft sind wir deswegen schon aneinandergeraten. »Hol zumindest eine Mentholsalbe von Madame Bouchard.« Meine Stimme schwankt zwischen Befehl und Flehen.
»Die beste Salbe bringt mir nichts, wenn uns wegen ihr das Geld für Essen ausgeht.«
Ich zerre eine Handvoll Francs aus der verborgenen Tasche meines Rocks, von denen ich Jo ein neues Paar Stiefel kaufen wollte. Sie wird Juliettes alte Bottines mit dicken Socken tragen müssen.
Bevor ich Papa jedoch das Geld geben kann, schiebt er meine Hände fort. In seine sanften Augen schleicht sich Argwohn. »Odette, ich habe dir vor Jahren versprochen, nicht zu fragen, woher das Geld kommt.« Er verzieht gequält das Gesicht, und ich weiß, worauf er hinauswill. »Aber falls du –«
»Ich mache nichts dergleichen«, versichere ich ihm, auch wenn sein Gedanke nicht weit hergeholt ist. Einige meiner Freundinnen aus der Schulzeit verdienen sich nachts auf den Straßen etwas dazu. Ich verurteile sie nicht – es fehlt nicht viel, und ich müsste auf die gleichen Mittel zurückgreifen. Gänsehaut prickelt über meine Arme, und ich dränge den Gedanken beiseite. »Weißt du was? Ich kaufe eine Salbe für dich. Du tust es ja eh nicht.« Bevor er widersprechen kann, hebe ich die Hand. »Du sagst immer, mit dem Geld, das ich verdiene, kann ich machen, was ich will.« Triumphierend grinse ich ihn an.
Das Gehalt von Frauen in ehrenwerten Berufen, wie Mamas und Mathildes in Madame Carbonnes Hutmacherei, geht direkt auf das Konto ihres Mannes oder Vaters. Dass ich mein Gehalt entgegen dieser Konvention selbst ausgezahlt bekomme, ist für Papa ein weiterer Grund zur Sorge.
Aber schließlich ist auch alles andere an meiner Arbeit unüblich.
Papa deutet mit dem Finger auf mich. »Meine grauen Haare habe ich wegen dir!«, schilt er mit einem Lachen.
»Wenn ich Ende dreißig bin, werde ich garantiert genauso graues Haar haben – wegen dir.« Ich hake mich bei ihm unter und gemeinsam betreten wir die Stube.
Sobald alle fort sind, räume ich unser Appartement auf. Ich schrubbe Töpfe und Tische, mache die eng stehenden Betten und versuche, mich im Kämmerchen, das Mathilde und ich uns als älteste Geschwister teilen, nicht in mein Bett fallen zu lassen. Ich habe noch einiges zu erledigen, bevor ich endlich schlafen kann.
Mit einem Weidenkorb unter dem Arm verlasse ich das Appartement, um zuerst Madame Bouchard aufzusuchen. Sie wohnt allein im spitz zulaufenden Eckhaus am Ende unserer Gasse, wo sie das Ladenlokal im Erdgeschoss und das Dachgeschoss-Appartement darüber mietet. Ich weiß nur wenig über ihre Vergangenheit. Vage Gerüchte darüber, wie sie als Kind mit ihrer Familie von Nigeria nach Boston und als junge Frau nach Paris kam. Und natürlich weiß jeder von ihrem sehr jung verstorbenen Mann. Doch woher sie ihre Kenntnisse der Chemie hat, dank der sie Medikamente für all diejenigen herstellt, die sich Docteurs und Pharmaciens nicht leisten können, entzieht sich mir. Schon vor der Tür rieche ich die bitteren Ausdünstungen dieser Medizin. Und sobald ich den spärlich eingerichteten Laden betrete, in dessen Mitte Madame Bouchard Kräuter mörsert, muss ich durch den Mund atmen.
Eine Gaslampe schenkt dem satten Dunkelbraun von Madame Bouchards Haut einen goldenen Schimmer, der mit den schweren Goldohrringen konkurriert.
»Dein Vater?«, fragt sie, ohne von ihrer Arbeit aufzuschauen, die sie immer mit dieser Akribie und Zweckmäßigkeit angeht, der ich stundenlang zusehen könnte. Ihre tiefe Stimme hebt sich von dem Blubbern ab, das ihre Apparaturen aus Glaskolben, Bunsenbrennern, Thermometern und andere Gerätschaften ausstoßen, mit denen sie mich als Kind ab und zu hat herumhantieren lassen. Bevor ich wusste, wie teuer all das ist.
Mit einem wehmütigen Blick auf ihr Laboratoire manövriere ich mich näher zu Madame Bouchard. »Er braucht etwas für seinen –«
»Husten«, unterbricht sie mich mit einem Schwenk ihrer Hand. »Glaub mir, jeder in der Straße kann ihn hören. Du weißt, dass meine Salbe ihn nicht heilen kann, sie –«
»– mildert nur die Symptome«, ergänze ich mit Singsang-Stimme, was sie mir jedes Mal predigt.
Endlich kann sich Madame Bouchard von ihrer Arbeit losreißen und blickt mit zuckenden Mundwinkeln auf. »Du hattest schon immer ein viel zu loses Mundwerk. Hat dich das noch nicht oft genug in die Bredouille gebracht?« Sie steht auf und kramt in einem Apothekerschrank mit Dutzenden Fächern herum.
»Ich weiß, mit wem ich offen sprechen kann.« In der Schule habe ich nie wie Henri oder Juliette Ärger bekommen, die bei Papas milder, etwas eigentümlicher Art nie Zurückhaltung gelernt haben. Ich hingegen bin eine Meisterin darin, meine spitzen Bemerkungen einzudämmen, ohne zu platzen. Es reicht, mir meinen Teil zu denken, ich muss andere nicht mit meinen Gedanken vor den Kopf stoßen. Vielleicht weil ich weiß, dass eine scharfe Zunge und konträre Meinung niemanden zum Umdenken bringen. Nicht, wenn sie von einem Mädchen wie mir kommen.
Madame Bouchard stellt einen Zinntiegel auf den Tisch. »Vier Franc.«
»Beim letzten Mal waren es drei«, entgegne ich durch zusammengepresste Zähne.
Sie zuckt die Schultern. »Das Leben wird für uns alle teurer. Ich hab dir schon einen Rabatt gegeben, weil ich dich mag.«
Unschlüssig fingere ich an den Münzen in meiner Tasche herum. Falls Papa wegen des Hustens nicht mehr arbeiten kann, verlieren wir auf lange Sicht noch mehr Geld. Doch vier Franc weniger, und heute Abend wird niemand von uns satt.
Madame Bouchard seufzt. »Drei Franc, und du nimmst meine Blusen zum Flicken mit. Aber gib sie Mathilde oder meinetwegen Juliette. Hauptsache, du näherst dich ihnen nicht mit Nadel und Faden. Madame Carbonne konnte eine geschlagene Woche lang über nichts anderes reden, als dass sie dir nach deinem ersten Tag in ihrer Hutmacherei einen Franc mehr als üblich gezahlt hat. Damit du nie wieder einen Fuß in ihr Geschäft setzt.«
Ich schiebe ihr die Münzen zu. »Merci beaucoup, Madame Bouchard«, flüstere ich mit belegter Stimme.
Das ist der Unterschied zum Leben der Oberschicht mit all dem Parfum, Reichtum und den Bällen. Egal, wie arm wir sind, egal, wie hungrig, wir können auf unsere Nachbarn zählen, wenn es besonders eng wird. Denn jeder weiß, nur wenige Tage später könnte man selbst in den Schuhen der anderen stecken. Verliert eine Familie der Bourgeoisie ihren Reichtum, schauen ihre Nachbarn sie nicht mal mit dem gepuderten Hinterteil an.
Die Salbe und die Blusen wandern in meinen Beutel, und ich verabschiede mich. Vor der Tür treffe ich Pauline, die ebenfalls zum Markt geht. Früher war sie meine beste Freundin. Aber seit ich Louise d’Amboise kenne, merke ich, wie selten mich die Gespräche mit Pauline zum Lachen bringen – und wie sehr sie mich an die aussichtslose Lage erinnern, in der wir stecken.
Mit Louise, in der Nacht, ist das anders.
Unsere Freundschaft, die seit drei Jahren besteht, ändert natürlich nichts an meiner Situation. Doch sie gibt mir zumindest manchmal das Gefühl von Veränderung.
Pauline verbirgt ihr strohblondes Haar unter einer Haube, und ich schicke ein Stoßgebet gen Himmel, dass sie damit keine Läuse verbergen will. Diese Woche haben wir wirklich kein Geld für eine weitere von Madame Bouchards Tinkturen, vor allem nicht, wenn sie für sechs Köpfe reichen muss. Doch Pauline hüpft strahlend auf mich zu und reckt mir eine Hand entgegen. Ein einfacher, etwas krummer, offensichtlich selbst geschlagener Goldring ziert ihren Ringfinger.
»Es ist offiziell! Papa hat Fernand seinen Segen gegeben!«
Ich muss lächeln und vergesse kurzzeitig meine Sorgen. Das wünscht sich Pauline, seit sie Fernand das erste Mal in der Schule gesehen hat.
»Wie wundervoll!«, rufe ich und ergreife ihre Hände. Der simple Ring an ihrem Finger ist kühl und schwer. Eine Vermählung ist ebenfalls ein Weg zu einer etwas sichereren Zukunft. Gut für Pauline. »Ich freue mich so für dich!« Ich schlucke den bitteren Beigeschmack herunter, der mir jedes Mal den Rachen verätzt, wenn ich darüber nachdenke, dass die Sicherheit eines Mädchens immer von einem Mann abhängt. Väter, Brüder, Ehemänner. Klammere ich mich deswegen so an Louise und unsere nächtlichen Eskapaden, auch wenn sie irgendwann enden müssen? Solange ich meine Familie selbst beschützen kann, bin ich wohl nicht bereit, ihre Sicherheit in die Hände eines Ehemanns zu legen. Doch ich darf mich nicht in dieses heiße Wüten in meinem Magen hineinsteigern. Also verscheuche ich die Gedanken, während wir durch die Avenue du Maine wandern.
Ich quetsche mich zwischen einer üppigen Madame und einer Kutsche hindurch, die den Eingang zum Marktplatz mit den aneinandergedrängten Ständen versperren. Sofort schlägt mir der Mief aus Pferdedung und fauligem Fisch in Zinneimern entgegen. Gemischt mit säuerlichen Ausdünstungen ungewaschener Menschen sickern sie mir in meine Nase. Immerhin vergeht mir so der Hunger.
Pauline plappert vom Hochzeitsmenü, Filet mignon, Sauce béarnaise und Soufflé, während wir uns durch die Marktbesucher schieben. Ich laufe in sie hinein, weil sie ohne Vorwarnung anhält. Sofort zieht sie mich weiter, schneller als zuvor. »Sieh bloß nicht hin!«
Ein Arbeiter wankt auf einem Stapel Gemüsekisten und schreit über die Köpfe der Menschen hinweg. Er trägt die Arbeitskleidung der Papierfabrik. Wie Papa. Obwohl sein Kopf vom Brüllen immer röter anläuft, wehen über das Getöse der Käufer und Marktschreier nur Wortfetzen zu mir herüber. Arbeiterrechte, Krankheit und Ausbeutung.
Drei Gendarmen kämpfen sich zu ihm durch und treffen zeitgleich mit Pauline und mir bei ihm ein. Sie zerren ihn von seiner Bühne. Er wehrt sich mit Händen und Füßen, doch sie zwingen ihn erbarmungslos mit Schlagstöcken auf die Knie.
Pauline senkt den Kopf, und ich sollte es ihr gleichtun.
Der Mann hört nicht auf. Zwischen seinen schützend erhobenen Armen und den auf ihn einprasselnden Schlagstöcken speit er Flüche hervor. Er hat die gleichen ausgehöhlten Wangen und kränklichen Schatten unter den Augen wie Papa.
Ein Glück, dass er nichts dergleichen versucht.
Der Mann bemerkt meinen Blick, und bei jedem Wort fliegt Spucke aus seinem Mund. »Sie rauben uns nicht nur die Würde, die Gesundheit, das Essen, den Lebenssinn – sie machen vor nichts halt!« Er streckt seine Arme nach mir aus, erinnert mich in seiner Intensität an die Jesusbilder in unserer Kirche. »Sie werden uns die Nacht rauben! Was ihnen so heilig ist, werden sie entweihen!«
»Armer Kerl.« Pauline schiebt mich in die nächste Menschentraube, wo Gelächter und das Feilschen der Händler die Worte des Mannes übertönen. Doch seine Schmerzensschreie finden noch den Weg in meine Ohren, während sich Pauline mit leicht erhobener Nase das frischeste Gemüse reichen lässt, das sie finden kann. Sie spielt sich auf, als gehörte ihr nach der Hochzeit ein Château. Dabei zieht sie nur in Fernands Appartement, das ein zusätzliches Zimmer mehr hat, aber ebenso schäbig wie ihres ist.
Ich kommentiere ihr Betragen jedoch nicht, während ich schrumpelige Petersilienwurzeln und laschen Kohl in meinen Korb packe. Solche schönen Momente erleben wir so selten, dass ich es nicht übers Herz bringen würde, ihn ihr zu verderben. Also nicke ich zu allem nur lächelnd, ohne ihr richtig zuzuhören.
Pauline stemmt die Arme in die Hüften. »Odette Leclair, wie lange willst du noch darüber brüten, was dieser Mann von sich gegeben hat? Er ist verrückt, mehr nicht.«
»Verrückt oder –?« Ich presse die Lippen aufeinander. Pauline schwärmt sowieso schon wieder von ihrem Hochzeitsmenü. Verrückt – oder mutig? Langsam schüttle ich den Kopf, mehr über mich selbst als über ihn. Denn jede Auflehnung verschlimmert die Situation nur. Ich brauche dringend Schlaf. Nur deshalb kommen mir solche Gedanken. Doch mein Herz schlägt den ganzen Weg nach Hause über schwer in meiner Brust. Es zerrt mich in Richtung einer unsichtbaren Tür, hinter der etwas liegt, auf das der Mann mich nur flüchtige Blicke werfen ließ.
In unserem Appartement verstaue ich den Einkauf im winzigen Kellerloch. Ich sollte Mama ein wenig zur Hand gehen und die Erde aus dem Kohl waschen. Aber Müdigkeit übermannt mich im Halbdunkeln, da dank der eng gebauten, mehrstöckigen Häuser nie wirklich Tageslicht in unser Appartement fällt. Louise hasst es, wenn ich nicht bei der Sache bin, also sollte ich bis zum Abend Schlaf nachholen.
Denn wenn ich in der Dunkelheit erwache, beginnt mein anderes Leben.
Kapitel 2
Von uns aus gibt es keine direkte Verbindung zum Hôtel d’Amboise, dem Stadthaus von Louise’ Familie. Also muss ich eine Weile durch die klammen Gassen streifen, die so eng und hoch sind, dass sie vom Sternenhimmel nur ein schmales Band übrig lassen. So stelle ich mir den Ausblick aus einem frisch geschaufelten Grab vor. Wie passend für L’Hadès. Zwanzig griechische Götter mussten sie bei der Benennung der Arrondissements verteilen. Natürlich weiß ich, dass sie den Gott der Unterwelt wegen des hier befindlichen Haupteingangs zu den Catacombes für uns gewählt haben, nicht weil L’Hadès wortwörtlich die Hölle ist. Aber nun, wenn der Schuh passt …
Gerade noch rechtzeitig erreiche ich den pferdegezogenen Omnibus meiner üblichen Linie, die garantiert bald einem motorisierten Omnibus oder gleich einer Tram des rasant wachsenden Schienennetzes weichen muss. Die Rösser traben los, und ich schwinge mich auf den schmalen Stieg, um mein Fahrgeld zu zahlen. Die steile Neigung der Straßen zaubert dieses Flattern in meinen Magen, das mich in die aufgedrehtere, leichtfertigere Odette verwandelt, die nachts verkleidet durch die Straßen flaniert. Seit drei Jahren. Doch wie lange noch?
Sobald wir durch L’Héra rattern, weiten sich die Gassen zu schicken Boulevards, gesäumt von Ministerien und Botschaften – und den repräsentativen Hôtels particuliers der adeligen und reichsten Pariser. An der Kreuzung des Boulevard Saint-Germain steige ich aus und wandere die Rue de Lille bis zum mit Marmorstuck verzierten Hôtel d’Amboise herab. Es könnte als mein zweites Zuhause durchgehen. Nun, wenn Louise mich nicht durch den Dienstboteneingang hereinlassen müsste. Ich bin keine ihrer Freundinnen, die sie zum Tee einlädt.
Doch wie jeden Abend, sobald ich in unserem geheimen Rhythmus klopfe, öffnet sie grinsend die Tür. »Da bist du ja endlich!«
Louise zerrt mich hinein und schiebt mich durch die Waschküche und Flure. Sie trägt bereits eine feine Abendrobe aus Organza, die direkt aus der neuesten Ausgabe von L’Art et la mode über die schickliche Kleiderwahl für den Morgen, den Abend, die Oper und den Landausflug stammen könnte. Dazu ihr blondes Haar auftoupiert, wie es in Mode ist, um alberne Hüte darauf festzustecken. Albern trifft auch ihr Verhalten gut – albern, kokett, aber gutmütig. Ein Mädchen, das man nicht hassen kann, obwohl es mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde und das mit jeder theatralischen Handbewegung demonstriert. Doch irgendetwas ist anders als sonst. Lebhaft ist sie immer, jedoch nie so aufgekratzt. »Ab ins Bad mit dir! Das Wasser ist fast kalt.«
»Ins Bad?« Ich stemme mich gegen sie. Noch nie hat sie verlangt, dass ich mich wasche, bevor ich mich in ihren Cousin verwandle. »Louise, was hast du vor?«
Sie greift sich an die Brust. »Einst rettete ich dich vor dem tristen Schicksal eines unserer einfachen Küchenmädchen. Als ich dich dabei ertappte, wie du Kleidung aus der Waschküche stehlen wolltest, zeigte ich Erbarmen.« Sie streicht sich eine unsichtbare Träne weg. »So arm und unterkühlt, dass dich auch der hässlichste Männer-Manteau in deinen Händen zu Glückstränen rührte.«
»Louise, du weißt, du hast mich nicht vor dem Kältetod gerettet. Ich hatte genug Kleider. Ich wollte mich nur als Junge verkleiden, um eine bessere Arbeit zu suchen.« Ich stemme die Arme in die Hüften. »Und du hast mir nicht aus Gutmütigkeit Erbarmen gezeigt. Du hast ein Auge bei meinem Verbrechen zugedrückt, weil ich dich bei etwas ebenso Verbotenem erwischt habe. Wie du dich nachts mit nur fünfzehn Jahren aus dem Haus schleichen wolltest, ohne Anstandsdame oder männliche Begleitung.«
Louise seufzt mit wogender Brust. »Der Beginn einer wunderschönen Freundschaft.« Dann schiebt sie mich beherzt und völlig ungerührt weiter. »Und einer Übereinkunft, die für uns beide von Vorteil war.«
Ich stolpere ins Badezimmer und vergesse alles. Fließendes Wasser aus bronzenen Wasserhähnen! Direkt im Haus, nicht wie bei uns aus Gemeinschaftsbrunnen in Innenhöfen. Mitten im Bad thront eine gigantische Wanne auf Klauenfüßen, aus der Dampf aufsteigt. Bevor ich reagieren kann, hat Louise mich aus meinem Manteau geschält. Ich scheuche ihre Hände fort. »Das kann ich allein!«
Sie drückt mir Seife in die Hand. »Die Haare nicht vergessen!«
Hastig ziehe ich mich aus und lasse mich ins Wasser sinken, während Louise aus dem Bad huscht. Von wegen fast kalt! Meine Haut versengt beinahe. Mir war bewusst, dass die d’Amboises als eine der wenigen Pariser Familien ein Privatbad besitzen. Aber niemals hätte ich es mir so vorgestellt. Obwohl ich immer noch nicht weiß, was das hier soll, sinke ich tiefer ins Wasser und schrubbe mich von Kopf bis Fuß ab. Wenn ich schon in den Genuss komme, kann ich es auch ausnutzen. Mit geschlossenen Augen schäume ich die Seife in meinen Haaren auf und nehme tiefe Atemzüge voll feiner Fliedernoten. So rieche ich zum ersten Mal.
Irgendwann steige ich aus der Wanne, und erst dann kehrt Louise mit einem ihrer bauschigen Kleider in den Armen zurück. »Herzlichen Glückwunsch zum achtzehnten Geburtstag, Odette!« Sie strahlt mich an, als hätte sie Geburtstag.
Ich halte mitten im Abtrocknen inne. »Louise, das Kleid kann ich nicht in L’Hadès tragen.«
Augenrollend wirft Louise das Kleid auf einen Hocker. »Das ist nicht das ganze Geschenk, du Genie. Du sollst es heute Nacht tragen, um unsere Volljährigkeit zu feiern. Als Frau.« Louise hebt den Finger, bevor ich widersprechen kann. »Ich weiß, was du sagen willst. Aber du kannst ja wohl eine Nacht so verbringen, wie ich jede erlebe. Du wirst es nicht bereuen. Uns passiert schon nichts, so wie all die Jahre nichts passiert ist!«
Die Widerworte in mir wollen noch nicht so recht verstummen. Doch sie finden auch keinen Weg heraus. Denn sie hat an meinen Geburtstag gedacht, anders als meine Familie. Oder ich selbst. Und mich überkommt das gleiche Kribbeln wie bei meinem ersten nächtlichen Ausflug mit ihr. Ein Abenteuer wartet auf mich, wenn ich in das wunderschöne, schneeweiße Kleid aus Mousseline schlüpfe. Also stiehlt sich ein Grinsen auf meine Lippen.
»Ich wusste, du würdest dich freuen!«, jauchzt Louise, während sie ein neumodisches Haareisen aufheizt, das noch gar nicht in den Läden erhältlich ist und eine Erfindung ihres Vaters sein muss.
Ich streife mir das Kleid über, und sein Mousseline – natürlich nicht aus Wolle, sondern aus Seide gewebt – fließt weich und erlesen über meine Haut. »Kann ich das Kleid verkaufen, wenn wir fertig sind?«
Sie kämmt meine kurzen Locken und schnalzt mit der Zunge. »Nichts anderes habe ich erwartet. Aber vielleicht wartest du mit dem Verkaufen, bis du sicher bist, dass du kein weiteres Mal als Odette die Nacht durchtanzen willst.«
Die Nachtluft fühlt sich anders an in diesem Kleid. Ich fühle mich anders an. Unser Omnibus rattert über die gerade erst für die Exposition Universelle de 1900 erbaute Pont Alexandre III, die sich unter dem wachen Blick von vier Goldstatuen der Göttin Fama über die glitzernde Seine spannt. Im Nachtglanz könnte ich schwören, alle vier Frauenstatuen, die geflügelte Pferde zügeln, zwinkern mir wissend zu.
Immerhin muss ich nicht wie Louise einen gigantischen Hut festhalten, den der Fahrtwind sonst mit sich reißen würde. Keine ihrer Dutzenden Kopfbedeckungen konnte sie an meinen schwarzen Locken festmachen, die ich mir für meine Verkleidung als junger Monsieur kinnlang geschnitten habe. Stattdessen hat Louise sie mit Blumenschmuck nach hinten gesteckt, zu einer Illusion langer Haare.
Louise zappelt auf ihrem Platz herum, unruhiger als ich, und ihr Lächeln schwindet keine einzige Sekunde. Das hier ist genau ihre Vorstellung von Spaß. Dunkelheit, Geheimnisse und Verheißung. Wie immer spiele ich mit, weil wir beide von unserem Arrangement profitieren. Sie bezahlt mich selten mit Geld. Um nicht aufzufallen, steckt sie mir Ohrringe zu, die sie bei Nachfragen als verloren meldet, oder Silberbesteck und anderen Tand, dessen Fehlen niemand bemerkt. Ihren Eltern spielt sie das Schusselchen perfekt vor. Ich weiß, sie ist alles andere als das.
Und Louise ist der zweite Grund, warum ich mitspiele. Mit ihr ist alles so leicht und gleichzeitig aufregend. Mit ihr vergesse ich für ein paar Stunden alle Sorgen.
Ausgerechnet auf den rappelvollen Champs-Élysées steigen wir aus, wobei wir mehrmals beinahe von anderen Omnibussen und Kutschen umgefahren werden. Im Gedränge entgeht mir fast, dass Louise eine andere Mademoiselle begrüßt und von ihr zwei anscheinend handgeschriebene Eintrittskarten entgegennimmt.
Ich ringe meine Hände. »Louise, wohin fahren wir?«
»Ein Geheimnis«, flüstert Louise verschwörerisch und bugsiert mich in den nächsten Omnibus, bevor ich die Augen rollen kann. Dann jagen wir durch die breite Rue de Rivoli mit ihren gewaltigen Arkaden und Ladenfronten, flankiert von dampfbetriebenen Kutschen mit mechanischen Zierpferden, die den reichsten Parisern gehören. Alles gehüllt in Dunstschwaden und das Bernsteinlicht der Straßenbeleuchtung.
Aufregung flattert im Rhythmus der flackernden Gaslaternen in meinem Brustkorb. Fahrig taste ich nach dem Anhänger meiner Kette, um zu überprüfen, ob er noch richtig liegt. Den rautenförmigen Anhänger, der Athéna in fließenden Gewändern zeigt, hat Louise mir vor Ewigkeiten als Versprechen geschenkt. Laut ihr eines ihrer schlichteren Stücke aus Glas, Emaille und einer Barockperle, von dem sie überzeugt war, ich könne es im Alltag tragen. Sie begreift nicht, dass die Kette nicht nur lächerlich mit meiner üblichen Kleidung aussieht, sondern ich zudem in ständiger Angst vor einem Raubüberfall leben müsste. Deshalb verstecke ich sie immer unter meinem Kleid. Doch heute kann ich den Anhänger vorzeigen, dieses kühle, wunderschöne Schmuckstück, das nicht zu mir oder meinem Leben passt. Ich lächle sanft. Nur heute.
An der nächsten Haltestelle springt Louise auf und zieht mich hinter sich her, die schmale Wendeltreppe des Omnibusses hinab. Wir landen mitten im Nachtleben von L’Ilithyie. Das erste, zentralste Arrondissement, nicht benannt nach einer der wichtigsten Gottheiten, sondern nach der eher untergeordneten Göttin der Geburt. Ein Zeichen, dass Paris im Herzen ein Ort der Innovation und Freiheit ist. Ich bin nicht sicher, was die Freiheit betrifft, aber die Innovation entdecke ich überall. In jedem Schaufenster, illuminiert mit Gaslicht ebenso wie dem neuartigen elektrischen Licht, in den Flaneuren mit ihren mondänen Ausgehroben und in den Musikmaschinen auf den Gehwegen. Ich ergreife die Hand meiner Freundin, als wäre dies mein erstes Mal auf der Rue de Rivoli. Nun, das ist es ja irgendwie auch. Mein erstes Mal als Odette.
Louise’ Lächeln verliert das Spitzbübische und wird sanft. »Heute Nacht dreht sich alles um dich.«
Ich bin nicht sicher, ob mir das gefällt. Denn die Lichter, der intensive Geruch aus Riechwasser und Maschinenöl, die Dutzenden Dampfmaschinen und Spielzeuge der oberen Schicht sind heute beinahe zu viel. Doch wir huschen schon in eine schmale Gasse, immer noch Hand in Hand, dann durch eine Hintertür in eines der von Baron Haussmann so akribisch geplanten noblen Reihenhäuser.
Das schwere Bouquet aus Merlot und Zigarren, verwoben mit exquisitem Eau de Parfum, hüllt mich ein. Mir wird schwindlig, weil ich nicht weiß, wohin ich zuerst sehen soll. Brokattapeten im dunklen Rot von Bordeauxwein, goldene Kronleuchter, Straußenfedern, gepolsterte Sitzgruppen und verschwenderisch befüllte Servierwagen. Der Salon, durch Marmorsäulen in verschiedene Bereiche unterteilt, wirkt obszön. So stelle ich mir das opulent dekorierte Bordell Le Chabanais vor, an dem wir ein paarmal vorbeigehuscht sind, ohne dass ich einen Blick hinein gewagt habe. Die Erzählungen über ausgefallene Zimmer, japanisch und hinduistisch, im Stile von Louis XVI. oder Pompeji reichen für eine lebhafte Vorstellung.
Das hier ist definitiv keine der gesitteten Soiréen, die wir üblicherweise besuchen.
Die tagsüber so anständigen Erben der Oberschicht fläzen ausgelassen auf den Récamièren, die Schultern zu nah an denen der anderen, die Wangen zu gerötet, die Lippen zu lasziv gespitzt. Manche tanzen zur Melodie, die von irgendwoher ertönt, ein sinnlicher Tanz, bei dem sich meine Wangen erwärmen.
»Du musst dich wohl kurz eingewöhnen.« Louise lacht bei meinem Anblick. »Möchtest du etwas essen?«
Mein Magen schlägt Saltos, doch bevor ich meine Bedenken zum Ausdruck bringen kann, winkt sie schon einen jungen Burschen heran. Nein, keinen Burschen – einen der Blechmenschen der Entreprise Machines et Mécanique Lacroix, die ich bisher nur in Schaufenstern gesehen habe. Sie kosten so viel, dass selbst Louise vor Ehrfurcht ihre Nase am Schaufenster platt gedrückt hat.
Wer bei Hadès’ Unterwelt richtet diese Feier aus?
Der Maschinenmann trägt ein goldenes Tablett, auf dem die wundervollsten Konfekte liegen. Ich starre sein Gesicht an, so kunstvoll und lebensecht gestaltet, aber vollkommen starr und aus Kupfer. Mit einem Surren reckt er mir das Tablett entgegen. Mechanisch, als wäre ich ein Maschinenmensch, greife ich ein karamellisiertes Praliné, und er stakst weiter durch die Menge. Louise drückt mir ein schmales Cordial-Glas mit beerenroter Flüssigkeit in die andere Hand, an der ich vorsichtig nippe. Zuckriger Liqueur.
Und schon zerrt sie mich weiter durch all die unwirklichen Eindrücke. Tiefer in die rauchigen, süßlichen, schummrigen Abgründe hinein. Die Melodie, so perfekt, dass sie nicht von Musikern, sondern aus einer Maschinerie stammen muss, vibriert in meinen Ohren. In meinem Herzen. Ich nehme einen weiteren Schluck Liqueur und bin bereit zu tanzen.
Als könnte Louise meine Gedanken lesen, bugsiert sie uns in die Mitte des Parketts. Die Tänzer wiegen sich eng umschlungen zur Musik, weder im gesitteten Valse der offiziellen Bälle der Bourgeoisie noch in der flotteren Polka, die ich gewohnt bin. Ich verrenke mich unsicher, meine Arme unpassend zu meinen Beinen. Ein unschicklicher, anstößiger Tanz. Aber hat man das nicht vor hundert Jahren auch über den Valse gesagt, der jetzt als erste Wahl gilt? Dank der Erkenntnis versinke ich in der ekstatischen Musik, in der Wärme der Menschen um mich herum.
Und dann blicke ich in das schönste und irritierendste Gesicht, das ich je gesehen habe. Es gehört zu einem jungen Mann, der von mehreren Frauen umringt auf einer Récamière lungert, als wäre er eine Gottheit. Sein dunkles Haar, das zu Beginn des Abends noch streng mit Pomade frisiert gewesen sein muss, ist von den Liebkosungen der Mädchen zerzaust. Seine Cravate hängt gelöst um seinen Hals, sein Hemd und das mit Edelsteinen bestückte Gilet aus schimmerndem Atlasgrund klaffen viel zu weit auseinander. Der Inbegriff eines Dandys, der sich dank des Vermögens seiner Eltern sorglos einen schönen Lenz machen kann. Er ist alles, was mich an der Bourgeoisie die Augen verdrehen lässt – dennoch kann ich meinen Blick nicht von ihm losreißen.
Er bemerkt, wie ich ihn anstarre. Seine Mundwinkel zucken, weil meine Augen vom Alkohol vermutlich glasig schimmern und er das für eine Reaktion auf seine Erscheinung hält. Gemächlich hebt er eine Hand, um mich mit einem Finger heranzulocken. Er scheint wahrhaftig zu glauben, er wäre ein Gott, der mich Sterbliche mit seinem bloßen Anblick in Trance fallen lässt. Ich schnaube, leere mein Glas in einem Schluck und wende mich augenrollend von ihm ab. Arroganter Godelureau.
Ich will Louise in ein Gespräch verwickeln – doch sie ist verschwunden.
Die Hitze meiner Haut weicht grausiger Kälte. Wo ist Louise? Mehrmals drehe ich mich um mich selbst. Was, wenn ihr etwas passiert? Ich wusste, das hier ist ein Fehler. Sobald ich mir erlaube, mich gehen zu lassen, vergesse ich alles um mich herum – und dann geschieht so etwas.
Eine Hand legt sich auf meine Schulter. Erleichtert – und fuchsteufelswild – peitsche ich zu Louise herum.
Doch vor mir steht der Godelureau mit dem offenen Hemd. Ich starre auf seine marmorblasse Haut, die zwischen dem Seidenhemd hervorblitzt und genauso makellos aussieht, wie ich mir die Haut eines reichen Erben vorstelle, der keinen Tag seines Lebens auf Feld, Marktplatz oder Fabrikgelände arbeiten musste. Ich presse meine Nägel in die Handflächen, um mich wieder auf Louise’ Verschwinden zu konzentrieren.
Er beugt sich ein wenig zu mir herab. »Louise geht es gut«, murmelt er mit einer Samtstimme, die trotz seines leichten Lallens in meinen Fingerspitzen vibriert.
Ich trete einen Schritt zurück, um seine Hand von meiner Schulter zu entfernen. »Wo ist sie?«
»Ich überlege oft, ob wir uns nicht alle in unserem ganz persönlichen Konstrukt der Realität befinden. Die Antwort auf die Frage, wo sie ist, kann dementsprechend –«
O bei Apollon, ein Fabulant. Ich dränge mich an ihm vorbei, weiter durch die Menschenmasse. »Louise?« Der Bodensatz meines Getränks landet auf der Tanzfläche. »Louise!«
»Wenn du dir mit mir einen Ausweg aus dem Schwarm an Tanzwütigen bahnst, gebe ich preis, wo sie ist.«
Er folgt mir also. Fantastique. Doch außer ihm habe ich keinen Anhaltspunkt, und vor meinem inneren Auge sehe ich schon, wie Louise in irgendeine Gasse verschleppt wird. Also atme ich tief ein und drehe mich zu ihm. »Du weißt wirklich, wo sie ist?«
Er legt seine Hand auf die Brust. »Ich gelobe es bei dem Reichtum meines Vaters.« Zu allem Überfluss verbeugt er sich.
»In Ordnung, aber lass die großen Gesten. Und die großen Worte. Schreib Sonette, wenn du Lord Byron nacheifern willst.« Ich schiebe ihn vor mir her.
»Lord Byron hat keine Sonette geschrieben. Zudem ist Baudelaire eher mein Vorbild.« Er greift sich an sein wie aus Marmor gemeißeltes Kinn. »Wobei das meinem Vater geschuldet sein könnte, der mir seinen Stolz auf Frankreich eingebläut hat, also sollte ich das noch mal überdenken.«
Ich quetsche uns zwischen zwei Paaren hindurch. »Kannst du deine Existenzkrise auf später verschieben?«
Endlich taumeln wir in die Freiheit, direkt vor die Récamière, auf der seine Verehrerinnen warten. Kichernd ziehen sie ihn zu sich. Zwei von ihnen ergreifen auch meine Hände mit den weichen Berührungen der Nymphen in Louise’ liebstem Ballett.
»Dort drüben«, dringt die Stimme des Schnösels erneut an mein Ohr. Er klingt sogar wie ein Gott. Ein betrunkener Gott, natürlich. Dionysos.
Ich schüttle den Kopf und lasse meinen Blick seinem Fingerzeig folgen. »Das kann doch nicht wahr sein.«
Louise tanzt vergnügt mit einem jungen Mann. Keine zwei Meter von uns entfernt.
Ich löse meine Hände aus dem Griff der Nymphen, stemme sie in die Hüften und drehe mich zu Dionysos. »Dafür dieses geheimnisumwobene Trara? Du hättest sie mir von der Tanzfläche aus zeigen können!«
Mit einem schiefen Grinsen neigt er den Kopf. »Ich habe das Trara gemacht, damit du uns Gesellschaft leistest.«
Eines der Mädchen schlingt ihren Arm um meine Taille. »Wir alle sind neugierig, wen Louise mitgebracht hat.«
»Und du entsprichst so sehr Eugènes Geschmack, dass wir dich nicht gehen lassen konnten«, säuselt eine andere. Sie streicht ihre Finger über Dionysos’ – nein, Eugènes’ – Nacken.
Jetzt, da die Sorge um Louise verpufft, überwältigt mich die Situation. Eugène und seine blumige Entourage, ihre Blicke auf mir, als störte es sie nicht, dass sich eine weitere Nebenbuhlerin an ihren stinkreichen Erben ranschmeißt. Ich zwicke mir in die Handfläche. Eine vermeintliche Nebenbuhlerin, die sich vermeintlich an ihren Erben ranschmeißt! Meine Ohren werden wärmer, weil ich die Bedeutung ihrer Worte erfasse. Ich entspreche seinem Geschmack – was soll das überhaupt bedeuten? Als wäre ich eine seiner pompösen Westen, die er nur ein einziges Mal trägt. Leise schnaube ich. »Ich gehe zurück zu Louise.«
Die Mädchen jaulen auf, als wäre mein Verlust das Tragischste, was ihnen in ihrem Leben widerfahren ist. Vielleicht ist es das auch. »Du hast dich nicht einmal vorgestellt!«
»Odette Leclair«, entgegne ich hastig, »aber ich muss wirklich zurück zu Louise.«
»Der Name einer Königin.« Eugène entkorkt eine Flasche mit den Zähnen.
»Sagst du das zu jedem Mädchen, das du kennenlernst?«
»Nicht zu einer Anne oder Marie.« Er sinkt auf die Récamière und werkelt an einer kristallenen Wasserkaraffe mit mehreren zierlichen Hähnen auf einem Beistelltisch herum.
Ich verschränke die Arme. Was hat er nur an sich, das mich so anstachelt? »Es gab nicht eine Königin Odette. Aber mindestens ein Dutzend namens Anne oder Marie.«
Die Mädchen brechen in Gelächter aus. »Du bist nicht halb so gebildet, wie du denkst, Eugène!«
Er schnalzt nur mit der Zunge. »Ich bin gebildet. Doch La Fée Verte spielt zu gern mit meinen Sinnen.« Er fischt ein hübsches Glas hervor, auf dem ein gelöcherter Silberlöffel balanciert. Milchige Spiralen aus Wasser und Zucker wirbeln in faszinierenden Mustern durch den giftgrünen Alkohol. La Fée Verte – Absinth. Kein Wunder, dass Eugène so … seltsam ist.
Er führt den Absinthlöffel, dessen Löcher Sterne und einen Halbmond bilden, an seine Lippen und nimmt die Zuckerreste mit seiner Zunge auf. »Wie Honig, der als Tau vom Himmel direkt in meinen Mund fällt.« Dann kräuseln sich seine Brauen. »Ich glaube, ich hatte genug.« Dramatisch drückt er mir das verzierte Kristallglas in die Hände.
Natürlich kenne ich die Geschichten. Leichtigkeit, Euphorie, Kreativität. Und Halluzinationen. Ich bin zu schlau, um mich darauf einzulassen.
Aber vor diesem Abend dachte ich auch, ich wäre schlauer, als an einer vermutlich illegalen Soirée teilzunehmen. Der Liqueur ist schuld, dass mich eine widernatürliche Neugierde überkommt und ich am Absinth nippe. Er schmeckt leicht bitter, nach Anis, nach Madame Bouchards Medizin, aber gleichzeitig süß vom Zucker. Prompt fühle ich mich, als könnte ich Kunstwerke malen, obwohl nicht eine künstlerische Faser in mir steckt.
Die Nymphen starren mich erwartungsvoll an. »Und?«
Mein Mund verzieht sich zu einem Lächeln, bevor ich es unterdrücken kann. »Sitzt ihr nur, oder tanzt ihr auch?«
Wir tanzen stundenlang. Oder wenige Minuten? Im Wirbel der herrlich duftenden Mädchen und unter Eugènes Blicken, aus Augen so dunkel und funkelnd wie ein klarer Nachthimmel, vergesse ich endgültig alle Vorbehalte. Das hier ist die eine Nacht meines Lebens, in der ich mir erlaube … ja, was eigentlich? Einfach zu tun, wonach mir der Sinn steht? Mir ist bewusst: Es bleibt bei dieser einen Nacht der Unbesonnenheit. Aus dem Traum erwache ich morgen früh für immer – also warum nicht dafür sorgen, dass es sich lohnt?
Eugène ergreift meine Hand, und ich wirble unter seinem Arm hindurch, als wäre ich wahrhaftig von La Fée Verte besessen. Er lächelt mich an, dieser junge Mann, der sonst nur ein Hausmädchen in mir sehen würde. Heute Nacht bin ich mehr. Heute Nacht lächle ich zurück. Heute Nacht lache, lache, lache ich, bis mein Hals schmerzt und mein Herz frohlockt.
Vielleicht wehre ich mich deshalb nicht, als wir in einem Moment über die Tanzfläche gleiten und im nächsten in einen schummrigen Lagerraum stolpern, mein Herzschlag schneller als unsere hastigen Schritte. Durch die hoch liegenden Fenster fallen die Lichter der Stadt, erleuchten sanft die mit Leinentüchern abgedeckten Möbel, einige Weinfässer und die Konturen seines Gesichts.
Seine Fingerspitzen tanzen über meine Hände. Spielen mit der Spitze meiner Ärmel, so unverfroren, dass ich ihn von mir stoßen sollte. So wie es jedes Mädchen, ganz egal, welchen Standes, tun sollte. Doch ich kann nicht. Ich will nicht.
Vor allem nicht, als seine Hände die feine Kette um meinen Hals finden, und er sich näher zu mir herablehnt, um den Anhänger zu betrachten.
»Athéna, die Göttin der Weisheit.« Er legt den Kopf etwas schief. »Du ziehst die Alten Gottheiten dem Dreifaltigen Gott vor?«
Ein heikles Thema. Im Alltag praktizieren viele Menschen beide Glaubensrichtungen, da keine die andere je ganz hat vertreiben können. Aber seit jeher fühlen sich die armen Menschen aus dem Prolétariat den Göttern des Olymps verbundener. Vielleicht, weil es einfacher ist, praktischer, Déméter um eine gute Ernte, Arès um die Rückkehr des Sohns aus dem Krieg oder Héra um Nachwuchs zu bitten, als einen einzigen allmächtigen, strengen Gott anzubeten. Ein Gott, der mit seinen sakralen Bauten, seinen strikten Riten, seinen Schriften, die bis vor wenigen Jahren nur Gelehrte lesen konnten, besser in das Leben der Bourgeoisie passt. Ich verrate mich nicht, wenn ich seine Frage beantworte. Aber es ist ungewöhnlich, wenn ein Mädchen aus seinen Kreisen den Alten Gottheiten den Vorzug gibt. »Ehrlich gesagt, weder noch«, murmle ich deshalb mit einem Schulterzucken. Es ist nicht einmal gelogen. »Mir gefällt die Kette einfach nur.«
Eugène streicht mit dem Daumen über die Barockperle, langsam und vorsichtig. »Du verbirgst Dinge in dir«, wispert er.
Seine Worte zerren mich in die Realität zurück und lassen mich zusammenzucken. Weiß er, wer ich wirklich bin?
Bevor ich zurückweichen kann, schwankt Eugène und lächelt selig. »Du solltest mich eines Tages einweihen.«
Er ist ein betrunkener, närrischer Phantast – doch das bin ich ebenfalls. Denn schon vergesse ich wieder jede Vorsicht. »Verbirgst du Dinge in dir?«, flüstere ich mit einer Stimme, die ich nicht kenne.
Durch seine Wimpern blickt er mich an, ernst und dunkel. Dann stiehlt sich sein sanftes Lächeln zurück auf seine Lippen. »Ich bin offen wie ein Buch. In mir ist nichts verborgen, weil ich alles auslebe. Sehr zum Leidwesen meiner Eltern, aber nun –«, er grinst verschlagen, nervtötend, bezaubernd, »sie hätten mich eben nicht so verziehen sollen.« In seinem Ton schwingt etwas Bittersüßes mit, das ich nicht greifen kann. So viel zum Thema nichts in sich verbergen.
Der Gedanke entfällt mir, weil Eugène so himmlisch nach geschmolzenem Zucker und dem betörenden Geruch von Absinth duftet. Würden seine Lippen auch so schmecken? Ein fehlgeleiteter Gedanke – der mich nur noch mehr berauscht. Meine Fingerspitzen stoßen gegen die Edelsteine auf seinem Gilet, Saphire vielleicht, so wunderbar kühl nach dem stickigen Tanzsaal. Doch umso wärmer wird mir unter seinem Blick, der dunkel und neugierig auf mir liegt. Hinter den Fenstern flackert Licht auf, ebenso im Tanzsaal.
Und dann brechen Geschrei und Getöse über uns herein.
Kapitel 3
Die Marmorwände beben. Stürzt das Gebäude ein? Eugène und ich fahren auseinander, stieren zur Tür. Nein, kein Einsturz. Aus dem Saal dringen Schreie und gebrüllte Befehle zu uns. Harsch, nüchtern, autoritär. Die Gendarmerie? Panik prescht durch meine Adern. Wenn die Sprösslinge der Bourgeoisie hier entdeckt werden, ist das eine Sache. Eine großzügige Spende wischt die Sache vom Tisch. Doch nicht bei meiner Familie.
Eugène flucht unterdrückt. »Verdammte Nyx.«
»Was?« Ich wende mich halb zu ihm, aber im Hauptraum knallt etwas Großes zu Boden oder gegen eine Wand. Das Brechen von Stein dröhnt in meinen Ohren. Hastig drehe ich mich im Kreis, suche nach einer Hintertür. Nichts.
Das Poltern rückt näher. Eugène klettert auf einen der abgedeckten Stühle, dann auf den Stapel Weinfässer, der bis zu einem Fenster reicht. Er wickelt sich eines der Leinentücher um die Faust, und bevor ich eine Warnung rufen kann, schlägt er die Scheibe ein. Splitter regnen herab, bis keine Scherben mehr im Rahmen stecken. »Komm schon!« Er winkt mich heran.
Ich kraxle auf den Stuhl, doch halte abrupt inne. Louise! Ich muss sie suchen.
Jemand schmettert die Tür auf, die mit einem Knall gegen die Wand prallt. Ein Mann, dessen Gesicht unter einer seltsamen kupfernen Maskenapparatur verborgen liegt, tritt über die Schwelle. Wenn der mich erwischt, kann ich die Suche nach Louise vergessen.
Also ergreife ich Eugènes ausgestreckte Hand und lasse mich von ihm auf die Kiste ziehen. Er gleitet durch das Fenster, und ich krabble hinterher. Aber ein Blick hinaus und ich erstarre. Die schmale Gasse verzerrt sich seltsam, bis endlose Leere zwischen mir und dem Boden klafft. Niemals springe ich da herunter!
»Ich dachte, wir suchen einen Jungen?«, dringt die tiefe Stimme des Maskierten zu mir. Die Kisten unter mir schwanken. Rüttelt er etwa an ihnen?
Eugène reckt mir die Arme entgegen. »Ich fange dich!«
Ein heftiges Ruckeln schleudert mich zur Seite. Im letzten Moment kralle ich mich am Fensterrahmen fest. Merde! Kreischend stürze ich mich vorwärts aus dem Fenster, presse die Augen zusammen, pralle gegen etwas Weiches – Eugène hat mich gefangen – und dann zusammen mit ihm auf den Boden. Meine Knie schrappen über den Schotter, und ich zische auf.
»Du bekommst keine Extrapunkte für die Kür, wenn du einen verdammten Hechtsprung machst«, spottet Eugène und richtet uns auf. »Jeder normale Mensch wäre mit den Beinen zuerst gesprungen.«
Endlich kann ich die Augen öffnen. »Wollen diese Leute dich?«, keuche ich.
»Ich bin ziemlich sicher, dass mich so ungefähr jeder will.« Er ergreift grinsend meine Hand. »Komm schon, wir sind noch nicht in Sicherheit.«
Ich halte ihn zurück, und die Panik in meinen Adern geht in meine Stimme über. »Ich muss Louise holen!«
Die Kupfermaske unseres Verfolgers taucht am Fenster auf – und am Ende der Gasse, in der wir gelandet sind, drei weitere Männer mit Maskenapparaturen. Definitiv keine Gendarmerie. Unter dem Licht der Straßenlaternen blitzen in ihren Händen Gewehre auf.
Wir rennen los. Die Wände der eng stehenden Häuser fliegen an uns vorbei, während Eugène uns durch die Straßen und Hintergassen lenkt. Die Maskierten verfolgen uns, ihre Stimmen und Schritte dröhnend hinter mir. Zum Glück erleuchten Laternen die Wege in L’Ilithyie, sonst wäre ich längst gestolpert.
»Merde!« Eugène stiert in jede Gasse, ohne unser Tempo zu zügeln. »Wo ist die Dunkelheit?«
Natürlich! Im Licht kann ich gut sehen – aber unsere Verfolger auch. Wir brauchen Dunkelheit, um zu entkommen.
Etwas zischt an meinem Ohr vorbei, wirbelt meine Haare auf wie eine lästige Mücke. Es schlägt in eine Hauswand ein. Mit ohrenbetäubendem Krach. Ganz und gar nicht wie eine Mücke. Zur Unterwelt, sie schießen auf uns!
»Aha«, stößt Eugène wissend aus, als hätte er den Schuss nicht bemerkt, und wir schlagen den nächsten Haken. Er weiß jetzt, wo wir sie abhängen können. Er weiß es. Muss es wissen. Doch halte ich so lange durch? Meine Knie schlackern und meine Unterschenkel brennen, während Eugène nur leicht außer Atem ist. Flieht er etwa öfter?
Jemand ergreift meinen Rock, und der Ruck bringt mich zum Stürzen. Meine Hand rutscht aus der von Eugène. Ich drehe mich im Fall, lande halb auf dem Rücken, halb auf der Schulter, deren Gelenk unter dem Aufprall ächzt. Instinktiv trete ich nach der Hand an meinem Rock. Ich treffe den kleinen Finger des Mannes, und das Knacken eines brechenden Knochens hallt durch die Gasse, gefolgt von seinem Brüllen.
»Fantastische Technik!« Angestrengt grinsend zerrt Eugène mich auf die Beine, dann weiter, ohne Verschnaufpause.
Der Maskierte verfolgt uns, und die Wut über den gebrochenen Finger scheint ihn nur noch mehr anzustacheln. Ich könnte schwören, sein Atem wirbelt die Härchen in meinem Nacken auf wie die Gewehrkugel zuvor.
Wir preschen in die nächste Gasse, wo mir ein unangenehmer Dunst entgegenschlägt. Wie bei uns in L’Hadès – nur schlimmer. Der îlots insalubres Beaubourg! Der eine Schandfleck von Häuserblock in den schicken Arrondissements, den die Regierung einfach nicht entfernen kann. Beengte, verwinkelte Gassen, mangelhafte Versorgung – wenn es irgendwo keine Straßenlampen gibt, dann hier!
Doch nach wenigen Metern erlischt meine Begeisterung. Gedimmte Lampen erleuchten die Schaufenster der heruntergekommenen Kaschemmen. Auch die ranzigen Ladenfronten mit den abgeblätterten Farbschichten werden bestrahlt – von elektrischen Straßenlaternen. Das ist neu.
Eugène knirscht mit den Zähnen. »Alle hier schlafen – was wollen sie mit dem verdammten elektrischen Licht?«
»Was hast du verbrochen, dass diese Kerle dich umbringen wollen?«, keuche ich.
Ein weiterer Schuss dröhnt durch die Luft, knapp an meiner Schulter vorbei. Mein Atem setzt aus. Wie in Trance lasse ich mich weiterzerren. Wenn ich sterbe, was passiert mit meiner Familie? Mein Hals schnürt sich zu.
Eugène stiert in die abgehenden Gassen. »Dunkelheit, ich brauche Dunkelheit.« Seine Worte verwirbeln mit meinen Gedanken. Dunkelheit. Noch ein Schuss. Dunkelheit. Energie schwirrt durch meine Fasern, kämpft gegen die Erschöpfung meiner Muskeln an. Wir biegen in einen schmalen Weg ab – an dessen Ende einer der Maskierten auf uns wartet. Sie haben uns umzingelt. Er zückt sein Gewehr, richtet es auf mich. Quälend langsam, als dehnte sich die Zeit, krümmt er den Finger am Abzug.
Durch meinen Kopf jagen Bilder meiner Familie. Aber auch von meinem Leben, das ich nicht erleben werde. Louise’ Worte, dass heute Nacht nichts passieren wird, so wie immer. Ich könnte fast lachen, so falsch lag sie. Ihre Wörter verschmelzen mit denen von Eugène.
Ich brauche Dunkelheit.
Ein verzweifelter Schrei löst sich aus meiner Kehle. Meine Fingerspitzen brennen, als presste ich sie gegen gefrorenes Metall. Die Straßenlaternen flackern auf, und Eugènes Fluchen klingt weit, weit entfernt.
Die Welt um mich implodiert. Energie breitet sich in einer Schockwelle um mich herum aus, lässt Licht für Licht sterben, bis die Gasse beinahe mitternachtsschwarz ist.
»Was hast du –«, keucht Eugène und ergreift meinen Oberarm, um mich zu sich zu drehen. »Wer bist –?«
Der Verfolger schießt im Dunkeln blind auf uns.
Eugène ergreift wieder meine Hand. »Halt dich gut fest!« Er rennt los, und ich folge ihm automatisch. Eine ähnliche Energie wie die, welche die Lichter gelöscht hat, pulsiert um ihn.
Etwas zerrt uns durch die Dunkelheit, so rasant, dass die Welt um mich verschwimmt.
Nach wenigen Sekunden stolpern wir in die nächste Gasse, eine Strecke, für die wir mindestens eine halbe Minute hätten brauchen müssen. Mein Magen dreht sich, und ich will zu Boden sinken, doch Eugène hält mich aufrecht und starrt die auch hier gelöschten Laternen an.
»Wie viele Gassen hast du –« Er schüttelt den Kopf, und wir rennen weiter. Gasse für Gasse durchqueren wir so, immer im Schatten, bis wir in kürzester Zeit einige Hundert Meter hinter uns gebracht haben.
»Der ganze Block liegt in Dunkelheit.« Er schüttelt ungläubig den Kopf. »Wir haben einen guten Vorsprung, dennoch sollten wir uns verstecken, damit –«
Ich unterbreche ihn, indem ich mich vornüberbeuge und versuche, den Absinth in meinem Magen zu behalten. »Was zur Unterwelt hast du gemacht?« Ich stütze mich auf meinen Knien ab, doch die Welt dreht sich weiter.
»Das«, Eugène zieht mich an den Schultern hoch, »sollte ich wohl eher dich fragen.«
»Ich habe überhaupt nichts gemacht«, erwidere ich instinktiv, obwohl ich mir selbst nicht sicher bin. Aber ich werde einen Teufel tun und das zugeben. Denn falls diese Energie tatsächlich von mir ausging, habe ich mit den Laternen Eigentum der Stadt zerstört. Dafür gehe ich sicher nicht ins Gefängnis.
»O bitte, versuch nicht, mir weiszumachen, dass du nichts von deiner Fähigkeit weißt.« Eugène dirigiert mich weiter, doch blickt mich aus den Augenwinkeln an.
»Ich weiß nichts von Magie«, keuche ich.
»Keine Magie.« Eugène seufzt. »Sondern eine besondere Fähigkeit. Du kannst doch nicht nicht davon gewusst haben! Sprechen die Schatten nicht mit dir?«
»Sprechen«, ich räuspere mich und bringe sicherheitshalber ein wenig mehr Distanz zwischen uns, »sprechen Schatten etwa mit dir?« Das wäre besorgniserregend. Ich sollte kehrtmachen und nach Hause rennen.
Doch alle paar Meter, im Schatten einer Markise oder in einer der wenigen dunklen Gassen, ergreift er meine Hand, und obwohl wir nur locker laufen, sind wir schneller, als würden wir sprinten. Ein seltsames Gefühl. Ein berauschendes Gefühl. Es macht mich zur Herrin über Raum und Zeit.
Wir halten vor einem unscheinbaren Reihenhaus, und weil Eugène noch immer nicht geantwortet hat, atme ich zittrig auf. »Du musst mir wirklich mehr Informationen geben. Damit ich nicht durchdrehe.«
Er lehnt sich gegen eine kleinere, gusseiserne Tür neben dem Eingangsportal des Hauses und studiert mich mit verschränkten Armen. »Ich habe das Gefühl, du nimmst die Begebenheiten ziemlich gelassen auf. Solltest du nicht klagen und zetern, dass all das nicht wahr sein kann?«
»Ich war nie für Fantastereien zu haben. Wenn ich etwas sehe, ist es real, oder?« Trotz meiner Worte trommelt mein Herz, als würden wir immer noch vor den Maskierten davonrennen. Mein Blick fällt auf eine Lampe. Zaghaft hebe ich eine Hand in ihre Richtung. Habe wirklich ich –?
»Eine enttäuschende Reaktion«, murmelt Eugène, und ich lasse meinen Arm fallen. Er greift nach der Tür, und an seinem Finger blitzt ein grob gearbeiteter Silberring auf, der so gar nicht zum Rest seiner herausgeputzten Erscheinung passen will. Ein eigenartiges Symbol – ein stilisierter Drache? – ist in die Oberfläche eingeprägt. Eugène führt ihn zum Schloss, das seltsam anmutet. Anstatt eines Schlüssellochs entdecke ich mit zusammengekniffenen Augen eine fein gearbeitete Kerbe – in der Form des Ringes. Eugène presst ihn hinein, und mit einem leisen Klicken öffnet sich die Tür. Dahinter führt eine schmale Stiege nach unten in die Dunkelheit. Muffige Luft steigt hoch, und mein Magen dreht sich.
Merde, wo bin ich hier nur hineingeraten?
Eugène steigt die ersten Stufen hinab, doch ich trete einen Schritt zurück. »Ich gehe da nicht runter.«
Er dreht sich zu mir, unverkennbar um einen vertrauenerweckenden Gesichtsausdruck bemüht. Als wäre ich ein ängstliches Kaninchen statt – angebrachterweise! – vorsichtig.
»Ich weiß, das hier ist nichts, wo sich eine Mademoiselle wie du normalerweise herumtreibt.«
Oh, richtig. Er geht immer noch davon aus, dass ich der Bourgeoisie angehöre. Besser, es bleibt dabei – auch wenn sich die tief hinuntergeschluckte Wahrheit schwer in meinen Magen legt. Weil ich ihn anlüge? Nein. Weil er mich anders behandeln würde, wenn er erführe, wer ich bin. Aus unerklärlichen Gründen will ich das nicht, obwohl mich so etwas bisher nie interessiert hat.
Eugène scheint mein Schweigen falsch zu interpretieren, denn er kommt einen vorsichtigen Schritt auf mich zu. »Glaub mir, du wirst es mir danken, sobald die Nyx herausfinden, was du bist.«
Skepsis drängt mich einen weiteren Schritt zurück. »Nyx? Die Göttin der Nacht?« Keine der Gottheiten, die wir verehren, sondern kaum mehr als eine Randnotiz in der Schule. Eugène wirkt nicht mehr betrunken, aber das kann täuschen. Ich werde nicht mit einem Trunkenbold in einen Keller hinabsteigen, damit er mich dort irgendeinem düsteren Göttinnenkult opfert.
»Du glaubst nicht an Nyx?« Er wirft einen prüfenden Blick über meine Schulter zur Straße. Trotz seiner bedachten Gelassenheit kann er seine Angespanntheit nicht völlig verbergen.
Widerwillig gehe ich zumindest zwei, drei Schritte vor, weiter in die Dunkelheit, die uns vor Blicken verbirgt. »Du etwa?«
»Natürlich.« Er grinst so breit, dass ich fast alle seiner perfekten Zähne sehe. »Sie steht schließlich vor mir.« Ich rolle nur die Augen, doch er fährt einfach fort. »Aber ich meine nicht die Göttin, sondern den Orden der Nyx. Die sympathischen Zeitgenossen, die uns nach Hause begleiten wollten. Glaub mir: Du willst ihnen kein zweites Mal begegnen, nicht unvorbereitet. Komm mit mir, und du musst es auch nicht.« Ohne auf meine Antwort zu warten, steigt er die schmale Treppe hinab.
Alles in mir sträubt sich. Ich sollte Louise suchen. Doch bleibt mir eine andere Wahl? Ich muss herausfinden, was mit mir los ist. Wie ich das wieder loswerde. Ich hoffe nur, dass Louise sich nicht zu sehr sorgt. Dass es ihr gut geht. Mit einem tiefen Atemzug folge ich ihm in die kalte, abgestandene Luft eines Kellers. Nur ist es keiner. Obwohl ich kaum etwas sehe, sagen mir die rauen Wände unter meinen tastenden Fingern und die unterschwellige Note von Verwesung genug.
Eugène besitzt einen Schlüssel für die Catacombes von Paris.
Mit angehaltenem Atem verharre ich in der Dunkelheit. Pfeifend entzündet Eugène eine Gaslaterne, deren Schein die schmale Kammer erleuchtet, von der zwei Gänge abgehen. Über dem breiteren entziffere ich das eingravierte Wort Ossuaire. Dort ruhen also die Gebeine von Millionen Menschen. Ich erschaudere. Doch wie ist das möglich? Die Catacombes und ihre Eingänge liegen bei uns in L’Hadès. Sicher, längst nicht alle Gänge sind erforscht, aber selbst wenn einzelne Abzweigungen bis hierher reichen – wie kann ein Tunnelsystem so weit im Norden völlig unbekannt bleiben?
Eugène deutet auf den breiteren Gang. »Seit Ewigkeiten überflutet, da solltest du keinen Fuß reinsetzen. Der Zutritt zu den Catacombes ist nicht grundlos verboten.« Er dreht mich nach links, wo eine eingestürzte Felswand nur einen Spalt des Eingangs frei lässt. »Der hier hingegen – dein Weg in ein neues Leben.«
Ich weiß es besser, als mich zu erkundigen, wohin er mich bringt. Noch habe ich auf keine meiner Fragen eine vernünftige Antwort erhalten. Aber vielleicht liegt am Ende dieses Tunnels eine Erklärung. Mit neuem Mut stakse ich über den unebenen Boden zum Spalt, quetsche mich und mein mittlerweile arg ramponiertes Kleid hindurch.
»Warte kurz auf mich.« Eugène löscht die Gaslampe.
Die beengte Welt um mich herum versinkt in Dunkelheit. Er lässt mich hier unten doch nicht zurück? Wie konnte ich nur so naiv sein und einem Wildfremden in ein verlassenes Kellerloch folgen? In die Catacombes? Mein Atem rasselt durch den Gang. »Eugène?« Meine Stimme klingt viel zu hoch, und ich schere mich nicht darum, dass ich ihn nicht beim Vornamen nennen sollte. »Eugène!«
Da, ein Schaben hinter mir! Presst er sich durch den Felsspalt? Ein zartes Surren weht durch die Luft, dann kullert etwas über den Felsboden. »Merde«, flucht Eugène, und ich atme auf. »Ich mochte dieses Gilet.«
Sanfte Finger streifen meine Schulter, finden meine Hand und umschließen sie. Obwohl ich die Berührung nicht gutheißen sollte, lösen sich meine Schultern aus ihrer Anspannung. »Hast du gerade einen der Saphire verloren?«
»Einen Topas.«
Entsetzen verdrängt die wallende Angst in meinem Magen. »Worauf wartest du? Hol die Lampe!«
Er schnalzt mit der Zunge. »Den finde ich nie wieder. Ich lasse einfach einen neuen annähen.«
Sprachlos starre ich die Dunkelheit dort an, wo er stehen müsste. »Meine Familie könnte –« Ich beiße mir auf die Zunge, bevor ich ausplaudern kann, wie lange wir von einem seiner Edelsteine leben könnten. Vermutlich werde ich mich nie daran gewöhnen, wie fundamental anders das Leben von Menschen wie ihm ist.
»Halt dich fest.« Um ihn züngelt eigenartige Energie, seine Fähigkeit, deren Gebrauch ihn von meinem Ausrutscher ablenken muss. »Das Schattenspringen wird anders als auf den Straßen.«
»Schatten-was?« Ein Ruck presst die Luft aus meinen Lungen. Wo wir zuvor gelaufen oder gerannt sind, fliegen wir jetzt. Meine Füße berühren kaum den Boden, als trüge ich Hermès’ Flügelschuhe – nein, als trügen die Schatten mich. Für Millisekunden glaube ich, ein Licht zu sehen, doch wir rennen, fliegen, schattenspringen bereits weiter. Fünfmal, sechsmal, unendliche Male. Tränen brennen in meinen Augenwinkeln, bis der Wirbel aus Dunkelheit, Raum und Zeit sie herauszerrt. Mit der Verzweiflung einer Ertrinkenden kralle ich mich an Eugènes Hand. Was passiert, wenn ich loslasse? Zerreißt mein Körper in tausend Stücke?
Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, als wir endlich zum Stillstand kommen. Schwankend fixiere ich den Schein einer einsamen Gaslaterne, meinen Anker. Immer noch unterirdisch, gefangen zwischen feuchten Steinwänden. Der Hauch von altem Fisch in meinem Rachen tut sein Übriges, und mein Magen verkrampft, doch nichts kommt hoch. Nur schmerzhaftes, trockenes Würgen.
»Schon gut. Es ist nur die ersten Male so schlimm.« Eugène reibt mir über den Rücken, die Hand so wohlig warm, dass ich sein unmanierliches Verhalten erneut dulde.
Nach einigen Atemzügen richte ich mich ächzend auf und trete einen Schritt von ihm weg. »Was ist dieses … Schattenspringen?«
Er greift sich an den Nacken. »Allein mit dem Namen meiner Fähigkeit habe ich schon zu viel verraten. Mehr solltest du wirklich nicht wissen.«
Ein zartes Grollen aus Trotz regt sich in meiner Brust. »Das Schattenspringen ist eine Fähigkeit. Du brauchst dazu Dunkelheit, die deine Bewegungen … akzeleriert. Und je dunkler es ist, desto schneller bewegst du dich.«
»Akzeleriert?«