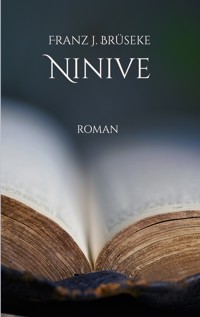
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jonathan bekommt den mysteriösen Auftrag, ein letztes Buch zu verfassen, es soll nur vom Wichtigsten handeln. Seine Recherchen führen ihn in die römischen Katakomben, wo eine Gruppe von Widerständlern versucht, die Reste der abendländischen Zivilisation zu retten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt: Jonathan bekommt den mysteriösen Auftrag, ein letztes Buch zu verfassen, es soll nur vom Wichtigsten handeln. Seine Recherchen führen ihn in die römischen Katakomben, wo eine Gruppe von Widerständlern versucht, die Reste der abendländischen Zivilisation zu retten
Franz J. Brüseke, geb. 1954, ist Autor von soziologischen Sachbüchern und Romanen. Seine wissenschaftlichen Publikationen in portugiesischer und deutscher Sprache behandeln zumeist Themen auf dem Gebiet der Entwicklungs- und Techniksoziologie. Seine Romane und Novellen kann man dem Genre des historischen Romans oder philosophischen Abenteuerromans zuordnen. Der Autor lebt mit seiner deutsch-brasilianischen Familie in Florianópolis, Brasilien.
Inhalt
Kapitel 1: Jonathans Traum
Kapitel 2: In den Katakomben
Kapitel 3: Die Flucht mit dem Schiff
Kapitel 4: Im Bauch des Wals
Kapitel 5: Ninive
Kapitel 6: Morgen fange ich damit an!
Kapitel 1
Jonathans Traum
Jonathan hatte es immer als dummes Zeug abgetan, wenn jemand seinem Geburtstag eine besondere Bedeutung zuschrieb. Ein Geburtstag war für ihn ein Tag wie jeder andere, lediglich dadurch bemerkenswert, dass auch dieser, wenn verstrichen, einen Tag weniger auf der Lebensskala bedeutete.
Doch konnte er nicht umhin sich einzugestehen, sein Fünfzigster hatte ihn erwischt. Vielleicht gerade, weil er seit Jahrzehnten dort, wo andere von Geburtstag zu Geburtstag freudig ein zeitliches Wachstum wahrnahmen, das genaue Gegenteil erfuhr. So ein Tag war für ihn die Markierung des näher rückenden Todestages. Die fünfzig jetzt verflossenen Jahre konnte man weder rückgängig machen noch, wie ein Freund scherzhaft bemerkte, verdoppeln.
Vielleicht hatte er, wenn die Gesundheit ihn nicht vorher im Stich ließ, noch dreißig Jahre zu leben. Wahrscheinlicher aber war es wohl, er musste es widerstrebend zugeben, dass es einige Jahre weniger sein würden. Aber niemand wusste es genau. Es konnte ihn auch jeden Moment niederstrecken, wie es mit seinem Kollegen Dr. Weißbinder geschehen war. Plötzlich und doch erwartet.
Ihn grauste es. Dabei schreckte ihn, mehr noch als der Gedanke an den Tod, die Antwort auf die an sich selbst gestellte Frage, was er denn bisher geleistet habe. Nicht dass er untätig gewesen wäre, nein, denn das Gegenteil wurde durch die schon in jungen Jahren erkämpften Diplome bewiesen, auch die Liste seiner Veröffentlichungen war durchaus respektabel. Er fragte sich, was denn all diese Artikel, Kritiken und Aufsätze – alle paar Jahre in Sammelbänden zusammengefasst – tatsächlich wert waren. Was blieb von alldem?
Er hatte allein in seiner Wohnung eine Flasche Wein getrunken. Sie war ihm heute Morgen zusammen mit einem Strauß Blumen von der Sekretärin der Fakultät überreicht worden. Dieser stand jetzt in einem Plastikeimerchen auf seinem Schreibtisch. Die Blumen wollten so gar nicht zu diesem kreischend roten Behältnis passen, aber er hatte nichts Besseres in seiner Wohnung gefunden. Eine Vase besaß er nicht. Warum auch, hatte ihm doch noch nie jemand Blumen geschenkt.
Die offiziellen Glückwünsche waren die einzigen gewesen, die er heute erhalten hatte. Nein, fast hätte er es vergessen. Eine ehemalige Freundin hatte ihn heute angerufen. „Ich habe mich an dich erinnert, weil ich auch in dieser Woche fünfzig geworden bin.“ So hatte sie das Gespräch begonnen und ihm dann, nachdem er sich für den Anruf bedankt hatte, aber dann nicht mehr wusste, was er sagen sollte, erzählt, dass sie es heute bereue, keine Kinder zu haben. Sie sei jetzt zwar mit einem Mann zusammen, der zwei Kinder hätte, die aber schon erwachsen seien und dass das auch etwas anderes wäre, denn die hätten schließlich schon eine Mutter und … Irgendwann hörte ihr Redestrom auf und er wusste immer noch nicht, was er sagen sollte. „Vielleicht können wir uns bald einmal zu einem Kaffee treffen,“ sagte sie schließlich. Er nickte und hätte fast aufgelegt, als ihm noch rechtzeitig einfiel, dass sie ihn nicht sehen konnte. „Eine gute Idee,“ sagte er eilig und legte den Telefonhörer aus der Hand.
Jonathan fragte sich, ob er noch eine Flasche öffnen sollte, denn die erwünschte Bettschwere wollte sich nicht einstellen. Es war schon weit nach Mitternacht als er sich geschlagen gab - eine zweite Flasche Wein hatte er nicht gefunden - und sich mit offenen Augen aufs Bett legte. Immer noch zogen endlose Gedankenketten durch seinen Kopf, bis er schließlich in einen unruhigen Schlaf fiel.
Eine Gruppe von Männern in langen weissen Gewändern stand um ihn herum und redete auf ihn ein. Der größte und älteste unter ihnen hob seinen rechten Arm und sagte mit Donnerstimme: Schreibe das letzte Buch! Die anderen gestikulierten und versuchten ihm klarzumachen, dass es nicht um das letzte Buch einer Saison ginge, nach der, wie gewohnt, andere, neue Bücher erscheinen würden, von denen ihre Verleger wie immer sagen würden, sie seien der letzte Schrei. Nein, es handele sich wirklich um das allerletzte Buch überhaupt und, wenn man so wolle, wäre es dieses Mal tatsächlich der letzte Schrei. Ein allerletzter Schrei, nach dem kein weiterer folgen würde. Zumindest nicht in Buchform.
Zuerst weigerte er sich. Daraufhin aber sagte der Alte, gut, dann gäbe es eben gar kein Buch mehr, denn die vorhandenen würden sämtlich eingestampft werden. Er solle sich also noch mal überlegen, ob er nicht doch etwas mitzuteilen hätte, ob er nicht meine, dass es etwas gäbe, das die Nachwelt wissen solle.
Ja, ja!, hatte er dann gerufen und begriffen, dass es ihnen durchaus ernst war, aber er wolle nur wissen, warum man denn dieses eine letzte Buch ausgerechnet von ihm erwarte. Wenn du das nicht weißt, schreib es nicht, sagte der Alte und fragte daraufhin, ob er vierundzwanzig Stunden Bedenkzeit wolle.
Die brauche er nicht, hatte er zu Tode erschrocken geantwortet, er beginne gleich heute mit dem letzten Buch, wie viel Zeit er denn hätte. Sie hatten die Frage nicht gleich verstanden, steckten die Köpfe zusammen, tuschelten eine Weile untereinander und nickten ihm dann zu: Er hätte Zeit, hundert Tage Zeit.
Jonathan wachte schweißgebadet auf. In den ersten Sekunden wusste er nicht, ob er wachte oder träumte. Mit Mühe fand er den Schalter der Nachttischlampe, deren gedimmtes Licht ihn langsam in die Welt zurückholte. Bald erkannte er die Konturen des Kleiderschranks, dann auch des Fensters, durch dessen halb offene Jalousien sich das Morgengrauen ankündigte. Er stand auf und widmete sich fröstelnd seiner Morgentoilette. Doch der Schreck, der ihm in alle Glieder gefahren war, wollte ihn nicht so ohne Weiteres verlassen. Zu befremdlich waren denn auch all jene Ereignisse, die sich in den letzten Tagen überstürzt hatten.
Der Umstand, dass ihn ausgerechnet einen Tag nach seinem Geburtstag die Nachricht erreichte, sein Fachbereich werde abgeschafft und an Frühpensionierung interessierte Kollegen möchten sich doch bitte im Rektorat melden, war dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Jetzt hatte er die Quittung, dass seine Arbeit sinnlos und er selbst überflüssig geworden war! Im Grunde hatte er es schon lange gewusst. Waren nicht die Studentenzahlen immer mehr zurückgegangen und hatte nicht das klassische Latein, das er lehrte, nur deshalb überlebt, weil es Pflichtfach war?
Vielleicht bildete er es sich nur ein, aber immer, wenn er sich an seinen Traum erinnerte, war ihm, als läge darin eine Botschaft, der er folgen sollte. Natürlich hatte er schon einige Bücher geschrieben, aber sie erschienen ihm heute wie ein belangloses Pingpong mit ebenso belanglosen Autoren, wie er selbst einer war. Ein wirklich wichtiges Buch, ja, das hätte er gern geschrieben. Und das wäre nicht etwa ein Buch – diese Erfahrung hatte er schon reichlich gemacht –, das in der Akademie gut ankäme und allseitig gelobt würde. Ein wichtiges Buch musste ein Buch über das Wichtige sein. Und ein Buch über das Wichtigste angesichts der fünfzig schon verflossenen Jahre, denn er hatte keine Zeit mehr zu verlieren.
Nachdem Jonathan endlose Stunden mit Grübeln verbracht hatte, schien ihm, als ob die Wände seines Arbeitszimmers immer näher rückten. Die seit vielen Jahren auf den Regalbrettern stehenden Bücher begannen in der Vielfalt der Stimmen ihrer Autoren zu wispern und machten ein Geräusch, das sich zu einem Piepton verdichtete, der einer immer höheren Frequenz zustrebte, um schließlich in einem Rauschen zu enden, das selbst heftiges Kopfschütteln nicht abstellen konnte. Er hielt es in seiner Wohnung nicht mehr aus. Nachdem er seine Brille wiedergefunden hatte, die aufgrund seiner abrupten Kopfbewegung durch den Raum geflogen war, nahm er seine Jacke und ging auf die Straße zu seinem Auto. Doch es half nichts. Er musste weg, weiter weg von diesen flüsternden Büchern, in denen sich Autoren stritten, die sich über nichts, aber auch gar nichts einig werden konnten.
Als er die letzten Häuser der Stadt hinter sich gelassen hatte, begann es zu regnen. Er fuhr noch einige Kilometer und stellte dann den Wagen in einem Feldweg ab. Der Regen hatte aufgehört, sodass er aussteigen konnte. Ein Blick nach oben in die sternenlose Dunkelheit genügte, um zu wissen, dass sich eine geschlossene Wolkendecke über das Land gelegt hatte. Er setzte sich wieder ins Auto und ließ die Zeit verstreichen. Hin und wieder öffnete er die Wagentür, stieg aus, tat ein paar Schritte und blickte nach oben, aber der Himmel öffnete sich nicht.
Bis in den frühen Nachmittag hinein hatte er geschlafen und gehofft, beim Einsetzen der Dunkelheit freie Sicht nach oben zu haben. Doch nach Stunden ergebnislosen nächtlichen Wartens, als schon ein erstes graues Licht durch die Gardinen fiel, stand fest, dass man in dem Land, wo er lebte, keine Sterne sehen konnte.
Die infernalischen Geräusche in seinem Kopf hatten sich nicht wieder eingestellt. Er deutete dies als ein Zeichen dafür, dass schon allein der Gedanke an einen wolkenlosen Sternenhimmel seiner seelischen Gesundheit förderlich war.
Zwei Männer erschienen. Jonathan, der keine zwei Stunden geschlafen hatte, war von ihrem wiederholten Klingeln aufgeschreckt worden und hatte ihnen, noch schlaftrunken und im rasch übergeworfenen Bademantel, die Tür geöffnet.
„Wir sollen die Bücher abholen,“ sagte der Größere von beiden. „Aber ich bin doch noch gar nicht so weit,“ entfuhr es Jonathan. „Machen Sie sich keine Umstände. Es kommt sowieso alles in den Container.“
Tatsächlich war vor dem Nachbarhaus ein Container von der Art, wie man sie sonst für Bauschutt nutzt, abgesetzt worden. Man hatte schon etliche Bücher hineingeworfen; ein wildes Durcheinander der unterschiedlichsten Ausgaben. Einige waren aufgeklappt und reckten ein paar Seiten wie nach Hilfe rufend in den Himmel.
„Bitte,“ sagte er und führte sie zu seinem Arbeitszimmer, wo sie sich gleich über die Regale hermachten. Selbst die kleine Sammlung lateinamerikanischer Literatur, die ihn in jungen Jahren begeistert hatte, verschmähten sie nicht.
„Sonst noch was?“ fragte schließlich der eine der beiden, der auch schon vorher das Wort geführt hatte. Nein, sagte Jonathan, mehr habe ich nicht. Der Mann drückte ihm eine Quittung in die Hand. Wir haben den Betrag aufgerundet, dann bekommen sie mehr. – Mehr? – Mehr Geld.
Er sah auf den Zettel. Darauf stand in der Rubrik “Menge in Kubikmetern”, die Zahl 4,5. Die beiden Männer hatten sich, nicht ohne vorher um seine Erlaubnis gefragt zu haben, auf sein Gartenbänkchen gesetzt und rauchten. Bald kam ein Lastkraftwagen und zog den Container an scheppernden Ketten auf das Fahrgestell. Einige Bücher fielen auf die Straße, wurden aber rasch aufgesammelt und zurückgeworfen. Die Männer verabschiedeten sich, kletterten ins Fahrerhaus und der LKW fuhr davon.
Wie benommen hatte Jonathan diese ganze Aktion über sich ergehen lassen und glaubte schon, dass er vielleicht einer Sinnestäuschung aufgesessen war. Aber die leeren Regalbretter, über die er mehrmals mit der Hand fuhr, um das, was er sah, als Halluzination zu entlarven, ließen keinen Zweifel. Seine Bücher waren verschwunden.
Die Vorstellung, ein letztes Buch angesichts leerer Regalbretter schreiben zu sollen, war unerträglich. Er hatte Jahrzehnte zwischen diesen Bücherwänden gesessen und hätte selbst im Dunkeln schnell einen gewünschten Titel herausgefunden. Doch jetzt war ihm sein Orientierungssinn abhandengekommen. Die aufgereihten Bücher hatten seine Gedanken stets in einer Ordnung gehalten, die nun unwiederbringlich verloren schien. Es gab eine Geschichte der Ideen, gewiss, aber es gab auch seine ganz persönliche Geschichte der Aneignung dieser Ideen, nicht eine chronologische, sondern eine voller Lücken, überraschender Zusammenhänge und entflammter Begeisterung, wenn ihn plötzlich ein Autor besonders ansprach.
Diese seine Lebenszeit verausgabende, in Regalen übereinandergeschichtete Lektüre hatte in seiner Bibliothek Autoren in eine Nachbarschaft gerückt, die jede Universität in sorgfältig getrennte Disziplinen verwiesen hätte. Was er in früher Jugend gelesen hatte, stand eng beieinander. Das schmale Bändchen aus dem Leben eines Taugenichts, neben dem Seewolf und Peter Camenzind, war seit Jahrzehnten treuer Nachbar von Moby Dick, der sich gleich, nur ein Jahr später gelesen, an das Herz der Finsternis anlehnte. Was Fachleuten als heilloses Durcheinander erscheinen musste, hatte sich in seinem Kopf folgerichtig miteinander verwoben. Autoren, die sich selbst noch zu Lebzeiten erbittert bekämpft hatten, standen friedlich nebeneinander und Titel, zwischen denen man fürwahr keine Verbindung sah, lehnten sich aneinander.
Der willkürlich anmutenden Ordnung seiner Bücher auf den Regalbrettern entsprach seine Weltanschauung, die sich aus hunderten von Gedanken zusammensetzte, die er nicht ohne Mühe zu einem feingesponnenen System zusammengetragen hatte und das von der Antike bis in die Gegenwart reichte. Aber all dies hatte sich mit einem Mal in Luft aufgelöst.
Wo waren seine Bücher jetzt? Sein Herz krampfte sich zusammen, wenn er an den Container dachte. Er untersagte sich die Vorstellung, was das Einstampfen bedeutete. Überhaupt hatte ihn der Anblick der verstaubten Wände schon zu lange gequält. Hier konnte er nicht denken, hier wollte er nicht bleiben.
Erschrocken stellte Jonathan fest, dass schon Tage vergangen waren, ohne dass er eine einzige Zeile geschrieben hatte. So beschloss er in der Hoffnung, dort Anregung oder wenigstens Ablenkung zu finden, die alte Kirche seiner Kindheit noch einmal zu besuchen.
Die morgendliche Sonne, verdeckt von einer undurchdringlichen Wolkenwand, hatte keine Chance bis zum Mosaikfenster vorzudringen, das die ganze östliche Seite des Altarraums ausfüllte. Kein mysteriöses Farbenspiel gab ihm dieses Mal, wie es so oft in den Tagen früher Jugend gewesen war, geheimnisvolle Kunde von etwas, das zu beschreiben ihm bis heute die Worte fehlten. Hier, in der sonntäglichen Messe, war er auf die lateinische Sprache gestoßen. Wie magische Formeln klangen damals in seinen Kinderohren die liturgischen Wechselgespräche zwischen Pfarrer und Gemeinde. Was redeten sie? Von woher kam diese geheimnisvolle Sprache, die nur noch Eingeweihte kannten? Später hatte er dann daraus, seinen Beruf gemacht. Es hatte ihn nie bekümmert, dass man Latein, weil nicht mehr in der Gegenwart gesprochen, eine tote Sprache nannte. Doch heute fühlte er sich als eines der letzten Exemplare einer aussterbenden Spezies. Was nutzte es, dass er einer der Wenigen war, die noch ganze Vorträge auf Latein halten konnte? Er stand noch eine Weile ratlos ganz hinten im Kirchenschiff und fühlte sich bald durch die leeren Bänke an sein verstaubtes Bücherregal erinnert.
Schon auf dem Hinweg hatte er die Kartons vor den Häusern gesehen, von denen einige, weil zu schwach für ihren schweren Inhalt, aufgeplatzt waren und den Blick auf Bücher freigaben, die er sich nicht näher zu betrachten traute, geschweige denn, in die Hand zu nehmen.
In den frühen Morgenstunden hörte man dann wieder die Lastwagen, die Rufe der Männer und das dumpfe Aufschlagen der Kisten. Mit jedem Buch, das auf den Lastwagen verschwand – von denen einige mit einer hydraulischen Presse ausgerüstet waren, die gleich an Ort und Stelle jeglichen unnötigen Hohlraum beseitigte –, fühlte er sich elender. Schon beim Verlust seiner eigenen Bibliothek war ihm, als hätte man ihm Teile seiner höchstpersönlichen Erinnerung weggenommen. Selbst Bücher, die er nie gelesen hatte, so enden zu sehen, erfüllte ihn mit einem Gefühl des Entsetzens.
Bald wurde es ruhiger auf der Straße. Die Lastwagen samt ihrem preziösen Inhalt waren verschwunden und seine Anwesenheit hinter der Gardine, die er aus irgendeinem Grunde für notwendig hielt, hatte keine Bedeutung mehr.
Er packte in sein Auto, was er für eine Reise in den Süden brauchte. Das Schreibwarengeschäft, eine Straße weiter, hatte ein Schild Ausverkauf ausgehängt. So erstand er für den halben Preis einige Schreibhefte.
Er hatte Angst vor Tunneln, in denen er jedes Gefühl für Geschwindigkeit verlor. Das letzte Mal, im Sankt-Gotthard-Tunnel, hatte er den Eindruck auf der Stelle zu stehen, obwohl sein Tacho eine deutlich überhöhte Geschwindigkeit anzeigte. Auch fürchtete er, dass der Luftdruck des Tunnels die Geräusche in seinen Ohren wieder aktivieren würde. Genug Argumente also, um die Alpen nicht direkt anzufahren, sondern sie in südwestlicher Richtung zu umrunden. Er übernachtete, wie schon so manches Mal vorher, in Besançon und fuhr dann die Rhône entlang Richtung Süden.
Auf dem letzten Rastplatz hatte er eine Flasche Côte du Rhône erstanden, die jetzt auf dem Beifahrersitz hin und her rollte. Schon wenige Kilometer hinter der Grenze meldete sich das Autoradio mit einer Auswahl französischer Chansons. Er hätte einen Flaschenöffner kaufen sollen. So aber blieb ihm nichts anderes übrig als, wie sie es früher oft gemacht hatten, den Korken in den Flaschenhals zu drücken. Die paar Spritzer, die er dabei abbekam, passten, so fand er, zur Musik und zur Gewissheit, bald am Mittelmeer zu sein.
Auf dem Parkstreifen war außer ihm kein Mensch, nur weiter vorn an der Ausfahrt zwei Anhalter, die offenbar Anstalten machten, mit ihm reden zu wollen. Ihm sollte es nur recht sein. Während die beiden sich näherten, setzte er die Flasche an den Hals und nahm einen Schluck.
Sie wollten nach Monaco, nicht weil sie diese Stadt liebten, sondern wegen des Geldes. Sie sagten tatsächlich, nicht, weil sie die Stadt liebten.
Da wolle er nicht hin, sagte er in seinem gebrochenen Italienisch, er wolle nur den Himmel sehen. Als sie ihn verständnislos ansahen, ergänzte er, des Nachts, wegen der Sterne.
Er reichte ihnen die Flasche und sie ihm ein Stück Baguette. Bald waren sie sich einig. Niemand würde heute nach Monaco fahren, sondern in die Nähe eines Flusses, abseits der großen Straßen, den die beiden von früher kannten. Sie schwärmten regelrecht von diesem Fluss, seinen verschlungenen Canyons und den Fischen, die man in den glasklaren Gewässern mit den Händen greifen könne.
Sie waren ein Paar, kaum über zwanzig Jahre alt und seit dem Frühjahr unterwegs. Emilio war vielleicht eine Handbreit kleiner als seine Begleiterin, von eher gedrungener Statur und mit einem forschen Lächeln im Gesicht. Ihren Lebensunterhalt verdienten die beiden in den Semesterferien mit der Anfertigung und dem Verkauf von Schmuck.
Nach den letzten Tagen, in denen er mit keiner Menschenseele ein Wort gewechselt hatte, genoss er die unbeschwerte Art, mit der Francesca, so hieß die junge Frau, ihrer Begeisterung für Landschaft und Leute Ausdruck verlieh. Immer wieder zeigte sie durch das geöffnete Seitenfenster, um auf etwas aufmerksam zu machen. Ihre Augen waren von einem tiefen Dunkel und verengten sich seitwärts, besonders wenn sie lachte. Sie erinnerte ihn an das Bildnis einer Peruanerin, das er vor Jahren ersteigert und an die einzige freie Stelle an der Wand seines Arbeitszimmers gehängt hatte.
Geld schien seine beiden Reisebegleiter nicht zu bekümmern, obwohl sie ständig, auch jetzt im Wagen, an irgendwelchen Broschen, Ohrringen oder anderen aus Silberdraht gefertigten Teilen herumbastelten. Sie wollten, so erzählte Emilio, eigentlich ihren Schmuck auf einem Flohmarkt in Monaco verkaufen, aber das könne auch warten.
Als sie schließlich von der Nationalstraße abbogen, um näher an die Ardèche heranzukommen, dämmerte es schon. Sie kauften noch zwei Flaschen Wein, Wasser, Käse und das unvermeidliche Baguette, das bald den Wagen mit seinem Duft erfüllte. Weit kamen sie nicht mehr. Bald war es dunkel und dem nicht asphaltierten Weg zu folgen, behagte ihm nicht.
Bleiben wir einfach hier, meinte Emilio plötzlich und griff, während der Wagen noch fuhr, schon nach seinem Rucksack. „Warte, Emilio“, sagte Francesca und warf Jonathan einen Blick zu, so als wolle sie um sein Einverständnis bitten.
Doch auch Jonathan hatte im Scheinwerferlicht die Zufahrt zu einem Feld erspäht und konnte noch gerade rechtzeitig halten, denn im Dunkeln auf dem schmalen Weg zu wenden wäre unmöglich gewesen. Er stellte den Wagen ab und öffnete die Tür. Die Luft war jetzt abgekühlt, nur über den Feldern, auf denen bis vor Kurzem die Sonne gestanden hatte, waberten noch warme Schwaden und verbreiteten einen unverwechselbaren Duft: Lavendel! Sie standen tatsächlich am Rand eines Lavendelfelds!
Emilio und Francesca hoben ihre Rucksäcke aus dem Wagen und rollten im flackernden Licht eines Feuerzeugs gleich neben dem Auto ihre Isopor- Matten aus. Im Handumdrehen breiteten sie ihre Schlafsäcke aus. Lachend lud Francesca ihn ein, sich doch zu ihnen zu setzen. Er selbst war immer noch wie betört von diesem unbeschreiblichen Aroma. Die Dunkelheit hatte hier nichts Bedrohliches, nichts Kaltes oder Abweisendes, sie duftete und schien sie mit weit geöffneten Armen zu empfangen. Welch ein Kontrast zu den bangen Stunden, die er in den Tagen zuvor erlebt hatte.
Bald saßen sie beieinander auf dem Boden, jeder mit einem Stück Brot und Käse in der Hand. Die erste Rotweinflasche war bald geleert und die zweite ging nun in geruhsameren Abständen von Hand zu Hand.
„Die Sterne,“ sagte Francesca, „da sind sie.“ Sie hatte sich hingelegt, er tat es ihr nach, war es doch so einfacher nach oben zu sehen, in das von keinem Nebel getrübten Firmament. Emilio schien sich für Francescas Entdeckungen, die sie manchmal mit halblauten Ausrufen der Freude begleitete, nicht zu interessieren. Er hatte sich an den Wagen gelehnt und rauchte irgendein Zeug, dessen Duft sich mit dem des Lavendels vermischte. Nur Francesca wies zuweilen hierhin und dorthin, nannte einige Namen, die Jonathan bekannt vorkamen, bis ihm, durch den Wein und den Wohlklang ihrer Stimme in eine angenehme Ruhe versetzt, schließlich die Augen zufielen.
Als er erwachte, staunte er nicht schlecht. Schon nach ein paar Schritten auf dem Feldweg, in den er gestern im Dunkeln eingebogen war, konnte er sehen, dass das Lavendelfeld nach vielleicht zweihundert Metern jäh endete.
„Die Ardèche,“ sagte Francesca, „hörst du das Wasser?“
Sie fanden eine Stelle, an der es möglich war, bis nach unten an den Fluss zu gelangen. Erst als er sich umsah, wurde ihm klar, auf welch halsbrecherischem Weg sie dies geschafft hatten. Ihm grauste schon vor dem Rückweg, waren seine Begleiter doch um etliche Jahre jünger als er – und er war schon beim Abstieg außer Atem geraten.
Ihre Morgentoilette verrichteten Emilio und Francesca in den klaren Fluten des Flusses, der sich im Laufe der Jahrtausende tief in die Landschaft eingegraben hatte. Unzählige flache Becken, aber auch halbmeterhohe Wasserfälle und mitreißende Strudel hatten sich dort unten zwischen den Felsen gebildet. Zuerst etwas zögernd, doch dann entschlossen, tat er es ihnen nach und zog seine verschwitzten Kleider aus. In einer knietiefen Mulde hockend ließ er das vorbeiströmende Wasser seinen Körper kühlen, während die beiden hinter einem Felsen miteinander Schabernack trieben.
Wie er erwartet hatte, war der Aufstieg mühsam. Einmal wäre er fast gestürzt, hätte er nicht im letzten Augenblick Halt im niedrigen Gebüsch gefunden. Seine Unterarme waren zerkratzt und in der Hand steckten allerlei Stacheln, die Francesca, kaum dass er oben angekommen war und von seinem Malheur berichtete, geschickt, mit der feinsten ihrer Zangen, die sie sonst zum Biegen des Drahtes benutzte, aus seiner Haut zog. Dabei benutzte sie einige Male seine Brille als Lupe, deren Gläser sie, nach getaner Arbeit, anhauchte und mit einem Zipfel ihrer leinenen Bluse polierte. Sie blieben an der Ardèche noch vier Tage. Nicht genau an der Stelle, wo sie angekommen waren, sondern in der Nähe eines mittelalterlich anmutenden Dorfes, in dem es ein kleines Lebensmittelgeschäft gab und sie mit dem Nötigsten versorgte. Zu Jonathans Freude bot dasselbe Geschäft auch allerlei Nützliches für die wenigen hier herumstreunenden Touristen an, meistens junge Leute mit Rucksack und wenig Geld. Er erstand eine billige Luftmatratze, aus deren unterem Drittel gleich in der ersten Nacht die Luft entwich, und einen Schlafsack. Emilio hatte einen Gaskocher und ein Aluminiumtöpfchen dabei, sodass nur noch eine Gaspatrone fehlte, die Jonathan gern beisteuerte, um ihren Hausrat zu vervollständigen.
Francesca erwies sich als eine ausgezeichnete Köchin. Er mochte besonders ihre in Olivenöl gebratenen Auberginen, begleitet von geschnittenen Tomaten und Zwiebeln, beide so riesig und saftig, wie sie nur im Süden vorkommen. Emilio hatte sich aufs Angeln spezialisiert. Da er frühmorgens loszog, brachte er, pünktlich zur Mittagsstunde, einige Fischchen mit. Was denen an Größe fehlte, machte ihre Anzahl wett, und so konnte sich niemand beklagen. Und das Baguette, der Käse und der Wein stillten jeglichen vielleicht doch verbliebenen Hunger.
In den Stunden zwischen den Mahlzeiten lagen sie auf dem Rücken, sahen dem Spiel der Wolken zu, hörten Musik aus dem Autoradio oder verfolgten die Passagierflugzeuge, die weiße Striche durch den Himmel zogen.
„Wann sind deine Ferien zu Ende? Wovon lebst du?“, fragte Francesca plötzlich.
„Ich schreibe“, sagte er. „Ich muss ein Buch schreiben, in dem nur das Wichtigste erzählt wird.“
„Das Wichtigste? Was meinst du damit?“
Über ihnen zog gerade wieder ein Flugzeug vorüber, blinkte kurz in der schon tief am Himmel stehenden Sonne und verschwand hinter einer Wolke. Francesca hatte ihr Kinn auf der flachen Hand aufgestützt und kaute vorsichtig an einem Grashalm, sagte nichts, sah ihn lange von der Seite her an und erhob sich dann.
„Komm, wir gehen spazieren!“ Sie sprang auf und hielt ihm die Hand hin, um ihm beim Aufstehen behilflich zu sein. Er griff nach ihr und war erleichtert, dass sie auf keiner Antwort bestanden hatte. Einige Schritte lang ließ sie seine Hand nicht los. Sie zog ihn vorwärts wie ein Kind, das dem Vater etwas zeigen wollte, und führte ihn quer durch ein Lavendelfeld, das seit Tagen in voller Blüte stand. Die Pflanzen, bewegt durch ihre Schritte, verteilten ihr Aroma noch intensiver als sonst. Schließlich kamen sie an ein Mäuerchen, hinter dem das Gelände steil abstürzte. Sie setzte sich und lud ihn ein, dasselbe zu tun.
Irgendwo da unten, man konnte es hören, war der Fluss. Die Sonne sandte ihre letzten Strahlen durch die Wolken, die den Horizont fast verdeckten, und färbte den Himmel langsam rot.
Francescas Teint wurde in das Lichtspiel über ihnen sanft einbezogen. Ein rötlicher Ton hatte sich auf ihr Gesicht gelegt und verlieh ihr einen Ausdruck von Milde, den Jonathan an etwas erinnerte, das er nicht benennen konnte. Es war keine andere Frau und sicherlich nicht das Foto in seinem Arbeitszimmer. Es war vielmehr ein Gefühl tief unten in seiner Seele, das er lange nicht gespürt hatte.
Francesca hatte bemerkt, dass Jonathan sie beobachtete und schüttelte ihren schwarzen Lockenkopf.
„Sieh dir den Himmel an,“ sagte sie, „du verpasst etwas.“
Emilio, der schon an ihrem Rastplatz war, als sie endlich zurückkehrten kramte in seinem Rucksack herum und warf Francesca auf Italienisch einige unverständliche Worte zu. Jonathan zog es vor, sich ins Auto zurückzuziehen und fand bald einen Sender, der die lauter werdende Stimme Emilios übertönte. Einmal, in einer kurzen Pause zwischen zwei Schlagern, die das regionale Radio fast ohne Unterbrechung sendete, meinte er, Francesca weinen zu hören. Den Impuls das Auto zu verlassen und Francesca beizustehen, konnte er nur mit Mühe unterdrücken, er wäre sich aber lächerlich vorgekommen, in eine Situation, die ihn nichts anging, einzugreifen. In dieser Nacht schlief er im Auto und fragte sich, während er auf dem unbequemen Liegesitz kaum Schlaf fand, warum er sich nur auf diese Reise eingelassen hatte.
Es war schon fast Mittag, als sie schließlich im Wagen saßen. Sie hatten noch einmal ausgiebig in der Ardèche gebadet und auch das Auto, ihre Schlafsäcke und alle anderen Utensilien einer gründlichen Reinigung unterzogen. Von Monaco, das Emilio und Francesca ursprünglich als Ziel angegeben hatten, war keine Rede mehr. Aber die Stimmung war wieder besser und Emilio versuchte sogar, Francesca vor Jonathans Augen einen Kuss zu geben, dem diese aber durch eine charmante Seitenbewegung des Kopfes im letzten Moment auswich.
Nach Italien sollte es gehen. Vielleicht in die Toskana, wo die beiden wohnten, vielleicht bis Rom oder, wer konnte das jetzt schon wissen, nach Neapel. Er hatte eingewilligt, machte nur zur Bedingung, eine Straßenverbindung ohne Tunnel zu wählen. Emilio lachte und meinte, wenn es nur das wäre, dann kämen sie sogar bis Sizilien.
Er war schon einige Male in Italien gewesen, in jüngeren Jahren. Warum nicht ein letztes Mal die Orte besuchen, die ihn damals so unbeschreiblich fasziniert hatten.
„Ein letztes Mal?,“ sagte Francesca und sah ihn an wie gestern, als sie auf dem Grashalm kaute. „Warum dann nicht nach Venedig?“ –
„Ja, warum nicht nach Venedig,“ antwortete er und nahm den Fuß vom Gaspedal, da die Straße gerade eine scharfe Kurve machte und ihnen ein Lastwagen entgegenkam.
Irgendwo in der Po-Ebene – den Verkehr um Mailand herum hatten sie endlich hinter sich gelassen – hielt er vor einem Motel direkt an der Straße. Nach der schlecht geschlafenen letzten Nacht und der langen Fahrerei war er rechtschaffend müde und brauchte heute ein richtiges Bett. Einige Lastwagen parkten gleich nebenan, was er als Zeichen deutete, dass die Unterkunft praktisch und billig war.
„Wir zwei schlafen heute im Auto,“ sagte Emilio. – „Falls du nichts dagegen hast,“ „ergänzte Francesca, den etwas ruppigen Tonfall Emilios abmildernd.
Ihm sollte es nur recht sein. Er brauchte Schlaf, dringend Schlaf. Er atmete schwer. So willkommen ihm die Ablenkung durch die beiden auch war, so lastete doch immer noch der Verlust all seiner Literatur auf ihm. Seine Bücher waren sein Leben gewesen. Und jetzt sollte es nur das Eine geben, das allem anderen einen Sinn gab. Aber wo war dieser Sinn? Und was genau war das Wichtigste, über das sich lohnte noch ein Buch zu schreiben.
So aßen sie noch eine Kleinigkeit im Restaurant, tranken ein Bier und verabschiedeten sich.
„Den Schlüssel,“ … sagte Francesca und streckte ihm die Hand hin.
Er legte ihr den Autoschlüssel in die geöffnete Hand, die er am liebsten ergriffen hätte, so verlassen fühlte er sich.
„Morgen ist ein anderer Tag,“ sagte Francesca, der seine Stimmung nicht entgangen war. Sie drehte sich rasch zu Emilio um und zog in fort.
Jonathan machte sich auf den Weg in sein Zimmer im zweiten Stock. Stufe um Stufe fühlte er das Gewicht seiner Reisetasche und des unbeschriebenen Heftes, das darauf wartete vom Wichtigsten Notiz zu nehmen.
Nachdem er ausgiebig geduscht hatte, stieg er in den Speisesaal hinab und bestellte einen Milchkaffee und ein Omelett. Ob Francesca und Emilio nicht auch frühstücken wollten? Er trat vor die Tür. Offenbar waren in der Nacht noch mehr Lastwagen angekommen. Sein Auto war von einem monströsen Gefährt vollkommen verdeckt, das, so sah es auf den ersten Blick aus, mit Brettern beladen war. Er machte ein paar Schritte um den LKW herum und sah bald Francesca. Sie saß bei geöffneter Tür auf dem Beifahrersitz und bog an irgendwelchen Drähten herum.
„Wollt ihr mit mir frühstücken? Ich lade euch ein.“ Francesca wies stumm auf den Lastwagen mit den Brettern, dann sagte sie: „Das sind Kirchenbänke. Zersägte Kirchenbänke.“
Jonathan verstand nicht gleich und dachte an sein Omelett, das wohl schon auf dem Tisch stand.
„Und der,“ jetzt wies sie auf den Lastwagen gegenüber, „hat Glocken geladen, die meisten sind kaputt.“
Zersägte Kirchenbänke und zersprungene Glocken. Er sah von einer Seite zur anderen und verstand nicht.
Emilio, der eine Runde auf dem Parkplatz gedreht hatte, erschien, wollte etwas sagen, klappte aber nur den Mund auf und zu.
„Lass uns reingehen,“ sagte Jonathan, „mein Kaffee wird kalt.“
Am Tisch hatte Emilio seine Sprache wiedergefunden. Er berichtete, dass er sich alle Lastkraftwagen, es mochten an die zehn sein, angesehen hätte. Alle, ohne Ausnahme, seien aus Venedig, ein Fahrer hätte ihm dieses bestätigt.
„Und?“ fragte Jonathan, immer noch nicht recht wissend, was das alles sollte.
„Einer ist voll mit Kirchenfenstern beladen. Einige sind zerbrochen, aber die meisten noch gut erhalten.“ –
„Ein Antiquitätentransport?“ Emilio sah ihn an, kam näher heran und flüsterte: „Eines der Fenster ist aus der Kathedrale von Choggia in der Nähe von Venedig, ich kenne es.“
Jonathan wusste, dass Emilio Kunstgeschichte studiert hatte, sodass kein Grund bestand, an seiner Aussage zu zweifeln.
„Und zwei andere sind voll mit Stücken von Mosaiken, überwiegend goldfarbene, wie sie in den Kuppeln des Markusdoms verbaut wurden.“
Auch Jonathan war schon im Markusdom gewesen und erinnerte sich wohl, wie er von den Mosaiken und der sie einrahmenden goldenen Pracht hoch über ihm beeindruckt war. Und die sollten zerbrochen auf einem Lastwagen liegen?





























