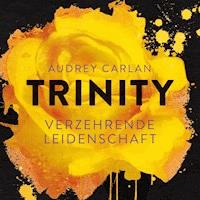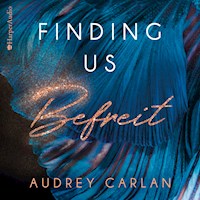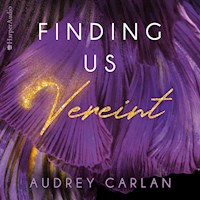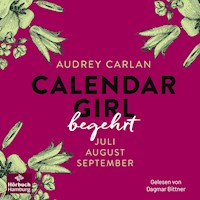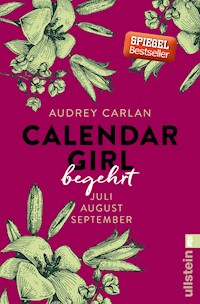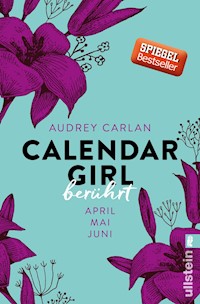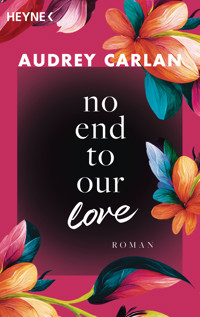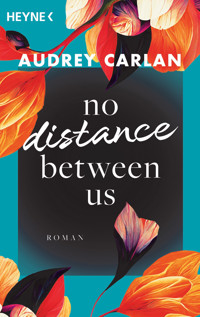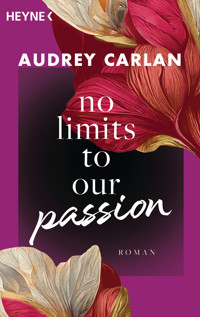
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Soul-Sisters-Reihe
- Sprache: Deutsch
Im dunkelsten Moment findet Simone die Liebe. Doch sie darf nicht sein.
Zweimal hat sich das Leben von Simone grundlegend verändert. Das erste Mal, als sie ihre Eltern verloren hat. Zusammen mit ihrer älteren Schwester wächst sie im Kerrighan House auf, einem Kinderheim, in dem beide eine neue Familie finden. Beim zweiten Mal wird Simone vom sogenannten Backseat Strangler überfallen und in allerletzter Sekunde von Jonah, einem ebenso attraktiven wie grüblerischen FBI-Agenten, gerettet. Da Simone weiter in Gefahr ist, beschließt Jonah, sie nicht mehr aus den Augen zu lassen. Obwohl er sich geschworen hat, nie etwas mit einer Frau anzufangen, die unter seinem Schutz steht, wird die Anziehung zwischen den beiden immer größer. Kann die lebensfrohe Simone die Schatten seiner Vergangenheit vertreiben – oder wird Jonah ausgerechnet an diesem Auftrag scheitern und Simone für immer verlieren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Kaum hatten wir meine Wohnanlage erreicht, war mir klar, dass irgendetwas nicht stimmte. Der Riegel meines Fensters oben stand offen, sodass sich die weiße Gardine im Wind bauschte.
»Das Fenster sollte nicht offen sein.« Ich packte Jonahs Unterarm und blieb wie gelähmt sehen. Er deutete mit dem Kinn auf mein Apartment im zweiten Stock. »Dort oben wohnen Sie?«
Ich nickte. »Okay, bleiben Sie hier draußen. Wir gehen zuerst hinein.«
Mein Herz pochte so heftig, dass es sämtliche anderen Geräusche übertönte. Ich hörte keine Autos. Keine Nachbarn. Keine Vögel. Nichts. Nur meinen eigenen Atem. Und meinen Herzschlag. Schließlich tauchte Jonah wieder an der Wohnungstür auf. Seine Miene war ausdruckslos. Ohne nachzudenken rannte ich einfach los. Zwei Stufen auf einmal nehmend flog ich die Treppe hinauf und prallte oben gegen ihn. Sofort schlang ich die Arme um ihn. Er wich einen Schritt zurück und keuchte, hielt dann aber abrupt inne, zog mich an sich, eine Hand an meinem Nacken, die andere an meiner Taille. Zitternd wartete ich darauf, dass meine Nerven sich beruhigten.
»Schon gut. Alles in Ordnung.« Er strich mir über den Rücken.
Die Autorin
Audrey Carlan ist eine international erfolgreiche Bestsellerautorin. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre prickelnden Romance-Reihen Calendar Girl,Trinity und Dream Maker. Ihre Bücher wurden weltweit in über 30 Sprachen übersetzt. Audrey Carlan lebt gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im California Valley. Wenn sie nicht schreibt, gibt sie Yoga-Unterricht, trinkt mit ihren »Seelenschwestern« Wein oder steckt mit ihrer Nase in einem sexy Liebesroman.
Lieferbare Titel
978-3-453-42430-2 – My Wish – Breite deine Flügel aus
978-3-453-42456-2 – My Wish – Strahle wie die Sonne
978-3-453-42457-9 – My Wish – Genieße jeden Moment
978-3-453-42458-6 – My Wish – Greife nach den Sternen
Audrey Carlan
no limits to our
passion
Aus dem Amerikanischen vonNicole Hölsken
Wilhelm Heyne VerlagMünchen
Die Originalausgabe Wild Child (Soul Sisters 1) erschien erstmals 2020.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstausgabe 07/2024
Copyright © 2020 by Audrey Carlan, Inc.
Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Anita Hirtreiter
Umschlaggestaltung: bürosüd, München, unter Verwendung von Motiven von © www.buerosued.de
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-29084-9V002
www.heyne.de
Für Dorothy Bircher.
Danke, meine Freundin, dass du deinen Schmerz und
die Wahrheit über dich mit mir geteilt hast.
Unser schwesterliches Band ist dadurch nur umso stärker geworden – ebenso wie dieses Buch.
Kapitel 1
Der heutige Tag war der allerschlimmste meines Lebens. Na ja, abgesehen von dem, an dem ich meine Eltern bei einem Hausbrand verloren hatte, als ich erst sechs war. Allerdings habe ich keine Erinnerungen an diese Nacht und auch nicht allzu viele an meine Kindheit, bevor ich vor einundzwanzig Jahren von meiner Pflegemom aufgenommen wurde.
Es begann damit, dass ich mir schon morgens eine Tasse brühend heißen Kaffees über meine einzige saubere Uniform schüttete, weshalb ich die schmuddelige vom Abend zuvor tragen musste, die ich noch nicht gewaschen hatte. So hatte ich den ganzen Tag über das Gefühl, nach fettigen Hamburgern und Schweiß zu riechen.
In meiner Mittagspause trennte sich dann mein Freund am Telefon von mir – wenn ich ihn überhaupt so nennen durfte, denn eigentlich war es eine klassische On-off-Beziehung. Im Hintergrund hörte ich dabei das Kichern einer Frau. Die neueste seiner zahllosen Eroberungen. Ich vermutete bereits länger, dass er mich betrog, aber aus irgendeinem Grund hatte ich mir trotzdem eingebildet, dass das zwischen uns mehr war. Vielleicht, da ich es leid war, eine Affäre nach der nächsten zu haben. Und ganz ehrlich: Der Sex mit ihm war einfach toll. Was das betraf, konnte ich echt nicht klagen. Jetzt fragte ich mich jedoch, ob er nur deswegen so gut im Bett war, weil er mit jeder Frau schlief, die ihn im Job anbaggerte. Das Ätzendste aber war, dass ich Trey morgen Abend bei der Arbeit sehen würde. Und natürlich würde er ein unschuldiges Lächeln aufsetzen und mich fragen, wie es mir ging. Er würde weiter mit mir spielen, während er mit anderen Frauen herummachte.
Ich biss die Zähne zusammen und sah durch die Windschutzscheibe auf die weite, dunkle Straße hinaus, während ich mich daran erinnerte, was mein beschissener Chef in dem Diner, in dem ich kellnerte, vor einer halben Stunde zu mir gesagt hatte und wodurch mein ohnehin schon blöder Tag zur Vollkatastrophe geworden war.
»Weißt du, Simone, wenn du einfach bloß ein artiges Mädchen wärst und mir gäbst, was ich will, würde ich dafür sorgen, dass du bei der nächsten Gehaltsabrechnung fünfzig Cent mehr bekommst. Wenn du brav bist, sogar noch mehr.«
Natürlich hatte er zuvor seine Hand unter den vorgeschriebenen blassrosa Uniformrock gleiten lassen und meinen Hintern begrapscht. Als ich mich umgewandt und dem schmierigen Typen eine Ohrfeige verpasst hatte, hatte er angekündigt, mich beim Besitzer des Diners der sexuellen Belästigung bezichtigen zu wollen. Dabei war es genau anders herum gewesen. Dieser Widerling stürzte sich auf alles, was nicht bei drei auf dem Baum war, worunter nicht nur die anderen Kellnerinnen zu leiden hatten. Er schreckte auch vor den weiblichen Gästen nicht zurück. Die merkwürdigerweise nie wieder kamen, um sich seine Zudringlichkeit nochmals gefallen zu lassen.
Nachdem ich ihm eine geschmiert hatte, riss ich mir die Schürze vom Leib, warf sie ihm ins Gesicht und schrie: »Ich kündige!«, während er mich bloß schockiert anstarrte.
Wenigstens das hatte sich gut angefühlt.
Zumindest zu diesem Zeitpunkt.
Jetzt hatte ich einen weiteren lausig bezahlten Nebenjob verloren, obwohl ich das Geld dringend brauchte. Anders konnte ich mir mein Studium, das ich online am Community College absolvierte, nicht leisten. Meine Haupteinnahmequelle war meine Stelle als Barkeeperin, mit der ich Miete, Nebenkosten und Benzin finanzierte. Sonntags half ich im örtlichen Blumenladen aus, der Mama Kerris bester Freundin gehörte. Aber auch mit dem Bargeld, das ich hier steuerfrei zugesteckt bekam, konnte ich keine großen Sprünge machen. Außerdem war eine Wohnung im Einzugsgebiet von Chicago, in einer sicheren Gegend mit guter Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel, auch nicht gerade billig. Ich hätte mir ja durchaus eine Mitbewohnerin gesucht, doch ich hatte nur ein kleines Apartment, in dem lediglich Platz für eine Person war. Der Job als Kellnerin, den ich gerade geschmissen hatte, deckte die Studiengebühren ab und sorgte in weiten Teilen für meine Mahlzeiten. Oft brachte ich Fehlbestellungen oder Beilagen mit nach Hause, die der Koch für mich abgezweigt hatte. Mit ganzen drei Teilzeitstellen konnte ich mir das schäbige Leben, das ich mir geschaffen hatte, immer noch kaum leisten. Dabei wollte ich mehr. Ich hoffte auf mehr. Arbeitete hart, um mehr zu erreichen.
Ich seufzte tief in die abgestandene Luft des Wageninneren hinein. Wie sehr ich mir ein anderes Leben wünschte! Eines Tages wollte ich einfach in einen Laden gehen und mir ein Outfit kaufen können, ohne mir Sorgen darüber zu machen, welche Rechnung ich nicht würde bezahlen können, weil ich mir diesen Luxus gegönnt hatte. Vielleicht sogar hin und wieder abends ausgehen. Ich wollte meine Pflegemom und meine Schwestern nicht länger um kostenloses Essen und abgelegte Kleidung anschnorren müssen. Bis zum heutigen Tag trug ich meine Schmutzwäsche zu Mama Kerri, um meine sauer verdienten Trinkgelder nicht für die Vierteldollarmünzen zu verschwenden, die man in die Münzautomaten im Waschsalon warf.
»Ich bin so eine Versagerin«, brummte ich in den leeren Wagen hinein. Auch das Radio in meinem Auto funktionierte nicht, und ich konnte mir weder eine Reparatur noch eine schicke neue Anlage leisten. Eines Tages jedoch, wenn ich meinen Abschluss in Business Administration in der Tasche und endlich etwas aus meinem Leben gemacht hatte, würde ich mir einen glänzenden Neuwagen kaufen. Einen, der morgens auch immer ansprang.
Als ich vor mir eine Tankstelle auftauchen sah, setzte ich den Blinker und steuerte meinen abgewrackten, fünfzehn Jahre alten roten Honda Civic neben eine der Zapfsäulen.
Ich kramte in meiner Tasche herum und fand eine zerknitterte Zwanzig-Dollar-Note. »Juhu!« Ich vollführte einen kleinen Freudentanz auf meinem Sitz, öffnete mein Portemonnaie und holte die beiden Fünfer heraus. Ein paar nette Leute hatten mir heute Abend mehr Trinkgeld gegeben als erwartet. Dreißig ganze Dollar für Benzin … Halleluja!
Da ich wusste, dass ich nicht mehr genug auf dem Bankkonto hatte, um mit Karte bezahlen zu können, hastete ich in den Laden, wartete in der Schlange, bis ich dran war, und gab mein letztes Bargeld für Sprit aus.
»Danke, Mann.« Ich winkte dem Kassierer zum Abschied zu und begab mich wieder nach draußen.
Während das Benzin in meinen Tank lief, holte ich mein Handy heraus und überflog die Nachrichten.
Von: Sonia
Ich habe nächsten Monat ein Dinner in der Stadt. Willst du mich begleiten?
Schaudernd las ich die Nachricht noch einmal und dachte fieberhaft über eine Ausrede nach, denn ich hatte überhaupt keine Lust, mit meiner Schwester geschniegelt und gestriegelt zu einem ihrer langweiligen Partei-Abendessen zu gehen. Sonia war meine einzige Blutsverwandte und zufällig auch Senatorin. Richtig gehört. Mit ihrem an die hundert Mitarbeiter zählenden Stab lenkte sie die Geschicke eines ganzen Bundesstaates, und das schon seit vier Jahren. Sie war die jüngste Senatorin aller Zeiten. Während ich nicht mal in der Lage war, meinen Job in einem lausigen Diner zu behalten, in dem ich nur den Mindestlohn bekam.
Ohne auf ihre Nachricht zu antworten, las ich nun eine weitere von meiner Pflegeschwester Addison. Genannt Addy.
Von: Addison
Nächstes Wochenende bin ich in der Stadt. Dann sind Blessing und ich von dem Shooting zurück. Lass uns zu dritt feiern gehen!
Das wiederum würde sicher Spaß machen. Mit zwei meiner Pflegeschwestern durch die Clubs zu tingeln, war genau das Richtige, um meine Laune zu heben. Schnell tippte ich ein Total gern! als Antwort und widmete mich der nächsten Nachricht.
Sie war von Trey. Mist.
Von: Trey
Hey, Baby. Tut mir leid wegen vorhin. Bleiben wir Freunde?
Ich verdrehte die Augen und knurrte vor mich hin, ignorierte seine Nachricht aber. Mein Gott, wie sehr ich Männer wie ihn hasste! Erst brachen sie einem das Herz, und dann wollten sie Freunde bleiben? Was sollte das? Allerdings weinte ich mir seinetwegen auch nicht gerade die Augen aus dem Kopf. Eigentlich sollte ich ihn nicht weiter auf die Folter spannen. Doch nach dem Tag, der hinter mir lag, hatte ich kein Interesse daran, mich nett oder gar höflich zu verhalten. Ich würde ihn noch ein bisschen zappeln lassen, denn mal ehrlich: Der Arsch hatte es verdient.
Diese Entscheidung hob meine Laune ein wenig. Nicht sehr, aber immerhin etwas.
Ein Klicken des Zapfhahns signalisierte mir das Ende des Tankvorgangs. Ich steckte ihn wieder in die Zapfsäule, schnappte mir den Kassenzettel, schloss den Tankdeckel und umrundete gemächlich mein Auto. Als ich mich umwandte und einstieg, sah ich, wie der Kassierer mir mit beiden Armen wild zuwinkte. Komisch. Ich kniff die Augen zusammen und bemerkte, dass er mir bedeutete, noch einmal zu ihm zu kommen.
Was immer er auf dem Herzen hatte, ich hatte keine Zeit, mich darum zu kümmern. Also winkte ich ihm stattdessen lächelnd noch einmal zu, schloss die Tür und sauste in die Nacht hinaus, nach Hause. Ich brauchte Schlaf, Tequila und die zweite Hälfte des Burrito, den ich mir von meinem gestrigen Ausflug zum Mexikaner aufgehoben hatte.
Mmmh. Ich konnte die mit Hackfleisch, Reis und Kidneybohnen gefüllte Köstlichkeit bereits schmecken, die ich bald im Bauch haben würde. Ein Hauch Limettensaft, vielleicht ein wenig Sour Cream … himmlisch. Mein Magen knurrte, und ich gab Gas.
Etwa zehn Minuten vor Erreichen meiner Wohnung und gute acht Kilometer hinter der Tankstelle, die ich gerade verlassen hatte, begannen die Sirenen zu plärren. Ich sah in den Rückspiegel und entdeckte die blinkenden roten und blauen Lichter hinter mir. Offenbar hatte der Wagen es auf mich abgesehen, denn er überholte nicht.
Verdammt und zugenäht!
Was jetzt?
Ich atmete tief ein, und sogleich brannten mir Tränen in den Augen. Ich konnte mir keinen Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit leisten.
Bitte, lieber Gott, mach, dass ich nur eine Verwarnung bekomme! Bitte, bitte, bitte. Dann opfere ich mich auch für Sonia und gehe mit ihr zu diesem blöden Dinner.
So behutsam wie möglich setzte ich den Blinker und fuhr an den Straßenrand. Die Gegend war ein bisschen unheimlich und lag in einem Industriegebiet, in dem sich abends nicht mehr allzu viele Leute aufhielten.
Mithilfe der Yoga-Atemübungen, die Mama Kerri mir beigebracht hatte, versuchte ich, die Ruhe zu bewahren. Im Laufe der Jahre hatte unsere Pflegemom uns jede Woche eine Yogastunde gegeben, bei der wir acht »Schwestern« im – wie sie es nannte – Kreis der Einheit lagen, atmeten und uns an den Händen hielten.
Trotzdem liefen mir Tränen über die Wangen, als ich das Fenster herunterkurbelte und in den Seitenspiegel sah.
Die Silhouette einer großen, dunklen männlichen Gestalt hob sich von dem einzelnen rot-blauen Blinklicht ab. Jener Art von Blinklicht, wie man sie auf Zivilfahrzeugen der Polizei sah. Langsam näherte sich der Mann. Er hatte die Waffe gezückt und hielt sie an der Seite nach unten. Er trug eine schwarze Stoffhose und ein Sakko in derselben Farbe, aber mehr war nicht zu erkennen. Ich konnte mich ohnehin nur auf die Waffe in seiner Hand konzentrieren.
Hatte man bei Routine-Kontrollen immer seine Waffe dabei? Und warum war er nicht im Streifenwagen hier? Wieso hatte er keine Uniform an, sondern einen Anzug?
O mein Gott! Hielt er mich etwa für eine Kriminelle? Ich meine, früher war der Wagen auf Sonia zugelassen gewesen, doch nachdem sie sich ein luxuriöseres Auto zugelegt hatte, hatte sie ihn mir überlassen. Ein paar Sekunden lang grübelte ich darüber nach, ob noch immer ihr Name auf den Papieren stand. Nein, es war meiner. Schließlich hatte ich dieses Jahr die Zulassungsgebühr bezahlt. Ja. Ich nickte vor mich hin, während der Cop näher kam.
»Ma’am, Hände ans Steuer«, verlangte eine leise und sehr tiefe Stimme.
Mist. Das kannte ich. Das kannte heutzutage jeder.
Ich legte meine zitternden Hände aufs Lenkrad und wandte den Kopf zur Seite, um ihn ein wenig aus dem Fenster zu recken.
»Tut mir leid, Officer. Ich meine …«
»Ma’am, steigen Sie bitte aus dem Fahrzeug aus.« Sein Ton war energisch und duldete keinen Widerspruch.
»Ähm, und wieso? Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich zu schnell gefahren bin. Ich schwör’s. Mir geht jede Menge durch den Kopf, und ich bin gerade gefeuert worden … na ja, genau genommen habe ich gekündigt, weil mein Boss mich belästigt und meinen Hintern betatscht hat und …«
»Ma’am, raus aus dem Fahrzeug, und zwar sofort!«, forderte er mich wieder auf.
»Aber warum? Ich-ich … ist das normal?« Meine Stimme brach.
»Ich habe Grund zu der Annahme, dass Sie dieses Fahrzeug gestohlen haben und illegale Substanzen darin transportieren. Bitte folgen Sie meiner Anweisung und steigen Sie aus. Dabei müssen Ihre Hände jederzeit sichtbar sein. Greifen Sie nicht nach irgendwelchen Gegenständen im Innern des Wagens.«
Mein Herz pochte so heftig, dass ich jeden Moment mit einem Herzinfarkt rechnete.
Autodiebstahl. Drogen.
Was zum Teufel war hier los?
»Officer …« Ich warf einen Blick auf die goldene Marke, die an seinem Gürtel befestigt war, die aber nicht wie die normale Dienstmarke eines Polizisten aussah. Die Scheinwerfer seines Wagens beleuchteten die glänzenden Buchstaben F-B-I. »Wirklich, das ist ein Missverständnis. Ich bin die rechtmäßige Besitzerin dieses Fahrzeugs, und ich habe keinerlei Drogen und auch noch nie welche genommen.« Ich streckte den rechten Arm Richtung Handschuhfach aus. »Ich kann Ihnen meine Fahrzeugpapiere zeigen und …«
»Raus. Aus. Dem. Fahrzeug!«, befahl er mir knurrend.
»Okay, okay. Ähm, aber ich muss erst den Gurt lösen.«
»Los. Und dann Hände hoch.«
Ich gehorchte, musste den Knopf sogar zweimal drücken, bevor es mir gelang, ihn zu öffnen. Wie verlangt hob ich die Hände, packte den Türgriff und stieß die Tür auf. Sie quietschte so laut, dass mir ein Schauer über den Rücken lief; sämtliche Türen gaben dieses Geräusch von sich. Das war schon seit einem geschlagenen Jahr so, und ich hatte keine Ahnung, was ich dagegen unternehmen sollte. Trey, mein untreuer Ex-Freund, hatte nicht mal den Versuch unternommen, sie zu reparieren. Der nichtsnutzige Loser. Noch ein Punkt, der gegen ihn sprach.
Meine erhobenen Hände zitterten nach wie vor, und ich weinte.
»Tür schließen!«, bellte er.
Ich gehorchte erneut und musste im hellen Scheinwerferlicht blinzeln.
»Und jetzt folgen Sie mir! Setzen Sie immer einen Fuß vor den anderen«, wies er mich an, als spräche er mit einem Kind.
»Verhaften Sie mich etwa?« Meine Brust zog sich schmerzhaft zusammen.
»Ma’am, folgen Sie mir einfach. Kommen Sie näher.« Er winkte mit seiner unbewaffneten Hand und ging rückwärts.
»Ich verstehe nicht. Das ist doch alles total verrückt.
Ich habe nichts verbrochen. Wirklich nicht! Das Auto gehört mir, und Drogen habe ich auch keine. Sie können nachsehen.«
»Das werde ich, sobald Sie sicher in meinem Wagen sitzen.«
»O mein Gott, Sie verhaften mich!« Ich raufte mir meine langen honigblonden Locken, bis sie an meinem verschwitzten Nacken kleben blieben. »So was Schlimmes ist mir noch nie passiert. Dabei sind meine Eltern bei einem Hausbrand ums Leben gekommen. Und ich wurde mit meiner Schwester in einer Pflegefamilie untergebracht. Aber dieser Tag, o mein Gott. Sonia, meine Schwester … nein. Officer, Sie dürfen mich nicht verhaften. Sie wissen ja gar nicht, welche Konsequenzen das für meine Schwester hätte. Sie ist die …«
»Ma’am! Sofort hier rüber!« Das Knurren des Polizisten war so angsteinflößend, dass ich auf der Stelle gehorchte.
Als ich näher kam, umfing er mein Handgelenk und zog mich ganz dicht an sich heran. Meine Brust prallte gegen seinen Oberkörper, sodass meine Hände auf seinem muskulösen Bizeps landeten. Ich blickte in das dunkelste Augenpaar empor, das ich je gesehen hatte. Wie schwarzer Kaffee, allerdings mit kleinen goldbraunen Punkten inmitten der Iris. Er hatte olivbraune Haut, ein markantes Kinn und hohe Wangenknochen. Sein dunkelbraunes Haar war am Oberkopf länger, an den Seiten kurz. Wenn ich hätte raten müssen, hätte ich ihn wahlweise in die Kategorie italienischer Mafiosi oder griechischer Gott eingeordnet.
Er war wunderschön.
Er legte mir die Hand an die Taille und drückte sie. Dann neigte er den Kopf und hielt den Mund so dicht an mein Ohr, dass ich seinen warmen Atem an meiner Wange spürte. »Wir haben eine Meldung erhalten, dass jemand an einer Tankstelle sich auf dem Rücksitz eines alten roten Honda Civic versteckt hat, der einer blonden Frau gehörte. Die ersten beiden Buchstaben des Kennzeichens lauten A2.«
»W-Wie bitte?«
»Ich muss mir Ihr Auto ansehen. Schnell. Wenn derjenige sich nicht in Ihrem Wagen befindet, könnte eine andere Frau in Schwierigkeiten geraten.«
»O mein Gott! Ich habe tatsächlich getankt.« Ich klammerte mich so fest an seinen Oberarm, dass meine Nägel womöglich Spuren auf seiner Haut hinterließen.
»Alles ist gut. Sie sind jetzt in Sicherheit«, murmelte er, und ich schloss die Augen und atmete seinen holzigen Duft ein. Sofort beruhigte ich mich ein wenig.
Bis wir beide in der Stille der kühlen Nacht das vertraute metallische Quietschen vernahmen.
Ich wirbelte herum und entdeckte einen dünnen, hochgewachsenen Mann neben meinem Wagen, dessen Gesicht abgesehen von Schlitzen an Augen und Mund unter einer Skimaske verborgen war.
Bevor ich irgendetwas tun oder sagen konnte, legte sich ein Arm um meine Taille und ich wurde hinter den Cop geschleudert. Gleichzeitig hob der maskierte Typ den Arm, zielte und gab zwei Schüsse ab.
Der Officer wurde zweimal in die Brust getroffen, und ich schrie auf. Er prallte rücklings gegen mich, während zwei weitere Schüsse zu hören waren. Einer surrte an ihm vorbei, und plötzlich breitete sich ein Höllenkreis aus Feuer an dem Bizeps jenes Armes aus, den ich um den Cop gelegt hatte, um ihn zu stützen. Er stürzte nun ganz und gar nach hinten, sodass ich mit ihm zu Boden ging.
Wieder schrie ich auf vor Schmerz, als meine Hüfte unter der Wucht des doppelten Gewichts hart auf dem Asphalt aufkam. Meine Hand schabte über die raue schwarze Oberfläche, die mir die Haut aufschürfte. Doch ich achtete nicht darauf. Kaum lagen wir auf dem Boden, blickte ich auf und sah, wie der Verbrecher die Fahrertür zuknallte und mit quietschenden Reifen in meinem Auto die Flucht antrat.
Ich konzentrierte mich auf den Officer, fühlte seinen Puls und stellte fest, dass sein Herz gleichmäßig schlug.
Okay, okay, okay. Du schaffst das, Simone! Ich tastete nach der Wange des Mannes und tätschelte sie ein paar Mal. »Wachen Sie auf, wachen Sie auf. Bitte. Er ist fort! Aufwachen!«
Keine Reaktion. Ich stand auf und sah mich um. Nirgends war eine Menschenseele zu sehen. O Gott, ich konnte ihn doch nicht einfach auf der Straße liegen lassen und mich zu Fuß auf die Suche nach Hilfe machen! Dann würde er überfahren werden.
Mein Handy befand sich in meiner Handtasche im Auto, das jetzt einem miesen Typen, über den ich lieber nicht weiter nachdenken wollte, als Fluchtfahrzeug diente.
Ich brachte den Officer in die stabile Seitenlage und eilte zu dessen Wagen hinüber. Dort entdeckte ich einen Laptop und eine Konsole mit lauter elektronischen Gerätschaften, deren Funktionsweise mir schleierhaft war. An einem Kabel hing ein Walkie-Talkie, so wie normale Polizisten sie benutzten. Ich griff danach und drückte den Knopf.
»Hilfe! Bitte helfen Sie mir. Mein Name ist Simone Wright-Kerrighan. Der Officer, der mich angehalten hat, wurde angeschossen. Bitte schicken Sie Hilfe!«, sprudelte ich hervor und ließ den Knopf wieder los.
Umgehend erschallte eine weibliche Stimme im Inneren des Autos. »Ich habe Ihre Nachricht erhalten, Ma’am. Ich schicke ein Einsatzfahrzeug sowie einen Krankenwagen. Sind Sie verletzt?«
Erst da spürte ich wieder das glühende Feuer in meinem Arm und bemerkte das Blut, das an meinem Ellbogen hinabtropfte. Ich hob den Arm, um den Schaden näher zu begutachten. Eine große, lange Wunde verlief von vorn bis zum hinteren Teil meines Oberarms. Sie sah aus wie ein tiefer Schnitt, doch ein Loch war nicht zu sehen. Dennoch schien die Wunde ziemlich tief zu sein und blutete heftig.
Ich zog scharf die Luft ein, drückte nochmals auf den Knopf und antwortete. »Ähm, anscheinend hat mich eine Kugel am Arm gestreift, aber mir geht es gut. Der Officer atmet und sein Puls ist normal, allerdings ist er bewusstlos. Ich weiß nicht, was ich tun soll!«
»Sie machen das großartig! Ein Einsatzwagen ist ganz in Ihrer Nähe und wird in zwei Minuten vor Ort sein.«
»Bitte beeilen Sie sich! Der Verbrecher hat meinen Wagen gestohlen und ist entkommen.« Wieder begann ich zu weinen.
»Schildern Sie dem eintreffenden Officer gleich einfach nur, was geschehen ist. Um den Rest werden wir uns kümmern.« Die Stimme der Frau klang beruhigend und wirkte wie Balsam auf meine überreizten Nerven.
Durch das Autofenster sah ich, wie sich das Bein des Mannes bewegte. Ich ließ das Walkie-Talkie fallen.
»Nicht bewegen!«, brüllte ich, sprang aus dem Wagen und eilte zu ihm zurück. Ich ließ mich neben ihm auf dem groben Asphalt auf die Knie fallen und unterdrückte einen Fluch. Danach legte ich ihm die Hände auf die Wangen. »Alles in Ordnung. Hilfe ist auf dem Weg. Ich habe sie gerufen.«
Seine Augen öffneten und schlossen sich ein paar Mal, als erwache er aus tiefem Schlaf.
»Wo wurden Sie angeschossen?« Ich musterte seine Brust, konnte aber nirgends Blut entdecken.
»Weste«, stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
Verwirrt runzelte ich die Stirn. Doch dann wurde mir klar, dass er eine dieser schusssicheren Westen meinte. Anscheinend trug er so ein Ding unter seiner Zivilkleidung.
»Zum Glück!«, rief ich albernerweise und bedauerte es sofort.
Erneut presste er die Lider aufeinander, als habe er große Schmerzen.
In der Ferne hörte ich die sich nähernden Sirenen.
»Sie sind fast da. Bleiben Sie nur ganz still liegen.«
»Wo ist er?« Er hustete und zuckte zusammen.
»Der Verbrecher? Der ist in meinem Wagen geflüchtet. Wir sind nun in Sicherheit.« Ich ließ die Hand auf seiner Wange liegen und betete darum, dass er die Augen wieder öffnen und mich ansehen würde.
Einen Moment später wurde mein Gebet erhört, und er richtete seine wunderschönen braunen Augen auf mich. »Name?«
»Keine Ahnung, ich kannte ihn nicht. Ich schwör’s!«
Wieder schloss er sekundenlang die Augen und schenkte mir dann ein kleines, wenn auch schmerzverzerrtes Lächeln.
»Ihr Name, meine Hübsche?«
Ich zog scharf die Luft ein. Mein Gott, was war ich blöd! »Simone. Ich heiße Simone.«
»Simone. Schöner Name. Ich bin Agent Fontaine«, murmelte er.
»Ähm, danke«, antwortete ich, doch der Officer schien den Kampf verloren zu haben. Jedenfalls schlossen sich seine Augen wieder, und er entglitt erneut in die Bewusstlosigkeit.
Plötzlich wimmelte es von Sanitätern und Cops um uns herum. Ich blieb dicht genug bei ihm, um mitzubekommen, wie sie sein Oberhemd aufschnitten. Nicht eine, nicht zwei, sondern ganze drei goldene Kugeln steckten in der Weste, die seine breite Brust schützte.
Sie hantierten mit einem Blutdruckgerät, einer Diagnostikleuchte und einer Sauerstoffmaske herum, dann richteten sie seinen Oberkörper auf und legten ihn anschließend auf eine Tragbahre.
»Kann ich ihn begleiten?«, fragte ich. Nachdem er sich vor mich geworfen hatte, um mich vor einem bewaffneten Irren zu beschützen, und mir dadurch das Leben gerettet hatte, wollte ich mich unbedingt davon überzeugen, dass er wohlauf war.
»Meine Liebe, Sie selbst müssen ebenfalls medizinisch versorgt werden. Ja, Sie dürfen mit in den Krankenwagen kommen, dann verbinde ich Ihre Wunde dort.« Eine kleine Frau mit Brille untersuchte meinen Arm. »Verbandsmull!« Sie streckte die Hand aus, und ihre Mitarbeiterin legte eine weiße Verbandsrolle hinein. Sofort begann sie, meinen blutenden Arm zu versorgen. »Fleischwunde. Nur ein Kratzer. Muss aber genäht werden. Offenbar hatten Sie Glück.«
Nein, ich hatte kein Glück. Das war das Letzte, was ich in meinem Leben je hatte.
»Wird Agent Fontaine durchkommen?« Als mir sein Name wieder einfiel, wurde mir klar, dass er sich als Agent, nicht als Officer vorgestellt hatte.
»Sobald er im Krankenhaus ist, wissen wir mehr. Es sieht aber gut für ihn aus. Die Weste hat die Kugeln abgehalten. Trotzdem wissen wir noch nicht, ob er innere Verletzungen davongetragen hat.«
Ich biss mir auf die Unterlippe und folgte der Frau Richtung Krankenwagen.
»Wir brauchen noch Ihre Aussage, Miss«, bemerkte ein weiterer massiger, mit einem Notizblock bewaffneter Officer.
»O mein Gott! Ja, Sie müssen den Typen verfolgen, der das getan hat. Er hat mein Auto gestohlen. Ich heiße Simone Wright-Kerrighan und fahre einen roten Honda Civic. Ich bin sicher, alles Genauere haben Sie im System«, sagte ich und nannte ihm abschließend mein Kennzeichen, das ich auswendig wusste.
»Wir werden Sie im Krankenhaus nochmals zu den Einzelheiten befragen, Ma’am. Lassen Sie sich zunächst erst einmal weiter medizinisch versorgen. Die Informationen über Ihr Fahrzeug helfen uns schon mal weiter. Danke.«
Ich nickte, und der Cop schloss die Tür des Krankenwagens hinter mir, um mich mit meinem gefallenen Retter allein zu lassen.
Sekunden später rasten wir die Straße hinab. Der Sanitäter hatte dem Agenten die kugelsichere Weste ausgezogen und tastete seinen harten, muskulösen Bauch sowie seine Brust ab.
Ich rückte nah genug an ihn heran, um seine Hand halten zu können. Dann schloss ich die Augen und betete darum, dass es ihm bald wieder gut gehen und man den Mann finden würde, der ihm das angetan hatte.
Als ich die Lider wieder öffnete, bemerkte ich, dass er mich unverwandt musterte.
»Es tut mir leid«, flüsterte ich und presste seinen Handrücken an meine Wange, um zu spüren, dass er lebte. »Danke, dass Sie mir das Leben gerettet haben«, würgte ich mühsam hervor, denn die Gefühle drohten mich zu überwältigen.
Er gab keine Antwort, sondern drückte nur meine Hand und machte erneut die Augen zu, wobei ein sanftes Lächeln um seine schönen Lippen spielte.
Kapitel 2
Ich machte eine Faust und hielt die Luft an, während die Krankenschwester mit einem weiteren Stich meine Armwunde vernähte. Als sie einen Moment innehielt, stieß ich den Atem wieder aus.
»Sie machen das hervorragend«, sagte sie und fuhr fort, die Wunde zu schließen. Glücklicherweise hatte sie den Arm zuerst örtlich betäubt, aber das Spannen, Brennen und scharfe Eindringen der Nadel spürte ich trotzdem.
»Wo ist meine Schwester?«, hörte ich hinter dem geschlossenen Vorhang, hinter dem ich in der Notaufnahme verarztet wurde, Sonias kühle Stimme, die keine Widerrede duldete.
»Meine Tochter? Simone Kerrighan. Bitte …«, drang kurz darauf auch Mama Kerris gemäßigterer Singsang an mein Ohr.
»Hier drüben, Leute!«, rief ich.
Der blaue Vorhang wurde zurückgezogen, und schon standen meine Schwester und meine Pflegemutter vor mir. Sonia hielt sich die Hände vor den Mund und fing an zu weinen. Mit den weißblonden Haaren, den blauen Augen und den rot geschminkten Lippen sah sie aus wie ein Engel. Ein äußerst ernster Engel im Hosenanzug, der sich in diesem Moment bemühte, seine Erschütterung zu verbergen.
»Ach du meine Güte, was ist meinem Mädchen nur zugestoßen?« Mama Kerri umrundete das Bett und umfing meine Wangen.
»Mama, mir geht’s gut. Wirklich! Ich, äh …« Ich biss mir auf die Unterlippe und überlegte, was ich ihnen überhaupt erzählen sollte. Schließlich wollte ich nicht, dass sie sich unnötig Sorgen machten.
»Ich will jetzt alles wissen.« Meine Schwester hatte sich bereits dem herbeieilenden Arzt zugewandt – die Arme vor der Brust verschränkt, ihre Mannschaft aus Anzugträgern in angemessenem Abstand im Rücken. Der Arzt, ein nicht allzu großer Mann mit asiatischen Gesichtszügen, presste die Lippen zu einem dünnen Strich zusammen. Das energische Auftreten meiner Schwester ließ ihn offenbar kalt, und er ignorierte sie vollkommen. An diesem Mann sollte ich mir ein Beispiel nehmen.
»Miss Wright-Kerrighan.« Er blickte auf das elektronische Gerät in seiner Hand herab, von dem er meinen Namen ablas. »Schusswunde am Arm. Prellung an der Hüfte, Schürfungen an Händen und Knien.« Er wischte auf dem Bildschirm eine Seite weiter.
»Sie hat eine Schusswunde!«, unterbrach ihn meine Schwester, schnappte nach Luft und presste die Hand auf die Brust.
»Mir geht es gut, SoSo. Ist nur ein Kratzer …«, versuchte ich sie zu beruhigen.
»Nur ein Kratzer! Wie? Was ist denn passiert, um Himmels willen?« Meine normalerweise immer vollkommen beherrschte Schwester verstummte. Ihre Unterlippe zitterte, und eine Träne kullerte ihre Wange herab. Sie wischte sie so schnell weg, wie sie gekommen war, denn sie wollte sich nichts anmerken lassen.
Bis jetzt war ich verdammt tapfer gewesen, doch bei diesem Anblick begann ich nun doch zu weinen.
Der Arzt begutachtete die Arbeit der Krankenschwester. »Sieht gut aus. Sobald die Wunde vernäht ist, verabreichen wir Ihnen Antibiotika, damit sich die Wunde nicht infiziert. Dann wird eine Schwester den Bereich nochmals reinigen und bandagieren. Sie sollten in ein paar Wochen nochmals bei Ihrem Hausarzt vorstellig werden, obwohl das Nahtmaterial sich in etwa zehn Tagen vollständig aufgelöst haben sollte. Achten Sie darauf, die Wunde in den nächsten achtundvierzig Stunden trocken und sauber zu halten. Danach können Sie wie gewohnt duschen. Haben Sie noch Fragen?«
»Ja. Dieser Agent, der mit mir zusammen eingeliefert wurde. Geht es ihm gut?«
»Darüber darf ich Ihnen keine Auskunft geben, da Sie keine Angehörige sind. Aber ein paar Officer wollen in Kürze ohnehin mit Ihnen reden. Ich habe sie gebeten, mit der Befragung bis zum Ende der Wundversorgung zu warten.«
»Danke, Herr Doktor. Das weiß ich zu schätzen.« Während der Arzt sich entfernte, dachte ich stirnrunzelnd an Agent Fontaine. Ich kannte nicht mal seinen Vornamen. Er hatte ganze drei Kugeln in die Brust in Kauf genommen, um mir das Leben zu retten. Bei der ganzen Aktion hätte er selbst sterben können. Gott sei Dank hatte er diese Weste getragen, und der Verbrecher war geflohen. Ich war zwar nicht begeistert darüber, dass er mein Auto genommen hatte, aber die Alternative wäre noch schlimmer gewesen.
»Liebes, was ist geschehen?« Mama Kerri drückte meine gesunde Hand, während meine Schwester sich an die andere Seite des Bettes stellte und mir die Hand auf die Schulter legte, wohl um nicht nur mich, sondern genauso sehr auch sich selbst zu trösten. Für gewöhnlich zeigte meine Schwester sich knallhart, bloß wenn es um mich ging, war sie schwach. Ich war ihre Achillesferse. Deshalb war mir auch nichts so verhasst, wie sie zu enttäuschen.
Ich schluckte und dachte, dass Ehrlichkeit immer noch am längsten währte.
Während der darauffolgenden halben Stunde schilderte ich den beiden die Ereignisse – angefangen von meinem beschissenen Boss, über das Tanken bis hin zum seltsamen Verhalten des Kassierers, der mich vergebens zurückzuwinken versucht hatte. Im Nachhinein wünschte ich wirklich, ich hätte mich in diesem Moment anders entschieden. Dann erzählte ich ihnen, wie der Cop mit eindeutig sichtbarer Waffe mich zum Anhalten gezwungen und wie viel Angst ich davor gehabt hatte, grundlos verhaftet zu werden. Als ich ausführte, was passiert war, nachdem der Typ aus meinem Auto gestiegen war, wurde es totenstill im Raum. Ich hatte das Gefühl, alles noch einmal zu durchleben.
Das metallische Quietschen der Tür ließ mich zusammenfahren.
Der heiße, tröstliche Atem meines Retters an meiner Wange durchflutete mich angenehm warm.
Sein Duft, der uns umfing, umhüllte mich auch nun wie eine Decke.
Das Licht der Scheinwerfer, das sich in der glänzenden schwarzen Waffe widerspiegelte, verursachte mir selbst jetzt noch eine Gänsehaut.
Bei der Erinnerung an die beiden Augenschlitze in der Skimütze und den Ausschnitt für seinen Mund, der vor mir aufblitzte wie der eines Raubtieres, presste ich mich instinktiv rücklings in die Kissen.
Dann der Knall der Waffe, als sie abgefeuert wurde. Ich zuckte heftig zusammen und schrie auf.
Als ich wieder zu mir kam und die neuerliche Erinnerung an das Erlebnis wegzublinzeln versuchte, saß Mama Kerri auf dem Bett, und ich lag in ihren Armen. Die Krankenschwester war fertig, und ich genoss die einzige mütterliche Nähe, die ich kannte. Mama Kerri strich mir mit der Hand übers Haar und den Rücken, immer und immer wieder, während ich das Gesicht an ihrem üppigen Busen vergrub, den Tränen freien Lauf ließ und ihren blumigen Duft einatmete. Ich zitterte am ganzen Körper.
»Alles in Ordnung, mein Mädchen. Alles ist gut. Du bist hier, bei mir und Sonia«, sprach sie beruhigend auf mich ein. »Wir sind zur Stelle, meine Süße. Ich bin immer für dich da.«
Genau so war es.
Von dem Augenblick an, da Sonia und ich Hand in Hand vor ihrer Tür gestanden hatten, hatte Mama Kerri für uns gesorgt. Wie eine wunderschöne irdische Göttin. Mit ihren langen erdbeerblonden Locken. Den rosigen Lippen. Dem Porzellanteint. Den blauen Augen, die je nach Tag oder Stimmung auch grün funkeln konnten. Doch all diese Schönheit war nichts gegen ihre Stimme. Ihre Klangfarbe, ihr Singsang hallte im Innern wider und schenkte mir ein Gefühl einzigartigen Friedens und unendlicher Ruhe. Es gab nichts Besseres.
»Mama«, schluchzte ich, klammerte mich wie ein Kleinkind an ihr fest und ließ alles heraus. Die Angst. Die Hoffnungslosigkeit der Situation und sogar die Sorge um das Wohlbefinden meines Retters.
»Schon gut. Mama ist ja da.« Sie tätschelte mir den Rücken und flüsterte an meiner Schläfe weiter beruhigend auf mich ein. »Alles ist gut. Dir. Geht. Es. Gut.« Ihre Stimme brach, und sie nahm mich noch fester in den Arm. »Es tut mir so leid, dass du all das durchmachen musstest. Du musst furchtbare Angst gehabt haben. Aber jetzt mach dir keine Sorgen mehr! Ich kümmere mich um dich. Sonia und ich sind für dich da, Liebes.«
Ich schniefte unter Tränen und holte ein paarmal tief Luft, ließ mich von ihr so lange trösten, bis ich mich wieder im Griff hatte.
»Entschuldigen Sie bitte, Senatorin Wright. Verzeihen Sie die Störung, aber man hat uns soeben informiert, dass die Presse bereits Wind von dem Ganzen bekommen hat. Man hat Sie das Krankenhaus betreten sehen, und jemand hat bestätigt, dass es sich bei der Person, die überfallen wurde, um Ihre Schwester handelt.«
Sonia seufzte, während ich tief Luft holte, um nicht noch mehr zu weinen. »Es tut mir so leid, SoSo. Ich habe nicht …«
»Das ist doch nicht deine Schuld! Du warst ein Zufallsopfer, und wir müssen dankbar sein, dass du keine schwereren Verletzungen davongetragen hast.«
»Apropos …« Der Mann trat unruhig von einem Fuß auf den anderen und zog eine Grimasse. »Mittlerweile geht man davon aus, dass der Backseat Strangler der Täter ist …«
»Was?!«, kreischte Sonia und wurde leichenblass.
»Nein …«, stieß ich mit erstickter Stimme hervor.
Der junge Assistent – er hieß Logan, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte – stellte sich breitbeinig hin und blähte die Brust, während er auf sein Handy hinabblickte. »Er hat sich an einer Tankstelle auf der Rückbank Ihrer Schwester verkrochen und sich dort versteckt.« Er las es vor, als habe man ihm die Geschichte aus erster Hand erzählt. »Die einzige andere Frau, die ihm lebend entkommen ist, hat ihn als großen, dünnen Weißen beschrieben, der ganz in Schwarz war und eine Skimaske trug.«
Ich schlug mir meine zitternde Hand vor den Mund. Genau so hatte er ausgesehen.
»Bislang hat er auf diese Weise acht Frauen getötet. Eins seiner Opfer kam mit dem Leben davon, ist aber inzwischen untergetaucht, und jetzt – äh – Ihre Schwester.« Er benetzte die Lippen und schien sich zusammenzureißen, weshalb ich ihn beglückwünscht hätte, wäre ich in einem besseren seelischen Zustand gewesen. Sich mit Sonia herumzuschlagen, wenn sie stocksauer war, war keineswegs ein Kinderspiel, doch er tat sein Bestes. »Wir müssen die Sache irgendwie in den Griff kriegen …« Er runzelte die Stirn.
»Im Moment gilt mein Hauptaugenmerk meiner Schwester. Sie müssen Quinn anrufen …«
»Wer ist Quinn?« Seufzend beobachtete ich, wie Logan den Namen notierte. Er musste tatsächlich ziemlich neu im Team sein. Sonia war eine harte Nuss und wechselte ihre Assistenten sofort, wenn ihr etwas nicht passte. Quinn McCafferty war die rechte Hand meiner Schwester, ihr bester Freund und Ansprechpartner in allen Lebenslagen, der zufällig auch noch schwul war und einen exquisiten Geschmack in Sachen Kleidung hatte. Ich war total neidisch auf seine Kompetenz in sämtlichen Bereichen. Sogar meine Schwester hatte er einigermaßen im Griff, etwas, das niemand sonst von sich behaupten konnte, nicht einmal Mama Kerri. Doch ich wusste auch, dass er gerade zwei Wochen im Urlaub gewesen war, den er sicher dringend nötig gehabt hatte. Daher konnte Neuling Logan noch nichts von ihm wissen.
»Mein PR-Chef«, stieß sie ungeduldig hervor. »Er ist gerade von den Bahamas zurückgekehrt. Schildern Sie ihm die Ereignisse, lassen Sie nichts aus. Ich kümmere mich um die Presse, nachdem ich mich davon überzeugt habe, dass meine Schwester in Sicherheit und wohlauf ist.« Mit einer Handbewegung entließ sie den armen Kerl. »Danke«, fügte sie ihren Befehlen noch hinzu, als sei ihr gerade aufgefallen, wie zickig sie klang. »Sie können gehen.«
Er nickte und huschte sichtlich verwirrt davon, sodass zwei uniformierte Polizisten seinen Platz einnehmen konnten.
»Miss Wright?«
»Wright-Kerrighan.« Ich drückte die Hand meiner Pflegemutter. Wir Pflegeschwestern hatten allesamt Doppelnamen. Sobald wir volljährig geworden waren, hatte jede von uns den Nachnamen meiner Mom an den eigenen angehängt oder ihn sogar angenommen. Als eine Art Hommage an sie für alles, was sie über die Jahre für uns getan hatte. Ich hatte den Namen Wright behalten, weil es sich falsch angefühlt hatte, jede Spur unserer leiblichen Eltern zu tilgen. Damit war ich Sonias Beispiel gefolgt. Sonia nannte sich allerdings nur in privatem Rahmen Wright-Kerrighan. Aus beruflichen Gründen begnügte sie sich ansonsten mit Wright.
»Können wir uns mit Ihnen über die Ereignisse unterhalten?«, erkundigte sich ein Mann in marineblauer Stoffhose und einem abgetragenen beigefarbenen Sakko.
»Dürfen die beiden bleiben?« Mit einem Kopfnicken deutete ich auf meine Schwester und meine Mom.
»Oh, hallo, Senatorin Wright. Tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen wiedersehen.« An seinem abgewetzten Gürtel prangte eine glänzende goldene Dienstmarke.
»Captain Mandle, danke, dass Sie gekommen sind.« Sonia presste die Lippen zusammen, als sei sie über seinen Anblick nicht wirklich erfreut.
»Captain?« Ich runzelte die Stirn. Bei wie vielen Straftaten kam es vor, dass der Captain höchstpersönlich die Opfer im Krankenhaus aufsuchte?
»Ein sehr heikler Fall. Das FBI ist darin verwickelt, und Sie sind, nun ja, meine Liebe, Sie sind eine lebende Zeugin.«
Das war die Erklärung. Statt Opfer Nummer neun zu sein, war ich am Leben. Toll. Dieser Tag wurde mit jeder Minute besser.
»Es war der Backseat Strangler.« Ich hatte einen Kloß im Hals.
»Ich fürchte, ja. Ich werde Ihnen jede Menge Fragen stellen müssen. Viele davon werden Sie vielleicht nicht beantworten können, aber geben Sie einfach Ihr Bestes, in Ordnung?«
Ich nickte. »Mach ich.«
***
Als ich den Korridor hinabspähte, entdeckte ich eine Handvoll Officer vor einer einzelnen Tür am Ende des Flurs.
Jemand stieß mich von hinten an, und ehe ich es mich versah, stolperte ich prompt auf den Gang hinaus.
»Sonia, verdammt! Ich wollte mich heimlich anschleichen!«, schimpfte ich leise.
»Weshalb?« Sie packte den Ellbogen meines gesunden Arms und steuerte zielstrebig auf die Schar Männer zu.
Einige der uniformierten Officer wandten sich zu uns um. Ein unglaublich hochgewachsener weißer Typ mit längeren, stufig geschnittenen blonden Haaren hob die Hand, um uns aufzuhalten. In seinem nachtschwarzen Dreiteiler sah er aus wie ein Geschäftsmann.
»Dieser Bereich des Krankenhauses ist abgeriegelt. Nur medizinisches Fachpersonal ist zutrittsbefugt«, begann er, aber meine Schwester ging sofort in die Offensive.
»Hallo, Agent.« Sie musterte ihn von Kopf bis Fuß.
Er grinste. »Agent Russell.«
»Agent Russell. Ich bin Senatorin Sonia Wright, und meine Schwester war es, die heute Abend überfallen wurde. Ihr Kollege, Agent Fontaine, hat ihr das Leben gerettet. Wir möchten uns nach seinem Befinden erkundigen, und meine Schwester würde sich gern mit ihm unterhalten, wenn er Besuch empfangen darf.«
Sonia war wirklich die Beste. Ich ergriff ihre Hand, verwob unsere Finger ineinander, sodass unsere Handflächen sich berührten, und drückte sie in stummer Dankbarkeit.
Die Miene des Mannes wurde weicher. »Sie sind Simone?«
»Ja. Geht es ihm gut?«
Ein Lächeln erhellte sein ohnehin schon schönes Gesicht, sodass er geradezu atemberaubend aussah. Obwohl der Mann, der mir das Leben gerettet hatte, noch viel attraktiver war. Ich stand sowieso eher auf große, dunkle Typen. Die meisten meiner Schwestern hätten sich jedoch eher auf diesen blonden Kerl hier gestürzt.
»Den Umständen entsprechend ja. Er hat ein paar Rippenbrüche und ziemlich schmerzhafte Prellungen, aber die Weste hat das Schlimmste verhindert. Sicher ist er schon bald wieder einsatzfähig. Nicht dass er sich überhaupt jemals Ruhe gönnen würde. Und wie geht es Ihnen?«
Ich umfasste meinen bandagierten Arm. »Zweiundzwanzig Stiche und dazu ein paar Beulen und Prellungen.«
»Und was ist mit Ihrer Hand?« Er blickte auf die Hand hinab, die in der meiner Schwester ruhte.
»Nur ein paar Kratzer vom Asphalt. In ein paar Tagen bin ich so gut wie neu. Ähm, ob ich ihn vielleicht doch besuchen könnte, was meinen Sie?«
Er schenkte uns ein jungenhaftes Grinsen. »Das würde ihm bestimmt gefallen. Er hat bereits nach Ihnen gefragt. Kommen Sie mit.« Er führte uns durch die Gruppe von Männern und öffnete die Tür.
Ich betrat das Zimmer, woraufhin mein Retter in seiner schicken Krankenhaus-Kluft den Kopf wandte und breit lächelte.
Mein Herz setzte einen Schlag aus.
Sämtliche Geräusche verstummten.
In diesem Moment gab es bloß noch ihn und mich.
Keine Maschinen. Kein Krankenhaus. Keine umhereilenden Menschen.
Nur uns beide.
Ich eilte zu ihm hin und schlang ihm so gut ich konnte die Arme um den Hals. Er hielt mich fest und ließ sein Kinn auf meinem Scheitel ruhen.
»Danke. Danke, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Das kann ich nie wieder gutmachen«, schniefte ich an seinem warmen Körper. Ich war so froh, dass er nicht gestorben war!
»Hey, hey, wir sind beide wohlauf. Ist doch alles noch mal gut gegangen!« Er schob die Hand unter mein Haar, umfing meinen Nacken und gab mir einen Kuss auf die Schläfe.
Ein paar Augenblicke lang verharrten wir in dieser Stellung. Ich beugte mich über ihn, klammerte mich an ihn, und er hielt mich fest.
Schließlich hörte ich ein Räuspern hinter mir.
An seinem Hals atmete ich tief ein. Sein holziger Duft war nun noch stärker als zuvor und zusätzlich unterlegt von einer intensiven männlichen Note. Ich riss mich zusammen, richtete mich auf und wischte mir ein paar Tränen ab.
»Oh, hallo. Wow. Senatorin Wright?«, sagte Agent Fontaine sichtlich verblüfft, meine Schwester dort stehen zu sehen.
Sonia lächelte verhalten, und beim Anblick meines Retters wurden ihre Züge weich.
»Danke, Agent Fontaine, dass Sie meine Schwester gerettet haben. Ich stehe in Ihrer Schuld. Wenn es etwas gibt, womit ich oder mein Büro dem FBI oder Ihnen in Zukunft behilflich sein können, lassen Sie es mich wissen.«
»Wow. Äh, okay. Danke für das Angebot.« Er schüttelte den Kopf, wie um wieder einen klaren Gedanken fassen zu können, bevor er den Blick erneut auf mich richtete.
Ich ergriff seine Hand und nahm mir die Freiheit, mich auf seine Bettkante zu setzen, um bloß ja nichts zu verpassen, was mein lebendiger Held zu sagen hatte. Außerdem war der Ausblick ehrlich gesagt alles andere als schlecht. Selbst so mitgenommen und unter dem Einfluss von Schmerzmitteln war dieser Mann wahnsinnig attraktiv.
»Wissen Sie schon, wann Sie entlassen werden?«
Er lächelte sanft. Ich beobachtete, wie seine perfekt geformten Lippen sich erst hoben und dann wieder senkten.
Was für ein Traummann!
Der Typ war unglaublich gut aussehend. Hätte ich nicht so unter Adrenalin gestanden, wäre ich bestimmt förmlich dahingeschmolzen.
»Ich heiße übrigens Jonah. Jonah Fontaine.«
»Jonah.« Ich ließ mir seinen Namen auf der Zunge zergehen und stellte fest, dass er mir gefiel. Ein kleiner Hoffnungsfunke entzündete sich in meinem Innern und rieselte durch meinen jetzt schon vollkommen überreizten Körper.
Ich erbebte, und seine Augen wurden schmal. »Sie sollten nach Hause gehen. Allerdings keinesfalls in Ihre eigene Wohnung. Da der Täter mit Ihrem Wagen geflohen ist, befinden sich Ihre Handtasche, Ihr Handy und Ihre Adresse ebenfalls im Fahrzeug, nehme ich an?«
Meine Schwester legte mir den Arm um die Schulter. Ich warf ihr einen Blick zu.
»Du kehrst keinesfalls in dein Apartment zurück. In diesem Wohnklo hast du eigentlich sowieso nichts verloren. Du ziehst zu mir«, verkündete Sonia kategorisch. Jetzt spielte sie sich als große Schwester auf, weshalb ihr Ton keinen Widerspruch duldete. Ich hasste diesen Modus und hatte bereits mit einundzwanzig herausgefunden, wie man ihn abschaltete. Trotzdem versuchte sie auch weiterhin unverdrossen, über mich zu bestimmen.
Ich schüttelte den Kopf. »Auf gar keinen Fall. Ich bleibe in meiner Wohnung.«
»Einen Teufel wirst du. Ich verbiete es dir.« Meine überbehütende große Schwester vibrierte förmlich. Die Röte, die ihre Wangen und ihr Dekolleté überzog, demonstrierte ihren wachsenden Zorn.
»SoSo, ich bin erwachsen. Aber na gut, ich werde heute Abend nicht nach Hause fahren. Wahrscheinlich habt ihr recht: Es ist zu gefährlich.«
Ihre Schulter sackten nach unten, und ein erleichterter Seufzer entrang sich ihren perfekt geschminkten Lippen.
Ich sah Jonah wieder an. »Ich bin sicher, Agent Fontaine und seine absolut fähige Hundertschaft können mir signalisieren, wann eine Rückkehr sicher möglich ist. Morgen muss ich zumindest mal hin, um ein paar Sachen für die kommende Woche oder so zusammenzupacken – je nachdem, wie sie die Lage einschätzen. Bis sich alles geklärt hat, übernachte ich in unserem alten Zimmer bei Mama Kerri. Keine Widerrede.«
»Verdammt, Sie sind schon eine verdammt starke Frau, Simone.« Jonah fuhr mit dem Daumen über meinen Handrücken, und seine Liebkosung traf mich geradewegs ins Herz.
»Danke.« Ich lächelte. Noch nie in meinem Leben hatte jemand mich als stark bezeichnet. Als zäh, das schon. Aber nicht als stark. Die meisten Menschen betrachteten mich als jemanden, der anderen gefallen wollte. Die Schwester, die stets bereit war, anderen bei der Erfüllung ihrer Wünsche und Träume zu helfen, jedoch keine eigenen hatte. Ich galt zwar als verlässlich, nicht aber als verantwortungsbewusst. Immer zu spät kommend, allerdings stets in Bereitschaft. Fleißig, aber nie ehrgeizig. Ich beherrschte vieles, tat mich jedoch in keinem Bereich hervor. Leider stimmte diese Einschätzung. Dennoch war ich megastolz, dass dieser Mann mich als stark bezeichnete, obwohl mir dieses Gefühl eigentlich fremd war.
»Simone, du kannst bei mir wohnen. Wofür habe ich denn ein Gästezimmer? Du weißt, wie gern ich dich bei mir hätte. Und ich bin ohnehin nicht allzu häufig zu Hause …«
Ich stand auf und nahm meine viel größere und durchtrainiertere Schwester in den Arm. In den Augen der Männer war ich eher üppig. Meine Schwester hingegen war mit ihrer athletischen Figur, für deren Erhalt sie hart trainierte, die Eleganz in Person. Sie behauptete, dass sie durch Sport einen klaren Kopf bekam. Ich selbst beschränkte mich bei meinen Workouts auf das Hin-und-her-Rennen im Diner, das Verteilen von Getränken und das Herumtragen von Essenstabletts über dem Kopf. Außerdem hatte ich viel mehr fürs Essen und Trinken übrig als meine Schwester. Daher die Kurven.
»Du weißt, dass ich dich über alles liebe …«
»Und ich dich, weshalb ich wirklich finde, dass du bei mir, in meiner gut bewachten und sicheren Wohnung leben solltest«, versuchte sie es noch einmal.
»So schlecht ist die Idee gar nicht, Simone. Immerhin läuft da draußen ein Serienmörder frei herum. Und mehr Schutz als unter dem Dach einer gewählten Politikerin werden Sie so schnell nicht finden, es sei denn natürlich, Sie sind selbst Präsidentin oder eine Prominente«, fügte Jonah hinzu.
Ich schüttelte den Kopf. »Sorry. Im Kerrighan House fühle ich mich entschieden wohler. Dort gibt es genug Platz. Und Mom ist da und kann sich um mich kümmern. Wenn etwas Schlimmes passiert …«
»… will man einfach nur nach Hause.« Sonia sprach jenen Satz aus, der uns beiden so viel bedeutete. Wir waren immer füreinander da gewesen, dennoch war meine Situation ein wenig anders. Ich war bei unserer Ankunft im Kerrighan House erst sechs gewesen. Sie hingegen schon zwölf. Es war das einzige Zuhause, das ich kannte und an das ich mich erinnerte. Doch ihr Zuhause war ich. Obwohl natürlich auch sie unsere Pflegemom heiß und innig liebte.
»Und noch etwas: Wenn ich jetzt nicht bei ihr einziehe, dann zieht Mama über kurz oder lang bei dir ein.«
Sonias breites Grinsen löste die Spannung, die über dem Zimmer lag. »Stimmt. So schnell wirst du sie nun wahrscheinlich eine ganze Weile nicht mehr los.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Warum sollte ich das auch wollen?« Meine Pflegemom war die coolste Mutter der Welt. Dieser Meinung war jeder, der sie kennenlernte. Sie gehörte zu den Menschen, die man einfach wahnsinnig gern um sich hatte.
Sonia nickte. »Na gut. Ich werde mit meinen Männern reden. Vielleicht können sie ja ein paar Officer für die ein oder andere Runde ums Haus abstellen. Ich hätte ein besseres Gefühl, wenn ich wüsste, dass sie ein Auge auf dich und Mama Kerri haben.«
»Meinetwegen«, gab ich nach. Sonst würde diese Frau nie Ruhe geben!
Sonia nickte. »Dann lasse ich euch beide mal allein.« Sie wandte sich um und verließ das Zimmer.
Als ich Jonah ansah, bemerkte ich, wie er mühsam die Augen öffnete und wieder schloss, als kämpfe er gegen den Schlaf an.
»Ich werde Sie morgen Nachmittag zu Ihrer Wohnung begleiten. Ich will nicht, dass Sie, Ihre Schwester oder Ihre Mutter allein dorthin gehen.«
»Sie haben doch nun wirklich schon genug für mich getan …«
Er schürzte die Lippen und veränderte seine Position, wobei er vor Schmerz zusammenzuckte. »Versprechen Sie mir, dass Sie meinen Kollegen sämtliche Auskünfte geben und warten, bis wir uns bei Ihnen melden?«
Ich tätschelte seine Hand. »Ich versprech’s. Das ist schließlich das Mindeste. Welche Cookies essen Sie am liebsten?«
Stirnrunzelnd schüttelte er den Kopf. Der Schlaf drohte ihn nun vollends zu übermannen. »Chocolate Chips. Warum?«
»Weil ich ein paar für Sie und die anderen Officer backen werde, die uns geholfen haben.«
Jonah lächelte. »Sie sind wirklich was Besonderes, Simone.«
»Inwiefern?«
Er machte die Augen zu. »Keine Ahnung, aber es macht sicher Spaß, das herauszufinden.«
Doch dann sagte er nichts mehr. Sein Kopf fiel zur Seite, und seine Brust hob und senkte sich gleichmäßig. Er war eingeschlafen.
Ich beugte mich herab, um ihm einen Kuss auf die Stirn zu geben, entschied mich jedoch im letzten Moment anders und ließ meine Lippen federleicht über seine gleiten, stahl mir einen hauchzarten Kuss von dem Mann, der mir das Leben gerettet hatte. Einem Mann, den ich gern näher kennengelernt hätte. Und zwar in jeder Hinsicht.
»Darauf freue ich mich«, flüsterte ich und umfing seine Wange. Ein letztes Mal bewunderte ich seinen wunderschönen Anblick, bevor ich mich von ihm löste und aus dem Zimmer schlüpfte.
Ich konnte es gar nicht abwarten, ihn morgen wiederzusehen.
Unter welchen Umständen auch immer.
Diesem Mann zu begegnen, eine Situation zu überleben, die sich zu einer schrecklichen Tragödie hätte auswachsen können, hatte mein Leben an einem einzigen Abend von Grund auf verändert.
Nun wurde es Zeit für mich zu leben.
Auf das hinzuarbeiten, was ich wollte, und daran mit aller Macht festzuhalten.
Und das Erste, was ich wollte …
… war, meinen Retter näher kennenzulernen, FBI-Agent Jonah Fontaine.
Kapitel 3
Sanft glitt ich aus dem Schlaf wieder an die Oberfläche des Bewusstseins, als ich ein Gewicht auf meinem Bauch spürte und es auf beiden Seiten warm wurde.
Was um alles in der Welt war das?
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: