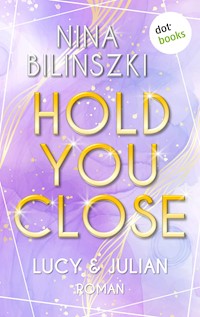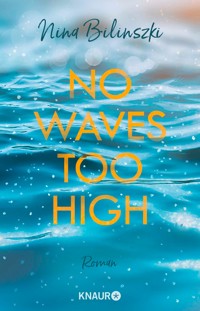
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Love Down Under
- Sprache: Deutsch
Muss Surfer-Girl Alicia nach einem Haiangriff ihren großen Traum aufgeben, oder kann sie mithilfe des Meeresbiologen Ethan ihre Angst überwinden? Nina Bilinszkis New-Adult-Roman »No Waves too high« ist der 3. Teil der bewegenden Liebesroman-Reihe »Love Down Under«, die in der traumhaft schönen Küstenstadt Eden in Australien spielt. Bis zu einem fatalen Haiangriff vor einem halben Jahr war Alicia Taylor so etwas wie eine Berühmtheit in der kleinen Küstenstadt Eden: Die 22-Jährige wollte nie etwas anderes sein als Surferin, und sie war richtig, richtig gut. Doch als Alicia jetzt endlich aus der Reha entlassen wird und sich voller Vorfreude ihr Surfbrett schnappt, stellt sie fest, dass sie sich ihrem geliebten Meer nur noch bis auf wenige Meter nähern kann. Dann brechen die Erinnerungen über sie herein – und mit ihnen die nackte Panik. Weil Alicia keinesfalls zu einem Psychologen gehen möchte, wendet sie sich in ihrer Verzweiflung an den Meeresbiologen und Haiexperten Ethan Parfit. Bald verbindet die beiden nicht nur ihre gemeinsame Liebe zum Ozean. Doch Ethan hat ganz andere Vorstellungen davon, welche Art von Hilfe Alicia wirklich braucht, als sie selbst. Ist ihr Vertrauen zu ihm groß genug, um sich auf ein völlig neues Wagnis einzulassen? Australiens Traumstrände und eine Liebe, die den Weg zurück ins Leben weist: New-Adult-Autorin Nina Bilinszki erzählt eine berührende Liebesgeschichte zum In-die-Ferne-Träumen. Die Romane der New-Adult-Reihe »Love Down Under«: - No Flames too wild (Isabel & Liam) - No Stars too bright (Sophie & Cooper) - No Waves too high (Alicia & Ethan)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Nina Bilinszki
No Waves too high
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
Triggerwarnung - Hinweis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
Nachwort
Danksagung
Playlist
Triggerwarnung
Für das Meer
Weil du alles besser machst
immer
Liebe Leser*innen,
bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen euch gute Unterhaltung mit No Waves too high.
Nina und der Knaur Verlag
Kapitel 1
Alicia
Der Ozean war mein Lebenselixier, das Rauschen der Wellen meine liebste Melodie. Wenn ich die Augen schloss, konnte ich mir noch immer einbilden, es zu hören, obwohl ich es bereits seit drei Monaten nicht erlebt hatte.
Drei verdammte Monate.
So lang hatte meine Tortur aus Operationen und Reha nach dem Haiangriff gedauert. Zwischenzeitlich hatte ich befürchtet, dass die ganze Sache nie ein Ende nehmen würde. Dass die Ärzte nie zufrieden mit dem Zustand meines Beins oder meine Physiotherapeuten mit meiner Beweglichkeit sein könnten. Doch jetzt saß ich tatsächlich – endlich – im Taxi auf dem Weg nach Hause. Ein kurzes Stück, als wir die Küstenstraße entlanggefahren waren, hatte ich das Meer sogar sehen können, doch jetzt, während wir durch die kleine Ortschaft fuhren, war es wieder aus meinem Blickfeld verschwunden.
Es war ohnehin nicht dasselbe, wie wenn die Wellen endlich wieder meine Knöchel umspielen. Wie mich endlich wieder auf ein Surfbrett zu legen, aufs Meer hinauszupaddeln und die höchste Welle zu reiten.
Vorfreude kribbelte durch meinen gesamten Körper, beginnend von meinen Fingerspitzen bis hinab zu meinen Zehen. Denn genau das war mein Plan, sobald wir die letzte Meile zu meinem Zuhause zurückgelegt hatten. Ich würde den Taxifahrer bezahlen, meine Reisetasche mit der dreckigen Wäsche zur Seite stellen, mir mein Surfbrett schnappen und damit zum Meer gehen. Zum Glück wohnte ich direkt in der Nähe eines kleinen Kiesstrandes. Zwar waren die Wellen dort nicht so hoch wie am Worang Point, aber vielleicht war das nach den drei Monaten Auszeit, zu der ich notgedrungen verdonnert worden war, auch ganz gut. Nie zuvor hatte ich so lange auf mein geliebtes Surfen verzichten müssen, und der bloße Gedanke daran, dass ich endlich wieder loslegen konnte, ließ mich vor Freude schier in Tränen ausbrechen.
Das war auch der Grund, warum ich die Angebote meiner Freunde, mich aus der Reha abzuholen, ausgeschlagen hatte und stattdessen im Taxi saß. Auch wenn ich es fast genauso wenig abwarten konnte, sie außerhalb der Krankenhausatmosphäre wiederzusehen, wollte ich diesen Vormittag für mich nutzen. Mein Board und ich hatten ein Date, und ich plante, das Beste herauszuholen.
Unter all der Freude schwelte jedoch auch die Angst um Mum. Wie es ihr ging und in welchem Zustand ich das Haus vorfinden würde. In den letzten Jahren waren diese Fragen zu einer Art ständigem Begleiter geworden, den ich oftmals nur am Rande mitbekommen hatte. Aber nachdem ich drei Monate nicht zu Hause gewesen war, konnte ich sie nicht so gut ausblenden wie gewöhnlich.
»Wir sind da«, riss mich die Stimme des Taxifahrers aus meinen Gedanken. Ich sah auf und erblickte das Haus, in dem ich mein komplettes Leben verbracht hatte. Der einstöckige Bungalow mit der weißen Fassade, dem für Eden typischen blauen Dach und dem Blumenbeet, das immer etwas mehr Wasser vertragen könnte. Dafür waren die Wasserschalen für die Vögel frisch gefüllt worden, daher konnte ich darüber hinwegsehen.
Ich bezahlte den Taxifahrer und stieg aus. Aus dem Kofferraum holte ich meine Reisetasche, dann wandte ich mich unserem Haus zu.
Ich hatte den gepflasterten Weg zur Tür kaum erreicht, da wurde diese von innen aufgestoßen, und meine Mum trat heraus. »Alicia, da bist du ja.«
Wie immer sah ich sie mir zuerst ganz genau an. Ihre blonden Haare waren ordentlich frisiert, sie trug eine Jeans, die ihr etwas zu weit war, und ein hellblaues T-Shirt. Doch das Wichtigste war, dass ihr Blick klar war und ihr Lächeln echt wirkte.
»Hey, Mum.«
Mit ausgestreckten Armen kam sie auf mich zu und zog mich in eine kurze Umarmung. »Wie geht es dir?«
»Gut.« Ich schulterte meine Reisetasche und folgte ihr ins Haus. »Ich bin froh, dass ich endlich nach Hause durfte.«
»Und damit ist deine Behandlung jetzt komplett vorbei?«
Ich stellte meine Reisetasche neben der Tür auf dem Boden ab und ließ meinen Blick durch den Raum wandern. Man befand sich beim Eintreten direkt im Wohnzimmer, das aufgeräumt und sauber wirkte. Ein wenig von dem Druck, der während der Fahrt auf mir gelastet hatte, löste sich, und ich konnte freier durchatmen.
»Nicht ganz.« Ich wandte mich Mum zu. »Ich muss weiterhin zur Physiotherapie, aber nur einmal die Woche, und die kann ich ambulant absolvieren.« Zunächst hatte man mir zwanzig weitere Stunden verschrieben – um meine Muskulatur zu stärken, das Gewebe zu lockern und meine allgemeine Beweglichkeit zu verbessern. Ich hoffte, dass diese Anzahl ausreichend sein würde, aber genauso gut konnte es passieren, dass nach Ablauf eine Verlängerung beantragt wurde.
»Aber wenigstens bist du wieder zu Hause. Komm erst mal an, ich habe deinen Lieblingskuchen besorgt.« Mum führte mich zu unserem Esstisch, der bereits gedeckt war. Auf meinem Teller befand sich ein Stück Käsekuchen, auf Mums ein Stück Obsttorte. Dazu hatte sie frischen Kaffee gekocht, und allein deswegen lief mir das Wasser im Mund zusammen. Die Plörre im Krankenhaus und während der Reha war eine wässrige Katastrophe gewesen, und meine Beine setzten sich von selbst in Bewegung, ohne dass ich ihnen den Befehl dazu gegeben hatte. Obwohl ich bis eben nur daran hatte denken können, endlich wieder aufs Surfbrett zu steigen, würde ich zu diesem verlockenden Mittagssnack nicht Nein sagen. Was machte es schon, eine halbe Stunde länger zu warten?
»Das wäre doch nicht nötig gewesen«, sagte ich, als ich mich auf meinen Platz setzte. Trotzdem freute es mich. Und zwar nicht nur für mich, sondern für Mum. Denn es bedeutete, dass es ihr gut ging. Gut genug, um das Haus zu verlassen, einzukaufen und das alles vorzubereiten. Das war keine Selbstverständlichkeit. Seit ich denken konnte, hatte Mum mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Es gab Phasen, da konnte sie kaum das Bett verlassen, lag den ganzen Tag nur herum und putzte sich nicht einmal die Zähne. In anderen kam sie nicht ins Bett, konnte nicht schlafen und geisterte die ganze Nacht im Haus herum. Und dann gab es Phasen wie diese, in denen ich mir einbilden konnte, dass wir eine ganz normale Familie waren.
»Es ist das Mindeste, was ich tun konnte, nachdem mein kleines Mädchen endlich wieder zu Hause ist.« Lächelnd nahm sie vor mir Platz und griff nach ihrer Gabel. »Es war ganz schön still hier ohne dich.«
Ich trennte ein Stück Käsekuchen ab und schob es mir in den Mund. Sofort explodierte der Geschmack auf meiner Zunge, und ich schloss für einen Moment genüsslich die Augen. Nichts ging über die kleine Konditorei am Ende der Straße.
»Aber Grandma und Granddad waren doch bestimmt regelmäßig hier, oder?«, fragte ich, nachdem ich geschluckt hatte. Meine Großeltern hatten uns immer zur Seite gestanden, waren in manchen der früheren schlimmen Episoden meiner Mum sogar teilweise hier eingezogen.
»Natürlich, aber es ist einfach nicht dasselbe, wie dich jeden Tag um mich zu haben.« Sie sagte das so locker und freiheraus, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, dass ich mit fast vierundzwanzig noch immer zu Hause wohnte. Und vielleicht war es das für sie auch, weil ich nie Anstalten gemacht hatte, etwas daran zu ändern.
Ich schüttelte den Kopf, um diese Gedanken zu vertreiben. »Wie geht es dir sonst so? Was habe ich in der Nachbarschaft verpasst?«, lenkte ich das Gespräch in eine andere Richtung.
»Mir geht es gut.« Mum nickte bekräftigend. »Ich arbeite wieder Teilzeit, um zwischendurch mal aus dem Haus zu kommen. Und in Eden ist alles wie immer. Manchmal habe ich das Gefühl, als würde die Zeit hier stillstehen. Ach so, Mary-Ann von gegenüber ist wieder schwanger.«
»Was?«, rief ich überrascht aus. »Wurde Pete nicht erst im Sommer geboren?«
»Genau.« Mum nickte. »Sie meinte aber auch, jetzt wäre Schluss. Drei Kinder sind genug, und entweder sie oder Jay ließen sich jetzt sterilisieren.«
»Wow.« Plötzlich kam es mir vor, als wäre ich viel länger als nur drei Monate weg gewesen. »Gibt es sonst noch was, das ich verpasst hab?«
Mum zuckte mit den Schultern. »Nicht wirklich. Der alte Mr Kirby hat eine neue Katze adoptiert, aber das ist wahrlich nichts Außergewöhnliches mehr.«
Jetzt musste ich lachen. Mr Kirby wohnte am Ende der Straße in einem Bungalow, der ähnlich aufgeteilt war wie unserer. Er war nie verheiratet gewesen, hatte keine Kinder, dafür rettete er am laufenden Band streunende Katzen. Ich hatte völlig den Überblick verloren, wie viele er mittlerweile beherbergte. »Er sollte einfach ein Tierheim eröffnen. Die müssen ihm doch mittlerweile die Haare vom Kopf fressen.«
Mum schmunzelte. »Das hab ich ihm auch gesagt, aber er meinte, er würde keine davon abgeben, weil man Menschen nicht vertrauen könnte.«
Ehe ich ihr antworten konnte, piepste mein Handy mit einer eintreffenden Nachricht. Ich zog es hervor und entdeckte, dass Kilian in unsere Whatsapp-Gruppe geschrieben hatte.
@Alicia: Heute Abend, 18 Uhr, Welcome back-Party im Moonlight!
Ein Grinsen breitete sich auf meinem Gesicht aus. Gott, was hatte ich meine Freunde vermisst. Fast sosehr wie das Surfen, dabei hatten sie mich regelmäßig in der Reha besucht oder Videocalls mit mir gemacht. Trotzdem war es nicht genug gewesen, wenn man sich sonst fast jeden Tag gesehen hatte. Sofort schrieb ich zurück.
Bin so was von dabei! Freue mich auf euch, will vorher aber eine Runde surfen gehen :)
Sofort sah ich, dass mehrere Leute zu tippen begannen.
Kilian: Genau deshalb treffen wir uns später. Sonst wären wir schon längst bei dir eingefallen.
Liam: Und du bist sicher, dass du es aus dem Ozean rausschaffst, nachdem du endlich wieder drin bist? ;)
Fotini: Aliciaaa <3 Wir sind so froh, dass du wieder da bist!
Sophie: Ich weine, dass ich nicht dabei sein kann :(
Kilian: Solltest du nicht längst schlafen? Wie spät ist es in Deutschland? Oder sollte ich lieber früh sagen?
Sophie: :p
Ich musste lachen, gleichzeitig wurde mir warm ums Herz. Ich hatte diese verrückte Bande wirklich vermisst. Auch Isabel und Sophie, die aktuell in Deutschland waren, aber bald für länger nach Eden zurückkehren würden. Hoffentlich für immer, doch das würde die Zeit zeigen. Eigentlich hatten sie nur ein Work-and-Travel-Jahr in Australien absolvieren wollen, bei dem Eden nur ein kurzer Punkt unter vielen auf ihrer Route hätte sein sollen. Doch dann hatte Isabel sich in Liam verliebt, und sie waren kurz entschlossen länger geblieben. Ihr Jahr war vorbei gewesen, kurz nachdem ich meine Reha begonnen hatte. In Deutschland hatten sie dann ein Fünfjahresvisum beantragt, mit dem sie bald nach Australien zurückkommen würden.
»Deine Freunde sind auch froh, dass du wieder da bist, oder?«, riss Mums Stimme mich aus meinen Gedanken.
Ich blickte auf und nickte. »Sie planen eine Party für mich heute Abend im Moonlight.« Ich aß das letzte Stück meines Käsekuchens, dann schob ich den leeren Teller von mir.
»Alles andere hätte mich auch überrascht.« Mit einem Lächeln griff Mum nach den leeren Tellern und stand auf.
»Und bis es so weit ist, gehe ich eine Runde surfen.« Ich erhob mich ebenfalls, schnappte mir meine Tasche, die noch immer neben der Tür stand, und machte mich auf in Richtung meines Zimmers, das den Gang entlang rechts vom Wohnzimmer lag. Hier sah es aus, wie ich es an dem Morgen verlassen hatte, als ich vor drei Monaten zum Surfen aufgebrochen war. Mein Bett war gemacht, und die fliederfarbene Tagesdecke war darüber ausgebreitet. Mein Schreibtisch war ein heilloses Chaos aus daraufgeschmissenen Büchern und Zeitschriften, weil ich ihn seit dem Ende der Highschool nur noch als Ablagefläche benutzte. Mein Kleiderschrank stand an der Wand, und an der Tür hing noch immer der Kleiderbügel mit dem luftigen Kleidchen, das ich an dem Abend für unser Treffen im Moonlight hatte anziehen wollen.
Ein Schnauben kam über meine Lippen, und ein bislang ungekannter Schmerz machte sich in meiner Brust breit. Ich würde es nie wieder anziehen. Generell konnte ich meinen halben Kleiderschrank wegschmeißen, weil ein Großteil meiner Garderobe aus kurzen Kleidern und knappen Shorts bestand, in denen ich mich nicht mehr wohlfühlte. Zumindest aktuell nicht. Vielleicht würde sich das wieder ändern, wenn etwas Zeit vergangen war, aber momentan …? Die Narbe war einfach hässlich. Sie war noch immer sehr rot – mir war mehrfach gesagt worden, dass sie noch verblassen würde, doch bisher war davon nichts zu sehen –, sie zog sich über einen Großteil meines rechten Oberschenkels, und wenn man nur einen Blick darauf warf, wusste man sofort, was geschehen war.
Gut, in Eden würde das ohnehin längst jeder erfahren haben, so gut wie der Buschfunk in unserem kleinen Ort funktionierte. Trotzdem wollte ich nicht, dass alle auf meine Beine starrten, um einen Blick auf die Narbe zu erhaschen, sobald sie mich sahen. Ich hatte die Befürchtung, dass ich vom Golden Surfer Girl, als das ich bisher bekannt gewesen war, zu der jungen Frau wurde, die von einem Hai angegriffen worden war.
Ein weiterer Grund, warum ich schnellstmöglich wieder auf mein Board wollte, um es allen zu zeigen. Um ihre Wahrnehmung von mir wieder in die richtige Richtung zu lenken. Ich würde genau da weitermachen, wo ich vor drei Monaten aufgehört hatte, wollte in den kommenden Wochen an möglichst vielen Surf Competitions teilnehmen, damit die Leute gar nicht mehr daran dachten, was mir zugestoßen war, sondern mich als das sahen, was ich mein Leben lang hatte sein wollen: die beste Surferin, die New South Wales je hervorgebracht hatte.
Ich nickte, wie um mir meine Gedanken selbst zu bestätigen, dann ging ich zu der schmalen Tür, die etwas versteckt neben dem Kleiderschank lag. Dahinter befand sich eine Abstellkammer, die kaum groß genug war, dass ich mich darin drehen konnte, aber genau passend, um meine drei Surfbretter aufzubewahren. Ich nahm das heraus, das sich besonders für kleine Wellen eignete, wie sie an dem Strandabschnitt hinter unserem Haus vorkamen, dann öffnete ich den Kleiderschrank, um einen meiner Neoprenanzüge hervorzuholen.
Ich wandte mich von dem Spiegel in meinem Zimmer ab, während ich mich auszog, um nicht versehentlich einen Blick auf meine Narbe zu werfen. Ich konnte sie nicht ansehen, ohne an das erinnert zu werden, was passiert war. Ohne erneut die Angst auf meiner Zunge zu schmecken, dass ich womöglich nie wieder surfen würde. Es war mein erster Gedanke gewesen, als ich nach der Operation im Krankenhaus aufgewacht war, und ich hatte noch heute Albträume davon, aus denen ich schweißgebadet hochschreckte.
Ein Schaudern durchlief meinen Körper, und resolut zog ich den Neoprenanzug meine Beine hoch. Da. Geschafft, ohne einen Blick auf die vermaledeite Narbe zu werfen. Ich wurde eindeutig besser darin.
Ich schlüpfte auch mit den Armen in den Anzug, zog den Reißverschluss am Rücken hoch, und erst dann wandte ich mich dem Ganzkörperspiegel zu, um mich zu betrachten. Sofort hoben sich meine Mundwinkel und mit ihnen meine Laune. Es war ein Anblick, den ich lange vermisst hatte. Einer, von dem ich trotz aller Beteuerungen meiner Ärzte eine Zeit lang befürchtete hatte, ihn nie wieder zu sehen. Ich drehte mich, um mich von allen Seiten betrachten zu können, und mein Lächeln wurde breiter. Ich sah aus wie immer, als wäre gar keine Zeit vergangen, seit ich den Anzug zuletzt getragen hatte. Nichts deutete gerade darauf hin, was mir zugestoßen war, was genau das war, was ich wollte. Vorfreude kam in mir auf, pulsierte durch meine Adern und brachte mich dazu, mich endlich in Bewegung zu setzen.
Ich schnappte mir mein Surfbrett und verließ mein Zimmer. Mum spülte gerade in der Küche unser benutztes Geschirr, und ich steckte nur kurz den Kopf zu ihr rein. »Ich geh surfen, bis später.«
»Viel Spaß, Schatz.« Ich sah Besorgnis in ihren Augen aufblitzen, aber ehe sie etwas wie ›Pass auf die Haie auf‹ sagen konnte, hatte ich mich bereits abgewandt. Durch die Terrassentür trat ich hinaus in unseren kleinen Garten, der diesen Namen eigentlich nicht verdient hatte. Es war nur ein zwei Meter breites Rasenstück, das zu selten gemäht wurde, und auf dem zwei Liegestühle standen, die schon lange nicht mehr benutzt worden waren – zumindest nicht von mir. Heute schenkte ich dem jedoch kaum Beachtung, steuerte auf das kleine Tor im Zaun zu und verließ unser Grundstück.
Ein kleines Wäldchen aus Pinien und Eukalyptusbäumen verband die Siedlung, in der wir wohnten, mit dem schmalen Kiesstrand, der mein Ziel war. Es war nur eine kleine Bucht, an der man selten andere Leute antraf. Morgens tummelten sich dort einige Angler, zwischendurch waren Spaziergänger oder Leute mit ihren Hunden zu sehen, ansonsten war man meistens allein. So auch heute. Außer mir war niemand da.
Vor mir lag der weite Ozean. Es war nichts als blaues Wasser zu sehen, das sich am Horizont mit dem wolkenbehangenen Himmel traf. Das Rauschen der Wellen war Musik in meinen Ohren, ich schmeckte das Salz auf meinen Lippen, und irgendwo in der Ferne war das Kreischen einer Möwe zu hören. Diese scheinbare Unendlichkeit war etwas, das ich in meinen beengten Zimmern im Krankenhaus und während der Reha besonders vermisst hatte.
Ich blieb stehen und schloss für einen Moment die Augen. Der Wind wehte meinen Pferdeschwanz über meine Schulter, und aus irgendeinem Grund fing mein Herz an, schneller zu schlagen. War es die Aufregung? Ich versuchte tief einzuatmen, doch auch meine Kehle wurde eng. Es kam mir vor, als würden Ketten um meinen Brustkorb liegen, die jemand fest zusammenzog. Ich öffnete die Augen wieder, aber das Atmen fiel mir immer schwerer, und mein Herz galoppierte regelrecht davon. Nicht so, als hätte ich Sport gemacht oder mich einfach nur überanstrengt, sondern auf eine Weise, die mir Angst einjagte, weil ich es so noch nie zuvor erlebt hatte. Mein Herzschlag war viel zu schnell, gleichzeitig bekam ich nicht genug Luft, und Schwindel setzte ein.
Was stimmt nicht mit mir?
Verzweifelt rieb ich über meine Augenlider, machte es damit aber nur schlimmer. Schwarze Punkte tanzten vor meinem Sichtfeld, meine Fingerspitzen begannen vor Taubheit zu kribbeln, und einen erschreckend langen Moment befürchtete ich, hier und jetzt ohnmächtig zu werden. Einfach umzukippen und auf den spitzen Steinen des Kiesstrandes aufzuschlagen.
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man sich hinsetzen oder hinlegen sollte, wenn einen Schwindel überfiel, daher ging ich in die Hocke, doch das verschaffte mir überhaupt keine Abhilfe. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, dass es schlimmer wurde, je länger ich den Ozean ansah. Mein geliebtes Meer, das ich mehr als alles andere vermisst hatte. Es lag nur wenige Meter vor mir und kam mir gleichzeitig unerreichbar vor. In meinem aktuellen Zustand traute ich mich nicht einmal, aufzustehen, weil ich befürchtete, dass mir sofort schwarz vor Augen werden würde. Wie sollte ich es da mit meinem Surfbrett aufs Meer schaffen?
Unmöglich.
Was auch immer mit mir los war, es wäre sträflich, es überhaupt zu versuchen. Wenn mir hier draußen etwas zustieß, wäre ich völlig auf mich allein gestellt. Es war niemand da, der mir helfen konnte, der überhaupt mitbekam, dass etwas nicht stimmte.
Mittlerweile saß ich zusammengekauert auf meinem Surfbrett, die Stirn auf meine Knie gelegt und die Arme um meine Beine geschlungen. Mein Herz raste noch immer in einem mörderischen Tempo und schien nicht langsamer werden zu wollen. Was hatte das alles nur zu bedeuten?
Drei Monate hatte ich in Krankenhäusern und in einer Rehaklinik verbracht. Ich war so oft durchgecheckt worden wie nie zuvor in meinem Leben und mit ›alles in bester Ordnung‹ entlassen worden. Also wo kamen diese seltsamen Symptome auf einmal her? Hatten sie etwas übersehen? Gab es eine unentdeckte Krankheit in mir, die sie hervorrief?
Oder war es vielleicht etwas völlig anderes? Unwillkürlich trat das Bild meiner Mum vor mein inneres Auge, wie sie zusammengerollt auf der Couch lag und sich nicht bewegte. War mein Problem vielleicht ein viel tiefergehendes, das mit meinem körperlichen Zustand überhaupt nichts zu tun hatte?
So schnell der Gedanke gekommen war, so schnell verwarf ich ihn auch wieder. Das war eigentlich nicht möglich, immerhin hatte ich mich doch so auf das Surfen gefreut. Seit Tagen hatte ich an nichts anderes denken können, außer mit meinem Board zurück aufs Wasser zu gehen. Wenn wirklich etwas Psychisches dahintersteckte, hätte sich das doch schon viel früher bemerkbar gemacht.
Auf meinem Nacken hatte sich mittlerweile ein Schweißfilm gebildet, dabei war es nicht einmal sonderlich warm heute. Der Sommer neigte sich dem Ende zu, dicke Wolken verdeckten die Sonne, und der frische Wind, der vom Meer aufs Land wehte, ließ mich sogar frösteln. Aber vielleicht lag das bloß an was-auch-immer-mit-mir-los-war, denn als ich vor dem Rehazentrum auf mein Taxi gewartet hatte, war mir nicht kalt gewesen.
Ich konnte da heute nicht rein. Egal, was mit mir war, ich konnte in diesem Zustand nicht mit meinem Board aufs Meer. Ich konnte aber auch nicht hier sitzen bleiben.
Obwohl ich mich immer noch schwindelig fühlte, stand ich langsam auf. Zuerst hockte ich mich auf die Knie, wartete einen Moment, um zu sehen, ob ich ohnmächtig wurde, und als nichts geschah, kam ich ganz auf die Füße. Meine Hände zitterten, mein Herz hämmerte noch immer in einem viel zu schnellen Rhythmus, und meine Atmung war zu flach, aber ich hatte es geschafft. Ich stand und fühlte mich zumindest halbwegs in der Lage, den kurzen Weg nach Hause anzutreten.
Kapitel 2
Alicia
Meine Hände zitterten noch immer, als ich zu Hause ankam, aber mein Herzschlag hatte sich zumindest ein bisschen beruhigt. Als ich das Haus durch die Terrassentür betrat, war von Mum nichts zu sehen, wofür ich dankbar war. Sie würde sofort bemerken, dass etwas nicht stimmte. Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich am Strand gehockt hatte, aber es konnte nicht länger als eine halbe oder Dreiviertelstunde gewesen sein. Nicht annähernd lang genug für eine ausgiebige Surfrunde. Außerdem war ich noch trocken, was ein untrügliches Indiz dafür war, nicht im Wasser gewesen zu sein.
Rasch verschwand ich in meinem Zimmer, stellte mein Surfbrett zurück in die Abstellkammer und öffnete meine Reisetasche, aus der ich meinen Kulturbeutel holte, mit dem ich ins angrenzende Bad ging. Bei meinem Anblick im Spiegel erschrak ich. Ich war viel zu blass, als wäre jegliche Farbe aus meinem Gesicht gewichen. Dazu stand noch immer Schweiß auf meiner Stirn, und meine Augen waren weit aufgerissen. Ich sah aus wie ein verschrecktes Tier, das seinem größten Widersacher begegnet und nur in letzter Sekunde entkommen war.
Ich wandte mich ab, schälte mich aus meinem Neoprenanzug und stellte mich unter die Dusche. Das Wasser drehte ich so heiß auf, wie ich es ertragen konnte, schloss die Augen und hielt mein Gesicht unter den Strahl. Es hatte eine beruhigende Wirkung. Fast so, als würde alles, was zuvor geschehen war, aus mir herausgewaschen werden. Aber egal, wie lange ich hier stand, es konnte meine ratternden Gedanken nicht beruhigen.
Was war das gerade gewesen? Etwas Ähnliches hatte ich nie zuvor verspürt. Es kam mir vor, als hätte mein Körper von einer auf die andere Sekunde kapituliert, nur konnte ich den Grund dafür nicht ausmachen. War es vielleicht wirklich ein körperliches Leiden, das bei den zahlreichen Untersuchungen im Krankenhaus übersehen worden war und sich ausgerechnet den Augenblick aussuchte, sich bemerkbar zu machen, als ich von der monatelangen Tortur entlassen worden war? Auch jetzt verspürte ich die Beklemmung noch tief in meiner Brust sitzen. Wie ein schlafendes Ungeheuer, das nur darauf wartete, mich erneut zu überfallen. Ich legte meine Hand auf meine Brust, genau an der Stelle, an der mein Herz vorhin noch viel zu schnell geschlagen hatte. Doch jetzt war es wieder zu seinem normalen Rhythmus zurückgekehrt. Nichts deutete mehr darauf hin, was am Strand geschehen war, aber ich konnte es auch nicht vergessen. Die Geschehnisse hatten sich in meine Erinnerung gebrannt, und selbst wenn so etwas nie wieder vorkam, würden sie so schnell nicht verblassen.
Ich drehte das Wasser ab und verließ die Dusche. Meine Haare wickelte ich in ein kleines Handtuch und ein großes um meinen Körper. So ging ich zurück in mein Zimmer. Meine Reisetasche beachtete ich gar nicht und öffnete stattdessen meinen Kleiderschrank. Meine kurzen Kleidchen und knappen Shorts ignorierte ich.
Vielleicht würde dieser Tag irgendwann kommen, an dem ich wieder zu ihnen griff, aber heute war es nicht so weit. Stattdessen zog ich eine weiße Jeans und ein geblümtes T-Shirt aus dem Schrank und zog mich an. Anschließend föhnte ich meine Haare, die ich offen ließ, weil der heiße Hochsommer vorbei war und ich darunter nicht schwitzen würde. Als ich mit allem fertig war, warf ich einen Blick auf die Uhr und ließ mich resigniert aufs Bett fallen. Ich hatte noch zwei Stunden, bis ich ins Moonlight musste, und keine Ahnung, womit ich sie füllen sollte. Ich könnte einen meiner Freunde anrufen oder in unsere Gruppe schreiben, dass wir uns schon früher treffen könnten, aber dann wüssten sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Normalerweise bekam man mich so schnell nicht aus dem Wasser, wenn ich einmal mit meinem Surfbrett draußen war. Ich konnte mich an mehrere Situationen erinnern, an denen ich zu spät zu Verabredungen gekommen war, weil ich auf dem Board komplett die Zeit vergessen hatte.
Tja, das würde mir heute definitiv nicht passieren.
Am Ende schaltete ich meinen Laptop ein und sah mir einige Folgen Brooklyn99 auf Netflix an. Ich war nie ein großer Serienschauer gewesen, weil ich früher selten zu Hause gewesen war, aber in den letzten Monaten hatte sich das geändert. Ich hatte einige großartige Serien durchgesuchtet, von denen meine Freunde früher geschwärmt hatten. Breaking Bad, Sons of Anarchy, und ich hatte mich sogar an einige Folgen The Walking Dead gewagt, obwohl mir Horror eigentlich immer zu gruselig war. Aber ich mochte die Geschichten der Menschen, die in einer ihnen völlig neuen Welt zu überleben versuchten.
Außerdem war ich auf eine Dokumentation gestoßen, die Izzy’s Koala World hieß. Darin ging es um ein vierzehnjähriges Mädchen, das zusammen mit seinen Eltern verletzte Koalas rettete und sie pflegte, bis es sie wieder in der Wildnis aussetzen konnte. Ich musste unbedingt Liam davon erzählen, weil sie mich so sehr an ihn erinnert hatte. Oder vielleicht lieber Isabel, wenn sie zurück war. Vielleicht gab es eine Möglichkeit, ein ähnliches Format mit Liam aufzuziehen.
Der Gedanke ließ mich grinsen, während ich auf das Moonlight zuging, denn ich konnte mir in etwa vorstellen, was Liam davon halten würde. Auch wenn er sich mittlerweile mit Instagram angefreundet hatte – mehr oder weniger – und es seit seinem öffentlichen Statement keinen weiteren Shitstorm gegeben hatte, würde er niemals zustimmen, ein Filmteam auf das Sapphire Coast Koala Sanctuary zu lassen. Aber um ehrlich zu sein, würde ich gerne sein Gesicht sehen, wenn ich ihm das vorschlug.
Das Moonlight zu betreten war wie nach Hause kommen. Grayson stand hinter der Theke und winkte mir zu. Cooper neben ihm zapfte gerade ein Bier, aber auch seine Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln. Es roch nach gebratenem Fleisch, würzigen Pommes, und irgendein Rocksong dudelte aus den Lautsprechern.
»Alicia.« Mit einem Mal stand Kilian vor mir, zog mich in die Arme und wirbelte mich im Kreis herum.
»Kilian, lass das«, schalt ich ihn, konnte das Lachen aber nicht verhindern.
»Ich freue mich halt, dich zu sehen«, entgegnete er, stellte mich aber wieder auf die Füße. »Du hast mir gefehlt.«
»Du mir auch, du Spinner.« Ich knuffte ihn in die Seite.
Kilian legte einen Arm um meine Schultern und führte mich nach hinten auf die Terrasse, wo die anderen bereits an einem Tisch saßen. »Ich wette, ich kann dich noch immer unter den Tisch trinken.«
Lachend stieß ich ihn von mir. Leider hatte er damit vollkommen recht. Ich war noch nie sonderlich trinkfest gewesen, aber nachdem ich drei Monate lang nicht mal einen Schluck Bier getrunken hatte, würde ich sicher nicht auf seine Wette eingehen.
Fotini sprang von ihrem Platz auf, kam um den Tisch herumgelaufen und zog mich in eine kräftige Umarmung. Ihre Haarspitzen waren momentan dunkelgrün gefärbt, und dazu trug sie Jeans mit einem schwarzen Oberteil, das mit Pailletten besetzt war und selbst designt aussah. »Du hast uns so gefehlt.«
Ich musste gegen die Enge in meiner Kehle anschlucken, weil ich plötzlich von einer Welle der Dankbarkeit überrollt wurde. Dankbarkeit, endlich wieder zu Hause und bei meinen wunderbaren Freunden zu sein, die alles stehen und liegen ließen, um den Abend mit mir zu verbringen. Zu Hause hatte ich das noch gar nicht empfinden können. Da hatte zuerst die Sorge um Mum überwogen und dann was auch immer am Strand geschehen war. Aber auch davon war jetzt nichts mehr zu spüren. Mein Herzschlag hatte sich wieder normalisiert, und wenn ich an den Moment zurückdachte, kam er mir vor, als wäre er einer anderen passiert. Als würde ich durch einen Schleier zu dieser anderen Alicia sehen, von der ich emotional abgekoppelt war, denn ich konnte mir diese unerklärlichen Symptome, die mich am Strand befallen hatten, gar nicht mehr vorstellen.
Ich schüttelte diesen Gedanken ab und zog Fotini noch ein bisschen enger an mich heran. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie froh ich bin, wieder bei euch zu sein.«
Sie löste sich von mir und schob mich auf Armeslänge von sich weg, um mich eingehend zu betrachten. »Gut siehst du aus. Erholt.«
Ich musste so plötzlich lachen, dass ich mich an meiner eigenen Spucke verschluckte und einen Hustenanfall bekam. »Dabei bin ich alles andere als das. Hast du eine Ahnung, wie anstrengend so eine Reha ist?« Ich war jemand, der schon immer einen aktiven Lebensstil geführt hatte, aber die ersten Tage in der Reha hatte ich gedacht, ich müsste sterben. Die Übungen hatten zwar im entfernten Sinne mit Sport zu tun, waren aber gezielt darauf ausgerichtet, die zerstörten Muskeln in meinem Bein wieder aufzubauen – was ein langwieriger und schmerzhafter Prozess war.
Dazu kam, dass mein Tag regelrecht vollgestopft mit Terminen gewesen war. Ich hatte morgens zum Frühstück mein Zimmer verlassen, war von einer Anwendung zur nächsten Massage und der darauffolgenden Besprechung gehetzt und erst nach dem Abendessen wieder zurückgekommen.
Fotini kniff mir in die Wange und grinste breit. »Es scheint dir auf jeden Fall nicht geschadet zu haben.«
Ich verdrehte die Augen, aber ehe ich dazu kam, ihr zu antworten, wurde ich schon zur nächsten Person gezogen. Ich umarmte Kate, dann Liam und zum Schluss Grayson, der zudem eine riesige Torte an unseren Tisch brachte. »Double-Chocolate-Caramel-Fudge«, erklärte Kilian. »Wir dachten uns, das könntest du gebrauchen, nachdem du die letzten Wochen sicher zu wenig Soulfood bekommen hast.«
Wie auf Kommando begann mein Magen zu knurren, und das Wasser lief mir im Mund zusammen, wenn ich die Schokoglasur betrachtete. Gleichzeitig musste ich grinsen. Da war ich keine vierundzwanzig Stunden aus dem Gesundheitsregime der Reha entlassen und bekam bereits das zweite Mal einen Kuchen vorgesetzt. Aber ich würde mich ganz sicher nicht beschweren. »Das Essen im Krankenhaus war wirklich fürchterlich. Das in der Reha ging eigentlich, aber so geile Torten hat man da vergeblich gesucht.« In der Reha war viel Wert auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung gelegt worden. Grundsätzlich versuchte ich das auch in meinen normalen Tagesablauf zu integrieren, aber manchmal brauchte ich einfach etwas Süßes für meine Seele. Es musste nicht einmal viel sein, ein kleines Stückchen Schokolade konnte schon Wunder wirken, aber auch davon hatte ich die letzten Wochen nicht annähernd genug bekommen.
»Du kannst jetzt alles nachholen, was du verpasst hast.« Kilian nahm das Messer zur Hand und schnitt die Hälfte der Torte in kleine Dreiecke. Das größte davon lud er mir auf den Teller.
Mit meiner Gabel bewaffnet, machte ich mich darüber her. Cremige Schokolade gepaart mit leicht salzigem Karamell traf auf meine Geschmacksnerven. Der Teig war so fluffig, er zerging direkt auf meiner Zunge. Ein zufriedener Laut verließ meine Kehle, und ich schloss genüsslich die Augen. »Das ist so gut«, nuschelte ich mit vollem Mund. »Ich möchte den Kuchen heiraten.«
»Ich möchte der Kuchen sein«, entgegnete Kate, die ihr Stück genauso verliebt ansah wie ich meins.
Über den Tisch hinweg taxierte ich sie. »Aber wenn du der Kuchen bist, kannst du ihn nicht essen. Beziehungsweise würdest du dich dann selbst essen, was irgendwie seltsam wäre.«
Unbeeindruckt zuckte sie mit den Schultern. »Und wenn du den Kuchen heiratest, müsstest du ihn mit ins Bett nehmen, was … na ja … nicht gerade hygienisch wäre.«
»Wie wäre es, wenn wir den Kuchen einfach essen, ohne ihn zu heiraten oder sonst was?« Kilian betrachtete uns leicht irritiert, und ich musste mir das Lachen verkneifen.
»Wie? Keine Wette, wer von uns das wirklich durchzieht?«, zog ich ihn auf.
Er schüttelte sich leicht. »Mit Essen spielt man nicht«, sagte er ernst. »Und über Essen macht man auch keine Witze.«
Kate seufzte leicht und stützte sich mit dem Ellbogen auf. »Da kennen wir uns schon so lange, und ich kannte diese Seite an dir gar nicht? Wie konntest du sie uns so lange verheimlichen?«
Während Kilian und Kate sich weiter kabbelten, grinste ich in mich hinein und wandte mich Liam zu, der neben mir saß. »Wie läuft das Sanctuary?« Liam leitete ein Koala-Rescue-Reservat in Eden, das in der Vergangenheit in Schwierigkeiten geraten war. Erst als seine Freundin Isabel, die ein Work-and-Travel-Jahr in Australien gemacht hatte, dort gelandet war, hatte sie den Laden komplett umgekrempelt und ihm zu neuem Ruhm verholfen.
»Sehr gut.« Liams Lächeln besaß eine Leichtigkeit, die ich bei ihm nicht gewohnt war. »Wir bauen gerade das vierte Gehege, Lucas arbeitet wieder Vollzeit bei uns, und wir konnten diesen Sommer so viele verletzte Tiere bei uns aufnehmen wie nie zuvor. Nicht nur Koalas. Mum bringt mittlerweile auch alle möglichen anderen aus den Nationalparks mit, die wir zuvor aus Platzgründen immer abweisen mussten.«
»Klingt super. Also kommen weiterhin regelmäßig Spenden rein?«
»Es schwankt immer ein bisschen. Wenn ich einen Koala mit einem schlimmen Schicksal vorstelle, kommt mehr rein, als wenn ich über unseren normalen Alltag im Sanctuary berichte. An Besuchstagen steigen die Spenden auch oft an. Allgemein ist es mittlerweile aber ausreichend, um ordentlich über die Runden zu kommen.«
Ich griff nach Liams Hand und drückte sie kurz. »Das ist doch die Hauptsache. Und mit Instagram hast du dich ebenfalls angefreundet?«
Er sah zur Seite und presste kurz die Lippen aufeinander. »Es gibt immer noch Tage, an denen ich die App am liebsten löschen würde. Tage, an denen wir blöde Kommentare bekommen, aus denen Neid und Missgunst sprechen. Ich versuche, sie bestmöglich zu ignorieren und sofort zu löschen, aber ich kann auch nicht verhindern, dass mich jeder Einzelne davon trifft.«
Mitfühlend nickte ich. Nachdem versehentlich ein Feuer auf dem Sanctuary ausgebrochen war, bei dem keine Tiere verletzt worden, aber die Gehege niedergebrannt waren, war ein Shitstorm über Liam hineingebrochen, woraufhin die Spenden ausgeblieben waren. Erst Isabel hatte mit einer großen Marketingaktion dem Sanctuary zu neuem Glanz verholfen, aber es gab immer noch einige Idioten, die es liebten, Stunk zu verbreiten.
»Verständlich, dass dich das mitnimmt.« Das Sanctuary war Liams Lebenstraum. Für die Tiere würde er alles tun, sogar sein letztes Hemd geben. »Aber die Kommentare können dir nichts anhaben. Das sind nur verbitterte Leute, die mit ihrem eigenen Leben unzufrieden sind und deshalb andere kritisieren, um sich selbst besser zu fühlen.«
Ironisch verzog er den Mund. »Das sagt Isabel auch immer.«
»Deine Freundin ist eine schlaue Frau. Wann kommen sie und Sophie wieder?«
»In zweieinhalb Wochen. Ich kann es kaum abwarten, sie wieder in die Arme zu schließen. Cooper und ich planen eine große Willkommensparty für sie.«
»So muss das sein. Ich vermisse die beiden auch.« Zwar schrieben wir uns in unserer Gruppe viele Nachrichten, aber durch den Zeitunterschied von Australien zu Deutschland waren sie wach, wenn ich im Bett war, und umgekehrt. Es war kaum möglich, eine Unterhaltung zu führen, die über wenige Nachrichten hinausging.
»Aber genug von mir. Wie geht es dir? Und wie war das erste Mal Surfen nach der langen Pause?«
Sofort war die Beklemmung wieder da, und das Lächeln rutschte von meinen Lippen. Wie gern würde ich Liam jetzt erzählen, dass ich die Zeit im Wasser genossen hätte und es wie nach Hause kommen gewesen war, auf meinem Board zu stehen. Aber ich konnte Liam auch nicht anlügen. Nicht vollständig zumindest. »Wir tasten uns neu aneinander heran.«
Er hob die Augenbrauen. »Wie meinst du das?«
Ich öffnete den Mund, um ihm zu sagen, was geschehen war, aber keine Worte verließen meine Lippen. Obwohl wir normalerweise keine Geheimnisse voreinander hatten, brachte ich es einfach nicht über mich, laut auszusprechen, dass ich es nicht einmal ins Wasser, geschweige denn auf mein Board geschafft hatte. Aber vielleicht war das auch gar nicht nötig. Vielleicht müssten Liam und die anderen nie erfahren, was sich heute zugetragen hatte. Noch immer war da die Hoffnung in mir, dass das heute bloß eine einmalige Sache gewesen war. Vielleicht war es einfach zu viel für mich gewesen. Nach den langen Wochen, die ich im Krankenhaus und in der Reha verbracht hatte, brauchte mein Körper möglicherweise einige Tage, um sich wieder an den Normalzustand zu gewöhnen. Eventuell würde die Sache schon morgen ganz anders aussehen und ich könnte ohne Probleme ins Wasser gehen. Sollte das der Fall sein, wollte ich meine Freunde nicht unnötig damit beunruhigen, was heute geschehen war. Wenn der Zustand länger anhielt, könnte ich sie immer noch einweihen.
Ich schüttelte den Kopf und versuchte, möglichst ehrlich zu lächeln. »Ich glaube, ich brauche einfach ein paar Tage, um wieder reinzukommen. Die lange Pause geht auch an mir nicht spurlos vorüber. Das ist alles.«
Liam sah nicht überzeugt aus. Kritisch bohrte sich sein Blick in meinen, wollte mich dazu bringen, ihm die ganze Wahrheit zu sagen, weil er mich gut genug kannte, um die kleinen Nuancen zu erkennen, wenn ich flunkerte. Und fast hätte es funktioniert. Beinahe hätte ich ihm alles gestanden, weil das einfach das war, was Liam und ich taten: Wir sagten uns die Wahrheit, auch wenn es wehtat. Doch dann kam etwas völlig anderes aus meinem Mund.
»Es ist einfach eine Umgewöhnung. Durch meine Verletzung«, ich deutete auf mein Bein, »hab ich noch nicht die Standfestigkeit wie vorher, aber ich denke, in einigen Tagen sollte das überwunden sein.«
»Oh.« Liams Blick senkte sich auf meinen rechten Oberschenkel, aber natürlich konnte er da nur den weißen Stoff meiner Jeans erkennen. Er schluckte sichtlich, ehe er mir wieder in die Augen sah. »Aber sonst ist alles okay? Also … die Ärzte haben dir doch grünes Licht gegeben, dass du alles wieder machen kannst, oder?«
Augenblicklich fühlte ich mich schlecht, meine Verletzung als Ausrede missbraucht zu haben. Aber wenn ich bald wieder die Alte war, müsste niemand davon erfahren. »Ja, klar, es ist so weit alles in Ordnung. Ich spüre die Narbe zwar noch und muss sie mehrmals am Tag eincremen, aber von der Beweglichkeit her schränkt sie mich nicht mehr ein. Ich glaube vor allem, dass ich mir selbst noch nicht zu hundert Prozent wieder vertraue, dass ich mein Bein voll belasten kann. Ich zögere auf dem Board, wenn ich mich eigentlich komplett reinlehnen müsste.«
»Verständlich nach der langen Zeit und dem, was dir zugestoßen ist.« Liam schob sich das letzte Stück seiner Torte in den Mund und nickte. »Aber grundsätzlich ist das wirklich gut. Wir hatten echt Angst um dich.«
»Ich auch.« Augenblicklich kamen mir die ersten bangen Minuten damals im Krankenhaus wieder in den Sinn. Ich war gerade aus der Narkose erwacht, Isabel und Sophie hatten an meinem Bett gesessen, und ihre besorgten Gesichter hatten mich die falschen Schlüsse ziehen lassen. Dass mein Bein hatte amputiert werden müssen und ich nie wieder surfen könnte. Es waren nur Sekunden gewesen, ehe ein Arzt mir versichert hatte, wieder völlig gesund zu werden, doch sie verfolgten mich bis heute in meinen Albträumen.
Erst später hatte ich erfahren, dass meine Freunde stundenlang im Wartebereich des Krankenhauses ausgeharrt hatten. Dass sie gebangt hatten, wie es mir ging, weil ihnen niemand etwas erzählt hatte. Ich wollte mir gar nicht ausmalen, wie sie sich gefühlt haben mussten, hatten mir die wenigen Sekunden doch schon ausgereicht.
Ich schob all diese Gedanken beiseite und blickte Liam fest an. »Genug Trübsal geblasen jetzt. Wir wollten heute doch feiern und eine gute Zeit haben.«
Liam nickte, und passend dazu trat Cooper mit einem Tablett Sektgläser an unseren Tisch. »Ich habe gehört, hier gibt es etwas zu feiern.« Er sah mich direkt an.« Schön, dass du wieder da bist. Die gehen aufs Haus.« Aus einem Impuls heraus stand ich auf und zog Cooper in eine Umarmung. Kurz vor meinem Unfall hatte er das Moonlight von seinem verstorbenen Großvater Bobby übernommen. Ich war bisher nicht dazu gekommen, mich länger mit ihm zu unterhalten – zumal wir anfangs auch dachten, dass Cooper nicht lange bleiben würde –, aber das musste ich ziemlich bald nachholen.
Ich nahm eins der Gläser, drückte Cooper ebenfalls eines in die Hand und wartete, bis alle anderen auch versorgt waren, dann hielt ich meins in die Höhe. »Auf euch alle. Weil ihr die besten Freunde seid, die man sich wünschen kann.«
»Auf dich«, kam es fast einstimmig aus ihren Mündern, dann stießen wir gemeinsam an.
Kapitel 3
Alicia
Heute wird es klappen.
Ich betrachtete mein Board, das neben mir an der Wand lehnte, und sprach mir selbst Mut zu. Nervosität machte sich in mir breit, weil ich kurz davor war, ein weiteres Mal an den kleinen Strand hinter unserem Haus zu gehen. Ich spürte es an dem nervösen Flattern in meiner Magengegend und in meinen Fingerspitzen, die zu kribbeln begannen.
Zwei Tage war es her, seit ich diesen seltsamen Anfall am Strand gehabt hatte, der mich davon abgehalten hatte, surfen zu gehen. Die Erinnerungen daran waren aber keinesfalls verblasst. Trotzdem hoffte ich, dass es heute anders ablaufen würde. Von den seltsamen Reaktionen meines Körpers hatte ich seitdem keine mehr bemerkt. Kein Herzrasen mehr, kein Schwindel, nicht mehr dieses unangenehme Gefühl, dass mit mir irgendwas nicht stimmen könnte. Was auch immer vor zwei Tagen vorgefallen war, es war sicher nur eine einmalige Angelegenheit gewesen. Hoffte ich.
Eigentlich hatte ich bereits gestern einen weiteren Surfversuch starten wollen, doch dann war ich mit dem Kater des Jahrhunderts aufgewacht. Eigentlich hatte ich im Moonlight gar nicht so viel Alkohol getrunken, aber die Kombination aus überhaupt mal wieder trinken und nach Monaten mal wieder bis drei Uhr nachts aufbleiben, hatte mir wohl den Rest gegeben. Ich hatte mich gefühlt, wie durch den Fleischwolf gedreht. Mein Kopf hatte gedröhnt, und meine Glieder waren schwer wie Blei gewesen. Es war ganz allgemein kein Zustand, in dem ich mich je auf mein Board gestellt hätte. Auch vor dem Unfall nicht, und selbst dann nicht, wenn mich jemand begleitet hätte. Surfen konnte gefährlich werden, vor allem, weil man die Strömungen nicht immer einschätzen konnte. Daher war ich gestern lieber zu Hause geblieben, hatte vormittags auf der Couch gegammelt und mich nachmittags in den Garten gelegt, um an meiner Bräune zu arbeiten, die mir in den letzten drei Monaten größtenteils abhandengekommen war. Mum hatte mich mit Kaffee und Soulfood versorgt, und irgendwie war es schön gewesen, einfach mal einen ganzen Tag nichts zu tun. Das machte ich ohnehin viel zu selten – wenn man von der Zeit im Krankenhaus nach meinen Operationen absah. Und da war es gezwungen gewesen, was dem Ganzen einen bitteren Beigeschmack gegeben hatte.
Aber heute war ich fit. Ich fühlte mich ausgeschlafen und hatte ordentlich gefrühstückt. Einem Ritt auf den Wellen stand nichts im Wege.
Ich schluckte die Empfindungen hinunter, die meine Kehle emporkrochen, und schnappte mir mein Board, um es mir unter den Arm zu klemmen. Dann verließ ich mein Zimmer, ging den schmalen Flur entlang, um das Haus durch die Terrassentür zu verlassen.
Das Wohnzimmer lag ruhig und verlassen da, aber ich konnte Mum in ihrem Schlafzimmer hantieren hören. Irgendwas klapperte, als wäre es heruntergefallen, und mein erster Impuls war es, hinzustürmen und nachzusehen. Es hatte eine Zeit gegeben, da hätten solche Geräusche mich in Angst versetzt, aber ich musste mir immer wieder in Erinnerung rufen, dass es Mum heute besser ging. Dass solche Geräusche normal waren und auch ich mal etwas fallen ließ, das Krach machte. Erst gestern war mir ein Kleiderbügel mit mehreren Jeans dran aus den Händen gerutscht und zu Boden gefallen. Rückwirkend betrachtet hatte es sich vermutlich nicht viel anders angehört.
Sie ist drei Monate ohne mich klargekommen.
Wie ein Mantra wiederholte ich diesen Satz mehrmals, dann machte ich mich auf den Weg zum Strand. Ein frischer Wind blies mir entgegen, als ich nach draußen trat. Es war noch nicht wirklich kühl, aber der Sommer war eindeutig vorbei. Dicke Wolken hingen am Himmel, aus denen es laut Wettervorhersage später auch regnen sollte. Perfektes Wetter für das, was ich vorhatte, weil es hieß, dass sich wenige bis gar keine Leute am Strand aufhalten würden.
Während ich durch das kleine Waldstück ging, horchte ich in mich hinein. Mein Herzschlag war ruhig und gleichmäßig, und ganz allgemein fühlte ich mich gut. Am Stand angekommen, schlüpfte ich als Erstes aus meinen Sandalen und ging mit nackten Füßen über den feinen Kies. Die kleinen Steinchen piksten unter meinen Fußsohlen, aber ich nahm den Schmerz kaum wahr. Dafür lief ich viel zu oft und nahezu überall barfuß.
Für einen Moment schloss ich die Augen und konnte die Veränderung in mir fühlen. Mein Herz begann schwerer zu schlagen. Auf eine Art, wie ich es nie zuvor verspürt hatte. Ich konnte es gar nicht richtig beschreiben, aber es war, als würde jeder Schlag anstrengender sein als der zuvor. Mein Brustkorb zog sich zusammen, und meine Atmung kam rasselnd, als würde ich gar nicht genug Luft in meine Lunge bekommen, egal, wie sehr ich mich anstrengte. Sofort schlug ich die Augen wieder auf und sah mich am Strand um. Außer mir war erneut niemand da, doch das beruhigte mich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Mein Sichtfeld grenzte sich ein, und schwarze Pünktchen begannen vor meinen Augen zu tanzen. Trotzdem machte ich einen Schritt nach vorne. Dann noch einen. Ich konnte – wollte – einfach nicht akzeptieren, dass ich erneut fünf Meter von der Uferlinie entfernt aufgeben musste.
Ich schaffte es einen Meter weiter als vorgestern, dann wurde mir schwarz vor Augen, und ich sank erneut auf mein Board. Die kleinen Kiessteine darunter gaben ein protestierendes Geräusch von sich, als ich mich mit meinem ganzen Gewicht auf das Surfbrett fallen ließ, doch das nahm ich kaum wahr. Tränen der Wut brannten in meinen Augen, weil ich einfach nicht verstand, warum mein Körper mich derart im Stich ließ. Jedes Mal kurz vor dem Ziel. Das Perfide war, dass es mir den ganzen Tag und auch gestern gut gegangen war. Kein Anzeichen davon, dass etwas mit mir nicht stimmte, aber sobald ich mich dem Ozean auch nur näherte, hatte ich das Gefühl, als müsste ich jeden Moment sterben. Als würde ich hier und jetzt in Ohnmacht fallen, ohne etwas dagegen unternehmen zu können. Ohne überhaupt zu wissen, was es ausgelöst hatte.
Dabei weißt du genau, woher es kommt.
Wie ein ungebetener Gast schlich sich die kleine Stimme in meinen Kopf. Ich wollte sie vertreiben, ignorieren und am liebsten verdrängen, was sie mir einflüsterte, aber konnte ich das wirklich? Wenn ich das Problem überwinden wollte, sollte ich da nicht wenigstens in Betracht ziehen, dass es einen psychosomatischen Ursprung haben könnte?
Von rechts sah ich eine Frau, die mit ihrer kleinen Tochter an den Strand und in meine Richtung gelaufen kam. Zu dem eigentlichen Chaos gesellte sich nun noch die Befürchtung, dass sie mich erkennen und ansprechen könnte. Dass sie mich fragen könnte, warum ich mit meinem Board hier auf den Steinen saß, anstatt draußen auf den Wellen zu sein. Dass sie auf den ersten Blick ausmachen könnte, was mit mir los war, auch wenn ich selbst noch mit mir haderte, es anzuerkennen.
Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass irgendjemand realisierte, dass ich zu einem Häufchen Elend wurde, sobald ich auch nur versuchte, mich dem Ozean zu nähern. Ich konnte mir die Schlagzeile im Lokalanzeiger schon vorstellen, wenn das die Runde machte. ›Golden Surfer Girl hat Angst vor dem Wasser.‹ Bisher hatte ich es genossen, dass eine Zeitung mich als Golden Surfer Girl betitelt hatte und dieser Begriff von vielen Einwohnern in Eden übernommen wurde, doch in diesem Zusammenhang bekam er schnell einen zynischen Beigeschmack. Ich wollte gar nicht darüber nachdenken, was dann hinter vorgehaltener Hand über mich getuschelt wurde. Eden war ein kleiner Ort, in dem nicht viel passierte. Wir hatten keine hohe Kriminalitätsrate, hier waren keine großen Firmen ansässig, die sich mit zweifelhaften Machenschaften am Geld der ehrlichen Bürgerinnen und Bürger bedienten, und das monatliche Highlight war immer noch, wenn das Kreuzfahrtschiff der Royal Caribbean Cruises vor Anker lag und die gut betuchten Touristen das Städtchen bevölkerten. Gossip war etwas, das einen von seinen eigenen Problemen ablenkte, und ich hatte wirklich keine Lust, zum Stadtgespräch zu werden. Zumindest nicht mehr als ohnehin schon, denn ich konnte mir gut vorstellen, was seit dem Haiangriff über mich gesagt wurde.
Immerhin wusste ich noch genau, wie das damals mit Liam abgelaufen war, nachdem ihm versehentlich die Koala-Gehege niedergebrannt waren. Die Leute hatten sich darauf gestürzt, die Ereignisse waren im lokalen Supermarkt, am Hafen und am Strand diskutiert worden, und auch wenn nicht alle die falschen Aussagen geglaubt hatten, dass Liam das Feuer absichtlich gelegt haben sollte, wollte ich nicht, dass ähnliche Gerüchte auch über mich existierten.
Ein Schaudern durchlief meinen Körper, und ich versuchte, aufzustehen. Mit wackeligen Knien, die unter mir nachzugeben drohten, zwang ich mich in die Höhe. Alles um mich herum drehte sich, schwarze Punkte tanzten vor meinem Sichtfeld, und mein Herz schien vor mir davongaloppieren zu wollen, trotzdem machte ich weiter. Die Frau und ihre Tochter waren nur noch knapp fünfzehn Meter von mir entfernt, und ich musste hier weg sein, ehe sie mich erreichten.
Ich klemmte mir mein Board unter den Arm und machte den ersten wackeligen Schritt in Richtung schützendem Wald. Dann noch einen. Und noch einen. Nach jedem blieb ich stehen und versuchte, einen tiefen Atemzug zu nehmen, der nicht auf halbem Weg in meiner Lunge stecken blieb. Es gelang mir nur semigut. Trotzdem gab ich nicht auf.
Immer wieder blickte ich mich dabei nach der Mutter und ihrem Kind um, aber sie schenkten mir zum Glück keine Beachtung, sondern waren mit sich selbst beschäftigt. Das kleine Mädchen bückte sich dann und wann und hob etwas aus dem Kies auf – vermutlich Muscheln, die ans Ufer gespült worden waren, oder vielleicht auch kleine Steine, die besonders hübsch aussahen. Sie hatten mich bisher nicht mal entdeckt, aber ich wollte trotz allem nicht hierbleiben und riskieren, dass sie mich doch noch erkannten.
Ich stolperte in den Wald hinein, und sobald man mich durch das Dickicht nicht mehr sehen konnte, lehnte ich mich gegen einen Baumstamm und ließ mich daran zu Boden gleiten. Mein Herz jagte unnatürlich schnell in meiner Brust, mein Atem kam rasselnd, alles um mich herum drehte sich, und für einen erschreckend langen Moment befürchtete ich, mich übergeben zu müssen. Ich klammerte mich an dem Surfbrett vor mir fest, als wäre es mein Rettungsanker, schloss meine Augen und nahm lange, tiefe Atemzüge. Bis zehn zählen, während ich einatmete, bis zehn zählen beim Ausatmen. Ich wusste nicht, wie lange es dauerte, bis die Welt aufhörte, sich um mich zu drehen, aber es kam mir wie eine Ewigkeit vor. Bis das Zittern in meinen Gliedern nachließ und mein Herzschlag endlich in einen normaleren Rhythmus verfiel.
Schließlich fühlte ich mich sicher genug, um aufzustehen und den Heimweg anzutreten.
»Warst du surfen?«, erklang Mums Stimme, kaum dass ich die Terrassentür hinter mir zugezogen hatte.
Ich erstarrte mitten in der Bewegung, dann drehte ich langsam den Kopf in ihre Richtung. Sie stand an der Spüle und trocknete gerade einen Teller ab. Ihr Kopf war von mir abgewandt, also hatte sie mich bisher nur gehört, nicht gesehen. Vielleicht schaffte ich es, in meinem Zimmer zu verschwinden, ehe sie einen Blick auf mich erhaschte.
In dem Moment drehte sie sich zu mir um. Ihre Augen weiteten sich unmerklich, als sie mich vom Scheitel bis zur Sohle betrachtete. »Du bist noch trocken.« Es war eine Feststellung, aber ich konnte die unausgesprochenen Fragen dahinter lauern hören. Es war noch nie passiert, dass ich zum Surfen rausgegangen war und es dann nicht durchgezogen hatte. Surfen war schon immer meine Leidenschaft gewesen, normalerweise war es eher so gewesen, dass man mich nicht mehr aus dem Wasser herausbekommen hatte, wenn ich einmal drin gewesen war. Ich konnte mir vorstellen, wie seltsam mein Aufzug auf Mum wirken musste.
Doch auch ihr konnte ich nicht sagen, was mit mir los war. Meine Kehle zog sich zusammen, wenn ich nur darüber nachdachte. Ich verstand ja selbst nicht, was mit mir los war, konnte es nicht einmal beschreiben, wie sollte ich es da jemand anderem erklären? »Keine guten Wellen«, murmelte ich deshalb und rauschte an ihr vorbei in die Sicherheit meines Zimmers.
Dort ließ ich mein Board achtlos auf den Boden fallen und schmiss mich aufs Bett. Ich zog das Kissen über meinen Kopf und presste es vor meinen Mund. Am liebsten hätte ich hineingeschrien. So laut ich konnte, um etwas von der Anspannung, der Wut und der schrecklichen Befürchtung, es nie wieder auf die Wellen zu schaffen, aus mir herauszubekommen. Es war wie ein Druck in mir, der bald explodieren würde, wenn ich nichts dagegen unternahm.
Gleichzeitig wollte ich aber nicht, dass Mum mich hörte und ihre eigenen Schlüsse daraus zog. Sie würde ohnehin schon misstrauisch sein, nachdem sie mich gerade gesehen hatte, und ich wollte ihr nicht noch mehr das Gefühl geben, dass irgendwas nicht in Ordnung war. Gerade vor ihr wollte ich den Schein wahren, auch wenn es bei ihr am schwersten werden würde, immerhin wohnten wir zusammen.
Dabei ließ mich die Befürchtung nicht los, längst zu wissen, was das alles zu bedeuten hatte. Wie bereits beim letzten Mal waren sämtliche körperlichen Symptome wieder verschwunden, kaum dass ich den Strand verlassen hatte. Sie überfielen mich immer nur, wenn ich drauf und dran war, ins Wasser zu gehen. In das Wasser, in dem ich beim letzten Mal von einem Hai angegriffen worden war.
Konnte es sein, dass ich eine Angststörung entwickelt hatte? So ungern ich es vor mir selbst zugeben wollte, aber die Symptome passten genau dazu. Was ich die letzten zwei Male am Strand erlebt hatte, waren Panikattacken gewesen. Für mich waren das beängstigende Begriffe, vor allem, weil ich mich nie näher damit befasst hatte und keine Ahnung hatte, was genau das alles bedeutete. Aber allein der Gedanke, eine psychische Krankheit entwickelt zu haben, löste ein kaltes Grausen in mir aus. Sofort stiegen Bilder von Mum in ihren schwersten Zeiten in mir auf, als sie tagelang bewegungslos auf der Couch oder in ihrem Bett gelegen hatte, dabei war ihre Krankheit überhaupt nicht mit meiner zu vergleichen. Oder?
Ehrlich gesagt hatte ich nicht den Hauch einer Ahnung, aber das war eine Sache, bei der ich hoffentlich schnell Abhilfe schaffen konnte.
Ich schob das Kissen von meinem Gesicht und setzte mich im Bett auf. Dann zog ich meinen Laptop heran, klappte ihn auf und gab in der Google-Maske Angststörung ein.
Über drei Millionen Ergebnisse wurden mir angezeigt. Ich scrollte durch die erste Seite und klickte auf den Wikipedia-Artikel.
Angststörung ist ein Sammelbegriff für mit Angst verbundene psychische Störungen, deren gemeinsames Merkmal exzessive, übertriebene Angstreaktionen beim Fehlen einer wirklichen äußeren Bedrohung sind.
Wow. Na, damit fühlte ich mich doch gleich viel besser. Nicht. Vielleicht war in diesem Fall Wikipedia nicht die Seite, der ich mich zuwenden sollte. Sie war zu trocken, ging zu wenig auf die Gefühle und Bedürfnisse ein, die dahinterstanden. Außerdem war Wikipedia doch eine Seite, bei der jeder Dinge hinzufügen oder löschen konnte, egal, ob man zu dem Thema informiert war oder nicht. Woher sollte ich also wissen, dass das, was dort stand, überhaupt zutreffend war? Ich klickte zurück auf die Google-Seite, auf der auch Ergebnisse unterschiedlicher Kliniken und Gesundheitspraxen gelistet waren. Diese konnten mir sicher besser helfen.
Zwei Stunden später musste ich einsehen, dass der Wikipedia-Artikel wohl recht gehabt hatte, auch wenn ich die Worte immer noch harsch und etwas zu deutlich fand. Angststörungen wurden vom Unterbewusstsein ausgelöst, das uns vor einer potenziell gefährlichen Situation warnen wollte, obwohl noch längst keine Gefahr bestand. Auf meinen Fall übersetzt hieß das wohl, dass es im Ozean Haie gab, die mich angreifen konnten. Was grundsätzlich erst mal nicht falsch war, immerhin war mir genau das vor etwas mehr als drei Monaten zugestoßen, trotzdem war es lächerlich, nun bei jedem Gang an den Strand eine Panikattacke zu bekommen. Ich hatte nämlich auch etwas anderes gegoogelt. Im Schnitt gab es pro Jahr zehn tödliche Haiangriffe auf Menschen und Angriffe insgesamt nur um die siebzig.
Auf der ganzen Welt.
Jedes Jahr.
Generell gab es von über fünfhundert Haiarten nur sieben, die dem Menschen überhaupt gefährlich werden konnten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich also von einem angegriffen wurde, lag bei … ach, keine Ahnung. Ich war in Mathe schon immer schlecht gewesen, ganz besonders in Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber selbst ich verstand, dass sie bei über sieben Milliarden Menschen auf der Welt sehr gering war. Vermutlich noch viel geringer, wenn man bedachte, dass es mir schon mal passiert war. Mein logischer Verstand wusste das, aber mein Unterbewusstsein schien das Memo nicht bekommen zu haben. Das schienen alle Angststörungen gemeinsam zu haben. Es ging wohl irgendwie um Kontrolle, die man in gewissen Situationen nicht hatte. Vermutlich ähnlich, wie manche Leute Flugangst hatten, obwohl Flugzeuge das sicherste Verkehrsmittel überhaupt waren. Leider war es sehr viel einfacher, Flugzeuge zu meiden als das Meer, wenn man professionelle Surferin war.
Sämtliche Seiten, die ich gelesen hatte, empfahlen bei Angststörungen und Panikattacken eine Therapie. Beim bloßen Gedanken daran zogen sich meine Eingeweide schmerzhaft zusammen, und ein kaltes Schaudern lief über meinen Rücken. Mein Blick wanderte zur Tür, hinter der ich Mum noch immer in der Küche klappern hören konnte.
Auf gar keinen Fall würde ich eine Therapie machen. Zu deutlich hatte ich noch in Erinnerung, was diese bei meiner Mum angerichtet hatte. Dem würde ich mich unter keinen Umständen aussetzen. Es musste einen anderen Weg geben, diese Angst meines Unterbewusstseins loszuwerden und wieder ins Wasser gehen zu können. Und wenn es bisher keinen gab, dann würde ich eben einen erfinden. Es musste doch möglich sein, das alles ohne eine Therapie zu bewerkstelligen, bei der man ohnehin nur mit irgendwelchen Medikamenten zugedröhnt wurde.
Ich setzte mich sofort dran. Bis spät in die Nacht las ich eine Internetseite nach der anderen, stöberte Blogs anderer Betroffener auf, machte mir Notizen und hatte irgendwann das Gefühl, das World Wide Web komplett durchgespielt zu haben. Sämtliche Seiten von Kliniken und Praxen empfahlen natürlich eine Therapie. Selbstverständlich in ihrem Haus. Klar, immerhin wollten sie auch was daran verdienen. Aber ich fand auch andere Berichte, in denen Leute es auch ohne eine Therapie geschafft hatten. Die sich selbst aus ihrem Loch gekämpft und die Angststörung selbst überwunden hatten. Frenetisch machte ich mir Stichpunkte, was sich für mich umsetzbar anhörte.
Am nächsten Tag hatte ich einen Plan zurechtgelegt, von dem ich mir Erfolg versprach.
Kapitel 4
Ethan
E