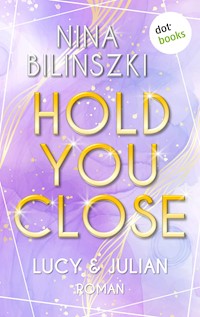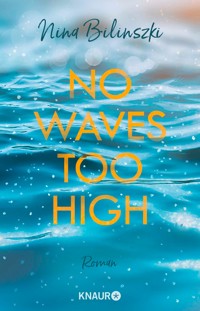Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Between Us-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band der romantischen »Between us«-Reihe von Nina Bilinszki: Du bist schön, so wie du bist! Lizzy Carmichael ist beliebt bei ihren Freunden, schlagfertig und witzig, doch schon ihr Leben lang fühlt sie sich unwohl mit ihrer Figur. Niemals glaubt sie, dass der durchtrainierte und gutaussehende Kayson Washington, aufstrebender Basketballer am LaGuardia Community College, ernsthaftes Interesse an ihr haben könnte, und sie nimmt seine Flirtversuche deshalb überhaupt nicht ernst. Erst bei ihrer gemeinsamen Arbeit im örtlichen Tierheim kommen sie sich näher, und langsam lernt Lizzy, sich Kayson zu öffnen. Trotzdem werden die Zweifel in Lizzy größer, je näher sie Kayson kommt. Zum ersten Mal wünscht sie sich, schlank zu sein, um jemand anderem zu gefallen. Doch damit bringt sie nicht nur ihre Beziehung zu Kayson, sondern auch sich selbst in große Gefahr ... Die neue New Adult-Reihe von Nina Bilinszki: »An Ocean between us« »A Fire between us«
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nina Bilinszki
A BETWEEN US
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Lizzy Carmichael ist beliebt bei ihren Freunden, schlagfertig und witzig, doch schon ihr Leben lang fühlt sie sich unwohl mit ihrer Figur. Niemals glaubt sie, dass der durchtrainierte und gutaussehende Kayson Washington, aufstrebender Basketballer am LaGuardia Community College, ernsthaftes Interesse an ihr haben könnte, und sie nimmt seine Flirtversuche deshalb überhaupt nicht ernst. Erst bei ihrer gemeinsamen Arbeit im örtlichen Tierheim kommen sie sich näher, und langsam lernt Lizzy, sich Kayson zu öffnen.
Trotzdem werden die Zweifel in Lizzy größer, je näher sie Kayson kommt. Zum ersten Mal wünscht sie sich, schlank zu sein, um jemand anderem zu gefallen. Doch damit bringt sie nicht nur ihre Beziehung zu Kayson, sondern auch sich selbst in große Gefahr ...
Inhaltsübersicht
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Danksagung
Playlist
Für Kathi,
weil Lizzy deine neue beste Freundin ist
Und für Jana,
weil Kayson (jetzt auch ganz offiziell) dir gehört
Kapitel 1
Lauter Jubel ertönte, als wir die Bühne betraten. Das Licht unzähliger Scheinwerfer blendete mich so sehr, dass ich die Zuschauer kaum erkennen konnte. Die Anfeuerungsrufe ließen aber darauf schließen, dass der Gemeinschaftsraum des Wohnheims gut gefüllt war.
Wie viele Leute genau gekommen waren, um unseren Auftritt anzusehen, konnte ich nicht sagen, aber das Wichtigste war ohnehin, dass unsere Freunde da waren.
Ein Hochgefühl breitete sich auf meinem Weg zum Mikrofon in mir aus, fast als könnte ich fliegen. Euphorie pulsierte durch meine Adern, und mein Bass war wie ein beruhigendes Gewicht, das um meine Schulter hing. Das Instrument war ein Teil von mir, der die Anwesenden zusammen mit meiner Stimme hoffentlich gleich in Ekstase versetzen würde.
Ich nahm das Mikro vom Ständer und hielt es vor meinen Mund. »Hallo, Leute, ich hoffe, ihr seid gut drauf!«
Lautes Gegröle war die Antwort.
»Habt ihr Bock, ein wenig abzurocken?« Erneut wurde es laut, diesmal schienen die Zuschauer zusätzlich mit den Füßen auf den Boden zu stampfen. Ich drehte mich zu meinen Bandkolleginnen um. Virginia, Chloe und Mia nickten mir zu, um mir zu bedeuten, dass sie bereit waren. Dann gab Chloe mit ihren Sticks den Takt vor, und wir legten mit dem ersten Lied los.
Eine halbe Stunde später kamen wir völlig verschwitzt und überglücklich an die Bar. Jede Zelle meines Körpers schien zu vibrieren, so vollgepumpt war ich mit Adrenalin. So ging es mir immer, wenn ich auf der Bühne stand. Schon als kleines Kind hatte es mich erfüllt, vor Publikum zu singen, und daran hatte sich bis heute nichts geändert.
»Ihr wart fantastisch.« Meine beste Freundin Avery flog mir regelrecht um den Hals und schien sich nicht daran zu stören, dass mir die Haare strähnig vom Schweiß um die Schultern hingen.
»Danke.« Ich drückte sie kurz und wandte mich ihrem Freund Theo zu, der bereits hinter ihr stand. »Konntest du die Musik ertragen, oder war sie zu hart für dich?« Theo war bekennender R&B-Fan und hatte sich bereits mehrfach bei uns beschwert, dass wir keine Songs aus der Richtung in unsere Setliste eingebaut hatten.
»Pff«, entgegnete er. »Für meine liebste College-Band würde ich noch viel Schlimmeres ertragen als ein bisschen Rock.«
Mein Grinsen wurde breiter. »Ach ja? Was denn so?«
Er hob eine Schulter. »Country zum Beispiel. Oder Pop.«
»Hey!« Avery schlug ihn auf den Oberarm. »Tu nicht so, als würdest du mittlerweile nicht selbst bei Taylor Swift mitsingen.«
Jetzt konnte ich das Lachen nicht mehr zurückhalten. »Das muss ich mir merken. Falls ich mal etwas brauche, was ich gegen dich verwenden kann.«
»Was willst du gegen Theo verwenden?«, fragte eine tiefe Stimme neben mir.
Mein Herz setzte für einen Schlag aus, und als ich mich umdrehte, sah ich geradewegs in ein Paar dunkle Augen. Für einen Moment vergaß ich zu atmen und verlor mich in dem Blick.
Vor mir stand Kayson, Theos bester Freund und der Mann, der mich regelmäßig aus dem Konzept brachte. So wie jetzt gerade. Dabei wusste ich nicht einmal, wieso. Wir waren zwar im selben Freundeskreis und begegneten uns auch am College regelmäßig, aber ich war mir ziemlich sicher, dass Kayson ansonsten nie mit mir sprechen würde. Wir kamen aus völlig unterschiedlichen Welten. Er, der gefeierte Basketballer, und ich, das kleine Moppelchen, das sich normalerweise lieber hinter Büchern versteckte.
Noch immer war ich unfähig, mich zu rühren, und starrte ihn weiterhin an. Seine braune Haut, die vollen, geschwungenen Lippen und die kurz geschorenen Haare, von denen ich gern gewusst hätte, wie sie sich unter meinen Fingerspitzen anfühlten. Ein verschmitzter Zug lag um seinen Mund, und seine Augen strahlten eine Vertrautheit aus, die mein Herz stolpern ließ.
Reiß dich zusammen, ermahnte ich mich und trat einen Schritt von ihm zurück. Ich räusperte mich, weil ich meiner Stimme nicht traute, ehe ich ihm antwortete. »Dass er bei Taylor Swift mittlerweile mitsingt.«
Ein kehliges Lachen brach aus Kayson heraus, das jede Zelle in mir zum Vibrieren brachte, und er drehte sich zu seinem Freund um. »Ich wusste schon immer, dass mit dir was nicht stimmt, Mann.«
»Ey, nichts gegen Taylor«, protestierte ich.
Kayson wirbelte zu mir herum. Kurz sah er verunsichert aus, dann trat wieder ein selbstbewusstes Grinsen auf sein Gesicht.
Ehe er etwas sagen konnte, legte mir jemand von hinten einen Arm um die Schultern und drückte mir einen roten Pappbecher in die Hand. »Das war geil. Einfach nur geil«, brüllte Virginia mir ins Ohr. Sie drehte mich zu sich um. Ihre Wangen waren von unserem Auftritt noch immer gerötet, und ihre Augen strahlten vor Freude. Ihre regenbogenfarbenen Haare waren ebenfalls verschwitzt, und sie hatte sie zu einem lockeren Pferdeschwanz gebunden.
»Es war der Hammer«, stimmte ich ihr zu. »Die Leute waren richtig begeistert.« Sie waren so mitgegangen, hatten jedes Lied mitgesungen und wären beim Finale beinahe auf die Bühne gestürmt, so nah waren sie an uns herangerückt.
»Es war so geil«, sagte Virginia erneut. Sie klang berauscht von dem Erlebten, und ich konnte ihr nur zustimmen. Ich fühlte mich noch immer wie auf Wolken und wünschte mir, dass es niemals aufhören würde. Aber ich wusste genau, dass der Höhenflug spätestens morgen vorbei sein würde, daher wollte ich ihn genießen, solange ich konnte.
Chloe gesellte sich zu uns. Sie strahlte ebenfalls über das ganze Gesicht, das von ihrer wilden Lockenmähne eingerahmt war. »Mädels, das war unglaublich!« Sie prostete uns zu und trank aus ihrem Pappbecher. »Ich wurde gerade schon gefragt, ob wir jetzt bei jeder Wohnheimparty auftreten.«
»Ich hätte nichts dagegen.« Ich nippte ebenfalls an meinem Getränk und verzog den Mund, als der bittere Geschmack von Bier auf meine Zunge traf.
»Ich würde viel lieber in ’ner richtigen Bar auftreten«, sagte Virginia.
»Jaaa«, sagte Chloe gedehnt, »aber solange wir nix Festes haben halt.«
Mit einem Nicken stimmte ich ihr zu. Wir hatten schon einige Bars in der Umgebung angeschrieben, die Newcomer-Bands bei sich auftreten ließen, und hatten ihnen Aufnahmen unserer Proben geschickt, doch bisher hatte sich nicht eine einzige zurückgemeldet. Vermutlich hatten sie unsere E-Mail einfach gelöscht, nachdem sie die Aufnahmen angehört hatten. Oder – was noch schlimmer war – sie hatten die Mail gelöscht, bevor sie auch nur einen Blick hineingeworfen hatten. Dabei waren wir wirklich gut und hatten eine Chance mehr als verdient.
Ich schob diese Gedanken beiseite und sah mich nach unserem vierten Bandmitglied um. »Wo ist eigentlich Mia?«
»Sie ist gleich nach dem Auftritt weg«, sagte Virginia.
Enttäuschung wollte sich in mir ausbreiten, doch ich unterdrückte sie. Ich wollte heute nicht darüber nachdenken, warum Mia so wenig Zeit abseits der Proben mit uns verbringen wollte. Stattdessen war ich fest entschlossen, mich einfach nur zu freuen und den Abend mit meinen Freunden zu genießen. Ich trank meinen Becher in einem Zug leer und stellte ihn auf einem Tisch ab, ehe ich mich zu Virginia und Chloe umdrehte.
»Dann lasst uns mal feiern.«
Zwei Tage später wollte ich gerade zur Bandprobe aufbrechen, als mein Handy klingelte. Ich kramte es aus der Tasche und ging ran, ohne auf den Anrufer zu achten.
»Elizabeth Katherine Carmichael.«
Nur mit Mühe konnte ich ein Seufzen unterdrücken. Wenn Mom meinen vollen Namen aussprach und noch dazu in diesem Tonfall, bei dem sich mir die Nackenhaare aufstellten, genauso als würde jemand mit den Fingernägeln über eine Schiefertafel kratzen, wusste ich, dass es kein gutes Gespräch werden würde.
Ich nahm einen tiefen Atemzug und klemmte mir das Handy zwischen Ohr und Schulter, um weiter meine Tasche packen zu können. »Hi, Mom.«
»Wie geht es dir? Ich bekomme gar nichts mehr von dir mit. Du meldest dich gar nicht mehr.« Bei ihrem vorwurfsvollen Ton regte sich mein schlechtes Gewissen, doch ich versuchte, es nicht an mich herankommen zu lassen.
»Sorry, aber ich hab wirklich viel zu tun.« Das war nicht mal gelogen. Vorlesungen, Bandproben und das viele Lernen sorgten dafür, dass meine Tage reichlich gefüllt waren. »Aber mir geht es gut. Das College läuft super, ich liebe meine Fächer, und mit der Band hatten wir schon zwei Auftritte, die richtig gut gelaufen sind.« Von den kleineren Patzern unseres ersten Auftritts erzählte ich lieber nichts. Beim ersten Mal hatte ich den Text einer kompletten Strophe vergessen, und Virginia hatte mit ihrer Gitarre mein Mikro umgeschmissen, als sie bei einem Refrain zu mir angerockt kam. Es war mir unangenehm gewesen, weil es unsere Unprofessionalität deutlich aufgezeigt hatte, aber die Leute aus dem Wohnheim hatten es mit Humor genommen. Oder vielleicht waren sie auch so betrunken gewesen, dass sie es nicht einmal bemerkt hatten. Wer weiß?
»Das klingt ganz wundervoll. Ich wusste von Anfang an, dass ich mir um deine Noten keine Sorgen machen muss.« Stolz schwang in ihrer Stimme mit, und ihr Lob ließ mich lächeln. Ich war vernarrt in Bücher, und in meinem Fall schloss das auch Studienliteratur mit ein – zumindest bei Fächern, die mich interessierten.
»Aber es ist nicht nur die Uni«, beharrte ich. »Ich fühle mich wohl hier, so als wäre ich endlich angekommen.« Es war überhaupt kein Vergleich zu dem Spießrutenlauf, den ich auf der Highschool erlebt hatte. Beim bloßen Gedanken an die Zeit musste ich ein kaltes Schaudern unterdrücken.
»Das freut mich für dich.« Mom legte eine Pause ein, ganz kurz nur, aber ich konnte selbst durch das Handy spüren, wie ihre Stimmung umschwang. »Dein Vater plant, das Restaurant zu renovieren, um neue Gäste zu gewinnen.«
Ich unterdrückte ein Seufzen. »Ich dachte, die Idee wäre durch.« Meine Eltern führten ein Restaurant in meiner Heimatstand Trenton, das für die Größe unserer Stadt gut lief. Trenton zählte nur knapp sechstausend Einwohner, dafür war das Restaurant jeden Tag gut besucht. Doch alle zwei Jahre setzte Dad sich in den Kopf, neue Kundschaft gewinnen zu wollen, und ließ sich immer irgendwelche Aktionen einfallen. Ich konnte gar nicht sagen, wie oft ich mit meiner Schwester Lana und unserem kleinen Bruder Tyler durch Trenton gezogen war, um Flyer oder Flugblätter zu verteilen.
»Du weißt, wie er ist. Er erhofft sich dadurch neue Kundschaft, ohne die alte zu verlieren.« Moms Seufzen machte deutlich, dass sie nicht begeistert davon war.
»Habt ihr denn genügend Geld dafür?« Auch wenn das Restaurant gut lief, waren wir weit davon entfernt, reich zu sein. Zwar schafften meine Eltern es, meine Studiengebühren zu stemmen, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen, aber würde das auch bei diesen zusätzlichen Ausgaben so bleiben?
»Das schaffen wir schon, mach dir keine Sorgen«, versuchte Mom, mich zu beruhigen. »Erzähl mir lieber mehr von deiner Band. Was für Sachen spielt ihr so?«
Meine Befürchtungen wurden dadurch nicht weniger, trotzdem nahm ich den Themenwechsel dankbar an. »Wir sind vier Mädels in der Band. Virginia spielt Gitarre, Chloe sitzt am Schlagzeug, Mia spielt Keyboard, und ich singe und spiele Bass. Wir haben überwiegend rockige Lieder auf der Playlist, seit Neuestem auch einige von reinen Frauenbands mit feministischen Texten.«
»Oh.« Moms Missmut schwang in diesem einen Wort deutlich mit. »Also Texte gegen Männer?«
»Mom!« Ich konnte mein Augenrollen nicht verhindern, zum Glück konnte sie es nicht sehen. »Feminismus hat nichts mit Männerhass zu tun. Es geht darum, dass wir Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen wollen, ohne uns vorschreiben zu lassen, wie wir zu sein oder was wir zu tun haben.«
Ein Seufzen drang an mein Ohr. »Ich verstehe diesen Wunsch nach Selbstbestimmung einfach nicht. Für mich war es damals eine Selbstverständlichkeit, deinem Vater nach Trenton zu folgen, und ich habe diesen Schritt bis heute nicht bereut.«
Ich kniff mir in die Nasenwurzel und zählte in Gedanken bis zehn, ehe ich antwortete. »Aber auch das ist Selbstbestimmung. Wenn du es aus deinem freien Willen getan hast, weil du es wolltest und nicht weil dich jemand dazu drängen musste, ist es Selbstbestimmung.«
Nachdenkliches Schweigen folgte auf meine Rede. Ich biss mir auf die Innenseite der Wange, um die Stille nicht zu durchbrechen und damit dem Gefühl nachzugeben, mich weiter rechtfertigen zu müssen.
»Ich denke, ich muss das nicht verstehen«, sagte Mom schließlich, und ich spürte Enttäuschung in mir aufwallen. Ich wünschte mir so sehr, dass Mom und ich bei diesem Thema mehr auf einer Wellenlänge wären, aber ich konnte ihr Verständnis auch nicht erzwingen.
»Musst du nicht, solange du es akzeptierst.« Ich wechselte das Handy zum anderen Ohr, um die rechte Hand frei zu haben. »Mom, ich muss jetzt los zur Bandprobe. Wir sprechen bald wieder, okay?«
»Na gut, viel Spaß und pass auf dein Gewicht auf.«
Der Boden unter mir tat sich auf, und ich fiel. Ich stürzte in einen bodenlosen Abgrund, der kein Ende zu nehmen schien. Das Rauschen in meinen Ohren verstärkte diesen Eindruck, und mein Herz hämmerte schmerzhaft in meiner Brust. Ich hätte mit diesem Satz rechnen müssen. Mom sprach mich jedes Mal darauf an. Sie meinte es nicht einmal böse, aber es traf mich jedes Mal wie ein Faustschlag.
Weil du selbst weißt, dass du dick bist, und es gern ändern würdest.
Ich blieb stehen und kniff mir erneut in die Nasenwurzel. Ich hasste die kleine gemeine Stimme, die mir diese Sachen einflüsterte. Vor allem weil sie vollkommen recht hatte. Ich war zu dick, das war nicht zu übersehen, und in der Highschool war ich deswegen viel gemobbt worden. Doch hier in New York war es anders, keiner meiner Freunde schien sich an meinem Gewicht zu stören oder gab mir das Gefühl, anders zu sein, sodass ich die Stimme an den meisten Tagen ausblenden konnte.
Der Anruf meiner Mom hatte sie mit voller Macht zurückgeholt, aber ich konnte ihr jetzt keinen Raum geben. Ich atmete tief ein und aus, bis sich das beklemmende Gefühl in meinem Brustkorb löste, dann betrat ich das Gebäude, in dem unser Proberaum war.
Aus dem Raum, den wir von der musikwissenschaftlichen Fakultät für unsere Proben zur Verfügung gestellt bekommen hatten, waren bereits die ersten Klänge einer Gitarre zu hören. Der sanfte Beginn einer Melodie, die mir mittlerweile sehr vertraut geworden war und mich schmunzeln ließ. Never There von Sum41 war seit dem Herbst Virginias Lieblingslied, und wann immer sie in Pausen wie gedankenverloren an den Saiten ihrer Gitarre herumzupfte, kam dieser Song dabei heraus.
Sobald ich eingetreten war, hielt Virginia in der Bewegung inne, und die Melodie verstummte. Sie saß auf einem Stuhl neben Chloes Schlagzeug, die Gitarre auf dem Schoß, und ihre regenbogenfarbenen Haare fielen ihr wie ein Schleier über die Schultern.
»Hey, Virginia. Sind die anderen noch nicht da?«, wollte ich wissen und ließ meine Handtasche und den Gitarrenkoffer neben ihrem Stuhl zu Boden gleiten.
Sie schob sich eine blau gefärbte Strähne hinter das Ohr, während sie den Kopf schüttelte. »Ich dachte schon, ich hätte den Termin falsch eingetragen. Keine Ahnung, wo die beiden stecken.«
»Nein, du bist richtig«, sagte ich und zog mein Handy aus meiner Hosentasche hervor. Chloe und Mia hatten sich nicht gemeldet, um abzusagen oder ihre Verspätung anzukündigen. »Ich wäre eigentlich auch schon eher da gewesen, wenn meine Mom mich nicht angerufen und aufgehalten hätte.«
Überrascht blickte Virginia auf. »Deinem Tonfall nach zu urteilen, war es kein gutes Gespräch.«
Ich zuckte mit den Achseln. »Es ist nicht so, als hätten wir ein schlechtes Verhältnis«, sagte ich, wobei Moms Verabschiedung in meinem Kopf nachhallte.
Virginias Augenbrauen hoben sich. »Aber?«
Hilflos sah ich zur Decke. »Es ist …« Ich wusste nicht, wie ich den Satz zu Ende führen sollte.
»Kompliziert?«, half Virginia mir auf die Sprünge.
»Ja … nein …« Ich raufte mir die Haare. »Können wir über was anderes sprechen?« Die Bandprobe – singen generell – war immer so etwas wie mein sicherer Hafen gewesen. Sobald ich ein Mikro in der Hand hielt und die ersten Töne eines Songs erklangen, konnte ich alles andere vergessen. Dann fühlte ich mich rundum wohl, und nur noch meine Atmung, das Zusammenspiel meiner Stimmbänder und die Laute, die über meine Lippen drangen, zählten. Beim Singen fühlte ich mich frei, ich konnte all meine Gefühle – die guten wie die schlechten – in meine Stimme legen und damit die Zuhörer begeistern. Ich konnte es direkt in ihren Gesichtern sehen, wie sie auf meinen Gesang reagierten, was mir ein unglaubliches Hochgefühl bescherte.
Die Tür zum Probenraum wurde mit Schwung aufgestoßen, und die plötzliche Bewegung holte mich aus meinen Gedanken. Chloe rauschte herein. Ihre blonde Lockenmähne sah noch wilder aus als normalerweise. »Leute, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist.« Sie stemmte die Hände in die Hüften und blickte uns erwartungsvoll an.
»Keine Ahnung«, entgegnete Virginia. »Deine Bewerbung zur Präsidentin der Vereinigten Staaten wurde angenommen?«
Chloe warf den Kopf in den Nacken und begann schallend zu lachen. Ich hatte keine Ahnung, wovon die beiden sprachen, also handelte es sich vermutlich um einen Insider.
»Nein, daran arbeite ich noch.« Chloe rieb sich die Hände, das Grinsen auf ihrem Gesicht wurde breiter. »Ich hab endlich eine Rückmeldung von einer der Bars, an die wir unsere Demo-Tapes geschickt haben. Der Besitzer hat mich gerade angerufen. Er ist total begeistert von uns und wir dürfen dort auftreten. In zwei Wochen schon.«
Virginia stieß einen begeisterten Schrei aus und flog Chloe regelrecht in die Arme, während mein Gehirn diese Informationen zuerst verarbeiten musste. Wir durften in einer Bar auftreten. Vor fremdem Publikum. Nicht wie zuletzt, als wir nur auf einer Wohnheimparty gespielt hatten, wo uns jeder kannte. Eine Bar war ein ganz anderes Kaliber. Dort würden wir vor Leuten spielen, die uns noch nie gesehen hatten. Menschen, die es gewohnt waren, regelmäßig gute Bands zu sehen. Eine Mischung aus Nervosität und Freude breitete sich in mir aus, und endlich kam Bewegung in mich.
Ich stürmte auf Virginia und Chloe zu, schloss die beiden in meine Arme und konnte ein fröhliches Quietschen nicht mehr unterdrücken. Das war eine unglaublich tolle Chance für uns, und je länger ich darüber nachdachte, desto mehr Glücksgefühle durchströmten mich.
»Was ist denn hier los?«, erklang eine weitere Stimme, die uns erstarren ließ. Langsam lösten wir uns voneinander und wandten uns Mia, unserem vierten Bandmitglied, zu, die soeben zur Tür hereinkam. Sie betrachtete uns skeptisch, reserviert, wie es ganz oft ihre Art war.
Virginia räusperte sich. »Wir haben einen Auftritt in einer Bar ergattert, in der regelmäßig Newcomer-Bands spielen dürfen.«
Kurzzeitig schien so etwas wie Freude in Mias Augen aufzuflackern, aber es war so schnell wieder verschwunden, dass ich glaubte, es mir nur eingebildet zu haben. »Cool«, sagte sie mit einem Nicken und begab sich zu ihrem Keyboard.
Ich versuchte, meine Enttäuschung zu verbergen. Mittlerweile wusste ich, dass Mia wenig von sich preisgab und ihre Emotionen nicht zeigen konnte – oder wollte. Trotzdem hatte ich gehofft, dass eine Neuigkeit wie diese sie etwas aus ihrer Reserve locken würde. Ich wünschte mir einfach, dass sie sich darüber genauso freute wie wir, und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte, ihre Stimmung nicht deuten zu können.
»Fangen wir dann an, oder was?«, fragte Chloe.
Als ich aufsah, erkannte ich, dass die anderen bereits an ihren Instrumenten standen. Ich riss mich aus meiner Starre, holte meine Bassgitarre aus dem Koffer und ging zu meinem Mikro. »Womit wollen wir beginnen?«
In den nächsten zwei Stunden spielten wir nicht nur alle Songs durch, die wir bisher im Repertoire hatten, sondern überlegten zudem, was auf die Setlist für unseren Auftritt kommen sollte. Wir konnten nicht alle Lieder spielen, die wir schon eingeprobt hatten und gut beherrschten, da der Gig nur eine halbe Stunde dauern sollte. Also entschieden wir am Ende, dass jeder sein Lieblingslied wählen durfte und wir zudem einige Songs spielen würden, die bei den vorherigen Auftritten gut angekommen waren. So hatten wir eine bunte Mischung, bei der hoffentlich für jeden etwas dabei war.
»Wie kann man eigentlich so viel lesen?«
Der Klang von Averys Stimme erschreckte mich so sehr, dass ich mein Buch beinahe fallen ließ. Sie stand mit verschränkten Armen in der Tür zu unserem Wohnheimzimmer, ihren Rucksack über eine Schulter geschlungen. Jetzt fielen mir auch die Geräusche des Wohnheims auf, die durch die geöffnete Tür in unser Zimmer drangen. Irgendwo wurde ein Lied von Beyoncé gespielt, in einem der Nebenzimmer wurde gestritten, und Mrs. Bowman, unsere Wohnheimleitung, maßregelte mal wieder eine Bewohnerin.
»Ich habe dich gar nicht kommen gehört«, sagte ich. Es war das Erste, was mir einfiel.
Mit einem Grinsen ließ Avery die Tür hinter sich ins Schloss fallen. »Das habe ich gemerkt, ich bin schon zwei Minuten hier, aber du warst so in dein Buch versunken, du hättest es vermutlich nicht mal mitbekommen, wenn das Wohnheim in Flammen aufgegangen wäre.«
Womit sie vermutlich recht hatte. »Möglich«, entgegnete ich lachend. »Es ist halt spannend. Aber wenigstens habe ich mitbekommen, dass du mit mir gesprochen hast.«
Avery ließ sich neben mich aufs Bett plumpsen und zog das Buch aus meiner Hand. »Zum Glück, sonst könntest du nicht länger leugnen, dass ich hinter den Büchern nur den zweiten Platz in deinem Leben einnehme.«
Ein Schnauben entwich mir. »Solange du bei Theo nicht nur den zweiten Platz einnimmst, solltest du das verkraften können.«
»Pff, als würde ich je gegen sein Schwimmen ankommen können.«
Als Antwort zog ich lediglich die Augenbrauen hoch, immerhin hatte Theo erst vorgestern sein Training sausen lassen, um stattdessen mit Avery ins Theater zu gehen – die gemeinsame Leidenschaft der beiden.
»Okay, okay«, lenkte Avery ein, und ein verliebter Ausdruck trat auf ihr Gesicht. »Ich glaube schon, dass Theo mich wählen würde, müsste er sich je zwischen dem Schwimmen und mir entscheiden. Nicht, dass ich das jemals von ihm verlangen würde.«
Ich griff nach ihrer Hand und drückte sie. »Das weiß ich doch.« Avery liebte das Schwimmen mittlerweile fast so sehr wie ihr Freund und begleitete ihn zu den meisten seiner morgendlichen Trainingseinheiten. Langsam gewöhnte ich mich daran, dass ihr Wecker regelmäßig um sechs Uhr früh klingelte, und schlief wieder ein, sobald sie das Zimmer verlassen hatte.
»Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wie kann man so viel lesen?«, fragte Avery erneut. Sie drehte noch immer Das Institut von Stephen King in ihrer Hand, als hätte sie nie zuvor ein Buch von Nahem gesehen.
»Das ist ganz einfach. Man nimmt ein Buch in die Hand, schlägt es auf und beginnt mit dem ersten Wort.« Ich streckte ihr die Zunge raus. Avery hatte mit Lesen noch nie viel anfangen können. Zu ihrer Verteidgung sei zu sagen, dass sie früher neben dem vielen Ballettunterricht auch gar keine Zeit dafür gehabt hatte.
»Dass dir dabei nicht langweilig wird.« Entrüstet schüttelte Avery den Kopf, was mich zum Lachen brachte.
»Ganz im Gegenteil, beim Lesen kann ich alles um mich herum vergessen, wenn das Buch fesselnd geschrieben ist.«
Sie stimmte in mein Lachen mit ein. »Was du gerade eindrucksvoll bewiesen hast.«
»Als würde es dir bei einem spannenden Hörbuch anders gehen.« Ich robbte zur Bettkante, um aufzustehen. »Ich muss jetzt auch los.«
Erstaunt sah Avery zu mir auf. »Los? Wo willst du denn hin?«
»Zum Tierheim. Ich hatte dir doch gesagt, dass ich mich dort als Freiwillige gemeldet habe. Heute ist sozusagen meine erste Schicht.« Die Flyer des Tierheims hingen bereits seit drei Wochen überall am College herum. Es wurden Helfer gesucht, die mit den Hunden Gassi gingen und auch den anderen Tieren ein wenig Zuneigung und Streicheleinheiten schenkten. Zuerst hatte ich versucht, sie zu ignorieren, weil ich eigentlich schon genug zu tun hatte, doch schließlich hatte meine Tierliebe gesiegt. Außerdem vermisste ich meinen Kater Spooky, der zu Hause bei meinen Eltern geblieben war.
»Dass du dir das freiwillig antust.« Avery verzog das Gesicht. »Wahrscheinlich darfst du dort nur die Zwinger säubern und irgendwelche Drecksarbeit erledigen.«
Ich streckte ihr die Zunge raus. »Sei nicht immer so pessimistisch. Ich hab extra nachgefragt, wir sollen wirklich nur mit den Tieren spielen oder kuscheln. Mal ganz davon abgesehen, fände ich die Drecksarbeit nicht mal schlimm.« Ich hatte in meinem Leben schon so oft das Katzenklo von Spooky gesäubert und seine Kotze vom Boden gewischt, dass mich nichts mehr erschüttern konnte.
Avery lehnte sich auf meinem Bett zurück, das Buch vor den Bauch gedrückt und ein zufriedenes Grinsen auf den Lippen. »Abwarten, meine Liebe, abwarten. Ich werde dich an deine Worte erinnern, wenn du dich das erste Mal über die Arbeit im Tierheim beschwerst. Und wir wissen beide, dass dieser Tag kommen wird.«
Ich schüttelte lachend den Kopf, schnappte meine Tasche und verließ das Zimmer. Auf dem Weg nach draußen nahm ich mir fest vor, mich niemals negativ vor Avery über das Tierheim zu äußern. Egal, was ich dort erleben würde, Avery sollte nie etwas Schlechtes darüber erfahren.
Das Tierheim lag nur knapp zehn Minuten Fußweg vom LaGuardia Community College entfernt. Es war eine recht große Anlage, die nicht nur die üblichen Hunde und Katzen aufnahm, sondern auch Hamster, Hasen und sogar einige Vögel beherbergte. Von außen war es ein unscheinbarer Plattenbau, doch sobald man die Tür aufzog, betrat man ein wunderbares Chaos. Der unvergleichliche Geruch von Tieren schlug mir entgegen, vermischt mit dem Bellen von Hunden und Kreischen von Vögeln. Ohne dass ich es beabsichtigte, schlich sich ein Lächeln auf meine Lippen.
Eine blonde junge Frau in Latzhose trat mir entgegen. »Hey, kann ich dir helfen?« Sie lächelte mich freundlich an und hielt eine Katze auf dem Arm, die sich aus ihrem Griff zu winden versuchte.
»Hi, ich bin Lizzy, ich hatte mich als Freiwillige gemeldet«, stellte ich mich vor.
Umständlich nahm sie eine Hand von der Katze und hielt sie mir hin. »Ich bin Sarah. Schön, dass du da bist, Lizzy. Die anderen sind schon hinten, ich bringe dich zu ihnen.«
Ich folgte Sarah in einen Gang, der rechts und links mit Zwingern gesäumt war. Jeder beherbergte einen oder mehrere Hunde. Einige kamen neugierig zur Tür gelaufen, um die Neuankömmlinge zu betrachten, einige lagen nur in ihrem Körbchen und beachteten uns gar nicht. Wieder andere bellten oder knurrten uns an – ob aus Freude oder Angst, konnte ich nicht sagen.
Am Ende des Gangs lag eine schwere Eisentür, die Sarah ächzend aufschob. »Hier entlang.« Mit einem Nicken bedeutete sie mir, dass ich eintreten sollte.
Ich betrat den kahlen Raum, in dem sich bereits fünf andere Personen befanden, drei Frauen und zwei Männer. Im ersten Moment war kein bekanntes Gesicht darunter, doch als sich der ganz linke Mann, dessen breite Schultern mir von der ersten Sekunde an sehr vertraut vorkamen, zu mir umdrehte, machte mein Herz einen kleinen Hüpfer. Seine braune Haut bildete einen starken Kontrast zu dem beigefarbenen T-Shirt, das er trug, die schwarzen Haare waren wie immer kurz geschoren, und in seinen dunklen Augen könnte ich versinken. Doch am schlimmsten war es, wenn er lächelte, denn sein Lächeln könnte selbst die kalten Herzen von bösen Schwiegermüttern auftauen lassen.
Was zur Hölle machte Kayson Washington hier?
Kapitel 2
Lizzy Carmichael starrte mich an, als wäre ich die letzte Person, die sie erwartet hätte. Ihre grünen Augen waren geweitet, ihr Blick huschte über mein Gesicht, als würde sie jedes Detail darin in sich aufnehmen wollen. Aufmerksam, aber auch vorsichtig, wie es oft ihre Art war – zumindest, wenn es mich betraf. Mit ihrer besten Freundin Avery konnte sie ausgelassen sein, sogar mit Theo schaffte sie das, während ich immer das Gefühl hatte, dass eine unsichtbare Mauer zwischen uns lag, die ich nicht überwinden konnte.
»Kayson, was machst du denn hier?«, platzte sie heraus, und ich musste mir ein Lachen verkneifen. War das nicht offensichtlich?
»Vermutlich dasselbe wie du«, entgegnete ich schmunzelnd. »Ich hab mich als Freiwilliger gemeldet.« Als ich die Flyer gesehen hatte, musste ich das Tierheim sofort anrufen und meine Hilfe anbieten. In dem Trailerpark, in dem ich aufgewachsen war, hatte es viele streunende Hunde gegeben, die total verwahrlost gewesen waren, weil sich niemand für sie interessiert hatte. Den Tieren fehlte es nicht nur an Nahrung, sondern vor allem an Zuneigung, und ich konnte mir vorstellen, dass es den Tierheimbewohnern nicht anders ging, was Letzteres betraf. Es waren einfach zu viele Tiere, als dass die paar festangestellten Mitarbeiter sich ausgiebig genug um jedes kümmern konnten.
»Oh, ich wusste gar nicht, dass du Tiere magst«, sagte Lizzy leise.
Meine Lippen verzogen sich zu einem Grinsen. »Woher auch, wir haben nie drüber gesprochen.« Was nicht an mir lag. Lizzy faszinierte mich mit ihrer fröhlichen Art, in der gleichzeitig so viel Nachdenklichkeit und Ernsthaftigkeit lagen. Ich würde sie gern näher kennenlernen, hatte sogar des Öfteren versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen, doch obwohl sie nie abweisend zu mir war, hatte sie jeden meiner Flirtversuche im Keim erstickt. Dabei erwischte ich sie manchmal dabei, wie sie mir verstohlene Blicke zuwarf. Blicke, die mir unter die Haut gingen und mir doch wieder Hoffnungen machten, dass wir uns näherkommen konnten. Nur um kurz darauf wieder zerstört zu werden, weil Lizzy nicht mehr als ein paar Worte mit mir wechselte.
Ich brauchte eindeutig einen Realitätscheck. Vermutlich war sie schlicht nicht an mir interessiert, und ich bildete mir das alles ein.
Lizzy sah mich weiterhin unverhohlen an, und ich konnte nicht bestreiten, dass mir ihre Aufmerksamkeit gefiel. In ihrem Blick lag etwas, das mich gefangen hielt. Etwas, das ich nicht benennen konnte, aber das dennoch einen Reiz auf mich ausübte, dem ich mich nicht entziehen konnte.
»Es müssten jetzt alle da sein, lasst uns anfangen«, durchdrang eine Stimme die Blase, in der ich mit Lizzy gefangen war.
Lizzy wandte sich ab, der Bann zwischen uns war gebrochen. Ich schluckte meine Enttäuschung hinunter und drehte mich ebenfalls zu dem Neuankömmling um. Sarah, die mich beim Eintreffen im Tierheim bereits begrüßt hatte, stand vor uns. Die Katze, die sie zuvor noch auf dem Arm gehalten hatte, musste sie zurück in ihren Käfig gebracht haben, denn stattdessen hielt sie einen Stapel Zettel in den Händen.
»Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid«, begrüßte sie uns, als sie unser aller Aufmerksamkeit hatte. »Für uns als Non-Profit-Organisation ist es immer schwierig, genügend Personal zu finden, das sich um die Tiere kümmert. Über Spenden können wir zwar das Futter und die medizinische Pflege gewährleisten, und unsere Mitarbeiter sind stets bemüht, sich umfassend um sie zu kümmern, aber wir sind einfach zu wenige, um alle Aufgaben zu übernehmen.«
Sarah blickte in die Runde und sah jedem in die Augen. Sie strich sich eine kurze blonde Haarsträhne hinters Ohr und fuhr fort. »Da kommt ihr ins Spiel. Keine Sorge, wir wollen nicht von euch, dass ihr Zwinger säubert oder so. Uns geht es nur darum, dass ihr mit den Hunden Gassi geht, mit den Katzen spielt und ihnen allgemein ein wenig Liebe gebt, wovon sie hier leider zu wenig bekommen. Einige unserer Tiere haben ein schwieriges Sozialverhalten, weil sie von ihren vorigen Besitzern nicht gut behandelt wurden, aber die würden wir euch erst vorstellen, wenn ihr mit den Abläufen vertraut seid und euch sicher genug fühlt, damit umgehen zu können. Die meisten Tiere sind Streuner, die auf der Straße aufgewachsen und für jegliche Aufmerksamkeit dankbar sind. Noch irgendwelche Fragen?«
Die meisten schüttelten den Kopf, nur eine Frau mit roten Haaren hob zaghaft ihre Hand. »Ich habe eine Allergie gegen Katzenhaare und würde daher gern nur mit Hunden zu tun haben. Ist das okay?«
»Selbstverständlich.« Sarah nickte. »Das gilt im Übrigen für euch alle. Ihr müsst nichts tun, womit ihr euch nicht wohl fühlt. Ihr mögt Katzen oder Hunde nicht besonders oder kommt mit der Persönlichkeit eines Tieres nicht klar? Kein Problem, dann finden wir eine Alternative. Wir wollen, dass ihr eure Arbeit hier gerne macht, aber auch, dass sich die Tiere bei euch gut aufgehoben fühlen. Kommt mit.«
Wir folgten ihr aus dem Raum und zurück zu den Zwingern, wo bereits eine weitere Tierheimangestellte auf uns wartete. Ihre hellbraunen Haare waren zu einem Dutt gebunden, und sie trug einen Overall, an dem schon eindeutige Dreckspuren zu sehen waren.
»Ich glaub, ich habe die falschen Klamotten an«, flüsterte Lizzy mir zu und sah an sich herab auf die Jeans und den hellen, weiten Pulli, den sie trug.
Mein Blick wanderte über ihren Körper. »Der Pulli war vielleicht nicht deine schlauste Wahl«, stimmte ich ihr zu. Ob sie noch nie mit Tieren zu tun gehabt hatte? Aber warum sollte sie dann überhaupt hergekommen sein?
Lizzy seufzte theatralisch. »Dabei sollte ich es eigentlich besser wissen, immerhin habe ich selbst einen Kater.«
Interessiert wandte ich mich ihr zu. Wie immer saugte ich jedes neue Detail über Lizzy wie ein Schwamm in mich auf. »Und der hat dich nie dreckig gemacht?«
Lizzy hielt sich die Hand vor den Mund, um ihr Lachen zu unterdrücken. »Natürlich nicht, ich habe den saubersten Hauskater der Welt.« Der Sarkasmus war deutlich aus ihrer Stimme herauszuhören.
»Immerhin wälzen sich Katzen nicht in Schlammlöchern«, entgegnete ich. Die Hunde, die mit uns im Trailerpark gelebt hatten, hatten das mit Vorliebe getan. Und wenn es geregnet hatte, hatte es viele Schlammlöcher gegeben.
Lizzys Grinsen wurde breiter und ließ mein Herz stolpern. »Spooky hat Angst davor, nach draußen zu gehen. Er hält sich nur in der Wohnung oder höchstens mal auf der Terrasse auf.«
Ich musste lachen. Ich hatte noch nie davon gehört, dass es so etwas gab. »Du hast einen Kater, der Angst hat, nach draußen zu gehen? Das ist …« Mir fiel kein treffendes Wort ein.
»Total absurd?«, half Lizzy mir auf die Sprünge, und ich nickte. »Glaub mir, ich weiß das selber und habe anfangs einiges versucht, um ihn wenigstens mal in den Garten zu bekommen, aber keine Chance.«
»Das war auch keine Kritik an dir«, sagte ich schnell. »Ich …«
Sarah räusperte sich, was mich verstummen ließ. Ich hatte völlig vergessen, dass wir uns im Tierheim befanden, so sehr war ich in das Gespräch mit Lizzy vertieft gewesen.
»Das ist meine Kollegin Marina«, stellte Sarah die Dunkelhaarige vor. »Sie ist unsere Katzenexpertin und hilft mir heute. Ich würde vorschlagen, dass ihr euch in zwei Gruppen aufteilt, eine kommt mit mir zu den Hunden, die andere geht mit Marina zu den Katzen.«
Sofort lösten sich zwei Personen und gingen zu Sarah. Die Frau mit der Katzenallergie und ein Mann mit langen aschblonden Haaren, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren.
Ich wandte mich Lizzy zu. »Hunde oder Katzen?«
»Generell beides, aber ich möchte heute mit Katzen beginnen, weil ich Spooky doch sehr vermisse.«
Ich nickte und folgte Lizzy zu Marina. Eigentlich war ich eher der Hunde-Typ, aber noch lieber wollte ich Zeit mit Lizzy verbringen, sodass ich es gerne in Kauf nahm, mich einen Nachmittag mit Katzen zu beschäftigen.
Marina führte uns zurück zu den Käfigen. »Ich würde vorschlagen, dass ihr euch für den Anfang jeder eine Katze aussucht.« Während ich die erstbeste Katze wählte, die zu mir gelaufen kam, sobald ich an ihrem Käfig vorbeilief, nahm Lizzy sich deutlich mehr Zeit. Sie ging vor jedem Käfig in die Hocke, redete leise mit den Tieren und versuchte, sie dazu zu animieren, zu ihr zu kommen.
Es war faszinierend, sie zu beobachten. Lizzy ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und zwischendurch, wenn sie zum nächsten Käfig ging, warf sie mir aus den Augenwinkeln einen Blick zu, der mein Herz stolpern ließ.
Überraschenderweise wählte sie am Ende genau die Katze, die sich bei ihren Annäherungsversuchen nicht einmal zu ihr umgedreht hatte.
»Eine interessante Wahl«, kommentierte Marina, als sie den Käfig öffnete und das Kätzchen hervorholte. Zum Vorschein kam ein zerrupftes Etwas mit dunklem Fell, das einige kahle Stellen aufwies, an denen pinkfarbene Haut durchschimmerte.
Vorsichtig nahm Lizzy das kleine Bündel entgegen und drückte es gegen ihre Brust. »Ich könnte mir vorstellen, dass er von anderen oft übersehen wird. Während alle anderen Katzen sich zumindest neugierig zu mir umgedreht haben, hat er sich gar nicht gerührt, als hätte er von Anfang an gewusst, dass ihn eh niemand nimmt.« Lizzy kraulte das kleine Kerlchen hinter den Ohren, woraufhin es aus großen Augen zu ihr aufsah und zu schnurren begann.
O Gott, ich war so was von verloren. Ich hatte vorher schon auf Lizzy gestanden, aber dass sie ebenfalls im Tierheim aushalf und sich dabei ausgerechnet um die Tiere kümmern wollte, die sonst übersehen wurden, machte es noch viel schlimmer. Ich musste mich abwenden, um nicht der Versuchung zu erliegen, sie in den Arm zu nehmen.
»Das war sehr aufmerksam von dir. Mephisto bekommt tatsächlich kaum Beachtung, daher finde ich es toll, dass du dich für ihn entschieden hast.« Marina bedachte Lizzy mit einem Lächeln und wandte sich mir zu. »Felix ist auch eine hervorragende Wahl. Er ist ein kleiner Wirbelwind und scheint nie genug Bewegung zu kriegen. Kommt mit, wir gehen raus.«
Marina führte uns auf eine abgezäunte Grünfläche, die hinter dem Tierheim lag. Jede erdenkliche Art von Katzenspielzeug lag auf der Wiese verteilt, und sobald ich Felix auf dem Boden absetzte, verstand ich, was Marina mit »Wirbelwind« gemeint hatte. Der kleine Racker schoss sofort auf einen Pappkarton zu und attackierte ihn regelrecht. Er schlug seine Krallen in die Pappe und knabberte an einer Ecke herum. Doch schon bald wurde es ihm wohl zu langweilig, dass der Karton nicht reagierte, und er ließ davon ab. Stattdessen fiel er über einen Ball her, an dem bunte Federn befestigt waren.
Ein helles Lachen neben mir lenkte meine Aufmerksamkeit von Felix ab. Lizzy war neben mich getreten, Mephisto immer noch auf dem Arm. »Oh, wow, der geht ja ab wie ein Duracell-Häschen.«
»Passender Vergleich, nur dass man ihn nicht aufdrehen, sondern stattdessen mit Leckerchen füttern muss.« Ich deutete auf Mephisto. »Willst du ihn nicht runterlassen?«
Ihr Lächeln bekam einen liebevollen Zug. »Das habe ich versucht, aber er hat sich so sehr an mir festgekrallt und zu zittern begonnen, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe.«
Vorsichtig näherte ich mich den beiden und streckte meine Hand in Mephistos Richtung aus. Zuerst wich er mit dem Kopf vor mir zurück, doch nachdem ich mich einige Sekunden völlig still verhalten hatte, begann er neugierig an meinen Fingern zu schnuppern. Als er dann auch noch sein Köpfchen an meiner Hand rieb, wusste ich, dass ich ihn streicheln konnte. »Und was machst du, wenn er dich auch nachher nicht loslassen möchte, wenn wir zurück ins Wohnheim gehen?«
Lizzy stieß ein verzweifeltes Seufzen aus. »Erinner mich nicht daran. Am liebsten würde ich ihn sofort mitnehmen, aber im Wohnheim sind keine Tiere erlaubt.« Sie drückte das kleine Fellknäuel ein wenig enger an ihre Brust, als könnte sie den drohenden Abschied damit abwenden.
»Ich bin mir sicher, du wärst nicht die Erste, die gegen diese Regel verstößt«, entgegnete ich, woraufhin Lizzy mich mit dem Ellbogen knuffte.
»Bring mich nicht auf dumme Ideen.«
Ehe ich antworten konnte, verspürte ich scharfe Krallen, die sich in mein Schienbein gruben. Einen Fluch unterdrückend, blickte ich nach unten und entdeckte Felix, der an meiner Hose hochzukrabbeln versuchte. Ich beugte mich zu ihm hinunter, zog sanft seine Krallen aus meiner Jeans und nahm ihn auf den Arm.
»Scheint so, als wäre ich nicht die Einzige mit einem neuen Anhang.« Lizzy grinste mich frech an, ihre grünen Augen funkelten herausfordernd, und ein wohliger Schauer jagte über meinen Rücken. Für einen Moment konnte ich sie nur stumm anstarren, gefangen von ihrer Ausstrahlung.
»Eigentlich bin ich eher der Hundetyp«, sagte ich möglichst neutral, um meinen inneren Aufruhr zu überspielen.
»Ach, echt?« Überrascht sah Lizzy zu mir auf. »Hast du selber einen?«
»Nein, ich hatte nie ein Haustier, aber ich habe oft mit den Hunden aus der Nachbarschaft gespielt.« Warum ich ihr nicht die ganze Wahrheit sagte, wusste ich selbst nicht. Normalerweise war mir meine Herkunft nicht unangenehm, aber aus irgendeinem Grund wollte ich das Gespräch nicht in diese Richtung lenken.
»Dann können wir ja beim nächsten Mal eine Runde mit den Hunden drehen«, schlug Lizzy vor.
Ich nickte so schnell, dass ich mir dabei beinahe den Hals verrenkte. »Sehr gern.«
»Kayson, was geht?« Noah begrüßte mich mit einem Handschlag, als ich mich in der Schlange der Essensausgabe zu ihm stellte. Es war Freitag, und während für die meisten Studenten das Wochenende in greifbare Nähe rückte, war die Woche für mich noch lang nicht vorbei. Morgen stand ein wichtiges Basketballturnier der Red Hawks an, von dem ich nicht sicher war, ob wir es gewinnen konnten. Wir hatten uns in den letzten Monaten zwar stabilisiert und einen festen Platz im oberen Drittel der Tabelle erarbeitet, aber es gab einfach Gegner, die man nur an einem perfekten Tag und in einer perfekten Verfassung schlagen konnte.
»Langer Tag, noch längere Woche«, sagte ich.
Noah klopfte mir auf die Schulter. »Ihr packt das morgen, da bin ich sicher. Und danach wird gefeiert.«
»Ich sollte eigentlich nicht …«, setzte ich zu einer Antwort an, wurde aber sofort unterbrochen.
»Ach, komm schon, Kayson. Ein Abend wird dich nicht aus deinem Rhythmus schmeißen. Du bist so fokussiert auf den Erfolg – vergiss nicht, auch ein bisschen zu leben. Wir sind immerhin auf dem College.«
Genau das hatte ich im letzten Semester getan und dabei bemerkt, dass meine Kondition darunter litt. Seitdem ging ich kaum noch feiern, hatte einen Ernährungsplan und legte zusätzlich zum Training noch Laufeinheiten ein. »Du weißt, wie wichtig es für mich ist, direkt nach dem College von einem NBA-Team gedraftet zu werden. Ich kann mir Schludrigkeiten nicht erlauben.«
Irgendjemand boxte mir im Vorbeigehen auf den Arm und rief mir ein »Viel Glück morgen« zu, doch ich beachtete denjenigen nicht weiter.
Noah verdrehte die Augen. »Niemand verlangt von dir, dass du all deine Prinzipien über Bord wirfst. Es geht nur um einen Abend und ich verspreche dir auch, dass ich dich nicht dazu zwingen werde, mehr Alkohol zu trinken als du willst. Aber vergiss mal für ein paar Stunden deine Vorgaben und hab ein bisschen Spaß mit uns. Du hast dich in den letzten Wochen ziemlich abgeschottet und nur noch für den Sport gelebt. Ehrlich, Mann, ich kenne niemanden, der sich so akribisch an seine Essenspläne hält wie du.« Nachdenklich legte Noah den Kopf schief. »Bis auf Theo vielleicht.«
Wie auf Kommando trat mir der würzige Geruch von geschmolzenem Käse in die Nase, der darauf hindeutete, dass es heute Pizza in der Mensa gab. Das Wasser lief mir im Mund zusammen, und mein Magen fing an zu knurren. Innerlich fluchte ich. Die Pizza in der Mensa war nicht mal sonderlich gut, aber in meiner aktuellen Verfassung würde ich selbst für ein Stück fetttriefender Pizza morden.
Ein Seufzen entwich mir, und ich kratzte mich am Hinterkopf. Noah hatte ja recht. Eigentlich wusste ich auch, dass es mich nicht umbringen würde, meine Prinzipien mal für einen Tag über den Haufen zu schmeißen und mit meinen Freunden feiern zu gehen. Das hatte ich seit dem Beginn der Saison zu selten getan – fast gar nicht, um genau zu sein. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir war, fehlte es mir, etwas mit den anderen zu unternehmen.
»Okay, du hast gewonnen«, gab ich mich geschlagen. »Lass uns nach dem Spiel feiern gehen.«
Ein selbstzufriedenes Grinsen erschien auf Noahs Gesicht, und er klopfte mir erneut auf die Schulter. »Sehr gut, Mann. Du wirst es nicht bereuen, und ich kann die Ablenkung gut gebrauchen.«
Erstaunt wandte ich mich ihm zu. »Warum, was ist passiert?«
»Ach, nur das übliche Drama wegen meinem Dad. Mom überlegt, das Haus zu verkaufen, weil sie die Abzahlungsraten trotz meiner Unterstützung kaum stemmen kann. Ich kann es sogar irgendwie verstehen, zumal das Haus viel zu groß für sie und Karla alleine ist, aber …« Noah brach ab und hob hilflos die Schultern.
Ich verstand ihn auch so. »Du hast Angst, dass dein Leben dadurch noch mehr aus den Fugen gerät als ohnehin schon.«
»Ganz schön armselig, oder?«
Ich fand es überhaupt nicht armselig, sondern verständlich. Nicht nur, dass Noahs Vater vor einigen Monaten von einem auf den anderen Tag mit seiner zwanzig Jahre jüngeren Sekretärin durchgebrannt war, er hatte Noahs Mutter danach auch komplett den Geldhahn zugedreht und bezahlte nicht einmal mehr die monatlichen Raten für das gemeinsame Haus. Noahs Mom, die nur halbtags arbeiten ging, konnte diese Summen alleine nicht stemmen, weshalb Noah sich einen Nebenjob besorgt hatte, um ihr unter die Arme zu greifen. Jeder, der bei normalem Verstand war, würde in dieser Situation durchdrehen oder zumindest verzweifeln.
»Du bist nicht armselig. Als mein Dad damals abgehauen ist, habe ich eine Woche lang die komplette Nachbarschaft zusammengebrüllt«, sagte ich.
Noah sah mich völlig unbeeindruckt an. »Du warst fünf, als dein Dad abgehauen ist. Verständlich, dass du da so reagiert hast.«
Ich zuckte mit den Achseln. »Und du meinst, du hättest kein Recht darauf, verletzt zu sein, nur weil du älter bist? Das ist Bullshit, Mann. Deine Gefühle verschwinden dadurch doch nicht, du verstehst sie nur besser.«
Noah wirkte nicht überzeugt. »Ich sollte sie trotzdem besser unter Kontrolle haben.«
Ein Schnauben entwich mir. »Sag das deinem Idioten von einem Vater, der seinen Schwanz nicht bei sich behalten konnte«, entgegnete ich, was Noah ein überraschtes Lachen entlockte.
»Auch wieder wahr. Was fällt diesem Penner eigentlich ein? Ehrlich, wenn ich ihn in die Finger …« Noah brach ab, weil er an der Essensausgabe angekommen war und die Bedienung ihn skeptisch musterte. Auf einen Schlag hellte sich seine Miene auf, und er schenkte ihr sein breitestes Lächeln. »Hey, sorry für die Kraftausdrücke, ich musste mich mal kurz aufregen. Ich bekomme die Salamipizza, bitte.«
Kopfschüttelnd beobachtete ich meinen besten Freund. Es war mir immer noch ein Rätsel, wie seine Stimmung so schnell wechseln konnte. Dabei war es nicht einmal so, dass er den Leuten etwas vorspielte, nicht wirklich zumindest. Vor seinen Freunden verstellte Noah sich nie, aber wenn er der Meinung war, dass jemanden seine privaten Probleme nichts angingen, konnte er auf Knopfdruck den unbeschwerten Typen herausholen, der alles mit einem Augenzwinkern abtat.
Nachdem er seine Pizza erhalten hatte, warf ich einen neidischen Blick darauf und bestellte einen Salat mit magerem Hähnchenfleisch, den ich zu meinem Proteindrink essen würde.
Wir gingen zu unserem angestammten Tisch, wo Theo bereits mit Avery und Lizzy saß. Mein Herz machte einen Satz, als ich Lizzy entdeckte. Sie trug ihre dunklen Haare heute offen, und sie fielen ihr lockig über die Schultern. Konzentriert schrieb sie etwas in einen Block, der neben ihrem Teller auf dem Tisch lag.
Ich ging zu ihr und setzte mich neben sie. »Hey«, sagte ich in die Runde.
»Hi, Kayson«, sagte Lizzy, ohne aufzublicken. Ich musste mich anstrengen, um meine Enttäuschung zu verbergen. Nach unserem zufälligen Treffen im Tierheim hatte ich gehofft, dass sich an unserem Verhältnis etwas ändern würde. Wir hatten uns am Vortag gut verstanden, und unsere Leidenschaft für Tiere verband uns auf eine Weise, die mir unheimlich viel bedeutete. Gestern hatte ich auch bei Lizzy das Gefühl gehabt, als hätten wir uns angenähert, doch jetzt zeigte sie mir wieder einmal die kalte Schulter.
Würde ich die Frauen jemals verstehen?
Ich wandte mich meinem Essen zu und lauschte dem Gespräch von Avery und Theo, die sich über einen von Theos neuen Sponsoren unterhielten. Eher lustlos stocherte ich in meinem Salat herum. Der Appetit war mir gehörig vergangen, dabei benötigte ich die Energie dringend für mein Training später.
»So, ich bin fertig.« Lizzy klappte ihren Block zu und schob den Stuhl zurück. Rasch räumte sie ihre Sachen in den Rucksack, setzte ihn auf und erhob sich von ihrem Stuhl. »Ich gehe schon mal vor, ich muss noch ein Buch aus der Bücherei ausleihen.« Sie sah in die Runde und warf auch mir dabei einen flüchtigen Blick zu, bei dem ich Unsicherheit in ihren Augen erkennen konnte. Dann wandte sie sich ab und verließ die Mensa.
Ich starrte ihr hinterher, bis sie aus meinem Blickfeld verschwunden war. Kam es mir nur so vor oder war Lizzy heute ruhiger als gewöhnlich?
»Was ist denn mit Lizzy los?«, fragte Theo das, was ich ebenfalls dachte.
»Keine Ahnung.« Averys Blick ging in die Richtung, in die Lizzy verschwunden war. »Heute Morgen war sie noch völlig normal.«
»Vielleicht liegt es an mir«, sprach ich meine Bedenken aus.
Drei Augenpaare richteten sich ungläubig auf mich. »Wie kommst du denn auf den Schwachsinn?«, platzte Noah heraus.
Avery nickte zustimmend. »Ihr seid doch bisher immer gut ausgekommen.«
»Hat sie dir erzählt, dass wir uns gestern im Tierheim getroffen haben?«
»Nein, aber wir haben gestern auch nicht mehr gesprochen. Ich …« Avery räusperte sich, warf Theo einen Blick zu, und eine leichte Röte bildete sich auf ihren Wangen. »Es war schon spät, als ich zurück im Wohnheim war, da hat Lizzy schon geschlafen.«
»Es war sehr spät«, fügte Theo selbstzufrieden hinzu.
Avery verdrehte die Augen und boxte ihn auf den Oberarm. »Angeber«, sagte sie, ehe sie sich mir zuwandte. »Ist im Tierheim etwas passiert? Habt ihr euch gestritten?«
»Nein, im Gegenteil, wir haben uns gut verstanden«, musste ich zugeben.
Avery runzelte die Stirn. »Dann ergibt es erst recht keinen Sinn. Wieso sollte sie wegen dir schlecht drauf sein, wenn ihr euch gut verstanden habt?«
Ihre Worte sollten mich beruhigen, trotzdem konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass Lizzy wegen mir so abrupt aufgebrochen war – und auf meinen Instinkt konnte ich mich normalerweise immer verlassen.
Kapitel 3
So ungern ich es zugab, aber Kayson Washington brachte mich aus dem Konzept, und das, obwohl wir uns inzwischen schon seit einigen Monaten kannten. Noch während ich regelrecht aus der Mensa flüchtete, wollte ich mir für meine Blödheit in den Hintern treten. Ich hatte mich wie eine komplette Idiotin verhalten, doch sobald er sich neben mich gesetzt hatte, hatte ich mich nicht mehr rühren können. Als wäre ein Schalter in mir umgelegt worden, der sämtliche meiner Synapsen blockierte und mich in eine Starre versetzte.
Dabei gab es überhaupt keinen Grund dazu. Dass wir uns gestern zufällig beim Tierheim getroffen und uns gut verstanden hatten, hatte überhaupt nichts zu bedeuten. Kayson war bisher immer nett zu mir gewesen, warum sollte sich etwas daran ändern, nur weil wir uns außerhalb der üblichen Runde sahen? Kayson war einer dieser Menschen, die einfach zu jedem nett waren. Ich hatte es noch nie erlebt, dass er sauer wurde oder einem anderen gegenüber die Stimme erhob. Ich konnte mich mit Kayson gut unterhalten, und obwohl ich es anfangs nie vermutet hätte, schienen wir auf einer Wellenlänge zu sein – was das zufällige Treffen im Tierheim nur unterstrich.
Wärme breitete sich in mir aus, als ich daran zurückdachte, wie Kayson mit den Katzen umgegangen war. Warum musste er nicht nur nett, sondern zudem noch tierlieb sein, und damit meine Gefühlswelt komplett ins Chaos stürzen?
Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, war er auch noch im College-Basketballteam. Er wurde von hübschen Frauen umschwärmt wie das Licht von Motten. Er müsste nur mit dem Finger schnippen und hätte an jedem Arm drei von ihnen hängen. Es wunderte mich schon länger, dass ich ihn noch nie in weiblicher Begleitung gesehen hatte. Meines Wissens schleppte er nicht mal nach Partys jemanden ab. Wenn es so wäre, hätte ich schon längst Gerüchte darüber gehört, die sich am LaGuardia Community College wie ein Lauffeuer verbreiteten. Theo Jemison war ein Paradebeispiel dafür. Als Avery und ich neu waren, waren die Geschichten über seinen freizügigen Lebensstil von allen Seiten an uns herangetragen worden, doch über Kayson hörte man nichts dergleichen. Was nur bedeuten konnte, dass Kayson kein Aufreißer war.
Gott, ich war so was von verloren.
Warum musste ich ausgerechnet den einen Typen an diesem College toll finden, der nicht nur in einer anderen Liga, sondern gleich in einem anderen Universum spielte? Bei dem ich selbst dann keine Chance hätte, wenn ich abnehmen und mich für Sport interessieren würde?
Durch meinen überhasteten Aufbruch war ich viel zu früh für meine nächste Vorlesung. Außer mir war noch niemand im Raum, was mich aber nicht störte. Ich setzte mich auf meinen üblichen Platz und zog mein Buch aus der Tasche. Das Institut von Stephen King hatte ich mittlerweile beendet und gestern mit Ninth House von Leigh Bardugo begonnen. Ich schlug die Seite auf, an der mein Lesezeichen steckte, und tauchte in die Welt von Alex Stern ein.
Als ich am übernächsten Tag zum Tierheim ging, war ich unerwartet nervös. Heute wollten Kayson und ich mit einigen Hunden Gassi gehen – zumindest hatten wir es beim letzten Mal ausgemacht, als wir uns verabschiedet hatten. Bisher hatte ich nicht an der Ernsthaftigkeit von Kaysons Aussage gezweifelt, doch je näher ich dem Tierheim kam, desto unsicherer wurde ich. Vielleicht hatte er es nicht ernst gemeint und nur aus Nettigkeit zugestimmt. Oder er hatte vergessen, sich überhaupt mit mir verabredet zu haben. Dass wir seitdem nicht wirklich miteinander gesprochen hatten, machte die Sache nicht besser, dabei war das ganz allein meine Schuld. Wieder musste ich daran denken, dass Kayson sich vorgestern in der Mensa neben mich gesetzt und ich danach kein Wort über die Lippen gebracht hatte. Vielleicht würde er mich jetzt versetzen, weil …
Schluss jetzt, ermahnte ich mich selbst. Dieses ewige Kopfzerbrechen brachte mich nicht weiter. Tief in mir drin konnte ich mir nicht vorstellen, dass Kayson einfach nicht auftauchte, aber selbst, wenn es so war, würden meine Grübeleien nichts daran ändern können. Erinnerungen aus meiner Highschoolzeit wollten sich in den Vordergrund meiner Gedanken drängen, doch ich schob sie zurück. Sie waren einfach zu schmerzhaft und hatten nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Kayson war nicht wie diese Idioten, er würde mich nicht wie sie bloßstellen, trotzdem kam ich nicht umhin, diesen Vergleich zu ziehen. Immerhin kannte ich Kayson bisher nur aus der Clique und konnte nicht einschätzen, ob er alleine nicht vielleicht anders war.
Um mich abzulenken, zog ich ein Haargummi aus meiner Jackentasche und band meine Haare zu einem lockeren Pferdeschwanz. Dunkle Wolken türmten sich am Himmel und kündigten einen weiteren Regenschauer an. Obwohl wir bereits April hatten, tat der Frühling sich noch schwer, in New York Einzug zu halten. Die Temperaturen kletterten kaum über die Zehngradmarke, und ich konnte mich gar nicht daran erinnern, wann es zuletzt mal einen ganzen Tag nicht geregnet hatte.
Als ich um die letzte Ecke bog und das Tierheim in meinem Blickfeld auftauchte, waren alle Zweifel und negativen Gedanken mit einem Schlag aus meinem Kopf gefegt. Kayson stand vor dem Eingang, die Hände tief in die Taschen seines Parkas geschoben. Ein Käppi saß falsch herum auf seinem Kopf, und ein Schal war um seinen Hals geschlungen. Mit der Schuhspitze kickte er einige lose Steine über den Bürgersteig und sah so plötzlich auf, als hätte er meinen Blick auf sich gespürt.
Sobald Kayson mich entdeckte, erschien ein Lächeln auf seinen Lippen, das seltsame Dinge mit meinem Magen anstellte. Er fühlte sich übervoll an, als hätte ich zu viel und zu gut gegessen, dabei hatte ich seit dem Mittagessen bloß einen Schokoriegel verputzt.
»Wartest du schon lange?«, fragte ich, nachdem wir uns begrüßt hatten.
Kayson hielt mir die Tür auf, damit ich vor ihm das Tierheim betreten konnte. »Nein, ich bin selbst grad erst gekommen.«
Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass es fünf Minuten vor der verabredeten Zeit war. »Trotzdem früh.«
Sein warmes Lachen schickte einen Schauer über meinen Rücken. »Gewöhn dich nicht daran, eigentlich bin ich eher für meine Unpünktlichkeit bekannt. Das treibt meinen Trainer regelmäßig in den Wahnsinn.«
Überrascht wandte ich mich ihm zu. »Ich habe dich noch nie unpünktlich erlebt.«
Kaysons Grinsen ließ eine Reihe strahlend weißer Zähne aufblitzen. »Weil Noah mich dazu zwingt, meinen Hintern in Bewegung zu setzen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind.«
»Immer diese Mitbewohner, die einen nicht faul sein lassen«, entgegnete ich augenzwinkernd.
»Sie können eine Pest sein, aber ohne sie wäre es auch langweilig.«
Ehe ich ihm antworten konnte, trat Sarah vor uns. Sie trug dieselbe Latzhose wie bei unserem letzten Besuch, und ihre blonden Haare waren zerzaust, als wäre sie zu oft mit den Händen hindurchgefahren. »Hey, da seid ihr ja wieder. Habt ihr die Tiere schon vermisst?«
»Ich hatte ohnehin vor, zweimal pro Woche herzukommen, solange mein Trainingsplan es zulässt«, sagte Kayson. »Vielleicht schaffen wir es wirklich, es so aufzuteilen, dass wir abwechselnd was mit Hunden und Katzen machen. Was meinst du?«
Kaysons Frage traf mich völlig unvorbereitet. Nachdem ich zuvor gezweifelt hatte, ob er überhaupt kommen würde, überforderte er mich jetzt damit, dass wir immer zusammen herkommen und uns um die Tiere kümmern sollten … Mein Mund öffnete sich, aber kein Ton kam hervor. Stattdessen wurde das Rauschen in meinen Ohren lauter. Wie war es nur möglich, dass Kayson mich so einfach aus dem Konzept bringen konnte?
»Ähm … klar … sicher«, brachte ich stotternd hervor.
»Super, dann kommt mal mit.« Sarah führte uns zu den Zwingern mit den Hunden. Entweder hatten sie und Kayson meinen inneren Tumult nicht bemerkt, oder sie waren freundlich genug, nichts dazu zu sagen.
Zehn Minuten später befanden Kayson und ich uns mit zwei Hunden auf dem Weg zum nahe gelegenen Queensbridge Park. Kayson hatte sich für eine Schäferhündin namens Daisy entschieden, während ich einen Colliemischling namens Derek an der Leine neben mir herführte. Sarah hatte uns versichert, dass beide Hunde schon länger im Tierheim und nicht nur aneinander gewöhnt waren, sondern sich auch gut verstanden. Schon jetzt alberten sie auf dem Bürgersteig herum, knurrten sich spielerisch an und brachten uns mehrfach dazu, fast über ihre sich verheddernden Leinen zu stolpern.
Kaum hatten wir den Park erreicht, öffnete der Himmel seine Schleusen, und es begann zu regnen. Ich zog die Kapuze meiner Regenjacke über meinen Kopf, und Kayson drehte den Schirm seines Käppis nach vorn, sodass der Regen ihn nicht mehr im Gesicht erwischen konnte.
»Ich würde mich ja über das Mistwetter aufregen, aber so haben wir den Park wenigstens für uns allein und können die Hunde frei laufen lassen.« Kayson beugte sich hinab, um die Leine von Daisys Halsband zu lösen.
»Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist?«, fragte ich vorsichtig. »Sarah hat uns gesagt, wir sollen sie erst freilassen, wenn sie uns als Anführer akzeptiert haben.« Mir war nicht wohl dabei, die Hunde heute schon von der Leine zu nehmen, wenn wir ihre Reaktionen noch nicht einschätzen konnten.
Kayson zuckte bloß mit den Schultern. »Sie sind doch total lieb. Frei können sie einfach besser miteinander toben, und wir können Stöckchen schmeißen. Außerdem, was soll schon passieren?« Er breitete die Arme aus und drehte sich, als wollte er erneut darauf hinweisen, dass wir die einzigen Personen im Park waren.
Ich zögerte noch einen Moment, löste dann aber ebenfalls Dereks Leine von seinem Halsband. Sofort schossen die beiden Hunde über die große Wiese, von links nach rechts, vor und zurück, immer im Zickzack, als würden sie Fangen spielen. Ihr lautes freudiges Bellen hallte dabei zu uns herüber.
Wir blieben am Rand der Wiese stehen und beobachteten die beiden dabei, wie sie sich ordentlich auspowerten. Sarah hatte nicht übertrieben, dass sie gut miteinander auskamen. Obwohl sie sich gegenseitig über die Wiese jagten, konnte ich keine Rivalität zwischen ihnen spüren, nur reine Freude an ihrem Spiel, was mich schmunzeln ließ. Ich wagte einen Blick in Kaysons Richtung, doch er sah gar nicht zu den Hunden, sondern zu mir.