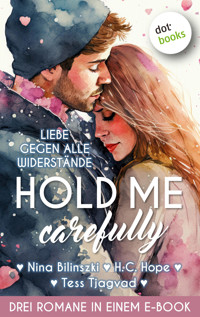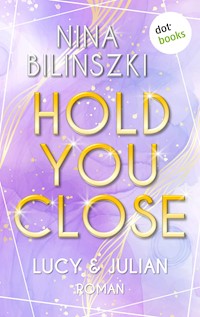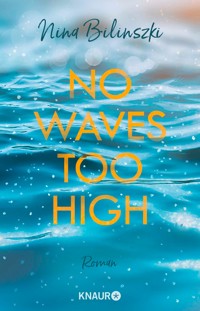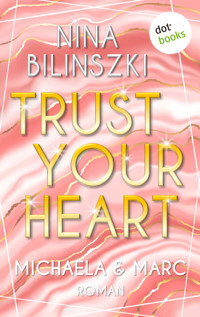
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Philadelphia-Love-Storys
- Sprache: Deutsch
Ist Liebe nur für die Glücklichen bestimmt? Der bewegende Liebesroman »Trust Your Heart: Michaela & Marc« von Nina Bilinszki jetzt als eBook bei dotbooks. Nie wieder einem anderen Menschen vertrauen, das hat Michaela sich schon vor Langem geschworen. In Philadelphia will sie die Dämonen ihrer Vergangenheit allein bezwingen – bis sie dem ebenso sympathischen wie gutaussehenden Studenten Marc begegnet. Mit seiner Hilfe schafft sie es, langsam wieder zurück ins Leben zu finden. Nach und nach erwachen auch andere Gefühle in Michaela, Gefühle, die sie nie wieder zulassen wollte ... aber gerade, als sie wieder zu hoffen beginnt, stößt Marc sie von sich, denn auch er trägt ein dunkles Geheimnis mit sich herum, dem er nicht entkommen kann. Ist in der Vergangenheit zu viel in den beiden zerbrochen, um heute zusammen glücklich werden zu können – oder werden sie sich gerade deswegen gegenseitig heilen? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Die College-Romance »Trust Your Heart: Michaela & Marc« von Nina Bilinszki – Autorin der New-Adult-Reihen »Love Down Under« und »Between us« – wird alle Fans der Bestseller von Mona Kasten und Nikola Hotel berühren. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Nie wieder einem anderen Menschen vertrauen, das hat Michaela sich schon vor Langem geschworen. In Philadelphia will sie die Dämonen ihrer Vergangenheit allein bezwingen – bis sie dem ebenso sympathischen wie gutaussehenden Studenten Marc begegnet. Mit seiner Hilfe schafft sie es, langsam wieder zurück ins Leben zu finden. Nach und nach erwachen auch andere Gefühle in Michaela, Gefühle, die sie nie wieder zulassen wollte ... aber gerade, als sie wieder zu hoffen beginnt, stößt Marc sie von sich, denn auch er trägt ein dunkles Geheimnis mit sich herum, dem er nicht entkommen kann. Ist in der Vergangenheit zu viel in den beiden zerbrochen, um heute zusammen glücklich werden zu können – oder werden sie sich gerade deswegen gegenseitig heilen?
Über die Autorin:
Nina Bilinszki ist in den 80er Jahren im Ruhrpott aufgewachsen und lebt heute im Rhein-Main-Gebiet. Seit sie sich erinnern kann, begeistert sie sich für das Schreiben. Wenn sie sich nicht gerade bei ausgedehnten Jogging-Runden inspirieren lässt, taucht sie in die mitreißenden, manchmal glücklichen und manchmal traurigen Welten ihrer Charaktere ein.
Die Website der Autorin: nina-bilinszki.de/
Die Autorin auf Instagram: instagram.com/nina.bilinszki
Bei dotbooks veröffentlichte Nina Bilinszki ihre romantische Philadelphia-University-Romance-Reihe:
»At Your Side: Emma & Jaxon – Band 1«
»Hold You Close: Lucy & Julian – Band 2«
»Trust Your Heart: Michaela & Marc – Band 3«
»Find Our Way: David & Kieran – Band 4«.
***
eBook-Neuausgabe März 2023
Copyright © der Originalausgabe Ullstein Buchverlag GmbH, Berlin 2019
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München, unter Verwendung eines Bildmotivs von Adobe Stock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-550-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Trust Your Heart« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Nina Bilinszki
Trust your heart: Michaela & Marc
Roman
dotbooks.
Für alle, die Probleme damit haben,
ihr Herz über ihren Verstand entscheiden zu lassen
Kapitel 1
Michaela
So eine verdammte Scheiße!
Mit aller Kraft, die ich aufbringen konnte, schlug ich auf den Sandsack vor mir ein.
Jab, Jab, Cross.
Jab, Cross, Jab.
Links, links, rechts.
Links, rechts, links.
Immer wieder diese Kombinationen, so schnell und hart ich konnte. Meine Arme begannen zu brennen, und eine Schweißperle lief mir über die Stirn direkt ins Auge. Ich ließ mich nicht davon beirren, sondern bearbeitete den Sandsack weiter. In der Hoffnung, dass die Erschöpfung auch mein Gedankenkarussell endlich stoppen würde.
Meine Schuhe quietschten bei jeder Drehung auf dem Hallenboden und ich versuchte mich auf meinen Atem zu konzentrieren, den ich bei jedem Schlag zischend zwischen meinen Zähnen herauspresste. Ich sehnte diese vollkommene Leere in meinem Kopf herbei, die das Training mir normalerweise verschaffte. Nicht denken, nicht fühlen müssen. Aber das erreichte ich heute nicht einmal ansatzweise.
Immer wieder spielte sich diese eine Szene vor meinem inneren Auge ab.
Fenton, wie er mir gestern ziemlich emotionslos mitgeteilt hatte, dass er mich nicht länger sehen wollte, weil ich ihm das Gefühl vermittelt hatte, kein Interesse an einer Beziehung zu haben. Was korrekt war. Ich wollte nicht mit ihm zusammen sein. Fenton war ein netter Kerl und würde ein nettes Mädchen einmal sehr glücklich machen.
Aber ich war kein nettes Mädchen. Von Anfang an hatte ich ihn nur dazu benutzt, um Marc eifersüchtig zu machen. Und hatte selbst dann nicht damit aufgehört, als es keine Wirkung gezeigt hatte.
Es war nur logisch, dass Fenton unser Techtelmechtel von sich aus beendet hatte, und sollte mich gar nicht stören. Trotzdem versetzte es mir einen Stich, erneut alleine dazustehen.
Wut stieg in mir auf und ich verstärkte meine Bemühungen, den Sandsack zu Brei zu verarbeiten. Warum konnte nicht einmal etwas so laufen, wie ich es mir wünschte?
Ich spürte Marcs Blicke auf mir, die sich wie eine Speerspitze in meinen Rücken bohrten. Das machte er ständig, als könne er mich nicht aus den Augen lassen und müsse jede meiner Bewegungen verfolgen. Ich versuchte mir einzureden, dass er als Trainer nur kontrollieren wollte, ob meine Armhaltung und Beinarbeit korrekt waren. Aber das war Schwachsinn, denn keinen seiner anderen Schützlinge bedachte er mit dieser intensiven Aufmerksamkeit. Selbst die nicht, die es bitter nötig hatten.
Genervt stieß ich die Luft aus und versuchte Marc auszublenden. Nur auf die Bewegungen konzentrieren. An nichts denken.
Unmöglich.
Mein Frust wuchs und damit auch meine Unachtsamkeit. Meine Bewegungen wurden schlampiger, unkoordinierter, was auch Daniel nicht verborgen blieb.
»Schultern hoch, denk an deine Deckung«, mahnte er mich sogleich.
Daniel war neben Marc ein weiterer unserer drei Trainer, die den Anfängerkurs im Boxverein leiteten. Er hielt gerade den Boxsack für mich, damit ich mich besser auf meine Bewegungsabläufe konzentrieren konnte und nicht noch den herumschwingenden Sack einplanen musste. Wie Marc war er sehr darauf bedacht, dass wir die Schläge präzise und aus der Hüftdrehung heraus ausführten anstatt mit roher Gewalt auf den Sandsack einzuprügeln ‒ was ich gerade tat.
»Mach ich doch«, sagte ich dennoch. Je länger ich das leblose Objekt vor mir bearbeitete, desto wütender wurde ich. Auf mich, auf Marc und das ganze verdammte Universum. Wenn er mich doch nicht wollte, warum konnte er mich dann nicht in Ruhe lassen? Würde er mich nicht länger beachten, würde sicher auch mein verliebtes Herz irgendwann kapieren, dass keine Chance für mich bestand.
Meine Fäuste flogen regelrecht durch die Luft, und mein Atem kam in keuchenden Stößen.
»Michaela, hör auf.« Daniel ließ den Boxsack los und trat zur Seite.
Das machte es mir um einiges schwerer, darauf einzudreschen, trotzdem ließ ich nicht davon ab. In meinen Ohren begann es zu rauschen, und ich bekam einen Tunnelblick, aber ich dachte gar nicht daran aufzuhören.
»Michaela«, sagte Daniel erneut, lauter diesmal.
Ich ignorierte ihn, blendete ihn sowie alle anderen in dieser Turnhalle aus. Es existierten nur noch meine gleichmäßigen Schläge und das Ziehen in meinen Schultern, das von Minute zu Minute stärker wurde.
Starke Arme schlossen sich von hinten um mich und zogen mich zurück. Zuerst wusste ich nicht, wer es war, und versuchte mich dagegen zu wehren. Dann stieg mir Marcs Geruch in die Nase, irgendwie erdig und frisch, der mich immer an einen Waldspaziergang im Frühling erinnerte, und sämtliche Kraft floss aus mir heraus. Schlaff hing ich in seinem Griff, wurde mehr von ihm als meinen eigenen Beinen getragen.
Der Schweiß lief mir in Strömen über das Gesicht, meine Glieder schmerzten vor Anstrengung, und ich bekam kaum genügend Luft: in meine Lunge. Wann war ich derart außer Atem geraten?
Marc dirigierte mich langsam zu einer der Bänke, die verteilt an den Wänden im Raum standen.
»Möchtest du mir sagen, was los ist?«, fragte er leise, dabei streifte sein Atem meinen Nacken und verursachte mir eine Gänsehaut.
Sofort hasste ich meinen Körper, dass er auf die kleinste Berührung von Marc derart heftig reagierte. Mal wieder. Als wäre ich ein verdammter Kompass und Marc mein Nordpol.
Dabei hatte ich mir geschworen, mich nie wieder nach jemand anderem auszurichten.
Resolut wand ich mich aus Marcs Umklammerung und drehte mich mit zu Fäusten geballten Händen zu ihm um.
»Wie kommst du darauf, dass etwas los ist?«
»Selbst für deine Verhältnisse bist du ungewöhnlich schlecht drauf.« Er zuckte mit den Schultern.
Selbst für meine Verhältnisse? »Was soll das denn heißen?«, fuhr ich ihn an. Wenn er mir jetzt sagte, ich wäre eine Zicke, würde ich ihm eine reinhauen.
»Du bist halt…« Er schien nach dem richtigen Wort zu suchen. »Leidenschaftlich«, sagte er schließlich.
Was nur eine nettere Umschreibung für Zicke war.
»Du musst dich ja nicht mit mir abgeben«, zischte ich, ehe ich kurz auflachte. »Ach, stimmt ja, tust du ja schon nicht mehr.« Meine Worte klangen bitter, aber er hatte mit seiner Ablehnung eine Wunde aufgerissen, die noch lange nicht verheilt war. Es hatte mich einiges an Überwindung gekostet, mich ihm zu öffnen und ihm von meinen Gefühlen zu erzählen. Er hatte erstaunt gewirkt, aber nicht überrascht, als hätte er es bereits vermutet, mir aber nicht zugetraut, es auszusprechen. Noch heute hallte seine Antwort in meinem Kopf wider.
»Michaela … es tut mir leid, aber ich kann nicht. Es ist nicht so, als würde ich dich nicht toll finden. Du bist eine umwerfende Frau, aber ich kann mich momentan nicht auf eine Beziehung einlassen. Es liegt nicht an dir, sondern an meinen chaotischen Lebensumständen. Tut mir leid.«
Es lag nicht an mir, sondern an seinen chaotischen Lebensumständen? Wenn es nicht so traurig wäre, könnte ich darüber lachen. Marc war der geradlinigste Mensch, den ich kannte. Er war ein guter Student, lernte immer fleißig und hatte zwei Jobs, um nicht nur seinen eigenen Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern auch seine Mom und seinen kleinen Bruder unterstützen zu können. Dass er mir nicht wenigstens ehrlich sagen konnte, dass er schlichtweg kein Interesse an mir hatte, war fast schon enttäuschend.
Auch jetzt schien er keine Antwort auf meine Worte zu finden, sondern starrte mich nur unschlüssig an. Daher wandte ich mich ab und marschierte in Richtung Umkleiden davon. Ich konnte mich heute eh nicht aufs Boxen konzentrieren, und Marc einfach mal stehen zu lassen, tat irgendwie gut.
Ich war nicht weit gekommen, als ich Schritte hinter mir hörte und Marc nach meinem Arm griff. Ein Kribbeln raste durch meinen Arm.
Ich wirbelte auf dem Absatz herum.
»Was?«, fragte ich schärfer als beabsichtigt.
»Bist du sicher, dass es dir gut geht?«
»Jetzt tu nicht so, als würde dich das interessieren«, gab ich zurück.
Erstaunen trat auf sein Gesicht. »Ich hab doch gesagt, dass ich unsere Freundschaft nicht gefährden will.«
Ein Schnauben entwich mir. »Und was ist seitdem passiert? Du ignorierst mich. Du hast nur noch Zeit, wenn ich dich wegen irgendwas um Hilfe bitte, von selber meldest du dich gar nicht, und was in deinem Leben passiert, erfahre ich auch nicht mehr. Newsflash, so verhalten sich Freunde nicht.« Erst jetzt fiel mir auf, dass er noch immer mein Handgelenk umklammert hielt, daher entriss ich es ihm, um meine Worte zu unterstreichen.
Marc wirkte sichtlich unwohl. »Aber ich wollte dir doch nur die nötige Zeit geben, um mit der Situation klarzukommen«, wehrte er sich.
»Woher willst du wissen, was ich nötig habe, wenn du nicht mit mir redest? Hör auf, über meinen Kopf hinweg Entscheidungen zu treffen. Wenn du wirklich mein Freund sein willst, dann verhalt dich auch gefälligst so.« Mit diesen Worten ließ ich ihn stehen und stolzierte hoch erhobenen Hauptes in die Umkleide.
Meine Hände zitterten noch immer, als ich die Boxhandschuhe von meinen Händen riss und die Bandagen löste, aber die Wut in meinem Inneren ebbte langsam ab. Eigentlich sollte ich froh sein, dass Marc mit offenen Karten spielte, anstatt mich hinzuhalten oder mir etwas vorzumachen. Wenn es nur nicht so verdammt wehtun würde.
Ich zog mich in Windeseile um und packte meine Sachen zusammen. Ein eisiger Wind pfiff mir um die Ohren, sobald ich die Sporthalle verließ, find ich ärgerte mich, dass ich meine Mütze vergessen hatte.
In der letzten Woche hatte es zuerst etwas geschneit, bevor die Temperaturen in den Dauerfrostbereich abgesackt waren. Vereiste Gehwege waren die Folge, was meinen Heimweg zu einer Rutschpartie werden ließ. Trotzdem mochte ich dieses Wetter. Der Himmel war klar, die eisige Luft hinterließ ein Prickeln auf meinen Wangen und das Licht der Straßenlaternen ließ den verbliebenen Schnee auf den Gehwegen glitzern. Ich schlug den Kragen meiner Daunenjacke hoch, vergrub die Hände tief in den Taschen und schlitterte nach Hause. Dabei kreisten meine Gedanken ununterbrochen um den Tag, als Jaxon Marc zu mir geschickt hatte.
Ich legte mir gerade eine neue Line Koks zurecht, als es an der Tür klingelte, was zur Hölle? Jaxon war kaum eine Stunde weg und es klingelte erneut? Was wollte er schon wieder? Ich hatte wirklich gedacht, ihn genug verschreckt zu haben, dass er sich so schnell nicht mehr hier blicken ließ.
Schnaubend ging ich zur Tür, um zu öffnen. Eigentlich sollte ich ihn draußen versauern lassen, aber mich totzustellen hatte ich bereits versucht, und es hatte nur darin geendet, dass Jaxon wie ein wahnsinniger auf den Klingelknopf eingedroschen hatte. Das wollte ich meinem Trommelfell kein weiteres Mal antun.
»Was willst du noch?«, rief ich das Treppenhaus hinab, sobald ich Schritte auf den Stufen hören konnte, ich erhielt keine Antwort und je näher die Schritte kamen, desto angespannter wurde ich. Mein vernebelter Verstand malte sich alle möglichen Schreckensszenarien aus. Als mein Besucher endlich in mein Blickfeld trat, war ich im ersten Moment zu keiner Reaktion fähig.
»Hey, Michaela.« Marc lächelte mich unsicher an.
»Du?«, fragte ich fassungslos. Er war so ziemlich der letzte Mensch, mit dem ich gerechnet hatte, »Was machst du hier? Woher weißt du, wo ich wohne?« Ich hatte nie viel mit Jalons Mitbewohner zu tun gehabt. Wir trafen uns überwiegend bei mir, und wenn wir doch mal bei ihm waren, war Marc entweder in seine Spielekonsole vertieft oder nicht zu Hause, ich konnte mich nicht daran erinnern, jemals eine Unterhaltung mit ihm geführt zu haben, die über »Hallo, wie gehts dir?« hinausgegangen war.
Marc rieb sich mit der Hand über den Nacken, »Jason hat mich zu dir geschickt. Er macht sich Sorgen um dich, hat aber Angst, selbst etwas nehmen zu wollen, wenn er bei dir bleibt, ich hoffe, das ist okay?« Dass er es als Frage stellte, unterstrich seine eigene Unsicherheit.
»Ähm…« ich fühlte mich völlig überrumpelt. Nach allem, was ich Jason zuvor an den Kopf geworfen hatte, war es irgendwie süß, dass er sich noch derart um mich sorgte, um mir Marc zu schicken. Aber wollte ich wirklich einen beinahe Fremden in meine Wohnung lassen? In ihrem aktuellen Zustand?
»Kannst du kurz zwei Minuten warten?« Ich wartete seine Antwort gar nicht ab, sondern sprintete zurück ins Wohnzimmer und versuchte wenigstens oberflächlich für Ordnung zu sorgen, was ein Ding der Unmöglichkeit war. Denn hier sah es aus, als hätte ein Messie einen Monat lang sein Unwesen getrieben. Hatte ich hier wirklich die letzten Tage verbracht?
»Lass mich dir helfen«, ertönte Marcs Stimme direkt hinter mir.
Hitze schoss mir ins Gesicht und ich wünschte mir ein Mauseloch, in dem ich mich verkriechen konnte, zum ersten Mal waren mir die Unordnung und der Dreck in meinen vier Wänden unangenehm, warum hatte er nicht auf mich gehört? Mit geballten Fäusten wandte ich mich ihm zu.
»Hab ich dir nicht ges…« Der Rest blieb mir im Hals stecken, als ich sah, was Marc tat. In Allerseelenruhe räumte er die nur zum Teil leeren Take-a-way-Boxen von meinem Tisch und steckte sie ineinander. Nachdem er sie zur Seite gestellt hatte, machte er mit den leeren Getränkedosen weiter. Dabei wirkte es, als würde ihm meine versiffte Wohnung gar nichts ausmachen, als würde er sich nicht davor ekeln.
»Wenn du mir hilfst, geht es schneller«, sagte Marc und zwinkerte mir schmunzelnd zu.
Das löste mich aus meiner Starre, und die nächste Stunde verbrachten wir damit, mein Wohnzimmer wieder in einen bewohnbaren Zustand zu bringen, ich ließ den Spiegel mit den weißen Pulverresten in einer Schublade verschwinden, weil es mir plötzlich unangenehm war, dass Marc meine Drogen sehen konnte. Dabei schüttelte ich über mich selbst den Kopf, denn es hatte mich noch nie interessiert, was andere Leute von mir dachten. Warum war es mir bei Marc so wichtig?
»Setz dich zu mir«, forderte Marc mich auf, als wir fertig waren, und klopfte neben sich auf die Couch. In gehörigem Sicherheitsabstand kam ich seiner Aufforderung nach, was wollte er von mir?
»Erzähl mir was über dich.«
Sämtliche meiner Alarmglocken sprangen an. »Was willst du wissen?«, fragte ich unfreundlicher als gewollt, ich wusste genau, dass dieses Gespräch auf eine »Aufklärung über mein Drogenproblem« hinauslaufen würde, und darauf konnte ich verzichten. Es gab nichts, das er mir sagen konnte, was ich nicht schon von meinen unzähligen Therapeuten gehört hatte.
Marc zuckte bei meinem Tonfall nicht mal mit der Wimper. »Na ja, wir kennen uns kaum, erzähl mir, was du gerne machst, welche Wünsche und Träume du für die Zukunft hast.«
Mein Mund klappte auf, aber kein Ton kam heraus. Meine Wünsche und Träume für meine Zukunft? War das sein Ernst? Ich hatte keine. Nicht einen einzigen, ich erlaubte mir nicht einmal, an meine Zukunft zu denken, weil dort sicher nichts Gutes auf mich warten würde.
»Glücklich werden«, entwich es mir unbeabsichtigt. Und wow, wo kam das auf einmal her? Glaubte ich wirklich, dass es für mich möglich war, irgendwann einmal glücklich zu werden? Ich wusste nicht einmal, wie sich das anfühlte, weil ich es nie erlebt hatte, wie kam ich auf solche abstrusen Gedanken? Etwas veränderte sich in Marcs Gesicht, weil ich ihn kaum kannte, konnte ich es nicht einschätzen, trotzdem konnte ich die Gänsehaut nicht verhindern, die sich daraufhin auf meinen Armen ausbreitete.
»Und wie stellst du dir das vor?«
Ein hohl klingendes Lachen entwich mir. »Gar nicht«, gestand ich. »Ich glaube nicht, dass ich jemals glücklich sein kann. Nicht nach allem, was ich bisher erlebt und getan habe.« Wenn ich ehrlich zu mir war, verdiente ich es nicht einmal, aber das würde ich niemals laut aussprechen.
Verwundert legte Marc den Kopf schief, »jeder kann glücklich werden«, beharrte er. »Man muss nur herausfinden, was man sich vom Leben wünscht und was man machen will. Man braucht ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann. Manche Menschen macht Reisen glücklich, andere gehen völlig in ihrer Arbeit oder ihrem Sport auf. Für manche ist es das größte Glück auf Erden, bei ihrem Haustier zu sein. Du musst nur wissen, was dich glücklich machen würde, dann können wir darauf hinarbeiten.«
Mich würde es glücklich machen, nicht mehr alleine zu sein, schoss es mir durch den Kopf, und ich biss mir auf die Zunge, um es nicht auch noch auszuplappern.
Dann stutzte ich, als ich seinen letzten Satz Revue passieren ließ. Moment mal. »Wir?«, hakte ich nach.
Verschmitzt grinsend hielt er mir die Hand hin. »Schlag ein, und ich helfe dir dabei, deine Träume herauszufinden und zu verwirklichen.«
Zum ersten Mal seit einer sehr langen Zeit klopfte mein Herz wild wegen etwas, das absolut nichts mit dem Genuss von Betäubungsmitteln zu tun hatte.
Ich schüttelte meinen Kopf, um mich von der Erinnerung zu befreien, als ich an meiner Haustür angekommen war. Warum musste ich ausgerechnet heute an den Tag zurückdenken, an dem ich begriffen hatte, was Hoffnung war?
Resolut ließ ich die Haustür hinter mir ins Schloss fallen und schaltete zuerst Licht und Radio ein. Ich hasste es, in eine leere und stille Wohnung heimkommen zu müssen. Was irgendwie ironisch war, weil ich alleine wohnte, seit ich mit 17 meinen ersten Entzug hinter mir hatte.
Eine eigene Wohnung hatte definitiv Vorteile. Kein Geschrei. Niemand, der mir Vorhaltungen machte oder mich zu etwas zwang. Tun und lassen können, was immer ich wollte. Wann ich es wollte. Keine Streitereien mit meinem Stiefvater mehr.
Aber es bedeutete auch Einsamkeit. Eine dröhnende Stille, die es nicht schaffte, das Flüstern meiner Gedanken abzustellen, das mich dazu überreden wollte, wieder zu den Sachen zu greifen, die mich überhaupt erst in diese Situation gebracht hatten. Damals hatte ich mich stark an Jaxon geklammert, der in einer ähnlichen Situation gesteckt hatte. Wir waren einander eine Stütze gewesen, hatten uns davon abgehalten, wieder nachzugeben, und in meiner Naivität hatte ich geglaubt, in ihn verliebt zu sein.
Heute wusste ich es besser. Denn Jaxon mit Emma zu sehen, hatte nicht einmal annähernd so wehgetan wie Marcs Ablehnung zu erfahren. Das mit Jaxon war bestenfalls Schwärmerei gewesen, nur ein Hauch von dem, was ich für Marc empfand.
Seufzend rieb ich mir über das Gesicht und verscheuchte die trüben Gedanken. Es wurde noch immer nicht einfacher. Obwohl ich seit mittlerweile fast einem Jahr clean war, waren der Drang und die Versuchung noch immer da. Vor allem, wenn ich einsam oder traurig war wie jetzt. Sofort war die kleine Stimme zur Stelle, die mir einflüsterte, wie viel besser es mir gehen würde, wenn ich etwas nehmen würde.
Auch jetzt spürte ich erneut diese innere Unruhe. Diesen Drang, wieder etwas zu nehmen. Nur eine einzige Line, um für einen Abend vor mir selbst entfliehen zu können.
Aber es machte alles nur schlimmer anstatt besser. Ich wusste es genau. Und ich wollte diesen Teufelskreis endlich brechen.
Kapitel 2
Marc
Ein lautes Poltern riss mich aus dem Schlaf, kurz bevor sich eine ganze Elefantenherde auf mich schmiss. Grunzen und Lachen waren zu hören. Ein Ellbogen oder Knie bohrte sich schmerzhaft in meine Seite. Ich versuchte mich zu drehen, um denjenigen, der auf mir lag, von mir runterzuschmeißen, aber ich konnte mich nicht bewegen.
Augenblicklich bereute ich es, Jaxon seinen Schlüssel nicht abgenommen zu haben, als er letzte Woche ausgezogen war.
»Hey, Arschgeigen«, sagte ich, aber der Laut wurde von dem Kissen auf meinem Gesicht geschluckt.
»Ohhh, ich glaube, er ist wach.« Die amüsierte Stimme gehörte David. Vermutlich war er auch derjenige, der gerade auf mir herumhopste.
»Runter von mir«, knurrte ich, was mit einigen Lachern quittiert wurde. Aber endlich verließ das erdrückende Gewicht meinen Körper, und ich konnte wieder frei atmen. »Was zur Hölle?«, stieß ich hervor und drehte mich zu meinen Angreifern um.
David, Jaxon und Julian hockten am Fuß meines Bettes, mit allgemein zufriedenen Grinsen auf den Lippen. »Ich wollte dich schon mal darauf vorbereiten, was dich von jetzt an erwartet«, sagte David mit Genugtuung.
Erstaunlich, eigentlich hätte ich eher Cole zugetraut, eine Aktion wie diese anzuheuern.
Außerdem … mit verengten Augen wandte ich mich Julian zu. »Hast du mir nicht gesagt, er wäre ein Morgenmuffel?« Ich deutete auf David.
»Ist er auch. Deswegen ist er heute extra früh aufgestanden«, erklärte Julian sichtlich zufrieden.
»Die Dinge, die ich für meinen neuen Mitbewohner tue.« David seufzte theatralisch.
»Ich hasse euch alle«, erwiderte ich und stand auf. Ein Blick auf die Uhr sagte mir, dass es gerade sieben war, aber mehr Schlaf würde ich wohl nicht bekommen.
David schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Dabei habe ich extra schon die Kaffeemaschine angemacht.«
Ich war gerade dabei, mir die Jeans anzuziehen, und hielt mitten in der Bewegung inne. Als ich zu den Jungs aufblickte, bildete sich nun auch auf meinem Gesicht ein Grinsen. »Vielleicht wirst du doch nicht so ein schlechter Mitbewohner sein.«
Nachdem ich mich angezogen und eine schnelle Tasse Kaffee getrunken hatte, begannen wir alles für meinen Umzug ins Wohnheim vorzubereiten. Viel würde ich nicht mitnehmen. Jaxon und ich hatten die Wohnung damals möbliert bezogen, daher blieb das meiste zurück. Trotzdem begannen sich die Kisten recht schnell im Wohnzimmer zu türmen. Klamotten, CDs, DVDs, Videospiele und Duschkram nahmen doch mehr Platz ein, als ich eingeplant hatte.
Um neun kamen Cole und Brittany dazu. Cole hatte einen Transporter organisiert, mit dem wir alle Sachen in einer Fuhre zum Wohnheim kriegen würden. Dort sollten bereits Connor, Preston und Katy auf uns warten, die beim Auspacken und Einräumen helfen wollten. Eigentlich auch Michaela, aber nach unserem Streit vorgestern plante ich sie eher nicht ein.
Erneut machten sich Schuldgefühle darüber in mir breit, wie ich sie die letzten Wochen behandelt hatte. Sie hatte es nicht verdient, dass ich ihr aus dem Weg ging. Es war mutig von ihr gewesen, mir von ihren Gefühlen zu erzählen. Dass es sie Überwindung gekostet hatte, war ihr anzusehen gewesen. Und ich? Hatte sie eiskalt abblitzen lassen, weil ich mir nicht anders zu helfen gewusst hatte.
Ich schüttelte diesen Gedanken ab und schob die Kiste in den Transporter. »Das war die Letzte«, sagte ich zu Cole.
Er schlug die Türen zu und verriegelte sie. »Bist du sicher, dass du nichts vergessen hast?«
»Ich gehe die Zimmer noch mal ab, aber von den großen Sachen ist alles verstaut, ihr könnt schon mal fahren.« Jaxon und ich würden nachkommen, nachdem wir abgeschlossen und die Schlüssel unserem Ex-Vermieter vorbeigebracht hatten.
Wir warteten, bis unsere Freunde außer Sichtweite gefahren waren, ehe wir zurück nach oben gingen. Ein letztes Mal betraten wir jedes Zimmer der Wohnung, die wir die letzten zweieinhalb Jahre gemeinsam bewohnt hatten. Es war eine gute Zeit gewesen, obwohl Jaxon es mir anfangs schwer gemacht hatte, sein Freund zu werden. Mittlerweile kannte ich den Grund dafür und konnte ihn besser verstehen. Umso schlechter fühlte ich mich, selber ein Geheimnis zu haben, das ich besser hütete als alles andere.
Wehmut kam über mich. Auch wenn mir das Leben im Wohnheim einige Vorzüge bot, würde ich Jaxon vermissen. Wir hatten uns eine Routine angeeignet, von der ich nicht wusste, ob sie auch mit David funktionieren würde.
Vermutlich, weil er selbst nicht gefragt werden wollte, hatte Jaxon nie in meiner Vergangenheit gebohrt. Erst, wenn ich von mir aus etwas erzählt hatte, hatte er nachgehakt. David hingegen kam mir nicht wie jemand vor, der ein Blatt vor den Mund nahm, wenn ihn etwas interessierte.
Ich war gespannt, wie lange es gut gehen würde.
Eine Hand landete auf meiner Schulter und ließ mich zusammenzucken. Ich hatte Jaxon gar nicht kommen hören. »Irgendwie seltsam, die Wohnung zum letzten Mal zu sehen.«
Mit hochgezogener Augenbraue sah ich ihn an. »Bereust du es schon, mit Emma zusammengezogen zu sein?«
»Kein Stück.« Er schüttelte entschieden den Kopf. »Aber ich musste gerade daran denken, dass dies meine erste Wohnung ohne elterliche Aufsicht war.«
»Meine auch. Und ich war vorher davon überzeugt, dass ich mehr Partys feiern als zu Vorlesungen gehen würde«, gestand ich. Das war die Vorstellung gewesen, die ich vom College gehabt hatte. Alle feiern und saufen den ganzen Tag und schaffen am Ende mit Ach und Krach die Prüfungen. Was natürlich nicht der Realität entsprach.
»Du?« Jaxon hörte sich entgeistert an. »Du steckst deine Nase öfter in Bücher als alle anderen, die ich kenne.«
Ertappt zuckte ich mit den Schultern. »Ich bin kein Genie, ich muss hart für meine Noten arbeiten.« Mein Traum war es, Kinderarzt zu werden, und ich hatte einen genauen Plan, wie ich das erreichen konnte. Dazu gehörte Disziplin, ich durfte mir keinen Fehltritt erlauben.
Jaxon verdrehte die Augen. »Sagt der mit dem Einser-Notenschnitt.«
»Wie gesagt, harte Arbeit.« Ich warf einen letzten Blick in mein Schlafzimmer, das ohne die Poster an den Wänden kalt und ungemütlich wirkte. Nicht mehr wie der Rückzugsort, der es mir die letzten Jahre gewesen war. »Komm, lass uns gehen.«
Wir lieferten unsere Schlüssel bei unserem Vermieter ab, der uns erst gehen ließ, nachdem er den Zustand der Wohnung inspiziert hatte und damit zufrieden war. Auf der Fahrt zum Wohnheim hingen wir beide unseren Gedanken nach. Meine Wehmut wurde langsam durch Aufregung ersetzt. Es fühlte sich an, als würde ich mit diesem Umzug ein neues Kapitel in meinem Leben beginnen, auch wenn sich eigentlich kaum etwas änderte. Aber es war auch ein Neuanfang, und meine Fingerspitzen kribbelten wegen all der Möglichkeiten, die in greifbarer Nähe lagen.
Am Wohnheim angekommen, hatten unsere Freunde den Transporter schon ausgepackt und alles in die Eingangshalle des Wohnheims gestellt, um die Kisten vor der Kälte und dem neu beginnenden Schneefall zu schützen. »Ihr wart ja fix«, lobte ich Cole, der mit Julian und David gemeinsam in der Tür stand.
»Wir hatten auch tatkräftige Hilfe.« Er ging einen Schritt zur Seite und gab den Blick frei auf Emma, Lucy, Katy und Michaela, die hinter ihm standen.
Mein Atem stockte, als ich Michaela erblickte. Sie trug eine Leggings und ein übergroßes Slytherin-T-Shirt. Ihre schwarzen Haare waren zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, und auf ihren nackten Armen konnte ich eine Gänsehaut entdecken, die sicher von der Kälte kam. »Bist du verrückt? Du holst dir noch den Tod«, entwich es mir, bevor ich wusste, was ich da sagte.
Michaelas Augen verengten sich. »Ich bin hier, um dir zu helfen, und beim Schleppen ist mir warm geworden. Aber ich kann auch gehen, wenn dir das alles nicht passt.« Sie versuchte sich an mir vorbeizuschieben, aber ich hielt sie mit einer Hand an ihrer Hüfte auf. Nicht nur, dass sie irgendwo drinnen eine Jacke oder einen Pulli haben musste, ohne den sie sich unterkühlen würde, ich wollte auch einfach nicht, dass sie ging.
Ich trat einen Schritt auf sie zu, bis uns nur noch wenige Millimeter trennten, und legte auch meine andere Hand an ihre Hüfte.
»Es tut mir leid, bitte bleib«, raunte ich ihr zu.
Aus dunklen Augen, die von diesen unfassbar langen und dichten Wimpern umrahmt waren, sah sie zu mir auf. Ihr Blick hielt mich gefangen, und ein Beben ging durch ihren Körper, das von meinem wiedergegeben wurde. Für einen Moment konnte ich sie nur anstarrten und daran denken, wie sehr ich sie wollte. Dann räusperte sich Cole hinter mir, und der Bann war gebrochen.
Michaela wandte sich ab und hievte eine Kiste hoch. Ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen, ging sie die Treppe hinauf, während ich ihr mit wild klopfendem Herzen und kribbelnden Fingern hinterhersah.
Cole schob mich eher unsanft von hinten an. »Beweg dich, Mann. Sind immerhin deine Sachen.«
Zwei Stunden später hatten wir alle Kisten hochgetragen und die meisten davon bereits ausgepackt. Brittany und Katy hatten es sich zur Aufgabe gemacht, meinen Kleiderschrank einzuräumen. Ich war nicht sicher, ob ich danach jemals etwas wiederfinden würde. Cole, Connor und Preston hatten meine Playstation angeschlossen und zockten darauf F1-Racer, wobei die anderen ihnen zusahen.
Nur David war in der Küche und packte die Lebensmittel aus, die ich mitgebracht hatte. Ich gesellte mich zu ihm. »Habt ihr eine bestimmte Ordnung im Kühlschrank?«
Irritiert zog er die Augenbrauen zusammen. »Eine was?«
»Na, hatte jeder sein eigenes Fach, und durfte keiner dem anderen etwas wegessen und so ein Kram?«
David sah mich an, als hätte ich sein Erstgeborenes dem Teufel versprochen. »Dein Ernst? War das so bei Jaxon und dir?«
Lachend schüttelte ich den Kopf. »Nein, zum Glück nicht. Aber das sind diese College-Horrorstorys, wegen denen ich nie ins Wohnheim wollte.«
David schüttelte sich. »Ich hab gedacht, das wären nur Mythen, wie man sie Kindern erzählt, damit sie ausreichend Respekt vor etwas haben. Jedenfalls brauchst du dir keine Sorgen darüber zu machen. So lief das bei uns nie. Irgendwer war halt einkaufen, jeder hat davon gegessen und am Ende des Monats haben wir Kassensturz gemacht.«
Erleichtert atmete ich aus. »Gott sei Dank. War bei Jaxon und mir genauso. Ich finde alleine die Vorstellung ätzend, dass jeder kleine Zettelchen mit seinem Namen an die Lebensmittel klebt, die ihm gehören.«
David lachte. »Meine Mom sagt, so läuft es bei ihr im Büro. Und dann klauen doch alle Sachen von den anderen und kleben die Zettelchen einfach innen an die Kühlschrankwand.«
»Mies, wenn man dann selber nichts mehr zum Essen hat.«
»Es muss wohl einen Kreislauf heraufbeschworen haben. Wem etwas weggegessen wird, der nimmt sich einfach das Nächstbeste, was ihm zusagt. Und so weiter.«
»Zum Glück werde ich nie in einem Büro arbeiten.«
»Meinst du echt, in einem Krankenhaus läuft das anders?«
»Ich bin dann der Chefarzt und leite meine eigene Station«, erklärte ich. »Wenn mir jemand was wegisst, wird er einfach gefeuert.«
Bevor David dazu kam, mir zu antworten, hörten wir lautes Geschrei aus meinem Schlafzimmer, gefolgt von hämischem Lachen.
Synchron drehten wir uns in die Richtung. »Was machen die Mädels da?«, fragte David.
»Ich weiß nicht, ob ich das wissen will.«
Trotzdem siegte meine Neugier, und wir gingen nachsehen, was der Lärm bedeutete. Katy und Brittany lagen in einem Knäuel auf meinem Bett, eingewickelt in ein Bettlaken. Als hätten sie das Bett beziehen wollen und sich dann mittendrin umentschieden, lieber damit zu kämpfen. Auf den ersten Blick wusste ich nicht, wo Brittany aufhörte und Katy begann.
»Was treibt ihr hier?«, fragte David schmunzelnd.
»Wonach sieht es denn aus?«, ächzte Brittany.
»Wrestling?« Schlamm-Catchen ohne Schlamm würde mir noch einfallen, aber daran sollte ich bei diesen beiden Frauen, die mit Freunden von mir liiert waren, besser nicht denken.
»Wir wollten dein Bett beziehen.« Katy versuchte sich aus dem Kokon zu befreien, was ihr mehr schlecht als recht gelang.
»Ich hab euch gleich gesagt, dass das so nichts wird«, erklang plötzlich Michaelas Stimme aus der Ecke meines Zimmers. Bisher hatte ich sie gar nicht wahrgenommen, doch im Nu waren all meine Sinne auf sie ausgerichtet. Mit verschränkten Armen lehnte sie an meinem Schrank und betrachtete amüsiert das Geschehen vor ihr.
»Ich wusste gar nicht, dass du auch hier bist.« Etwas Schlaueres fiel mir leider nicht ein, da ihre bloße Anwesenheit mein Logikzentrum erneut ausgeschaltet hatte.
»Computerspiele finde ich langweilig«, entgegnete Michaela. Sie war auch grandios schlecht darin. Noch gut konnte ich mich daran erinnern, wie sie einmal mit mir Mario Kart gezockt und auf ganzer Linie versagt hatte. Selbst nach einer Stunde hatte sie die Steuerung über die einzelnen Knöpfe noch nicht rausgehabt und den Controller wutentbrannt in die Ecke gepfeffert.
»Ich weiß.« Ich starrte sie weiter an, war wie so oft gefesselt von ihrem Anblick. Für einen Moment hielt sie meinem Blick stand, ehe sie sich abwandte. Es fühlte sich wie eine Abfuhr an und ließ mich frösteln.
Ich hasste es, wie wir nicht mehr normal miteinander umgehen konnten. Dass plötzlich diese schier unüberwindbare Mauer zwischen uns existierte. Es war ganz allein meine Schuld, trotzdem wünschte ich mir die Zeit zurück, als ich mit Michaela reden konnte, ohne jedes Wort dreimal zu hinterfragen. Die Leichtigkeit war uns abhandengekommen, und sie hatte ein schmerzhaftes Loch in meinem Innern hinterlassen. Ich machte einen Schritt auf sie zu, ohne einen Plan zu haben, was ich zu ihr sagen wollte.
Michaela schien mich sofort zu bemerken, denn sie versteifte sich und betrachtete mich misstrauisch aus dem Augenwinkel.
»Können wir reden?«, hörte ich mich sagen, obwohl ich meinem Mund nicht den Befehl dazu gegeben hatte.
Sie schnaubte. »Was? Hier?« Sie deutete auf Katy, Brittany und David, die uns mittlerweile interessiert beobachteten.
»Wir gehen schon.« Katy sprang vom Bett und zerrte Brittany und David praktisch hinter sich her. Mit einem Knall fiel die Tür zu, und die anschließende Stille war nahezu ohrenbetäubend. Michaela betrachtete mich erwartungsvoll, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich beginnen sollte. In meinem Kopf herrschte gähnende Leere.
»Du wolltest reden, also rede.« Michaela machte einen Schritt zurück, als wollte sie mehr Abstand zwischen uns bringen.
»Es tut mir leid, dass ich dich ignoriert hab. Das war nicht meine Absicht, aber ich wusste einfach nicht, wie ich mit dir umgehen sollte.«
»Ganz normal vielleicht? Wie man mit Freunden eben umgeht. Mit Emma und den anderen schaffst du das doch auch.«
Aber Michaela war nicht wie die anderen. Sie brachte mich durcheinander, forderte mich ständig heraus und hatte sich in meinen Gedanken festgekrallt. Mein Herz wollte mehr als Freundschaft, aber mein Verstand mahnte mich zur Vorsicht. Je näher ich sie an mich heranließ, desto schmerzhafter würde es werden, wenn sie sich von mir abwandte. Wenn sie wieder auf die Beine kam und feststellte, dass ich nur ein netter Zeitvertreib war. Wie es mit Jaxon auch schon gewesen war.
Doch mit jedem weiteren Blick von ihr, der bis auf den Grund meiner Seele vorzudringen schien, bröckelte ein weiteres Stück von der Mauer ab, hinter der ich mich versteckte.
»Ich weiß, es tut mir leid.« Ich wrang meine Hände, als ich darüber nachdachte, was genau ich wollte. »Du fehlst mir, und ich vermisse es, mit dir zu reden. Können wir noch mal von vorne beginnen? Ich verspreche dir auch, mich zu bessern.«
Michaela betrachtete mich kritisch, als wollte sie eine Lüge in meinen Worten entlarven. Ich hielt absolut still, wagte nicht einmal zu atmen oder wegzusehen, während sie ihr Urteil fällte. Sekunden zogen sich zu einer kleinen Ewigkeit, und mir brach schon der Schweiß aus, als sie endlich nickte.
»Okay, abgemacht. Du bekommst noch eine Chance. Versau sie nicht wieder.« Sie nickte mir kurz zu und verließ dann, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen, das Schlafzimmer und kehrte zu den anderen zurück.
Kapitel 3
Michaela
Es dauerte fast zehn Minuten, bis Marc mir ins Wohnzimmer folgte. Und selbst dann sah er noch ziemlich mitgenommen aus. Es erfüllte mich mit einer fast perversen Zufriedenheit, dass ich ihn derart aus dem Konzept gebracht hatte. Ich würde ihm eine Chance geben, mir zu beweisen, dass ihm meine Freundschaft wichtig war. Aber es würde von ihm ausgehen müssen. Ich wollte, dass er sich mal wieder bei mir meldete, nur um zu fragen, wie es mir ging. Dass wir uns wieder auf einen Kaffee trafen, wie wir es früher so oft getan hatten. Auch wenn die Abfuhr mich am meisten aus der Bahn geworfen hatte, fehlten mir vor allem Marcs Freundschaft und die Gespräche mit ihm.
Marc erntete einige skeptische Blicke, als er sich zu uns gesellte, aber niemand fragte ihn, was los war. Mittlerweile glaubte ich, dass unsere Freunde insgeheim darauf warteten, dass wir endlich zusammenkamen oder alles in einem großen Streit endete.
»Wollen wir Pizza bestellen?«, fragte Jaxon in die eingetretene Stille hinein. Viel zu laute Zustimmung kam von allen Seiten, als wäre jeder froh, dieser seltsamen Situation zu entkommen. Wie von Zauberhand zog David das Menü einer Pizzeria hervor.
Während wir auf unser Essen warteten, zockten die Jungs irgendein Rennspiel auf der Konsole. Obwohl ich damit nicht wirklich etwas anfangen konnte, ließ ich mich von der ausgelassenen Stimmung mitreißen. Emma hatte für uns Mädels eine Flasche Sekt besorgt, und diesmal lehnte ich das Glas nicht ab. Alkohol war nie mein Problem gewesen. Ich hatte nie viel getrunken, weswegen es mir auch nicht schwergefallen war, nach meinem Entzug darauf zu verzichten. Das Problem mit Alkohol war nur, dass er die Hemmschwelle senkte und ich Angst gehabt hatte, dadurch eher wieder zu Drogen greifen zu wollen. Aber ein Gläschen unter Freunden konnte sicher nicht schaden.
Als es endlich an der Tür klingelte, sprang Marc auf, um den Pizzaboten zu bezahlen. Mit zwei Familienpizzen kam er zurück und stellte sie auf den Tisch.
»Ein Dank an den Spender.« Cole prostete Marc mit seiner Bierflasche zu.
»Ich habe zu danken. Ohne euch hätte ich weder so schnell eine neue Bleibe gefunden, noch wäre der Umzug so fix vonstattengegangen.«
»Für Speis und Trank kannst du uns jederzeit buchen.« Coles Grinsen wurde eindeutig zweideutig.
»Dein Ernst?«, fragte David kopfschüttelnd.
»Ich möchte da gleich Einspruch einlegen«, stimmte Julian zu. »Wenn du Hilfe beim Umzug, Renovieren und solchen Dingen brauchst, bin ich gerne zur Stelle. Bei anderen… handwerklichen Dingen frag doch am besten …« Sein Blick wanderte durch die Runde und blieb unweigerlich an mir hängen. Julian öffnete bereits den Mund, als ich langsam den Kopf schüttelte. Er zuckte mit den Schultern. »Ja, keine Ahnung, aber an der TU wird es sicherlich einige willige Damen geben.«
Erleichtert atmete ich aus. Das hätte mir gerade noch gefehlt, dass Julian meine nicht vorhandene Beziehung zu Marc ins Rampenlicht rückte, nachdem wir uns gerade erst wieder zusammengerauft hatten.
***
Lucy wartete bereits vor der Tür, als ich in ihre Straße einbog. Obwohl Sonntag war, hatte ich eine Stunde gebraucht, um nach Somerton zu fahren. Dem Vorort, in den Lucy zusammen mit Emma, Jaxon und Julian gezogen war. Hier fühlte man sich fast nicht mehr wie in einer Großstadt. Die Häuser standen ein Stück von der Straße entfernt und hatten einen kleinen Garten hintenraus. Nur die Hochhäuser der Skyline in der Ferne erinnerten daran, dass wir uns noch immer in Philadelphia befanden.
Lucy trug eine Reithose, Stiefel und eine gelbe Winterjacke. Spencer saß schwanzwedelnd neben ihr. Meine Lippen verzogen sich bei seinem Anblick zu einem Lächeln. Wie alle anderen hatte Spencer auch mich sofort um den kleinen Finger gewickelt.
Lucy riss die Beifahrertür auf, kaum dass ich am Straßenrand anhielt. »Hi, Michi, schon aufgeregt?«
»Ein wenig.« Ich hatte Angst, entweder nicht aufs Pferd draufzukommen oder direkt auf der anderen Seite wieder runterzufallen. »Willst du Spencer mitnehmen?«
»Ja, meinst du, das wäre okay? Julian ist heute auch unterwegs, und ich will ihn in der neuen Umgebung noch nicht so lange alleine lassen.« Sie kaute auf ihrer Unterlippe und sah mich nachdenklich an.
»Klar, wieso nicht. Solange er die Pferde nicht fürchtet.« Früher hatte es einige Hunde auf dem Pferdehof gegeben, ich konnte mir nicht vorstellen, dass jemand damit ein Problem haben würde.
Lucy riss die Hintertür auf und legte eine Decke auf den Rücksitz. »Vor Pferden hat er keine Angst, das sollte also okay sein.« Sie bedeutete Spencer, auf die Rückbank zu springen, und machte ihn mit einem speziellen Haltegurt fest, den sie mitgebracht hatte.
Dann stieg sie neben mir ein. »Wir können los.«
»Habt ihr euch schon gut eingelebt?« Ich nickte in Richtung des Hauses, das sie mit Julian, Jaxon und Emma erst vor einer Woche bezogen hatte, während ich den Wagen auf die Straße lenkte.
»Puh, gute Frage.« Lucy lachte kurz. »Es herrscht noch das totale Chaos. Überall stehen Kisten rum, die ausgepackt werden müssen. Das Gästezimmer muss noch gestrichen werden, was wir eigentlich dieses Wochenende machen wollten, aber durch Marcs Umzug ist daraus nichts geworden. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber grundsätzlich ist es toll.« Sie strahlte über das ganze Gesicht.
»Die Hauptsache ist, dass ihr euch wohlfühlt. Den Rest könnt ihr nach und nach erledigen.«
»Das stimmt. Ich habe mich übrigens auch dafür entschieden, endlich meinen Führerschein zu machen. Die Praxis liegt zwar eigentlich nicht so weit entfernt, aber mit dem Bus muss ich zweimal umsteigen, was ganz schön nervig ist.«
»Lucy, das ist klasse, ich bin stolz auf dich.« Sie hatte mir mal erzählt, sich nie an den Führerschein gewagt zu haben, aus Angst, bei der theoretischen Prüfung durchzufallen. Durch ihre erst kürzlich überstandene Amnesie konnte sie sich manche Dinge schlecht merken.
Lucy zuckte mit den Schultern, als wäre es keine große Sache. »Wie lange ist es eigentlich her, seit du geritten bist?«, wechselte sie das Thema.
»Ich war noch klein, vielleicht acht oder neun. Mein Dad war noch bei uns. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie viele Stunden ich damals genommen habe, aber ich kann mich noch an das Gefühl der Freiheit erinnern, wenn ich ausgeritten bin.«
»So geht es mir auch immer. Und genau das ist es auch, was ich vermisse, seit ich in Philadelphia bin.« Lucy betrachtete mich nachdenklich. »Hast du noch Kontakt zu deinem Dad?«
»Nur sporadisch.« Ich schob mir eine Haarsträhne hinter das Ohr. »Als Dad uns damals verlassen hat, habe ich ihm die Schuld dafür gegeben, die Familie zerstört zu haben. Er wollte den Kontakt zu mir aufrechthalten, aber ich war so sauer auf ihn, weil wir damals alles verloren haben. Wir mussten aus dem Haus in eine kleine Wohnung umziehen, ich musste die Schule wechseln und habe alle meine Freunde verloren. In meinen Augen hat er mein Leben zerstört.«
Lucy schenkte mir ein mitfühlendes Lächeln. »Wie alt warst du damals?«
»Zehn.« Noch heute sehe ich ihn vor mir, wie er sein Hab und Gut erst in seinen Koffer und, als dieser voll war, ohne Ordnung in den Kofferraum seines Autos geschmissen hatte, um bloß so schnell wie möglich verschwinden zu können. Während Mom teilnahmslos zugeschaut hatte, als wäre es ihr egal, hatte ich mit meinem Bitten und Flehen die halbe Nachbarschaft auf die Straße getrieben. Dass alle Dads lieblosen Abgang ‒ er hatte sich nicht einmal richtig von mir verabschiedet ‒ mitbekommen hatten, war rückblickend noch viel schwerer zu verkraften gewesen.
»Eine Trennung kann für ein Kind nie einfach sein«, sagte Lucy mitfühlend und blies sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
Schulterzuckend sah ich in den Rückspiegel, um das Auto vor uns überholen zu können. »Manchmal habe ich das Gefühl, als würde ich von allen verlassen werden. Dad, Jaxon, Marc.«
Lucy lehnte sich gegen die Beifahrertür und sah mich direkt an. »Kann ich fragen, was genau bei dir und Marc vorgefallen ist? Als ich euch kennengelernt habe, wart ihr schon nicht mehr richtig zusammen.«
»Wir waren nie richtig zusammen«, erklärte ich und versuchte das schmerzhafte Ziehen in meinem Brustkorb zu ignorieren. »Marc und ich hatten so eine Art Deal abgeschlossen. Ich sollte herausfinden, was ich mir von der Zukunft wünsche und was mich glücklich macht, dann würde er mir dabei helfen, es zu erreichen. Das hat anfangs auch gut funktioniert. Während ich im Entzug war, hat er mir immer wieder E-Mails mit Dingen geschickt, von denen er dachte, sie könnten mein Interesse wecken. Hobbys, die mir gefallen könnten, oder Bücher und so was. Es war schön zu wissen, dass er an mich dachte, aber ich hätte nie vermutet, dass mehr dahinterstecken könnte.« Unwillkürlich breitete sich ein Lächeln auf meinen Lippen aus, als ich daran zurückdachte. Marcs E-Mails waren mein tägliches Highlight gewesen, weil seine Vorschläge immer gut durchdacht, dabei aber lustig verfasst waren.
Ich unterdrückte ein Lächeln und redete weiter. »Als ich aus dem Entzug entlassen wurde, hat er vor der Klinik auf mich gewartet, obwohl ich ihm gesagt habe, er müsse das nicht tun. Aber er wollte nicht, dass ich alleine in eine verlassene Wohnung zurückkomme. In den folgenden Wochen haben wir uns häufig gesehen. Wir sind nicht gleich miteinander ins Bett gesprungen, sondern es hat sich zuerst eine Freundschaft entwickelt, ehe ich Gefühle für ihn bekam. Anfangs konnte ich sie auch gar nicht richtig deuten. Ich war noch nie zuvor verliebt und habe das Herzrasen und die Schmetterlinge, die ich in Marcs Gegenwart verspürt habe, zuerst mit Nachwirkungen des Entzugs verwechselt.«
Lucy lächelte leicht. »Das kenne ich. Ich wusste zuerst auch nichts mit dem Gefühlschaos anzufangen, das Julian in mir ausgelöst hat. Aber ich wollte es vermutlich auch nicht wahrhaben.«
Ich schnaubte. »Ich auch nicht. Mich zu verlieben, war so ziemlich das Letzte, wonach mir der Sinn stand.«
»Aber was ist dann passiert?«
»Ich habe keine Ahnung.«
Mit verengten Augen legte Lucy den Kopf schief. »Aber du musst doch irgendwas vermuten.«
»Nein, wirklich nicht. Von einem auf den anderen Tag war alles anders. Mittwochs waren wir noch im Café, da war alles in Ordnung, und Donnerstag hat Marc zum ersten Mal unsere Verabredung abgesagt und mich auf nächste Woche irgendwann vertröstet. Von da an war er kühl und reserviert und hat nur noch so viel Zeit wie absolut nötig mit mir verbracht. Ich dachte zuerst, er würde denken, ich hätte kein Interesse an ihm, aber als ich ihm meine Gefühle gestanden habe, wurde es noch schlimmer.«
Rechts von uns sah ich die Zufahrt zum Pferdehof, und meine trüben Gedanken verpufften wie eine Seifenblase. Freudige Aufregung machte sich in mir breit und auch Lucy neben mir klatschte vergnügt in die Hände. »Sind wir da?«
»Sind wir.« Ich bog auf den vereisten Schotterweg ab, der zwischen zwei leeren Koppeln hindurchführte. Zwei Hunde spielten vor dem Haus, denen die Kälte nichts auszumachen schien. Bei ihrem Anblick begann Spencer zu kläffen und aufgeregt mit dem Schwanz zu wedeln.
Ich parkte meinen Toyota neben dem schwarzen Pick-up, als die Tür zum Haus sich öffnete und eine Frau im mittleren Alter heraustrat. Sie trug eine dicke Wollmütze, unter der vereinzelte blonde Strähnen herauslugten, und kam zielsicher auf mein Auto zu.
»Du musst Michaela sein, ich bin Madison.« Für eine so kleine Person hatte sie einen überraschend kräftigen Händedruck.
»Freut mich. Das ist meine Freundin Lucy.«
Lucy winkte kurz. »Ich habe meinen Hund Spencer dabei. Ist es okay, wenn ich ihn rauslasse?« Sie deutete über ihre Schulter zu den spielenden Hunden.
»Klar. Nemo und Dori freuen sich immer über Gesellschaft und kommen auch mit den meisten Hunden klar.«
»Nemo und Dori?«, fragte ich lachend, während Lucy Spencer, der sofort auf die beiden zusagte, aus dem Auto ließ.
»Meine jüngste Tochter war gerade im Findet-Nemo-Fieber, als wir die beiden bekommen haben. Ich hatte keine andere Wahl, als sie so zu nennen.«