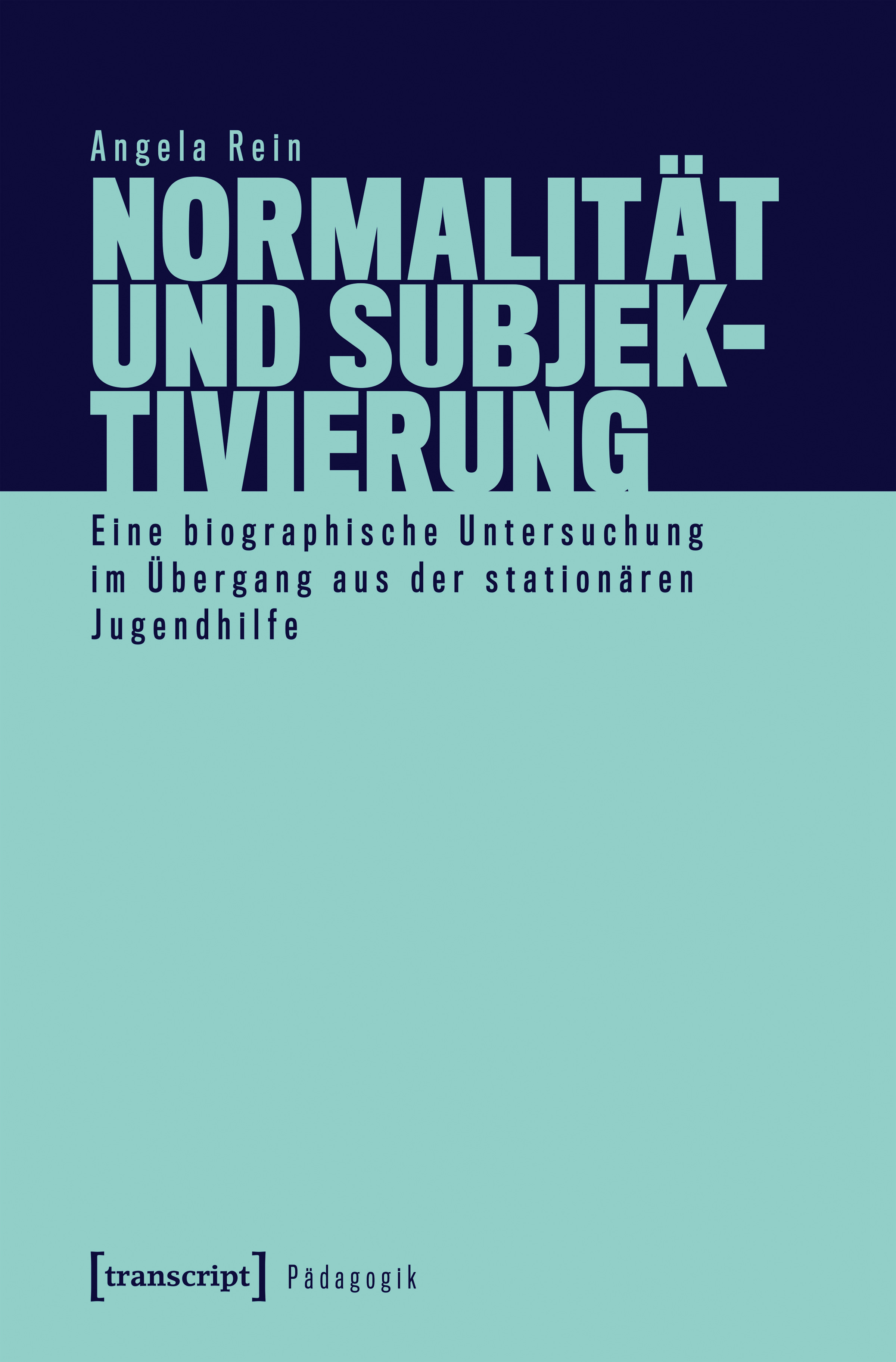
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pädagogik
- Sprache: Deutsch
Welche Bedeutungen haben Normalitätskonstruktionen von Care Leaver*innen aus biographischer Perspektive? Wie wird in der stationären Jugendhilfe Biographie konstruiert? Welches widerständige Potenzial entwickeln die jungen Erwachsenen und welche Rolle spielen hierbei Differenz- und Machtverhältnisse? Auf der Basis von biographischen Erzählungen gibt Angela Rein Einsichten in Subjektivierungsprozesse in der stationären Jugendhilfe. Ihre adressat*innenbezogene und subjektivierungstheoretisch inspirierte Studie leistet damit einen zentralen Beitrag zu bislang wenig beachteten Aspekten der Care-Leaver*innen-Forschung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 811
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Angela Rein (Dr. rer. soc.) arbeitet am Institut Kinder- und Jugendhilfe der Hochschule für Soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Ihre Arbeitsund Forschungsschwerpunkte sind Kinder- und Jugendhilfe, Hilfen zur Erziehung, Übergänge aus der stationären Jugendhilfe, Queer Theory und Diversität in der Sozialen Arbeit, Adressat*innenforschung sowie Biographieforschung.
Angela Rein
Normalität und Subjektivierung
Eine biographische Untersuchung im Übergang aus der stationären Jugendhilfe
Diese Studie wurde 2018 als Dissertation an der Universität Tübingen angenommen.
Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-Derivs 4.0 Lizenz (BY-NC-ND). Diese Lizenz erlaubt die private Nutzung, gestattet aber keine Bearbeitung und keine kommerzielle Nutzung. Weitere Informationen finden Sie unterhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de Um Genehmigungen für Adaptionen, Übersetzungen, Derivate oder Wiederverwendung zu kommerziellen Zwecken einzuholen, wenden Sie sich bitte an [email protected] Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.
© 2020 transcript Verlag, Bielefeld
Umschlaggestaltung: Maria Arndt, Bielefeld Lektorat: Anja Lochner Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar Print-ISBN 978-3-8376-5170-6 PDF-ISBN 978-3-8394-5170-0 EPUB-ISBN 978-3-7328-5170-6https://doi.org/10.14361/9783839451700
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Besuchen Sie uns im Internet: https://www.transcript-verlag.de Unsere aktuelle Vorschau finden Sie unter www.transcript-verlag.de/vorschau-download
Inhalt
Dank
Einleitung
Aufbau der Arbeit
Teil IKontext der Untersuchung
1Das Feld der stationären Jugendhilfe
1.1Forschungen mit Adressat*innenperspektive
1.2Care-Leaver-Debatten in den Hilfen zur Erziehung
1.3Zur Thematisierung von Differenz- und Ungleichheitsverhältnissen in der Sozialen Arbeit
1.4Normalität und Normalisierung in der Sozialen Arbeit
Teil IITheoretische und methodologische Rahmung
2Theoretische und methodologische Perspektiven
2.1Theoretische Implikationen des Biographiekonzeptes
2.2Übergangstheoretische Perspektiven
2.3Subjektivierung, Macht und Normalität bei Judith Butler
2.4Intersektionalität als Analyseperspektive
2.5Zusammenführung – Zur Analyse von Normalitätskonstruktionen auf verschiedenen Ebenen – Heuristische Perspektive der Arbeit
3Methodische Herangehensweise
3.1Grounded Theory als Forschungsstil
3.2Biographisch-narratives Interview als Erhebungsmethode
3.3Darstellung des Forschungsprozesses
Teil IIIEmpirische Analysen
4Einführung in die Einzelfallanalysen
5Falldarstellung Elif Yıldız
5.1Rekonstruktion biographischer Ereignisse – Biographisches Kurzporträt
5.2Anbahnung des Interviews und Reflexion der Interviewsituation
5.3Konstruktion der Biographie – Übersicht Interviewverlauf
5.4Feinanalyse der Anfangssequenz – Rahmungen Interviewsituation
5.5Biographie bis zur Jugendhilfe – »Am (.) Gymnasium ist eigentlich alles gut gegangen ich bin sehr eine Fleißige auch interessiert so«
5.6Übergang in die Jugendhilfe – »Zufälligerweise am Tag der Frau […] bin ich von zu Hause weg«
5.7Biographie in der stationären Jugendhilfe – »Dort bin ich gewesen, fü:nfeinhalb Jahre lang«
5.8Entwicklungen in und nach der stationären Jugendhilfe – »Und äh::m möchte dieses Jahr im September dann an der Uni Deutsch und Geschichte studieren«
5.9Jugendhilfeerfahrungen führen zu Ausgrenzungserfahrungen – »Ich habe wie so das Gefühl gehabt=ich kriege einen Stempel aufgedrückt, so Opfer«
5.10Fazit Fall Elif Yıldız – Zwischen Ausgrenzung, Handlungsmacht und Widerstand
6Falldarstellung Celina Schweizer
6.1Rekonstruktion biographischer Ereignisse – Biographisches Kurzporträt
6.2Anbahnung des Interviews und Reflexion der Interviewsituation
6.3Konstruktion der Biographie – Übersicht Interviewverlauf
6.4Feinanalyse der Anfangssequenz – Rahmungen Interviewsituation
6.5Biographie bis zur Jugendhilfe – »Ja am Anfang von meiner Zeit ist eigentlich alles okay gewesen«
6.6Biographie in der stationären Jugendhilfe – »Ja sie sind glaube recht mit mir am Anschlag gewesen«
6.7Übergänge nach der Jugendhilfe – Fortsetzung des Wechselspiels aus Abbrüchen und Neuanfängen – »Ja habe sehr viel (.) Selbstzweifel mit mir«
6.8Fazit Fall Celina Schweizer – Wechselspiel aus Abbrüchen und Widerstand
7Falldarstellung Nazar Sautin
7.1Rekonstruktion biographischer Ereignisse – Biographisches Kurzporträt
7.2Anbahnung des Interviews und Reflexion der Interviewsituation
7.3Konstruktion der Biographie – Übersicht Interviewverlauf
7.4Feinanalyse der Anfangssequenz – Rahmungen Interviewsituation
7.5Biographie bis zur Jugendhilfe – Vom simplen Leben zum Anfang »meiner Heimgeschichte«
7.6Biographie in der Jugendhilfe – »Sie haben wirklich mein Leben konstruiert«
7.7Fazit Fall Nazar Sautin – Biographie in zwei Teilen und Zonen von Normalität
8Biographien zwischen Prozessen der ›Ent-Normalisierung‹ und ›Ringen um Normalität‹
8.1Erfahrungen der (Ent-)Normalisierung im Kontext von stationärer Jugendhilfe aus biographischer Perspektive
8.2›Ringen um Normalität‹ – Strategien der (Selbst-)Normalisierung
8.3Fazit Biographien zwischen ›(Ent-)Normalisierung‹ und ›Ringen um Normalität‹
9Ausblick
9.1Methodologisches Resümee
9.2Perspektiven auf mögliche Veränderungen: Dekonstruktion von hegemonialen Normalitäten
Literatur
Anhang
Interviewleitfaden
Transkriptionszeichen
Dank
Die Arbeit ist in einem mehrjährigen Prozess entstanden, der trotz vieler Stunden alleine am Schreibtisch gleichzeitig von vielen Menschen unterstützt und getragen wurde. Ohne diese soziale Dimension des Projekts und die verschiedenen Formen des Austausches und der Unterstützung wäre die Arbeit für mich nicht denkbar gewesen.
Zuallererst möchte ich meinen Betreuerinnen Barbara Stauber und Bettina Dausien danken. Sie haben mich wunderbar begleitet, Fragen gestellt, konstruktive Ideen eingebracht und waren dabei immer sehr ermutigend und wertschätzend. In den verschiedenen Diskussionen konnte ich viele Denkrunden und Bildungsprozesse durchlaufen. Barbara Stauber hat mich bereits im Studium begeistert für theoretische Auseinandersetzungen. Sie hat auch dazu beigetragen, dass ich überhaupt auf die Idee kam, Promovieren als eine interessante Option zu betrachten.
Besonderen Dank will ich den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aussprechen, die sich mit mir getroffen und sich die Zeit genommen haben, ihre Geschichten zu erzählen. Ihre Offenheit und die inspirierenden Erzählungen haben diese Arbeit erst möglich gemacht. Beim Zugang ins Feld hatte ich sehr viel Unterstützung. Hier danke ich herzlich meinen Vertrauenspersonen, die auf die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zugegangen sind, sie für eine Teilnahme angefragt und viel in den Kontaktaufbau investiert haben.
Die Herbstwerkstatt von Bettina Dausien, Paul Mecheril und Daniela Rothe war für mich über einige Jahre ein wichtiger Ort der intensiven Beschäftigung mit qualitativer Forschung. Herzlichen Dank auch an die Teilnehmenden der Kolloquien von Barbara Stauber und Bettina Dausien für die Rückmeldungen zu meinen Beiträgen. Im Rahmen des Mobilitätsstipendiums doc.mobility des Schweizer Nationalfonds konnte ich einen wichtigen Teil der Arbeit fertigstellen. Die Kolleg*innen am Lehrstuhl für Pädagogik der Lebensalter an der Universität Wien haben mich hierbei herzlich empfangen, und ich konnte mich in einen sozialen und sehr bereichernden Arbeitszusammenhang einklinken. In diesem Zusammenhang gebührt auch meinen Kolleg*innen an der Hochschule für Soziale Arbeit (FHNW) Dank für die Möglichkeit, mich beurlauben zu lassen, und für die Übernahme von Aufgaben währenddessen. Insbesondere Stefan Schnurr hat mich unterstützt während der Jahre.
Mit Katharina Mangold verbrachte ich entspannte Arbeitsurlaube und konnte hier befreit vom Alltag meine Arbeit vorantreiben und mich intensiv mit ihr austauschen. Auch die gemeinsamen Artikel waren schöne Formen des gemeinsamen Denkens. Sarina Ahmed hat mich während der gesamten Dauer der Arbeit freundschaftlich begleitet. Unsere gemeinsamen Diskussionen und auch die Zusammenarbeit haben mich beflügelt und angeregt für die Fragen, die in der Arbeit stecken.
Für Rückmeldungen und Diskussionen zu Texten der Arbeit gilt mein Dank Sarina Ahmed, Natascha Khakpour, Katharina Mangold, Christine Riegel, Magdalene Schmid, Nadja Thoma und nicht zuletzt Mirjana Zipperle, mit der ich schon seit langer Zeit freundschaftlich fachliche Diskussionen und Denkprozesse teile. Bei der Auswertung von Daten gilt mein Dank insbesondere Lalitha Chamakalayil, Magdalene Schmid und Wiebke Scharathow sowie Clemens Fellman für die Transkription. Ganz herzlichen Dank für das geduldige Lektorat der Arbeit an Anja Lochner. Wichtige Impulse in Bezug auf die Gestaltung dieser Lebensphase habe ich von Gerhilt Haak erhalten, der ich hierfür großen Dank aussprechen will.
Ein besonderer Dank gilt meinen Eltern Annely und Erich Rein für ihre liebevolle Unterstützung und ihr Vertrauen in mich.
Zuletzt möchte ich Christine Riegel danken, die immer genau richtig da war und mit einer guten Portion Gelassenheit diese Zeit mitgetragen hat.
Einleitung
In der vorliegenden Untersuchung geht es um die Frage nach den Bedeutungen von Normalitätskonstruktionen in den Biographien von jungen Menschen, die in der stationären Jugendhilfe aufgewachsen sind und sich im Übergang ins Erwachsenalter befinden. In internationalen Fachdiskursen werden diese jungen Menschen als ›Care Leaver‹ (vgl. Stein 2006) bezeichnet. Zahlreiche internationale Studien zeigen auf, dass Care Leaver im Vergleich zu ihren Peers im Übergang ins Erwachsenenalter benachteiligt sind. Gleichzeitig sind Übergänge ins Erwachsenenalter bei allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch gesellschaftliche hegemoniale Macht- und Ungleichheitsverhältnisse geprägt (vgl. Ahmed et al. 2013; Thielen 2014).
Die Frage nach den Normalitätskonstruktionen rekonstruiere ich aus der Perspektive der Subjekte, die in der stationären Jugendhilfe gelebt haben. Diesen Rekonstruktionen liegt ein gesellschaftstheoretisch gerahmtes Verständnis von Normalitätskonstruktionen zugrunde. Normalität wird von Dausien und Mecheril als machtvolle Ordnung verstanden, »die das Individuum justiert und ihm jene Selbstjustierung (ganz ›natürlich‹) aufnötigt, in der es sich in ein Subjekt verwandelt, handlungsfähig und unterworfen in einem Atemzug« (Dausien/Mecheril 2006, S. 163). Dieser Prozess der Verwandlung von Individuen in Subjekte als Unterworfene und Handlungsfähige zugleich wird Subjektivierung genannt (vgl. Butler 2001).
Gleichzeitig geht es mir auch darum herauszuarbeiten, welche Rolle Institutionen der stationären Jugendhilfe in Bezug auf die Frage nach Normalität aus biographischer Perspektive spielen. Auch in den Fachdiskursen der Sozialen Arbeit ist der Begriff der Normalität bedeutsam und es sind unterschiedliche programmatische Ideen und Konzeptionen damit verbunden. Einerseits kann beobachtet werden, dass die theoretische Aufarbeitung der verschiedenen Konzeptionen von Normalität in den letzten Jahren zugenommen hat. Andererseits bleiben aber die mit dem Begriff verknüpften Konzeptionen teils unbestimmt (vgl. Seelmeyer 2018). So hat die stationäre Jugendhilfe den Auftrag, ihre Zielgruppe auf den Übergang aus der Erziehungshilfe in den Beruf sowie in das Erwachsenenalter vorzubereiten, was gleichzeitig auch mit der Anpassung an hegemoniale Vorstellungen von Erwachsensein verbunden ist. Angebote der Sozialen Arbeit können in diesem Sinne nach Kessl und Plößer gleichermaßen als »Normalitätsermöglichung und Normalisierung verstanden werden« (Kessl/Plößer 2010, S. 7, Herv. i. O.). Damit verweisen die Autor*innen auf das grundsätzliche Dilemma Sozialer Arbeit, mit ihren Angeboten einen Beitrag zur Erhöhung der Teilhabemöglichkeiten für ihre Zielgruppen zu leisten und diese gleichzeitig an dominante und hegemoniale Vorstellungen von Normalität anzupassen. Soziale Arbeit »produziert die Nutzer_innen durch die fachliche Fallmarkierung überhaupt erst als ›Andere‹ (mit)« (Kessl/Plößer 2010, S. 8). In diesen Fallmarkierungen spielt die Bezugnahme auf hegemoniale Normalitätsordnungen eine bedeutsame Rolle, die mit Differenzziehungen und Kategorisierungen einhergehen.
Übergänge ins Erwachsenenalter sind zudem eng verbunden mit Normalitätsvorstellungen, die sich einerseits aus den Skripts von Lebenslaufregimes ergeben und stark von Vorstellungen linearer Übergangsverläufe geprägt sind (vgl. Walther/Stauber 2018). Andererseits bestehen entlang von verschiedenen Differenz- und Machtverhältnissen – wie bspw. Rassismus, Klassismus, Heterosexismus oder Ableismus1 – ebenfalls Konstruktionen von Normalität und Abweichung, die im Übergang ins Erwachsenenalter relevant werden. Diese Differenzordnungen tragen zur Reproduktion von ungleichen Chancen bei (vgl. Thielen 2013; Karl 2014; Stauber 2014b; Mey 2015; Scharathow 2017). Zugehörigkeiten und Positionierungen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden ebenfalls durch diese Ordnungen organisiert. Für die Institution der Schule liegen Untersuchungen vor, die aufzeigen, wie heteronormative (vgl. Kleiner 2015), rassistische (vgl. Rose 2012) oder ableistische (vgl. Buchner 2018) Ordnungen Jugendliche subjektivieren – also zu Subjekten machen – und welche Folgen dies für deren Biographien hat. Verbunden mit diesen Differenz- und Machtverhältnissen sind Normalitätskonstruktionen, die entlang dichotomer symbolischer Ordnungen festlegen, wer selbstverständlich dazugehört und als ›normal‹ gilt und wer nicht den Normalitätskonstruktionen entspricht und daher als ›abweichend‹ verstanden wird. Zusammenfassend sind mit unterschiedlichen Diskursen über Jugendliche und junge Erwachsene Ordnungen und Einteilungen verbunden, wer als normal und selbstverständlich zugehörig und wer als anders verstanden wird.
Diese Differenz- und Ungleichheitsordnungen sind neben der Schule auch in der stationären Jugendhilfe relevant. Dabei stellt sich die Frage nach Normalität für junge Menschen, die in der stationären Jugendhilfe aufgewachsen sind, in besonderem Maße, denn das Aufwachsen in der stationären Jugendhilfe wird als Abweichung von hegemonialen Vorstellungen des Aufwachsens in einer sogenannten Normalfamilie erlebt (vgl. Mangold/Rein 2017). Care Leaver müssen mit Erreichen der Volljährigkeit die Jugendhilfe i. d. R. verlassen. Dies führt zur Benachteiligung im Vergleich zu ihren Peers, die aufgrund der veränderten Bedingungen im Übergang ins Erwachsenenalter durchschnittlich bis 25 Jahre bei ihren Eltern wohnen und dort häufig auch über den Auszug hinaus Unterstützung finden (vgl. Gabriel/Stohler 2008; Schaffner/Rein 2015). In der Folge ist für die jungen Menschen eine selbstverständliche gesellschaftliche Teilhabe nicht ohne Weiteres möglich. So wird in den Forschungen bspw. darauf verwiesen, dass Care Leaver Bildungsbenachteiligung erfahren, dass sie einem höheren Obdachlosigkeits- und Armutsrisiko oder auch stärkeren gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt sind (vgl. Dixon et al. 2004; Mendes/Snow 2016b).
Die Konstruktion von Care Leavern als Gruppe und Studien, die auf deren ›poor outcomes‹ im Vergleich zu ihren Peers fokussieren, bergen allerdings die Gefahr, dass in der Rezeption der Ergebnisse das ›schlechtere Abschneiden‹ der Care Leaver in Bereichen der gesellschaftlichen Teilhabe schnell als ›Scheitern‹ und damit als ein individuelles Problem der Personen gedeutet wird. Durch die Konzentration auf die mit der Lebenslage verbundenen Herausforderungen wird in vielen Studien die Handlungsfähigkeit von Care Leavern ausgeblendet. Mit der Konstruktion und Zuordnung zur Gruppe der Care Leaver in gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskursen ist darüber hinaus eine mögliche Homogenisierung der unterschiedlichen Erfahrungen, gesellschaftlichen Positionierungen und Umgangsstrategien der individuellen jungen Erwachsenen verbunden. In der Folge werden potenziell andere Differenzkonstruktionen und damit verbundene gesellschaftliche Ordnungen wie bspw. Gender, Migrationserfahrungen, Behinderungen oder Klasse de-thematisiert und unter den gemeinsamen Jugendhilfeerfahrungen subsumiert. Allerdings ist aus einer intersektionalen Perspektive anzunehmen, dass Differenzkonstruktionen wie Geschlecht, Ethnizität, Behinderung, Klasse oder sexuelle Orientierung die Positionierungen von Care Leavern ebenfalls überlagern und dies zu weiteren Benachteiligungen führt (vgl. von Langsdorff 2014).
In den vorliegenden Studien zum Thema ist eine weitgehend offene Frage, wie sich gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse aus der Perspektive von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Heimerfahrungen gestalten und wie diese ihre subjektiven Sinnkonstruktionen vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Ordnungen und Normalitätskonstruktionen entwerfen. Um Antworten darauf zu finden, gehe ich in der vorliegenden Untersuchung der Frage nach, wie Care Leaver Normalitätsordnungen erleben, wie sie sich vor deren Hintergrund positionieren bzw. selbst ›justieren‹. Zentral ist dabei auch, wie sie Handlungsfähigkeit und widerständige Strategien entwickeln.
Mit der Perspektive auf die lebensgeschichtlichen Erzählungen der jungen Menschen sollen die Herausforderungen und Umgangsstrategien erforscht werden, die diese selbst als relevant darstellen. Die Perspektive auf die lebensgeschichtlichen Erzählungen verhindert auch, dass ein einseitiger Problemfokus auf die jungen Menschen gerichtet wird.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen habe ich folgende Fragestellung für die Untersuchung gewählt:
Welche Bedeutung haben Normalitätskonstruktionen in den Übergängen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der stationären Jugendhilfe ins Erwachsenenalter aus biographischer Perspektive im Kontext von Differenzverhältnissen?
Die biographischen Erzählungen werden hierzu mit Bezugnahme auf Machtverhältnisse und Normalitätsannahmen analysiert. Für die Rekonstruktion der biographischen Interviews dienen folgende Fragen als Orientierung:
•Wie werden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit gesellschaftlichen Normalitätskonstruktionen sowie mit diesbezüglichen Zuschreibungen konfrontiert? Welche gesellschaftlichen Ordnungen werden hierbei relevant?
•Welche Anrufungen, Adressierungen und Grenzziehungsprozesse lassen sich aus der Perspektive der Jugendlichen und jungen Erwachsenen rekonstruieren? Welche Rolle spielen dabei Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe?
•Wie greifen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen diese Adressierungen auf und wie positionieren sie sich dazu?
oInwiefern zeigen sich hierbei Unterwerfungspraxen in dem Sinne, dass Adressierungen bekräftigt werden?
oInwiefern zeigen sich widerständige Praxen im Sinne von Veränderungen oder Verschiebungen?
oInwiefern werden Adressierungen und damit verbunden Diskurse der Kinder- und Jugendhilfe von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufgegriffen?
Ich orientiere mich in der theoretischen und methodischen Umsetzung der Forschungsarbeit an biographieanalytischen Überlegungen (vgl. bspw. Dausien 1996, 2004). Mit diesem Zugang können die Normalitätskonstruktionen in ihren komplexen und prozesshaften Entwicklungen aus der Perspektive der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Heimerfahrungen rekonstruiert werden. Zudem werden dadurch die Prozesse in den Blick genommen, die mit den Übergängen aus der Jugendhilfe und ins Erwachsenenalter verbunden sind. Gleichzeitig kann dadurch das Verwobensein von gesellschaftlichen Normalitätsanforderungen, institutionellen Praxen der Jugendhilfe und den Positionierungen der jungen Erwachsenen untersucht werden.
Den Ansatz der Biographieanalyse verknüpfe ich mit den theoretischen Überlegungen zu Subjektivierungsprozessen von Butler (2001). Dadurch wird ein Fokus in der Arbeit auf die Verschränkung von Macht und Subjekt gelegt. Dies ermöglicht es, in der Untersuchung ein Verständnis von Subjekten zu entwickeln, das diese gesellschaftstheoretisch rahmt und in Verbindung zu Normalitätsordnungen setzt. In ihren Arbeiten zum Thema Geschlecht markiert Butler Gender als Folge von Sprechakten und Adressierungen und dekonstruiert die vermeintlich zugrunde gelegte Natürlichkeit der bipolaren Geschlechterordnungen (Butler 1991). Butler setzt Subjektivierungsprozesse in den Kontext von Machtverhältnissen und Normalitätsannahmen. Diese umfassen immer gleichzeitig Aspekte des Unterworfenseins und der Subjektwerdung (Butler 2001). In Bezug auf die Thematik der Care Leaver stellt sich die Frage, mit welchen Anrufungen die jungen Erwachsenen konfrontiert sind und welche gesellschaftlichen Positionen damit verbunden sind. Beispiele für Anrufungen können bspw. Kategorisierungen sein durch Diagnosen, geschlechterbezogene Anrufungen oder auch Anrufungen als »Migrationsandere« (Mecheril 2010, S. 17). Verbunden mit den Adressierungen sind hegemoniale Ordnungen. Diese Ordnungen bringen Subjektpositionen hervor, denen sich Subjekte in ihren Positionierungen unterwerfen oder auch widersetzen können.
Subjekte, Macht und Normalitätsverhältnisse sowie gesellschaftliche Institutionen sind mehrfach miteinander verwoben. Normalität wird dabei als eine Ordnung verstanden, die für Subjekte und deren Biographien relevant ist und die Möglichkeiten und Grenzen des Denk- und Lebbaren strukturiert. Dabei deuten Studien zu Leaving-Care-Prozessen darauf hin, dass für Jugendliche, die in der stationären Jugendhilfe gelebt haben, die Erfahrung, nicht der Norm zu entsprechen, in verschiedener Hinsicht zu ihrem Alltag gehört und hierbei gesellschaftliche Differenz- und Machtordnungen eine zentrale Rolle spielen.
Die vorliegende Arbeit verfolgt somit ein mehrebenenbezogenes Erkenntnisinteresse, das nach den Bedeutungen von Normalitätskonstruktionen in Biographien fragt und diese in Verbindung mit gesellschaftlichen Macht- und Differenzverhältnissen setzt. Dabei lege ich auch einen Fokus auf die Frage, wie Institutionen der stationären Kinder- und Jugendhilfe eingebunden sind in die (Re-)Produktion von Normalitätskonstruktionen aus einer biographischen Perspektive. Ziel dieser Untersuchung ist es, aus biographischer Perspektive Erkenntnisse zur hegemonialen und sozialen Bedeutung von Normalitätskonstruktionen – verstanden als dominante gesellschaftliche Ordnungen – herauszuarbeiten.
Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. In einem ersten Teil der Arbeit nähere ich mich dem Kontext der Untersuchung an. Hierzu wird im ersten Kapitel eine Verortung des Vorhabens vor dem Hintergrund empirischer Studien und wissenschaftlicher Diskurse im Feld der stationären Jugendhilfe vorgenommen. Dies sind zum einen Forschungen mit einer expliziten Adressat*innenperspektive sowie Debatten um Care Leaver in den Hilfen zur Erziehung. Zum anderen stelle ich Debatten in der Sozialen Arbeit dar, die sich mit Fragen der Thematisierung von Differenz- und Ungleichheitsverhältnissen sowie Fragen der Normalität und Normalisierung beschäftigen. Dabei markiere ich einerseits, welche Konsequenzen aus den bestehenden empirischen Studien und fachlichen Diskursen gezogen werden können. Andererseits zeige ich auf, welche Fragen sich daraus für die vorliegende Untersuchung ableiten lassen.
Im zweiten Teil der Arbeit (Kap. 2 und 3) stelle ich basierend darauf die theoretischen und methodologischen Rahmungen der Arbeit vor und gehe auf das methodische Vorgehen ein. Zunächst werden im zweiten Kapitel zentrale theoretische Konzepte der Arbeit herausgearbeitet, die sich als Ansatzpunkte und Aufmerksamkeitsfokusse in der empirischen Analyse als weiterführend herauskristallisiert haben: Biographietheorie, Übergangstheorie, Subjektivierung sowie Intersektionalität. Damit verbunden ist die Entwicklung einer Perspektive, die es ermöglicht, Subjekte in deren Eingebundenheit in Macht- und Ungleichheitsverhältnisse zu verstehen und dabei die prozesshafte biographische Dimension der Entwicklung von Subjektpositionen in den Blick zu nehmen. Im dritten Kapitel steht das methodische Vorgehen der Untersuchung im Zentrum, das in der Tradition der rekonstruktiven Methodologie verortet ist. Hierzu wird zunächst kurz auf die Grounded Theory als Forschungsstil eingegangen. Danach gehe ich auf das biographisch-narrative Interview als Erhebungsmethode in ihren theoretischen und praktischen Dimensionen ein. Zuletzt stelle ich relevante Aspekte des Forschungsprozesses dar zur Verortung des Kontextes der Untersuchung.
Im dritten Teil der Arbeit erfolgt schließlich die Darstellung der empirischen Ergebnisse. Dieser Teil ist das Zentrum der empirischen Untersuchung. Zunächst werden die Bedeutungen von Normalitätskonstruktionen in drei Einzelfalldarstellungen dargelegt (Kap. 4 bis 6). Im Anschluss werden im siebten Kapitel in einer fallübergreifenden Darstellung – basierend auf 14 biographischen Erzählungen von Care Leavern – Theoretisierungen zu den Bedeutungen von Normalitätskonstruktionen herausgearbeitet. Diese sind fallübergreifende Bedingungskonstellationen, mit denen Jugendliche und junge Erwachsene mit Jugendhilfeerfahrungen konfrontiert werden. Daneben geht es auch um die Darstellung der Zusammenhänge von Möglichkeitsräumen und Umgangsweisen der jungen Erwachsenen. Diese Ergebnisse bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen Prozessen der ›Ent-Normalisierung‹ und einem ›Ringen um Normalität‹. Im achten Kapitel der Untersuchung ziehe ich zunächst ein kurzes methodologisches Resümee. Danach eröffne ich Perspektiven und mögliche Ansatzpunkte für Veränderungen und Dekonstruktion von hegemonialen Normalitätsordnungen in Fachdiskursen, Forschungen sowie der pädagogischen Praxis der stationären Jugendhilfe.
1 Mit ›Ismen‹ werden gesellschaftliche Ordnungen beschrieben, die Benachteiligung aufgrund sozialer Differenzen legitimieren und so Machtverhältnisse reproduzieren. So wird bspw. mit dem Begriff Ableismus auf Ordnungen verwiesen, die soziale Differenzen hinsichtlich geistiger und körperlicher Fähigkeiten naturalisieren. Auf der einen Seite wird eine Norm definiert, auf der anderen Seite werden Behinderungen zugeschrieben und mit der Nicht-Erfüllung einer gesellschaftlich konstruierten Normerwartung begründet (vgl. Köbsell 2015, S. 25).
Teil IKontext der Untersuchung
1Das Feld der stationären Jugendhilfe
Wissenschaftliche Diskurse und Verortungen
In diesem Kapitel werde ich eine Verortung und Reflexion des Forschungsvorhabens vor dem Hintergrund verschiedener empirischer Studien und wissenschaftlicher Diskurse durchführen. Mit der Frage nach Normalitätskonstruktionen in der stationären Jugendhilfe aus biographischer Perspektive im Kontext von Differenzverhältnissen spielen unterschiedliche Debatten und Bezugsmomente eine Rolle.
Einen Strang, an den die vorliegende Arbeit anknüpft, stellen adressat*innenbezogene Forschungen in der stationären Jugendhilfe dar. Damit einher gehen Forschungen, die die Subjektperspektive sowie Erfahrungen und Deutungen von Adressat*innen ins Zentrum rücken (vgl. Kap. 1.1). Weiter knüpft die Arbeit an internationale Debatten rund um Care Leaver und Leaving-Care-Prozesse an und interessiert sich dafür, wie diese Prozesse aus biographischer Perspektive erlebt werden (vgl. Kap. 1.2). Zuletzt spielen auch die Diskurse über Differenzen in der Sozialen Arbeit (vgl. Kap. 1.3) und über Normalität sowie Normalisierung (vgl. Kap. 1.4) eine Rolle.
In der nun folgenden Darstellung werden relevante Aspekte der verschiedenen Diskurse und relevante empirische Studien dargestellt. Vor diesem Hintergrund wird eine Verortung des Forschungsvorhabens vorgenommen und reflektiert, welche Konsequenzen daraus für die vorliegende Untersuchung gezogen werden können.
1.1Forschungen mit Adressat*innenperspektive
Der Fokus der vorliegenden Untersuchung liegt auf den Biographien von jungen Menschen, die in stationären Hilfen zur Erziehung gelebt haben.1 Nach Flösser et al. (1998) können die Strukturelemente Sozialer Arbeit im Dreieck von sozialpädagogischen Institutionen, den Professionellen der Sozialen Arbeit sowie den Adressat*innen bestimmt werden. Die vorliegende Arbeit fokussiert auf die Subjekte Sozialer Arbeit und legt damit einen Schwerpunkt auf die Adressat*innen Sozialer Arbeit.
Mit Forschungen, die auf die Perspektive von Adressat*innen fokussieren, geht eine Machtverschiebung einher von einer expertokratischen Deutung von Professionellen und institutionellen Perspektiven hin zu einer Perspektive, die die Erfahrungen und Positionen der Adressat*innen zum Ausgangspunkt macht (vgl. Graßhoff/Paul/Yeshurun 2015, S. 8). Dabei können Adressat*innen aber nicht unabhängig von den anderen Strukturelementen gedacht werden. Oder wie Bitzan und Bolay (2017, S. 9) formulieren: »Adressat*innen [gibt es] nur als Adressat*innen von Institutionen und in Interaktionen mit Professionellen«. Sie werden damit in einem gemeinsamen Herstellungsprozess zu Adressat*innen gemacht. In den Forschungen der Sozialen Arbeit lag lange Zeit der Schwerpunkt auf den Professionellen bzw. auch den Organisationen Sozialer Arbeit. Die Perspektive von Adressat*innen wurde hingegen kaum berücksichtigt (vgl. Lüders/Rauschenbach 2001, S. 564 ff.).
Aktuell nimmt die Anzahl an Forschungen zu, die sich explizit mit der Perspektive von Adressat*innen beschäftigen (vgl. Graßhoff 2013, S. 9). Dies ist auch auf die dezidierte Kritik zurückzuführen, dass die Perspektive oder »Stimme der Adressaten« (Bitzan/Bolay/Thiersch 2006) zu wenig in sozialpädagogische Forschung Eingang finde. Den Forschungen ist ein relationales Adressat*innenverständnis zugrunde gelegt, das Adressat*innen in ihren Relationen zu Institutionen und den Interaktionen mit Professionellen der Sozialen Arbeit konzeptionalisiert (vgl. Bitzan 2016, S. 9).
Verbunden mit einer adressat*innenorientierten Forschung ist die analytische Verbindung von gesellschaftlichen Konstruktionen von Adressat*innen auf der einen Seite und dem Bedarf von Adressat*innen und deren Perspektive auf ihre Lebenssituation auf der anderen Seite (vgl. Bitzan/Bolay 2013, S. 37). Es geht dabei insbesondere um die Frage der Passung institutioneller Erfahrungen im biographischen Verlauf: »Lebensgeschichtliche Erzählungen über Erfahrungen in sozialpädagogischen Kontexten offenbaren […] individuelle Passungsverhältnisse zwischen Individuen und Institution« (Finkel 2013, S. 66). Hierbei stehen auch das Handeln der Adressat*innen im Zentrum sowie die Frage, inwiefern es durch sozialpädagogische Angebote gelingt, die Handlungsfähigkeit zu erhöhen bzw. auch wieder zu ermöglichen, und ob die Angebote an den Bedarfslagen anknüpfen (vgl. ebd., S. 53). Gleichzeitig sind damit auch eine normativ-emanzipatorische Dimension verbunden und ein Interesse an der Frage der Erhöhung der Handlungsfähigkeit von Adressat*innen (vgl. Bitzan/Bolay 2011, S. 42). Damit einher gehen insbesondere empirische Forschungen, die die Perspektiven von Adressat*innen einbeziehen: »Gleichsam sind die Grenzen in einem relational verstandenen Verständnis von Adressat_innen gegenüber anderen Forschungsschwerpunkten, wie zum Beispiel professions- oder institutionsbezogener Forschung, fließend« (Graßhoff 2015, S. 97).
Adressat*innenforschung spielt auch im Bereich der stationären Erziehungshilfen eine bedeutsame Rolle. Im Folgenden werden Forschungen vorgestellt, die sich mit der Perspektive von Adressat*innen oder den Konstruktionsprozessen von Adressat*innen in den Hilfen zur Erziehung beschäftigen.
Margarethe Finkel (2004) hat die Biographien von Mädchen in den Erziehungshilfen untersucht. Ihre Arbeit stellt eine der ersten Studien im Bereich Hilfen zur Erziehung dar, die sich dezidiert als Adressat*innenforschung ausgewiesen hat. Sie konstatierte für den Zeitpunkt ihrer Untersuchung, dass die Kategorie Geschlecht bislang in den Forschungen der Erziehungshilfe kaum Berücksichtigung gefunden habe (vgl. Finkel 2004, S. 19 ff.). In den Fallstudien wird deutlich, wie biographische Erfahrungen einen Einfluss auf die Nutzung der Angebote der Hilfen zur Erziehung haben. Gleichzeitig markiert Finkel auch Spannungsfelder zwischen Autonomie und Bedürftigkeit, in denen sich die jungen Frauen bewegen. Für die Hilfen zur Erziehung leitet sie aus ihrer Studie die Notwendigkeit ab, dass diese sich in Bezug auf Biographien noch deutlicher ihrer mitgestaltenden Rolle bewusst werden müssen. Weiterhin hebt sie das Potenzial hervor, das die Reflexion lebensgeschichtlicher Perspektiven für Angebote der Hilfen zur Erziehung bieten kann. In der Studie wird auch sichtbar, wie gesellschaftliche Normalitätserwartungen die Zukunftsentwürfe der jungen Frauen beeinflussen und hier auch genderbezogene Rollenerwartungen dominant sind (vgl. ebd., S. 309 ff.).
Auch Maren Zeller hat in der Untersuchung von Bildungsprozessen von jungen Frauen in den Erziehungshilfen einen biographischen Zugang gewählt (vgl. Zeller 2012). Als Ergebnis der Studie entwickelt sie ein Modell von Resonanz, das beschreibt, wie Bildungsprozesse durch institutionelle Arrangements behindert oder gefördert werden können. Bildung ergibt sich dabei im Zusammenspiel von biographischen Mustern und institutionellen Arrangements. Da diese jeweils im Wandel sind, lassen sich – so das Ergebnis der Studie – keine eindeutigen Zusammenhänge rekonstruieren, wie Bildungsprozesse durch institutionelle Arrangements befördert werden können. Vielmehr ist dieses Verhältnis prozesshaft und durch Wandel geprägt. Sie plädiert mit dem Begriff der Resonanz dafür, starre Vorstellungen des Verhältnisses von Institution und Biographie zu hinterfragen, die mit dem Begriff der Passung verbunden sind. Hinsichtlich der Kategorie Geschlecht kommt Zeller zu dem Schluss, dass diese eine Kategorie neben anderen relevanten Kategorien ist (vgl. ebd., S. 203 ff.).
Von Langsdorff (2012) untersucht in ihrer Studie die Wege von jungen Frauen mit Migrationsgeschichte in die Hilfen zur Erziehung. Dabei geht sie der Frage nach, inwiefern intersektionale Wechselwirkungen auf diesem Weg relevant werden und welche Handlungsstrategien die Mädchen entwickeln. Sie arbeitet in ihrer Studie heraus, dass die Unterrepräsentanz von jungen Frauen mit Migrationsgeschichte in der stationären Jugendhilfe insbesondere darauf zurückzuführen sei, dass in den Kontakten mit dem Hilfesystem keine Angebote gemacht würden, die als Unterstützung von den jungen Frauen und ihren Familien wahrgenommen werden (vgl. von Langsdorff 2012, S. 195 ff.).
Neben diesen Forschungen, die eine explizite Adressat*innenperspektive einnehmen, gibt es Untersuchungen in den Hilfen zur Erziehung, die stärker auf die Konstruktionsprozesse von Adressat*innen durch institutionelle Prozesse und in Interaktionen fokussieren. Thieme (2013, S. 191 ff.) hat untersucht, wie Adressat*innen in der Kinder- und Jugendhilfe konstruiert werden mit Bezugnahme auf Kategorisierungen. Ihre Ergebnisse verweisen darauf, dass essenzialisierende Negativkategorisierungen der Adressat*innen vorgenommen werden, auf deren Basis Hilfebedarf konstruiert wird. Diese Befunde knüpfen auch an die Studie von Messmer und Hitzler (2011) an, die konversationsanalytisch Hilfeplangespräche untersucht haben. In den Analysen wird deutlich, wie Adressat*innen am Anfang von Hilfen mit Bezugnahme auf soziale Kategorisierungen als Hilfeempfänger*innen hervorgebracht werden, am Ende hingegen deklientifiziert werden (vgl. Messmer/Hitzler 2011, S. 783 ff.).
Empirische Studien zu Elternbildern in der Kinder- und Jugendhilfe zeigen auf, dass Pädagog*innen sich wenig von ihrem eigenen normativen (kleinbürgerlichen) Familienbild distanzieren und dies unreflektiert in die Arbeit mit Familien einfließt (vgl. Bauer/Wiezorek 2009, S. 173 ff.). Gleichzeitig finden Prozesse statt, in denen Familien in Diskursen des Kinderschutzes als vulnerabel konstruiert werden, worüber wiederum Normierungsprozesse und die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe legitimiert werden. Mit dieser Konstruktion als vulnerable Familie gehen individualisierende Problematisierungen der Familie und eine De-Thematisierung von Ungleichheits- und Armutsverhältnissen einher (vgl. Bauer/Wiezorek 2016, S. 22 ff.). Gleichzeitig besteht eine latente Idealisierung einer ›familialisierten Kindheit‹ im Kontext von Fremdunterbringung (vgl. Pomey 2017).
In den bestehenden Forschungen der Hilfen zur Erziehung mit einem Adressat*innenbezug fällt auf, dass hier auf der einen Seite Forschungen bestehen, die explizit auf die Perspektive von Adressat*innen fokussieren. Auf der anderen Seite gibt es Forschungen, die stärker die Konstruktionsprozesse von Adressat*innen durch Professionelle und institutionelle Kontexte beleuchten. Hanses und Richter (2009, S. 66 f.) kritisieren, dass in Forschungen Institutionen und Subjekte bzw. Adressat*innen oftmals als Gegensatzpaare konzeptualisiert werden. Gleichzeitig werde dabei ein hierarchisches Verständnis zugrunde gelegt, in welchem Institutionen Subjekte determinieren. Dieses dichotome Verständnis kann mit biographischen Studien aufgebrochen werden, welche sichtbar machen, wie Adressat*innen auch organisationale Strukturen prägen: »So zeigen biographische Studien auf, wie der Zugang der NutzerInnen zu unterschiedlichen sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungen entscheidend durch die biographischen Erfahrungen und Sinnhorizonte bestimmt ist« (Hanses 2010, S. 859). Biographieforschung stellt für Adressat*innenforschung in unterschiedlicher Hinsicht einen weiterführenden Zugang dar. So bietet Biographieforschung Hinweise zu Problemkonstellationen und Verlaufs- und Wandlungsprozessen, die zur Reflexion professioneller Praxis herangezogen werden können. Gleichzeitig ermöglichen biographische Zugänge Einblicke in Rahmungen durch Lebenswelten und gesellschaftliche Institutionen (vgl. ebd., S. 861 f.).
Mit der Wahl eines biographischen Zugangs in der vorliegenden Arbeit wird also ein Schwerpunkt auf die Adressat*innen gelegt. Gleichzeitig soll damit aber eine Perspektive eingenommen werden, welche die Verbindungen zwischen Adressat*innen, institutionellen Strukturen und gesellschaftlichen Verhältnissen fokussiert. Damit wird in den Strukturelementen der Sozialen Arbeit ein Schwerpunkt auf die Adressat*innen gelegt, wobei dennoch auch die anderen Ebenen mitberücksichtigt werden. Weiterhin konzentriert sich die vorliegende Forschung auf Subjektivierungsprozesse in der stationären Jugendhilfe. Damit einher geht auch das Anliegen, mit einem relationalen Verständnis von Adressat*innen »die Dichotomie Individuum/Institution aufzuheben und Prozesse von Subjektivierungsweisen in Bezug auf und innerhalb der Nutzung von Angeboten der Sozialen Arbeit als vielschichtige Prozesse der Selbstkonstitution aufzuzeigen« (Bitzan/Bolay 2013, S. 48). Bislang liegen für die Hilfen zur Erziehung noch keine Forschungen vor mit einer dezidierten Perspektive auf Subjektivierungsprozesse in den Institutionen der stationären Jugendhilfe. Welche Folgen Prozesse des Zur-Adressat*in-gemacht-Werdens aus Subjektperspektive im Kontext von Differenz- und Normalitätsverhältnissen haben, ist Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.
1.2Care-Leaver-Debatten in den Hilfen zur Erziehung
Der Begriff Care Leaver hat sich international etabliert für junge Menschen, die eine gewisse Zeit ihres Lebens in der stationären Erziehungshilfe oder in einer Pflegefamilie gelebt haben und sich im Übergang ins Erwachsenenalter befinden. Dabei wird in den Forschungen herausgestellt, dass Care Leaver im Vergleich zu ihren Peers international in vielen Lebensbereichen benachteiligt sind und es trotz großer Variationen der Hilfesysteme insgesamt nur unzureichende Unterstützungsangebote für Care Leaver gibt (vgl. Mendes/Snow 2016b; Refaeli 2019). Der Begriff Care Leaver wird auch in Selbstorganisationen und Netzwerken von Personen genutzt, die in einer Pflegefamilie oder in der stationären Jugendhilfe aufgewachsen sind. Exemplarisch können hier The Care Leavers’ Association (o. J.) im Vereinigten Königreich, das Care Leavers Australasia Network in Australien und Neuseeland (o. J.), der Care Leaver e.V. Deutschland und neuerdings auch das Care Leaver Netzwerk in der Region Basel (o. J.) genannt werden. Dies deutet darauf hin, dass der Begriff Care Leaver nicht nur in fachliche Diskurse Eingang findet, sondern auch emanzipatorisch als Identitätskategorie und zur Selbstorganisation benutzt wird. Dabei sind die Formen von Initiativen und Selbstorganisationen heterogen und reichen von regionalen oder überregionalen Austauschtreffen über Seminarreihen bis hin zu trägerbezogenen Formen des Zusammenschlusses von Care Leavern (vgl. Arns/Mangold/Strunk 2018, S. 5). In Europa spielt das Vereinigte Königreich eine zentrale Rolle im Vorantreiben des wissenschaftlichen, fachlichen und politischen Diskurses rund um Care Leaver (vgl. Pinkerton 2012, S. 309 f.).
Zunächst fällt auf, dass mit der geläufigen Bezeichnung des Diskurses als Care-Leaver-Diskurs auf begrifflicher Ebene bereits eine Fokussierung auf die Subjekte, die Adressat*innen stattfindet. Gleichzeitig geraten thematisch die Übergänge aus der Hilfe in den Blick und damit Prozesse, in denen Adressat*innen nicht mehr Adressat*innen von Hilfe sind. In Bezug auf das oben skizzierte relationale Adressat*innenverständnis entsteht dadurch die Frage, was damit verbunden ist, nicht mehr Adressat*in eines Angebotes zu sein. Mit einem relationalen Verständnis von Care Leavern als ehemaligen Adressat*innen stellt sich auch die Frage, wie Agency als Handlungsmacht in den Übergangswegen aus der Jugendhilfe entstehen kann (vgl. Göbel et al. 2020).
Die Thematisierung von Übergängen aus der stationären Jugendhilfe und der Familienpflege ins Erwachsenenalter hat in den letzten Jahren auch in fachlichen Diskursen in der Schweiz zugenommen. Darauf verweisen u. a. eine zunehmende Zahl an Fachartikeln (bspw. Gabriel/Stohler 2008; Gabriel et al. 2013; Schaffner/Rein 2015; Rein 2018) oder auch Fachtagungen. Es ist zu beobachten, dass eine Bezugnahme auf internationale Debatten rund um Leaving-Care-Prozesse stattfindet. Die internationale Einbettung scheint weiterführend zu sein, um an bereits bestehende Forschungsbefunde und fachliche Perspektiven anzuknüpfen und danach zu fragen, welche Bedeutung diese für die Schweiz haben.
In den Überlegungen zu Leaving Care wird im deutschsprachigen Raum in den Diskursen auch auf die veränderten Übergänge ins Erwachsenenalter hingewiesen (vgl. Köngeter/Schröer/Zeller 2012, S. 262 ff.). So wird auf der Basis von Befunden der Übergangsforschung und mit Bezugnahmen zum Konzept der Yoyo-Übergänge (vgl. Stauber/Walther 2002) begründet, dass das frühe Ende stationärer Angebote (mehrheitlich mit Erreichen der Volljährigkeit) nicht mit veränderten Bedingungen der Übergänge ins Erwachsenenalter in Einklang steht. Die Schweizer Längsschnittstudie TREE (›Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben‹) zu Übergangsverläufen in Ausbildung und Arbeit zeigt auf, dass der Normalvorstellung eines linearen Bildungsverlaufes zunehmend diskontinuierliche Verläufe gegenüberstehen (vgl. bspw. Scharenberg et al. 2014; Scharenberg et al. 2016). Auch eine Studie über junge Erwachsene in der Sozialhilfe hat auf die veränderten Übergänge in Arbeit hingewiesen (vgl. Schaffner 2007). Dabei besteht ein Zusammenhang zwischen Diskontinuitäten im Bildungs- und Ausbildungsverlauf und der Gefahr, das Bildungssystem vorzeitig und ohne Abschluss zu verlassen (vgl. Meyer 2016). Care Leaver gelten international als »Bildungsverlierer*innen« (vgl. Pothmann 2007, S. 179 ff.) und ihre Übergänge in Berufsbildung und Arbeit entsprechen oftmals nicht gesellschaftlichen Normalvorstellungen, was das Risiko gesellschaftlicher Exklusion für sie erhöht (vgl. Berridge 2012).
In Bezug auf die institutionellen Rahmungen der Übergänge aus der stationären Jugendhilfe in der Schweiz kann konstatiert werden, dass durch die föderale Struktur des Landes für das System der Kinder- und Jugendhilfe die Fragmentierung kennzeichnend ist (vgl. Schnurr 2017, S. 117). Es besteht eine Gewaltenteilung zwischen dem Bund, den 26 Kantonen sowie den 2255 Gemeinden. Weiterhin wird die Fragmentierung noch durch die Mehrsprachigkeit des Landes verstärkt (vgl. Bundeskanzlei 2017). In der Folge gibt es in der Schweiz kein nationales Kinder- und Jugendhilfegesetz. Die rechtlichen Grundlagen für Platzierungen von Kindern und Jugendlichen in der stationären Jugendhilfe oder Familienpflege finden sich in mehreren Bundesgesetzen (insbesondere Jugendstrafgesetz und Zivilgesetzbuch) sowie in einer Vielzahl von kantonalen Gesetzen und Verordnungen von Gemeinden. Die Verantwortung für das Leistungsangebot sowie die Organisation der Behörden werden auf kantonaler Ebene erbracht (vgl. Schnurr 2017, S. 117 ff.).
Für Prozesse des Leaving Care in der Schweiz folgt daraus, dass diese regional sehr unterschiedlich gerahmt sind. Für die Dauer der gewährten Hilfe in stationären Einrichtungen ist dabei u. a. ausschlaggebend, auf welcher Gesetzesgrundlage die Entscheidungen hinsichtlich der Unterbringung gefällt werden. Die Invalidenversicherung (IV), die keine Altersbegrenzungen für Hilfen definiert, oder das Jugendstrafgesetz (JStG) mit einer Altersgrenze von 25 Jahren bieten die längsten Platzierungsmöglichkeiten. Im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdung schreibt das Kindesschutzgesetz (ZGB) hingegen in der Regel das Ende der Hilfe mit 18 Jahren fest (vgl. Schaffner/Rein 2015). Da es keine nationale Kinder- und Jugendhilfestatistik gibt, können keine Aussagen darüber getroffen werden, bis zu welchem Alter durchschnittlich Hilfen in Anspruch genommen werden (vgl. Schnurr 2012). Dies erschwert es, Aussagen darüber zu machen, wie sich Praxen der Hilfegewährung auch über 18 Jahre hinaus gestalten und wie lange junge Menschen durchschnittlich in der stationären Jugendhilfe bleiben.
Die in den unterschiedlichen Gesetzen sichtbar werdende starke Verknüpfung des Hilfeendes mit der Volljährigkeit erscheint vor dem Hintergrund des durchschnittlichen Auszugsalters von jungen Menschen zwischen 24 und 25 Jahren allerdings problematisch (vgl. Freymond 2016, S. 4 f.). In der Angebotsform ›Schulheim‹ erfolgt das Ende bereits mit dem Ende der obligatorischen Schulpflicht bereits vor der Volljährigkeit i. d. R. mit 16 Jahren (vgl. Schaffner/Rein 2015, S. 13 ff.). Hier zeigt sich, dass damit herausfordernde Übergänge für junge Erwachsene einhergehen. So ist der Übergang aus dem Schulheim gekoppelt mit einem Wohnübergang und oftmals auch mit Übergängen in Arbeit, was aus biographischer Perspektive eine große Anforderung darstellt (vgl. Schaffner/Rein 2013).
Die Befunde deuten also daraufhin, dass Care Leaver in der Schweiz ebenfalls benachteiligt sind. Dies ergibt sich zum einen durch die großen regionalen Unterschiede, was die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Hilfe anbelangt. Dabei scheinen auch ähnliche Themen wie in internationalen Diskursen virulent zu sein, die mit dem frühen Ende der Hilfe verbunden sind und der fehlenden Möglichkeit, nach erfolgtem Austritt nochmals Unterstützung durch das System der Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen (vgl. Rein 2018).
Pinkerton (2012) weist in Bezug auf internationale Debatten um Leaving Care auch auf kritische Effekte der Internationalität hin, die er mit der Gefahr der Homogenisierung der unterschiedlichen wohlfahrtsstaatlichen Systeme begründet. So werde der Diskurs internationaler Forschungen stark durch das Vereinigte Königreich dominiert. Dabei werde aber zu wenig berücksichtigt, dass dort das System der Unterstützung für Care Leaver bereits sehr weit etabliert ist und daher die Diskurse auch nicht ohne Weiteres auf andere Systeme übertragbar sind. Diese Unterschiedlichkeit der Wohlfahrts- bzw. auch Jugendhilfesysteme und damit einhergehende Variationen finden Pinkerton zufolge in den internationalen Debatten zum Teil zu wenig systematische Berücksichtigung (vgl. Pinkerton 2012, S. 310). Er unterstreicht, dass der internationale Diskurs über Care Leaver durch die gute Vernetzung der Forscher*innen in Netzwerken wie im ›International Research Network on Transitions to Adulthood from Care‹ (INTRAC) oder auch im Rahmen von Kongressen dazu führe, dass hier zum Teil ähnliche Themen untersucht werden und im Vergleich der verschiedenen Forschungen in Reviews auch die Varianz der verschiedenen Systeme, Wohlfahrtsstaatssysteme, Familienvorstellungen oder auch Bildungs- und Ausbildungssysteme verloren gehe (vgl. ebd., S. 312 ff.).
Weiterhin fällt in den Diskussionen über Care Leaver national wie international auf, dass in der Verhandlung des Themas implizit die Gruppe der Care Leaver homogenisierend benutzt und dabei eine Subjektposition konstruiert wird, mit der problemorientierte Perspektiven einher gehen. Diesem Effekt wird im Folgenden nochmals genauer nachgegangen.
Zunächst einmal wird in den Diskussionen übergreifend mit Bezug auf die strukturellen Barrieren argumentiert, mit denen junge Menschen im Übergang aus der stationären Jugendhilfe ins Erwachsenenalter konfrontiert sind und die eine Gruppe mit speziellen Risiken der Exklusion hervorbringen (vgl. Stein/Munro 2008). In Studien und fachlichen Diskursen werden dabei Care Leaver mit einer Gruppe von Gleichaltrigen verglichen. In der Folge werden Care Leaver als ›andere Jugendliche‹ konstruiert, da sie begrifflich als eine Gruppe hergestellt werden, die sich von anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterscheidet. Mit dem in der postkolonialen Theorie entwickelten Konzept des Othering (vgl. Said 1978; Castro Varela/Dhawan 2015) kann festgehalten werden, dass die jungen Menschen, die in der stationären Jugendhilfe aufgewachsen sind, mit dieser gängigen Art der Bezeichnung und Perspektive in den internationalen Diskursen bereits als Andere konstruiert werden. Somit scheint darin eingelagert zu sein, dass so adressierte Jugendliche und junge Erwachsene nicht selbstverständlich dazugehören und ihre Übergänge ins Erwachsenenalter anders seien als die von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die implizit die Normalität repräsentieren und zu denen die Care Leaver nicht gehören.
In Care-Leaver-Diskursen wird dabei auch auf Differenzen von Care Leavern hingewiesen. Eine exemplarische Argumentation ist dabei:
»Care Leavers are not a homogeneous group, and have varied backgrounds and experiences in terms of the structure and capacity of their families, the type and extend of abuse or neglect, the age at which they enter care, their cultural and ethnic backgrounds, their in-care experiences, their developmental stage and needs when exiting care, the presence of special needs such as developmental disability or mental illness and the quantity and quality of supports available to them.« (Mendes/Snow 2016a, S. xxxii)
In den hier aufgezählten Differenzen und Dimensionen von Diversität wird deutlich, dass diese eher auf individuelle Unterschiede und zugeschriebene Merkmale fokussiert sind, die zu unterschiedlichen Erfahrungen führen. So wird hier bspw. auf Entwicklungsverläufe, einen speziellen Unterstützungsbedarf aufgrund von familiären Erfahrungen oder zugeschriebene psychische Erkrankungen hingewiesen.
Differenz- und Ungleichheitsverhältnisse wie Rassismus, Sexismus oder Ableismus strukturieren die Übergänge ins Erwachsenenalter in der Schweiz (vgl. Haeberlin/Imdorf/Kronig 2004; Imdorf 2008; Seibert/Hupka-Brunner/Imdorf 2009; Imdorf 2010; Sacchi et al. 2011; Imdorf 2014; Zimmermann/Seiler 2019). Es gibt dabei auch Hinweise, dass im Kontext von Jugendhilfeangeboten ebenfalls Differenzen hervorgebracht werden, wenn bspw. ›Behinderungen‹ diagnostiziert werden, um Angebote oder Anschlusslösungen für Adressat*innen der Jugendhilfe bereithalten zu können (vgl. Rein 2016a, 2016b). Diese Befunde verweisen darauf, dass Prozesse des Leaving Care neben den Herausforderungen, die mit den Übergängen aus der stationären Jugendhilfe verbunden sind, noch durch weitere Macht- und Ungleichheitsverhältnisse strukturiert werden.
Der renommierte Care-Leaver-Forscher Mike Stein (2012) teilt auf der Basis von internationalen Studien zwischen 1980 und 2012 Care Leaver in drei Gruppen ein (vgl. Stein 2012, S. 170 ff.). Die erste Gruppe nennt er ›moving on-group‹, die sich durch Resilienz auszeichnet. Die Care Leaver in dieser Gruppe konnten insgesamt positive Erfahrungen in der Hilfe machen und es gelingt ihnen, bestehende Unterstützungsangebote nach der stationären Jugendhilfe zu nutzen. Die zweite Gruppe, die sogenannten ›survivors‹, zeichnen sich dadurch aus, dass sie insgesamt mehr Instabilität und Diskontinuität in ihrer Biographie erfahren haben. In ihrem Übergang aus der stationären Jugendhilfe sind sie mit mehr Herausforderungen konfrontiert als die erste Gruppe und sie müssen stark mit Problemen kämpfen, die sich ihnen in ihrem Übergang ins Erwachsenenalter stellen. Sie bleiben dabei auch zum Teil in Bereichen ihres Lebens abhängig von Unterstützung. Die dritte Gruppe bezeichnet er als ›struggler‹. Diese Gruppe ist am stärksten von Benachteiligung betroffen, und die jungen Menschen hatten oftmals auch sehr belastende Erfahrungen vor der Hilfe. Er beschreibt ihre Übergänge ins Erwachsenenalter als brüchig und sieht bei ihnen soziale und emotionale Defizite. Insgesamt sind in dieser Einteilung aber die Gruppen nicht starr zu verstehen. Das Anliegen der Einteilung und der Beschreibungen der Gruppen ist die Frage, wie Care Leaver möglichst gut in ihrer Resilienz gefördert werden können (vgl. ebd., S. 172 ff.).
Im Vergleich dieser unterschiedlichen Formen der Kategorisierungen von Care Leavern wird deutlich, dass hier insbesondere individualisierte Betrachtungsweisen stark im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Obwohl zwar in der Beschreibung der Gruppen von Stein (2012) auch Bezug genommen wird auf die Erfahrungen und strukturellen Barrieren von Care Leavern, werden die jungen Menschen in Gruppen eingeteilt und ihr individuelles Vorankommen und ihr Handeln bewertet. In den oben aufgeführten Differenzierungen von Care Leavern stehen dabei auch eher individuelle Merkmale im Zentrum als strukturelle Differenzverhältnisse. Mit der Argumentation, dass auf der Grundlage dieser Unterscheidungen Wissen über die Resilienz von Care Leavern herausgearbeitet werden soll, ist die Gefahr verbunden, die strukturellen Barrieren aus dem Blick zu verlieren. Vielmehr gerät dadurch die Frage ins Zentrum, wie die Individuen gestärkt werden können im Umgang mit den Barrieren.
Zusammenfassend wird deutlich, dass in den dargelegten Diskursen eher auf Care Leaver als eine homogene Gruppe und weniger auf deren individuelle Fähigkeiten oder eben Belastungen fokussiert wird. Auf die Unterschiedlichkeit der Gruppe der Care Leaver wird zwar in den Diskussionen rund um Care Leaver immer wieder hingewiesen. In den Diskussionen und Studien hingegen wird aber diese Unterschiedlichkeit zum Teil zugunsten einer homogenisierenden Sprechweise über ›die‹ Care Leaver aufgegeben. Dabei wird insgesamt kaum eine macht- und ungleichheitstheoretische dekonstruierende Perspektive in den Diskursen über Care Leaver sichtbar. Dieses Verständnis liegt der vorliegenden Untersuchung zugrunde und wird in Kap. 2.4 entfaltet.
Diese Kritik an Kategorisierungen von Care Leavern, die an individuellen Fähigkeiten festgemacht wird, soll im Folgenden noch mit Überlegungen der Disability Studies unterstrichen werden. In den Disability Studies gibt es vielfältige Auseinandersetzungen darüber, was unter dem Begriff der ›Behinderung‹ zu fassen sei. Im sozialen Modell von Behinderung wird Behinderung als sozial hervorgebracht verstanden: »Das soziale Behinderungsmodell postuliert eine Dichotomie zwischen den zwei Ebenen des Behinderungsprozesses, der medizinisch oder psychologisch diagnostizierbaren Beeinträchtigung oder Schädigung (impairment) und der daraus resultierenden sozialen Benachteiligung (disability)« (Waldschmidt 2007, S. 57). In dieser Unterscheidung werden also einerseits feststellbare ›impairments‹ bestimmt und dabei dann die Folgen der Behinderung als sozial und institutionell hervorgebracht. An diesem Modell und der damit verbundenen Unterscheidung wird andererseits aber mit Bezugnahme auf Foucault eine starke Kritik geübt, da hier objektive Schädigungen an Körpern den sozialen Prozessen gegenübergestellt werden. In der Folge werden die Differenzen naturalisiert, was verschleiert, dass diese vermeintlich ›natürlichen‹ Differenzen auch Konstruktionen sind, die abhängig sind von historischen Machtverhältnissen (vgl. ebd., S. 57 ff.).
Aus diesen Überlegungen lässt sich für die Thematik der Care Leaver ableiten, dass zum einen mit der Bezugnahme auf ›Merkmale‹, die in den Studien zur Differenzierung der Gruppe herangezogen werden, die Gefahr besteht, diese diagnostizierbaren Merkmale zu naturalisieren. Zum anderen kann dadurch auch aus dem Blick geraten, was gesellschaftlich und institutionell an Bedingungen besteht, die den unterschiedlichen ›Merkmalen‹ überhaupt erst Bedeutung beimessen. Hier gibt es auch Hinweise darauf, dass die stationäre Kinder- und Jugendhilfe an der Herstellung von folgenreichen Differenzen mitbeteiligt ist. Damit besteht die Gefahr, aus dem Blick zu verlieren, dass Differenzziehungen und die darin zugrunde gelegten medizinisch oder psychologisch diagnostizierbaren Beeinträchtigungen gesellschaftlich hervorgebracht sind. Die Folge kann eine Überbetonung von Merkmalen von Subjekten auf naturalisierende Art und Weise sein, die eine De-Thematisierung von Machtverhältnissen mit sich bringt. Wie Differenz- und Ungleichheitsverhältnisse in der Sozialen Arbeit thematisiert werden und welche Schlussfolgerungen daraus für die vorliegende Untersuchung gezogen werden können, ist Gegenstand des folgenden Kapitels.
1.3Zur Thematisierung von Differenz- und Ungleichheitsverhältnissen in der Sozialen Arbeit
Die Thematisierung von Differenz- und Ungleichheitsverhältnissen in der Sozialen Arbeit ist Veränderungen unterworfen, gleichzeitig spielen Differenzen und Differenzverhältnisse eine zentrale Rolle: »Die Thematik ist grundlegend, weil die Thematisierung von Differenz(en) – in Form von Armut, Desintegration oder abweichendem Verhalten – überhaupt erst den Katalysator bereitgestellt hat für die institutionelle Etablierung Sozialer Arbeit« (Kessl/Plößer 2010, S. 7, Herv. i. O.). Gleichzeitig steht die Frage nach sozialer Ungleichheit und sozialer Gerechtigkeit von jeher im Fokus Sozialer Arbeit (vgl. Böhnisch/Schröer/Thiersch 2005, S. 247 ff.). So wird im Ansatz der Lebensweltorientierung proklamiert: »Das Konzept Lebensweltorientierung ist so gesehen ein Zugang, soziale Gerechtigkeit in den neuen sozialpolitischen Aufgaben der Hilfe und Unterstützung in den heutigen lebensweltlichen Bedingungen zu realisieren« (Grunwald/Thiersch 2004, S. 16). Trotz des Anspruches, soziale Gerechtigkeit zu realisieren, haben in den fachlichen Perspektiven Sozialer Arbeit das Thema und die Reflexion von Differenz- und Ungleichheitsverhältnissen für lange Zeit keine große Rolle gespielt (vgl. Leiprecht 2011a, S. 19 f.). Leiprecht rekonstruiert die Thematisierungen und De-Thematisierung von verschiedenen Differenzlinien in der Entwicklung Sozialer Arbeit und kommt zu dem Schluss, dass hier insbesondere Klassenverhältnisse lange im Zentrum der Theoriediskurse standen und andere Differenzverhältnisse bis in die 1990er-Jahren aus den Theoriediskursen eher ausgeklammert wurden (vgl. ebd.). Im weiteren Verlauf wurden dann Differenzen zwar aufgegriffen und es entwickelten sich differenzbezogene Ansätze rund um die Themen Gender, Migration oder auch Behinderung. Mecheril und Plößer weisen aber darauf hin, dass mit der Fokussierung auf eine Differenzkategorie immer potenziell andere de-thematisiert und ausgeblendet werden (vgl. Mecheril/Plößer 2011, S. 280). Seit ungefähr 2008 ist eine verstärkte Thematisierung von verschiedenen Differenzverhältnissen und deren Überlagerungen in der Sozialen Arbeit zu beobachten, was sich an zahlreichen Veröffentlichungen zu Diversity oder auch Intersektionalität festmachen lässt (bspw. Leiprecht 2008; Riegel 2012a; von Langsdorff 2012; Widersprüche 2012; von Langsdorff 2014). Aktuell ist allerdings zu beobachten, dass die Thematisierung von Diversity oder auch Intersektionalität in der Sozialen Arbeit bereits wieder nachgelassen hat.
Mit Bezugnahme auf Normalitätsvorstellungen wird begründet, wer überhaupt Zugang zu Sozialer Arbeit erhält. Hierbei spielen Differenzkonstruktionen eine zentrale Rolle für die Perspektive auf Problemkonstruktionen und die Markierung von Personen oder Gruppen, die Unterstützung benötigen. In der Betrachtung der Entwicklung der Diskurse um Differenzen und Differenzverhältnisse wird deutlich, wie stark diese wirkmächtigen Problemkonstruktionen und damit einher gehende Kategorisierungen einem Wandel unterworfen sind. Eine diversitätsbewusste Soziale Arbeit stellt eine Antwort dar für einen differenz- und ungleichheitssensiblen Umgang mit Differenzen (vgl. Leiprecht 2008). Dabei unterscheiden sich Diversity-Ansätze durchaus in ihren theoretischen Bezügen und Implikationen sowie den jeweiligen Zielsetzungen und reichen von (eher kulturalisierendem) ›Vielfalt anerkennen und zelebrieren‹ über ›Empowerment von marginalisierten bzw. diskriminierten Gruppen‹ oder ›Benachteiligungen und Diskriminierungen thematisieren und beseitigen‹ bis hin zu einer grundsätzlichen ›Kritik an gesellschaftlichen Macht- und Ungleichheitsverhältnissen‹. Als zentrale Prämissen, die in den unterschiedlichen Strömungen vorhanden sind, identifiziert Walgenbach die Bezugnahme auf soziale Gruppenmerkmale, einen Fokus auf die organisationale Ebene sowie eine positive Bezugnahme und Anerkennung von Ressourcen (vgl. Walgenbach 2014, S. 107 ff.). Mecheril und Plößer (2011, S. 282 ff.) benennen drei Hauptlinien von diversitätsbezogenen Ansätzen: Diversity als Anti-Diskriminierungsansatz, Diversity als Anerkennungsansatz und Diversity als Ressourcenansatz. Walgenbach unterscheidet ›affirmative Diversity-Management-Ansätze‹ und ›machtsensible Diversity-Ansätze‹, hebt aber hervor, dass es zwischen beiden Strömungen durchaus auch Überschneidungen gebe (vgl. Walgenbach 2014, S. 102). Leiprecht versteht diversitätsbewusste Soziale Arbeit im Sinne einer »Dachkonstruktion zur Orientierung, deren tragende Säulen die Perspektive der Antidiskriminierung, die Intersektionalität und die Subjektorientierung sind« (Leiprecht 2011b, S. 40). In dieser Perspektive sind die Macht- und Ungleichheitsverhältnisse explizit benannt und enthalten. Als Orientierung verstanden bietet so ein Konzept von Diversität bzw. Diversity das Potenzial für eine ungleichheitskritische pädagogische Haltung. Diversity zielt dabei auf Vielfalt und Diskriminierung entlang von Differenzkonstruktionen, wie z. B. Geschlecht, ›race‹/Ethnizität, Klasse, Körper, Generation. Damit bekommt also nicht nur das Thema der Differenzen Aufmerksamkeit, sondern es wird darin auch ein Verständnis sichtbar, das auf die Überlagerung von verschiedenen Differenzverhältnissen fokussiert.
Die Thematisierung von Differenzen in Diversity-Ansätzen kann kritisch auch als eine Form der Unterwerfung unter eine kapitalistische Logik der Anerkennung von Differenzen mit dem Ziel der ökonomischen Verwertung verstanden werden. Gleichzeitig ist mit Diversity auch immer die Gefahr verbunden, Menschen als Andere festzuschreiben, was auf die Widersprüchlichkeit des Konzeptes verweist:
»Das Selbst ist ohne das Andere nicht denkbar, weswegen es dilemmatisch bleibt, Diversity als Raum des Anderen zu zelebrieren, ohne die Prozesse des Othering selbst in Augenschein zu nehmen. Beim Versuch allerdings, Othering sichtbar und begreifbar zu machen, ist die kritische Stimme selber der Gefahr ausgesetzt, Othering zu reproduzieren.« (Castro Varela 2010, S. 257, Herv. i. O.)
Riegel hat sich mit den Widersprüchlichkeiten von pädagogischem Handeln in ihrer Studie zu »Bildung – Intersektionalität – Othering« (2016a) theoretisch und empirisch beschäftigt. Widersprüchlichkeiten ergeben sich zunächst auch durch das doppelte Mandat von Sozialer Arbeit zwischen Hilfe und Kontrolle (vgl. Riegel 2016a, S. 109 f.). Differenzen werden als Begründung für die Notwendigkeit sozialpädagogischer Angebote herangezogen. In diesem Sinne begründen sich also sozialpädagogische Angebote und sozialpädagogisches Handeln durch die Bezugnahmen auf Differenzen. Gleichzeitig gehört es zur Aufgabe sozialpädagogischer Interventionen, ihre Adressat*innen an Normalität anzupassen. Sozialpädagogik ist somit immer an der Reproduktion vorherrschender Vorstellungen von Normalität mitbeteiligt.
Eine weitere Widersprüchlichkeit im Umgang mit Differenzen ergibt sich hinsichtlich der Pole zwischen einer Thematisierung und der De-Thematisierung von Differenzen. Mit einer Thematisierung kann einerseits Empowerment verbunden sein; so liegt »in der Benennung von Differenz ein emanzipatorisches Potential des Zusammenschlusses von ›Gleichen‹« (ebd., S. 110). Gleichzeitig besteht dabei aber die Gefahr der Homogenisierung. Andererseits ist aber auch eine De-Thematisierung von Differenzen mit Gefahren verbunden, da so potenziell auch ungleiche Lebenslagen unbenannt bleiben (vgl. ebd., S. 111 ff.). Zuletzt zeigt die Studie von Riegel auf, dass auch in pädagogischen Praxen, die sich explizit für einen differenzsensiblen Zugang stark machen, dennoch vorherrschende Ungleichheitsverhältnisse reproduziert werden und Prozesse des Othering in die pädagogischen Diskurse und Praktiken Eingang finden (vgl. ebd., S. 310 ff.). Diese Ausführungen verdeutlichen, dass für die Frage nach Differenzverhältnissen im Feld der Hilfen zur Erziehung aus biographischer Perspektive widersprüchliche Verhältnisse als Rahmung für die Biographien bestehen.
So wird auf der Grundlage von Differenzkonstruktionen abweichendes Verhalten von Menschen oder auch ganzen Gruppen markiert, die eine Intervention durch die Soziale Arbeit begründen (vgl. Kessl/Plößer 2010, S. 7). Die Bezugnahme auf Normen und Differenzen durch die Soziale Arbeit zur Begründung ihrer Interventionen ist laufend Veränderungen unterworfen. Dabei ändert sich auch die Frage, auf welchen Notstand oder welche Problemkonstruktion durch Sozialpolitik reagiert wird (vgl. Maurer 2001, S. 126). Gisela Hauss zeigt in ihren Arbeiten auf, wie die Geschichte der Heimerziehung in der Schweiz eng mit Konstruktionen von Kindheit verbunden ist und wie diese mit normativen Vorstellungen von Familie einhergehen, die ebenfalls einem Wandel unterzogen sind (vgl. Hauss 2017, S. 179 ff.).
Soziale Arbeit agiert somit in gesellschaftlichen Verhältnissen, die in vielfältiger Weise durch soziale Differenzen, Grenzziehungen, Diskriminierungen und soziale Ungleichheiten geprägt sind: Ihre Rahmenbedingungen, ihre Aufgaben und Handlungsfelder werden durch diverse – zwar zu unterscheidende, aber dennoch nicht unabhängig voneinander wirkende – Macht- und Herrschaftsverhältnisse strukturiert (vgl. Rein/Riegel 2015). Soziale Differenzen bzw. Differenzlinien stellen zum einen Ordnungsmuster dar, »entlang derer Individuen sozial positioniert werden bzw. sich selber entlang dieser Kategorien positionieren« (Mecheril/Plößer 2011, S. 281). Diese Positionierungen und Verhältnisse strukturieren die Möglichkeitsräume der Adressat*innen und der Professionellen in ihrem pädagogischen Tun. Zum anderen trägt auch die Soziale Arbeit selbst in ihrer Organisation, ihrem Selbstverständnis, in Fach- und Alltagsdiskursen sowie in der sozialen Praxis zu Prozessen der Differenzierung, der Grenzziehung und Normalisierung (vgl. Maurer 2001; Kessl/Maurer 2010) bei und somit auch zu einer Reproduktion von gesellschaftlichen Dominanz- und Ungleichheitsverhältnissen.
Eine Frage, die für die vorliegende Studie entsteht, ist, wie Differenzverhältnisse und Normalitätsvorstellungen in Institutionen aus biographischer Perspektive erlebt werden und wie diese das Aufwachsen rahmen. Im Kontext von Schule liegen Studien vor, die Differenzverhältnisse im institutionellen Kontext der Schule aus einer biographischen Perspektive näher beleuchten. So hat Kleiner (2015) sich in ihrer Studie »subjekt. heteronormativität. bildung.« damit beschäftigt, wie Subjektbildung im Kontext von heteronormativen2 Ordnungen in Schulen von Jugendlichen erlebt wird, die sich als LGBTQ identifizieren. Mit Bezug auf Judith Butler geht sie der Frage nach, wie in alltäglichen Praktiken in der Schule und in Interaktionen geschlechtliche und sexuelle Subjekte hervorgebracht werden. Mit einer machttheoretischen Perspektive arbeitet sie die Folgen homophober Anrufungen von Schüler*innen heraus, die nicht heterosexuell begehren oder nicht bipolaren Geschlechternormen entsprechen. Dabei fokussiert Kleiner auch auf damit verbundene Umgangsstrategien. Die Institution der Schule fasst sie mit einer dekonstruktiven Perspektive als performativen Diskursraum: »Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens und der formalen Bildung, sondern auch ein Raum, in dem Normalitätsvorstellungen und normkonforme Verhaltensweisen reproduziert und verhandelt werden« (Kleiner 2016, S. 14). Institutionen wie die Schule sind mit dieser Perspektive Orte, an denen Normalitätsvorstellungen verhandelt werden. Dieser Gedanke ist auf die vorliegende Untersuchung anwendbar. Für die stationäre Jugendhilfe liegen bislang keine Studien vor, die mit explizit dekonstruktiver und poststrukturalistischer Perspektive die Institution der stationären Jugendhilfe als performativen Diskursraum verstehen, an dem Normalitätsordnungen reproduziert und Subjekte entlang dieser Ordnungen hervorgebracht werden. Die vorliegende Studie soll hierzu einen Beitrag leisten. Weiterhin wird deutlich, wie eng Differenzverhältnisse mit Normalitätsordnungen zusammenhängen.
1.4Normalität und Normalisierung in der Sozialen Arbeit
Die Studie von Jürgen Link (1996) zum Normalismus wird in den Diskussionen über Normalität vielfach rezipiert. Er versteht Normalismus »als ein Netz von Dispositiven […], durch das in ›modernen‹ Gesellschaften okzidentalen Typs seit mehr als zwei Jahrhunderten ›Normalitäten‹ produziert und reproduziert werden« (Link 2008, S. 59). Normalität durchdringt dabei beinahe alle Gesellschaftsbereiche, worüber Kontrolle und Regulation ausgeübt werden. In seiner diskursanalytischen Beschäftigung zeigt er auf, dass Normalität nicht eine menschliche Konstante ist, sondern eng im Zusammenhang mit modernen Gesellschaften steht (vgl. Link 1996, S. 15 ff.). Dabei unterscheidet er Normalität von Normativität, in der die moralischen Grundsätze einer Gesellschaft verankert sind. Geänderte Normalitäten verstanden als statistische Normalitäten führen dabei aber nicht immer zu Veränderungen von normativen Ordnungen und sind daher begrifflich zu unterscheiden (vgl. ebd., S. 23 ff.). Normativität als normative Orientierung löst in diesem Verständnis Ideologie als Orientierung in westlichen Gesellschaften ab (vgl. ebd., S. 81 ff.).
Dausien und Mecheril kritisieren diese Dualität bei Link zwischen Ideologie und Normalität bzw. Normativität und weisen darauf hin, dass Ideologien nach wie vor auch in sogenannten ›westlichen‹ Gesellschaften relevant sind. Sie begründen das u. a. mit der aktuell vorherrschenden Notwendigkeit, dass Subjekte Biographie- und Identitätsarbeit zu leisten haben. Dies kann aus ihrer Sicht »nur im Zusammenhang von ideologischen Diskursen verstanden werden, die diese Selbst-Praxen kontextualisieren, sozial legitimieren und gewissermaßen verwirklichen« (Dausien/Mecheril 2006, S. 163).
Mit dem Normalismus geht es Link um die Analyse einer normalistischen Gesellschaftsstruktur, wobei er auch auf die produktive Dimension dieses gesellschaftlichen Modells fokussiert. Die Kontrolle und Regulation sind in Verfahrensweisen festgehalten, mit denen bestimmt wird, was noch als ›normal‹ gilt und was als ›abweichend‹ markiert wird. Link unterscheidet zwei Strategien von Normalismus: zum einen eine protonormalistische und zum anderen eine flexibel-normalistische Form der Grenzziehung (vgl. Link 1996, S. 77 ff.). Diese beiden Strategien lassen sich nicht trennscharf voneinander abgrenzen und gehen ineinander über. Die protonormalistische Form schreibt rigide Grenzen der Normalität vor und definiert damit klare Zonen von Normalität in einem vergleichsweise engen Korridor, der an soziale und ethische Normen gebunden ist. Diese Norm ist dabei starr und nicht verhandelbar und Subjekte werden als Regierungsmodi auf eine Erfüllung von Normen hingeführt (vgl. Link 2008, S. 65 f.). Verbunden mit der flexibel-normalistischen Strategie hingegen sind weite Grenzen. Im flexibel-normalistischen Konzept ist Normalität einem Prozess unterworfen. Das, was heute als normal gilt, kann bereits morgen als abweichend markiert werden. Auch wenn die Grenzen zwischen Normalität und Nicht-Normalität fließend sind und laufend neu bestimmt werden, ist dennoch auch im flexiblen Normalismus eine Grenzziehung zwischen normal und nicht normal vorhanden. Im flexiblen Normalismus wird die Verantwortung für die Einhaltung der Normen den Subjekten übertragen; in dieser Regierungsform erhalten die Modi der Selbststeuerung zugunsten einer Fremdsteuerung durch bspw. Institutionen eine größere Bedeutung (vgl. ebd., S. 67 f.).
Damit verbunden sind Formen der Subjektivierung auf der Basis von Normalitätsordnungen: »Normalität ist eine Ordnung, die das Individuum justiert und ihm jene Selbstjustierung (ganz ›natürlich‹) aufnötigt, in der es sich in ein Subjekt verwandelt, handlungsfähig und unterworfen in einem Atemzug« (Dausien/Mecheril 2006, S. 163). Hier wird deutlich, wie Fragen der Normalität eng verwoben sind mit der Subjektbildung. Für die Untersuchung von Biographien im Kontext von stationärer Jugendhilfe folgt daraus eine Perspektive, die sensibilisiert ist für die Verwobenheit und Abhängigkeit der befragten Subjekte mit verschiedenen Normalitätsordnungen.
Neben dieser Frage der Verwobenheit von Subjekten mit Normalitätsordnungen spielt die Frage der Normalität auch in der Sozialen Arbeit eine Rolle. So hat sich Soziale Arbeit im Laufe ihrer Entwicklung als Instanz zum Schutze gesellschaftlicher Normalitätsstandards etabliert (vgl. Olk/Otto 1987, S. 11). Dabei zeigt sich aber in einer theoriegeschichtlichen Rekonstruktion Sozialer Arbeit, dass von einer vormals stark ausschließlich normativen Orientierung durch die kritische und empirische Wende ab den 1960er-Jahren eine Bedeutungsverschiebung stattgefunden hat hin zur Thematisierung Sozialer Arbeit als Institution sozialer Kontrolle. In der Folge haben die Begriffe der Norm und Normalität an Bedeutung gewonnen (vgl. Seelmeyer 2017, S. 29). Thomas Olk verweist auf die funktionale Bestimmung Sozialer Arbeit als »Normalisierungsarbeit« (Olk 1986, S. 12).
Auch Seelmeyer (2008) arbeitet heraus, dass Normalität und Normalisierung fest mit der Sozialen Arbeit verknüpft sind und zu deren Schlüsselelementen gehören. Er sieht drei unterschiedliche Nutzungsweisen der Begriffe Normalität und Normalisierung in der Sozialen Arbeit. Zunächst bietet Normalität eine Orientierung für erwünschte Praxen der Lebensführung der Adressat*innen Sozialer Arbeit. Als zweites wird damit auf einer konzeptionellen Ebene das Prinzip von alltagsnahen Angeboten gemeint, die sich an den lebensweltlichen Bezügen ihrer Adressat*innen orientieren. Mit dieser Strategie soll verhindert werden, dass aufgrund der Inanspruchnahme von Hilfe ein Ausschluss der Adressat*innen von Normalität entsteht. Zuletzt ist damit noch die Normalisierung von Sozialer Arbeit als Profession gemeint, also die zunehmende Etablierung als Disziplin und Profession (vgl. Seelmeyer 2008, S. 15 ff.).
Seelmeyer kommt zu dem Schluss, dass der Begriff der Normalität daher aktuell zentral für die Bestimmung der Aufgaben Sozialer Arbeit ist. Normalität wird dabei aber in sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen mit unterschiedlichen Inhalten gefüllt. Zum einen gibt es einen weiten Normalitätsbegriff, der Normalität im Sinne von Selbstverständlichkeit untersucht und sich darauf konzentriert, »wie Individuen in ihren Interaktionen Normalität herstellen« (Seelmeyer 2017, S. 26). Zum anderen wird mit einer engen Begriffsdefinition von Normalität selbige auf struktureller Ebene analysiert. Dabei wird auf statistische Verteilungen »von Merkmalen und Handlungsweisen von Individuen fokussiert« (ebd.), und in diesem Verständnis entsteht dann eine Differenz zwischen dem Normalen und der Ebene der Normativität. Dieses Verständnis von Normalität ist vergleichbar mit den oben dargestellten Überlegungen von Link (1996).
In aktuellen Diskursen wird auf das Spannungsfeld Sozialer Arbeit verwiesen zwischen »Normalitätsermöglichung und Normalisierung« (Kessl/Plößer 2010, S. 7). Aktuell wird die Frage um Normalität und Normalisierung viel mit Bezug auf Foucault diskutiert und bearbeitet. Diese Reflexion von Normalisierung als eine Strategie der Gouvernementalität Sozialer Arbeit, in deren Folge Subjekte regiert und normalisiert werden, hat in den letzten Jahren erhöhte Aufmerksamkeit erfahren (vgl. Seelmeyer/Kutscher 2011, S. 1126 f.).
In den Hilfen zur Erziehung hat sich Daniela Reimer in ihrer Studie mit den Normalitätskonstruktionen von Pflegekindern aus einer biographischen Perspektive beschäftigt (vgl. Reimer 2017). Ausgangslage der Untersuchung ist der Befund, dass das Aufwachsen in einer Pflegefamilie außerhalb von normativen Vorstellungen des Aufwachsens in einer leiblichen Familie stattfindet, was zu Bewältigungsanforderungen bei Pflegekindern führt. Das Interesse der Autorin ist es herauszuarbeiten, wie Jugendliche und junge Erwachsene mit dieser Abweichung ihres Aufwachsens biographisch umgehen.
Der Studie liegt ein Konzept von Normalitätsbalance zugrunde, das sich auf das Verhältnis zwischen einem Menschen sowie seinen Zielen und biographischen Wünschen einerseits und den gesellschaftlichen Normalitätserwartungen andererseits bezieht. Das Verständnis von Normalität basiert auf der Normalismustheorie von Link (vgl. ebd., S. 60 ff.). Auf der Grundlage der Grounded Theory arbeitet Reimer vier Typen von Normalitätskonstruktionen und Normalitätsbalance bei Pflegekindern heraus (vgl. ebd., S. 379 ff.). Die Autorin kommt zu dem Schluss, dass es für Pflegekinder erhöhter Anstrengungen bedarf, Normalität aufrechtzuerhalten und für sich in Anspruch zu nehmen. Als Konsequenz aus ihrer Studie für Angebote für Pflegekinder leitet sie die Notwendigkeit ab, »der Komplexität von Normalitätsprozessen bei Pflegekindern gerecht [zu] werden und Pflegekinder darin unterstützen [zu] können, die chancenreichen Konsequenzen der Normalitätskonstruktionen und -balancen weiter auszubauen« (ebd., S. 389).





























