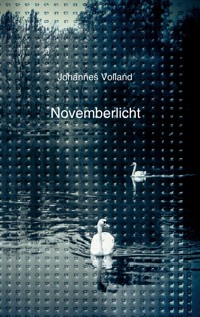
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Herbst 1989. Eigentlich sollte die WM66 längst auf dem Trockenen liegen. Da ihr Haupteigentümer jedoch im Spätsommer nach West-Berlin ausgereist ist und niemand mehr an das Boot gedacht hat, wippt es noch immer in der Nähe von Brandenburg am Steg auf und ab. Erst wenige Tage vor dem Mauerfall macht sich der damals zwanzigjährige Autor mit einem Freund auf den Weg, um das Kajütboot über die Flüsse in seine Heimatstadt Halle an der Saale zu überführen, wo es den Winter an Land verbringen soll. An sich würde ein Wochenende für die Fahrt ausreichen, wären da nicht das immer kürzer werdende Tageslicht und so mancherlei Missgeschick, dem sich die Bootsfahrer in der ostdeutschen Flusslandschaft gegenübersehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Graue Gischt umschmeichelt die Sperrholzplanken der WM66, als sie sich an diesem Novembertag ihren Weg über den Möserschen See bahnt. Erst vor wenigen Minuten haben wir abgelegt, um das Boot ins Paddlerheim nach Halle an der Saale zu manövrieren, wo es ein trockenes Winterlager finden soll.
Klaus sitzt mit gekreuzten Beinen vor der Kajüte und wir machen im leichten Gegenwind gute Fahrt. Hin und wieder mischen sich die Ausdünstungen meiner Gummijacke und eine Spur Zweitaktabgas in die Brise des Sees, während die Häuser von Kirchmöser langsam in den Hintergrund wandern und der Kiehnwerder mit seinen Bäumen vor uns immer größer wird.
Noch vor ein paar Monaten sprühte es hier nur so vor Leben. Jetzt aber ist der See kaum wiederzuerkennen – kein Sirren, kein Flimmern, kein Grün und auch kein grelles Sonnenlicht, in dem sich die braungebrannten Bootsfahrer tummelten. Unter ihnen die Bohème aus Halle, deren Herren im leger geknöpften Hemd mit Schneid ihre Segeljollen übers Wasser schnellen ließen. Selbst angetütert beherrschten sie ihre Boote aus dem Effeff und legten waghalsige Wendemanöver hin, um schließlich seidenweich auf dem Ufer der Kanincheninsel aufzusetzen. Die sonnendurchfluteten Nachmittage und Abende glichen einem nimmer enden wollenden Fest, bei dem die Hauptbeschäftigung darin bestand, am Strand an der Malge oder in Kirchmöser für Getränkenachschub zu sorgen. Es wurde geraucht, getrunken, lauthals debattiert, gelacht und selbst nach Einbruch der Dunkelheit noch so manches Ründchen auf dem See gedreht.
Nun jedoch ist alles grau, regungslos und leer. Eingehüllt in den monotonen Singsang unserer Forelle, die uns mit ihren 7,5 PS vorantreibt, werden wir in wenigen Augenblicken das offene Wasser des Plauer Sees erreichen, auf dem wir dann scharf backbord drehen, um Kurs gen Westen auf den Elbe-Havel-Kanal zu nehmen. Noch steckt mir der stramme Ritt im Trabi über die holprige Autobahn in den Gliedern, doch mit jedem weiteren Meter auf dem Wasser fällt ein Stück der Anspannung von mir ab. Ich atme die Kühle dieses Tages, die uns über den See entgegenweht, und frage mich, wie es uns nur hierher verschlagen konnte – auf diesen See und um diese Zeit. Der gleichmäßige Vortrieb und das sanfte Schunkeln lassen mein Zeitgefühl Welle für Welle in den Hintergrund wandern und unter dem weiten grauen Himmel beginne ich mich frei und gleichzeitig geborgen zu fühlen – wie einst, als ich im Garten meiner Oma im Babywagen lag und dem sanften Rauschen der Pappeln lauschte.
Das war jetzt über zwanzig Jahre her. Die Besatzung von Apollo 11 schaute vom Mond auf unsere Erde, während ich ihnen durch das endlose Blau über Halle an der Saale entgegenblinzelte und ein paar Sonnenstrahlen meine kleine Nase kitzelten. Die hohen Pappeln am unteren Ende des Gartens spendeten nachmittags angenehmen Schatten und nur hier und da huschten Lichttupfer über das Gras oder die Gesichter der in dieser Oase Erholung Suchenden.
Manchmal ließ sich mein Vater auf den Rücken ins Gras plumpsen und hielt mich strampelndes Würstchen mit ausgestreckten Armen über sich. Dann wuschelte er seinen Kaffee- und Zigarettendunst verströmenden Vollbart in mein Gesicht, was mich vor Lachen glucksen ließ, aber auch ganz schön kiekeln konnte.
Wir lebten damals noch bei meinen Großeltern im Haus, bevor wir in eine winzige Neubauwohnung mit Ofenheizung am Landrain zogen. Vom obersten Stockwerk aus hatten meine Schwester und ich einen grandiosen Blick auf den Gertraudenfriedhof und im Winter tummelten sich nachts die Schneeflocken im Schein der Peitschenleuchten entlang der Straße.
In diesem nördlichen Teil unserer mit Kohledunst geschwängerten Stadt wuchs ich heran und fühlte mich im Schoß meiner Familie angenehm aufgehoben, bis ich mit sechs in die Schule kam. Auch wenn mit dem Eintritt in die sozialistische POS ein neues Wertesystem in meine durch Elternhaus und Kindergarten christlich geprägte Welt Einzug hielt und ich mich oft wie die unstete Kugel zwischen den emsigen Fingern eines Jahrmarktflippers fühlte, hinderte mich dies in keiner Weise daran, das Leben mit Inbrunst zu umarmen und mit meinen Schulfreunden den Galgenberg oder das Terrain zwischen der Dessauer Brücke und der Ruine am Ende des Bergschenkenwegs mit Vehemenz unsicher zu machen.
Mit unseren abgetragenen Hosen am Leib warfen und traten wir in jeder freien Minute einen Ball, gruben Höhlen in den Bahndamm, fuhren Rollschuh oder Rad, schangelten, schaukelten oder wippten uns in Ekstase, kaupelten Murmeln und Matchbox, schlichen als Räuber und Gendarm durchs Unterholz, stürzten uns Purzelbaum schlagend den Hang hinunter, kletterten auf Felsen, Bäume und Masten, verkauften alten Leuten Solidaritätsmarken, machten Klingelpartie, sammelten Flaschen, Gläser und Altpapier, um sie beim SERO gegen Bares einzutauschen, holten uns Brötchen und Drops im Konsum an der Ecke, rodelten, glanderten oder rasten todesmutig auf Gleitschuhen die Pisten des Galgenbergs hinab, kringelten uns vor Lachen über Plakate an Litfaßsäulen, reisten auf Motorradwracks durchs Universum, wurden von jugendlichen Heiminsassen gekidnappt und wieder freigelassen, erröteten im Gebüsch beim ersten Liebesskat, holten Äpfel aus der Plantage, rupften Maiskolben vom Stängel, sackten Schoten grüner Erbsen in unsere Dederonbeutel oder bissen in die gelben Birnen des Bergschenkenwegs.
Wir ließen selbstgebaute Fallschirme mit Klammermännchen durch die Luft schweben, fuhren auf dem Mötzlicher See in Ermangelung von Gummistiefeln mit Plastiktüten über den Schuhen Floß, zielten mit Erbsgewehren auf leere Schnapsfläschchen und sprangen vom höchsten Gipfel des Heuhaufens, auf dass es im Bauch nur so kribbelte.
Nach der zehnten Klasse ging ich bei der Bahn als Elektriker in die Lehre. Die Deutsche Reichsbahn, so versicherte man mir dort, war der „Staat im Staate“, was ein besonders straffes Regiment erwarten lassen sollte. Für mich war dieser Umstand jedoch keineswegs von Nachteil, da er mich und meine Lehrlingskumpels umso deutlicher erfahren ließ, wie bunt das Leben auch in einem von Uniformen und starren Regeln durchzogenen System sein konnte.
Unsere Clique, die Popper, Stinos und Punks ohne Vorbehalt in sich vereinte, zog es jedes Wochenende nach gemeinsamem Vorglühen in einer der elterlichen Wohnungen in eine Disco. Nach zähen Tagen zwischen elektrischen Formeln und verbrannten Schützkontakten dürstete es uns nach dieser Auszeit, nach dem von der Frau in Kittelschürze ausgeschenkten Cola-Wodka, den geschminkten, schwitzenden Mädels und den westlichen Beats im hohen Dezibelbereich. Ob im Schmett auf Lehmannsfelsen, zur Pop-Parade im Volkspark oder dank der uns kostenfrei zur Verfügung gestellten Bahnfahrten im Fünfzig-Kilometer-Naherholungsradius auch mal in Leipzig – wir feierten die Wochenenden und wir feierten den Raum, den uns die graue Kulisse des Alltags übrigließ.
In den späteren Achtzigern – ich machte bereits Abendabitur an der Volkshochschule – spielte sich der Abriss weiter Teile der halleschen Innenstadt direkt vor meinen Augen und hin und wieder auch vor der Linse meiner POUVA Start SL100 ab. Immer häufiger begann ich mich zu fragen, wie, angesichts der vom Kohle- und Aschestaub geschwärzten, zusehends verfallenden Häuser und der maroden Betriebe, die Zukunft unserer Stadt und unseres Landes wohl aussehen mochte. Dank Gorbatschow schwappten zwar trotz Sputnik-Leseverbots Gedanken von Glasnost und Perestroika zu uns, doch als immer mehr Leute ihre Trabis und Wartburgs in Ungarn am Wegesrand stehen ließen und das Loch im Eisernen Vorhang nutzten, um gen Westen zu ziehen, wuchsen die Fragezeichen in mir umso mehr.
Von meinen Freunden, mit denen ich nach meinen Lehr- und Discojahren in der Gose oder an lauen Sommerabenden auch auf der ein oder anderen Parkbank Bier getrunken hatte, befanden sich im Herbst 89 nur noch wenige im sozialistischen Wirtschaftsgebiet. Selbst meine große Schwester, der ich im Sommer nicht selten einen Besuch abgestattet hatte, hatte sich per Ausreiseantrag mit Mann und Sohn nach Berlin-West verabschiedet.
So traf es sich, dass ich gut zwanzig Jahre nach der ersten Mondlandung in der verlassenen, jedoch noch komplett eingerichteten Dreizimmerwohnung meiner Schwester – ich hatte zwischenzeitlich selbst Quartier dort bezogen – vor dem großen Schwarzweißfernseher lungerte und der live übertragenen Rede des Staatsratsvorsitzenden zum vierzigsten Jahrestag der DDR lauschte.
Nicht, dass mich Erich Honeckers Reden sonderlich interessiert oder gar vom Hocker gerissen hätten. Was er bezüglich der Planerfüllung und der Errungenschaften zum Wohle der Werktätigen zu sagen hatte, wie auch seine sich mit verlässlicher Regelmäßigkeit überschlagende Stimme, löste in mir jedes Mal einen unwillkürlichen Gähnreflex aus, der mich spätestens nach zwei Minuten zumindest mental abschalten ließ. Dieses Mal jedoch strengte ich mich an, diesen Reflex zu überwinden, und harrte vor dem gräulichen Geflimmer aus, das über die Gemeinschaftsantenne in die dumpfigen Räume der Erdgeschosswohnung waberte. Wort um Wort, Satz um Satz wartete ich ungeduldig auf ein Zeichen, das einen Hoffnungsschimmer auf eine, wenn auch noch so kleine Öffnung des Landes verheißen könnte. Tausende waren im Sommer über Ungarn oder die Tschechoslowakei geflohen und immer mehr Menschen demonstrierten Montag für Montag auf den Straßen, doch seine steife Rede schaffte es selbst in diesen bewegten Zeiten nicht, auch nur mit einer Silbe Bezug darauf zu nehmen. Als die Tortur des Vortrags schließlich ihr Ende gefunden hatte, schob ich meine herabgesunkene Kinnlade wieder rauf und schaltete den Fernseher aus.
Nun war es still. Kein Motorengeräusch, kein Fahrradgeklapper, auch keine Schritte waren von draußen zu hören. Nicht einmal das Fensterguckerpärchen von Gegenüber grölte eine Obszönität nach unten auf die Straße.
Kalten Rauch verströmend verharrte mein selbstgetöpferter Aschenbecher auf dem großen runden Couchtisch. Grünlich glasiert in der dreieckigen Form einer miniaturisierten Zuckerschütte mit geschwungenem Henkel drohte er, jeden Moment überzuquellen. Dem Tisch waren zum Zweck der Gemütlichkeit die Beine ein Stück abgesägt und sein ehemals roter Anstrich durch ein kunstvoll in mehreren Dunkeltönen aufgepinseltes Blau ersetzt worden. So nahm er sich vor dem grünen Ecksofa „Yvonne“ recht passabel aus. Der Aschenbecher hatte etwas von einem überfüllten Boot, das ziellos im Meer umhertrieb.
Mein Blick fiel auf die zerknitterte Packung Kenton Blau am Tischrand. Ich langte danach und pulte mit dem Zeigefinger in der zerdrückten Stanniolöffnung. Tatsächlich versteckte sich noch genau eine Zigarette darin. In diesem Moment kam mir unser Kajütboot in den Sinn. Eigentlich müsste es noch immer in Kirchmöser bei Brandenburg am Steg liegen und sanft in der Herbstsonne auf und ab wippen.
Da man nicht wissen konnte, wie lange es mit der Genehmigung eines Ausreiseantrags dauern konnte oder ob er überhaupt jemals genehmigt wurde, hatten mein Schwager und ich uns im Frühjahr nicht davon abhalten lassen, bei einem älteren Herrn aus Potsdam ein hölzernes Kajütboot zu erstehen. Er hatte es mit viel Mühe und Geschick eigenhändig aus Sperrholz gebaut und dabei dem Typ „Spree“ nachempfunden. Der Typ „Spree“ zeichnete sich durch einen Bug mit gerader Kante aus, der nicht wie üblich vorne spitz zusammenlief. Dies war besonders zum Baden sehr praktisch, da man einerseits vom Bug aus, wie von einem Startblock, ins Wasser springen konnte und andererseits leichter wieder aufs Boot zurückkam. Finanziell hatte sich mein Schwager zu zwei Dritteln und ich mich zu einem Drittel am Erwerb beteiligt. Den Sommer über hatte er dann mit Frau und Sohn die meisten Wochenenden im Brandenburgischen an Bord verbracht.
Doch nun nahte schon bald der Winter und was sollte dann aus dem Boot werden? Im Trubel des vom Thema Ausreise beherrschten Spätsommers hatten wir jeglichen Gedanken an das Boot erfolgreich verdrängt. Bei einem der nächsten Telefonate mit der Familie meiner Schwester, die seit ihrer Ausreise jeden Donnerstagabend um halb acht am Apparat meiner Eltern stattfanden, sollten wir unbedingt besprechen, was aus dem Boot werden soll, bevor es womöglich noch vom Eis zerdrückt wird.
Zuerst standen für die nächsten Tage jedoch noch ein paar Arbeitseinsätze an der Döblitzer Dorfkirche auf dem Plan.





























