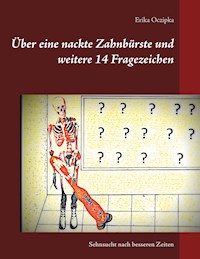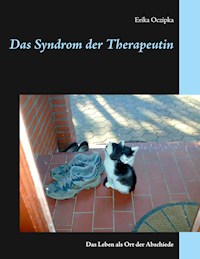Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Der Architekt Thomas bezieht mit seiner Frau Katharina ein kleines Bauernhaus in der Vulkaneifel. Die ersten Begegnungen in diesem Dorf auf der Hoehe finden mit einem alten Bauern statt, der nur auf die beiden gewartet zu haben scheint, um endlich seine Geschichten und Erlebnisse weitergeben zu koennen. Sie umfassen viele Lebensbereiche und Epochen, von Kriegen bis hin zu ganz persoenlichen Dramen. Mit dem Tod des Bauern wird eine Luecke gerissen, aber es bleiben wenigstens diese Episoden erhalten. Mit seiner eigenen Sprache, aber auch im Versuch der Anpassung an die Sprache der neuen Umgebung erschafft der Autor eine kleine Chronik für diesen Landstrich, aus der Waerme und Verstaendnis sprechen für Verhalten und Lebensweise der Menschen hier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wie ein alter Bauer aus der Vulkaneifel
zwei entwurzelte Städter
beeindruckt
und gegen den nahenden Tod erzählt
Inhaltsverzeichnis
Erste Annäherung
Der Reigen beginnt – Christina und die Wölfe
Das Sandsteinkreuz aus dem 30jährigen Krieg
Kurz in der Stadt – Und dann das Grab im Schnee
Vater und Sohn – Vor der Hochzeit
Racheschwüre
Wie wir uns verändern
Die Fortsetzung folgt unweigerlich – zwei Fremde
In der Jetztzeit – im Wald
Änderung der Methode – Zwei Fremde, zweiter Teil
Wir erobern weiter unsere neue Umgebung
Über die Architektur
Der alte Bauer und sein Sohn, ein Wettstreit
Die Geschichte von Hanni, wie er 90 wird
Der alte Bauer und sein Sohn – im Wettstreit
Hanni stirbt noch lange nicht
Wie es dem Alten sagen, dass wir erst im Frühjahr wieder kommen
Elias und der Keiler, eine Reise in die politische Vergangenheit
Ein schwerer Abschied
Sehnsucht nach der Eifel
Abschied vor dem Abschied
Der Tag ist gekommen
Erste Annäherung
Wir haben es endlich wahr gemacht, wir sind der Stadt entflohen. Unser Leben ist auf den Füßen gelandet nach einem gewaltsamen Absprung von einem bedrohten Podest, ohne dass zu ahnen war und eigentlich ist es immer noch unausdenkbar, wie unser Abenteuer enden wird.
Mein Mann Thomas hat den Auftrag erhalten, für einen renommierten Verlag ein Buch zu schreiben, eine Aufarbeitung all dessen, was alltägliche Architektur ausmacht. Es liegt ihm etwas daran, dass er sich für dieses Projekt zeitweise aus dem Büro zurückzieht, die Leitung der Geschäfte seinem Freund Zehnpfennig überlässt, aber er will unbedingt immer von Donnerstag bis Sonntag in diesem Eifeldorf sein. Ich weiß nicht, wie das für mich werden wird.
Natürlich bin ich nicht unschuldig an seinem Entschluss. Ich hätte nicht mehr lange mit ihm in der Stadt gelebt, unter dem unmenschlichen Druck durch des Büros, durch Lärm und Gestank.
Unser Haus liegt auf einer kleinen Anhöhe, die von der Kirche besetzt ist. Von meinem Fenster sehe ich auf den Rand eines Kraterkegels, bei dessen Anblick mir auch bei bemühter Phantasie nicht der Begriff Vulkan einfällt, der dennoch hier eher als sonst wo in dieser Gegend, die reich ist an vulkanischen Bewegungen, zuzutreffen scheint.
Alles kommt mir so ärmlich vor, die rostigen Dächer, die kaum verputzten Häuser. Schlimmer scheinen noch die Lücken, die der Unverstand in den Ortskern geschlagen hat, aber auch die Bemühungen der Dorfbewohner, neuzeitlichen, quasi städtischen Charakter ihrer Häuser vorzutäuschen durch Alufenster und Verbundpflaster.
Vielleicht ist es noch zu früh, mir ein solches Urteil zu erlauben. Das, was einmal unser Garten werden soll, ist einstweilen ein öder Schuttplatz, über den hinwegzusehen ich mich bemühen muss. Thomas macht sich nicht klar, was es bedeutet, auch nur dieses kleine Stück Land urbar zu machen. Aber er, der noch nie einen Spaten in der Hand gehabt hat, ist guten Mutes, seine Begeisterung für das Landleben furchteinflößend.
Das Dorf hat ungefähr achthundert Einwohner. Auf der Straße grüßen sich alle, nur ein paar Fremde außer uns zieren sich. Neulich sagte ich einer Frau Guten Tag, worauf sie mich hochmütig fragte: „Warum grüßen Sie mich, ich kenne Sie doch gar nicht.“ Es bedarf sicher einiger Zeit, um diese Dorfbewohner zu verstehen. Das gilt besonders für ihren merkwürdigen Dialekt, eine holprige Aneinanderreihung von Guttural- und Zischlauten.
Ich weiß nicht, ob ich es betonen soll, aber wir sind ganz zufällig hier gelandet, ohne mehr zu wissen über diese Gegend, als dass es sich um die Südeifel handelt und um ein renoviertes Bauernhaus.
Wir wussten weder etwas von der Geschichte dieses Bodens und den ihn bewohnenden Menschen, Tieren, Pflanzen, noch von ihrem gegenwärtigen Zustand. Nicht besser sind wir hierhergekommen als viele Touristen, die irgendwo in der Welt aussteigen, etwas sehen oder auch nicht sehen, von einer ungeheuren Beliebigkeit erfasst, angetrieben, um wie eine uninteressante Flaschenpost wieder ins Meer geworfen, an anderer Stelle auf festen Grund zu stoßen.
Irgendetwas hielt uns aber hier, vielleicht ein Blick, zwei vollkommen gleich gewachsene Straßenbäume in kräftig gefärbtem gelborange aufschießendem Herbstlaub. Ich weiß nicht, was es war, vielleicht die verlassene, ärmliche Öde des Ortes, die freundliche Verschlossenheit der Wirtin im Gasthof, wo wir an jenem Sonntag zu Mittag aßen.
Thomas meinte, sie habe ihn an seine vor kurzem gestorbene Mutter erinnert, mit ihren leicht vorstehenden, wasserhellen Augen, der breiten Sattelnase, den energischen, doch auf seltsame Weise zerstreut wirkenden Bewegungen, mit denen sie uns das Essen auf den Tisch stellte.
Ich habe seine Mutter kaum kennen gelernt, ich kann dergleichen nicht beurteilen. Jedenfalls haben wir auf der Rückfahrt in unsere Großstadt hin und herüberlegt. Beim Aussteigen stellten wir fest, dass wir uns einig waren: wir wollten unser Leben ändern und dieser schien ein angemessener Ort dafür.
Eigentlich ist Thomas, ebenso wie ich, ein Entwurzelter. Wer weiß, wie sich das Wurzelgeflecht, das hier dicht alles fein überzieht, auf uns auswirkt.
Manchmal habe ich Angst davor, von tentakelnden Saugnäpfen festgehalten zu werden, von den Saugnäpfen eines Tieres, das in die Welt der Fabeln verbannt worden ist. Als ich davon träumte, vor ein paar Tagen, hatte es das rote Gesicht dieses alten Bauern, der mit dem Argument, er sei unser Nachbar und wolle uns helfen, uns seit unserem Einzug auflauert.
Gestern kam er das erste Mal in unsere Küche, nahm seine Mütze ab, ein ehemals wohl grünes Stoffding, an dem außer Stroh auch einiger Mist zu hängen schien, war mit einer Bereitwilligkeit meiner Einladung gefolgt, die ihr Gegengewicht darin fand, dass er sich stur weigerte, etwas zu trinken anzunehmen. Die klobigen Hände hielten die Kappe auf seinen Knien, drehten sie hin und her, man sah den Fingern an, dass sie ein Leben lang gegriffen, sich zu Fäusten geballt hatten. Die gelben Nägel eher wie abgebrochene Krallen, der kleinmassige Körper in weiter, wie sich herausstellen sollte, selten ordentlich geschlossener, dunkelgrüner Kordhose, wollenem, an der Brust bei jedem Wetter weit geöffnetem Hemd.
Listig und lebhaft blickten seine Augen, leicht wässrigblau. Wenn er sich ärgerte, etwa wenn Thomas von Politik anfing, schob sich ein stumpfer Ton wie ein Filter über sie. Welcher Ernst dann von seinen wenigen weißen Haarsträhnen, von denen einige sich zu sträuben schienen, ausging.
Ich hatte, als er sich auf den Küchenstuhl setzte, Angst, der würde zusammenbrechen unter dem Gewicht dieser Muskelmasse. Der Alte war alles andere als grob und gewalttätig, obwohl er gern darauf anspielte, und das bezog sich gleichermaßen auf seine körperlichen Kräfte wie auf seine Härte, zum Beispiel überflüssige Jungkatzen erst gegen die Hauswand zu schlagen, um sie dann auf den Mist zu werfen.
Im Gegensatz zu Thomas, der ihm zu glauben scheint, habe ich sofort durchschaut, dass es sich um eine Attitüde handelt, obwohl ich nicht ausschließen möchte, dass er zu Gewalttaten fähig sein könnte. Dieser alte Mann scheint ein beängstigendes Mitteilungsbedürfnis zu haben. Und er weiß alles - besser, mein Vater könnte da sitzen, aber immerhin, wenn nicht die Rede auf den Krieg kommt, erfährt man einiges über diese Gegend: Die Eifel als Lebensraum von Menschen ist mir neu, bislang wäre mir dieses Mittelgebirge nur als Erholungsraum für Großstädter in den Sinn gekommen.
Thomas animiert den alten Bauern zu erzählen, der wartet kaum auf Ermunterungen: Ich glaube, er wird von etwas getrieben. Vielleicht hat er eine nicht abweisbare Angst vor dem Verstummen. Die Anknüpfungspunkte sind irgendwelche Fragen, Probleme, die mit dem Haus, dem Garten zusammenhängen, aber bald - ein von der Leine gelöster Hund - suchen seine Worte die Fährte der Vergangenheit.
Als Thomas sich eine Zigarre anzündete, interessierte er sich für die Marke - es war eine Ouro do Brasil - fing dann aber furchtbar an zu husten, lief röter an, erzählte, als er sich scheinbar beruhigt hatte, dass ihn seine Krankheit schnell umbringen könne, er würde ersticken bei einem seiner Asthmaanfälle, irgendein Wetter, ein Luftdruck werde ihn umbringen. Das klang so, als nahe eine nur für ihn bestimmte Konstellation und als quäle ihn die Ungewissheit des zu erwartenden Überfalls. Seine Stimme hatte trotz eines schleppenden Tonfalls, der vielleicht daher kam, dass er sich bemühte, Hochdeutsch zu sprechen, etwas unruhig Gehetztes, das keine Pausen duldete.
An diesem ersten Abend, als er hereingekommen war, die Küche erfüllte mit einem zunächst nicht erklärlichen strengen Geruch, die Linde auf dem kleinen Hof, an den unsere Grundstücke grenzten, begann sich in phantastischen Kindheitsfarben zu illuminieren, fragte ihn Thomas nach einem merkwürdigen Wegkreuz, das wir auf einem Höhenweg entdeckt hatten: „Es handelt sich um ein schlichtes Barockkreuz, aber die Inschrift ist von beängstigender Frische, wie ich es von einem im Aachener Grenzwald versteckten Stein kenne, der errichtet worden ist zum Gedenken an einen Ermordeten, dem es nicht gelungen war, von der lichten Höhe des heutigen Stadtwaldes die merkwürdige Kuppel des Kaiserdomes zu sehen. Kennen Sie diesen Stein?“
Der Alte schnaufte: „Und ob ich diesen Stein kenne. Es gibt in unserem Gemeindebezirk keinen Stein, von dem ich nicht weiß. Die einen sind verwittert, die anderen im Unterholz verschwunden. Ich bin der einzige, der davon weiß.“
Wir erwarteten, nun die Geschichte, die sich an den Gedenkstein knüpfte, zu hören, aber der Alte wurde plötzlich unruhig, als fürchte er ihre Preisgabe, als erfasse ihn Misstrauen gegen uns Fremde, wie er einmal, ganz am Anfang unserer Bekanntschaft in einem Gespräch über selten gewordene Pflanzen und Tiere feststellte: „Besser, man erzählt nichts davon. Sonst kommen die Städter in Scharen und zertrampeln alles.“ Es war klar, dass wir dabei mit eingeschlossen waren. Der Alte stand auf, erklärte, er müsse jetzt das Vieh füttern, die Geschichte könne er ja anderntags erzählen, stand vor der niedrigen Küchentür, deren Glasscheibe seine massige Gestalt widerspiegelte, drehte seine Mütze in den Händen, ehe er sie aufsetzte, und ging.
Wir blieben ratlos zurück, verstanden nicht, warum er etwas ankündigte, uns neugierig werden ließ, um uns dann mit unserer ungelösten Spannung zurückzulassen.
Ich muss zugeben, ich war einigermaßen verärgert und kündigte Thomas an, dass ich den Bauern, falls er die Stirn haben sollte, anderentags tatsächlich Einlass zu begehren, die Tür wiese. Ich erwartete, Thomas würde sich aufregen über meine nicht sehr ernst gemeinte Verärgerung, aber er sagte ganz ruhig, nachdenklich, wie ich ihn mir immer gewünscht hatte, worauf ich so lange vergeblich gewartet hatte: „Er spricht gegen den Tod an. Ich mag ja nicht viel spüren, aber das merke ich genau. Er hat Angst, uns zu schnell zu viel zu erzählen, weil damit seine Lebensspanne erheblich reduziert würde. Je länger er erzählt, desto länger hat er zu leben.“
Ich sah Thomas an, als sei die Stimme eines Geistes aus seinem Mund zu hören. Ich habe ja bemerkt, dass er sich veränderte, aber dass es so rasch zu seltsamen Äußerungen kommen konnte, verwunderte mich doch. Meine Erwiderung, dass, wenn er sich auf solch eigenartige Spekulationen einließe, er seine Arbeit nie zu Ende bringen würde, störte ihn überhaupt nicht. Er hatte, wie man so sagt, wenn einer sich ungewöhnlich benimmt, an dem Alten einen Narren gefressen.
Und ich finde, er macht sich lächerlich, wie er sich Anweisungen geben lässt, er, der erfolgreiche Architekt, sich von einem dicken, kleinen, rotgesichtigen Bauern sagen lässt, wie man Holz hackt. Thomas übertreibt ganz entschieden mit seiner Sehnsucht nach dem einfachen Leben, womit er sich im Dorf nur unmöglich macht. Die Dorfbewohner verstehen das nicht und machen sich über ihn lustig. Das ist unerträglich. Thomas wischt es weg: Das verstehst du nicht, Katharina, für mich beginnt ein neues Leben. Den Schaft einer Spaltaxt anzufassen, diesen dicken Buchenstamm vor dir ins Auge zu fassen, zu lernen, an der richtigen Stelle den ersten wuchtigen Schlag zu setzen, das ist Leben. Lass’ auch unsere sogenannten Freunde in der Stadt lachen. Ich finde den Zusammenhang mit der Natur.“
Meinen Vorschlag, da er unser Haus unbedingt mittels Holz und drei Öfen beheizen wollte, das Brennmaterial liefern zu lassen, lehnte er ab. Er will es selber verarbeiten, zitiert den albernen Spruch des Bauern, dass einem auf diese Weise dreimal warm würde: beim Holzrücken aus dem Wald, beim Spalten bzw. Kleinhacken und beim Heizen. Als ich ihm vorhielt, er wäre verantwortlich dafür, dass die letzten Buchen abgehackt würden, meinte er, die würden sowieso gefällt. Natürlich ist das ein Symbol. Aber auch ein Anachronismus. Dass einer, der immer nur in Großstädten gelebt hat, mit vierzig Jahren darauf kommt, den Ursprung zu suchen.
Auf unserer stundenlangen Wanderung an diesem Tag fand er schon wieder Wegkreuze, eine Kapelle, nach deren Geschichte er am Abend den Bauern fragen will. Ein gelinder Südwestwind an diesem Spätsommertag schuf milde Konturen, ließ das nahe Moseltal deutlich erkennbar werden. Die Farben waren von ungewöhnlicher pastellener Milde.
Ich hörte den Schritt des Bauern, langsam, bedächtig, wie zögernd, dennoch zielstrebig.
Der Reigen beginnt – Christina und die Wölfe
Wir nahmen in der Küche Platz; es wird sich ein Ritual daraus entwickeln, und ich wusste nicht, ob ich mich darüber freuen oder es als Belästigung ansehen sollte. Diese Urindunstglocke, unter der der Alte saß wie unter einer Tarnkappe, war jedenfalls eine.
Thomas sagte im Scherz: „Meine Frau hätte Sie fast nicht hereingelassen, weil Sie gestern die Geschichte nicht erzählt haben.“ Der Alte hob seine schweren Hände halb, ließ sie dann auf seine Schenkel fallen: „Ihr müsst mich verstehen, ich kann nicht so viel auf einmal erzählen. Wenn ich nicht mehr weiterweiß, wird mich meine Angst umbringen. Ich bin schwer krank, es kann mich jederzeit treffen.“ Er wischte mit seinem Handrücken über die Stirn, als wolle er etwas verscheuchen. Wir sahen ihn ungläubig an. Dieser starke, dicke, alte Mann sollte todkrank sein! Er ergriff wieder das Wort auf seine schleppend insistierende Weise: „Ja, ja, deswegen fahr ich ungern allein aufs Feld. Aber was das Wegkreuz betrifft, von dem wir’s gestern hatten:
Es war vor dem ersten napoleonischen Krieg, tiefer Winter; die Kinder der Christina Schmitz aus Bleckhausen waren seit Tagen unruhig. Sie waren krank. Ihre Augen glänzten vom Fieber. Christina hatte es schwer in ihrer Einsamkeit. Der Mann war schon so lange tot, die drei Kinder erinnerten sie täglich an ihn. Das war ein Trost. Sie war eine kräftige Frau, ja, sogar stolz wurde sie genannt im Dorf, denn sie hatte alle Hilfe abgelehnt, als sie Witwe geworden war. Sie wollte und konnte für sich und die Kinder sorgen; niemand sollte ihr nachsagen, sie vernachlässige das Geringste. Sie hatte hart zupackende Hände und Muskeln wie ein Mann. Die Geburten schienen sie nur gestärkt zu haben. Sie hatte Braten im Ofen, Futter für Helga und Susanna, die beiden Kühe im winzigen Stall, für die Muttersau, die Hühner. Den Kindern hatte es an nichts gemangelt. Sie waren auch gut gediehen, neun, sieben und fünf Jahre, bis zu dem Tag, als die Kleinste anfing zu husten und es nicht lange dauerte, bis die anderen auch husteten, Andreas, der Älteste, der schon helfen konnte, Thomas, der Mittlere, von Maria angesteckt, und die von wem?
Christina stützte sich einen Moment auf die fichtene Platte des Tisches, die Kinder wimmerten leise in der Kammer. Das ging nun schon Tage, eigentlich, seitdem der Nordoststurm zu toben angefangen hatte.
Alles hatte sie probiert, Wickel, Kompressen, Kamillentee, es war keine Linderung zu spüren gewesen. So konnte das nicht weitergehen. Mit einem kleinen Ruck stieß sie sich von der Tischplatte ab. Sie musste zum Doktor, Arznei holen in Manderscheid, oder aber ihn selber. Es musste gewagt werden. Die Kinder starben ihr sonst unter der Hand.
Sie hatte einen Entschluss gefasst, ging in die Kammer, holte aus der Wäschelade ihr Erspartes, wenige Münzen klingelten leise. Andreas stemmte mühsam seinen Kopf hoch: „Mutter, was machst du? Ich bin so durstig.“ Sie setzte sich neben ihn: „Geh, bleib du ruhig. Ich hol’ Arznei aus Manderscheid. Du bist der Älteste, pass auf.“ Sie gab ihm zu trinken. Die Kleine dämmerte. Christina spürte einen Stoß, ein wehes Zerreißen. Hilfe musste her!
In der Küche warf sie einige Scheite aufs Feuer. Das sollte reichen bis zu ihrer Rückkehr. Das Heulen des Sturms hatte sich abgeschwächt, klang wie ein Winseln, um manchmal tückisch in anderen Lauten aufzuleben.
Sie horchte hinaus. - Ja, da war ein anderer Ton. Was hatten die Leute erzählt von Wölfen? Sie hatte keine Furcht. Der festgewebte, bergende Umhang, nun der dicke wollene Schal. Als sie vor die Tür trat, hörte sie wieder, deutlicher den fremden Laut. Christina trat in den Holzschuppen, löste mit entschlossenem Griff die langstielige Axt vom Hackklotz. Sollten sie ruhig lachen, die feinen Nachbarn. Sie würde zurückkehren. Der Michel, der ein Haus weiter allein wohnte, trat gerade aus dem Stall, als sie vorüberwollte.
„Wo gehst denn hin, Christina, ist kein Wetter, spazieren zu gehen.“ „Die Kinder sind krank, sie gehen mir tot. Ich will nach Manderscheid zum Doktor.“ „Sei vorsichtig, man redet von Wölfen. Wenn du wartest, am Abend komm ich mit.“ „Danke. Ich muss gleich.“ Sie wies auf die Axt, stapfte durch den klirrend brechenden Schnee. Mutig war sie, brauchte keine Hilfe, schon gar nicht von dem, der ihr nachstellte, wo es ging. Die Häuser verschwanden.
Es war nicht weit, in drei Stunden konnte sie zurück sein. Der Schnee war auf der Höhe fortgeweht. Es war leichtes Gehen. Nur die Axt wurde ihr schwer. Die Gedanken an die Kinder. Warum hatte sie sich so belastet. Im Südwesten überm hochgefächerten Mosenberg zeigte sich ein heller graurosiger Streifen. Sie mochte Glück haben. Der Wind jaulte auf, unvermutet. Christina wandte sich um. Aus der dunkelgrauen Wolkenwand schossen weiß pfeilende Schneeflocken.
Sie stapfte weiter. Bei jedem Schritt brach klirrend die Eisschicht, die auf der Schneedecke lag. Flockenwirbel hüllte sie ein, wie die Düsternis, fahlgelbgrau, die nur ein paar Schritte voraussehen ließ auf die unerbittlich glatte Fläche, auf der Schleier wedelten wie Gardinen um ein Totenbett. Sie war allein, es gab gar keine Welt außer ihrem Atem. Während ihre Füße sich bewegten, mühsam, Schritt vor Schritt, war plötzlich der Gedanke da, den sie in ihrer Kindheit oft gedacht hatte: niemand kümmerte sich um sie, wenn sie aufhörte zu atmen, würde sie verschwinden, einfach weg sein, in sich zurückfallen, da sie aus sich heraus entstanden war. Dann schämte sie sich, weil sie ihre Kinder vergessen hatte. Ihr Atem keuchte, die kalte Luft schmerzte in ihrem Gaumen. Sie musste doch bald die Höhe vor Manderscheid erreicht haben. Mit einsetzender Verzweiflung spähte sie ins Dusterlicht, ohne aufzuhören voranzuschreiten. Der Wind begann zu heulen, zerrte an ihrem breiten Wollschal, den sie um den Kopf geschlungen hatte. Christina blieb stehen. Das Heulen schien ihr so anders zu klingen. Sie wandte sich wieder um.
Der Hügelkamm war eine Fläche, auf der eine weißgepunktete Wand sich beweglich aufgerichtet hatte. Wieder das Heulen, unheimlich, aus dem plötzlich ein Jaulen ausfiel. Ihre Rechte krampfte sich um den Axtstiel. So stand Christina vornüber gebeugt, lauernd, die Augen zusammengekniffen im eisigen Sturm.
Da, als sie sich eben abwenden wollte, um ihren Weg aufzunehmen, lösten sich zwei, drei Schatten aus der Wand, schossen auf sie zu, das Heulen war verstummt. Wölfe! Einer erhob sich, die Axt traf ihn im Sprung.
Sie hatte nicht Zeit, sein Sichkrümmen zu verfolgen, da prallte ein anderer Körper, schwer von Hunger und Schnee und Kraft auf sie, riss sie fast zu Boden. Ihre Hand umklammerte die Axt, schlug zu, ohne zu sehen, schlug in das Gezerre, Körper, irrlichternd, Biss, zähnefletschend; abschüttelnd, Befreiung, die Kinder, ein krachender Schlag auf die Schädeldecke, Gewichte an ihren Gliedern, blutet dampfendes Weiß, Sturz vom neuerlichen Ansprung, Fall, Schreie, schmerzverröchelnd im stiebenden Schnee.“