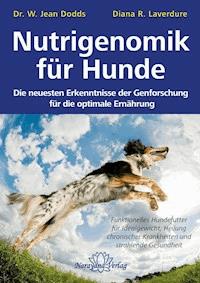
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narayana
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ob Mensch, ob Tier – Gesundheit beginnt in den Zellen! Dieses Werk vermittelt bahnbrechende Erkenntnisse auf dem Gebiet der Hundeernährung. Es zeigt, wie Sie die Zellgesundheit Ihres Hundes, dem Garant für ein langes, aktives Leben, allein durch das optimale Futter erreichen und bewahren. Die renommierte Tiermedizinerin Jean Dodds und die Expertin für Hundeernährung Diana Laverdure beziehen sich dabei auf die Ergebnisse der noch jungen, vielversprechenden Wissenschaftsdisziplin Nutrigenomik, die das Zusammenspiel zwischen Genen und Ernährung untersucht. Entscheidend für unsere Gesundheit und die unseres Hundes ist, wie die Nahrung, die wir aufnehmen, zu unseren Zellen „spricht“ und dadurch die Genexpression reguliert. Die Gene, mit denen wir auf die Welt kommen, sind zwar nicht veränderbar, aber wir können ihr Verhalten steuern. Genau hier setzen die Autorinnen an. Sie zeigen, wie herauszufinden ist, welche Nahrungsmittel die Genexpression und Zellgesundheit optimal fördern und welche zu chronischen Krankheiten führen. Mit bestimmtem Futter ist es möglich, Erkrankungen wirksam zu behandeln und zu heilen. Dodds und Laverdure haben „drei Schlüssel” erarbeitet, mit denen Sie künftig das Hundefutter gemäß den Prinzipien der Nutrigenomik zusammenstellen können. Mit 10 nährstoffreichen Superfoods erzielen Sie bei Ihrem Hund eine optimale Genexpression und verbessern seine Gesundheit um ein Vielfaches. Selbst Futtermittelunverträglichkeiten können Sie zukünftig wirksam behandeln. NUTRIGENOMIK FÜR HUNDE präsentiert verblüffende Möglichkeiten. Lange hat man den Einfluss der Ernährung auf die Genexpression auf der Zell-ebene nicht erkannt. Doch die Nutrigenomik beweist: Nahrung „spricht“ zu unseren Zellen. Mit diesem unverzichtbaren Ratgeber für Hundeernährung legen Sie den Grundstein für lang anhaltende Gesundheit und Wohlbefinden Ihres Tieres „Dieses bahnbrechende Buch bestätigt, dass Ernährung die beste Medizin auch bei Hunden ist. Das Werk stellt eine Bereicherung für alle Tierärzte und Betreuer dar. Für Studenten der Tiermedizin und Tierernährung sollte es zu einem obligatorischen Lehrbuch werden.“ — Dr. Michael W. Fox, Autor
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. W. Jean Dodds
Diana R. Laverdure
Nutrigenomik für Hunde
Die neuesten Erkenntnisse der Genforschung für die optimale Ernährung
IMPRESSUM
Dr. W. Jean Dodds
Diana R. Laverdure
Nutrigenomik für Hunde
Die neuesten Erkenntnisse der Genforschung für die optimale Ernährung
1. deutsche Ausgabe 2017
ISBN: 978-3-95582-180-7
© 2017, Narayana Verlag GmbH
Titel der Originalausgabe:
Canine Nutrigenomics
The New Science of Feeding
Your Dog for Optimum Health
© 2015 W. Jean Dodds, DVM; Diana R. Laverdure, MS (2015)
Graphic Design: Lindsay Peternell
Übersetzung aus dem Englischen:
Shiela Mukerjee-Guzik
Coverlayout © Lindsay Peternell
Coverabbildung © Shevs, shutterstock.com
Herausgeber:
Narayana Verlag GmbH
Blumenplatz 2, 79400 Kandern
Tel.: +49 7626 974 970-0
E-Mail: [email protected]
www.narayana-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlags darf kein Teil dieses Buches in irgendeiner Form – mechanisch, elektronisch, fotografisch – reproduziert, vervielfältigt, übersetzt oder gespeichert werden, mit Ausnahme kurzer Passagen für Buchbesprechungen.
Sofern eingetragene Warenzeichen, Handelsnamen und Gebrauchsnamen verwendet werden, gelten die entsprechenden Schutzbestimmungen (auch wenn diese nicht als solche gekennzeichnet sind).
Die Empfehlungen dieses Buches wurden von Autor und Verlag nach bestem Wissen erarbeitet und überprüft. Dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Weder der Autor noch der Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
Lasst Nahrung Eure Arznei sein, und Arznei Eure Nahrung.– Hippokrates
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Einleitung
TEIL I Nutrigenomik: Ein Überblick über die wissenschaftlichen Grundlagen der Gesundheitsförderung durch die Ernährung
KAPITEL 1 Nutrigenomik: Ein Überblick
KAPITEL 2 Funktionelle Ernährung: Was Ihr Hund fressen sollte
KAPITEL 3 Wie man nicht-funktionelles Futter erkennt und vermeidet
TEIL II Aufbau der Nutrigenomik-basierten Fütterung: Die Basisfütterung
KAPITEL 4 Die Basisfütterung als Grundlage für optimale Gesundheit
KAPITEL 5 Die Basisfütterung für Hochleistungshunde
TEIL III Funktionelle Ernährungstipps für häufige Gesundheitsprobleme des Hundes
KAPITEL 6 Futtermittelunverträglichkeiten und -überempfindlichkeiten und die diagnostische NutriScan-Testung
KAPITEL 7 Nutrigenomik zur Gewichtskontrolle
KAPITEL 8 Nutrigenomik bei Arthritis
KAPITEL 9 Nutrigenomik bei Krebs
KAPITEL 10 Nutrigenomik bei Verhaltensstörungen und altersbedingten kognitiven Problemen
KAPITEL 11 Nutrigenomik bei sonstigen Gesundheitsproblemen des Hundes
TEIL IV Nutrigenomik im Alltag
KAPITEL 12 Nehmen Sie die Fütterung Ihres Hundes in Angriff
KAPITEL 13 Wie Sie alles unter einen Hut kriegen
KAPITEL 14 Bleiben Sie am Ball
Nachwort: Ein Wadenbeißer
Anhang A: Weitergehende Informationen
Anhang B: Wie man die Deklaration auf den Etiketten von Futtermitteln liest
Quellen
Bezugsquellen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Über die Autorinnen
Impressum
Sachregister
Danksagung
Wir als Autorinnen möchten all jenen danken, deren Unterstützung und Anstrengungen dieses Buch erst möglich gemacht haben. Beginnen möchten wir mit dem wissenschaftlichen Team des National Human Genome Research Institute (NHGRI) und allen anderen Wissenschaftlern, die weltweit an dem Humanen Genom-Projekt teilgenommen haben. Bei diesem Projekt handelt es sich um den internationalen Versuch, die bekannten Gene des menschlichen Körpers, auch als Genom bekannt, zu entschlüsseln und zu kartieren. Ihre bahnbrechende Arbeit hat den Weg für neue Erkenntnisse hinsichtlich der genetischen Komponenten von Krankheiten geebnet. Es wird immer deutlicher, welch entscheidenden Einfluss Umweltfaktoren, zu denen auch die Ernährung gehört, auf die Genexpression und komplexe Störungen haben können. Als ein noch recht junger Bereich ist aus diesem Wissen die Nutrigenomik hervorgegangen.
Das NHGRI hat weiterhin ein Projekt unterstützt, bei dem das Genom des Hundes entschlüsselt wurde. Die Leitung hatte dabei Kerstin Lindblad-Toh, Ph.D., vom Broad Institute/MIT Center for Genome Research inne. Dieses Projekt ermöglicht es, dass unsere Hundefreunde von denselben Fortschritten in der Gentechnologie profitieren wie wir Menschen. Das Genom der Katze wurde ebenfalls entschlüsselt. Für die Arbeit dieser Wissenschaftspioniere sind wir ungemein dankbar.
Wir möchten auch allen Wissenschaftlern und Forschern danken, die diese Informationen zum menschlichen und tierischen Genom dazu verwenden, um neue Erkenntnisse im Bereich der individualisierten Medizin und Ernährung sowohl für den Menschen als auch unsere geliebten Tiere zu gewinnen. In diesem Buch haben wir Hunderte von diesbezüglichen Studien zitiert. (Bitte beachten Sie, dass sich dieses Buch zwar auf den Hund bezieht, es aber auch viele wichtige Parallelstudien zur Katze gibt.)
Ganz besonders möchten wir Dr. Barbara Fougère aus Australien und Dr. Sue Armstrong aus dem Vereinigten Königreich für ihre wertvollen Beiträge zu Kräutern, Rohfutter und anderen Nahrungsbedürfnissen von tierischen Krebspatienten danken.
Ein Buch von diesem Umfang kann nur im Team geschrieben werden. In unserem Fall hatten wir das große Glück, von den Mitarbeitern von Dogwise Publishing unterstützt zu werden, sodass wir unsere Vision zum Leben erwecken konnten. Wir möchten uns bei Charlene Woodward, Nate Woodward, Jon Luke und Lindsay Peternell dafür bedanken, dass sie die Bedeutung dieses überaus wichtigen Themas erkannt und uns auf der langen Reise von der Geburt der Buchidee bis zu seiner Fertigstellung begleitet und unterstützt haben. Ganz besonders möchten wir Larry Woodward, unserem Verleger bei Dogwise, danken, dessen Fähigkeiten dazu geführt haben, dass die Qualität dieses Buches weit über das hinausgeht, was wir ursprünglich für möglich gehalten hatten. Großartige Verleger tun so etwas, und genau das hat Larry für uns getan.
Wir danken natürlich auch all unseren Lieben, allen voran Jeans Ehemann Charles und Dianas Partner Rodney für ihre Unterstützung und Hingabe in den mehr als zwei Jahren, die von langen Nächten, Überarbeitungen bereits geschriebener Texte und der schier endlosen Konzentration auf Details beherrscht wurden. Zum Glück sind sie ebenfalls Perfektionisten.
Jean möchte auch ihre treuen vierbeinigen Begleiter in all den vergangenen Jahren nicht unerwähnt lassen, ganz besonders Issho, den Engel, dessen kurzes Leben auf Erden uns so viel über die Haltung von Hunden gelehrt hat und darüber, wie eine vollwertige Ernährung Tiere selbst unter widrigen Umständen gedeihen lässt.
Diana möchte ebenfalls ihrem geliebten Hund Chase danken. Seit mehr als zwölf Jahren ist er ihr bester Freund, Vertrauter und Inspiration bei ihrem Versuch, aus allen Hunden das Bestmögliche herauszuholen. Sie freut sich auf viele weitere wunderbare gemeinsame Jahre und Abenteuer.
Für alle Hunde, deren strahlende Gesundheit noch darauf wartet, sich zu entfalten, und für die Menschen, die sie lieben.
Einleitung
Übergewicht. Verdauungsstörungen. Hautreizungen. Chronische Hefepilzinfektionen. Verhaltensprobleme. Arthritis. Autoimmunkrankheiten. Herzerkrankungen. Krebs. Dies sind nur einige wenige der Gesundheitsstörungen, an denen unsere Hunde heute leiden – wobei die Zahl der Erkrankungen erschreckend in die Höhe schnellt und manchmal sogar epidemische Ausmaße annimmt.
Auf den ersten Blick scheinen die oben genannten Erkrankungen nicht viel gemeinsam zu haben, aber sie alle resultieren aus einer Entzündung, die sich auf der tiefsten Ebene im Körper Ihres Hundes abspielt – in seinen Zellen. Woher kommt diese Entzündung? Eine große Rolle dabei spielt die Lebensweise, die unsere Hunde mit uns, ihren Haltern, teilen – und ganz besonders die moderne Ernährung. Wie Sie bald feststellen werden, haben viele Futtermittel, die unsere Hunde eigentlich nähren sollen, einen verheerenden Einfluss auf ihre Gesundheit und führen zu Übergewicht und chronischen Krankheiten (Dodds, 2014; Dodds, 2014a). Aber so muss es nicht sein.
Es gibt inzwischen genügend wissenschaftliche Informationen, die es ermöglichen, dass Ihr Hund ein vor Gesundheit nur so strotzendes langes Leben führen kann und von chronischen Krankheiten verschont bleibt. Aber sehr wahrscheinlich haben Sie bisher noch nicht viel darüber gehört. Diese Informationen finden Sie nun im vorliegenden Buch.
Auf den folgenden Seiten werden wir auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse eingehen und aufzeigen, wie die Nahrungsbestandteile auf der zellulären Ebene mit dem Körper Ihres Hundes »sprechen«. Wir werden enthüllen, wie viele der Futtermittel, die Sie (und höchstwahrscheinlich auch Ihr Tierarzt) für gesund halten, sich in Wahrheit sehr ungesund auf die Gene Ihres Hundes auswirken. Außerdem werden wir Ihnen wirksame Hilfsmittel an die Hand geben, mit denen Sie die Gesundheit Ihres Hundes maximieren können – indem Sie durch die Ernährung eine optimale Genexpression fördern, unabhängig davon, wie sein derzeitiger Zustand ist (mehr zur Genexpression in Kürze).
Das Konzept vom gesunden Essen ist nicht neu, aber erst seit ein paar Jahrzehnten hat die Wissenschaft tatsächlich angefangen zu verstehen, welchen Einfluss die Ernährung auf die tiefste Ebene unseres Körpers hat – auf die Zellebene. Der größte Durchbruch wurde 2003 mit dem Abschluss des Humanen Genom-Projektes erzielt. Dabei handelt es sich um ein bahnbrechendes internationales Forschungsprogramm, bei dem es den Wissenschaftlern gelang, die Lokalisation der bekannten Gene im menschlichen Körper zu entschlüsseln und zu kartieren. (Entschlüsseln bedeutet die Bestimmung der exakten Reihenfolge der chemischen Grundeinheiten eines Gens, die mit den Buchstaben A, T, G und C bezeichnet werden und einen DNA-Strang bilden) (NHGRI, 2011). Unsere DNA enthält unsere Gene, die wiederum die Bauanleitungen für die Synthese von Proteinen (Eiweißen) liefern. Diese bestimmen alles an uns, angefangen von unserem Geschlecht und unserer Augenfarbe bis hin zu unserer Fähigkeit, Krankheiten abzuwehren. Der vollständige Satz DNA eines Organismus enthält die Gesamtheit seiner Gene und wird auch als Genom bezeichnet. Das menschliche Genom enthält schätzungsweise 20.000 bis 25.000 Gene, von denen jedes durchschnittlich drei Proteine codiert. Wir alle haben Billionen von Zellen und jede einzelne von ihnen enthält eine vollständige Kopie unseres Genoms (NHGRI, 2011; NHGRI, 2012). Um Krankheiten zu behandeln und vorzubeugen, ist es unabdingbar, das Genom zu verstehen, denn nahezu jede Erkrankung hat eine genetische Grundlage (NHGRI, 2011).
Wir Menschen sind nicht die Einzigen, die von der Entschlüsselung des Genoms profitieren. Auch das Genom vieler anderer Spezies wurde bereits entschlüsselt, darunter auch das des Hundes. (Ein Boxer namens Tasha war der erste Hund, dessen DNA entschlüsselt wurde!) Bei dem Projekt zur Entschlüsselung des Hundegenoms zeigte sich, dass wir Menschen noch viel enger mit unseren Hunden verbunden sind als angenommen – sogar im Hinblick auf die Struktur und Evolution unserer Gene (Broad Institute, 2014). Das Genom des Hundes enthält ca. 21.000 Gene (Starr, 2011). 2013 fanden Forscher an der Universität von Chicago und anderen internationalen Institutionen heraus, dass die Evolution des Genoms von Menschen und domestizierten Hunden umfassende Parallelen aufweist, v. a. bei Genen, die mit der Verdauung und dem Stoffwechsel, neurologischen Prozessen und Erkrankungen, wie z. B. Krebs assoziiert sind. Den Forschern zufolge haben sich diese Gene wahrscheinlich in ähnlicher Weise entwickelt, weil Mensch und Hund über viele Tausende von Jahren in enger Gemeinschaft zusammengelebt und dabei möglicherweise auch zusammen nach Nahrung gesucht haben (Lee, 2013; Wang et al., 2013). Das sind wirklich aufregende Neuigkeiten (aber für die unter uns, die eine tiefe Verbundenheit mit ihren Hunden fühlen, vielleicht nicht wirklich überraschend!), denn es bedeutet, dass beide Spezies gleichermaßen von den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen im Hinblick auf die beste Ernährungsform für eine optimale Zellgesundheit profitieren können.
Aber wie genau kommuniziert die Nahrung mit unseren Zellen und wie kontrolliert sie unsere Gene? Obwohl der Körper aus Billionen von Zellen besteht, die alle eine vollständige Kopie des Genoms enthalten, verhalten sich nicht alle Zellen gleich, sondern sie spezialisieren sich und übernehmen verschiedene Identitäten und Funktionen (The University of Utah, 2014). Einige Zellen werden zu Herzzellen, andere zu Knochenzellen, Hirnzellen, Nierenzellen, Muskelzellen, Hautzellen usw. Was führt zu dieser Differenzierung? Jedes Gen codiert Proteine, aber nicht alle Gene führen in allen Zellen und jederzeit zur Synthese von Proteinen. Stattdessen werden verschiedene Gruppen von Genen an- (aktiv) oder abgeschaltet (unterdrückt), um in bestimmten Zellen zu unterschiedlichen Zeiten Proteine herzustellen (NHGRI, 2012a; The University of Utah, 2014). Der Vorgang des An- und Abschaltens von Genen innerhalb einer Zelle wird als Genexpression bezeichnet. Die Art und Weise der Genexpression hat einen großen Einfluss auf unser Schicksal. Aber wer oder was kontrolliert die Genexpression?
Hier kommt das Epigenom ins Spiel. Das Epigenom ist eine strukturelle Schicht, die unsere DNA und die mir ihr verbundenen Proteine umgibt. Das Epigenom leitet chemische Reaktionen in solchen Zellen ein, die die Genexpression kontrollieren und bestimmen, welche Gene an- oder abgeschaltet und welche Proteine synthetisiert werden (NHGRI, 2012a; Sample, 2009; The University of Utah, 2014). Durch Veränderung der Genexpression einer Zelle ändert das Epigenom auch die Bestimmung der Zelle und entscheidet somit darüber, ob diese zu einer Hirn-, Herz- oder Hautzelle wird – und ob sich aus ihr eine gesunde oder eine kranke Zelle entwickelt (The University of Utah, 2014).
Und an dieser Stelle tritt die Ernährung auf den Plan. Wir wissen nun, dass das Epigenom sehr empfindlich auf Signale aus der Umgebung reagiert – einschließlich der Ernährung. Dies führt uns zu dem aufregenden neuen wissenschaftlichen Gebiet – dem Thema dieses Buches –, das als Nutrigenomik (Nutri-gen-omik) bezeichnet wird. Der Begriff Nutrigenomik ist eine Kombination aus den Worten Nutrition [Ernährung] und Genomik [das Genom betreffend]. Sie ist die Wissenschaft vom Einfluss der Ernährung auf das Epigenom und damit die Genexpression, die wiederum unsere genetische Prädisposition für Gesundheit oder auch Krankheit bestimmt (Dodds, 2014; Dodds, 2014a; Elliot and Ong, 2002; Fekete and Brown, 2007; Swanson, Schook and Fahey, 2003).
Genauso wie wir unsere Gene von unseren Eltern geerbt haben, so hat auch unser Epigenom ein zelluläres Gedächtnis, das von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden kann (The University of Utah, 2014). Das bedeutet, dass der Lebenswandel einer zukünftigen Mutter, aber auch des Vaters, einschließlich ihrer Ernährung, einen Einfluss auf das Epigenom ihrer Nachkommen hat! Allerdings können wir unser Epigenom im Gegensatz zu unserem Genom im Laufe der Zeit durch neue Umweltsignale, wie z. B. eine optimale Ernährung, verändern. Und genau das werden Sie in diesem Buch im Hinblick auf die Ernährung Ihres Hundes lernen!
Auf den folgenden Seiten werden wir erläutern, wie die Fütterung zur Entwicklung vieler chronischer Krankheiten, die heutzutage in der Hundewelt vorherrschen, beigetragen hat. Daneben machen wir Sie mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Nahrungsbestandteilen vertraut, die genau diesen Erkrankungen vorbeugen bzw. sie bessern oder sogar rückgängig machen können. Darüber hinaus werden Sie lernen, wie Sie Futtermittel erkennen können, die gesund erscheinen, aber tatsächlich aus dem einen oder anderen Grund ungesunde Signale an das Epigenom abgeben und daher aus dem Speiseplan Ihres Hundes gestrichen werden sollten.
Wir haben außerdem bestimmte Futtermittel ausfindig gemacht, die wissenschaftlich betrachtet sehr vielversprechend erscheinen und offensichtlich ein derartig großes Potenzial haben, die Gesundheit und Vitalität von Hunden zu steigern, dass wir sie »funktionelle Superfoods für den Hund« genannt haben. Eine Liste dieser Futtermittel finden Sie in Kapitel 2. Zudem haben wir sie an allen Stellen, an denen sie in diesem Buch erscheinen, in kursivem Fettdruck gesetzt, sodass Sie sie mühelos erkennen können.
Weiterhin lernen Sie eine einfache und kostengünstige Testmethode kennen, mit der bestimmt werden kann, ob Ihr Hund womöglich an einer grundlegenden epigenetischen Futtermittelunverträglichkeit oder -überempfindlichkeit leidet, sodass Sie alle unverträglichen Bestandteile aus seiner Ernährung eliminieren können. Dies ist überaus wichtig, denn kein Nahrungsbestandteil kann, unabhängig davon, wie gesund er grundsätzlich auch ist, gesunde Botschaften an die Zellen senden, wenn er eine unerwünschte Reaktion hervorruft. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches können mit dem von W. Jean Dodds entwickelten bahnbrechenden Speicheltest auf Futtermittelunverträglichkeiten, dem sogenannten NutriScan (auf den wir in Kapitel 6 noch ausführlich eingehen werden), Überempfindlichkeiten auf 24 verschiedene Futtermittel identifiziert werden. Bei dem Testsystem handelt es sich um einen einfachen Speicheltest, den Sie selbst zu Hause durchführen können und anschließend an das Hemolife Diagnostics Laboratory der Autorin senden. Das Ergebnis bekommen Sie dann innerhalb von zehn Tagen. Die Möglichkeiten, den Ernährungsplan Ihres Hundes anhand eines solchen Tests individuell auf seine Bedürfnisse zuzuschneiden, sind aufregend!
Um die Handhabung des Buches zu erleichtern, haben wir es in vier Abschnitte untergliedert:
Teil I:Nutrigenomik: Ein Überblick über die wissenschaftlichen Grundlagen der Gesundheitsförderung durch die Ernährung (Kapitel 1, 2 und 3). Diese Kapitel liefern ausführliche Hintergrundinformationen zur Nutrigenomik und geben eine Einführung in das Thema »funktionelle Nahrungsmittel«. Wir zeigen, wie man »gut« und »schlecht« unterscheiden kann und geben viele Beispiele für Futterbestandteile, die Ihr Hund sehr wahrscheinlich bekommt, die aber möglicherweise ungesunde Botschaften an seine Zellen senden. In Kapitel 3 werden wir einige erstaunliche Fakten über kommerzielle Futtermittel des Massenmarktes enthüllen, die Sie vermutlich noch nicht kennen.
Teil II, Aufbau der Nutrigenomik-basierten Fütterung: Die Basisfütterung (Kapitel 4 und 5), zeigt, wie Sie die Basisbestandteile einer Nutrigenomik-orientierten Fütterung zusammenstellen – die »Grundlage«, auf der dann der Rest der Fütterung aufbaut. Dabei geben wir Ihnen verschiedene Ernährungspläne an die Hand – für Welpen, ausgewachsene Hunde, Senioren und Hochleistungshunde (Sporthunde, tragende und säugende Hündinnen). In diesem Abschnitt erfahren Sie, dass ein Großteil der Informationen zum Thema »vollwertige und ausgewogene« Fütterung, mit denen Sie bislang von der Futtermittelindustrie (und vielleicht sogar von Ihrem Tierarzt) »gefüttert« wurden (Wortwitz beabsichtigt!), auf veralteten Ansichten über die Nahrungsbedürfnisse von Hunden beruht. Im Gegenzug zeigen wir alternative Lösungen auf, die auf den Prinzipien der Nutrigenomik aufbauen.
Teil III,Funktionelle Ernährungstipps für häufige Gesundheitsprobleme des Hundes (Kapitel 6 bis 11), befasst sich mit den Ursachen einiger der heutzutage häufigsten chronischen Erkrankungen des Hundes und zeigt Möglichkeiten auf, wie Sie Ihren Hund mithilfe der Ernährung wieder auf den Weg zu einer optimalen Gesundheit führen können. Themen wie Übergewicht, Futtermittelallergien und -überempfindlichkeiten, Arthritis, Krebs und viele weitere werden ausführlich abgehandelt. Sollte Ihr Hund momentan an einer oder mehreren Krankheiten leiden, ist dies der Abschnitt, den Sie vermutlich wieder und wieder zu Rate ziehen werden, um Nahrungsbestandteile zu finden, die eine wissenschaftlich gesicherte Wirkung haben und mit denen diese Krankheiten auf der zellulären Ebene behandelt, gelindert oder sogar rückgängig gemacht werden können. Darüber hinaus erhalten Sie eine umfassende Einführung in das Testsystem NutriScan.
Teil IV, Nutrigenomik im Alltag (Kapitel 12 bis 14), zeigt, wie Sie das Gelernte in Ihrer individuellen Situation umsetzen können, und gibt wertvolle Tipps zur Herstellung aller Arten von Futtermitteln, sei es Trockenfutter oder auch selbst gekochtes Futter, das aus Sicht der Nutrigenomik empfehlenswerter wäre. Sie bekommen auch Empfehlungen zur Vorratshaltung, sodass Sie immer ideale hundefreundliche Futtermittel zur Hand haben, und wir geben Ihnen Tipps, wie Sie das neue Konzept das ganze Leben Ihres Hundes lang beherzigen können. Diejenigen von Ihnen, deren Hund kommerzielles Hundefutter bekommt, finden in Anhang B wichtige Informationen, wie man die Deklaration auf den Etiketten von Futtermitteln liest.
Ab Kapitel 6 finden Sie unter der Überschrift »Erfolg!« auch zahlreiche Fallbeispiele, die den bemerkenswerten Erfolg, den man mithilfe der Nutrigenomik erzielen kann, illustrieren.
In diesem Buch werden Sie immer wieder auf das folgende Symbol stoßen:
Dieser Knochen steht für »tieferes Graben« (so wie ein Hund seinen heißgeliebten Knochen möglichst tief vergräbt!). Wenn Sie dieses Symbol sehen, wissen Sie, dass Sie in Anhang A weitergehende Informationen zu dem jeweiligen Thema finden. Damit haben wir sichergestellt, dass diejenigen von Ihnen, die sich weiter in die wissenschaftlichen Hintergründe zu einem Thema vertiefen möchten, die Gelegenheit dazu haben, ohne dass das Buch zu sehr mit Fachbegriffen überladen wird, die für andere Leser wiederum vielleicht nicht so interessant sind.
In der Zusammenfassung am Ende jedes Kapitels sind noch einmal die wichtigsten Punkte aufgeführt, was das schnelle Nachschlagen bzw. Wiederauffrischen des Inhalts erleichtert.
Je mehr Sie über die gesunde Ernährung erfahren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch Ihre eigene Ernährung im Sinne der Nutrigenomik umstellen werden. Das wäre wirklich großartig! Wie bereits erwähnt, weisen Menschen und Hunde viele Gemeinsamkeiten im Hinblick auf ihr Genom auf, und wir alle können nur davon profitieren, wenn wir Nahrung konsumieren, die gesunde Signale an unser Epigenom sendet.
Bevor wir beginnen, möchten wir einen ganz wichtigen Punkt klarstellen. Wir selbst sind immer wieder aufs Neue von der wundersamen Welt der Ernährung gemäß der Nutrigenomik begeistert und diese Welt kann sich nun auch Ihnen und Ihrem Hund erschließen, aber wir möchten auf keinen Fall, dass Sie durch die ganzen Informationen verunsichert oder eingeschüchtert werden, und glauben nicht, dass Sie alles davon übernehmen müssten. In diesem Buch geht es nicht dogmatisch um Alles oder Nichts. Bitte picken Sie sich das heraus, was für Sie, Ihren Zeitplan, Ihre Finanzen und Ihren Lebenswandel richtig und passend erscheint. Wenn Sie die Mahlzeiten Ihres Hundes selbst zubereiten möchten, ist das großartig, und wir werden Ihnen zeigen, wie es geht. Wenn Sie weiterhin Trockenfutter füttern möchten, wird besonders Kapitel 12 für Sie von Interesse sein, wo wir wertvolle Hinweise geben, worauf Sie beim Kauf achten müssen, um ein Produkt zu bekommen, das frei von Zutaten ist, die möglicherweise ungesunde Signale an die Zellen Ihres Hundes aussenden. Stattdessen versetzen wir Sie in die Lage, ein Futter zu wählen, das mit den Prinzipien der Nutrigenomik weitestgehend im Einklang steht. Außerdem geben wir Ihnen Tipps, wie Sie den Nährwert Ihres Trockenfutters schon durch ein paar kleine Veränderungen deutlich verbessern können. Wie bei allen anderen Dingen auch geht es darum, dass Sie das umsetzen, was für Sie funktioniert und den Rest einfach stehen lassen. Wie viel Sie auch immer davon annehmen, Ihr Hund wird es Ihnen danken!
Nun noch eine letzte Anmerkung. Wir beziehen uns im gesamten Buch auf »den Hund« in der männlichen Form. Damit wollen wir keinesfalls die »Mädchen« vor den Kopf stoßen! Wir haben dies nur gemacht, um die bestmögliche Lesbarkeit zu erhalten.
Wir hoffen, dass Sie es nun kaum noch erwarten können, zu einer treibenden Kraft innerhalb einer Bewegung zu werden, deren Ziel es ist, dem sich immer weiter verschlechternden Gesundheitszustand unserer Haustiere entgegenzuwirken.
Wenn Sie bereit sind, sich auf das Non plus Ultra der Hundeernährung einzulassen und sich mit Ihrem Hund zusammen auf den Weg zu optimaler Gesundheit zu begeben, dann blättern Sie bitte um und fangen Sie an!
TEIL I
NUTRIGENOMIK: EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE WISSENSCHAFTLICHEN GRUNDLAGEN DER GESUNDHEITSFÖRDERUNG DURCH DIE ERNÄHRUNG
KAPITEL 1
NUTRIGENOMIK: EIN ÜBERBLICK
»Das sind alles die Gene.« Wie oft haben Sie diesen Satz nicht schon aus dem Mund eines Verwandten, Freundes oder Mitarbeiters gehört? Er bringt die Ansicht zum Ausdruck, dass man wenig oder gar keine Kontrolle über den eigenen Gesundheitszustand und die Lebenserwartung hat. »Ich kann nichts dafür, dass ich übergewichtig bin, es steckt in meinen Genen.« Oder vielleicht auch: »Es spielt keine Rolle, ob ich dieses Eis esse oder nicht. Meine Großeltern und meine Eltern hatten Diabetes, also werde ich auch irgendwann daran erkranken. Es liegt einfach in unseren Genen.« Vielleicht hatten Sie selbst auch schon einmal ähnliche Gedanken und haben bestimmte ungesunde Ernährungsgewohnheiten damit rechtfertigt, dass Ihr Schicksal, zum Guten wie auch zum Schlechten, sowieso überwiegend von Ihrer geerbten DNA bestimmt wird. Wahrscheinlich führen Sie diesen Gedankengang nicht ganz so weit, wenn es um Ihren Hund geht, aber es bestehen durchaus Parallelen. Für viele Rassen sind bestimmte Gendefekte bereits allgemein bekannt, genauso wie eine Bandbreite von chronischen Erkrankungen. Im Wartezimmer eines Tierarztes (nicht Ihres eigenen!) hat eine der Autorinnen (DRL) mitangehört, wie der Tierarzt beiläufig zu seinem Klienten sagte, dass »Hunde mit elf Jahren anfangen abzubauen«. Wenn der »Abbau« in einem bestimmten Alter tatsächlich ein unausweichliches »Nebenprodukt« des kollektiven genetischen Erbes unserer Hunde ist, lohnt es sich dann wirklich, mehr Zeit und Geld in ihre Ernährung zu investieren? Kann die Ernährung chronischen Krankheiten vorbeugen oder sie heilen? Kann die Nahrung tatsächlich den Unterschied zwischen einem älteren Hund, der an einer Krankheit dahinsiecht, und einem, der sich bester Gesundheit erfreut, ausmachen?
Die Antwort ist: absolut!
Unsere Gene machen uns einzigartig
Wie Sie bereits aus der Einleitung wissen, haben Menschen und Hunde ein Genom. Darunter ist die Gesamtheit aller Gene im Körper zu verstehen. Der menschliche Körper enthält schätzungsweise 20.000 bis 25.000 Gene (NHGRI, 2011), während Hunde ungefähr 21.000 Gene in ihrem Genom haben (Starr, 2011). Das Genom enthält immer zwei Sätze von Genen – von jedem Elternteil einen. Gene bestehen aus DNA-Strängen und enthalten die Bauanleitungen bzw. den genetischen Code für die Synthese aller Proteine, die einen lebenden Organismus ausmachen (NHGRI, 2012; NHGRI, 2012a; Silverman, 2008; The University of Utah, 2014).
Aber nicht alle Gene verhalten sich hinsichtlich ihrer proteinbildenden Aktivität gleich. Nicht alle Gene synthetisieren zu jeder Zeit und in allen Zellen Eiweiße. Und sie stellen auch nicht alle dieselben Arten und Mengen von Proteinen her. Bestimmte Gene können in den Zellen angeschaltet (aktiv) sein, was bedeutet, dass sie Proteine bilden, während andere wiederum abgeschaltet (unterdrückt) sind. Dieser Vorgang der Proteinsynthese wird auch als Genexpression bezeichnet und bestimmt, wie die Zellen aussehen, wachsen und agieren. Wie bereits erwähnt, steuert die Genexpression die Identität und Funktion der Zellen (also beispielsweise den Unterschied zwischen einer Hirn-, Herz- und Hautzelle); darüber hinaus kann sie auch den Ausschlag geben, ob die Zelle gesund oder krank ist (NGHRI, 2012a; The University of Utah, 2014).
Jeder von uns hat einen spezifischen genetischen Code, der unsere Einzigartigkeit ausmacht (mit Ausnahme von eineiigen Zwillingen, die denselben genetischen Code haben). Gene bestimmen, ob Sie blaue Augen haben, während Ihr Bruder vielleicht braune Augen hat, und ob Ihr Hund ein Labrador Retriever ist oder ein Chihuahua. Die DNA verändert sich nicht; der grundlegende genetische Code bleibt das ganze Leben lang immer gleich. Unabhängig von Ihrem äußeren Umfeld werden Sie immer blaue Augen haben (es sei denn, Sie tragen farbige Kontaktlinsen), und Ihr Labrador wird niemals zu einem Chihuahua werden!
Die meisten Gene sind bei allen Menschen (bzw. Hunden) gleich, nur einige wenige (weniger als ein Prozent der Gesamtmenge) unterscheiden sich geringfügig voneinander. Und genau dieser winzige Unterschied bestimmt unsere einzigartigen Charakteristika, unseren sogenannten Genotyp (NHGRI, 2012; Ostrander, 2012; Ostrander & Wayne, 2005; Science Daily, 2007; Stein, 2004).
Unser Epigenom kommuniziert mit unseren Genen und sagt ihnen, wie sie sich zu verhalten haben
Wir wir bereits in der Einleitung erläutert haben, kommen wir außerdem mit einer zweiten Schicht aus chemischen Verbindungen auf die Welt, die unsere DNA umgibt und als Epigenom bezeichnet wird (Epigenom bedeutet »außerhalb des Genoms«). Das Epigenom ist wie die Bedienungsanleitung für unsere Gene (NHGRI, 2012a). Allerdings entstammen die chemischen Bestandteile unseres Epigenoms, im Gegensatz zu unserer DNA, die wir von unseren Eltern geerbt haben, einer Vielzahl von Quellen aus unserer Umwelt, die sowohl gut als auch schlecht sein können. Dazu zählen natürliche Quellen wie z. B. die Nahrung, aber auch menschengemachte Quellen wie Medikamente und Pestizide. Indem das Epigenom das Genom mit seinen chemischen Verbindungen beeinflusst, verändert es auch die Genexpression und ordnet an, welche Gene an- bzw. abgeschaltet werden (d. h., ob sie Proteine synthetisieren oder nicht), und welche Arten von Eiweißen gebildet werden (NHGRI, 2012a; The University of Utah, 2014). Chemische Marker, die aus ungesunden Quellen aus der Umwelt stammen, können ungesunde Botschaften an das Genom senden und damit zu einer unerwünschten und nachteiligen Modifikation der Genexpression führen. Auf diese Weise dient das Epigenom als Brücke (oder vielleicht mehr als Autobahn), die das Genom mit der Umwelt verbindet.
Die nachstehende Abbildung veranschaulicht die Beziehung zwischen genetischen und umweltbedingten Faktoren, die das Epigenom beeinflussen und eine entscheidende Rolle spielen, ob die Genexpression in Richtung Gesundheit oder Krankheit stattfindet. Bitte beachten Sie, dass alle Kreise in der Mitte konvergieren und gemeinsam ein diamantenförmiges Zentrum bilden: Dieser Diamant stellt die Ernährung dar.
Wie schaltet das Epigenom Gene an und ab?
Das Epigenom verwendet zwei Hauptmechanismen, um das Genom zu kennzeichnen und Gene an- und abzuschalten:
• Bei der Methylierung der DNA werden chemische Marker, sogenannte Methylgruppen, an eine der vier Basen, aus denen ein DNA-Molekül besteht, geheftet. Dadurch wird die DNA direkt verändert. Eine fehlgesteuerte DNA-Methylierung kann die Genexpression aus dem Gleichgewicht bringen und in der Folge zu einer Vielzahl ernsthafter Gesundheitsstörungen führen (Hardy & Tollefsbol, 2011; Hyman, 2011; NHGRI, 2012a; Phillips 2008). So ist beispielsweise das Genom von Krebszellen im Vergleich zu normalen Zellen oft hypomethyliert (zu wenig methyliert). Dahingehend sind Gene, die Tumoren unterdrücken, in Krebszellen oft infolge einer Hypermethylierung (Über-Methylierung) ruhiggestellt (Phillips, 2008). Wir werden später noch auf Nahrungsmittel eingehen, die eine optimale DNA-Methylierung fördern. Sollte Ihr Hund an Krebs erkrankt sein, schenken Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt in Kapitel 9 besondere Aufmerksamkeit.
• Die Modifikation der Histone beeinflusst die DNA in einem Genom indirekt. Histone sind Proteine in den Zellkernen, um die sich wie um eine Art Spule sehr lange DNA-Moleküle winden, wodurch die DNA zu hübschen kleinen »Chromosomenpäckchen« verdichtet wird und damit in den Zellkern passt. Wenn sich epigenetische chemische Substanzen an das Ende eines Histons anheften, beeinflussen sie, wie fest oder locker die Windungen der DNA sind. Eine feste Wickelung kann bestimmte Gene verbergen und dazu führen, dass diese abgeschaltet werden, wohingegen eine lockere Wickelung zur Freilegung vormals verborgener Gene und deren Aktivierung führen kann (NHGRI, 2012a).
Genau wie das Genom können auch die chemischen Bestandteile des Epigenoms vererbt werden (NHGRI, 2012a; The University of Utah, 2014). Das bedeutet, dass Eltern, die ungesund leben – beispielsweise sich mangelhaft ernähren –, epigenetische Botenstoffe an ihre Kinder weitergeben und damit bei diesen die Prädisposition für eine nachteilige Genexpression fördern können!
Allerdings kann sich das Epigenom im Gegensatz zu unserem genetischen Code, der ein Leben lang feststehend ist, abhängig von den Signalen aus der Umwelt verändern (NHGRI, 2012a; The University of Utah, 2014). Das heißt, dass selbst Individuen, die ursprünglich epigenetisch schlecht aufgestellt sind, ihr Schicksal ändern können, indem sie sich bewusst für eine gesunde Lebensweise entscheiden. Wenn das Epigenom infolge dieser positiven Signale aus der Umwelt transformiert wird, wird es chemische Substanzen bilden, die sich wiederum positiv auf die Genexpression auswirken. Dies ist ein entscheidender Aspekt, denn die Genexpression bestimmt den Phänotyp eines Individuums. Der Phänotyp ist die Summe aller Merkmale, die wir sehen oder messen können, beispielsweise die Größe, Blutgruppe, aber auch das Verhalten – ebenso wie das Vorhandensein oder die Abwesenheit von Erkrankungen (Dodds, 2014; Dodds, 2014a).
Wenn Sie Ihren Hund mit Nährstoffen füttern, die wünschenswerte Signale an sein Epigenom senden und eine gesunde Genexpression fördern, können Sie die Umwelteinflüsse so weit in Schach halten, dass er ein Leben in optimaler Gesundheit führen kann, statt an einer chronischen Krankheit dahinzusiechen (Dodds, 2014; Dodds, 2014a; Choi & Friso, 2010; Epigenetics NoE, 2014).
Ein kurzer geschichtlicher Abriss der Epigenetik
Das Epigenom: die Geschichte eines Zwillingspärchens
Epigenetik: der Unterschied zwischen Bienenköniginnen und Arbeiterbienen
Wie Sie sich erinnern, bedeutet das Knochenzeichen, dass diese Themen ausführlich in Anhang A abgehandelt werden.
Nahrung und Entzündungen
Wenn Faktoren wie eine schlechte Ernährung ungesunde Botschaften an das Epigenom senden, kann es Jahre dauern, bis sich ein sichtbares Problem manifestiert. Das bedeutet, dass Ihr Hund nach außen hin gesund erscheinen kann, sich in seinem Inneren aber bereits ein Entzündungsgeschehen ausbreitet. Eines schönen Tages erwachen Sie dann vielleicht und stellen fest, dass Ihr bislang augenscheinlich so gesunder Hund gar nicht mehr aufhören kann sich zu kratzen, oder dass er Blähungen und Durchfall hat, die gar nicht mehr weggehen, oder dass er an wiederkehrenden Hefepilzinfektionen leidet – oder, Gott bewahre, dass er Krebs hat. Vielleicht hat sich auch sein Temperament verändert, und Sie tun sein erregtes oder aggressives Verhalten einfach als »böse« oder »starrköpfig« ab. Aber diese Veränderungen treten alles andere als plötzlich auf. Sie sind das Ergebnis einer lang dauernden Entzündung, die durch eine Kombination von Faktoren ausgelöst wurde, die wiederum sehr stark von Angriffen aus der Umwelt auf das Epigenom beeinflusst werden. Nehmen diese Angriffe überhand und wird der Körper nicht mehr damit fertig, läuft das Fass buchstäblich über und es entwickelt sich Krankheit (Dodds, 2014; Dodds, 2014a).
Die meisten glauben, dass eine Entzündung etwas ist, was man an der Oberfläche des Körpers erkennen kann, beispielsweise eine Schwellung, Quetschung oder Rötung. Tatsächlich handelt es sich bei innerlichen Entzündungen auf der zellulären Ebene aber um einen natürlichen Bestandteil der körpereigenen Abwehrmechanismen (Perricone, 2010).
Es gibt zwei Arten von zellulären Entzündungen:
Die akute zelluläre Entzündung ist ein vorübergehender Entzündungszustand, der zu einem bestimmten Zweck entsteht und verschwindet, sobald seine Arbeit getan ist. Eine akute Entzündung ist notwendig, um Infektionserreger wie Bakterien, Protozoen und andere Parasiten sowie Pilze und sogar Viren anzugreifen und zu vernichten (Punchard, Whelan & Adcock, 2004).
Die chronische zelluläre Entzündung ist ein anhaltender Entzündungszustand, der zu einer Vielzahl von Krankheiten führt. Eine chronische Entzündung tritt auf, wenn die Gewebe oder Organe fortwährend Botschaften von Entzündungsmediatoren erhalten, die ihnen vorgaukeln, dass das krankmachende Agens immer noch anwesend ist, wodurch eine entsprechende Reaktion provoziert wird. Der Entzündungszyklus kommt somit niemals zum Abschluss. Es findet keine Heilung statt, sondern es entwickelt sich eine überschießende Entzündungsreaktion, die ein Leben lang mehr oder weniger aktiv ist (Beynen et al., 2011; Perricone, 2010; Punchard, Whelan & Adcock, 2004). Eine chronische Entzündung schafft Verhältnisse im Körper, die zu Fettleibigkeit und anderen chronischen Krankheiten führen, auf die wir im Laufe dieses Buches noch näher eingehen werden.
Was ist eine Entzündung?
Hier sind lediglich ein paar Beispiele für die Vielzahl der Erkrankungen aufgeführt, die mit chronischen Entzündungen im Zusammenhang stehen:
• Allergien
• Arthritis
• Autoimmunerkrankungen
• Diabetes
• Erkrankungen der Harnwege
• Fettleibigkeit
• Haut- und Fellprobleme
• Herzerkrankungen
• Kognitive Störungen
• Krebs
• Lebererkrankungen
• Nierenerkrankungen
• Verdauungsprobleme
Funktionelle Nahrungsmittel: der Schlüssel zur Gesundheit Ihres Hundes
Wir wissen, dass die Ernährung eine entscheidende Rolle bei der Genexpression spielt (Daniel, 2002), aber woher wissen wir, welche Nahrungsmittel tatsächlich durch das Aussenden gesunder Signale an die Zellen eine optimale Genexpression fördern? Wissenschaftler haben in der letzten Zeit intensive Forschungen betrieben, um spezifische Nahrungsbestandteile herauszufinden, welche die Genexpression solcherart beeinflussen, dass eine ganze Bandbreite chronischer Krankheiten verhindert, gelindert oder sogar rückgängig gemacht werden kann (Daniel, 2002; Elliot & Ong, 2002; German et al., 2002; Swanson, Shook & Fahey, 2003). Diese überaus nützlichen Inhaltsstoffe werden auch als funktionelle Nahrungsmittel bezeichnet.
Funktionelle Nahrungsmittel sind Nahrungsbestandteile wie z. B. bestimmte Pflanzen, Aminosäuren, Vitamine und Phytonährstoffe (pflanzliche Inhaltsstoffe, die sich als förderlich für die Gesundheit erwiesen haben), die Signale an das Epigenom senden und eine gesunde Genexpression fördern (Essa & Memon, 2013; Kaput & Rodriguez, 2006). Sie werden im Verlauf dieses Buches eine Vielzahl von funktionellen Nahrungsmitteln kennenlernen, die antientzündlich wirken, eine gesunde Methylierung der DNA fördern und zur Vorbeugung bzw. Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden können.
Zur Förderung einer optimalen Genexpression müssen wir zwei Dinge tun: (1) eine Ernährungsform kreieren, die auf funktionellen Nahrungsmitteln beruht, welche gesunde Signale an die Zellen aussenden; und (2) Nahrungsbestandteile reduzieren oder eliminieren, die eine ungesunde Genexpression fördern. Das ist allerdings nicht immer so offensichtlich, wie es scheinen mag. Das Ganze wird durch eine Reihe von Faktoren verkompliziert, die darüber entscheiden, ob ein bestimmter Inhaltsstoff oder eine Kombination von Bestandteilen tatsächlich funktionell ist. Selbst typisch funktionelle Nahrungsmittel können sich schädlich auswirken, wenn sie mit Zusatzstoffen, Hormonen oder Antibiotika behaftet sind, die das Epigenom nachteilig beeinflussen. Sie kennen bestimmt das alte Sprichwort »Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern«? Nun, wenn dieser Apfel gentechnisch verändert wurde (mehr zu diesem Thema in Kapitel 3) oder mit Pestiziden behaftet ist, kann er ungesunde Signale an die Zellen senden und seine funktionelle Wirkung selbst sabotieren (Dodds, 2014; Dodds, 2014a).
Der Umstand, dass jeder Hund ein einzigartiges Individuum mit eigenem Genom darstellt, verkompliziert die ganze Angelegenheit noch, denn ein Inhaltsstoff, der dem genetischen Code des einen Hundes nützt, ist möglicherweise für einen Hund mit einem unterschiedlichen genetischen Code nicht förderlich – evtl. sogar schädlich. So gedeiht Ihr eigener Hund vielleicht mit Lammfleisch, während der Hund Ihres Nachbarn eine genetisch vererbte (oder erworbene) Unverträglichkeit gegenüber Lammfleisch hat, die dazu führt, dass er anfängt sich zu kratzen und aufgebläht ist, wenn er dieses Fleisch frisst. Das Testsystem NutriScan, auf das wir in Kapitel 6 noch ausführlich eingehen werden, gibt Ihnen Aufschluss darüber, auf welche Futterbestandteile Ihr Hund reagiert, sodass Sie diese aus seiner Diät eliminieren können.
Mythos: Ich füttere meinen Hund mit einem kommerziellen Diätfutter, deshalb brauche ich mir keine Sorgen zu machen
Einige Futtermittelhersteller haben auf die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse hinsichtlich der Ernährung und Genexpression reagiert und spezielle Diätfuttermittel entwickelt, die funktionelle Bestandteile enthalten. Um mit diesen Futtermitteln Gewinn zu erzielen, müssen sie auf große Gruppen von Hunden zugeschneidert sein. Deshalb orientieren sich die handelsüblichen Futtermittel an verschiedenen Faktoren: der Körpergröße (d. h. kleine oder große Rassen), der Lebensphase (z. B. Welpen, trächtige oder säugende Hündinnen, erwachsene Hunde oder Senioren), dem Aktivitätslevel (z. B. Wachstum, aktiv, Leistung) oder an medizinisch relevanten Zuständen (Übergewicht, Nierenerkrankung). Diese Produkte sind vielleicht bei manchen Hunden durchaus hilfreich, aber ihre Wirkung ist dennoch begrenzt. Es gibt einfach zu viele genetische und umweltbedingte Variablen, als dass allgemeine Diätfuttermittel die Bedürfnisse aller Hunde erfüllen könnten.
Ein weiterer Punkt sind irgendwelche »mysteriösen« Inhaltsstoffe, die ihren Weg in handelsübliche Futtermittel finden. Wenn Ihr Hund beispielsweise an einer Futtermittelallergie leidet, kaufen Sie vielleicht ein Fertigfutter mit einer begrenzten Anzahl von Zutaten und einer neuen Eiweißart. Und nun dies: Eine europäische Studie untersuchte jüngst zwölf handelsübliche Futtermittel mit einer limitierten Anzahl von Inhaltsstoffen, die als Eliminationsdiäten für Hunde mit Futtermittelallergien und -unverträglichkeiten gedacht waren (Ricci et al., 2013). Elf Diäten mit neuartigen Proteinen und ein Futtermittel mit hydrolysiertem Eiweiß wurden auf eine Kontamination mit anderen tierischen Inhaltsstoffen, die nicht auf dem Etikett deklariert waren, hin untersucht. Zehn der zwölf analysierten Futtermittel enthielten Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs (auch Fisch), die nicht deklariert waren!
Wenn Ihr Hund nicht wie erhofft auf ein kommerzielles Diätfuttermittel mit limitierten Antigenen (eine Diät, die nur wenige oder gar keine Inhaltsstoffe enthält, die als Auslöser von Futtermittelallergien und -unverträglichkeiten bekannt sind) anspricht, ist das Futter möglicherweise mit potenziellen Allergenen kontaminiert. Sie haben allerdings keine Chance, dies herauszufinden, da die Quellen nicht auf dem Etikett deklariert sind.
Aufgrund des Mysteriums um nicht deklarierte Inhaltsstoffe in kommerziellen Futtermitteln haben die Autoren der oben genannten Studie den Schluss gezogen, dass im Falle des Nichtansprechens eines Hundes auf ein kommerzielles antigenlimitiertes Diätfuttermittel eine selbst gemachte Diät mit einer neuen Eiweißquelle ausprobiert werden sollte, bevor man eine Futtermittelallergie oder -unverträglichkeit als Ursache des Problems ausschließt (Ricci et al., 2013).
Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die mit handelsüblichen Futtermitteln zu tun haben und deren mögliche funktionelle Wirkung zunichtemachen können. In Kapitel 3 werden wir ausführlich darauf eingehen.
Ihrem Hund könnte es besser gehen
Auch wenn die Nutrigenomik noch ein neues und sich entwickelndes wissenschaftliches Gebiet darstellt, wissen wir bereits genug über das Genom und Epigenom, um unsere Hunde mit einer Ernährung zu unterstützen, die zu einer erstaunlichen Verbesserung der Gesundheit führen kann. Professor Michael Müller, wissenschaftlicher Direktor des niederländischen Zentrums für Nutrigenomik an der Universität von Wageningen, schreibt dazu:
Ein statistisches genetisches Risiko für eine bestimmte Erkrankung bedeutet nicht, dass man diese Krankheit auch tatsächlich entwickeln wird … Es ist ein wichtiger Ausgangspunkt, aber man hat die Freiheit und Verantwortung, seinen eigenen Weg zu wählen und die richtige Ernährung und optimierte Lebensweise für die eigene genetische Prädisposition auszuwählen (Epigenetics Project Blog, 2012).
>> Auf den Punkt gebracht <<
• Das Genom ist die Gesamtheit aller Gene des Körpers. Hunde haben ca. 21.000 Gene.
• Gene bestehen aus DNA-Strängen und enthalten die Baupläne – den genetischen Code – für alle Proteine, aus denen ein lebender Organismus besteht.
• Die Genexpression ist der Vorgang des An- und Abschaltens von Genen und entscheidet darüber, wie die Zellen aussehen, wachsen und arbeiten.
• Alle Individuen haben einen spezifischen genetischen Code, der lebenslang unverändert bestehen bleibt.
• Das Epigenom ist eine zweite Schicht aus chemischen Verbindungen, welche die DNA umgeben und durch An- oder Abschalten der Gene die Geneexpression modifizieren (sodass Proteine gebildet werden oder auch nicht).
• Das Epigenom verwendet hauptsächlich zwei Wege, um das Genom zu markieren und die Geneexpression zu beeinflussen – die DNA-Methylierung und die Histonmodifikation.
• Ebenso wie das Genom können auch die chemischen Marker, die das Epigenom bilden, vererbt werden.
• Im Gegensatz zu dem lebenslang unveränderlichen genetischen Code reagiert das Epigenom außerordentlich empfindlich auf Signale aus der Umwelt.
• Positive Signale aus der Umwelt führen zur Bildung chemischer Marker, die wiederum eine für den Organismus nützliche Genexpression zur Folge haben.
• Plötzlich auftretende Gesundheitsprobleme haben sich in der Regel über einen langen Zeitraum entwickelt und werden durch umweltbedingte Angriffe auf das Epigenom ausgelöst. Wird der Körper mit diesen Angriffen nicht mehr fertig, manifestiert sich eine Krankheit.
• Eine Entzündung ist in einem bestimmten Rahmen normal und hat eine wichtige Funktion. Eine chronische Entzündung ist allerdings schädlich und führt zu einer Unzahl von Gesundheitsproblemen.
• Epigenetische Marker können chronischen entzündlichen Krankheitszuständen vorbeugen bzw. diese lindern, indem sie die Bildung entzündungsfördernder Moleküle beeinflussen.
• Funktionelle Futtermittel sind bestimmte Pflanzen, Aminosäuren, Vitamine und Pflanzeninhaltsstoffe, die Gene zur Krankheitsabwehr aktivieren und Gene zur Krankheitsförderung unterdrücken.
• Viele Faktoren können den Umstand, ob ein Futtermittel tatsächlich funktionell ist, beeinflussen, beispielsweise der Zusatz von Chemikalien, Hormonen oder Antibiotika.
• Da jeder Hund ein eigenes Genom hat, ist ein Futtermittel, das dem einen Hund nützt, bei einem anderen Hund nicht unbedingt ebenso hilfreich.
• Der NutriScan-Speicheltest kann herausfinden, auf welche Futtermittel ein Hund reagiert, sodass die entsprechenden Inhaltsstoffe aus seiner Ernährung eliminiert werden können.
• Kommerzielle Diätfuttermittel können bestimmten Hunden helfen, aber sie sind zu allgemein gehalten, als dass sie die individuellen Bedürfnisse aller Hunde abdecken könnten.
• Kommerzielle Diätfuttermittel können mit Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs kontaminiert sein, die nicht auf dem Etikett deklariert sind.
• Es gibt noch viele weitere Gründe, warum handelsübliche Futtermittel ungesunde Botschaften an die Zellen senden können. Die funktionelle Wirkung eines Futtermittels ist nur so gut wie die Summe all seiner Inhaltsstoffe.
KAPITEL 2
FUNKTIONELLE ERNÄHRUNG: WAS IHR HUND FRESSEN SOLLTE
Bisher haben wir gelernt, dass es in Bezug auf die Ernährung vor allem zweier Schritte bedarf, um auf der zellulären Ebene ein Optimum an Gesundheit zu erzeugen:
• Schritt 1: Die Fütterung einer Diät, die reich an funktionellen Bestandteilen ist, wodurch das Epigenom das Signal erhält, eine gesunde Genexpression in Gang zu setzen.
• Schritt 2: Die Reduktion oder Elimination von Bestandteilen, die schädliche Botschaften an das Epigenom senden und damit eine ungesunde Genexpression anregen (Fekete & Brown, 2007).
Sie erinnern sich bestimmt, dass funktionelle Futtermittel Nahrungsbestandteile sind, die eine Genexpression in Gang setzen, welche die Abwehr von Krankheiten zur Folge hat, und gleichzeitig die Expression von Genen abschalten, die Erkrankungen begünstigen (Bauer, 2001; Kaput & Rodriguez, 2006).
In diesem Kapitel werden Sie lernen wie man funktionelle Nahrungsbestandteile innerhalb der drei Hauptkategorien, aus denen Hundefutter zusammengesetzt ist, identifiziert:
• Kohlenhydrate
• Eiweiß
• Fett
Außerdem werden wir erläutern, welche Vorteile es hat, so viele biologisch-organische Futtermittel wie möglich in die Diät Ihres Hundes einzubauen.
Funktionelle Kohlenhydrate
Bei all dem neumodischen »Hype« um »Low-Carb«- oder »No-Carb«-Diäten (Diäten mit wenig oder ganz ohne Kohlenhydrate) sowohl für Menschen als auch für Hunde wundern Sie sich vielleicht, dass wir diese Kategorie überhaupt hier aufführen. Es stimmt, dass Hunde keinen spezifischen Bedarf an Kohlenhydraten haben, aber wie bereits erwähnt, betrachten wir das Futter Ihres Hundes nicht unter dem Aspekt von Zahlen. Uns geht es darum, eine optimierte Diät zusammenzustellen, die gesunde Botschaften an sein Epigenom sendet. Es hat sich gezeigt, dass Kohlenhydrate wesentlich dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen, da sie eine Menge funktioneller Nährstoffe enthalten – vorausgesetzt, es handelt sich um die richtige Sorte von Kohlenhydraten. Funktionelle Kohlenhydrate sind voller Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzennährstoffe, die sich auf der zellulären Ebene gesundheitsfördernd auswirken.
Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, sind Phytonährstoffe von Natur aus in Pflanzen enthalten (»Phyto« bedeutet im Griechischen Pflanze). Sie sind zwar nicht essenziell, um einen am Leben zu erhalten, wie z. B. Proteine, Fette, Vitamine und Mineralstoffe, aber es hat sich herausgestellt, dass ihr Konsum einen großen gesundheitlichen Nutzen mit sich bringt. Karotinoide, zu denen auch das Alpha- und Beta-Karotin zählen, sind wahrscheinlich die bekanntesten Pflanzennährstoffe. Sie sind die roten, orangefarbenen und gelben Pigmente, die Gemüsesorten wie Kartoffeln, Karotten und Kürbissen ihre schöne Farbe geben. Zu den Flavonoiden, einer weiteren Gruppe von Pflanzennährstoffen, zählen Anthocyane – Pigmente, die Beeren und anderen dunklen Früchten und Gemüsesorten ihre blaue, violette und rote Färbung verleihen (Linus Pauling Institute, 2013).
Pflanzennährstoffe haben außerordentliche antioxidative Eigenschaften (Antioxidantien sind Substanzen, die die Zellen vor oxidativen Schäden durch freie Radikale schützen). Es liegen Forschungsergebnisse vor, dass sie vor Herzkrankheiten und Krebs schützen und die Tumoraktivität hemmen (Drewnowski & Gomez-Carneros, 2000; mehr dazu in Kapitel 9).
Pflanzennährstoffe wirken durch eine Vielzahl von Mechanismen, wie z. B.:
• Wirkung als Antioxidantien
• Verbesserung der Immunantwort
• Verbesserung der Zellkommunikation
• Beeinflussung des Östrogenstoffwechsels
• Umwandlung in Vitamin A (Retinol) (mehr dazu in Kapitel 8)
• Induktion des Zelltodes von Krebszellen (Apoptose) (mehr dazu in Kapitel 9)
• Reparatur von DNA-Schäden, die durch Umweltgifte hervorgerufen wurden
• Entgiftung von Karzinogenen durch Aktivierung von Cytochrom P450 und Phase II Enzymsystemen (USDA, 2005)
Aber hier hört der Nutzen von Obst und Gemüse noch nicht auf. Eine bahnbrechende Studie aus dem Jahre 2014, die an Mäusen durchgeführt und in der Fachzeitschrift Molecular Nutrition and Food Research veröffentlicht wurde, konnte nachweisen, dass es sogenannte Exosomen gibt, die von pflanzlichen und tierischen Zellen sezerniert werden und über eine Form der artübergreifenden (Pflanze-Tier) Kommunikation miteinander »sprechen«. Die Forscher zeigten, dass Exosomen-ähnliche Nanopartikel (EPDEN) aus essbaren Pflanzen wie Ingwer und Karotten die zellulären Vorgänge in Mäusezellen so veränderten, dass es in diesen zu antientzündlichen und antioxidativen Aktivitäten kam. Diese Ergebnisse zählen zu den neuesten Erkenntnissen, die wir im Hinblick auf das Zusammenspiel von Nahrungsbestandteilen, dem Epigenom und der Genexpression gewinnen konnten (Ji, 2014; Mu et al., 2014). Sie sind ein weiterer Grund dafür, warum Ihr Hund immer Obst und Gemüse bekommen sollte!
Wir empfehlen, die folgenden funktionellen Kohlenhydrate in die Ernährung Ihres Hundes aufzunehmen:
• Kreuzblütler, wie z. B. Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl, Weißkohl und Chinakohl (siehe auch Kapitel 9 zu den positiven Auswirkungen dieser Gemüsesorten bei der Bekämpfung von Krebs).
• Frische, ganze Früchte, beispielsweise Äpfel, Bananen, Beeren (siehe Kapitel 9), Cantaloupe-Melone und Wassermelone. Obst enthält zwar die Einfachzucker Fruktose und Glukose, besitzt darüber hinaus in seiner ganzen, unveränderten Form aber auch funktionelle Attribute. Früchte enthalten einen großen Anteil gesunder Faserstoffe, die den Zucker abpuffern. Da der Verdauungstrakt längere Zeit benötigt, um die Faserstoffe aufzubrechen, wird Zucker aus Früchten nur langsam in die Blutbahn absorbiert, wodurch starke Blutzuckerspitzen vermieden werden (Egan, 2013). Faserstoffe aus frischem Obst fördern auch eine optimale Funktion des Verdauungsapparates und die Gewichtsabnahme. Allerdings ist Fruchtsaft ohne die Faseranteile ein Zuckerfiasko! Außerdem dürfen Sie Ihrem Hund niemals Weintrauben oder Rosinen geben, da diese für Hunde giftig sind.
• Glutenfreie Getreide, wie z. B. Hirse, Quinoa, Sorghum und glutenfreier Hafer.
• Grünes Blattgemüse, z. B. Grünkohl und Blattkohl (siehe unten).
• Hülsenfrüchte, wie z. B. Kidneybohnen, Pintobohnen, Schwarzaugenbohnen, Kichererbsen, Linsen, Limabohnen und Erbsen.
Blattgemüse und Oxalate
Oxalate sind natürlich vorkommende pflanzliche Substanzen vieler Obst- und Gemüsesorten, Nüsse und Samen – und beispielsweise auch in grünem Blattgemüse enthalten. Unter bestimmten Umständen (z. B. beim »Leaky Gut Syndrom«) können exzessive Mengen an Oxalaten aus dem Darm absorbiert werden und im Blut, Urin und in den Geweben erscheinen. Werden Oxalate über den Urin ausgeschieden, können sie sich an Kalzium binden und Kalzium-Oxalat-Kristalle bilden, die wiederum zu Nierensteinen werden können (Oxalosis and Hyperoxaluria Foundation, 2008).
Wegen des Oxalatgehaltes von grünem Blattgemüse wird häufig davor gewarnt, dieses an Hunde zu verfüttern. Allerdings weisen einige »Experten« auf diesem Gebiet darauf hin, dass auch viele andere Pflanzen wie z. B. Süßkartoffeln, bestimmte Bohnensorten (schwarze und weiße Bohnen, Great Northern Bohnen, Navy Bohnen und Pink Bohnen), Rote Bete, Vollkornreis, Buchweizen und Erdnüsse ebenfalls einen hohen Gehalt an Oxalaten aufweisen, ebenso wie Mais, Weizen und Soja (Oxalosis and Hyperoxaluria Foundation, 2008). Und besonders Letztere sind in den meisten kommerziellen Tierfuttermitteln enthalten!
Da grünes Blattgemüse so viele gesundheitliche Vorteile für unsere tierischen Begleiter bietet, raten wir nicht dazu, es aus der Diät Ihres Hundes zu eliminieren, es sei denn, dies geschieht auf den ausdrücklichen Rat Ihres Tierarztes hin. Wir empfehlen, die Sorten mit den höchsten Oxalatgehalten zu meiden, beispielsweise Spinat, das Grüne von Roter Bete und Mangold, und stattdessen solche mit niedrigeren Oxalatwerten zu wählen, z. B. Blattkohl, Brunnenkresse, Weißkohl, Pflücksalat und Grünkohl. Auch diese Sorten sollte man natürlich nur in moderaten Mengen füttern. Auf der Webseite der Oxalosis and Hyperoxaluria Foundation (www.ohf.org) finden Sie eine Liste mit dem Oxalatgehalt verschiedener Nahrungsmittel (auf Englisch).
Hunde mit einer fütterungsbedingten Hyperoxalurie, d. h. einem hohen Gehalt von Oxalaten im Urin, können von der Zugabe von Kalziumzitrat zum Futter profitieren (wobei andere Mineralstoffsupplemente vermieden werden). Das Kalzium bindet die Oxalate im Futter und bildet mit diesen einen Kalzium-Oxalat-Komplex, der im Darm nicht absorbiert wird und stattdessen unschädlich mit dem Kot ausgeschieden wird (NYU School of Medicine, undatiert; Puotinen & Straus, 2010).
Moderne Hunde und Diäten mit einem hohen Stärkegehalt
Wir würden gerne noch auf einen weiteren Punkt eingehen. Im Januar 2013 veröffentlichte eine Gruppe von Evolutionsgenetikern der schwedischen Universität in Uppsala in der Zeitschrift Nature eine Studie, die zeigte, dass die Domestikation des Hundes mit einer evolutionsbedingten Selektion von drei für die Verdauung von Stärke (komplexen Kohlenhydraten) verantwortlichen Hauptgenen einherging – AMY2B, MGAM und SGLT1. Die Autoren zogen daraus den Schluss, dass die Mutation dieser Gene dafür sorgt, dass Hunde mit einer stärkereichen Fütterung gedeihen können. Sie schrieben: »Unsere Ergebnisse zeigen an, dass neue Anpassungen bei den frühen Vorfahren unserer heutigen Hunde dafür sorgten, dass diese mit einer im Vergleich zu den fleischlastigen Nahrungsgewohnheiten der Wölfe sehr stärkereichen Kost gedeihen konnten, was einen entscheidenden Schritt in der frühen Domestikation der Hunde darstellte« (Axelsson et al., 2013, pp. 360).
Beachten Sie, dass die Forscher schreiben »im Vergleich zu den fleischlastigen Nahrungsgewohnheiten der Wölfe«. Ein wichtiges Ergebnis der Studie war, dass Hunde zwischen vier und 30 Kopien eines Gens haben, das die Amylase kodiert, ein Enzym, das Stärke zerlegt, während Wölfe nur zwei Kopien haben (Axelsson et al., 2013). Allerdings sagen uns die Autoren nicht, wie viele dieser Gene ein echter Allesfresser hat. Was, wenn dieser 100 oder 10.000 hat? Diese Auslassung lässt die Bedeutung der obigen Ergebnisse zweifellos fragwürdig erscheinen (Knueven, 2014). Die Autoren bemerken darüber hinaus, dass Menschen, die echte Allesfresser sind, Amylase im Speichel bilden (der ersten Kontaktstelle für die Stärkeverdauung), während Hunde Amylase nur in der Bauchspeicheldrüse bilden (Axelsson et al., 2013).
Wie bereits erwähnt, sind wir absolut der Meinung, dass Hunde durchaus von der Aufnahme bestimmter funktioneller komplexer Kohlenhydrate profitieren können. Allerdings besteht ein großer Unterschied zwischen der Integration von funktionellen Stärkeprodukten in die Diät eines Hundes und der Schlussfolgerung, dass Hunde »mit einer stärkereichen Fütterung gedeihen können«, ohne dabei die Art und Qualität der Stärke zu benennen. Unserer Ansicht nach ist diese Annahme recht weit hergeholt. Leider hat sie dazu geführt, dass die Gesundheit unserer Hunde über Jahrzehnte unterminiert wurde und wir jetzt im Hinblick auf den derzeitigen Gesundheitszustand unserer vierbeinigen Begleiter mitten in einer nationalen Gesundheitskrise stecken, in der Übergewicht und chronische Krankheiten nicht die Ausnahme, sondern die Norm darstellen. Wenn wir davon ausgehen, dass die meisten Hunde heutzutage ein industriell hergestelltes Futter mit einem sehr hohen Stärkeanteil erhalten, liegt für uns ganz klar auf der Hand, dass Hunde nicht mit einer stärkereichen Fütterung gedeihen!
Wir werden im weiteren Verlauf dieses Buches aufdecken, dass Stärkearten mit einem hohen glykämischen Index, wie z. B. Mais und Getreide, die in Tierfuttermitteln verarbeitet werden, einer der Hauptgründe für die in der heutigen Hundepopulation grassierenden chronischen Krankheiten und Fettleibigkeit sind. Oder wie unser lieber Freund und bekannter ganzheitlicher Tierarzt Doug Knueven, DVM, sagt: »Zu behaupten, dass Hunde mit einer stärkereichen Fütterung gedeihen, nur weil sie Stärke verdauen können, ist genauso, als würden wir annehmen, dass Menschen, nur weil sie Ethanol und Glukose verstoffwechseln können, mit einer Ernährung gedeihen könnten, die reich an Rum und Keksen ist!« Dem haben wir nichts hinzuzufügen!
Funktionelle Eiweiße (Proteine)
Eiweiß ist wohl der wichtigste Bestandteil in der Nahrung der Hunde, denn ohne diesen können sie nicht überleben. Eiweiß ist für den Aufbau und die Reparatur von Muskeln und Geweben notwendig, und es gibt die Struktur von Haut, Haaren, Nägeln, Knochen, Gelenken, Sehnen, Bändern, Knorpel und Muskelfasern vor (Case et al., 2011).
Nachfolgend sind einige wichtige Funktionen von Eiweiß aufgeführt:
• Antikörper aus Eiweißverbindungen schützen den Körper vor fremden »Angreifern« wie z. B. Viren und Bakterien und erhalten das Immunsystem stark.
• Kollagen (eine Eiweißsubstanz) macht den größten Teil des Bindegewebes des Körpers aus.
• Eiweiß-Botenstoffe, darunter auch einige Hormone, regulieren etliche Systeme im Körper (z. B. Insulin, das unabdingbar für die Kontrolle des Blutzuckerspiegels ist).
• Enzyme aus Eiweißen sind an fast allen der Abertausende chemischer Reaktionen beteiligt, die in den Zellen ablaufen.
• Proteine unterstützen die Regulation der Muskelaktion.
• Transport-Proteine im Blut schaffen lebenswichtige Vitamine und Nährstoffe in alle Teile des Körpers (z. B. Hämoglobin, das den Sauerstoff in die Gewebe bringt).
(Case et al., 2011; National Library of Medicine, 2013; PetMD, 2013)
Betrachtet man die vielen wichtigen Aufgaben, die Eiweiß im Körper hat, liegt auf der Hand, dass Hunde eine Menge davon aufnehmen sollten, um zu gedeihen. Umso mehr, als Eiweiß permanent um- und abgebaut wird, sodass der Körper ständig Nachschub benötigt, um seine Vorräte wiederaufzufüllen. (Case et al., 2011; PetMD, 2013).
Qualitativ hochwertiges Eiweiß
Aber nicht nur die Eiweißmenge ist von Bedeutung, sondern auch die Qualität. In der Vergangenheit gab es zahlreiche Veröffentlichungen zur Eiweißqualität. Sie können auch einfach ein x-beliebiges Magazin zum Thema Bodybuilding nehmen und werden darin detaillierte Informationen zu Eiweißen und den Nahrungsmitteln finden, die man für maximalen Muskelaufbau essen sollte. Das alles ist sicher sehr wichtig, aber wir werden die Eiweißqualität unter ganz anderen Gesichtspunkten betrachten. Das Eiweiß, das Ihr Hund bekommen sollte, muss immer noch aus herkömmlicher Sicht qualitativ hochwertig sein, aber von jetzt an muss es auch noch funktionell sein. Im nächsten Kapitel werden wir uns all den Faktoren widmen, die ein normalerweise hochwertiges Eiweiß zu einem ungesunden Nahrungsbestandteil werden lassen, der Entzündungen und chronische Erkrankungen fördert. Dies ist natürlich das genaue Gegenteil von dem, was wir anstreben, um eine optimale Zellgesundheit und nützliche Geneexpression zu erreichen.
Aminosäuren: die Bausteine von Eiweißen
Eiweiße bestehen aus langen Ketten kleinerer Einheiten – den sogenannten Aminosäuren. Ein Eiweißmolekül kann Hunderte oder sogar Tausende von Aminosäuren enthalten (Case et al., 2011). Hunde verwenden 22 verschiedene Aminosäuren, die zu unterschiedlichen Sequenzen zusammengesetzt werden, um die verschiedenen Proteine zu bilden. Zwölf dieser Aminosäuren werden als »nicht-essenziell« bezeichnet, da der Körper des Hundes diese selbst in ausreichender Menge herstellen kann, um den Eigenbedarf zu decken; somit stellen sie keinen notwendigen Bestandteil des Futters dar.
Die anderen zehn sind hingegen sogenannte »essenzielle Aminosäuren«, da Hunde selbst nicht genügend von ihnen synthetisieren können, um die Gesundheit aufrechtzuerhalten. Demnach müssen diese essenziellen Aminosäuren über das Futter zugeführt werden (Case et al., 2011).
Die zehn essenziellen Aminosäuren für Hunde sind:
• Arginin
• Histidin
• Isoleucin
• Leucin
• Lysin
• Methionin
• Phenylalanin
• Threonin
• Tryptophan
• Valin
Das im Futter enthaltene Eiweiß liefert nicht nur die zehn essenziellen Aminosäuren, sondern ist auch die Hauptquelle für Stickstoff. Der Körper benötigt Stickstoff, um die nicht-essenziellen Aminosäuren und andere lebenswichtigen Moleküle, wie z. B. verschiedene Hormone und Neurotransmitter, zu synthetisieren (Case et al., 2011).
Der Körper kann nur dann Eiweiß synthetisieren, wenn alle essenziellen Aminosäuren in ausreichender Menge vorhanden sind. Wenn auch nur eine einzige essenzielle Aminosäure fehlt, bricht der gesamte Vorgang der Proteinsynthese zusammen, unabhängig davon, wie viel von jeder anderen Aminosäure zur Verfügung steht. Daher ist der Nahrungsbedarf des Körpers nicht auf Eiweiß per se ausgerichtet, sondern auf essenzielle Aminosäuren. Als Eiweißbausteine sind Aminosäuren die Bausteine des Lebens schlechthin. Damit eine Eiweißquelle also als qualitativ hochwertig bezeichnet werden kann, muss sie die richtige Zusammensetzung essenzieller Aminosäuren liefern. Sie muss außerdem eine hohe biologische Wertigkeit haben, d. h., dass der Körper die in dem Eiweiß enthaltenen Aminosäuren und den Stickstoff effizient absorbieren und verwenden kann (Case et al., 2011).
Auf der Grundlage dieser Kriterien stammt das Eiweiß mit der höchsten Qualität aus tierischen Quellen. Die Gewinner sind (in alphabetischer Reihenfolge):
• Eier
• Fisch
• Milchprodukte
• Muskelfleisch
• Organe
Allerdings bekommt »hohe Qualität« eine ganz neue Bedeutung, wenn man noch berücksichtigt, dass die Quellen funktionell sein sollen. Deshalb definieren wir ein qualitativ hochwertiges und gemäß den Prinzipien der Nutrigenomik wie folgt:
• Bioverfügbar (leicht zu verdauen und zu verwerten).
• Frei von Verunreinigungen wie z. B. Chemikalien, Hormone und Antibiotika.
• Keine Förderung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten bzw. -überempfindlichkeiten.
• Enthält keine Bestandteile, die ungesunde Botschaften an das Epigenom senden und dadurch eine ungesunde Genexpression auslösen.
• Unverfälscht (also z. B. nicht genma- nipuliert) und unverarbeitet bzw. nur minimal verarbeitet.
Basierend auf dieser Definition empfehlen wir Ihnen, im Wechsel die folgenden qualitativ hochwertigen und funktionellen Eiweißquellen zu verfüttern:
• Milchprodukte aus Ziegen- oder Schafsmilch, einschließlich Milch, Käse und Joghurt (vorzugsweise roh und biologisch-organisch).
• Eier (vorzugsweise aus Freilandhaltung und biologisch-organisch).
• Fisch mit niedrigem Quecksilbergehalt, z. B. Sardinen, wildgefangener Alaska-Lachs (vermeiden Sie gezüchteten Lachs), Seelachs und Seewolf. Meiden Sie Fisch mit hohem Quecksilbergehalt wie z. B. Thunfisch (v. a. Weißen Thunfisch), Makrele, Torpedobarsch, Hai und Schwertfisch. Wir empfehlen außerdem, Hunden keine Schalenfrüchte wie Shrimps, Krabben, Hummer, Muscheln und Austern zu geben, da manche Hunde darauf ebenso schwere allergische Reaktionen entwickeln können wie Menschen. (Bitte beachten Sie, dass wir im weiteren Verlauf dieses Buches zahlreiche Supplemente empfehlen, die wegen ihrer therapeutischen Eigenschaften Bestandteile von Schalenfrüchten enthalten, beispielsweise Grünlipp-Muschelextrakt oder Glucosamin. Diese stellen für die meisten Hunde kein Problem dar, aber wenn Sie sich Sorgen machen, dass Ihr Hund evtl. allergisch auf Schalenfrüchte reagieren könnte, suchen Sie bitte Ihren Tierarzt auf, bevor sie derartige Produkte einsetzen.)
• Muskelfleisch und Organe aus neuen tierischen Quellen, z. B. Bison oder Büffel, Ente, Ziege, Schwein, Kaninchen, Truthahn und Wild (vorzugsweise grasgefüttert und aus natürlicher Aufzucht ohne Hormone oder Antibiotika). Diese Quellen bergen ein geringeres Risiko, Futtermittelunverträglichkeiten oder Überempfindlichkeiten auszulösen als herkömmliche tierische Eiweiße wie Rind, Huhn und Lamm.
Die Eiweißmenge, die Ihr Hund benötigt, hängt von seinem Alter, Aktivitätslevel, spezifischen gesundheitlichen Problemen und der Eiweißqualität ab (Kealy, 1999). Bedenken Sie: Je geringer die Bioverfügbarkeit der Proteinquelle ist, desto mehr braucht Ihr Hund davon, um die Aminosäuren zu assimilieren. Bekommt Ihr Hund also ein kommerzielles Futter voller Eiweiß minderer Qualität auf Getreidebasis (mehr dazu im nächsten Kapitel), muss dieses einen höheren Prozentsatz an Eiweiß enthalten als ein selbst gemachtes Futter aus frischen tierischen Eiweißquellen mit hoher Bioverfügbarkeit.
Funktionelle Fette und Öle
Genauso, wie momentan Low-Carb-und No-Carb-Diäten der letzte Schrei sind, gilt dies auch für Low-Fat-Diäten (Diäten mit wenig Fett). Aber Sie sollten Ihrem Hund diese wichtige Nährstoffquelle nicht versagen, es sei denn, er hätte eine spezifische Erkrankung, die eine Fettrestriktion erfordert, wie z. B. eine Pankreatitis (Bauchspeicheldrüsenentzündung). Das in der Nahrung enthaltene Fett versorgt den Hund mit der am höchsten konzentrierten und am leichtesten verdaulichen Form von Energie (mehr als die zweifache Menge an Kalorien pro Gramm im Vergleich zu Eiweiß oder Kohlenhydraten) und liefert wichtige essenzielle Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren. Außerdem spielt es eine entscheidende Rolle bei der Resorption fettlöslicher Vitamine und trägt zu einem gesunden Nervensystem bei (Case et al., 2011; PetMD, 2013). Hunde können auch einen höheren Anteil an Fett im Futter vertragen, da ihre Fähigkeit zur Fettverbrennung sehr viel größer ist als die des Menschen (mehr dazu in Kapitel 5, wenn es um das Thema Hundesport geht) (Hill, 1998). Außerdem lieben sie den Geschmack!
Fette fallen in zwei Kategorien:
• Gesättigte Fette, die in den meisten Futtermitteln tierischer Herkunft enthalten sind (z. B. Fleisch, Milchprodukte). Gesättigte Fette sind bei Raumtemperatur fest.
• Ungesättigte Fette, die v. a. in Pflanzenölen enthalten sind. Ungesättigte Fette sind bei Zimmertemperatur flüssig.
Es gibt zwei Arten von ungesättigten Fetten:
• Einfach ungesättigte Fette, z. B. Olivenöl, Erdnussöl.
• Mehrfach ungesättigte Fette, beispielsweise Sonnenblumenöl, Sesamöl (auch bekannt als mehrfach ungesättigte Fettsäuren). Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren sind ebenfalls ungesättigte Fettsäuren. Im weiteren Verlauf dieses Buches werden Sie noch sehr viel mehr über die wundersamen Eigenschaften von Omega-3-Fettsäuren erfahren.
(Web MD, 2014)
Wir empfehlen, verschiedene funktionelle Fette in die Ernährung Ihres Hundes zu integrieren. Einige unserer Favoriten sind:
• Hühnerfett oder Lammfett (es sei denn, Ihr Hund hat eine Futtermittelunverträglichkeit oder Überempfindlichkeit auf Huhn oder Lamm).
• Fettreicher Fisch mit niedrigem Quecksilbergehalt und hohem Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, wie oben aufgeführt.
• Neue Fleischquellen, wie oben aufgeführt.
• Öle, z. B. Fischöl (für die Omega-3-Fettsäuren), Borretschöl, Kokosöl, Hanföl, Olivenöl, Nachtkerzenöl, Kürbiskernöl und Sonnenblumenöl.
Tipps zum Kauf von Ölen
Wenn Sie Öl kaufen möchten, achten Sie darauf, dass das Öl nicht durch Extraktion, sondern durch mechanische Kaltpressung gewonnen wurde, da nur dadurch eine optimale Reinheit gewährleistet ist. Bei dieser Form der Pressung wird das Öl mechanisch aus den Nüssen bzw. Samen gepresst. Ansonsten wird das Öl durch Extraktion gewonnen, wobei meist Hexan verwendet wird; Hexan ist ein Petroleumderivat aus Rohöl! Das Portal der Behörde der U. S. Regierung für toxische Substanzen und die Registrierung von Krankheiten (ATSDR) schreibt dazu:
Die meisten der industriell verwendeten n-Hexane werden mit ähnlichen Chemikalien gemischt, die auch als Lösungsmittel bezeichnet werden. Das Haupteinsatzgebiet für Lösungsmittel, die n-Hexan enthalten, ist die Extraktion pflanzlicher Öle aus Feldfrüchten wie z. B. Sojabohnen. Diese Lösungsmittel werden außerdem als Reinigungsmittel in der Druck-, Textil-, Möbel- und Schuhindustrie verwendet. Bestimmte Arten von Klebstoffen in der Bedachungs-, Schuh- und Lederindustrie enthalten ebenfalls n-Hexan, ebenso wie zahlreiche Verbrauchsgüter wie z. B. Benzin, Sekundenkleber für den Hobbybereich und Gummizement (ATSDR, 2011).
Glauben Sie nicht, dass Sie Hexan in dem Zutatenverzeichnis entdecken würden – es wird nicht aufgeführt sein. Da Hexan während der Verarbeitung verdampft, muss es nicht deklariert werden! Mechanisch kalt gepresste Öle kosten etwas mehr als mit Hexan extrahierte Öle, aber wir finden, dass es nur ein geringer Preis ist, wenn man kein Rohöl konsumieren möchte!





























