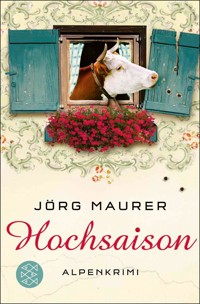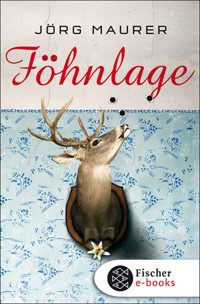16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER digiBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ermittlerfreude mit Bestseller-Autor Jörg Maurer: Kommissar Jennerwein braucht für seinen vierten bis sechsten Fall den berühmten Blick für alles Unstimmige. Freuen Sie sich auf Lesegenuss mit unerwarteten Wendungen und hintergründigem Witz. Oberwasser: Dunkle Gestalten schleppen eine leblose Person zur Höllentalklamm. Kommissar Jennerwein muss in seinem vierten Fall einen verschwundenen BKA-Ermittler finden, aber niemand darf wissen, dass er nach ihm sucht. Während er mit seinem bewährten Team offiziell einem Wilderer nachstellt, forscht er in Gumpen und Schluchten nach dem Vermissten. Derweil erzählen die Einheimischen düstere Legenden von Flößern, die einst das Wildwasser in eine Höhle sog, ein neugieriger Numismatiker entdeckt kryptische Zeichen auf einer alten Goldmünze, und ein Scharfschütze lauert am Bergbach. Kommissar Jennerwein gerät beinahe ins Strudeln… Unterholz: Auf der Wolzmüller-Alm wird eine Frauenleiche gefunden. Jennerweins Bemühungen, etwas über die "Tote ohne Gesicht" zu erfahren, laufen ins Leere. Niemand im Ort will etwas über geheime Treffen auf der Alm gewusst haben, und der Bürgermeister bangt nur um seine Bollywood-Kontakte. Endlich verrät das Bestatterehepaar a.D. Grasegger dem Kommissar, dass es sich bei der Toten um die "Äbtissin" handeln soll, eine branchenberühmte Auftragskillerin. Wer hat es geschafft, sie umzubringen? Da geschieht ein weiterer Almenmord, ein mysteriöser Maler gerät ins Fadenkreuz, und Jennerwein pirscht mit seiner Truppe durchs Unterholz… Felsenfest: Geiselnahme auf einem Gipfel! Ein maskierter Mann bringt brutal eine Wandergruppe in seine Gewalt. Kurz danach stürzt eine Geisel den Abgrund hinunter. Als Kommissar Jennerwein alarmiert wird, merkt er, dass er alle Opfer persönlich kennt – aus der Schulzeit. Hat sein sechster Fall etwas mit der eigenen Vergangenheit zu tun? Während sein Team Geocacher jagt, macht das Bestatterehepaar a.D. Grasegger in Grabgruften und Grundbüchern eine brisante Entdeckung. Jetzt muss Jennerwein alles anzweifeln, woran er felsenfest geglaubt hat … »Da schreibt einer, der weiß, was er tut. Sehr unterhaltsam.« Süddeutsche Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1374
Ähnliche
Jörg Maurer
Auf der Alm mäht der Tod noch selbst
Jennerweins vierter bis sechster Fall in einem E-Book
Über dieses Buch
»Oberwasser« (Kommissar Jennerweins vierter Fall): Jennerweins Suche nach einem verschwundenen BKA-Ermittler führt sein Team in die Höllentalklamm und in gefährliches Strudel.
»Unterholz« (Kommissar Jennerweins fünfter Fall): Auf der Wolzmüller-Alm wird eine Frauenleiche gefunden. Nur das Bestatterehepaar a.D. Grasegger weiß, dass die Tote eine berühmte Auftragskillerin war...
»Felsenfest« (Kommissar Jennerweins sechster Fall): Geiselnahme und Mord auf einem Gipfel über dem Kurort! Jennerwein kennt alle Opfer persönlich – aus der Schulzeit. Auch den Mörder?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jörg Maurer stammt aus Garmisch-Partenkirchen. Er studierte Germanistik, Anglistik, Theaterwissenschaften und Philosophie und wurde als Autor und Kabarettist mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kabarettpreis der Stadt München, dem Agatha-Christie-Krimi-Preis, dem Ernst-Hoferichter-Preis, dem Publikumskrimipreis MIMI und dem Radio-Bremen-Krimipreis.
Inhalt
Buch 1: Oberwasser
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
Kielwasser
Anhang 1
Anhang 2
Danksagungen
Buch 2: Unterholz
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
Eine schöne Leich’
Ein zünftiger Leichenschmaus
Ein nützlicher Anhang
Ein herzliches Dank’schee
Buch 3: Felsenfest
Vorwurf des Autors
Die Absolventen des Abiturjahrgangs 82/83
[Klassenzeitung Beppo Prallinger]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
[Klassenzeitung Harald Fichtl]
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
[Klassenzeitung Bernhard Gudrian]
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
[Klassenzeitung Antonia Beissle]
16. Kapitel
[Klassenzeitung Christine Schattenhalb]
17. Kapitel
[Klassenzeitung Siegfried Schäfer]
18. Kapitel
[Klassenzeitung Heinz Jakobi]
19. Kapitel
20. Kapitel
[Klassenzeitung Uta Eidenschink]
21. Kapitel
[Klassenzeitung N.N.]
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
[Klassenzeitung Susi Herrschl]
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
[Klassenzeitung Helmut Stadler]
[Klassenzeitung Simon Ricolesco]
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
[Klassenzeitung Dietrich Diehl]
39. Kapitel
40. Kapitel
[Klassenzeitung Ronni Ploch]
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
[Klassenzeitung Max Schirmer]
46. Kapitel
47. Kapitel
[Klassenzeitung Jerry Dudenhofer]
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
[Klassenzeitung Gunnar Viskacz]
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
[Klassenzeitung Schorsch Meyer III]
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
Nachwurf
Anhang 1
Anhang 2
Anhang 3
Jörg Maurer
Oberwasser
Alpenkrimi
1
Berge, Berge, Berge. Zithermusik. Ein Mann in oberbayrischer Tracht. Sein Gesicht ist geschwärzt. Er blickt wild um sich. Er trägt einen Riesenschnauzbart, den er jetzt sorgfältig glattstreicht. In der Hand hält er einen uralten Schießprügel, der noch mit Pulver geladen werden muss.
Wilderer (singt) Auf den Bergen wohnt die Freiheit!
Ein Polizeiauto nähert sich mit Martinshorn, Türen werden aufgerissen.
Lautsprecherstimme Geben Sie auf, Sie haben keine Chance!
Wilderer (lädt nach) I gib net auf, nia und nimmer!
Ein Fallnetz wird über den Berserker geworfen, jodelnd und schuhplattelnd wird er ins Polizeiauto gezogen. Die Türen werden zugeschlagen, das Auto fährt mit kreischenden Reifen davon. Im Inneren des Autos reißt sich der Wilderer den falschen Schnauzbart herunter.
Wilderer Den Düwel ook, dat war knapp!
2
Es war Anfang Mai, die Nacht war schwül, und ein warmer Wind schob sich im Schritttempo westwärts durch den Werdenfelser Talkessel. Der Mond hing über der Alpspitze wie ein frisch geschmiertes, ganz leicht angebissenes Schmalzbrot, er warf einen matten Glanz über den heruntergekommenen Schrottplatz dort unten am Rande des Kurorts. Der heiße Wind strich durch die verbeulten Rohre und ließ ein hohles Stöhnen und heiseres Rasseln hören. Das Mondlicht brachte die verbogenen Stahlteile und ausgeweideten Metallgerippe der Autowracks auf derart unheimliche Weise zum Glitzern und Funkeln, dass man nicht überrascht gewesen wäre, wenn sich die alten Kardanwellen und zerbrochenen Pleuelstangen zu einem schaurigen Totentanz aufgerafft hätten, zu so etwas wie einem Danse Macabre im Otto’schen Viertakt. Ein einzelnes Eisenteil stach besonders hervor. Es hing über der Tür des kleinen ramponierten Bürohäuschens, es war ein armdickes U, alle anderen Buchstaben des Wortes waren längst abgefallen. Sicher waren viele der Kunden schon stehengeblieben und hatten gerätselt, was denn das einst für eine Inschrift gewesen sein mochte. Denn der Schrottplatz gehörte dem alten und versoffenen, ganz und gar U-losen Heilinger Herbert. Gleich neben dem einsamen Buchstaben-Cowboy lehnte eine verwitterte Holzleiter an der Wand, sie führte in den ersten Stock, durch das zersplitterte Fenster konnte man ein paar Sofas und Chaiselongues mit herausgewachsenen Sprungfedern erkennen. Das wirkte von weitem fast romantisch und einladend, nahezu crimsig und cloverig, doch der Raum war bei genauerer Überprüfung so verwanzt und verlaust, so endgültig siffifiziert, dass sich der Mühlriedl Rudi und die Holzmayer Veronika entschlossen hatten, nicht dort oben zu bleiben, sie hatten es sich vielmehr gegenüber dem verfallenen Bürohäuschen in einem alten Mercedes gemütlich gemacht. Der Benz war vor ein paar Tagen erst auf der Bundesstraße 2 vom rechten Weg abgekommen, in den Motorraum hatte sich eine kräftige Mittenwalder Tanne gefräst, die Lederbezüge im Inneren hingegen waren noch intakt, und die Rücksitze luden zum launigen Verweilen ein. Der Mühlriedl und die Holzmayerin hatten sich auf den nachlässig abgesperrten Schrottplatz geschlichen, und der Diesel war ihnen gleich als Erstes aufgefallen. Eine Weile hatten sie eng umschlungen nebeneinander gesessen und in die Nacht hinein gelauscht, die schaurigen Geräusche der Fahrzeugleichen um sie herum gaben ihnen noch den zusätzlichen Kick. Geflüsterte Liebesschwüre und gepresste Zukunftspläne flogen hin und her, dann aber hielten beide gleichzeitig inne. Sie richteten sich langsam auf und spähten vorsichtig durch die zersplitterten Fensterscheiben.
»Hast du das gehört?«
»Ja. Da draußen ist jemand.«
»Angestellte vom Schrottplatz.«
»Jetzt? Mitten in der Nacht?«
Aus Richtung des Bürohäuschens näherten sich hastige Schritte, dazwischen wurden Stimmen laut. Es waren zornige Flüche in einer fremden Sprache, gepresste Beschimpfungen und gebellte Befehle. Man konnte drei Gestalten erkennen, eine davon ließ ein kurzes Rohrstück über dem Kopf kreisen, um es schließlich wütend auf den Boden zu knallen. Sie waren auf Krawall aus.
»Jessas!«, sagte der Rudi und dämpfte die Stimme auf Winnetous Pirschlautstärke. »Was kommen denn da für welche?«
Die Veronika sagte nichts, sie bekreuzigte sich zitternd.
Der Mühlriedl und die Holzmayerin waren verheiratet, jeweils verheiratet, und jeweils unglücklich. Sie waren beide auch nicht gerade die Teenys, welche man auf dem Rücksitz eines zerbeulten Mercedes Benz erwartet hätte, sie waren schon im fortgeschrittenen Alter, hätten sich deshalb locker ein Hotelzimmer leisten können, was natürlich eine Lachnummer gewesen wäre in einer überschaubaren Gemeinde mit knapp dreißigtausend Einwohnern. Die Hotelbranche des Kurorts war fest in der Hand von hochmultiplikativen Ratschkathln und ureinheimischen Dampfplauderern, das Anmieten eines Hotelzimmers von zwei bekannten Größen des Ortes (Sägewerk und Apotheke) hätte sich mit Überlichtgeschwindigkeit herumgesprochen. Sie waren noch nicht sonderlich weit fortgeschritten mit ihren aushäusigen Aktivitäten, die Holzmayer Veronika hatte mal grade eben ihr Handtäschchen von der Schulter gestreift und auf den Sitz gestellt.
»Die kommen direkt auf uns zu!«, flüsterte sie entsetzt.
Der Mühlriedl Rudi murmelte ein paar unverständliche Worte, vielleicht war es auch ein Stoßgebet. Kleine Schweißperlen traten ihm auf die Stirn. Beide wagten es nicht, sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen, so groß war ihre Angst, das Geknarze des maroden Unfallwagens könnte sie verraten. Die Gestalten kamen Schritt für Schritt näher, einer zeigte sogar in ihre Richtung. An Flucht war jetzt nicht mehr zu denken.
»Hast du dein Stichmesser dabei?«, presste die Veronika heraus.
Der Mühlriedl Rudi schluckte und schüttelte den Kopf. Nein, natürlich nicht. Wer nimmt zu einem nächtlichen Rendezvous schon ein Stichmesser mit? Die schwarz gekleideten Männer da draußen sahen auch nicht so aus, als ob man sie mit einem Brotzeitmesser in Schach halten könnte. Sie waren jetzt nur noch zehn oder fünfzehn Meter vom Benz entfernt. Einer von ihnen torkelte, als ob er betrunken wäre. Doch er war nicht betrunken, man hatte ihm die Arme hinter dem Rücken gefesselt, durch die Stöße der beiden anderen konnte er das Gleichgewicht nur mit Mühe halten. Sein Mund war mit einem Band verklebt, und er wand sich unter Schmerzen. Einer der beiden anderen nahm das Eisenrohr vom Boden auf und schlug ihm ohne Vorwarnung von hinten in die Kniekehlen, so dass er strauchelte und zusammensackte. Er blieb leblos liegen. Die beiden packten ihn an den Füßen und schleiften ihn über den grobkörnigen Kiesboden. Dabei blieben die Kopfhörerkabel seines neongrünen iPod immer wieder an einzelnen Steinen hängen. Sein Kopf holperte über die Schlaglöcher, sie beachteten es nicht. Dann hielten sie inne und sahen sich um. Sie schienen ein Versteck zu suchen. Der Mühlriedl Rudi schloss die Augen.
»Die werden doch nicht ausgerechnet –«
Die Holzmayerin hielt sich die Hand vor den Mund, ihre Augen waren weit aufgerissen. Doch die beiden Gestalten bemerkten die unfreiwilligen Zeugen nicht, sie richteten den leblosen Körper auf, fassten ihn an Armen und Beinen, um ihn zu einem alten Ford zu tragen, der nur ein paar Meter neben dem Benz stand. Die Gesichter der beiden Schlepper waren nicht zu erkennen, sie trugen schwarze Skimützen, die sie tief in die Stirn gezogen hatten. Einer öffnete den Kofferraum des Wagens, der andere machte Anstalten, den Leblosen hochzuzerren und in den Kofferraum zu hieven. Als er auf der Kante lag, konnte man das Gesicht des Opfers gut erkennen. Seine Glatze war frisch rasiert, die Augen waren geschlossen, der Mund war mit einem Haushaltstape überklebt, die Hände waren mit demselben Tape auf dem Rücken gefesselt. Dem Mühlriedl und der Holzmayerin liefen Schauer des Entsetzens den Rücken hinunter.
Besonders unheimlich bei dem Glatzköpfigen war eine Markierung auf dem geschorenen Kopf. In Höhe der Ohrenspitzen lief rund um den ganzen Schädel eine gestrichelte Linie. Innerhalb des Kreises war ein Punkt gemalt, auf den ein Pfeil zeigte. Veronika Holzmayer versuchte sich diese beiden Details einzuprägen: die seltsame Markierung auf der Glatze des Bewusstlosen und den um den Hals gehängten iPod, der in einer neongrünen Plastikhülle steckte. Das lenkte ein bisschen von der Angst ab, jedoch nicht lange, denn bald fiel ihr Blick auf ein neues beunruhigendes Detail. Es war hell genug, um den dunklen Fleck auf der Innenseite des linken Unterarms zu sehen. Die Verfärbung sah wie ein Brandfleck aus, der von einem Stromschlag herkommen mochte, vielleicht war es auch ein Bluterguss von einem unsauberen Nadeleinstich oder anderen Dingen, die man gar nicht so genau wissen wollte. Die Holzmayer Veronika versuchte sich auch diese Beobachtung für eine eventuelle spätere Zeugenaussage einzuprägen. Das hätte sie sich sparen können. Es sollte keine späteren Zeugenaussagen geben.
Der leblose Körper wurde roh in den Kofferraum geworfen, der Deckel wurde zugeschlagen, die beiden Pudelmützen schrien und fuchtelten, sie schienen sich immer noch zu streiten. Der Mühlriedl und die Holzmayersche wurden nicht recht schlau aus den gutturalen stoßweise gepressten Zischlauten und fremdländischen Zungenschlägen. Irgendetwas Slawisches glaubte der Rudi herauszuhören. Dann ging alles ganz schnell, die Fremden stiegen in den Wagen und starteten ihn. Das überraschte insofern, weil man nicht vermutet hätte, dass sich inmitten der vielen Fahrzeugwracks auch ein quicklebendiges befand. Die Pudelmützen wendeten den Wagen und fuhren sehr, sehr leise davon. Ein Blitzstart mit quietschenden Reifen wäre nicht so beunruhigend gewesen wie dieses leise Wegfahren.
Veronika Holzmayer hängte ihre Handtasche wieder um, nur um irgendetwas zu tun. Beide blieben eine Weile sitzen und warteten, ohne zu wissen worauf. Sie lauschten zitternd in die stille Nacht hinaus, doch nun war kein Seufzen verbogener Karosseriebleche mehr zu hören, selbst die Grillen schwiegen.
»Was machen wir jetzt?«, stieß die Holzmayerin heraus, und die Angst schnürte ihr die Kehle zu.
»Wir warten eine halbe Stunde, dann hauen wir ab«, erwiderte der Mühlriedl Rudi, ohne rechte Überzeugung.
»Was meinst du, wer die waren?«
»Russen vielleicht.«
»Ich glaube, wir müssen zur Polizei gehen«, sagte die Holzmayer Veronika irgendwann um vier Uhr in der Frühe. »Vielleicht jeder einzeln.«
Dann schwiegen sie wieder. Es breitete sich eine Ruhe aus, die nur entsteht, wenn gerade etwas Schreckliches passiert ist.
3
Draußen herrschte herrliches Juniwetter, drinnen standen zwischen den sauber beschrifteten Leitz-Ordnern gravierte Zinnbecher, bedruckte Bierseidel und verstaubte Preispokale, die Wände waren bedeckt mit gerahmten Urkunden und Zeitungsausschnitten – und überall las man etwas von zweiten oder dritten Plätzen bei süd- und oberbayrischen Meisterschaften. Von der Decke hingen Wimpel mit Inschriften wie Wolfgang-Mayer-Gedächtnisturnier oder In Erinnerung an František Hovorčovická. Der Raum war mit so vielen Erinnerungsstücken vollgestopft, dass keinem normalen Betrachter noch eine zusätzliche Besonderheit aufgefallen wäre.
Kriminalhauptkommissar Hubertus Jennerwein war kein normaler Betrachter, er ließ sich nicht vom Wirrwarr des zusammengesammelten Edelplunders gängeln, ein paar Sekunden, nachdem er den Raum betreten hatte, blieb sein trainierter Blick sofort an einem flachen Tischchen hängen, auf dem ein Schachbrett stand. An den kleinen hölzernen Kämpfern war sicherlich lange und sorgfältig geschnitzt worden (die Könige blickten phlegmatisch uninteressiert, die Damen melancholisch arrogant), doch das eigentlich Auffällige war die geringe Anzahl der Figuren auf dem Feld. Es war wohl eine zu Ende gespielte Partie, die Mehrzahl der kleinen Kämpfer stand außerhalb – die geopferten Bauern und ausgetricksten Offiziere warteten draußen am Spielfeldrand, niedergeschlagen wie enttäuschte Bezirksligaspielerbräute. Jennerwein fand das insofern merkwürdig, als dekorativ aufgebaute Schachspiele meist in der Grundstellung zu sehen sind, manche Chess-Protzer bauten auch berühmte Weltmeisterschaftspartien auf, so etwas wie Lasker-Capablanca, St. Petersburg, 1918, kurz vor dem entscheidenden 32. Zug. Ein Schachspiel in Endstellung stehenzulassen jedoch war ungewöhnlich, und das fiel Jennerwein sofort auf. Nicht dass er besonders gut Schach gespielt hätte, er beherrschte nicht viel mehr als die Regeln, aber er hatte nun einmal die Begabung, an den unübersichtlichsten Tatorten sofort das Auffällige, das Merkwürdige, das aus dem Rahmen Fallende herauszufiltern, selbst wenn es ein ihm vollkommen fremder Ort war. Und die meisten der Räume, die er betrat, betrat er das erste Mal, das unterschied einen Kriminaler Raub/Mord/Erpressung deutlich von einem Oberstudienrat Deutsch/Geschichte/Sozialkunde. War die merkwürdige Konstellation dort auf dem Brett vielleicht ein Schachrätsel aus der Samstagsbeilage, so etwas wie Matt in drei Zügen? Dafür jedoch war die Situation zu eindeutig, die Weißen waren drückend überlegen, für ein Rätsel war die Endstellung viel zu leicht. Es war nicht einmal Matt in einem Zug, es war Matt ohne irgendetwas. Warum aber hatte der Spieler der geschlagenen Schwarzen den König dann nicht, wie es üblich war, aufs Brett gelegt?
Vier weitere Mitglieder der Mordkommission IV betraten den Raum. Jennerwein beobachtete unauffällig, ob noch jemandem das sonderbare Schachspiel auffiel. Als Erste erschien die Polizeipsychologin Dr. Maria Schmalfuß. Sie kam gerade frisch von einer zweiwöchigen Profiler-Fortbildung, ihr Kopf war vollgestopft mit Täterprofilanalysen und Tatablaufszenarien. Sie blieb mitten im Raum stehen und ließ ihren Blick über die Urkunden und Preisbecher schweifen.
»Pathologische Sammelleidenschaft«, flüsterte sie halblaut in Richtung Jennerwein. »Zeigt den infantilen Wunsch nach einer überschaubaren, einfachen Welt.«
»Oder zeigt, dass der Sammler nicht weiß wohin mit seiner freien Zeit«, maulte Hauptkommissar Ludwig Stengele. Der Allgäuer aus Mindelheim machte einen Schritt auf Maria zu, stolperte aber gleich über einen vorstehenden Teppichrand. Droben am Berg, in luftigen Höhen, in den heimatlichen Felswänden, bewegte er sich wie eine junge Gemse, in geschlossenen Räumen wirkte er hölzern und staksig. Stengele schnüffelte und verzog das Gesicht, der Geruch in dem ungelüfteten Raum gefiel ihm augenscheinlich nicht. Oder er konnte ihn nicht recht einordnen.
»Uagnäm«, sagte er, und es klang wie das Quaken eines Frosches.
»Wie meinen Sie?«, fragte Nicole Schwattke, die hinter ihm hereingekommen war.
»Unangenehm«, übersetzte Stengele frei aus dem Allgäuerischen. Die Recklinghäuser Austauschkommissarin war die jüngste Mitarbeiterin im Team. Sie sah sich beim Eintreten gar nicht erst im Raum um, ihr Blick tunnelte quer durch das muffige Gewusel und zielte sofort auf den wuchtigen Mahagonischreibtisch, der an der anderen Seite des Büros vor dem Fenster stand. Schweigend betrachtete sie das Holzgebirge und nickte nur stumm, so wie es die wortkargen Westfalen seit Jahrhunderten tun, wenn sie etwas Unbekanntes sehen. Als Letzter kam schließlich Hansjochen Becker, der Kriminaltechniker. Nach drei kurzen, insektenartigen Wischblicken kreuz und quer durch den Raum galt seine Aufmerksamkeit sofort dem weichen Teppich, den er aufmerksam betrachtete. Jennerwein schmunzelte. Offensichtlich war keinem der vier Ermittler das Nussholzgemetzel auf dem kleinen Schachtischchen aufgefallen. Es war auch nicht so wichtig. Es hatte vermutlich gar nichts zu bedeuten. Das Kernteam der Mordkommission IV war komplett, ein bisschen verlegen stand es jetzt da, das kleine Rudel der vier weisungsgebundenen Betatiere, augenscheinlich auf das muntere Gebell des Leitwolfs wartend.
»Nun denn«, sagte Jennerwein und drehte den Kopf in Richtung Schreibtisch.
Der beeindruckende Mahagoniklotz war bis auf ein aufgeklapptes Notebook und einen blutroten Schnellhefter mit der Aufschrift Streng vertraulich! leer. Der Mann hinter dem Schreibtisch war stattlich, sein Äußeres sah gepflegt aus. Ein Telefon war unter dem wuchtigen Kinn eingeklemmt, seine Arme hingen neben den Lehnen des Stuhls herunter, seine blauen Augen waren weit geöffnet, so als wäre er erstaunt über das, was er da gerade gehört hatte. Sein grabsteingraues Haar saß glatt, wie gemeißelt, er trug einen sauber gestutzten Kinnbart, eine ultrakonservative Brille – zu einem Kneifer und einem Vatermörder fehlte nicht viel. Der tadellos sitzende Anzug war keinen Zentimeter verrutscht, die Schuhe, die man deshalb gut sah, weil der Mann auf dem Klappdrehschwenkstuhl mehr lag als saß, waren blitzblank. Jennerwein trat noch einen Schritt näher. Der Teint des Hünen war sonnengebräunt, man roch Rasierwasser, und Jennerwein wusste jetzt, warum Stengele gleich beim Eintreten geschnüffelt hatte. »Hm«, machte Maria und hob ihre ägyptisch dünnspitze Nase etwas hoch. »Äußerst interessant.«
Plötzlich ließ der gepflegte Mann das Telefon vom Kinn gleiten und fing es mit der Hand geschickt auf. Der Liegelümmelstuhl drehte sich quietschend, so dass der Mann seinen fünf Besuchern frontal gegenüber saß.
»Entschuldigen Sie«, sagte er und legte das Telefon auf den Tisch. »Ein wichtiges Gespräch.«
Alle nickten verständnisvoll. Jennerwein ging auf den Mann zu und schüttelte ihm über das Mahagoni hinweg die Hand.
»Aber setzen Sie sich doch bitte, meine Herrschaften«, sagte Dr. Rosenberger. »Kaffee? Tee? Wein? Bier?«
»Ein Kaviarbrötchen«, scherzte Maria. Der gepflegte Mann war Polizeioberrat Dr. Rosenberger, der Vorgesetzte von Kommissar Jennerwein. Er lachte höflich und verschränkte seine Hände auf der Platte des Edelholzschreibtischs. Alle starrten auf die Intarsien, mit denen der Tisch an der Vorderseite verziert war. Eine exzentrische Weise, sich Distanz zu verschaffen, dachte Jennerwein. Infantile Fixierung auf Reviermarkierung, Angst vor Machtverlust, dachte Maria. Ein wunderbares Holz, um viele, viele verwertbare Spuren zu hinterlassen, dachte Becker. G’spinnerter Hirni, dachte Stengele, der hockt wahrscheinlich den ganzen Tag hinter diesem toten Holzklotz und weiß dabei gar nicht mehr, wie man Handschellen anlegt. Nicole Schwattke machte sich als Einzige keine Gedanken über den Tisch. Sie starrte in eine andere Ecke des Raums.
»Das sieht aber gar nicht gut aus für Schwarz«, sagte sie.
4
Seine Hand krallte sich an einem scharfkantigen Stein fest. Er spürte, wie ihm das Blut über den Unterarm lief, doch er beachtete es nicht weiter. Die pulsierenden Kopfschmerzen ließen nicht nach. Sein trockener Mund brannte wie Feuer, der Durst nahm ihm fast die Besinnung. Trotzdem hatte er eine winzig kleine Chance, wenn er alle seine Kräfte zusammennahm. Mit großer Willensanstrengung richtete er sich auf. Es gab kaum eine Stelle an seinem Körper, die nicht schmerzte. Er schüttelte sich und atmete tief durch, dann begann er mit der waghalsigen Operation. Jeder Griff musste sitzen. Als Erstes säuberte er die Hand mit dem Taschentuch, dann griff er vorsichtig in die Mundhöhle, umfasste mit zwei Fingern seinen vorletzten linken Backenzahn und zog die Schutzkappe herunter. Ein Zahnarzt aus Sewastopol, dem man die Approbation entzogen hatte, war der Schöpfer dieser Konstruktion, und der Krimtatare hatte geschworen, dass sie funktionierte. Vorsichtig legte er jetzt die Schutzkappe auf das Taschentuch. Es sollte ihm nicht so ergehen wie Pavel, seinem ehemaligen Kameraden. Der hatte versehentlich auf eine Notfallkapsel gebissen. Das war lange her. Warum musste ihm diese verdammte Geschichte gerade jetzt einfallen! Sie waren nach einem Einsatz noch zum Essen gegangen, ins Knedlík & Knedlíky, dem einzig wahren Knödelparadies in der Knödelhochburg Prag, und Pavel hatte Hasenrücken zu den český knedlíky bestellt, von einem garantiert frisch geschossenen Hasen. Man hätte es sich eigentlich denken können, dass man da schon mal auf Schrot beißen konnte. Und so kam es dann auch. Mitten während des Essens war Pavel plötzlich und ohne einen Laut von sich zu geben zusammengesunken und mit dem Kopf auf dem Tisch aufgeschlagen. Erst dachten alle an einen Schwächeanfall, einen Herzinfarkt, vielleicht auch an einen Scherz, doch dann rochen sie es, zwischen den feinen Düften von Böhmischen Knödeln und Szegediner Gulasch: Kaliumcyanid, mit dem sprichwörtlichen Bittermandelgeruch, der Visitenkarte von Gevatter Tod. Dieser Idiot hatte eine Schrotkugel zwischen die Zähne bekommen und auf seine Notfallkapsel gebissen.
»Ist alles in Ordnung? Schmeckts? Kaffee zum Nachtisch? Palatschinken?«
Plötzlich war die Bedienung am Tisch gestanden, und man hatte dem armen dummen Pavel noch posthum einen Vollrausch andichten und ihn aus dem Knedlík & Knedlíky hinaustragen müssen, um aus der Sache heil herauszukommen. Verdammte Geschichte!
Die Schmerzen konnte er noch einigermaßen ertragen, aber der Durst brannte ihm ein Loch in den Leib. Er biss auf seinen Fingerknöchel und saugte gierig daran. Dann atmete er nochmals tief durch und konzentrierte sich. Er wusste nicht, wie viel Zeit ihm noch blieb, er musste schnell und sorgfältig arbeiten. Seine körperliche Verfassung war katastrophal, aber er musste es versuchen. Wenn er jetzt aufgab, würde er sich nicht mehr aufraffen können, das wusste er. Er hatte sich diese Spezialkonstruktion vor einem halben Jahr einbauen lassen. Das ausgeklügelte System hatte den Vorteil, dass es unmöglich war, die Kapsel durch einen zufälligen Biss zu zerstören, man musste mit der Zunge erst einige Turnübungen machen, um den Mechanismus auszulösen. Man musste mit der Zungenspitze an der Innenseite des vorletzten Backenzahns einen Riegel nach oben schieben. Durch Zubeißen und energisches Vorschieben des Unterkiefers wurde der Riegel zurückgeschwenkt. Im Prinzip war es eine winzige Türklinke, die man um hundertachtzig Grad drehen konnte. An der ›Türklinke‹ war ein Dorn angebracht, der bei einem Winkel von hundert Grad auf der Zyanidkapsel auflag und bei einem Überschreiten die Glasampulle mit dem Gift zerbrach. Eine Krone schützte den ganzen Mechanismus im Alltag. Der Tod trat innerhalb von allerhöchstens zwanzig Sekunden ein – und solch einen Abgang konnten auch die gewieftesten Verhörspezialisten nicht mehr verhindern.
Der Schweiß brach ihm aus. Die Schmerzwellen in seinem Kopf pulsierten weiter, sie schaukelten sich bis zur Unerträglichkeit hoch. Und dann immer wieder der Durst. Der höllische, brennende Durst. Aber er durfte sich jetzt nicht hängen lassen. Er musste bereit sein. In der Situation, in der er sich jetzt befand, war alles möglich. Er konzentrierte sich. Nachdem er die goldene Schutzummantelung mit dem schwachen Schein eines Streichholzes angeleuchtet und auf Intaktheit überprüft hatte, baute er sie wieder ein. Er wusste, dass er ein Verhör ab einer gewissen Stufe nicht mehr durchstehen würde. Nicht bei diesen Leuten. Deswegen hatte er sich solch eine Versicherung für den Fall der Fälle überhaupt erst besorgt. Die Konstruktion des Winkel-Dentisten aus Sewastopol hatte noch einen weiteren Vorteil: Sie war optisch nicht zu erkennen, sie war auch nicht zu ertasten. Viele Befragungsexperten griffen einem vor dem Verhör in den Mund und untersuchten die Zähne, da sie von solchen Tricks wussten. Genau aus diesem Grund war die Krone aus Gold gefertigt und somit röntgendicht. In seinem Fall hätte man schon eine Tomographie machen müssen, um den Mechanismus zu entdecken. Aber welcher schmutzige Folterkeller am Ende der Welt war schon mit einem verdammten Kernspintomographen ausgestattet!
War er vielleicht schon wieder in einem solchen Verhörraum? Kam gleich ein Weißkittel herein und nippte genüsslich an einem Glas Champagner? Dagegen sprach, dass sie ihm lediglich seine Schusswaffe abgenommen hatten, eine Brünner M 75, sonst fehlte nichts. Sie hatten ihm seine Streichhölzer gelassen, seine Ausweise und Papiere, ein paar Schreibstifte, eine Mehrzweck-Drahtschlinge, ein Bündel Banknoten, sogar sein Schweizer Armeemesser, schließlich das Notizbuch, das er sich erst letzte Woche gekauft hatte. Jetzt benützte er es für seine Aufzeichnungen. Er schrieb im Dunkeln, um Streichhölzer zu sparen.
Erster Tag. Eine Art Kellerverlies mit feuchtkalter Atmosphäre. Bin unverletzt, zumindest nicht schwer verletzt, kann mich bewegen. Unerträglicher Durst. Die Wände: grobe, unregelmäßig große Bruchsteine. Habe dafür ein Streichholz verbraucht.
Vielleicht war es auch eine nackte, unbehauene Felswand, an die in den Alpen oft überteuerte Appartements im Landhausstil gebaut werden. Aus den vermoosten, scharfen Kanten sickerte fauliges, übelriechendes Wasser. Es war zum Trinken sicherlich nicht geeignet. Er hatte trotzdem gierig an der nassen Wand geleckt. Das hatte den Durst jedoch nur verschlimmert.
Vielleicht halten sie mich im Keller einer Luxusalpenvilla gefangen. Der Raum muss riesige Ausmaße haben. Ein Probeschrei: hundertfaches Echo von allen Seiten.
Wie sie ihn hierhergebracht hatten, daran erinnerte er sich nicht. Er war plötzlich hier aufgewacht. Benommen und mit quälenden Kopfschmerzen, aber fähig, sich zu bewegen. Sie hatten wohl keine Chance mehr gesehen, dass er ihnen das verriet, was sie wissen wollten. Sie hatten die Folter aufgegeben und ihn hier zwischen-, vielleicht sogar endgelagert. Würden sie die Verhöre irgendwann wiederaufnehmen? Warum hatten sie ihn nicht getötet? Er war in den ganzen vergangenen Tagen gefoltert worden, aber weniger auf die körperlich schmerzhafte, sondern auf die wesentlich subtilere und fiesere Psycho-Art.
In einer Art Zahnarztpraxis. Gefesselt, aber nicht geknebelt auf dem Zahnarztstuhl festgeschnallt. Musikberieselung, vielleicht, um Geräusche von außen zu übertönen. Ein Weißkittel kam herein, er antwortete nicht auf Fragen, bereitete schweigend ein Tablett mit Zahnarztwerkzeugen vor. Zog eine kleine Bohrmaschine aus der Halterung, schaltete sie an. Mit einem Fußschalter ließ er sie ein paar Mal aufjaulen, dann legte er einen großen Briefbeschwerer auf das Pedal, warf das laufende Gerät auf den Tisch und verließ den Raum.
Die rotierende Nadel war kaum einen Meter von ihm entfernt, und das Geräusch wurde schon nach einer Minute unerträglich. Der Weißkittel hatte keine Anstalten gemacht, seine Mundhöhle auf eine günstige Bohrstelle hin zu untersuchen. Er hatte lediglich die Instrumente vorbereitet. Die Tür stand offen, der Bohrer drehte sich gleichmäßig. Die erste halbe Stunde war nicht die schlimmste. Schlimmer waren die halben Stunden, die noch folgten und in denen nichts geschah. Außer dass ein Zahnarztbohrer seine übelklingende Soloarie sang. Iiiiiiiih! Endlich, vielleicht am Abend (der Raum hatte keine Fenster und eine stehengebliebene Uhr zeigte wie zum Hohn Viertel nach vier) kam der Weißkittel zurück und schaltete den Bohrer ab –
WELCH EINE WOHLTAT!!!!!!!!!!!!!!!!
– und stellte wie beiläufig einige Fragen, einige ganz spezielle Fragen, die er nur mit Mühe nicht beantwortete. Am nächsten Tag kam der Weißkittel wieder, jetzt etwas gesprächiger. Er selbst hatte einen guten Blick auf einen wohl ganz bewusst angebrachten Spiegel. Er sah darin, dass man ihn kahl rasiert hatte.
Der Weißkittel sprach hochdeutsch mit leichtem, undefinierbarem Akzent. Vielleicht slawisch, vielleicht auch bewusst mit slawischem Duktus, um eine falsche Fährte zu setzen.
»Ich werde Ihnen die obere Hälfte der Kopfhaut abziehen«, sagte der Weißkittel, »die Schädeldecke in der Höhe der Ohrenspitzen rundherum vorsichtig aufmeißeln und abheben, so dass das Gehirn zu einem Drittel freiliegt. Keine Angst, Sie bekommen eine Lokalanästhesie, wenn ich Ihnen den Schädel öffne. Sie wissen sicherlich, dass das Gehirn selbst nicht schmerzempfindlich ist. Wenn ich also einen bestimmten Bereich bearbeite, werden Sie das sehen, jedoch nicht spüren.«
Der Weißkittel tupfte ihm mit einem abgenagten Bleistiftstummel auf den Schädel.
»Hier zum Beispiel, unter der Schädeldecke, befindet sich das motorische Brodmann-Areal, das für Ihre Füße zuständig ist. Sie werden die einmalige Gelegenheit bekommen, zusehen zu können, wie ich durch Stimulierung des Homunkulus in Ihrem Gehirn Ihren großen Zeh zum Wackeln bringe. Morgen nehmen wir uns dann das sensorische Areal vor und tauchen in die wunderbare Welt der Schmerzen ein.«
Der Weißkittel sah aus, als würde er diesmal den Bohrer nicht einfach liegen lassen, um ihn am Abend wieder auszuschalten.
Ich erinnere mich bloß noch daran, dass mir der Weißkittel eine Spritze gesetzt hat. Dann habe ich das Bewusstsein verloren. Ob die Operation durchgeführt worden ist, weiß ich nicht.
Er ließ den Stift sinken. Er hatte gleich zu Beginn seiner Gefangenschaft in der Höhle seinen Körper von unten bis oben abgetastet, um ihn auf Verletzungen zu überprüfen. Er hatte es aber bisher noch nicht gewagt, die obere Hälfte seines Kopfes zu untersuchen.
5
Dr. Rosenbergers Büro, die überladene Mischung aus Dienstzimmer und Vereinsheim, lag im sechsten Stock, mitten in der Stadt, bei Föhn konnte man jedoch durchs Fenster das wuchtige Alpenpanorama des Karwendelgebirges sehen. Und es war oft Föhn. Sie alle lebten im Föhnland.
Dr. Rosenberger war der direkte Vorgesetzte von Kriminalhauptkommissar Jennerwein, und in dieser Eigenschaft hatte er das vollständige Team zu einem vertraulichen Treffen zusammengerufen.
»Es freut mich, dass Sie den Weg zu mir in die Stadt gefunden haben«, begann Dr. Rosenberger und zeichnete bei dem Wort Stadt zwei dicke Gänsefüßchen in die Luft.
»Sie kennen den Paragraphen 353 b des Strafgesetzbuches: Verletzung von Dienstgeheimnissen. Verstöße gegen die besondere Geheimhaltungspflicht bei besonderen Fällen.«
Alle nickten.
»Jeder von Ihnen kann die Teilnahme an der Operation, um die es geht, selbstverständlich ablehnen. Doch auch in diesem Fall gilt der genannte Paragraph. Sie alle verpflichten sich, mit niemandem drüber zu reden, auch nicht – vor allem nicht – mit den Ehegatten. Ist das so weit klar?«
Wieder nickten alle. Die Teilung von Dienstgeheimnissen mit den Ehegatten stellte bei den wenigsten ein Problem dar. Hansjochen Becker war verheiratet, seine Frau unterrichtete am Gymnasium (war also auch eine Art Spurensucherin – nach Anzeichen von Intelligenz), aber beide redeten grundsätzlich nie über Dienstliches, das stand bei den Beckers sozusagen im Ehevertrag. Nicole Schwattke war ebenfalls verheiratet, sie hingegen besprach eigentlich alles mit ihrem Hunderte von Kilometern entfernten Mann, der ebenfalls Polizist war, die beiden telefonierten jeden Tag eine Stunde zwischen Oberbayern und dem Recklinghäuser Land hin und her. Aber es war nicht der erste Dreihundertdreiundfünfziger-Fall in ihrer Ehe, sie wussten damit umzugehen. Hubertus Jennerwein konnte man getrost als einen Mann in festen Händen bezeichnen – er war mit den Tätern, Zeugen und Teammitgliedern verheiratet, er hatte sich auf eine dauerhafte und glückliche Bindung mit Indizienketten, Schlussfolgerungen und Verfolgungsjagden eingelassen. Aber dafür war ja wohl der fragliche Paragraph nicht vorgesehen. Der Familienstand von Ludwig Stengele schließlich verlor sich ganz und gar im Nebel des Allgäuer Voralpenlandes. Stengele hatte sich in dieser Hinsicht immer bedeckt gehalten, aus keiner Äußerung konnte man auf seine diesbezügliche Daseinsweise schließen. Wohin er nach Dienstschluss verschwand, wusste man nicht. Da Dr. Rosenberger ebenfalls verheiratet war, schien Maria Schmalfuß die einzig richtiggehend Ledige im Raum zu sein. Alle nickten bezüglich des Paragraphen Dreifünfdreibe. Und das Nicken eines bayrischen Beamten wiegt schwer.
»Ich kann mich also auf Sie verlassen«, sagte Dr. Rosenberger zufrieden und verschränkte die Hände vor der Brust. »Und nun zum Fall selbst. Es gibt eine Vermissung mit Mordverdacht, die darüber hinaus staatliche Interessen berührt. Normalerweise ist das BKA dafür zuständig. Aber man hat sich an höherer Stelle dazu entschlossen, die Ermittlungen Ihrem Team zu übertragen, nicht zuletzt wegen Ihrer ausgezeichneten Ortskenntnisse im Raum Werdenfels –«
Er machte eine bedeutungsvolle Pause.
»– und auch wegen Ihrer sonstigen fachlichen Qualifikationen und Leistungen«, fuhr er fort und setzte dazu ein mikroskopisch feines Lächeln auf. Das war so etwas wie eine Belobigung. Alle nickten ein mikroskopisch kleines Danke. Doch sie hatten zu früh genickt, denn Dr. Rosenberger stand jetzt auf. Regel aus der Arbeitswelt: Wenn ein Chef nach einem Lob aufsteht, ist immer etwas faul.
»Ganz nebenbei gesagt«, fuhr er fort, »haben Sie alle bei den letzten Fällen ein paar Dienstvorschriften verletzt. Jeder von Ihnen. Sie haben jetzt Gelegenheit, diese Scharten auszuwetzen.«
»Ich nehme die rote Pille«, sagte Jennerwein. Alle lächelten, nur Stengele, der Naturbursch und Bergfex, schüttelte verständnislos den Kopf.
»Die rote Pille?«
»Aus dem Film Matrix. Das Einverständnis, die andere, unbekannte Welt kennenzulernen. Nicht gesehen?«
»Nein, nicht gesehen, aber ich mache mit.«
»Ich spreche hier von ernsten Dingen«, sagte Dr. Rosenberger leise. Maria hatte das Gefühl, dass er es fast traurig sagte. Der Oberrat war als nüchterner Kriminologe bekannt, der brillante Vorlesungen an der Polizeischule hielt. Er war weniger der Praktiker des Polizeialltags, mehr der Analytiker und Kriminalhistoriker, der schon einige diesbezügliche Bücher veröffentlicht hatte. Warum berührte ihn dieser Fall so? Warum zeigte er Nerven? Dr. Rosenberger setzte sich wieder.
»Es gibt im Werdenfelser Land in letzter Zeit verstärkte Hinweise auf organisiertes Verbrechen. Ich erzähle Ihnen vermutlich nichts Neues: Der Talkessel eignet sich ideal dafür, etwas zu verstecken, zu vertuschen, zu schmuggeln, etwas verschwinden oder unter den Tisch fallen zu lassen. Die Flucht- und Rückzugsmöglichkeiten sind ideal, das Gelände ist unübersichtlich und mit den üblichen polizeilichen Mitteln nicht vollständig zu kontrollieren. Die Bevölkerung ist manchmal stur und durchaus auch einmal geneigt, der Gegenseite zu helfen. Dazu kommt noch die nahe Grenze zu den unberechenbaren Österreichern.«
Dr. Rosenberger stand auf und setzte sich aufs Fensterbrett. Merke: Wenn sich ein Chef aufs Fensterbrett setzt, kommt ein längerer historischer Vortrag.
»Es gibt einen alten Handelsweg zwischen Mittel- und Südeuropa, der durch das Werdenfelser Tal führt. Bereits die alten Römer benutzten ihn, später die Fugger, dann Schmugglerbanden und andere zwielichtige Organisationen. Schon Cicero berichtet über Schlupfwinkel im Loisachtal, andere Geschichtsschreiber äußern sich ähnlich darüber. Graf Perchtold von Eschenloh zum Beispiel errichtete im Jahr 1293 in der Burg Werdenfels ein eigenes Lager für beschlagnahmte Diebesware –«
In den Weiten ferner Galaxien verglühten Sonnen, auf der Erde entstanden neue Kulturen und Imperien, ganze Weltreiche blühten auf und gingen wieder unter, Jahrhunderte vergingen, neue Lebensformen entwickelten sich – und Dr. Rosenberger saß immer noch dort auf der Fensterbank und hielt einen Vortrag über die Kriminalgeschichte des Werdenfelser Landes.
» – die Republik Venedig unterhielt bis ins Jahr 1679 einen eigenen Markt in Mittenwald, auf dem auch Soldaten angeworben wurden –«
Und da entkam Maria Schmalfuß doch ein klitzekleiner Räusperer, ein winziges Zeichen der Ungeduld.
»Ja, ich weiß schon«, sagte Dr. Rosenberger und hielt mitten im Satz inne, »meine Ausführungen sind manchmal ein wenig zu detailliert –«
»Aber nein, überhaupt nicht«, sagte Maria, jetzt wieder eine Spur zu interessiert. Es entstand eine peinliche Pause, Jennerwein sprang in die Bresche.
»Ich denke, wir wissen, worauf Sie hinauswollen, Herr Oberrat. Vielleicht greifen die jetzigen Täter wieder auf alte Strickmuster zurück.«
Maria lächelte ihn dankbar an. Jennerwein bemerkte es nicht, aber Dr. Rosenberger hatte es gesehen und lächelte seinerseits.
»Danke für die Zusammenfassung«, sagte er milde. »Kommen wir zur Gegenwart.«
»Ich habe mich ebenfalls mit dem Thema beschäftigt«. fuhr Jennerwein fort. »Heutzutage werden Auftragskiller in unscheinbaren Hotels und Pensionen geparkt, um sie bei Bedarf schnell am Einsatzort zu haben.«
»Hartnäckig hält sich auch ein Gerücht«, sagte Stengele, »dass es mitten im Kurort eine Arztpraxis gäbe, in der man jederzeit Schusswunden und andere ungeklärte Verletzungen behandeln lassen könne.«
»Sie wissen davon?«, fragte Dr. Rosenberger überrascht.
»Es ist ein Gerücht, mehr nicht.«
Wieder entstand eine Pause. Dr. Rosenberger schlug den Schnellhefter auf und notierte etwas. Alle versuchten einen Blick auf das Deckblatt zu erhaschen. Unter dem Schriftzug Streng vertraulich! war, etwas kleiner, die italienische Entsprechung segretissimo! zu lesen. Nicole Schwattke, die Jüngste im Team, folglich die mit den besten Augen, konnte darunter noch Direzione Investigativa Antimafia entziffern.
»Und diese Arztpraxis sollen wir finden?«, fragte sie.
»Nein«, sagte Dr. Rosenberger, »darum kümmert sich bereits das BKA. Ein Team ist deshalb schon seit einiger Zeit im Kurort tätig. Das Sondereinsatzkommando ermittelt verdeckt. Sie arbeiten eng mit den italienischen Kollegen von der Antimafia-Einheit DIA zusammen. Das BKA agiert schon einige Monate sehr erfolgreich im Kurort. Doch mitten in den brisanten Ermittlungen ist urplötzlich ein Beamter aus dem Team verschwunden. Er heißt Adrian Dombrowski –«
Nicole machte eine Bewegung zu ihrer Brusttasche hin, in der ein Kugelschreiber steckte. Dr. Rosenberger warf ihr einen strengen Blick zu.
»Bitte nichts Schriftliches. Notieren Sie sich vor allem keine Namen«, sagte er. »Prägen Sie sich den Namen ein. A-dri-an Dom-brow-ski. Seinen Steckbrief finden Sie hier im Ordner. Wir müssen befürchten, dass er nicht mehr lebt. Er ist wie vom Erdboden verschwunden. Alle Suchaktionen sind ohne Ergebnis geblieben. Nachdem wir alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen haben, bleibt nur die übrig, dass er getötet wurde.«
»Gibt es nicht die Möglichkeit, dass er doch noch am Leben ist?«, fragte Nicole. »Vielleicht wurde er verschleppt!«
»Wenn das so wäre, hätte er einen Weg gefunden, sich bei uns bemerkbar zu machen. Er ist, wie alle Beamten in Team, ein Profi, der mit den Risiken bei verdeckten Ermittlungen vertraut ist.«
»Kann er sich nicht außerhalb des Kurorts befinden?«
»Dann hätte er Spuren hinterlassen, die aus dem Ort herausführen.«
»Wir sollen also diesen Adrian Dombrowski finden?«, fragte Jennerwein.
»Mehr als das. Ein weiterer BKA-Beamter, Fred Weißenborn, ist kurz darauf ebenfalls verschwunden.«
Fred Weißenborn. Maria Schmalfuß bemerkte eine emotionale Erschütterung, als Dr. Rosenberger diesen Namen aussprach.
»Ich kenne diesen Mann gut«, fuhr er fort. Er blickte plötzlich sehr ernst. »Das ist keiner, der spurlos verschwindet. Außerdem lege ich meine Hand für ihn ins Feuer. Er ist ein enger Freund von mir, ein Sandkastenspezi, wenn Sie so wollen. Ich hoffe inständig, dass er noch lebt. Sie müssen ihn finden und retten. Und wenn Sie sein Leben nicht retten können, dann finden Sie die Spur, die zu seinem Mörder führt.«
6
Auf der Kramerspitze in knapp zweitausend Meter Höhe. Aus der Ferne Kirchenglocken. Der Wilderer in Werdenfelser Tracht hält sich mit der einen Hand am Gipfelkreuz fest, mit der anderen fuchtelt er mit einem uralten Schießprügel herum.
Wilderer (singt) Auf den Bergen wohnt die Freiheit!
Ein Hubschrauber nähert sich.
Lautsprecherstimme Geben Sie auf, Sie haben keine Chance!
Wilderer (lädt nach) I gib net auf, nia und nimmer!
Zwei vermummte Männer seilen sich ab, greifen sich den Wilderer und ziehen ihn hoch. Im Inneren des Hubschraubers reißt er den falschen Schnauzbart herunter.
Wilderer en Düwel ook, dat war knapp!
7
Fès (wobei فاس halt nun mal wesentlich besser aussieht), uralter Treffpunkt der Seidenhändlerkarawanen um das fruchtbare Land von Habran-al-m’ chein, erbaut im alten Tal der Hoffnung, Königsstadt und Keimzelle der buntscheckigen Lügengeschichten. Schief gepflasterte, vom groben Wüstenstaub polierte Tuffsteine, Klänge von abessinischen Qarqabas, Wüstenschalmeien und quietschenden zweilöchrigen Flöten, die die Gesänge der Nachtigallen und das Geschrei der Affen nachzuahmen versuchen. Die Sonne brüllt. Die Hitze dampft dir den Rest von klarer Denke aus dem Hirn. Doch die Gerüche, die betörenden Anmutungen an die Nase sind das Umwerfendste an Fès. Dort einen klaren Kopf behalten? Unmöglich. Die Düfte der vielen kühnen Ras-el-Hanout-Variationen, die einem auf Schritt und Tritt entgegenwehen, werden schon in den Märchen aus Tausendundeiner Nacht beschrieben. Dann der marokkanische Geräuschpegel: schallendes Gehämmere der barfüßigen Kesselflicker, vermischt mit dem hellen Klopfen der Steinmetze, die ihre Marmortafeln bearbeiten, so wie unsereins eine E-Mail ins Notebook tippt. Muezzine, Feuerspucker, Kamelflüsterer, Zuckerbäcker – alles Kulisse? Natürlich ist alles Kulisse, kein Wort ist echt, kein Blick ist das, was er scheint, aber hier, auf dem Markt von Fès el-Bali ist die Inszenierung schon in Ordnung. Ein Kurort bleibt eben ein Kurort. Manche sagen, Fès el-Bali sei das Garmisch-Partenkirchen Nordafrikas. Sie haben recht, aus vielen Gründen. Und dann natürlich die Gesprächsfetzen, die man aufschnappt. Wenn man Glück hat, hört man auch ein junges, hellauflachendes »رآيشم ال ديآب« durch den heiseren Nebel der Händler und Schlangenbeschwörer hindurch.
Das رآيشم ال ديآب kam von einem strohblonden Jungen, der einen Stadtplan von Fès auffaltete.
»رآيشم ال ديآب«, erwiderte das Mädchen und biss in ein Stück Mandelkuchen.
Der Junge hieß Dirk, das Mädchen hieß Tina, sie kamen beide aus einer westdeutschen Kleinstadt, sie machten mit drei anderen ehemaligen Schulkameraden Urlaub hier in Fès. Das Abitur lag knapp hinter ihnen. Dirk hatte in Mathe gerade mal fünf Punkte geschafft, trotzdem war er, wie die anderen, guter Dinge. Er hatte sogar den passenden Spruch dazu erfunden.
»Knapp drin ist auch getroffen.«
Dirk, die Mathe-Niete faltete die unbrauchbare Straßenkarte wieder zusammen und ließ den Blick über das Gewusel auf dem Marktplatz schweifen. »Richtig derb hier«, sagte er und nickte voller Anerkennung.
»Derbst«, bestätigte Tina. »Da schau mal, die Hoddles da drüben, . Jeder mit einem Teppich unterm Arm.«
Eine Busladung unverkennbarer Engländer hatten sämtliche 40-mal-80-Zentimeter-Badteppiche in Fès und Umgebung aufgekauft.
»Und wie gebamboozled die schauen!«, griente Fuzzy und hieb sich parodistisch auf den Oberschenkel. »Die glauben alle, sie hätten das Geschäft ihres Lebens gemacht.«
Fuzzy, Tina, Dirk, Flo und Oliver schlenderten fröhlich feixend über den kleinen Platz der Schreiber, Geschichtenerzähler und Profilügner. Sie hatten alle noch keine klaren Zukunftsvorstellungen. Fuzzy wollte vielleicht Mediziner werden, Zahnmediziner, Tiermediziner, plastischer Chirurg, keine Ahnung, ein Studienplatz war noch nicht in Sicht. Vielleicht was im Ausland, vielleicht Genua oder Berkeley, mal sehen.
»Sicher gibt es hier in Fès auch eine Uni«, sagte Dirk.
»wwwPunktMüdesLachenPunktde«, entgegnete Fuzzy. »Eine permanente Hitzefrei-Uni mit Kursen in Wegschmelzen und Auflösen.«
Er griff in die Hosentasche, um sein Mobiltelefon herauszufingern. Doch da steckte keines. Da steckte nur eine Tüte, aus der feuchte, klebrige Datteln herausgefallen waren. »Heatmäßig heißer Scheiß«, murmelte Fuzzy.
»Sind gar keine Engländer, sind wahrscheinlich Schweizer, die Hoddles«, sagte Flo.
Flo wusste nicht einmal im Ansatz, was er die nächsten sechzig Jahre machen wollte. Irgendetwas Künstlerisches oder was Soziales. Vielleicht auch Maschinenbau.
»رآيشم ال ديآب«, rief Tina den anderen fröhlich zu. Sie wiederholte es nochmals, sie war auf ihre Aussprache sehr stolz, denn es klang so arabisch, dass sich ein einheimischer Gewürzhändler verdutzt umdrehte. Sie alle hatten im letzten Schuljahr einen Wahlkurs Arabisch belegt, aus einer Laune heraus. Nach ein paar Stunden hatten sie allerdings aufgegeben. Niemand von ihnen war auch nur in die Grundzüge des kehligen Pressens und gutturalen Knackens dieser wüstensandumwehten Sprache eingedrungen, keiner konnte auch nur ein einziges Fuzzelchen Arabisch, der Kurs war völlig für die Katz gewesen, das hatten sie gleich beim Grenzübertritt festgestellt. So hatten sie sich bemüht, wenigstens dieses eine Wort رآيشم ال ديآب (»Rhabarber«) richtig auszusprechen und damit so zu tun, als ob sie Sätze bildeten. Auf dem Campingplatz hatten sie damit ein Pärchen aus Uelzen zum Narren gehalten und ihnen weisgemacht, sie sprächen Arabisch. »wwwPunktVerarschePunktde«, hatte Fuzzy gesagt, als das Pärchen abgereist war.
»Wenn schon, dann wwwPunktVerarschePunktma«, hatte Oliver eingeworfen.
Oliver Krapf war der Stillste der jungen Urlauber. Er war auch der mit dem besten Notenschnitt (Einskommaeins, zum Nullmannsdorfer hatte es nicht ganz gereicht, weil er in Biochemie Polymethylester und Polyäthylether verwechselt hatte). Oliver Krapf hatte ebenfalls noch kein festes Berufsziel. In Mathe war er allerdings ein Genie. Wo andere rechneten, legte er die Hand aufs Blatt, er fühlte die Drehstreckzerrspiegelungen durch den ganzen Körper. Aber jetzt, mitten auf dem Marktplatz in Fès, wo die mitteleuropäische Denkweise ins Schlingern gerät, vermisste Oliver Krapf sein Notebook. Er vermisste sein iPhone, sein Mobiltelefon, alles, was einen Menschen ausmacht eben. Aber das sollte ja der Witz von diesem Nordafrika-Trip sein. Sie hatten zusammen beschlossen, eine vollkommen analoge Reise zu machen, ohne irgendwelche digitale Hilfsmittel, ohne Besuch eines Internetcafés, ohne Telekommunikation und hunderttausend Songs auf der Festplatte. Der Joke sollte der sein, so zu reisen, wie ihre Eltern in grauer Vorzeit gereist waren. Sogar eine Gitarre hatten sie mitgenommen, und Tina hatte, sozusagen als historisches Zuckerl, mehrmals versucht, Bob-Dylan-Songs zu klampfen und zu singen: ♫ Come gather ’round people wherever you roam, G-Dur/E-moll/C-Dur/G-Dur mit haufenweisen Barréegriffen. Sie hatten alle sehr gelacht über die schauderhafte Weltsicht der Siebziger und Siebzigerinnen.
»Meine Mam und mein Dad sind damals auch hierher gefahren«, sagte Flo. »Es gibt peinliche Fotos: Walleklamotten, Jesuslatschen, Mittelscheitel, Henna.«
Es war gar nicht so leicht, solch eine analoge Reise konsequent und den ganzen Tag lang durchzuziehen. Papierene Stadtpläne, zentnerschwere Lexika, schließlich Restaurants, von denen man die Userbewertungen nicht kannte. Oliver Krapf traf dieser digitale Entzug jedoch am härtesten. Für ihn war die Aktion Lebe die Siebziger ein Cold Turkey, und er bereute es immer mehr, mitgefahren zu sein. Sie gingen jetzt eine enge Gasse entlang. Oliver Krapf hielt sich ein bisschen hinter den anderen, er betrachtete die arabisch geschnörkelten Ornamente an der Hauswand, er versuchte eine Ladeninschrift zu entziffern, und er fragte sich, ob ein Araber das altdeutsche große »G« auch als so ornamental, so abgedreht und fern empfindet. Ein Händler winkte, ein Schlepper schleppte, ein Drücker drückte, und bald standen alle fünf in einem marokkanischen Laden, prall voll mit Teppichen. Es roch nach Pfefferminztee und, natürlich, Ras el-Hanout. Oliver fand diesen Laden total doof, er versuchte jedoch, sich nichts anmerken zu lassen.
»Gefällt es dir nicht?«, fragte Tina.
»Wenn ich einen Teppich haben will, dann kauf ich mir den bei eBay«, raunzte Oliver.
»رآيشم ال ديآب«, sagte Dirk, der Händler hielt das für ein schlecht ausgesprochenes as-lahma, was so viel wie Grüß Gott bedeutet hätte. Der Händler grüßte zurück in echtem Hocharabisch, fragte auf Englisch nach Herkunftsland, sozialem Hintergrund und Verkehrsmittel, um auszuloten, bei welchem Teppichpreis man bei diesen Fremden einsteigen könnte. Sie sahen sich um. Sie konnten einen echten Teppich nicht von einem noch echteren unterscheiden. Oliver Krapf blieb im Laden etwas zurück und sein Blick fiel auf Tina, die zu einem großen, mit einem Halbmond bedruckten Jutesack gegangen war. Sie beugte sich über den Sack und wühlte darin herum. Tina fand er gar nicht so uninteressant, aber den Jutesack fand er doof und den Halbmond drauf fand er gigadoof. Doch Tina winkte ihm, und er ging schließlich hin und half ihr beim Wühlen. Warum er das machte, wusste er selbst nicht. Selbst ein paar Wochen später, als ihm jemand einen kalten Pistolenlauf an die Stirn drückte, konnte er sich noch an diesen Moment der Inkonsequenz erinnern. Hätte er bloß damals diesen Sack nicht durchwühlt, dachte er später, dann wäre er nicht in solche Schwierigkeiten geraten. Hätte, wäre.
Der Jutesack war zur Hälfte gefüllt mit Münzen in verschiedenen Größen, Aufschriften und numismatischen Daseinszuständen. Beide tauchten ihre Hände in das kalte Kleingeld, ihre Finger berührten sich irgendwo in der Mitte des Münzenteichs, beide zuckten zurück und ließen die Hände wieder auftauchen.
»Hier sieh mal«, sagte Tina und hielt etwas Blinkendes hoch. »Eine deutsche Münze. Wie die wohl hierhergekommen sein mag?«
Tina legte ihm den Silberling in den Handteller, einen plumpen Metallklacks, etwas größer als ein Zweieurostück, auch ein wenig dicker, und ein wenig schwerer. Unregelmäßig waren die Ränder, ungleichmäßig schien die Prägung. Vielleicht hatte jemand die Münze aber auch nur auf die Eisenbahnschienen gelegt.
»Wieso deutsch?«, fragte Oliver Krapf.
»Da sieh mal«, sagte Tina. »Der Aufdruck. E…hr…e d…ts…hs V…terl…d.«
Vor allem das Vaterland war ziemlich zerquetscht.
»Tatsächlich«, sagte Oliver Krapf und betrachtete die Münze näher. Tinas Kopf kam an seine Schulter. Sie roch nach Mandelkuchen.
»Und da«, sagte Tina. »Vielleicht eine Jahreszahl.«
Krapf betrachtete die Stelle, wo Tina mit ihrem kleinen Finger hingedeutet hatte. Eine klitzekleine Gravur war da zu sehen, eher eine Kritzelei. Vielleicht auch bloß eine Schramme. Aber in diesem Augenblick war Oliver Krapf gefangen, auch später, als er die Mauser an der Schläfe spürte, musste er an diesen Moment der unbedingten und kompromisslosen Faszination denken. Er musste diese Münze haben. Diese Münze barg ein Geheimnis. Der Händler näherte sich.
»Nur kein Interesse zeigen«, murmelte Tina. »Beiläufig eine Handvoll nehmen.«
»Ein Handvoll kostet 500 Dirham«, sagte der Händler und stach mit einer verbeulten Kelle in den Münzhaufen. »Ich schütte sie dir in ein Säckchen, ohne dass du was siehst. Alter Brauch. Du machst das Säckchen zu Hause auf, und in alle Länder, von denen du Münzen hast, wirst du mal fahren.«
Der Händler füllte ein Säckchen ab, Oliver Krapf hielt die eine Münze fest umklammert. Sie handelten noch, dann zahlten sie einen womöglich zu hohen Preis für die nutzlosen Dinger in dem Säckchen. Die nächsten Stunden, den Rest des Tages konnte Oliver Krapf an nichts anderes mehr denken. Die Münze und vor allem die Gravur darauf hatten eine Saite in seinem rätselsüchtigen Kryptologenherzen angerissen, die nicht mehr zu klingen aufhörte. Er bewunderte die tollen Bauwerke der Kalifendynastien nur noch mit halbem Auge, ihm schmeckten die pappsüßen Crêpes und die mit Mandelbrei gefüllten Teigrollen nicht mehr. Auf dem Zeltplatz sah er sich die Münze nochmals genauer an. Wie leicht wäre es mit einem Netzzugang gewesen, ein Numismatikerforum zu besuchen! So gab es keinen Hinweis darauf, ob das eine preußische Kupfermark war, ein kurpfälzischer Thaler, ein oberhessischer Groschen, was auch immer. Was ihn aber am meisten interessierte, war die klitzekleine Gravur auf der Vorderseite, eher eine Kritzelei, auf den ersten Blick mochte es ein Gesicht sein. Auf den zweiten Blick hätte es auch eine Inschrift sein können, so etwas wie LUK A – oder eher LUK M. Das Lukas-Evangelium? Aber im tiefsten Nordafrika war natürlich kein Neues Testament aufzutreiben. Und ohne Internet –
»Ich fahre zurück«, sagte Oliver Krapf zu Tina.
»Wenn du musst«, sagte sie.
»Ich muss«, sagte er.
Auf dem sommersprossigen Gesicht Tinas erschien ein merkwürdiger Ausdruck. Oliver Krapf deutete ihn als Enttäuschung.
8
»Die verdeckten Ermittler arbeiten seit einem halben Jahr im Kurort«, sagte Dr. Rosenberger und tippte mit den Fingerspitzen auf den roten Schnellhefter. »Wir haben ihnen wasserdichte Parallelexistenzen verschafft. Sie sollten sich Zugang zu gewissen Kreisen im Ort verschaffen, um zu gegebener Zeit schnell zugreifen zu können. Sie sind unauffällig auf verschiedene, wechselnde Pensionen und Gästehäuser im – oder genauer gesagt: um den Kurort herum verteilt und warten dort auf ihren Einsatz.«
»Sie sind als harmlose Wanderer getarnt?«
»Einige von ihnen, ja. Wenn etwas in diesem Talkessel auf gar keinen Fall auffällt, dann sind es harmlose Wanderer. Zwei haben einen Cateringservice aufgemacht, sie versuchen auf diese Weise, an bestimmte sensible, Mafia-affine Adressen heranzukommen. Sie haben es schon geschafft, ins Rathaus zu liefern, ins Gefängnis, in einige verdächtige Arztpraxen, in die VIP-Lounge des Skistadions, usw.«
»Das BKA steigt ins Cateringservice-Geschäft ein? Ein ausgebildeter Scharfschütze rührt Salatsoßen zusammen?«, fragte Maria verwundert.
Alle lachten, auch das Gesicht des Oberrats heiterte sich auf. Doch er fand sofort wieder zum amtlich gebotenen Ernst zurück.
»Nun ja, so ist es eben. Im Kampf gegen das Verbrechen sind manchmal außergewöhnliche Maßnahmen nötig. Am Anfang der Aktion hatten wir sogar die Idee, ein italienisches Restaurant zu eröffnen, eine Pizzeria, die ausnahmslos mit Beamten des BKA bestückt ist. Wer weiß, vielleicht hätten sich da Mitglieder der Familie eingefunden und nach ein paar Fläschchen Barolo das eine oder andere ausgeplaudert.«
»Die Idee finde ich toll«, warf Nicole Schwattke ein. »Warum haben Sie es nicht gemacht?«
»Vielleicht haben wir es ja gemacht«, sagte Dr. Rosenberger und schwieg entschieden.
»Gibt es im Ort eine besondere Stelle, an der sich die kriminelle Energie verdichtet?«, fragte Maria Schmalfuß.
»Es gibt sogar mehrere!«, antwortete Dr. Rosenberger. »Das BKA-Team findet schon seit Monaten immer wieder Spuren von gewalttätigen Zusammenstößen und Schießereien. Im Keller eines Anwesens ist vermutlich sogar gefoltert worden, es sind Werkzeuge mit Blutspuren zurückgeblieben. Es muss Verletzte, vielleicht sogar Tote gegeben haben, aber weiter sind wir nicht gekommen, denn sämtliche Spuren brechen plötzlich ab und führen ins Nichts. Opfer wie Täter sind, wie Sie sich denken können, verschwunden. Und es gibt natürlich keine Zeugen. Das BKA-Team hat diese Orte gründlich durchkämmt und untersucht, dort sind die beiden Vermissten sicher nicht zu finden. Sie können die Details in der Akte nachlesen. Ich weise Sie aber hiermit ausdrücklich an, diese Orte bei ihren Ermittlungen zu meiden, um die BKA’ler nicht zu gefährden.«
»Wie sollen wir dann überhaupt ermitteln?«, fragte Becker.
»Sie müssen sich etwas einfallen lassen«, unterbrach Dr. Rosenberger. »Sie müssen ohnehin verdeckt agieren. Und, wenn ich das so sagen darf: Das ist kein Kinderfasching. Die Tarnung muss über aufgeklebte Theaterschnurrbärte und verstellte Stimmen hinausgehen.«
»Wir werden uns etwas einfallen lassen«, sagte Jennerwein und massierte die Schläfen mit Daumen und Zeigefinger. Es sah aus, als hätte er schon eine Idee.
»Wann werden wir die Herrschaften vom BKA kennenlernen?«, fragte Stengele.
»Es wird kein Zusammentreffen zwischen Ihnen und diesen Herrschaften geben. Ihre Aufgabe ist es, die beiden verschwundenen Beamten zu finden, und nicht, verdeckte Ermittler zu unterstützen. Es ist auch besser, wenn das Team Werdenfels von Ihren Ermittlungen nichts erfährt, abgesehen natürlich vom Einsatzleiter, den ich Ihnen noch vorstellen werde.«
»Ich denke, die anderen vom Team werden wir dann schon erkennen«, sagte Maria.
»Das glaube ich nun wiederum nicht, dass Sie einen Beamten in Zivil ohne weiteres erkennen«, sagte Dr. Rosenberger. »Bei allem Respekt, aber diese Leute sind geschult darin, sich dem Milieu, gegen das sie vorgehen, anzupassen. Sie nehmen die Farbe der Wand an, vor der sie sitzen.«
»Pah!«, rutschte es Stengele heraus. »Ich würde einen Polizisten sofort herausschmecken. Schon die Grundausbildung hinterlässt tiefe und unauslöschliche Spuren. Da gewöhnt man sich ganz bestimmte, forschende Blicke an, einen gewissen Gang, sogar eine unverwechselbare Art, wie man dasteht.«
»Wenn Sie sich da mal nicht täuschen«, erwiderte Dr. Rosenberger und nahm den Hörer hoch. »Seien Sie doch bitte so lieb«, sagte er zu jemandem am anderen Ende des Funkstroms, »und schicken Sie den Kollegen Gärtner sowie meinen Schwager zu mir ins Büro.« Er legte auf. »Kommissar Gärtner ist der Einsatzleiter dieser Operation Werdenfels, das andere ist mein Schwager, mit dem ich hier in der Mittagspause manchmal Schach spiele.«
Er wies beiläufig auf das Brettchen, das Jennerwein vorher aufgefallen war.
»Ihre Aufgabe ist es nun, mir zu sagen, wer von den beiden Männern der durchtrainierte, in vielen Einsätzen kampferprobte Polizist ist, und wer der Chef einer gut laufenden Steuerkanzlei. Nur raten gilt nicht, ich will eine Begründung.«
Kurze Zeit darauf betraten zwei Männer ohne anzuklopfen den Raum und blieben am Türrahmen stehen. Beide hatten etwas Lasches, Laxes, fast Weichliches, keinen von ihnen konnte man sich bei einem brisanten Geiselbefreiungseinsatz vorstellen.
»Dann will ich mal den Anfang machen.«
Maria Schmalfuß erhob sich samt ihrer unvermeidlichen Kaffeetasse, in der sie meditativ herumrührte.
»Bitte, Frau Doktor, auf wen tippen Sie?«
Sie zeigte mit ihrem Kaffeelöffel auf den rechten Mann.
»Ich vermute, dass der da der verdeckte Ermittler ist.«
Der da zeigte keinerlei Regung.
»Sehen Sie sich nur die Körpersprache der beiden an«, fuhr Maria fort. »Die stehen da, wie man unterschiedlicher nicht dastehen kann! Der Linke hat eine lockere und entspannte Körperhaltung, wie ein Zivilist. Der Rechte hingegen versucht lediglich locker und entspannt dazustehen. Das Gespielte, das Bemühte, das erkennt man sofort. Aus dem wird nie ein Steuerberater!«
Sie setzte sich wieder und blickte Dr. Rosenberger erwartungsvoll an.
»Nicht? Fehlversuch?«
Dr. Rosenberger machte eine undefinierbare, väterlich gutmütige Handbewegung. Stengele erhob sich rumpelnd und trat ein paar Schritte auf die Männer zu. Abwechselnd untersuchte er die Handinnenflächen der beiden. Er verglich sie so sorgfältig, wie er im Hochwald frische Gamskitzlosung untersucht hätte.
»Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der linke Mann ein Verdeckter ist«, sagte er schließlich brummelnd. »Der rechte hat Hände zum Seitenumblättern und Bleistiftspitzen – dem anderen traue ich zu, dass er schon ein paar Mal in einer Felswand gekraxelt ist. Oder bei der Einzelkämpferausbildung drei Tage im Matsch gelegen ist. Die Schwielen kommen jedenfalls nicht vom Papierfalten.«
Stengele setzte sich wieder zu seinen Kollegen.
»Und Sie, Becker?«, sagte Dr. Rosenberger, dem die Demonstration immer mehr Vergnügen zu bereiten schien. »Was meinen Sie?«
»Ich muss leider passen«, erwiderte dieser verlegen. »So rein aus dem Bauch heraus kann ich das nicht beurteilen. Ich bräuchte Hautfetzen von den Händen. Ein ausgezupftes Haar würde mir auch genügen. Oder wenigstens eine Faser. Bis heute Abend hätte ich dann Ergebnisse. Spätestens morgen früh. Meine Ergebnisse wären dann allerdings hundertprozentig.«
Den kleinen Seitenhieb auf alle anderen Ermittler und Schlussfolgerer hatte er sich nicht verkneifen können. Nicole Schwattke war dran. Sie stellte sich vor den linken Mann und hob die Hände zu einer Tai-Chi-Kampfpose, so etwas wie Wendige Mücke weckt schläfrigen Tiger. Dann holte sie zu einem Schlag aus, einem stilisiert langsamen Hieb allerdings, ihre Faust stoppte dicht vor dem Gesicht des linken Mannes. Alle beobachteten die Szene gespannt. Der Mann zeigte keinerlei Reaktion. Konnte ein Steuerberater so viel Selbstbeherrschung zeigen? Härteten ihn die Gesetzblätter und Sonderverordnungen so ab? Es schien so. Nicole brachte sich in Stellung, um die Übung mit dem rechts Stehenden zu wiederholen.
»Bei mir brauchen Sie es gar nicht zu probieren«, sagte dieser unvermittelt und verzog dabei ebenfalls keine Miene. »Jetzt, wo ich weiß, dass Sie nicht durchziehen, werde ich sicherlich nicht zusammenzucken.«
»Vielleich hätte ich bei Ihnen ja wirklich zugeschlagen.«
»Dazu sind Sie nicht der Typ.«
»Sie sind nicht der verdeckte Ermittler«, sagte Nicole und ging zurück. »Sie quatschen mir zu viel.«
Alle blickten auf Jennerwein. Dr. Rosenberger nickte ihm ermunternd zu. Der Kommissar seufzte. So wie der Papa beim Kindergeburtstag seufzt, wenn er beim Würstlschnappen mitmachen soll. Er trat auf den linken Mann zu und sah ihm aus nächster Nähe in die Augen. Der hielt der Blickmensur stand, ohne zu blinzeln. Jennerwein schritt zum anderen und musterte ihn ebenfalls. Er suchte etwas ganz Bestimmtes – den starren Blick des Jägers, den Blick eines Menschen, der gar nicht anders kann, als in den Polizeidienst zu gehen. Der todunglücklich ist, wenn er Steuerberater, Oberstudienrat oder Restauranttester wird. Jennerwein fand keinen solchen Blick.
»Das sind beides keine verdeckten Ermittler«, sagte Jennerwein. »Sie haben nicht den Blick.«
Auf einen Wink des Polizeioberrats wandten sich die beiden weichlichen Probanden zum Gehen, sie tuschelten dabei leise miteinander. Nicole Schwattke (die mit den jüngsten und folglich besten Ohren) glaubte ein Das geht ja schon gut los! herauszuhören. Der Chef machte überhaupt keine Anstalten, das Rätsel aufzulösen. Das hatte auch niemand erwartet. Alle hatten die Botschaft verstanden: Bei diesem Auftrag konnte man nicht sicher sein, wer der Gute und wer der Böse war.
Dr. Rosenberger erhob sich. Dann hielt er den knallroten Schnellhefter hoch und fächelte damit ein paar Kubikmeter Luft weg.
»Jeder von Ihnen liest sich das durch und prägt sich die Daten ein. Verteilen Sie die Informationen auf das Team. Sie haben zwei Stunden Zeit. Gehen Sie in den Büroraum nebenan. Wenn Sie fertig sind, bringen Sie mir das gute Stück wieder zurück. Und nochmals: keine Notizen.«
Alle machten sich daran, dieser Anweisung Folge zu leisten und ins Nebenzimmer zu gehen.
»Nein, halt, Sie bleiben hier, Jennerwein. Ich habe unter vier Augen mit Ihnen zu reden.«
»Anpfiff?«, fragte Nicole Schwattke die anderen, als sie draußen auf dem Flur standen.
»Das glaube ich nicht«, sagte Stengele. »Jennerwein ist der gewissenhafteste Beamte, den ich kenne. Ich denke nicht, dass er auch nur einen einzigen Eintrag in der Personalakte hat.«
»Jeder hat irgendwas«, sagte Maria Schmalfuß.