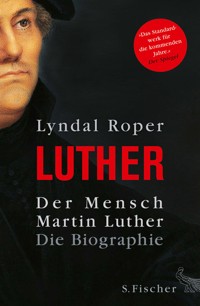14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Warum tötet eine Frau ihr Kind? Warum gesteht eine andere, mit dem Teufel wie Mann und Frau gelebt zu haben? Warum beschäftigt ein berühmter Bankier und Kaufmann eine Dorfhellseherin? Und was verbirgt sich hinter der frühneuzeitlichen Mode der opulenten Schamkapseln? Lyndal Roper bietet überraschende Einblicke in eine fremde und doch begreifbare Welt. Ihr gelingt es, der Historiographie der Frühen Neuzeit einen entscheidenden Impuls zu verleihen. Mit feinem, aber festem Strich fügt sie dem Bild vom ausschließlich sozial und kulturell geprägten Individuum, wie es uns seit Max Weber und Norbert Elias vertraut ist, eine neue Dimension hinzu: Lyndal Roper fragt nach den psychischen und physischen Aspekten individuellen Handelns, nach der Bedeutung des Irrationalen und Unbewußten für die Geschichte, nach der Bedeutung des Körpers und schließlich nach der Beziehung dieser Aspekte zur Geschlechterdifferenz. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 558
Ähnliche
Lyndal Roper
Ödipus und der Teufel
Körper und Psyche in der Frühen Neuzeit
Aus dem Englischen von Peter Sillem
FISCHER Digital
Inhalt
Der Aufsatz »Sexualutopien in der deutschen Reformation« beruht auf einer Übersetzung von Hans-Jürgen Bachorski. Der Aufsatz »Hexerei und Hexenphantasien in der Frühen Neuzeit« wurde von Christa Schuenke übersetzt.
Vorwort
Für mich ist das Schreiben nie das Ergebnis einsamer Arbeit, sondern es muß aus dem Gespräch entstehen. Ich möchte beginnen mit dem Dank an die vielen Freunde, die mit mir diskutiert und gesprochen haben, die mir Briefe schrieben und Vorträge kommentierten, die mich unterstützt und mir geholfen haben zu denken. Sie haben dieses Buch geprägt.
Die darin enthaltenen Aufsätze sind zwischen 1988 und 1992 in Deutschland und Großbritannien entstanden. Sie wurden ebenso für eine deutsch- wie für eine englischsprachige Leserschaft geschrieben und sind das Ergebnis von Erfahrungen und Diskussionen in beiden Ländern. Als Australierin entstamme ich einer Migrantenkultur. Die Spannung zwischen diesen beiden Sprachen und Kulturen ist nicht immer bequem gewesen, aber sie hat mich beständig dazu angehalten, meinen Ausgangspunkt zu überdenken und in Frage zu stellen. Sie hat überdies die freudige Erfahrung mit sich gebracht, an mehr als einem Ort zu Hause zu sein. Ich möchte hier dankbar besonders die Wärme, Gastfreundschaft und Offenheit erwähnen, die ich von meinen deutschen Freunden erfahren habe: Sie haben mir mehr gegeben, als ich sagen kann.
Meine Forschungsarbeit ist großzügig von verschiedenen Institutionen unterstützt worden. Insbesondere hatte ich während eines Jahres am Wissenschaftskolleg zu Berlin 1991 – 1992 den Freiraum und die Zeit, Ideen auszuprobieren und Themen zu erkunden, an denen mich zu versuchen mir sonst der Mut gefehlt hätte. Ich möchte besonders Etienne François danken, der über Augsburg und vieles mehr gearbeitet hat, Amos Hetz, Tänzer und Bewegungsphilosoph, sowie Patrizia Pinotti, die mich so vieles gelehrt hat. Neben anderen veränderten meine Denkweise am Wissenschaftskolleg Horst Bredekamp, Hinderk Emrich, Menachem Fisch, Ingrid Gilcher-Holtey, Michael Lackner, Larissa Lomnitz, Sigrid Metken, Lolle Nauta, Claudia Schmölders und Gabi Warburg. Der Deutsche Akademische Austauschdienst finanzierte mir 1991 eine Forschungsreise, und die British Academy gewährte mir Forschungsgelder, die mir Arbeiten im Archiv ermöglichten. Das History Department am Royal Holloway College der University of London unterstützte meine Arbeit nicht nur großzügig durch die Gewährung von Urlaub und Forschungssemestern, sondern auch durch ein intellektuelles Umfeld, in dem die Arbeit zum Vergnügen wird.
Ich danke den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren am Wissenschaftskolleg zu Berlin, die selbst aufgrund vagester Informationen außerordentlich hilfreich beim Auffinden von Büchern und Artikeln waren, Herrn Wolfram Baer sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtarchivs Augsburg, dem Mitarbeiterstab der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg sowie der Staatsbibliothek München, insbesondere Liselotte Renner, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek Berlin, Erika Kartschoke und dem Projekt »Bilder von Liebe, Ehe und Familie in der Literatur des 15. und 16. Jahrhunderts« an der Freien Universität Berlin sowie schließlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der British Library.
Ich danke auch Sally Alexander, Hans-Jürgen Bachorski, Ingrid Bátori, Judith Bennett, Willem de Blécourt, Guy Boanas, Wendy Bracewell, Roland Bracewell-Shoemaker, Alan Bray, Philip Broadhead, Alison Brown, Susanne Burghartz, Trish Crawford, Leonore Davidoff, Cyril Edwards, Hella Ehlers, Liz Fidlon, Laura Gowing, Annabel Gregory, Barbara Hahn, Karin Hausen, dem History Workshop Journal-Kollektiv, Pia Holenstein, Olwen Hufton, Eva Hund, Michael Hunter, Lisa Jardine, Mark Jenner, Ludmilla Jordanova, Rolf Kiessling, Eva Labouvie, Yasmin Lakhi, Elisabeth Lintelo, Nils Minkmar, Maria E. Müller, Jinty Nelson, Alex Potts, den Herausgebern des Radical History Review, Jörg Rasche, Gareth Roberts, Bernd Roeck, Jörg Rogge, Ailsa Roper, Cath Roper, Stan Roper, Hans-Christoph Rublack, Ulinka Rublack, Raphael Samuel, Peter Schöttler, Regine Schulte, Beate Schuster, Peter Schuster, Gerd Schwerhoff, Bob Scribner, Pam Selwyn, Kathy Stuart, Anne Summers, Rosalind Thomas, Ann Tlusty, John Tosh, J.B. Trapp, Hans Wilhelm, Lore Wilhelm und Charles Zika.
In Deutschland möchte ich besonders Michael Schröter danken, der gewaltige Mengen Kaffee mit mir getrunken und mir Denkanstöße gegeben hat, Peter Morgan, von dem ich so viel über das Deutschland von heute gelernt habe, Wolfgang Behringer, der immerzu Hexen für mich findet, Heide Wunder, die so viel dafür getan hat, eine feministische Geschichtswissenschaft in Deutschland zu begründen, und Norbert Schindler, dessen großherziger Glauben an dieses Projekt mir geholfen hat, es abzuschließen. Natalie Zemon Davis hat das Buch gelesen, sie war eine nie versiegende Quelle der Inspiration. In Großbritannien hat Nick Stargardt das gesamte Manuskript Korrektur gelesen und mir dabei über die Geschichte der Kinder erzählt, Lorna Hutson hat die Einleitung mit mir diskutiert und mich gelehrt, frühneuzeitliche Texte zu lesen; Ruth Harris hat unermüdlich Entwürfe und sogar Vor-Entwürfe kommentiert – ich stehe hoch in ihrer Schuld; Alison Light hat alles gelesen und den Mut gehabt, mir zu sagen, wenn es nicht ausreichte (die Feuerprobe wahrer Freundschaft); mein Bruder Mike Roper hat sich unverdrossen endlose Vorträge und Schwärmereien angehört und Stapel von Entwürfen durchgeackert – seine Arbeit über Männlichkeit hat mich stark beeinflußt –, und Barbara Taylor hat als »Lektorin« fungiert, indem sie mir nicht nur das Zutrauen schenkte, so lange weiterzumachen, bis es endlich stimmte, sondern auch aufzuhören, wenn es dann einmal stimmte. Für die deutsche Ausgabe möchte ich Herrn Walter H. Pehle, Fischer Taschenbuch Verlag, danken, dessen scharfsinniger Humor immer den Kern der Sache traf, und Peter Sillem, Historiker der Melancholie, dessen optimistische Geduld für eine einfühlsame Übersetzung sorgte. Ohne sie alle gäbe es dieses Buch nicht.
Einleitung
I
Im Jahre 1686 gestand Appolonia Mayr, eine sitzengelassene Dienstmagd, ihr neugeborenes Kind ermordet zu haben. Der Teufel hatte ihr versprochen, daß ihr Liebhaber sie heiraten würde, wenn sie ihr Kind umbrächte. Sie hatte den Säugling an einem kleinen Hügel jenseits der Lechbrücke, kurz vor dem Dorf Friedberg, erdrosselt. Sie erinnerte sich noch an den Ort ihrer Tat und konnte ihn wiederfinden. Nicht weit davon entfernt stand ein Baum. Sie war in die Felder gegangen, und es war Mittag, als es passierte.[1] Bei der Beschreibung der Geburt und des Mordes sagte sie aus, »der bose habe Ihr kein frid gelassen, es seie nur ein Augenblick gewesen, der Teuffel habs angeruhrt, als wan Er ein hebam were, seie gar bald geschehen, das dz kind heraus gewesen. Sie habs auch gleich ertrosselt mit der hand, vnd sie habe im bringen kein schmerzen gespuhrt.«[2] Anschließend ging Appolonia weiter: »Ja sie habs also gantz nackent ligen lassen, vnbedeckt, vnd unbegraben. […] der Teuffel seie nicht mit Ihr gegangen, sondern beym kind stehen bliben, sie habe weitter nicht vmbgesehen.«[3]
Was können wir mit einem solchen kulturellen Fragment anfangen? Anscheinend begeht hier eine Frau Kindsmord als eine Art Liebeszauber, als verzweifelten und hoffnungslosen Versuch, ihren Liebhaber dazu zu bewegen, sie zu heiraten. Allein auf dem Pfad zwischen den Feldern und dem Dorf, hat sie die Grenze menschlicher Behausung überschritten – der einsame Baum, der den Ort bezeichnet, ist das einzige markante Merkmal in der Landschaft. Sie gebiert das Kind ohne die Unterstützung einer Frau. Der Teufel agiert als Hebamme, und er ist es auch, der bei dem Kind bleibt. Appolonia selbst tut kaum irgend etwas – die Geburt bereitet ihr kaum Mühe, Appolonia läßt das Kind unbedeckt im Gebüsch zurück und läuft weiter. Um so deutlicher sticht ihre einzige Tat heraus: das eigenhändige Erdrosseln ihres neugeborenen Kindes. Appolonia Mayr wurde als Hexe verbrannt. Sie lebte in einer Welt, in der der Teufel ein Wesen war, dem man auf jedem einsamen Pfad begegnen konnte, das einem einzuflüstern vermochte, wen man töten sollte und wie man andere Menschen beherrschen konnte. Wie ist eine solche Welt zu verstehen? Es hat viele Anläufe dazu gegeben, angefangen bei den Richtern, die die Kriminellen verhörten, über die Verleger von Flugschriften, die diese schrecklichen Fälle in Unterhaltung verkehrten, bis hin zu den Kulturgeschichtlern des 19. Jahrhunderts[4] und weiter zu den Historikerinnen und Historikern unserer Tage. Damals wie heute rührt ein Großteil dieses Interesses aus der Faszination einer fremden und doch vertrauten Welt. Fälle wie dieser geben uns Rätsel auf über unsere eigene Identität und sind ein Anreiz für uns zu spezifizieren, worin das Historische eigentlich besteht. Sie konfrontieren uns mit einer Zeit, die anscheinend unberührt war von unserem Persönlichkeitsbegriff, in der moralische Kategorien eine andere Gewichtung hatten und in der man sich die Beziehung zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen anders vorstellte. Wir haben viele Hilfsmittel bemüht, um diese Welt zu analysieren. Wir haben von der Anthropologie und der Literaturwissenschaft gelernt, beim Lesen unserer Texte das Augenmerk auf Symbole und Rituale zu richten, Verwandtschaftsstrukturen aufzudecken und, dies vor allem, die Andersartigkeit der frühneuzeitlichen Gesellschaft zu unterstreichen.[5] Durch dieses Vorgehen konnten wir schließlich die Distanz ausloten, die uns von jener anderen Welt trennt, und diese durch die Rekonstruktion des kollektiven Charakters der frühneuzeitlichen Gesellschaft »historisieren«, wobei Subjektivität selbst als kulturelles Konstrukt gilt. Wie können wir mit einer historischen Vorgehensweise, die auf solchen Annahmen beruht, Appolonia Mayrs Geschichte deuten? Man könnte in ihr das Beispiel einer Frau auf dem Höhepunkt der Gegenreformation sehen, gepeinigt von sexuellen Schuldgefühlen, mit denen sie durch katholische »Umschulung« und Sozialdisziplin beladen war. Ihre Geschichte vom Teufel könnte man lesen als eine Art abgedroschenen Blindtext, den Frauen, die sich einer geschlechtsspezifischen Sünde schuldig gemacht hatten, in der Kultur des Barock aufzusagen gezwungen waren. Ganz wie eine gute Katholikin des 17. Jahrhunderts es tun würde, die sich ihrer religiösen, konfessionellen Identität bewußt ist – das würden uns die Historiker erwarten lassen –, beschreibt Appolonia, wie sie in Augsburg nach Katholiken Ausschau hielt, um in deren Herberge ihr Kind zur Welt zu bringen.
Doch es gibt in ihrem Verhalten etwas Tiefgründigeres, Verstörenderes. Als Appolonia einige Monate später nach Augsburg zurückkehrte, war es ihre Bitte an die Franziskaner, ihr eine Taufurkunde für ihr totes Kind auszustellen, die den Stein ins Rollen brachte. In der ersten Befragung bestritt Appolonia energisch, ihr Kind getötet zu haben; sie erzählte, »Fast Ein stund nach der geburth habe sie begert Jhr kind zu sehen«, und sei dann davon unterrichtet worden, daß ihr Kind schon nicht mehr gelebt hätte, als es zur Taufe zu den Franziskanern gebracht worden war. Die fehlende Bescheinigung der Kindstaufe als Beweis für das ewige Leben des Säuglings steht für den Verlust des Kindes selbst. Wie Appolonia es ausdrückte: »Sie wolle halt ihr kind wieder sehen, kenne also nicht mehr leben«.[6] In ihren Versuchen, an das Schriftstück zu gelangen, offenbart sich eine selbstmörderische Verzweiflung: Auf ihrer Suche nach dem Schreiben verfing sie sich im Spinnennetz der Bürokratie, die unweigerlich ihre Tat aufdeckte und ihr Lügengebäude über den Tod des Kindes zum Einsturz brachte. Das spricht weniger für konfessionelle Identität und sexuelle Schuld – Appolonia hatte keinen Hehl aus ihrer Schwangerschaft gemacht –, als vielmehr für nackte Verzweiflung angesichts des Verlusts ihres Kindes, ein Schmerz, der nicht das Produkt gegenreformatorischer Religiosität ist. Angesichts der Vielfalt und Inkonsistenz der Erklärungen darüber, wo und wie Appolonia das Kind zur Welt brachte, müssen die Historikerin und der Historiker (ebenso wie Appolonias Befrager) jegliche Hoffnung aufgeben, jemals die »Wahrheit« darüber zu ergründen; doch die Erklärungen sind in anderer Weise aufschlußreich.
Appolonias Teufelsphantasien haben wenig mit Ritualen zu tun. Sie sind so eindeutig lokalisierbar und offenbaren so viel persönliches Leid, daß es unangemessen wäre, von kollektiven Überzeugungen und Symbolen zu sprechen. Der Prozeß, den Appolonia durchlief, bis sie, indem sie über den Teufel sprach, ihren Schmerz beschreiben konnte, ist wesentlich komplexer, als eine bloße Rekapitulation kultureller Stereotypen es wäre. Es ist sicher richtig, daß die Plausibilität ihrer Aussagen für ihre Befrager ebenso wie für sie selbst von dem gemeinsamen Glauben an die Macht des Teufels abhing, doch gestaltete Appolonia ihre ganz eigene Geschichte über Mutterschaft und Schuld. Es war eine Geschichte mit einer eigenen gotteslästerlichen, marianischen Ausprägung: In ihrer ersten Version erzählte sie, wie sie als Fremde um Aufnahme in einer Herberge ersucht und in einem einsamen Raum auf einem Bett aus Stroh das Kind zur Welt gebracht habe.
Es waren Geschichten wie jene von Appolonia Mayr, bei denen es mir unbehaglich wurde in der Art und Weise, wie ich bislang die Beziehung zwischen individueller Subjektivität und Kultur konstruiert hatte. In diesem Buch möchte ich einer allzu starken Betonung der kulturellen Erzeugung von Subjektivität entgegentreten und dafür plädieren, daß Hexerei und Exorzismus, diese beiden fremdartigsten Phänomene frühneuzeitlicher Kultur, daß Freien, Werben und Rituale, also scheinbar unwiderlegbar kollektive Gesellschaftsereignisse der Frühen Neuzeit, nicht zu verstehen sind, ohne ihre psychische Dimension zu berücksichtigen. Ich bin davon überzeugt, daß die frühneuzeitlichen Menschen über eine individuelle Subjektivität verfügten, die geprägt war durch Konflikte, welche uns nicht ganz unvertraut sind. Ich behaupte nicht, daß es keine historische Kluft gäbe, die unser Zeitalter von der Epoche der Frühen Neuzeit trennt – das wäre absurd. Aber ich möchte mich dafür stark machen, daß diese Kluft zwischen uns und der Vergangenheit, durch die wir uns eine bestimmte Art des Umgangs mit jener Vergangenheit angewöhnt haben, nicht so tief ist, wie wir manchmal glauben, und daß die Annahme von Differenz nicht immer ein brauchbares heuristisches Hilfsmittel ist. Im Gegenteil meine ich, daß sie uns beim Verständnis der frühneuzeitlichen Menschen als Individuen hinderlich gewesen ist.
Dieses Buch beschäftigt sich (vor allem) mit drei Themen: Erstens mit der Bedeutung des Irrationalen und des Unbewußten in der Geschichte; zweitens mit der Bedeutung des Körpers; und drittens mit der Verbindung dieser beiden zur Differenz der Geschlechter. Es geht darin um das Wesen von Männlichkeit und Weiblichkeit, um den kulturellen Einfluß von Reformation und Gegenreformation sowie um die zentrale Rolle von Magie und Hexerei für die psychische und emotionale Welt der Frühen Neuzeit und für das, was wir für »Rationalität« halten. Die vorliegenden Aufsätze dokumentieren, was mich angeht, eine Abkehr von der Überzeugung, daß die Geschlechtlichkeit [gender][7] ein Produkt kultureller und sprachlicher Praxis sei, hin zu der Ansicht, daß die Geschlechterdifferenz ihre eigene physiologische und psychologische Realität besitzt und daß die Anerkennung dieser Tatsache sich auf die Geschichtsschreibung auswirken muß. Die Aufgabe, die sich mir stellte, war die, wie eine Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit zu schreiben sei, in der die Geschlechterdifferenz nicht als nachträglicher Gedanke, als eine weitere Variante einfach angefügt wird, sondern in die sie grundlegend integriert ist. Das bedeutet, daß das Freien, die Geschichte der Mutterschaft, Hexerei, Besessenheit und Männlichkeit – allesamt Themen, bei denen es auf die Geschlechtlichkeit [gender] und das Verhältnis von Psyche und Körper ankommt – zentrale kulturelle Gebiete darstellen. Es bedeutet auch, daß die Geschlechterdifferenz – mitnichten eine Sache des Zufalls – sowohl als physiologische Tatsache wie auch als gesellschaftliches Konstrukt ein Teil des Stoffes ist, aus dem Kultur besteht. Diese Konsequenz wird in der Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit noch immer nur sehr zögerlich akzeptiert; auch weiterhin wird dort das Thema Geschlechtlichkeit [gender] behandelt, als sei es eine Frage der Beteiligung bzw. Nichtbeteiligung von Frauen an der Kultur des Volkes und der Eliten.
Doch so zentral die Geschlechterdifferenz meiner Meinung nach für die Wahrnehmung von Kultur ist, konnte ich bei der Untersuchung Europas in der Frühen Neuzeit nicht mehr ohne weiteres mit dem herkömmlichen Handwerkszeug der feministischen Geschichtswissenschaft arbeiten. Wie ich im folgenden im Einklang mit anderen derzeit schreibenden Feministinnen darlegen werde, hat die feministische Geschichte, wie ich und andere sie betrieben haben, auf einer Verleugnung des Körpers beruht. Die hier versammelten Aufsätze stellen – nicht immer vollständig artikuliert – den Versuch dar, einen anderen Weg zum Verständnis von Körper, Kultur und Subjektivität zu erschließen.
II
Für die Historikerinnen und Historiker stellte sich das Problem der Subjektivität vergangener Epochen in erster Linie in Gestalt der Frage dar, auf welche Weise große Bewegungen historischer Transformation (die Entstehung des Kapitalismus, die Reformation, die Entwicklung des Staates) die individuelle Selbstwahrnehmung veränderten. Dabei erlangten die Arbeiten der Soziologen Max Weber und Norbert Elias eine besondere Bedeutung speziell für diejenigen, die sich mit der Erforschung Europas zwischen 1500 und 1800 beschäftigten. Webers Die protestantische Ethik und der »Geist« des Kapitalismus[8] prägt noch immer unsere Sichtweise der Frühen Neuzeit, auch wenn die Historiker nunmehr einige empirische Details in Zweifel ziehen. Wir verdanken Weber die Einsicht, daß die mit dem Aufstieg des Protestantismus einhergehenden Veränderungen insofern mit den Ursprüngen des Kapitalismus verbunden waren, als im Zuge dieser Umbrüche die Qualitäten des Laienvolkes neu bewertet wurden, indem man das rationale, abwägende, disziplinierte Individuum förderte, eine Persönlichkeit also, die sich den Anforderungen des Marktes zu stellen wußte. Luthers Doktrin des »Berufs« war neu aufgrund ihrer »Schätzung der Pflichterfüllung innerhalb der weltlichen Berufe als des höchsten Inhaltes, den die sittliche Selbstbetätigung überhaupt annehmen könne«, was »die Vorstellung von der religiösen Bedeutung der weltlichen Alltagsarbeit zur unvermeidlichen Folge hatte […]«.[9] Folglich ist die »Rationalisierung der Lebensführung innerhalb der Welt im Hinblick auf das Jenseits […] die Berufsidee des asketischen Protestantismus«.[10] Norbert Elias’ Werk verbindet psychoanalytische Einsicht mit historisch kenntnisreicher Soziologie.[11] Seine Ideen nahmen die Historikerinnen und Historiker der Frühen Neuzeit auf, indem sie zu zeigen versuchten, daß abstrakte, generelle historische Übergänge wie Reformation und Gegenreformation oder das Entstehen von Bürokratie und Staat nicht nur Auswirkungen auf die Politik hatten, sondern auch auf die sehr viel weniger greifbaren Dimensionen menschlicher Geschichte, die Konstituierung menschlicher Subjekte, ihre Gefühle, ihre Wahrnehmungen, ihr Verhalten und sogar ihre Gesten. In neuerer Zeit ist Charles Taylor mit einer gewaltigen philosophischen Synthese dafür eingetreten, daß die Ursprünge des modernen westlichen Begriffs von Individualismus und Identität im Aufstieg dessen anzusiedeln sind, was er die »Innerlichkeit« im Gefolge der protestantischen Reformation nennt. Sie ging einher mit der Abkehr von einem älteren, magischen Weltbild, in dem die Grenzen zwischen dem Selbst und der natürlichen Welt in hohem Maße durchlässig waren. Taylor schreibt:
[Es bestand] ein Zusammenhang […] zwischen der Entzauberung und einer neuen moralischen bzw. geistigen Haltung gegenüber der Welt, die ihrerseits diese Entzauberung vorantrieb. Sie stand im Zusammenhang mit einer neuen Frömmigkeit, und was wir nun zum Vorschein kommen sehen, ist eine vorher nicht dagewesene, von dieser Frömmigkeit geförderte Vorstellung von Freiheit und Innerlichkeit.
Der Niedergang der Weltanschauung, die der Zauberei zugrunde lag, war die Kehrseite des Aufstiegs des neuen Gefühls für Freiheit und Selbstbeherrschung. Vom Blickpunkt dieses neuen Selbstgefühls scheint die Welt der Zauberei Knechtschaft nach sich zu ziehen, eine Einkerkerung des Selbst durch unheimliche äußere Kräfte, ja eine Schändung oder einen Verlust des Selbst. Sie droht mit einer Beherrschung, die das genaue Gegenteil der Selbstbeherrschung ist.[12]
Synthesen wie dieser kommt das Verdienst zu, der historischen Forschung neue Felder menschlicher Erfahrung zu erschließen. So erhellend jedoch diese Darstellungen der Verbindung von historischem Wandel und Psychologie auch sein mögen, so bin ich trotzdem der Ansicht, daß sie auf einem problematischen Begriff von Subjektivität basieren und daß die Historiker dann, wenn sie sich auf Elias oder Weber beziehen, Gefahr laufen, die Erfahrung historischer Subjekte zu schematisieren. In der Nachfolge Webers nimmt man häufig an, die Frühe Neuzeit habe das Ideal des rationalen homo oeconomicus oder, wie Taylor es formulieren würde, ein neues Gefühl von Selbstbeherrschung, von individueller Identität hervorgebracht. Doch wie die Infragestellung von Modellen rationalen Verhaltens durch die Psychoanalyse vermuten läßt, wird das menschliche Handeln nicht allein von bewußter Überlegung bestimmt; Identität ist demzufolge kein sicherer Besitz, sondern ein allmählich fortschreitender Prozeß von Identifikationen und Trennungen. Die Epoche der Frühen Neuzeit war weit davon entfernt, die Geburt des rationalen asketischen Individuums einzuleiten; vielmehr lebte das Interesse an der Magie und am Irrationalen wieder auf. Dies ist eine wesentliche Komponente jener Subjektivität, die wir heute gerne als »rational« und »modern« ansehen. Die Magie und das Irrationale sind integrale Bestandteile und nicht lediglich Kinderkrankheiten im Zuge einer »Krise […], die aus dem Übergang von einer Identität zur anderen entstand«.[13] Daß wir von der Geschichte des Entstehens von Individuum und Vernunft nicht lassen wollen, ist, denke ich, mit ein Grund dafür, daß wir so häufig den Hexenwahn mit der Intoleranz und der sogenannten Irrationalität des Mittelalters assoziieren, obwohl wir wissen, daß die Hexenjagd eher ein frühneuzeitliches als ein mittelalterliches Phänomen war.[14] Als solches gehört seine Geschichte in unser eigenes Zeitalter.
Elias’ Darstellung des Zivilisationsprozesses scheint auf den ersten Blick dem Irrationalen und jenen Bereichen menschlicher Erfahrung, die sich den vertrauten Kategorien historischer Darstellung entziehen, mehr Beachtung zu schenken. In der Tat hat sich sein Werk für die Historikerinnen und Historiker des Europa der Frühen Neuzeit als sehr fruchtbar erwiesen.[15] Elias beschreibt das Entstehen der civilité, die zunehmende Disziplinierung des ungebärdigen Körpers und die Zügelung natürlicher menschlicher Triebe und zeigt, wie diese Prozesse mit sozialen und politischen Veränderungen zusammenhängen. Der Mensch lernt, die natürlichen Funktionen durch ein System von Verhaltensweisen zu kontrollieren, während die »Gesellschaft beginnt, an bestimmten Funktionen die positive Lustkomponente durch die Erzeugung von Angst allmählich immer stärker zu unterdrücken«.[16] Im Verlauf des 16. Jahrhunderts, so Elias, hätten sich die Angehörigen der Aristokratie allmählich einen neuen Verhaltenscodex angeeignet und damit begonnen, ihre natürlichen Triebe durch soziale Tabus und innere Disziplin einzudämmen, ein Prozeß, der von den sozial niedriger Rangierenden nachgeahmt wurde. In der höfischen Gesellschaft Ludwigs XIV. kulminierte diese Disziplin des Körpers, was einen maßgeblichen Faktor in der Entwicklung des Absolutismus darstellte:
In der höfisch-aristokratischen Phase wird die Zurückhaltung, die man den Neigungen und Affekten auferlegt, vorwiegend mit der Rücksicht und dem Respekt begründet, den man anderen und vor allem den sozial Höherstehenden schuldet. In der folgenden Phase wird das, was zu Triebverzicht, Triebregelung und Zurückhaltung zwingt, weit weniger durch bestimmte Personen repräsentiert; es sind, provisorisch und undifferenziert gesagt, unmittelbarer als zuvor die weniger sichtbaren und unpersönlicheren Zwänge der gesellschaftlichen Verflechtung, der Arbeitsteilung, des Marktes und der Konkurrenz, die zur Zurückhaltung und Regelung der Affekte und der Triebe zwingen.[17]
Diese Konzeption menschlicher Psychologie ist stark beeinflußt durch den frühen Freudianismus und seine Betonung der Macht der Triebe.[18]
Elias’ Anleihen bei der Psychoanalyse haben jedoch eine besondere Form angenommen. In seinem Werk wird das Psychische als sozial variabel und historisch kontingent betrachtet, da es einen »Zusammenhang von Gesellschaftsaufbau und Affektaufbau«[19] gebe. Die Organisation und den Ausgleich der verschiedenen Elemente innerhalb der Psyche hält er weder für universell noch für ahistorisch. Daher behauptet Elias, daß im späten Mittelalter die Triebkontrolle weniger stark geregelt gewesen sei: Es war eine Welt, »in der man den Trieben, den Empfindungen unvergleichlich viel leichter, rascher, spontaner und offener nachgab, in der die Affekte ungebundener, d.h. aber auch ungeregelter und stärker zwischen Extremen hin- und hergeworfen, spielten als später«, so daß »Triebversagungen« »nicht den gleichen Grad, wie in der späteren Zeit, und […] nicht die Gestalt eines beständigen, gleichmäßigen und fast automatischen Selbstzwangs«[20] hatten. Ja, weil »hier die Emotionen in einer Weise zum Ausdruck kommen, die wir im eigenen Lebensraum im allgemeinen nur noch bei Kindern beobachten können, nennen wir ihre Äußerungen und Gestaltungen [d. h. die der spätmittelalterlichen Gesellschaft; A.d.Ü.] ›kindlich‹«.[21] In seinem gesamten Werk werden Zivilisation und Instinkt einander gegenübergestellt, und der Körper wird als eine anarchische Ansammlung von Trieben gedacht, welche die Zivilisation, selbst in ihrer ›fortschrittlichsten‹ Form, beunruhigt unter Kontrolle behält. Vielfach findet in der von Elias beeinflußten historischen Literatur diese Sichtweise der Epoche vor dem Aufstieg des bürgerlichen, disziplinierten Individuums ihr passendes Gegenstück im Bild von der freien, undisziplinierten Kultur des vorreformatorischen Karnevals, eine Vorstellung, die stark durch die Arbeit des russischen Kulturtheoretikers Michail Bachtin über die Schriften von Rabelais geprägt ist.[22]
Das ermöglicht es den Historikern, eine Theorie anzuwenden, die das Unbewußte historisiert, während sie sich paradoxerweise gleichzeitig der Herausforderung entzieht, welche die Psychoanalyse für eine traditionelle historische Sichtweise darstellt. (Ebenso scheinen Historiker, wenn sie über die Geschichte der Gesten, der Kleidung oder der Hygiene arbeiten, nur über den Körper zu schreiben, während sie tatsächlich oft über einen Diskurs über den Körper schreiben; dies ist ein wichtiges Thema, dessen Formulierung als Diskurs allerdings, wie ich weiter unten darlegen werde, dem Problem der Subjektivität als sowohl körperliches wie auch psychisches Phänomen den Stachel nimmt.) Trotz ihres radikalen Potentials ist die psychoanalytische Einbeziehung des Irrationalen, wie wir sie Elias und anderen verdanken, in der Hauptsache von Weber geprägt: Sie spannt das Entstehen des modernen Subjekts mit dem Entstehen des Rationalen, des »Erwachsenen« zusammen, indem sie Subjektivität mit dem Entstehen der Moderne verbindet. Für Charles Taylor ist auch die »Entzauberung der Welt«, der Verlust des magischen Weltbildes eine Voraussetzung für das Entstehen einer Empfindung des Selbst, wie wir sie in der modernen Welt kennen.[23]
Im allgemeinen historischen Verständnis ist der Übergang von einer wilden, karnevalesken, Bachtinschen Kultur zu einer gemäßigten Organisierung des disziplinierten Menschen klar und einfach: Es ereignen sich historische Veränderungen, denen die individuelle Subjektivität auf dem Fuße folgt. Aber es ist alles andere als einleuchtend, warum diese Vorstellung vom Zusammenspiel von sozialem Wandel und individueller Subjektivität zutreffend sein soll. Mit der Identifizierung einer moralischen Reformbewegung oder eines Disziplinierungsversuchs ist noch nichts über deren mögliche Auswirkungen auf die Psyche und den Körper gesagt, die historisiert werden sollen. Wie Michel Foucault uns gelehrt hat, können solche Bewegungen die Werte, die sie hochhalten, unterminieren, anstatt sie zu stützen. Eine anders geartete Anwendung der Psychoanalyse könnte uns in die Lage versetzen, die Dynamik zwischen Verdrängung und Libido zu erkennen, die das gemäßigte bürgerliche Betragen entscheidend prägt. Gleichzeitig unterliegt die Freiheit des Bachtinschen Subjektes eigenen Über-Ich-Formationen. Rabelais’ Werk, das, von dem Calvinisten Johann Fischart übersetzt, zu einem so wichtigen Bestandteil des deutschen Schrifttums im 16. Jahrhundert wurde, kann nicht als reiner Karneval verstanden werden. Es ist das Produkt einer lateinischen, literarischen, moralistischen Kultur. Das Karnevaleske ist kein Überbleibsel eines älteren, rustikaleren und stärker libidinösen Zeitalters, das in Fischarts Büchern aufgehoben ist wie eine Fliege in Bernstein. Ein weiteres Beispiel ist die moralistische Zerstörung von Kunst, die ihrerseits, wie Horst Bredekamp am Beispiel von Florenz im 15. Jahrhundert gezeigt hat, den Charakter eines Fetischs annahm, als die Anhänger Savonarolas während des Karnevals Bilder auf dem Scheiterhaufen der Eitelkeiten verbrannten und damit gegen eine Gesellschaft protestierten, die sie für eine politische Tyrannis hielten.[24]
Dies wird um so deutlicher, wenn wir über Unterdrückung selbst nachdenken, den Begriff, der von so großer Bedeutung ist für die historische Literatur in der Nachfolge der psychologischen Theorie von Elias. Es wäre möglich, disziplinarische Verordnungen als ein riesiges Projekt der Unterdrückung zu begreifen, und so ist es auch meistens geschehen. Die Protestanten, dies wäre in etwa der Gang der Argumentation, wurden »konfessionalisiert«, als die Prostitution verboten, das Tanzen von Unzucht bereinigt und das ungezügelte Verhalten unter Kontrolle gebracht waren und als die Familie lernte, gemeinsam zu beten. Das Schamgefühl nahm zu, und das sexuelle Verhalten wurde zunehmend Einschränkungen unterworfen. Regeln zu erfinden bedeutet jedoch nicht, daß damit auch Konformität gewährleistet ist. Verhaltensrestriktionen können, wie Foucault betont hat, ihre eigenen Zwänge und Überschreitungsmöglichkeiten sogar bei ihren Verfechtern selbst entfalten. Die protestantischen Geistlichen trugen, indem sie in ihren Predigten vehement gegen das Übel des Tanzes und die erotischen Versuchungen durch das Berühren beim Tanz wetterten, mit ihrer farbigen Rhetorik auch dazu bei, das »ergerlich/vnzüchtig vnd leichtfertig tantzen«[25] zu sexualisieren. Anstatt Unterdrückung bzw. Verdrängung lediglich als oktroyierte Kontrolle zu verstehen, sollten wir ihren aktiven Part bei der Herausbildung sexueller Identitäten beachten. Das Unbewußte ist kein nutzloser Abwasserkanal für negative Triebe, der irgendwann überläuft und dann die höhergelegenen sauberen Bereiche des Bewußtseins verunreinigt. Uns fehlt vielmehr ein dynamisches Modell des Unbewußten – eine Vorstellung, die auch in Freuds späterem Werk zu finden ist –, um das fortwährende Wechselspiel zwischen Verlangen und Verbot erkennen zu können.[26]
Die Schwierigkeit besteht darin, daß weder Weber noch Elias eine ausreichende Erklärung dafür haben, wie sich soziale Veränderungen auf die individuelle Psyche auswirken. Tatsächlich existiert eine solche Theorie noch immer nicht. In der Zwischenzeit verfahren wir als Historikerinnen und Historiker oftmals so, als wirkten sich soziale Veränderungen unmittelbar und einheitlich auf die geistige Struktur des Individuums aus und als wäre die Psyche ein weißes Blatt Papier, das durch soziale Prozesse beschrieben würde. Dies ist mit ein Grund dafür, daß Geschlechter-, Rassen- und Klassenunterschiede nicht eben eine dialektische Schlüsselrolle in Elias’ Werk spielen – Veränderungen haben die Tendenz, allmählich von den oberen zu den unteren Schichten hinunterzurieseln, während die Volkskultur undynamisch ist –, und daß in den durch Elias’ Denken beeinflußten historischen Erklärungen so großes Gewicht auf den Schultern des Staates lastet. Wandlungen in der Struktur des Staates dienen als explanatorische »black box«, als Ursache für die Veränderungen der Sitten, des sozialen Verhaltens und sogar der Wahrnehmung. Ironischerweise wird auf diese Weise in der historischen Erklärung der Primat des Politischen wiederhergestellt, und zwar just zu einem Zeitpunkt, da Sozial- und Kulturgeschichte ihre Berechtigung und Eigenständigkeit durchzusetzen versuchen.[27] Die politische Geschichte, auf die sie sich bezieht, basiert dabei oftmals auf alten Abstraktionen wie »Absolutismus«, die die revisionistisch gesinnten Historiker von heute allmählich über Bord werfen. Gleichzeitig jedoch tun sich historische Arbeiten, die sich mit Subjektivität auseinandersetzen, schwer damit, dem Irrationalen oder der Phantasie des Subjekts einen Platz einzuräumen: Wenn es keinen anderen Grund gibt, dann verstößt die mangelnde Logik des Unbewußten gegen unsere Vorstellung von einer rational überzeugenden und befriedigenden Erklärung. Eine rationalistische Darstellung von Subjektivität ist nur partiell möglich; dennoch will es das Gebot historischer Synthese, daß wir vereinfachen, die bewußten Rationalisierungen des Subjekts beschreiben oder uns einer klaren, schematischen Psychologie befleißigen, bei der die Logik des politischen Wandels den Verlauf der Darstellung bestimmt.[28]
Das ist nicht nur bei Norbert Elias ein Dilemma. Jegliche Applikation einer psychoanalytisch geprägten Theorie sieht sich mit der Schwierigkeit konfrontiert, wie ein Modell, das dazu gedacht ist, die unbewußten geistigen Prozesse eines Individuums an den Tag zu bringen, auf eine ganze Gesellschaft angewendet werden kann. Dies ist der Grund dafür, daß es dem psychoanalytischen Vorgehen mit Biographien besser ergangen ist.[29] Während die Psychoanalyse zu zeigen vermag, auf welche unendlich variierende Weise einzelne Individuen imaginativ das Material ihrer Leidenserfahrungen umsetzen, indem sie ihre eigene symbolische Sprache und Symptomatik entwickeln[30], entwirft der Eliassche Typus der Psychogenetik eine historische, aber phantombildhafte Psychologie, in der individuelle psychische Kreativität wenig Platz hat. Eine historisch brauchbare Applikation der Psychoanalyse muß es jedoch vertragen können, daß Menschen individuell und dem sozialen Strom entgegengesetzt denken, handeln und fühlen – ein Ziel, das leichter zu bestimmen als zu erreichen ist.
III
Bisher haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie die von Elias und Weber beeinflußten Forschungsansätze die Konzeptualisierung von Subjektivität in der Frühen Neuzeit dominiert haben. Es gibt aber noch andere Traditionen, die sich, ausgehend von der poststrukturalistischen Diskussion über den Tod des Subjekts, ebenfalls mit der historischen Ausformung von Subjektivität befaßt haben. Das Werk Michel Foucaults, das nachdrücklich die Macht der Sprache und die Bedeutung des Diskurses für die Konstitution des Subjekts betont, hat sich dabei als besonders einflußreich erwiesen.[31] Es hat uns erlaubt, die Konstruktion sexuellen Begehrens durch Sprache im weitesten Sinne zu untersuchen, und uns den Weg geebnet zu einem sehr viel anspruchsvolleren und vielseitigeren Verständnis von Körper und Sexualität.[32] Die Historiker, die sich mit dem 16. und 17. Jahrhundert beschäftigen, bringt Foucaults Werk allerdings in eine etwas verzwickte Lage. Foucault, dessen Projekt die pessimistische Neubewertung des rationalen Vermächtnisses der Aufklärung war, lokalisiert die wesentlichen historischen Übergänge im 18. Jahrhundert.[33] Doch die Ambivalenz, mit der sexuelle Regulative wirken und die Foucault so eindringlich beschrieben hat, kann lange vor dem 18. Jahrhundert festgemacht werden. Die Folge ist, daß von Foucault beeinflußte Historikerinnen und Historiker, deren Epoche die Frühe Neuzeit ist, Methoden von ihm übernehmen, während ihre Darstellung häufig auf einem bei Elias entliehenen historischen Schema beruht.
Selbst Ansätzen, die versuchen, auf Weber oder Elias basierende Subjekttheorien in Frage zu stellen und sich statt dessen kreativ eklektizistisch der Anthropologie oder der Diskurstheorie zuzuwenden, liegt oftmals ein eindeutig kollektives Konzept von Subjektivität zugrunde. Diese kollektive Subjektivität prägt dann das Individuum. Folglich vermißt man hier, wie übrigens auch im Werk Foucaults, die psychische Dimension. Einen besonderen Reiz von Natalie Zemon Davis’ Wahrhaftiger Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre macht die für uns so verwirrende Möglichkeit aus, daß der Schwindler Arnaud du Tilh tatsächlich mit Erfolg als Martin Guerre durchgegangen wäre, wäre nicht der »echte Martin« unerwartet aus dem Krieg zurückgekehrt: Was also ist Identität anderes als die Summe der kollektiven Bezeugungen und Erwartungen der Dorfbewohner?[34] Auch in Robert Darntons Das große Katzenmassaker, das uns Einblick gewährt in die Welt der Handwerksgesellen, ist deren Bewußtsein das Produkt einer Gruppe – merkwürdigerweise eines, das sich nicht aus dem erschließt, was die Gesellen sagen, sondern aus dem literarischen Erzeugnis eines ihrer Gruppenmitglieder. Die halbfiktionale Autobiographie des Nicolas Contat, auf die Darnton sich in seiner Beschreibung des symbolischen Lebens in einer Druckerwerkstatt bezieht, ist, wie Harold Mah dargelegt hat, in hohem Maße literarisch und strukturiert sich um hübsche erzählerische Inversionen herum.[35]
In einer ähnlichen Weise tendiert, glaube ich, die gegenwärtige Begeisterung für die Geschichte der Wahrnehmung – der Zeit, der Sinne, der Materialität des Alltagslebens – dazu, in uns die Überzeugung von der gänzlichen Andersartigkeit der Vergangenheit zu festigen; sie gestattet uns überdies, wenn wir über das Bewußtsein der frühneuzeitlichen Menschen nachdenken, die Ebene der Psyche durch jene der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung zu ersetzen. Es scheint, als wüßten wir, sobald wir einmal begriffen haben, daß die Menschen der Frühen Neuzeit in einer visuellen Kultur lebten (was wir nicht tun?) und Geräusche und Gerüche anders wahrnahmen, worin sie sich von uns unterscheiden. Es gibt zur Zeit in Deutschland eine Unmenge von Untersuchungen zum frühneuzeitlichen Alltagsleben (ein Genre, das in der anglo-amerikanischen Geschichtsschreibung praktisch nicht existiert), die die Kultur der »kleinen Leute« anhand der Analyse von Volksritualen und -festen erforschen.[36] Sie versuchen, das »gemeine Volk« wieder in die Geschichte einzugliedern und die Grenzen dessen zu sprengen, was wir Kultur nennen, indem sie über Hochzeiten und Karneval, Klatsch und Tratsch oder über die Einstellung der Menschen zur Zeit und zum Kalender berichten, anstatt über die »hohe« Kultur der Elite allein. Das hat unser Verständnis der Kultur der Frühen Neuzeit immens bereichert und uns geholfen, in unserer Vorstellung die sinnliche Wahrnehmung und die Diskurse der Menschen wiederzubeleben und über Einzelheiten des frühneuzeitlichen Lebens, über Gebrauchsgegenstände und die Gewohnheiten der Menschen nachzudenken.[37] Was allerdings das psychische Leben der Menschen angeht, laufen diese Studien Gefahr, ein Bild von urtümlichen Charakteren ein und desselben einfachen Gemüts zu entwerfen, eine Geschichte, die Psychisches durch Sinnliches ersetzt und damit auch eine Geschichte, die, ihrem Vorsatz entgegenlaufend, gelegentlich Züge einer historischen Herablassung gegenüber dem »Volk« trägt.
Ein Großteil der von Foucault beeinflußten Literatur dagegen, die für sich ein Interesse am Individuellen und Atypischen reklamiert, betrachtet die Psychoanalyse als eine weitere regulative Darstellungsweise unter anderen, als einen Diskurs, der durch eine bestimmte Verkettung von Entwicklungen des späten 19. Jahrhunderts entstand und aufgrund der neuartigen Faszination, die die Sexualität ausübte, nur einen weiteren Wirkungsbereich der Macht begründete. Die Überzeugung, daß die Psychoanalyse deshalb nichts über die vorfreudianische Welt zu sagen hätte, ist in der Geschichtswissenschaft, die sich mit der Frühen Neuzeit befaßt, sehr fest verankert.[38] Selbst wenn einmal die Psychoanalyse herangezogen wird, um die trüberen Gewässer der Renaissanceschriften zu ergründen, tut man dies durchdrungen von der poststrukturalistisch gefärbten Überzeugung vom Tod des Subjekts, um Historizität zu gewährleisten. Daher beruht in Stephen Greenblatts Arbeiten Subjektivität auf Artikulation. Greenblatt zufolge ist die Sprache nicht das Medium des Selbst, sondern sie ist der Stoff, aus dem das Selbst besteht, und ihre Durchlässigkeit für Konvention und Macht bildet das Prisma dessen, woraus sich das Selbst nie befreien kann.[39] In einem glänzenden Aufsatz legt Greenblatt dar, daß die Psychoanalyse auf einer bestimmten Ebene einen Begriff des Selbst voraussetzt, welcher der Renaissancekultur schlicht nicht vertraut war, und daß konsequenterweise die Psychoanalyse selbst von dem Abstand zeugt, der uns vom frühneuzeitlichen Verständnis des Selbst trennt.[40] Mit anderen Worten, wir wissen, daß wir es mit frühneuzeitlichen, historischen Subjekten zu tun haben, weil sie kein Konzept des Individuellen vorweisen können – darin besteht die historische Distanz zu ihnen –, und dennoch ist es die poststrukturalistische Kritik des Subjekts und der Psychoanalyse, auf die man sich beruft, um das zu beweisen.
In der Tat könnte man denken, dies mache die Andersartigkeit der frühneuzeitlichen Welt aus: das Nichtvorhandensein eines Konzeptes des individuellen Selbst und statt dessen ihre charakteristische kulturelle Kollektivität. Symbole, Rituale, kollektives Zusammenwirken – sie sind das Rüstzeug des Historikers der Frühen Neuzeit. Das Zurateziehen der Anthropologie, die es uns erlaubt, das Exotische dieser Gesellschaft herauszustellen, bringt uns in die seltsame Lage, einerseits rational die Andersartigkeit dieser Welt zu erfassen, während wir zugleich eine schriftliche Garantie für die Modernität unseres eigenen Zeitalters in den Händen halten. Dies ist natürlich ein Zirkelschluß. Die Mittel, mit deren Hilfe wir die Gesellschaft interpretieren, gestatten es uns gleichzeitig, alles ins Reich des »Vormodernen« zu verbannen, was uns an der frühneuzeitlichen Gesellschaft (ver)stört, und uns dennoch auf das Konzept von der Eigentümlichkeit der Frühmoderne zu berufen, um die Anwendbarkeit psychischer Kategorien abzustreiten. Die Folge ist, daß die Menschen der Frühen Neuzeit mit Rüschen und Latzen herausgeputzte Marionetten zu werden drohen, deren Subjektivität uns weder zu überraschen noch zu erschüttern vermag.
Gleichzeitig bereitet der »literary turn« der Kulturgeschichte ganz eigene Probleme. Es ist bezeichnend, daß Greenblatt in Renaissance Self-Fashioning, einem der ausgefeiltesten Portraits frühneuzeitlicher Subjektivität, die wir besitzen, nur über Männer zu schreiben weiß – ein Vorgehen, das sich zwangsläufig ergibt aus seinem Verständnis von Selbst-Identität als etwas, das durch das geschriebene Wort ausgedrückt werden kann. Doch das Europa der Frühen Neuzeit war noch eine orale Kultur, eine Kultur, die, wie die Arbeiten von Norbert Schindler zeigen, auch für Bauern, Bettler und Vagabunden eine Unmenge komplexer Ausdrucksformen und kultureller Kreativität bereithielt. In einem außerordentlichen Aufsatz über Spitznamen gelingt es Schindler, den unbarmherzigen Einfallsreichtum einer oralen Kultur, mit dem die Wesensmerkmale einer Person publik gemacht wurden, zum Leben zu erwecken. In einer Rekonstruktion der geistigen Welt jugendlicher Salzburger Bettler, die der Hexerei bezichtigt wurden, zeigt er, wie die unerreichbaren Sehnsüchte eines der Bettler sich in den Phantasien von einem Zaubererjackl ausdrückten, der die tiefsten Wünsche des Jungen erfüllte, indem er ihn Lesen, Schreiben und Schießen lehrte.[41]
Die literarische Kultur war außerdem vornehmlich eine männliche Kultur. Selbst wenn wir beispielsweise die geistige Welt der Bauersfrau Bertrande de Rols, der Gattin von Martin Guerre, zu rekonstruieren versuchen, müssen wir uns auf den Text eines männlichen Richters, Jean de Coras, verlassen, der beschloß, über den Fall zu schreiben. Seine eigentümlichen und vielschichtigen Reflexionen über die Gewißheit und über die Natur der weiblichen Treue erweisen sich letztlich als fesselnder und feinsinninger als die Subjektivität der unergründlichen Bertrande selbst. Entgegen all unseren Intentionen ist das Weibliche wieder einmal insofern interessant, als es erhellt, wie die Männer darüber dachten.[42]
Überlegungen zum ausgesprochen kollektiven Wesen der Kultur der Frühen Neuzeit und ihrer Unvertrautheit mit unserem Begriff von Persönlichkeit erklären zu einem gehörigen Teil die Zögerlichkeit, die die Historikerinnen und Historiker der Frühen Neuzeit im Umgang mit der Psychoanalyse an den Tag gelegt haben. Die Psychoanalyse, so heißt es häufig, sei ein Produkt des 19. Jahrhunderts, eine Welt, die geprägt sei von der für den gehobenen Wiener Mittelstand typischen Kleinfamilie. Doch die Argumentation macht außer dem jungen Datum der Theorie noch etwas anderes geltend: »Familie«, wie wir sie kennen, das Unbewußte und die Individualität seien so grundlegend verschieden, daß die Anwendung psychoanalytischer Kategorien in toto und von vornherein ausgeschlossen sei. Folglich zielt das Argument, die Psychoanalyse sei für die Erforschung frühneuzeitlicher Gesellschaften nicht brauchbar, ins Herz dessen, was das Studium der Frühen Neuzeit ausmacht.
Es berührt das Wesen unseres Forschungsgebietes selbst. Es hat Auswirkungen auf das Ausmaß historischen Wandels, die Vorstellung vom Subjekt, die Rolle von Religion und Ritual – kurz: Es rechtfertigt die Ablehnung, Begriffe wie »Familie« und »Individuum« auf die frühneuzeitliche Welt zu übertragen. Dagegen sind in den folgenden Aufsätzen genau dies die Begriffe, zu deren Gebrauch ich mich gedrängt sah, um ein Verständnis der frühneuzeitlichen Menschen zu ermöglichen, das mehr leistet, als sie wie psychische Primitive einer karnevalesken Welt zu behandeln, und das individuelle Subjektivität ernst genug nimmt, um sich der schwierigen Frage stellen zu können, was denn nun genau das Historische an der Subjektivität sei.
In diesem Sinne unterscheidet sich dieses Buch in seinem Vorhaben etwas von der Form, in der die Psychoanalyse schon häufiger angewandt worden ist. Wendet man die Psychoanalyse bei Diskursanalysen in der Geschichte an, gleicht die Beziehung zwischen beiden meist mehr einem Flirt als einer Ehe. Sprachliche Analyse wird mit psychoanalytischen Sichtweisen kombiniert, um das Bild von der menschlichen als einer kontingenten und sich mit der Sprache verändernden Persönlichkeit zu untermauern. Das Problem ist dabei, daß es bislang keine überzeugende psychologische Erklärung gibt, warum diese kontingenten Veränderungen just in der Form vonstatten gehen, in der sie es tun: Die Erklärungsmodelle der Psychoanalyse werden einfach außer acht gelassen. Von Anbeginn ihres Selbstverständnisses als Wissenschaft hat die Psychoanalyse für sich beansprucht, universell die menschliche psychologische Funktionsweise erklären zu können. Daher scheint sie mit jedwedem historischen Verständnis von Subjektivität unvereinbar zu sein.
Um das Problem noch einmal zusammenzufassen: Auf der einen Seite ist die Psychoanalyse selbst ein veraltetes, historisches Produkt des 19. Jahrhunderts, auf der anderen Seite macht sie universalistische Erklärungsansprüche für die psychologische Funktionsweise des Menschen geltend, die dem Studium der Geschichte zuwiderzulaufen scheinen. Trotzdem, glaube ich, können wir uns diesem scheinbaren Dilemma entziehen. Alle Theorien haben ihre Geschichte, und die Psychoanalyse verändert sich ebenso fortwährend wie der Marxismus, ein weiteres Kind des 19. Jahrhunderts. Es bedeutet keine Gefahr für den Status des Historischen, wenn man sich eingesteht, daß es Aspekte der menschlichen Natur gibt, die fortdauern, ganz wie auch einige Aspekte der menschlichen Physiologie konstitutiv sind.[43] Das Schwierige daran – und dies ist ebenso Gegenstand einer Debatte innerhalb der Psychoanalyse selbst – ist zu spezifizieren, was genau an der Subjektivität historisch sei. Was ich vermeiden möchte, ist eine entwicklungstheoretische Darstellung kollektiver Subjektivitäten, die aus Individuen lediglich Beispiele für eine Beschreibung kollektiven historischen Fortschritts macht. Dieses Unternehmen unterscheidet sich von anderen Anwendungsformen der Psychoanalyse darin, daß ich die Erklärungsmodelle der Psychoanalyse ernst nehmen möchte, so daß bedeutungsvolles Verhalten und individuelle Subjektivität unter besonderen historischen Umständen erklärbar werden könnten.
IV
Vielen feministischen wie nicht-feministischen Historikerinnen und Historikern schien es so, als sei die Geschlechtlichkeit [gender] jene Kategorie, durch welche die Geschichte der Frauen das Potential erhalten könnte, sich die Geschichtswissenschaft nicht nur als ein respektables historisches Gebiet zu erobern, sondern auch die historischen Darstellungen selbst neu zu gestalten. Das Axiom, daß Geschlechtsidentität [gender identity] nicht etwas biologisch Gegebenes, sondern ein historisches Produkt sei, wirkte ungemein befreiend: Die Aufgabe der Historiker war es nun, die genaue historische Bedeutung von Männlichkeit und Weiblichkeit in der Vergangenheit freizulegen und so die Bedeutung dieser Konstrukte in der Gegenwart zu relativieren. Wir konnten zum Beispiel zeigen, daß sich die Männer der Frühen Neuzeit an Mode und Kleidung ergötzten, daß die mittelalterlichen Frauen in fast allen Wirtschaftsbereichen arbeiteten und daß das Mutter-Kind-Verhältnis zu einer Zeit, da die Kinder Ammen überlassen wurden, eine andere Form von Beziehung gewesen sein muß als die, die wir heute darunter verstehen.
Gleichzeitig verlangte die Anthropologie der frühneuzeitlichen Gesellschaften förmlich nach der Einbeziehung einer weiblichen Perspektive. Man braucht sich nur einen klassischen Text wie jenen von Clifford Geertz über den balinesischen Hahnenkampf anzuschauen, um sich mit der Abwesenheit von Frauen aus dem Theater der Kultur konfrontiert zu sehen.[44] Die Beschränkung der Frauen auf Statistenrollen rüttelt uns auch deshalb auf, weil die Diskurstheorie, die Vorstellungen der Psychoanalyse von Männlichkeit und die Anthropologie zu einem nahtlosen Ganzen miteinander verwoben zu sein scheinen. Die meisten Darstellungen von Volkskultur sind in Wirklichkeit Darstellungen einer Männerkultur, Rituale des Freiens und Werbens in jeweils anderer Gestalt. Das Aufbegehren, zu dem diese Ausgrenzung führte – um so heftiger, als sie ein Spiegel der Gesellschaft ist, die diese Kultur hervorgebracht hat – hatte einige wirksame feministische Rekonstruktionsarbeit zur Folge. Die Feministinnen waren nun außerdem in der Lage, auf einer Kulturanthropologie bestehen zu können, die die Frauen mit einbezieht. Aber wie soll das geschehen?
Dieses Problem ist sehr tiefgreifend, und seine Ursprünge wurzeln in der Kulturgeschichte selbst. Weil der Kulturgeschichte daran gelegen war, sich einen einheitlichen Forschungsgegenstand zu schaffen, neigte sie natürlich dazu, Kultur als etwas Uniformes, etwas Gemeinsames einer bestimmten und begrenzten Gruppe anzusehen. Das gilt ebenso für Sebastian Francks wunderbare Ethnographie regionaler Identität aus dem 16. Jahrhundert[45] wie für die Arbeiten der großen Kulturgeschichtler und Soziologen des 19. Jahrhunderts. Es ist kein Zufall, daß »Gemeinschaft«, dieser kaum in andere Sprachen zu übersetzende Begriff für kulturelle und kommunale Identität, von so großer Bedeutung für die Versuche des 19. Jahrhunderts gewesen ist, vormoderne Gesellschaften zu begreifen, und daß sich der ebensoschwer faßbare Begriff »Gemeinde« aus dem 16. Jahrhundert, in seiner Bedeutung schillernd zwischen Kirchenversammlung, kommunaler Einheit und einer Gruppe von Subjekten, im Bauernkrieg als so einflußreich und mobilisierend erwies.[46] Doch fast immer stammen die maßgeblichen Ideen dieser gemeinsamen Kultur von Männern. Frauen haben zu dieser Kultur entweder als eine kulturelle Ressource oder aber als Schöpferinnen einer separaten, weiblichen Kultur Zutritt. Diese zweite Sichtweise unterminiert jedoch die Vorstellung von Kultur oder Sprache als etwas einheitlich Ganzem und bringt die Grundlage ins Wanken, auf der das Projekt einer Kulturgeschichte gründen könnte.
Als die sogenannte neue Kulturgeschichte mit der Vorstellung von einer linearen Darstellungsweise brach und die Einheit der Kultur aufsprengte, schien sich der feministischen Geschichtswissenschaft ein neuer Raum zu öffnen. Wenn unser kulturelles Erbe zwangsläufig fragmentarisch war und man die Fiktion von einer einheitlichen Kultur aufgeben konnte, dann war den Frauen eine Stimme in der Geschichte sicher. (Paradoxerweise basiert selbst ein Teil der neuen Kulturgeschichte letztlich auf der Annahme einer kulturellen Einheit, indem sie von einer gemeinsamen Natur der Sprache ausgeht. Diese Lösung ist – auf einer anderen, schwerer zugänglichen Ebene – ein schlichtes Replikat des Problems, in welcher Beziehung Frauen zur Kultur stehen.[47]) Für die feministischen Historikerinnen waren die Verlockungen der Kulturanthropologie und der Diskurstheorie die ordnende Kraft. Wenn die Geschlechtlichkeit [gender] durch den Diskurs oder durch soziales Verhalten und Interaktion erst geschaffen werde, dann wäre die Geschlechterdifferenz ihrem Wesen nach historisch und damit etwas, das man ändern könnte. Das Konzept der Geschlechtlichkeit [gender] erschien den Feministinnen folglich wie eine Verheißung, Zugang sowohl zur historischen Anthropologie als auch zur Diskursgeschichte finden zu können. Joan Scotts Aufsatz aus dem Jahre 1985 bekräftigte mit Nachdruck, daß Geschlechtlichkeit [gender] nicht nur tatsächlich eine historische Kategorie sei, sondern überdies auch eine Kategorie der historischen Analyse.[48] Der Dekonstruktivismus erlaubte den Feministinnen, mit den Umkehrungen und Aufhebungen, verborgenen Bedeutungen und endlosen Widersprüchen der Geschlechterdifferenz zu jonglieren – als ob die Geschlechterdifferenz nun kein Gefängnis mehr sei, aus dem ein Entkommen nicht möglich ist, sondern ein ätherischer Stoff, ein unentwegtes Spiel von Licht und Schatten, an dem der Geist sich erbauen kann.
Historisch angewandt, neigt die Dekonstruktion jedoch dazu, ihre eigenen Tricks und Paradoxa zu vervielfältigen. Die Widersprüchlichkeiten von Weiblichkeit im 16. Jahrhundert ähneln auf unheimliche Weise jenen im 20. Jahrhundert. Und tatsächlich äußert Joan Scott selbst sich nur aufreizend vage darüber, in welchem Sinne »Geschlechtlichkeit [gender]« nun tatsächlich eine historische Kategorie sei. Denn während wir inzwischen gelernt haben, die Auswirkungen der Geschlechtlichkeit [gender] in der Politik, im Krieg und in der Wirtschaftsgeschichte – all jenen historischen Feldern also, von denen man einst annahm, sie seien ausschließlich der männlichen Geschichte vorbehalten – zu erkennen, ist weniger klar, wie sich die Geschlechtlichkeit [gender] selbst auf den historischen Wandel auswirkt. Statt dessen machen wir Anleihen bei den auf Staat und Klasse basierenden Darstellungen historischer Veränderungen und lassen offen, welchen kausalen Unterschied die Frage nach der Geschlechtlichkeit [gender] macht. Die Geschlechtlichkeit [gender] erscheint oftmals als eine Art Notenschlüssel, durch den die alten und vertrauten historischen Lieder in höhere oder tiefere Lagen transponiert werden: die Melodie bleibt jedoch dieselbe.
Wenn Geschlechtlichkeit [gender] eine soziale Erklärungskategorie sein soll, dann muß damit die Kluft zwischen Diskurs, Gesellschaftsstruktur und dem individuellen geschlechtsbestimmten [gendered] Subjekt zu überbrücken sein.[49] Ebenso, wie kulturanthropologische und diskurstheoretische Erklärungsmodelle der Subjektivität letztlich etwas zu kurz zu greifen schienen, blieb auch die feministische Geschichtswissenschaft aufgrund ihrer symbiotischen Beziehungen zu diesen geistesgeschichtlichen Entwicklungen in den Beschränktheiten jener Begriffe gefangen, die sie kritisierte. In der abschließenden Analyse bleibt die Geschlechtlichkeit [gender] wegen ihres prächtigen diskursiven Farbenspiels eine Kategorie, deren Gehalt sich als schwer faßbar erweist und deren kausale Ansprüche weiterhin Rätsel aufgeben.
Neuerdings lehnen auch Feministinnen die bequeme Orthodoxie der Unterscheidung zwischen Geschlecht und Geschlechtlichkeit ab.[50] Judith Butler hat darauf hingewiesen, daß die sex/gender-Unterscheidung das biologische Geschlecht zu einer Sache der Natur mache, obwohl es ein kulturelles Produkt sei, wobei sie aber einer binären Unterscheidung von Natur und Kultur das Wort redet, die wir hinterfragen müssen.[51] Dieser Schritt beraubt uns Historikerinnen und Historiker des soziologischen Hilfsmittels, das es uns bislang erlaubte, geschlechtliche Identität [sexual identity] als ein historisches und soziales Produkt darzustellen. Es zeigt sich nun, daß jener Teil geschlechtlicher Identität, der einst klar als soziales Konstrukt bestimmt und säuberlich von der »Gegebenheit« des biologischen Geschlechts unterschieden werden konnte, in nichts mehr ein Konstrukt ist als das Geschlecht selbst. Die Geschlechtlichkeit [gender] als soziologische Kategorie ist eine in ihrer eigenen Abgrenzung gefangene Illusion.
Dennoch ist die Geschichtswissenschaft durch den Postmodernismus nicht arbeitslos geworden. Ironischerweise sind die Historikerinnen und Historiker mit ihrer Wissenschaft von großer Bedeutung für die poststrukturalistischen Skeptiker. Denn wenn das Geschlecht, die Person und die geschlechtlichen Identitäten [sexual identities] nicht nur auf der Ebene des Details, sondern als ontologische Kategorien kontingente Schöpfungen sind, dann wird klar, daß es »andere Welten« gegeben haben muß, in denen diese Kategorien nicht entscheidend waren. Die Geschichte scheint sowohl solche möglichen Welten zu kennen als auch erklären zu können, wie wir zu den Kategorien gekommen sind, mit denen wir heute leben. Butlers Schleifung der Begriffe von »Geschlecht« und »Person« erfolgt durch den Nachweis der Kontingenz eben jener Kategorien und ihrer Einbettung in binäre Trennungen, die sie zu kritisieren suchen. Doch die Ironie ihres Standpunktes besteht darin, daß sie auf der historischen Ebene genau dasselbe Muster einführt, während sie darauf abzielt, »die kontingenten Akte, die den Schein einer natürlichen Notwendigkeit hervorbringen, zu enthüllen«.[52] Es gibt ein implizites historisches »vorher« und »nachher«, das definiert wird durch die An- oder Abwesenheit der binären Oppositionen, die ihre Argumentation materialisiert: der Moment, bevor »die Kategorie ›Frau(en)‹, das Subjekt des Feminismus, gerade durch jene Machtstrukturen hervorgebracht und eingeschränkt wird, mittels derer das Ziel der Emanzipation erreicht werden soll«.[53] Die Historikerinnen und Historiker, die sich als Komplizen an der Suche nach den großen Augenblicken der Transformation beteiligen, um damit erzählerische Spannung zu erzeugen – wie baut man schließlich eine packende Geschichte der Emotionen auf, wenn es keine Epochen gibt, um die herum man seine Kapitel anordnen kann? –, greifen oftmals auf die alten Hüte zurück: Renaissance, Reformation oder Absolutismus müssen als Erklärung für den Wandel herhalten. Das Problem solcher Arbeiten liegt darin, daß aus dem Historischen allzuviel abgeleitet werden soll. Daß eine Unterscheidung in verschiedenen historischen Epochen unterschiedlich aussieht, bedeutet nicht, daß sie vollständig kontingent ist. Die Geschichte spielt eine zu große und doch zu kleine Rolle in solchen Arbeiten: zu groß, weil das Ausmaß menschlicher Veränderung überbetont wird, und zu klein, weil die Betonung der diskursiven Schaffenskraft die Subjektivitäten allzusehr vereinfacht und die Reichweite und Komplexität historischer Determinanten verkürzt.
Die Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht und Geschlechtlichkeit [gender] aufzugeben, hat sicherlich Vorteile mit sich gebracht. So gibt es inzwischen Untersuchungen der Geschichte des biologischen Geschlechts selbst. Thomas Laqueur hat dargelegt, daß bis zum 18. Jahrhundert ein eingeschlechtliches Modell des Körpers dominierte, in dem die Geschlechterdifferenz eine Frage der Abstufung und nicht zweier eigenständiger Geschlechter war.[54] Dies ist eine beeindruckende Syntheseleistung, die unsere grundlegendsten Annahmen über die Natürlichkeit der Unterscheidung zwischen den Geschlechtern ins Wanken bringt. Doch was Laqueur tatsächlich beschreibt, ist der Diskurs der medizinischen Theorie. Es spricht nichts dafür, daß die Menschen der Frühen Neuzeit ihren Körper mittels einer solchen Theorie verstanden. Ihre Kultur basierte vielmehr auf einer sehr tiefgreifenden Wahrnehmung geschlechtlicher Differenz als einem ordnenden Prinzip von Kultur – in Religion, Arbeit, Magie und Ritual. Es ist sehr viel einfacher, den literarischen Diskurs über geschlechtliche Differenz zu untersuchen, als zu ergründen, welchen Begriff die Menschen der Frühen Neuzeit tatsächlich von Geschlechterdifferenz hatten, weil solche Strukturen nicht vollständig bewußt und mit derselben Klarheit artikuliert werden können wie eine medizinische Theorie. Randolph Trumbach hat sich argumentativ für das sich rapide wandelnde Wesen der Beziehung zwischen den Kategorien von Geschlecht und Geschlechterdifferenz eingesetzt: Die Londoner des 18. Jahrhunderts, behauptet er, hätten ein Modell mit drei biologischen Geschlechtern – Mann, Frau, Hermaphrodit – und drei Geschlechtlichkeiten [genders] gehabt, von denen die dritte, »illegitime«, die des »erwachsenen, passiven, transvestitischen, weibischen Mannes oder Weichlings« gewesen sei, »der angeblich ausschließlich Männer begehrte«. Im späten 19. Jahrhundert habe es zwei biologische Geschlechter und vier Geschlechtlichkeiten [gender roles], »Mann, Frau, homosexueller Mann und lesbische Frau«, gegeben.[55] In einem Großteil solcher Literatur wird geschlechtliche Identität [sexual identity] zu einer Art Maskerade, der die Epoche der Frühen Neuzeit als Bühne dient: Als habe der Umstand, sich im frühneuzeitlichen Europa im Besitz einer geschlechtlichen Identität [sexual identity] zu befinden, bedeutet, an einer nicht endenden »cross dressing«-Party teilzunehmen. Und tatsächlich werden durch fadenscheinige Taschenspielertricks Transvestiten und Transsexuelle oft als Beispiele herangezogen, wenn sich die Historikerinnen und Historiker Gedanken über das Problem individueller Subjektivität im Europa der Frühen Neuzeit insgesamt machen.[56]
Die Herausforderung, die die Geschichte des Körpers für die Diskurstheorie darstellt, besteht darin, daß sie den diskursiven Kreationismus mit dem Physischen konfrontiert, mit einer Realität also, die nur teilweise eine Frage der Sprache ist. So gelingt es zwar beispielsweise Londa Schiebinger mit ihrer faszinierenden Darstellung der Entwicklung der anatomischen Wissenschaft im 18. Jahrhundert zu zeigen, wie Vorstellungen von Geschlechtlichkeit [gendered notions] sich in die verschiedene Wahrnehmung von Unterschieden des Skeletts einschrieben, und doch fragt man sich, ob es nicht tatsächlich auch Unterschiede zwischen den Skeletten der beiden Geschlechter geben könnte, die nicht das Produkt der Wissenschaft des 18. Jahrhunderts sind.[57]
Natürlich stimmt es, daß wir den Körper durch eine Reihe von Mittelbarkeiten wahrnehmen, und die Versuchung ist groß, so zu tun, als gäbe es nichts anderes als den historisch konstruierten Körper, weil uns daran gelegen ist, die Konstruiertheit von Körperwahrnehmung zu unterstreichen. Unsere eigene Terminologie ist dabei keine Hilfe: »der Körper« ist schließlich in sich eine irritierend unkörperliche Abstraktion.
Geschlechterdifferenz ist weder etwas rein Diskursives noch etwas ausschließlich Soziales. Sie ist auch etwas Physisches. Der Preis für die Flucht vor dem Körper und der Geschlechterdifferenz zeigt sich in dem, worüber ein Großteil der feministischen historischen Literatur zu schreiben für unmöglich befunden hat – oder vielmehr: in dem leidenschaftlichen Ton der theoretischen Arbeiten, die am stärksten auf dem radikal konstruierten Wesen der Geschlechterdifferenz beharren. In meiner eigenen Arbeit ist diese Lücke am augenfälligsten in dem ältesten der hier publizierten Aufsätze über »›Wille‹ und ›Ehre‹«. Er befaßt sich mit der sozialen Konstruktion von Geschlechtlichkeit [gender] durch Sprache und soziale Praxis – doch seine Quellen erzählen eine andere Geschichte über den Schmerz und die Wonnen der Liebe. In seinem Kern ist etwas abwesend: der Körper. Wie kann es eine Geschlechtergeschichte geben, die sich nur mit Sprache beschäftigt und den Körper ignoriert?
Ich glaube nicht, untypisch gehandelt zu haben, als ich der Weiblichkeit zu entkommen suchte, indem ich mich, um den Körper zu meiden, in die rationalen Gefilde des Diskurses zurückzog. Der Schmerz, die Frustration und die Wut, dem Geschlecht anzugehören, das noch nicht einmal eine eigene Geschichte hat und so oft in welchem intellektuellen Kontext auch immer eine Außenseiterrolle spielt, waren eine Verlockung, Geschlechterdifferenz schlechthin abzulehnen – oder jedenfalls zu versuchen, sich seine eigene geschlechtliche Identität [sexual identity] ganz so zu schaffen, wie man sie sich wünscht. Das ist eine hochfahrende Utopie. Wie Barbara Taylor gezeigt hat, gründen ihre Wurzeln in den ersten Anfängen des Feminismus, beispielsweise in der leidenschaftlich ambivalenten und sogar frauenfeindlichen Rhetorik von Mary Wollstonecraft über die Verfehlungen »systematisch wollüstiger« Frauen.[58] Diese Utopie ist auch eine umwälzende kreative Kraft, die es sowohl Männern als auch Frauen ermöglicht hat, neue Wege in der Ordnung der Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu finden und neue Handlungsräume für Frauen und Männer zu erschließen. Wenn die Utopie jedoch intellektualisiert wird und ihren imaginativen Bezug zur Gegebenheit des Körpers verliert, bezahlt man dafür einen hohen Preis. Wir brauchen ein Verständnis von Geschlechterdifferenz, das das Körperliche einschließt, anstatt es zu bekämpfen.
V
Diese Bedenken sind Voreingenommenheiten unserer Tage, ja eines ganz bestimmten Augenblicks in der Geschichte des Feminismus, da es Abschied zu nehmen galt von einigen Illusionen darüber, was neu und anders gemacht werden könnte. Aber es sind auch Themen, mit denen sich die Menschen der Frühen Neuzeit leidenschaftlich auseinandersetzten. Die Reformation, ich habe an anderer Stelle darauf hingewiesen, bezog einiges an Kraft aus ihrer moralisierenden Rückbesinnung auf einen älteren, auf dem Haushalt basierenden Utopismus, der eindeutig die Rollen von Männern und Frauen, von Alt und Jung bestimmt hatte.[59] Die Protestanten setzten das Thema Körper mit Vehemenz auf die Tagesordnung, indem sie den Geistlichen erlaubten und sie dazu ermutigten, zu heiraten und ihren eigenen Haushalt zu gründen. War Heiligkeit unvereinbar mit Sexualität? Wenn der Körper Gottes Schöpfung war, welche Sünde verband sich mit Sexualität in der Ehe? Worin bestanden die unterschiedlichen Pflichten von Männern und Frauen? Die erste Generation der Reformatoren sah sich mit der Frage der Geschlechterdifferenz in ihrem täglichen Leben konfrontiert, und die Bibliotheken waren nicht dafür gemacht, sich eine Vorstellung davon zu verschaffen, was es bedeutete, als Geistlicher verheiratet zu sein. Es war keineswegs so, daß die Geistlichen ohne Frauen gelebt hätten oder nicht sogar den zweifelhaften Ruf genossen, Frauenhelden zu sein – ganz im Gegenteil. Doch die Ehe bedeutete, daß die erste Generation der protestantischen Geistlichen sich bewußt und artikuliert mit der Geschlechterdifferenz arrangieren mußte. Folglich wurde die Geschlechterdifferenz ausdrücklich zu einem Thema in ihren Gesprächen und Schriften, manchmal sogar in einem entwaffnend konkreten Sinne, wie in der Beschreibung des Ungemachs – so beispielsweise Luthers Erschrecken über ein Paar Zöpfe neben sich im Bett[60] –, welches das Zusammenleben mit dem anderen Geschlecht mit sich bringt. Die Geschlechterdifferenz war natürlich alles andere als ein neues geistesgeschichtliches Thema, doch mußten die protestantischen Geistlichen jetzt für ein Schrifttum über das Frausein und die Heirat sorgen, das mehr leistete, als die Frauen lediglich mit Eva und sexueller Versuchung gleichzusetzen. Der Ehestand machte es erforderlich, mit der Geschlechterdifferenz ein Auskommen zu finden – so schwer es war, das mönchische Erbe des Argwohns gegenüber der Sexualität auszuschlagen, das noch immer seine Schatten auf ihre Schriften warf.
Worin bestand der Unterschied zwischen den Geschlechtern? Es wäre verlockend, Luthers Sicht der Frauen als das leere Gerede eines besonders fanatischen Patriarchen abzutun und den Protestantismus als Erben seines starren sexuellen Konservatismus anzusehen. Doch das würde bedeuten, den ganz eigentümlichen Ton des frühprotestantischen Verständnisses von Geschlechterdifferenz und Körper zu überhören und seinen Utopismus nicht zu erfassen. Für Luther, dessen irdische Rhetorik noch immer von einer atemberaubenden Kraft ist, war geschlechtliche Differenz etwas Materielles, der Stoff, aus dem der Körper ist. So sagt er in einem Abschnitt, der einen Platz in jeder Anthologie über Frauenfeindlichkeit verdient hätte:
Männer haben eine breite Brust und kleine Hüften, darum haben sie auch mehr Verstandes denn die Weiber, welche enge Brüste haben und breite Hüfter und Gesäss, dass sie sollen daheim bleiben, im Hause still sitzen, Kinder tragen und ziehen.[61]
Die Geschlechterdifferenz ist eine natürliche Tatsache, Gottes Schöpfung, und sie diktiert den Frauen ihr Schicksal: eins ergibt sich aus dem andern so unmittelbar, daß es kein symbolisches Zwischenreich gibt. Frau und Haus gehören nicht metaphorisch zusammen, sondern als Tatsache. Für Luther ist der Kern des Frauseins die Mutterschaft, eine Gleichsetzung von solcher Überzeugtheit, daß er schon 1520 den Vorschlag machte, eine Frau, die von ihrem Mann keine Kinder bekomme, sollte das Recht haben, mit einem anderen zu schlafen.[62]