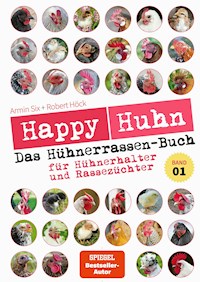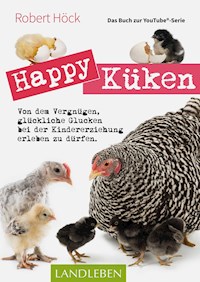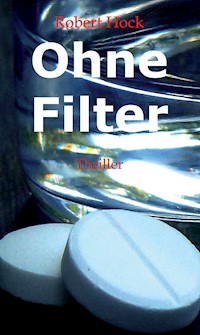
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Weil Alex Farwick gerne in den Abgründen anderer wühlt, arbeitet er gelegentlich als Detektiv. Als Sara Klee ihn beauftragt, den vermeintlichen Selbstmord ihres Sohns zu untersuchen, überschlagen sich die Ereignisse. Plötzlich scheinen Dinge zusammenzugehören, die zunächst nichts miteinander zu tun hatten: seltsame Unfälle, unerklärliche Amokläufe und das autistische Verhalten einiger Psychiatriepatienten. Um die vielen Rätsel zu lösen und den roten Faden zu finden, der sich durch alles hindurchzieht, benötigt Alex die Hilfe seiner Freunde Marc und Susanne und ihre Erfahrungen als Molekularbiologen. Doch je näher sie durch ihre Recherchen der Wahrheit kommen, desto tiefer geraten sie in einen unheimlichen Sumpf aus Verbrechen und Gier. Als schließlich eine dubiose Pharmafirma und der amerikanische Geheimdienst ins Spiel kommen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. "Erschrocken und verwirrt hielt er sich beide Ohren zu und schrie so laut er konnte, um all die Geräusche durch nur eines zu ersetzen. Seine Augen waren vor Entsetzen aufgerissen, als er realisierte, dass es keinen Augenwinkel und keinen Blickfokus mehr gab. Er sah alles gleichzeitig. Ohne Filter."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
www.tredition.de
Der Autor
Robert Hock wurde 1961 in Aschaffenburg geboren. Er studierte Biologie und ist habilitierter Zell- und Entwicklungsbiologe. Robert Hock lebt heute in Eisingen und arbeitet an der Universität Würzburg.
Die Handlung und die Personen des vorliegenden Romans sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen ist rein zufällig. Die Verwendung von Namen bestehender Institutionen, Einrichtungen oder Unternehmen ist schöpferisches Stilmittel. Der Autor hat zahlreiche Quellen für die Recherche genutzt und beabsichtigt keine persönlichen Ansprüche verletzen zu wollen.
Ohne
Filter
Robert Hock
Thriller
www.tredition.de
© 2014 Robert Hock
Umschlaggestaltung, Illustration:
Robert Hock
Lektorat, Korrektorat:
Maria-Elisabeth Rudolf, Lektorat Schusterjunge
(www.lektorat-schusterjunge.de)
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
978-3-8495-8746-8 (Paperback)
978-3-8495-8747-5 (Hardcover)
978-3-8495-8748-2 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Ungewöhnliche Ereignisse
1
Als Florian Bohn vor der Kühltheke im Supermarkt stand, überkam ihn wie aus dem Nichts ein beängstigendes, fremdartiges Gefühl. Als ob Wasser über ihn gegossen würde, durchlief ihn eine heiße Welle vom Kopf ausgehend bis in die Füße. Sein Blick war starr nach vorne gerichtet und seine Hände krallten sich an seinem halb gefüllten Einkaufswagen fest. Das Letzte, das er gezielt wahrnahm, war eine echohafte Stimme – »Sie wünschen?« – und aus dem Augenwinkel das beharrliche Flackern einer Neonröhre. Wie ferngesteuert drehte er seinen Kopf zu dem flackernden Licht. Kurzzeitig war alles, was er eben noch sah, hörte, roch oder fühlte nicht mehr da. Als sich nach wenigen Sekunden der Nebel lichtete, war es ihm unmöglich, einzelne Geräusche zu unterscheiden. Das Gerede anderer Menschen, der Tumult im Supermarkt, die Fragen der Verkäuferin, die mittlerweile drängender wurden, das Öffnen von Regaltüren, schreiende Kinder, das Brummen des Kühlregals.
Erschrocken und verwirrt hielt er sich beide Ohren zu und schrie so laut er konnte, um all die Geräusche durch nur eines zu ersetzen. Seine Augen waren vor Entsetzen aufgerissen, als er realisierte, dass es keinen Augenwinkel und keinen Blickfokus mehr gab. Er sah alles gleichzeitig. Ohne Filter. Die Verkäuferin, die jetzt einen eher ängstlichen Ausdruck bekam, die Blicke anderer Menschen, die er mittlerweile alle auf sich zog, jede Kleinigkeit, die sich in seinem und in den Einkaufswagen der anderen befand, Schilder, Farben, Werbeschriften, Wurst und eine Theke voller Fleisch. Und alles war gepaart und vermischt mit tausenden Gerüchen nach Schweiß, Angst, Parfüms, Cremes, Blut, Öl, Fisch, Käse, Leder, Obst.
Florian Bohn wusste nicht mehr, dass er Florian Bohn war. Seine Sinne lieferten ihm zu viele Informationen und sein Gehirn schien zu bersten. Für alles, was er je gewusst hatte, war plötzlich kein Raum mehr. Schreiend und mit zugehaltenen Ohren ließ er seinen Blick auf der Suche nach Halt hin und her huschen. Die Menschen um ihn herum wichen ängstlich zurück, doch sein Gehirn konnte es nicht mehr wahrnehmen. Sein Körper signalisierte ihm nur eines: Flucht.
Dieses Gefühl stammte nicht aus seinem Kopf, es war ein uralter Instinkt, der immer dann einsetzt, wenn das Gehirn nicht mehr in der Lage ist zu denken. Seine Nebenniere schüttete riesige Mengen Adrenalin aus, das über den Blutkreislauf seinen ganzen Körper überschwemmte. Aus den Leberzellen wurden daraufhin Zuckermoleküle ins Blut entlassen. Genug Energie für eine lange und schnelle Flucht. Sein Herzschlag beschleunigte sich und seine gesamte Muskulatur war bis zum Äußersten angespannt.
Wild um sich blickend und schreiend sprang Florian Bohn, vom metallischen Geruch des Blutes angezogen, über die Fleischtheke, ergriff das Schlachtermesser und hieb mit einer flüssigen Bewegung der Verkäuferin den Kopf vom Rumpf, der auf dem Rinderhack zu liegen kam und mit noch immer aufgerissenen Augen in die Weiten des Supermarktes starrte. Nach kurzem Zittern und Unmengen an ausgepumptem Blut sackte der Rumpf in sich zusammen. Fast gleichzeitig drehte sich Florian Bohn zum heraneilenden Metzgermeister, den er in einer ebenso flüssigen Bewegung von unten bis oben aufschlitzte und der mit herausquellenden Därmen zu Boden sank. Ein irrsinniger Gestank nach Eingeweiden, Blut, Panik und Angst legte sich auf die wie angewurzelt herumstehenden und schreienden Kunden des Supermarktes, als diese sahen, wie Florian Bohn fast beiläufig einen riesigen Fleischerhaken nahm und sich diesen durch die Nase bis in sein pochendes Gehirn stieß.
2
Kurz hinter Aachen, noch in Deutschland, machte Sascha Krubb gerne noch einmal eine Pause. Die Container seines Zweiachsers waren dieses Mal mit Maschinenteilen für England schwer beladen. Er wollte nur kurz an der Raststätte anhalten, um sich etwas zu essen und einen Kaffee zu holen. Es war schon relativ spät und der Verkehr in Belgien würde allenfalls in der Nähe von Brüssel etwas heftiger werden. Er hatte vor, den Fährhafen in Calais in spätestens fünf Stunden zu erreichen. Normalerweise kein Problem. Die Straßen in Belgien waren zwar schlecht, dafür aber zumindest nachts zuverlässig frei. Er fragte sich, ob die für Belgien typische Beleuchtung der Autobahnen mit Straßenlaternen dazu diente, die schlechten Straßenverhältnisse und Schlaglöcher auch nachts erkennbar zu machen.
Sascha kaufte sich zwei Bockwürste mit Brötchen und zwei große Becher Kaffee, die er sich größtenteils in seine Thermoskanne umfüllte und sich einen Schluck zusammen mit einer Zigarette sofort genehmigte. Danach stieg er wie so oft in seinen Brummi, atmete einmal tief durch und bereitete sich mental auf die langweilige, beleuchtete Ruckelfahrt durch Belgien vor. Dem Schengenabkommen sei Dank, würde es keine lästigen Grenzkontrollen mehr geben. Sicherheitshalber hatte Sascha allerdings immer einen Stopp durch mobile Zollbeamte in seiner Fahrzeitberechnung eingeplant. Ein Zeitpuffer musste sein, um nicht durch irgendetwas Unvorhersehbares die Fähre zu verpassen. Meist war er deshalb früher in Calais als nötig. Er wusste, dass er selbst mit langen Fahrzeiten und einer weit im Voraus gebuchten Fähre billiger transportieren konnte als der Containerzug durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal. Sascha war es egal, was er geladen hatte und wohin er es transportierte. In Calais würden die Container auf seinem Aufleger ausgetauscht werden und er würde für die Rückfahrt etwas anderes hinter sich herziehen. Er wusste noch nicht was und es interessierte ihn auch nicht. Sascha war nur der Fahrer bis Calais.
Das langweiligste Stück lag zwischen Brüssel und Brügge. Lauwarmer Kaffee, kalte Bockwurstbrötchen, Zigaretten und die Schlaglöcher hielten ihn wach. Mittlerweile hatten die Belgier nur jede zweite Straßenlaterne angeschaltet. Wahrscheinlich, um Strom zu sparen.
»Prima«, dachte Sascha, als es heftig zu regnen begann. Das Licht der Straßenlaternen wurde jetzt vom nassen Asphalt reflektiert und Sascha musste immer wieder die Augen zukneifen, um nicht geblendet zu werden. Unter diesen Bedingungen zu fahren war anstrengend, aber als Brummifahrer hatte er die nötige Routine. Dennoch wurde er seltsam unruhig und begann zu schwitzen. Immer wieder musste er sich die Augen und die Schläfen reiben. Irgendetwas begann in seinem Kopf zu brummen und ihm wurde seltsam warm. Bei dem Versuch, sich etwas Kaffee in den Becher zu schütten, zitterte er so stark, dass er beschloss, die nächste Raststätte anzufahren. Er war bereits kurz hinter Gent. Sascha verspürte jetzt Angst und hatte das Gefühl, fliehen zu müssen, ohne zu wissen wovor. Die Beleuchtung der Raststätte war schon zu sehen.
Als er sich gerade noch eine Zigarette anzünden wollte, löschte die Flamme des Feuerzeugs scheinbar alles, was er je wusste, aus seinem Gehirn. Dabei fiel ihm die brennende Zigarette auf den Boden. Seine weit aufgerissenen Augen sahen nur noch das sich spiegelnde Licht auf den regennassen Straßen. Gleichzeitig hörte er das Quietschen der Wischblätter, das Prasseln des Regens, den brummenden Motor, das Fahrgeräusch auf der nassen Autobahn, das Radio und die kleine Engelsfigur, die er neben sich aufgehängt hatte und die beständig an die Windschutzscheibe klopfte. Es roch nach Zigaretten, Kaffee, Schweiß, Öl, Metall und Diesel. Seine Augen waren jetzt starr auf die Beleuchtung der Raststätte gerichtet und sein Kopf bewegte sich seltsam zuckend. Sein stumpfer Blick fixierte gerade noch die Ausfahrt zum Rasthof. Dies war das letzte einigermaßen willentliche Erkennen irgendeines Details. Mit aufgerissenen Augen und den Kopf hilflos suchend hin und her werfend, hielt Sascha mit beiden Händen krampfhaft das Lenkrad fest und raste auf die Zapfsäulen der Tankstelle zu.
Da sich Benzin kaum entzündet, wäre es kein größeres Problem gewesen, dass Sascha mit seinem Brummi die Zapfsäulen förmlich abrasierte und das Benzin in Massen ausfloss. Vor Kurzem hatte sich die Rastanlage jedoch Gaszapfstellen zugelegt. Sascha rasierte natürlich auch diese Säulen ab und wäre sicherlich so lange starr geradeaus weitergefahren, wie der Treibstoff im Tank seines Lastwagens gereicht hätte. Das entzündliche Gas explodierte augenblicklich, als es mit Saschas brennender Zigarette in Kontakt kam, die die ganze Zeit auf dem Boden unter seinem Sitz vor sich hin geglimmt hatte.
Die Explosion war gewaltig und noch in großer Entfernung zu spüren. Belgien war jetzt vom Flugzeug aus nicht mehr nur durch die Beleuchtung seiner Autobahnen deutlich zu erkennen. Das explodierende Gas setzte genügend Hitze und Energie frei, um auch noch die Benzintanks zu zünden. Dutzende Menschen verbrannten, wurden in Stücke gerissen oder von Teilen der Maschinen, die Sascha geladen hatte, regelrecht erschossen. Kurz bevor Sascha in die Gaszapfsäulen gerast war, hatte er die Hände vom Lenkrad gerissen, seine Ohren zugehalten und war schreiend dem Inferno entgegengefahren. Das Letzte, das Sascha hätte wahrnehmen können, wenn sein Gehirn nicht schon vorher ausgestiegen wäre, wäre ohnehin nur eine große weiße Fläche gewesen – das Nichts.
3
Martha Löbel machte alles für ihren Sohn. Seit seiner Geburt stand Sven immer im Mittelpunkt, wurde verhätschelt und verwöhnt. Sven entwickelte sich zwangsläufig zu dem, was man mit Fug und Recht als Muttersöhnchen bezeichnen konnte. Er wusste, egal was er tun würde, jede seiner vier Mütter würde zu ihm stehen und ihn aus jeder Schwierigkeit herausholen. Sven wusste, dass er seine Geburt dem berechnenden Verhalten seiner Mütter zu verdanken hatte, die unbedingt ein Kind, aber keinen Mann wollten.
Damals, vor etwas mehr als 24 Jahren, lebte Martha zusammen mit drei anderen Frauen in einer WG im Würzburger Stadtteil Grombühl. Alle WG-Mitglieder hatten zwar gelegentlich Beziehungen zu Männern, aber nur der Abwechslung und des Spaßes wegen. Sie waren der Überzeugung, dass es sich am besten ohne Mann lebte. Da Martha gewillt war, ihre Gene weiterzugeben, beschlossen sie nach langen Gesprächen in der WG, Martha schwängern zu lassen.
Nach mehrmonatigem Suchen hatten sie endlich den geeigneten Befruchter ausgewählt. Ein stattlicher, erfolgreicher, gut aussehender und intelligenter Mann, der zwangsläufig willenlos wurde, als er von vier Frauen gleichzeitig verführt wurde. Der Plan ging auf und Martha wurde schwanger. Der Befruchter wurde kurz nach dem Orgasmus etwas ratlos zurückgelassen und hörte nie wieder etwas von den Frauen.
Die vier beschlossen, das Ereignis mit gebührendem Respekt zu feiern. Da sie wussten, dass ein Kind in naher Zukunft ihre volle Konzentration fordern würde, planten sie eine letzte große Sause und buchten einen mehrwöchigen Urlaub in Kenia. Sie wollten sich dort mit Männern für den Rest ihres Lebens sättigen und diesem Geschlecht dann ein für alle Mal Adieu sagen. Als Sven geboren wurde, strahlten Martha und drei weitere Frauen ein Kind an, das in Zukunft von vier Müttern erzogen werden würde.
Seit zwei Jahren hatte Sven so etwas wie eine Arbeit. Er war Paketfahrer. Seine Mütter hatten ihn gedrängt, doch endlich mal einer Beschäftigung nachzugehen. Die WG als solche existierte zwar nicht mehr und er lebte mittlerweile mit Martha alleine, aber seine Mütter sah er öfter als ihm lieb war.
An diesem Morgen hatte Martha wie immer schon die Brote für Sven fertig, hatte ihm seinen Kaffee in die Thermoskanne gefüllt und den Frühstückstisch gedeckt. Zum Beladen seines Fahrzeugs musste Sven sehr früh aufbrechen. Es war gerade 4.30 Uhr. Martha war bereits die ganze Nacht wach, weil sie eine seltsame innere Unruhe verspürte. Außerdem wurden momentan auf der Straße neben ihrer Wohnung die Straßenbahnschienen saniert. Das pfeifende Geräusch der Schienenschleifmaschine hatte Martha am Einschlafen gehindert.
»Müde siehst du aus, Mutter«, sagte Sven und drückte Martha einen Kuss auf die Stirn.
Fast automatisch antwortete sie: »Heute Abend sind Sara, Christine und Maria da. Sei pünktlich zuhause.«
Unbemerkt blies Sven die Backen auf, zog die Augenbrauen hoch, zuckte dann mit den Schultern und verließ die Wohnung.
Es war Herbst und relativ kühl. Die Schleifarbeiten an den Straßenbahnschienen waren gerade beendet und die orangefarbenen Baufahrzeuge standen am Straßenrand. In wenigen Minuten würde wieder die erste Straßenbahn um die Kurve am Wagnerplatz kommen. Der Wind blies das noch verbliebene Laub von den Bäumen der benachbarten Parkanlage, und die Schienenarbeiter waren froh, die Nachtschicht beenden zu können. Sven bemerkte, wie in ihrer Wohnung im vierten Stock die Jalousien hochgezogen wurden und ihm seine Mutter, wie jeden Morgen, hinter dem Fenster zuwinkte. Eigentlich fand sich Sven mit 24 Jahren etwas zu alt für dieses Verabschiedungsritual und wegen der Bauarbeiter war es ihm dieses Mal ein wenig peinlich.
Als sich die Baufahrzeuge in Bewegung setzten, bekam Sven ein seltsames Gefühl und starrte wie magnetisiert auf das orangefarbene Warnblinklicht, das wieder angeschaltet worden war und die Umgebung rhythmisch in gelbes Licht tauchte.
Sven riss die Augen auf, blickte ruhelos und zitternd umher und schaute fast automatisch und Hilfe suchend zu seiner Mutter hoch. Marthas Herz pochte und ihre Gesichtszüge waren wie gelähmt, als sie Svens ungewöhnliches Verhalten beobachtete. Während Sven zu Martha starrte, verschwand allmählich das Gesicht seiner Mutter und löste sich auf im Haus, in Gebäuden, Fahrzeugen, Himmel und Erde. Sven sah alles und nichts. Er roch die Abgase der Baufahrzeuge, die nassen Straßen, das feuchte Laub und den modrigen Geruch des Herbstes. Neben dem pfeifenden Geräusch des Windes, den brummenden Motoren und seiner schreienden Mutter hörte Sven das Rumpeln der nahenden Straßenbahn, das sich in seinem Kopf zu einem unerträglichen Grollen aufschwang. Die Erschütterungen, verursacht durch die holpernden Wagen, kamen ihm wie ein Erdbeben vor. Voller Entsetzen hielt sich Sven seine Hände an die Ohren. Das Gleiche tat seine Mutter.
Als die Straßenbahn um die Kurve kam, hatte Sven nur noch das Bedürfnis, dieses ratternde Monster aufzuhalten. Mit ausgestreckten Armen rannte er auf die Straßenbahn zu, wurde frontal von ihr erfasst, erschlagen, mitgeschleift und halbiert.
Seine Mutter, die kreidebleich, mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund alles beobachtet hatte, nahm ihre gesamte Energie zusammen und sprang durch die Scheibe des noch geschlossenen Fensters vom vierten Stock nach unten. Marthas Schmerzen des durch die Glasscherben aufgeschnittenen Gesichts waren nur kurz und wurden von dem harten Aufschlag auf dem Asphalt beendet. Inzwischen konnte die Straßenbahn anhalten. Die Bauarbeiter, die alles mit ungläubigen Blicken beobachteten, stellten sich auf eine Verlängerung ihrer Nachtschicht ein.
Die Beerdigung
Obschon November, so war es doch ein goldener Herbsttag, an dem Sven und Martha Löbel beerdigt wurden. Auf dem Würzburger Waldfriedhof zwitscherten die Vögel auf den Bäumen, die nur noch wenige bunte Blätter besaßen. Es war eine einsame Beerdigung, bei der sich die drei verbliebenen, ganz in Schwarz gehüllten Familienangehörigen Sara, Christine und Maria gegenseitig stützten, um die schwerste Stunde ihres bisherigen Lebens gemeinsam ertragen zu können.
Alle drei waren zusammengebrochen, als sie vom Tod ihrer beiden Geliebten erfuhren und sich im Pathologischen Institut der Universitätsklinik in der Versbacher Straße in Würzburg einfinden mussten, um Sven und Martha zu identifizieren. Das zerschmetterte und vom Glas zerschnittene Gesicht von Martha war nur notdürftig wieder hergestellt und Svens Teile zu einem Körper zusammengeflickt worden. Der Anblick und die anschließende Gewissheit, dass es tatsächlich Sven und Martha waren, die dort auf den Seziertischen lagen, ließen Maria in Ohnmacht fallen. Als es ihnen etwas besser ging, schleppten sich die drei Frauen in Marthas Wohnung und weinten sich mit Hilfe mehrerer Flaschen Martini in einen unruhigen Schlaf.
Als sie am nächsten Tag im Bestattungsunternehmen die Beerdigung organisierten, wich zumindest bei Sara und Christine die übergroße Trauer einem Gefühl von Ratlosigkeit und Wut. Diese Gefühle wurden noch stärker, als sie im Polizeibericht die Zeugenaussagen der Stadtarbeiter lasen, die die Szene beobachtet hatten. Wie konnte von der einen Sekunde auf die andere ihr gesamtes Leben zerstört werden? Was hatte ihren geliebten Sven dazu gebracht, sich vor die Straßenbahn zu werfen? Immer wieder schüttelten sie ungläubig ihre Köpfe und verfielen in gemeinsame Weinkrämpfe. Dieser Zustand hielt bis zur Beerdigung an.
Maria dagegen schien sich nicht mehr zu erholen.
Die Beerdigung hatte schließlich Sara organisiert, die von allen dreien noch am besten mit der Situation zurechtkam. »Wir trauern um unsere Geliebten«, hatte sie in einer ganzseitigen Anzeige schreiben lassen. Sara wusste, dass sie seit mehr als 25 Jahren eine nahezu verschworene Gemeinschaft waren. Sie, Christine, Maria, Martha und Sven, ihr gemeinsamer Sohn. Sie hatten kaum jemanden in ihr Leben eindringen lassen und daher erwarteten sie nicht, dass viele Menschen zu der Beerdigung ihrer zwei Familienmitglieder erscheinen würden. Sara engagierte deshalb Trauergäste von einem Bestattungsunternehmen. Lediglich die Mitglieder des kleinen Chors, in dem Martha und Sven gelegentlich gesungen hatten, wären auch uneingeladen gekommen. Sie sangen »Why Worry« von den Dire Straits, »Trouble« von Cat Stevens und »Boulevard of broken dreams« von Green Day – alles Stücke, die Sven und Martha gemocht hatten.
Sara spürte, dass Maria am schlechtesten mit der Situation fertigwerden würde. Seit dem Besuch in der Pathologie und ihrer anschließenden Ohnmacht war sie wie in Trance und musste mit starken Antidepressiva und Beruhigungsmitteln behandelt werden. Sara und Christine mussten sie fast tragen, als sie auf dem Weg von der Aussegnungshalle bis zum offenen Grab hinter den Särgen hergingen. Große Sonnenbrillen und schwarze Kopftücher verbargen ihre blassen, verweinten und wütenden Gesichter. Es war in der Tat eine einsame Beerdigung.
Vielleicht hatten sie sich seit Svens Geburt doch zu sehr abgeschottet? Zumindest Sara gab es zu denken, dass bei der Beerdigung eines 24-Jährigen keine Freunde anwesend waren. Außer einigen Verwandten von Martha, die keine Eltern mehr hatte, waren tatsächlich nur die Chormitglieder, die Sargträger und die bezahlten Trauergäste anwesend, die in respektvollem Abstand warteten, bis Sara, Christine und Maria ihre Blumen und etwas Erde auf die Särge geworfen hatten, um sich damit ein letztes Mal und endgültig zu verabschieden. Als sich die drei weggeschleppt hatten, begann das Bestattungsunternehmen sofort, seine Arbeit zu vollenden und beide Särge wurden vollständig mit Erde bedeckt.
Nur drei Tage nach der Beerdigung nahm sich Maria mit einer Überdosis Tabletten das Leben. Für Sara und Christine war dies allerdings nur ein Nadelstich im Vergleich zu dem, was sie vor knapp zwei Wochen durchmachen mussten. Mit Sven und Martha war ihre Gemeinschaft gestorben. Dass Maria den beiden nachfolgen würde, war eine Möglichkeit, die immer wieder ihre Gedanken gekreuzt hatte. Und irgendwie konnten sie die Gefühle Marias nachvollziehen, die offensichtlich jegliche Kraft verloren hatte.
Sie hatten mit sich selbst zu kämpfen gehabt und konnten Maria in den letzten Tagen wenig Hilfe in ihrem Kummer bieten. Das war der einzige Vorwurf, den sie sich machten. Doch sie kannten Maria auch gut genug, um zu wissen, dass sie nicht wieder aus ihrem Loch herausgefunden hätte. Daher akzeptierten sie den Schlussstrich, den sie gezogen hatte.
Doch die Umstände von Svens Tod nagten auch Tage nachdem sie ihn zu Grabe getragen hatten an ihnen. Allmählich setzte sich die Erkenntnis fest, dass Sven das niemals getan hätte, wenn er nicht von irgendetwas dazu gezwungen worden wäre. Er hätte sich nicht freiwillig das Leben genommen und seinen Müttern solchen Kummer bereitet. Dennoch bedurfte es langer Diskussionen und schlafloser Nächte, bis sie schließlich davon überzeugt waren, dass es Mord war.
Schließlich hielt Christine Sara eine große Anzeige unter die Nase, die sie in der Zeitung gelesen hatte: »Privatdetektiv Alexander Farwick – für die ungewöhnlichen Fälle.«
Der Fall Sven Löbel
Alexander Farwick hatte die Beine auf den Tisch gelegt, eine Tasse Kaffee in der Hand und vor sich auf den Knien lag die Tageszeitung. Er ärgerte sich wie immer über das unhandliche Zeitungsformat und die Schwierigkeit, die Seiten umzublättern. Alex war ein Mensch, der es schaffte, einen ganzen Tag totzuschlagen, ohne dass ein Gefühl der Langeweile oder der Unzufriedenheit aufkam. Ganz im Gegenteil, er war hochzufrieden mit seinem Leben. Hin und wieder arbeitete er als Detektiv oder Journalist. Doch nicht etwa, um damit seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, sondern lediglich, um sich die Zeit zu vertreiben. Alex liebte es, in den Abgründen anderer Menschen zu wühlen.
Alexander Farwick war Anfang vierzig, hatte für die Zukunft ausgesorgt und war finanziell unabhängig. Seine Eltern waren früh gestorben und hatten ihm ein beachtliches Vermögen in Form von Mietshäusern und Ländereien hinterlassen. Als Glückskind, als das er sich immer sah, hatte er auch noch in einer Lotterie eine Sofortrente gewonnen. Er hatte genug Geld zum Leben ohne je wieder arbeiten zu müssen und verstand es vortrefflich, dieses Geld für allerlei Unsinniges auszugeben.
In den letzten Jahren hatte sich sein wildes Leben allerdings etwas beruhigt und Alex bemerkte selbst, dass er deutlich ruhiger und spießiger geworden war. Ab und zu lebte er in einer flüchtigen Beziehung mit einer Frau zusammen, doch meist hielten diese Beziehungen nicht lange. Immer häufiger hatte er sich in seinem Penthouse in Frankfurt eingeigelt und mehr und mehr begonnen, das Leben der anderen von seiner Gartenterrasse aus zu beobachten, als selbst daran teilzunehmen.
Immer öfter verschwand er auch tagelang in einem alten Forsthaus mitten im Spessart, das er sich wohnlich eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet hatte. Schleichend wurde das Forsthaus schließlich zu seiner Hauptwohnung. Vollkommen zurückgezogen. Um wieder Kontakt mit der Welt aufzunehmen, hatte Alex geplant, wieder einmal als Detektiv zu arbeiten und die Welt etwas sicherer oder auch unsicherer zu machen. Er hatte eine Anzeige in verschiedene Regionalzeitungen setzen lassen und wartete nun, bis sich jemand mit einem interessanten Fall melden würde.
An den einsamen Tagen im Wald dachte Alex häufig an die »Guten alten Zeiten« und an seine Freunde aus Studienzeiten. Er hatte seit Langem den Kontakt doch etwas einschlafen lassen. Seinen besten Freund Marc würde er schon gerne wieder einmal treffen. Er wusste aber nicht einmal, wo Marc sich momentan aufhielt. Marc war Molekularbiologe und wechselte oft den Arbeitsplatz. Seinen letzten Vertrag hatte er in Stockholm, wo er am Karolinska Institut untergekommen war. Aber jetzt? Alex hatte keine Ahnung. Seine Gedanken weckten seine Neugier. Er legte die Zeitung weg, setzte sich an seinen PC und begann im Internet nach seinem Freund Marc Lebois zu suchen.
Meist hatten Wissenschaftler ihre eigene Homepage, um sich selbst und ihre Arbeit zu präsentieren. Alex hielt es mittlerweile für eine richtig gute Idee, wieder mit Marc in Kontakt zu treten. Als er Marcs Namen in die Suchmaschine eingab, dauerte es keine Sekunde, bis er dessen Homepage gefunden hatte.
»Aha, da bist du also«, sagte Alex zu sich selbst, als er Marc in München am Helmholtz-Zentrum ausfindig machen konnte.
Offensichtlich war Marc nach Deutschland zurückgekehrt. München war ja vom Spessart nicht ganz so weit entfernt.
»Die knapp 300 Kilometer rutsche ich auf einer Arschbacke ab, mein lieber Marc. Ich werde dich die Tage in München besuchen«, schwirrte es Alex durch den Kopf.
Über die Homepage von Marc gelangte er schließlich auf eine Kongressseite der American Society of Cell Biology, die ihren nächsten Kongress in San Francisco ankündigte. Mehr durch Zufall entdeckte er schließlich den Namen von Marc unter den eingeladenen Rednern. Der Kongress würde in drei Wochen stattfinden.
Und dann fiel ihm noch ein Name auf. »Susanne Abele«, las er laut. »Welch Überraschung«, murmelte Alex. »Marc und Susanne auf ein und demselben Kongress. Ob das ein Zufall ist?«
Marc und Susanne waren die beiden, mit denen er während des Studiums immer unterwegs war. Sie waren wohl seine besten Freunde gewesen. Und außerdem das Liebespaar schlechthin. So dachte Alex jedenfalls immer. Es waren stets diese beiden und Alex, plus eine immer wieder »wechselnde Begleitung«, wie es Susanne ausdrückte, die gemeinsam allerlei Spaß erlebt hatten.
»Such dir doch mal was Dauerhaftes«, hatte Susanne gelästert.
Umso mehr war Alex dann überrascht gewesen, mit welcher Berechnung Marc und Susanne ihre Beziehung der Karriere opferten. Als sie nach ihrer Doktorarbeit getrennte Wege einschlugen, ebbte auch sein Kontakt zu Marc und Susanne merklich ab. Nur gelegentlich traf sich Alex noch mit Marc. Susanne war aus seinem Leben verschwunden.
Selbst bei diesen wenigen Treffen mit Marc bemerkte Alex bald, dass sein Freund die Gelassenheit und innere Ruhe verloren hatte und immer mehr das Gesicht eines gehetzten Tieres aufsetzte. Alex hatte zunehmend das Gefühl, nicht mehr in Marcs Welt zu passen. Dieses Gefühl verstärkte sich noch, als die Eltern von Alex tragisch bei einem Autounfall ums Leben kamen und Alex als Alleinerbe der Besitzer von mehreren Häusern und einer ganzen Menge Land wurde. Alex dachte immer, dass es dann nur konsequent gewesen war, sein nicht enden wollendes Journalismus-Studium an den Nagel zu hängen. Marc und Susanne waren ihm eine Warnung. Sie zeigten ihm, was Karriere aus ehemals lebensfrohen Menschen machen konnte. Gestresste, verbissene Menschen, die es verlernt hatten, am Leben teilzunehmen.
Alex hatte Geld und entschied sich für das Leben und verlor dabei Marc und Susanne mehr und mehr aus den Augen. Alex hatte gelebt. Vielleicht etwas zu intensiv.
Marc und Susanne würden also auf dem gleichen Kongress sein. Zufall? Einem Impuls folgend klickte sich Alex durch die Internetseiten und schaute nach, in welchem Hotel der Kongress stattfinden würde. Er war urplötzlich von der Idee überzeugt, seine alten Freunde in San Francisco überraschen zu müssen. Und wenn Alex eine Idee hatte, setzte er diese auch um. Kurz entschlossen buchte er einen Flug über Chicago nach San Francisco und mietete sich in dem Hotel, in dem der Kongress stattfinden würde, ein Zimmer. Es waren nur noch zwei Zimmer frei, die nicht durch Kongressteilnehmer belegt waren, und beide waren etwas teurere Suiten.
»Egal«, dachte Alex, »ich bin eben ein Glückskind.«
Alex stellte sich die Gesichter von Marc und Susanne vor, wenn er sie in San Francisco mit seinem Erscheinen überraschen würde. In diesem Augenblick klingelte das Telefon und er wurde jäh aus seinen Träumereien gerissen. Die wenigen Anrufe, die er bekam, bestanden meist aus irgendwelchen Umfragen oder Werbung. Es klang deshalb etwas grantig, als er sich mit einem gepressten »Alexander Farwick« am Telefon meldete.
»Guten Tag. Hier spricht Sara Klee. Bin ich richtig bei Alexander Farwick, dem Detektiv?«
Alex war erstaunt. Die Anzeige schien tatsächlich Wirkung gezeigt zu haben. Was für ein Glückstag! Erst eine Reise nach San Francisco gebucht, um alte Freunde wiederzusehen und jetzt vielleicht ein schöner Auftrag. Perfekt.
»Äh, guten Tag«, antwortete Alex nun viel freundlicher und räusperte sich. »Entschuldigen Sie bitte meinen rüden Ton, mit dem ich mich gerade gemeldet habe. Ich bekomme in letzter Zeit einfach zu viele Werbeanrufe. Aber richtig. Hier spricht Alexander Farwick, Detektiv.«
»Ich rufe aufgrund Ihrer Anzeige an. Ich – wir brauchten Ihre Hilfe«, bekam er ohne weitere Reaktion auf seine Entschuldigung zu hören.
»Aber natürlich, dafür bin ich ja da. Sie haben Glück, ich bin gerade frei und kann jeden Fall übernehmen. Ich möchte Ihnen aber gleich mitteilen, dass ich 150 Euro pro Tag plus Spesen berechne. Egal, mit was Sie mich beauftragen möchten.«
Alex ärgerte sich sofort über das Gesagte. Klingt nach »habe gerade nichts Besseres zu tun« und »nehme alles an«. Aber das war jetzt nicht mehr zu ändern. Und gleich auf die Kosten hinzuweisen würde hoffentlich einen seriösen Eindruck machen. Detektive wollen immer Geld. Auch wenn Alex die Detektivspielerei sogar kostenlos gemacht hätte, nur um sich die Zeit zu vertreiben. Aber das musste er ja nun nicht ausposaunen.
»Ihr Preis ist mir egal, wenn Sie mir helfen können«, erwiderte Sara Klee. »Sie werden bekommen, was Sie verlangen. Aber ich muss Ihnen vertrauen. Der Fall ist möglicherweise etwas heikel. Könnten wir uns womöglich persönlich treffen, um alles Weitere zu besprechen? Ich möchte ungern am Telefon erklären, um was es geht.«
»Aber natürlich, natürlich. Wir sollten uns vielleicht das erste Mal auf quasi neutralem Boden treffen«, reagierte Alex schnell.
Sein ehemaliges Büro in seinem Penthouse in Frankfurt war eigentlich keines mehr und würde nicht sehr vertrauenerweckend sein. In das Forsthaus, in dem er sich gerade befand, konnte er erst recht keine potentielle Kundin einladen.
»Von wo rufen Sie denn an, wenn ich fragen darf?«, wollte Alex wissen.
Er hatte die Anzeige sowohl im Frankfurter, im Aschaffenburger als auch im Würzburger Raum aufgegeben, weil so der Spessart in der Mitte schön als Zentrale dienen konnte.
»Aus Hanau«, bekam er zur Antwort.
»Gut. Ich befinde mich gerade in meinem Wochenendhaus im Spessart und ich schlage vor, dass wir uns in der Mitte, in Aschaffenburg, treffen. Parken Sie im Parkhaus an der Sandkirche. Das ist ausgeschildert und leicht zu finden. Wir können uns dann heute noch im Café Schwarzer Riese treffen. Einfach aus dem Parkhaus in Richtung Kirche raus und gerade die Gasse vor. Dort können wir uns gemütlich und unverbindlich über Ihr Anliegen unterhalten. Sind Sie damit einverstanden?«
»Ich denke, ich werde das Café finden. Ich wollte gerade nach Würzburg fahren. Sagen wir also schon in zwei Stunden? Es ist wirklich wichtig und ich möchte schnell wissen, ob Sie den Fall übernehmen.«
»Einverstanden. In zwei Stunden«, stammelte Alex etwas überrumpelt. »Wie kann ich Sie denn erkennen?«
»Ich werde ein dunkelgrünes Kleid tragen und ich habe rote Haare. Das sollte auffallen.«
»Zur Sicherheit können Sie einfach Ihren Namen im Café nennen«, bemühte sich Alex mit ruhiger Stimme zu antworten. »Ich werde dort anrufen und uns einen Tisch im Nebenraum reservieren lassen. Also – ich würde sagen, bis gleich in Aschaffenburg.«
»Ja, bis später«, kam zur Antwort und beide legten die Hörer auf.
Nur zwei Stunden. Alex entwickelte eine ungewohnte Hektik. Er wusste nicht, was er zuerst erledigen sollte und er musste auch noch duschen, sich vernünftig anziehen und rasieren. War das Smartphone geladen? In zwei Stunden war es drei Uhr. Die richtige Zeit für einen Kaffee.
»Ein guter Tag«, dachte Alex.
Deshalb liebte er das Detektivspielen. Genau wegen solchen geheimnisvollen Treffen mit unbekannten Leuten.
Als er mit Duschen, Waschen und Rasieren fertig war und im Spiegel einen gesellschaftsfähigen Eindruck hinterließ, rauchte er gemütlich eine Zigarette. Dann setzte er sich in sein Auto und fuhr genauso gemütlich nach Aschaffenburg.
Er war pünktlich und sah eine äußerst attraktive Frau, wahrscheinlich nur etwas jünger als er selbst, mit roten gelockten Haaren und einem grünen Kleid vor dem Café warten.
»Sara Klee?«, sprach er sie mit einem Lächeln an, und beim Blick in ihre blaugrünen Augen wurde ihm heiß und kalt zugleich. Dieses Gefühl überkam ihn immer dann, wenn etwas Ungewöhnliches passierte, das er nicht einordnen konnte.
»Ich bin Alexander Farwick und ich glaube, wir haben vor zwei Stunden miteinander telefoniert.«
»Schön, dass wir uns gleich treffen konnten«, antwortete Sara Klee, lächelte und reichte Alex zur Begrüßung die Hand.
Alex sah Kummer und Schmerz in ihren Augen und vermutete, dass sie in letzter Zeit sehr viel geweint hatte.
»Lassen Sie uns reingehen. Der Herbst ist etwas frisch hier draußen. Bei einem Kaffee und etwas Kuchen können Sie mir am besten schildern, was ich für Sie tun kann.«
Nach einem kurzen Zögern platzte er heraus: »Ich will ehrlich sein. Ihrem Ehemann nachspionieren würde ich nicht so gerne.«
Alex hatte sofort an Eheprobleme gedacht, als er Saras verweintes Gesicht sah.
»Ich bin nicht verheiratet und habe auch keine Beziehung mehr«, sagte Sara noch auf dem Weg ins Nebenzimmer.
Alex wunderte sich über die Erleichterung, die er bei diesen Worten empfand. Im Nebenraum angekommen, nahmen sie Platz. Er bestellte für beide einen Kaffee und einen Kuchen. Doch Sara hatte keinen Appetit.
»Also«, begann Alex und versuchte, die Situation etwas zu entspannen, denn er bemerkte, dass es Sara schwerfiel, mit dem Sprechen zu beginnen. Alex wiederum fiel es schwer, seinen Blick von ihren Augen abzuwenden. Etwas umständlich zog er sein kleines Netbook aus der Hülle.
»Sie erzählen mir einfach, um was es geht und ich mache mir gleich ein paar Notizen. Sie erlauben doch?«
Sara bejahte.
»Lassen Sie sich dadurch nicht stören«, fuhr Alex fort. »Legen Sie bitte los. Ich höre einfach zu und tippe hier mit. Wenn ich Fragen habe, unterbreche ich Sie.«
»Gut«, seufzte Sara und schloss kurz die Augen. »Dann werde ich mal beginnen. Haben Sie in den letzten Tagen die Zeitung gelesen?«
Alex nickte.
»Haben Sie etwas über den Unfall gelesen, bei dem ein junger Mann von der Straßenbahn überfahren wurde?«
Alex nickte wieder.
»Ich bin seine Mutter.«
»Moment«, unterbrach Alex und runzelte die Stirn. »Ich glaube, mich zu erinnern, dass seine Mutter aus dem Fenster sprang und ebenfalls umkam.«
»Sven, so hieß der junge Mann, hatte vier Mütter«, sagte Sara.
»Entschuldigung – wie?«, fragte Alex ungläubig.
»Er hatte vier Mütter«, wiederholte Sara ungerührt. »Wir waren eine Familie. Martha, die Frau, die seine leibliche Mutter war und jetzt tot ist. Maria, die sich aus Gram vor wenigen Tagen mit einer Überdosis Tabletten umgebracht hat. Christine und ich. Wir waren eine Familie und wir haben Sven gemeinsam aufgezogen.« Sara waren Tränen in die Augen gestiegen.
Alex hatte immer seine Schwierigkeiten, wenn er mit weinenden Frauen sprechen musste. Etwas unbeholfen und plumper als beabsichtigt meinte er deshalb nur, dass sie sich doch bitte beruhigen und weitererzählen solle.
Sara hatte sich auch gleich wieder im Griff und fuhr fort:
»Der letzte Mann bei uns war Svens Vater. Allerdings nur ausgesucht, damit wir in unserer Weiber-WG unseren Kinderwunsch erfüllen konnten. Wir wollten einfach gerne ein Kind. Deswegen hatte Sven vier Mütter. Jetzt ist er tot und zwei seiner Mütter dazu. Es ist der Umstand seines Todes, der dem jetzt noch lebenden kärglichen Rest unserer Familie Kopfzerbrechen bereitet. Christine und ich sind der Überzeugung, dass Sven sich niemals selbst umgebracht hätte. Er war absolut zufrieden und glücklich mit seinem Leben. Er wusste zwar, dass es ein Leben war, das nicht in ein gängiges Schema passte, er hätte aber nie, niemals mit dem Gedanken gespielt, sich etwas anzutun oder uns irgendwie Kummer zu bereiten. Dennoch lief er vor etwas mehr als zwei Wochen in eine fahrende Straßenbahn. So sagten es jedenfalls alle Zeugen.«
Sara stockte kurz und strich eine Strähne hinter das Ohr.
»Martha musste alles mit ansehen und ist aus Verzweiflung aus dem Fenster gesprungen. Oder wollte ihn möglicherweise retten. Wir wissen das nicht. Maria konnte diese ganze Tragödie nicht verkraften und brachte sich deshalb mit Tabletten um. Und ich? Ich kann nicht akzeptieren, dass Sven freiwillig vor die Straßenbahn gelaufen sein soll und sitze genau deshalb hier vor Ihnen. Christine geht es genauso. Wir beide haben beschlossen, den … na ja … den Vorfall untersuchen zu lassen. Dabei sind wir über Ihre Anzeige gestolpert. Sie sind der erste Detektiv, den wir ansprechen und wenn Sie kein Interesse haben, gehen wir zum nächsten. Wir glauben definitiv nicht, dass es Selbstmord war. Das, was in den Zeitungen stand, ist absoluter Quatsch. Ganz sicher. Sohn von vier Müttern in den Tod getrieben – das war ein gefundenes Fressen für den einen oder anderen Journalisten. Quatsch. Sven ging es wirklich gut und er war glücklich. Er hätte uns jederzeit verlassen können. Es wäre uns schwergefallen, aber er hätte es tun können. Doch Sven hat niemals auch nur eine Sekunde daran gedacht, uns zu verlassen.«
»Hätte ich auch nicht getan«, dachte Alex kurz, als er Sara von oben bis unten musterte.
»Verstehen Sie? Er hatte keinerlei Grund, sich umzubringen«, redete Sara Klee weiter. »Nun sagen aber die Zeugen, dass er gezielt vor die Straßenbahn lief. Mit ausgebreiteten Armen. Als ob er sie aufhalten wollte. Laut Akten war es nur ein Unfall. Also? Da er nie an Selbstmord gedacht hätte und ich nicht an einen Unfall glauben kann, muss er gezwungen worden sein, sich vor die Straßenbahn zu werfen. Er MUSS gezwungen worden sein. Für uns gibt es keine andere Lösung.«
»Verstehe ich Sie richtig? Sie sagen also, dass Ihr … ähm … Sohn … sich niemals aus eigenen Stücken umgebracht hätte, sondern zum Selbstmord gezwungen wurde?«
»Es war kein Selbstmord«, widersprach Sara sofort. »Es war Mord. Jedenfalls hat er sich nicht freiwillig vor die Straßenbahn geworfen.«
Alex seufzte. Er kannte das. Die Angehörigen von Selbstmördern wollten nicht immer wahrhaben, unter welchen Umständen ihre Liebsten ums Leben kamen. Konnte Sara dennoch recht haben? War es möglich, dass beim Tod von Sven etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war? Wie dem auch sei, Alex mochte Sara vom ersten Augenblick an und war entschlossen, den Fall anzunehmen. Auch wenn sich herausstellen sollte, dass es eigentlich keiner war.
»Gut. Oder auch nicht«, sagte Alex. »Ich werde die Umstände des Todes von Sven untersuchen. Ist es das, was Sie wollen?«
»Ja. Auch wenn alles für einen Selbstmord sprechen mag, ich versichere Ihnen, dass es keiner war«, wiederholte Sara. »Es ging ihm gut. Bitte untersuchen Sie, was da wirklich passiert ist. Geld spielt keine Rolle. Ich zahle Ihnen die 150 Euro am Tag plus Spesen, wie Sie wollen. Aber bitte, nehmen Sie Ihre Untersuchungen ernst.«
»Gut, dann ist das schon einmal geklärt«, sagte Alex. »Sie müssen natürlich nur etwas bezahlen, wenn ich auch etwas herausfinde. Bitte geben Sie mir noch ein paar Informationen. Ich brauche Ihre Telefonnummer und Adresse, die Namen der Schulen, in die Sven ging, wo er gearbeitet hat, einfach jegliche Information über sein Leben. Alles, was Ihnen und Ihrer … äh … Freundin einfällt. Jeder noch so versteckte Hinweis könnte wichtig sein.«
»Christine und ich werden Ihnen ein Paket zusammenstellen. Besuchen Sie mich in drei Tagen. Dann ist die Beerdigung von Maria vorbei. Ich weiß nicht, wie wir uns dann fühlen werden, aber ein Paket mit Informationen über Sven können Sie in jedem Fall abholen. Hier ist meine Adresse und die Telefonnummer.«
Sara reichte Alex eine Visitenkarte. »Sara Klee – Heilpraktikerin.«
»Musste ja so sein«, ging es ihm durch den Kopf. »Die Rothaarigen waren schon immer Hexen.«
»Ach, Sie wohnen in Würzburg. Ich dachte in Hanau?«, fragte Alex, als er auf die Visitenkarte blickte.
»Wir alle wohnen oder wohnten in Würzburg«, sagte Sara. »Ich war in Hanau nur bei einer alten Freundin zu Besuch, weil ich nach dem Tod von Maria dringend raus musste. Ich hatte diese Freundin schon Jahre nicht mehr gesehen. Aber wie es eben bei guten Freunden so ist. Man versteht sich sofort und kann sich auf sie verlassen.«
Alex dachte an Marc und Susanne und hoffte, dass es bei ihnen genauso sein würde, wenn er sie in San Francisco überraschte.
»Ich werde in drei Tagen zu Ihnen kommen und das Päckchen abholen«, sagte Alex. »In Würzburg also. Allerdings kann ich Ihnen nicht versprechen, dass schnell etwas bei meinen Untersuchungen herauskommen wird. Könnte dauern. Außerdem habe ich gerade heute Morgen eine Reise nach San Francisco gebucht und komme erst kurz vor Weihnachten wieder zurück. Ich werde wohl erst so richtig im nächsten Jahr mit der Arbeit beginnen können. Wie gesagt, könnte dauern, bis ich etwas habe. Aber ich werde mich auf jeden Fall bei Ihnen melden und Ihnen Bericht erstatten. Wenn Sie meinen, es dauert Ihnen alles zu lange, dann schicken Sie mir einfach eine Nachricht und suchen sich jemand anderen, der den Fall übernehmen soll. Sie haben ja meine Kontaktdaten. Geben Sie mir Bescheid, wenn sich bei Ihnen etwas tut.«
»Ich glaube, Sie sind der Richtige. Nicht jeder hätte so einen Fall, der eigentlich keiner zu sein scheint, angenommen, ohne gleich Vorkasse zu verlangen. Ich denke, wir werden uns wiedersehen. Mehr als einmal.«
Wieder wurde es Alex heiß und kalt zugleich. Diese Sara war bestimmt eine Hexe!
»Gut«, sagte Alex, »dann gibt es jetzt einen Fall Sven Löbel.«
Sara lächelte Alex an, als sie aufstand und sich verabschiedete. Alex schaute ihr intensiv nach, als sie das Café verließ. Er wusste, dass er Sara wiedersehen würde und er wusste, er würde den Fall ernst nehmen. Alex wollte gleich beginnen. Als Erstes würde er im Zeitungsarchiv suchen und alles zusammenstellen, was zu diesem Unfall geschrieben wurde. Das ist immer ein guter Anfang. Er musste sich erst einmal ein Bild von allem machen. Alex hatte Lunte gerochen. Und er wollte herausfinden, wann und wo die Beerdigung dieser Maria stattfinden würde. Er würde die beiden Frauen Sara und Christine gerne dabei beobachten. Er schlürfte seinen Kaffee und bestellte sich noch einen leckeren Kuchen. Es war ein guter Tag.
Gegen Abend war Alex mit einem Bündel Kopien von Zeitungsartikeln zurück in seinem Forsthaus. Sein Kumpel Bernd, der bei der Zeitung in Aschaffenburg arbeitete, hatte ihm rasch alle Artikel zusammengestellt und ausgedruckt, die in den Lokalzeitungen in Würzburg und am Untermain zum Tod von Sven Löbel erschienen waren. Aus dem Internet konnte er sich noch den einen oder anderen Bericht aus den überregionalen Boulevardblättern ziehen. Das sollte für einen ersten Eindruck reichen. Wenn er in drei Tagen das »Paket«, wie es Sara heute im Café bezeichnet hat, abholen würde, sollte es möglich sein, etwas mehr über diesen Sven in Erfahrung zu bringen. Wie war er in der Schule? Wie auf der Arbeit? Hatte er eine Freundin? Was machte er in seiner Freizeit? Vielleicht gab es irgendwo einen Hinweis.
In seinem Forsthaus machte es sich Alex gemütlich, schürte den offenen Kamin an, legte mittelalterliche Lautenmusik auf, versank in seinem Ohrensessel und las die verschiedenen Versionen des Unfallhergangs.
»Eigentlich ein klarer Selbstmord«, brummelte er vor sich hin, als er die Berichte das zweite Mal gelesen hatte und die erste Flasche Rotwein geleert war.
Die Boulevardpresse hatte den Unfall kurz aufgegriffen. Wohl weil die Familienverhältnisse doch gar zu interessant schienen. Der Fall Sven verschwand aber schnell wieder in der Versenkung, weil das Metzgermassaker und die Tankstellenexplosion in Belgien noch bessere Schlagzeilen hergaben.
»Da hatten Sara und Christine wohl Glück im Unglück, dass ihre Story nicht bis zum Erbrechen breitgetreten wurde«, dachte Alex.
Vier Frauen mit einem Sohn, den sie sich quasi auch noch selbst erzeugt hatten. Normalerweise ein gefundenes Fressen. Nur kurz dachte er daran, dass er selbst die Story journalistisch ausschlachten könnte. Immerhin hatte Alex ein paar Semester Journalismus studiert. Beim Gedanken an Sara verwarf er diese Idee jedoch schnell.
Alex wechselte zu ACDC als Hintergrundmusik und notierte sich: »Zeugen: Stadtarbeiter einzeln befragen. Straßenbahnschaffner befragen. Fahrgäste befragen. Polizeibericht. Beerdigung Maria. Paket abholen.«
Dann wunderten sich nur noch die Tiere im umliegenden Wald über den Krach, der mitten in der Nacht aus dem einsamen Forsthaus im Spessart schallte.
Am nächsten Tag wachte Alex mit einem kleinen Brummschädel auf, schluckte drei Kopfschmerztabletten und trank eine ganze Kanne Kaffee. Nach einem ausgiebigen Frühstück mit viel Chili fühlte er sich besser und fit für den Tag. Er schaute auf den Zettel, der neben den Weinflaschen auf dem Boden lag und dachte, dass er besser noch etwas warten sollte, bevor er auf der Würzburger Polizeiwache nach dem Polizeibericht fragte. Zu viel Restalkohol. Man musste ja nichts provozieren. Besser erst mal die Arbeiter der Stadtwerke befragen, die alles mit angesehen hatten. Und dann gab es ja noch die Beerdigung auf dem Würzburger Waldfriedhof.
Die Befragung der Stadtangestellten, die er in ihrer Mittagspause abgefangen hatte, verlief eindeutig. Sowohl die Arbeiter als auch der Straßenbahnfahrer sagten unmissverständlich, dass Sven gezielt und mit ausgebreiteten Armen auf die Straßenbahn zulief. Sven sei alleine gewesen und hätte nur einer älteren Frau zugewinkt, die ihn aus einem Fenster des gegenüberliegenden Hauses beobachtet hatte.
»Wir machten noch unsere Witze darüber«, sagte einer der Bauarbeiter, ein bulliger Mann Anfang fünfzig. »Der steht wohl auf ältere Frauen, lästerten wir. Das Ganze wurde dann komisch, als wir losfahren wollten. Dieser junge Mann starrte plötzlich mit aufgerissenen Augen in Richtung unseres Autos und hielt sich die Ohren zu. Das Blinklicht schien ihn zu irritieren. Als die Straßenbahn um die Ecke kam, rannte er ohne zu zögern direkt auf sie zu. Als ob er sie aufhalten wollte. Wir sprangen aus dem Auto und riefen ihm noch nach und wären dabei beinahe von seiner herabspringenden Mutter erschlagen worden. Aber warum wollen Sie das denn alles wissen? Das haben wir doch schon alles der Polizei erzählt.«
»Wenig hilfreich«, dachte Alex, als er die Stadtwerke verließ und Richtung Friedhof fuhr. Dort konnte er an der Tafel am Eingang lesen, dass die Beerdigung einer Maria Bernhardt heute um vierzehn Uhr stattfinden sollte. Also hatte er noch etwas Zeit. Alex beschloss, diese zu nutzen, um in der nahegelegenen Pathologie vorbeizuschauen. Er war mit einem der dort arbeitenden Rechtsmediziner, Johannes Frank, befreundet, der ihn immer wieder gerne mit Informationen versorgte und Tipps gab, wenn er ungewöhnliche Leichen auf dem Seziertisch hatte. Vielleicht wusste Johannes etwas Interessantes über Svens Tod zu berichten.
»Moin Jo«, begrüßte Alex seinen Freund, als er ihn in den Katakomben des Pathologischen Instituts ausfindig gemacht hatte.
»Ach ne. Ich glaub’s ja nicht. Alexander Farwick lebt noch.« Johannes Frank streckte Alex seine Hand zum Gruß entgegen. Alex schüttelte sie.
»Na klar, sonst würde ich nicht aufrecht hier erscheinen. Alles klar bei dir?«
»Na ja, so klar wie es die Arbeit hier erlaubt. Was führt dich zu mir? Du willst doch bestimmt wieder irgendetwas von mir wissen.«
»Sven Löbel«, sagte Alex nur.
»Kann ich wenig dazu sagen. War durch die Straßenbahn ziemlich schlimm zugerichtet und ich war einige Stunden beschäftigt, die Teilchen wieder zusammenzuflicken.«
»Irgendetwas Ungewöhnliches?«, fragte Alex und kniff die Augen zusammen.
»Nix – keine Krankheiten, kein Alkohol, keine Drogen, nix.«
»Mist, ich hatte auf deine sonst stets hilfreichen Erkenntnisse gehofft«, sagte Alex kurz.
Obwohl er mit der Antwort von Jo gerechnet hatte, machte sich doch Enttäuschung in ihm breit. Jagte er einem Phantom nach? Etwas, das nur in Saras und Christines Kopf existierte? Johannes räusperte sich und holte Alex damit zurück ins Hier und Jetzt.
»Wir könnten uns demnächst mal auf ein Bierchen treffen«, schlug Alex vor, um die Stille zu durchbrechen.
»Klar«, antwortete Jo. »Wir sollten mal wieder zusammen etwas ausgraben.«
Alex nickte, drehte sich um, hob kurz die Hand zum Abschied und sagte: »Bis bald und halte wie immer deine Augen offen und die Nase geschlossen. Wenn dir etwas Ungewöhnliches unter die Messer kommt, dann melde dich bei mir. Bin immer bereit, mit dir in den tiefsten Abgründen zu wühlen.«
»Klar doch, mach ich«, antwortete Jo mit einem Grinsen und lief in Richtung Gefrierfächer, um eine Leiche zu holen.
Es war windig und hatte stark zu regnen begonnen. Alex wickelte sich in seine Jacke ein und lief zurück zum Friedhof.
»Das richtige Wetter für eine Beerdigung«, dachte er, als er durchnässt kurz vor vierzehn Uhr am Friedhof ankam.
Er sah eine Trauergesellschaft, die aus ein paar Sargträgern, nur wenigen Trauergästen und zwei sich gegenseitig stützenden Frauen bestand.
»Sehr einsame Beerdigung«, murmelte er vor sich hin.
Er beobachtete Christine, die zusammen mit Sara, Maria und Martha eine der vier Mütter von Sven gewesen war.
»Sieht eigentlich ganz normal aus. Hier werde ich jedenfalls heute auch nichts mehr erfahren«, dachte sich Alex und verließ den Friedhof schon wegen des miesen Wetters gleich wieder.
Auf dem Weg zurück in sein Forsthaus fuhr er noch beim Polizeirevier vorbei, um sich den Bericht über Svens Tod anzusehen. Auf dem Revier war er allseits bekannt und wenn er die richtigen Personen fragte, konnte er nahezu alle Informationen bekommen, die er wollte. Eigentlich konnte Alex alle dort gut leiden. Hauptkommissar Jennes Meier bildete allerdings eine Ausnahme. Alex hielt ihn für einen überheblichen Wichtigtuer und war froh, ihm nicht zu begegnen. Mit dieser Meinung war Alex nicht alleine. Schon um Jennes Meier zu ärgern, wurde ihm bereitwillig geholfen und er bekam den vollständigen Bericht ausgehändigt. Er überflog ihn noch im Polizeirevier, erfuhr jedoch nichts, was er nicht schon wusste.
»Verdammt«, dachte er. »Verdammt, verdammt.« Offensichtlich gab es nirgends einen Anhaltspunkt. Alle seine üblichen Informationsquellen lieferten nicht den kleinsten Hinweis auf etwas Ungewöhnliches. Hatte er etwas übersehen? Oder jagte Sara vielmehr einem Hirngespinst nach? Gab es überhaupt etwas herauszufinden? Alex wusste nicht, wo er ansetzen sollte. Es sah tatsächlich alles nach Selbstmord aus.
Alex brauchte zwei Tage, um sich etwas zu sortieren. Schließlich erinnerte er sich an das Päckchen mit Informationen zu Sven, das ihm Sara versprochen hatte und machte sich sogleich auf den Weg, um es bei ihr abzuholen. Es erschien ihm typisch, dass diese schöne Hexe in Würzburg ausgerechnet in einem Stadtteil wohnte, der Frauenland hieß. Als Alex klingelte, öffnete ihm Christine.
»Sie wünschen?«, fragte sie.
»Entschuldigen Sie die Störung, ich bin Alexander Farwick und möchte zu Sara Klee.«
»Ach. Sie sind der Detektiv. Ich bin Christine Marsch. Auch eine Mutter von Sven.« Sie lächelte schelmisch. Christine schien sich gut erholt zu haben. Sie sah vor zwei Tagen auf dem Friedhof noch etwas niedergeschlagener aus.
»Sara ist leider gerade nicht hier«, fuhr sie fort. »Nach allem, was sie mir über Sie erzählt hat, wird sie das möglicherweise bedauern. Hier, das Päckchen mit allerlei Informationen über unseren Sven. Es steht schon zwei Tage neben der Haustür. Ich bezweifle aber, dass der Inhalt Ihnen etwas bringt. Sven war durch und durch unauffällig und normal. Sie sollten mal kommen, wenn Sara da ist und sich vielleicht vorher melden. Sara würde Sie gerne wiedersehen, Herr Farwick.«
Alex wurde rot, als Christine das sagte.
»Ich werde wiederkommen, sobald ich etwas Konkretes habe. Ich werde Frau Klee sicher noch einmal besuchen.«
»Da wird sich Sara aber freuen«, antwortete Christine verschmitzt und mit einem süffisanten Unterton.
Alex verließ das Frauenland und Würzburg.
Als er voller Erwartung am Abend im Forsthaus das Päckchen nach Informationen durchsuchte, erkannte er darin keine verwertbaren Hinweise. Wie es Christine prophezeit hatte.
Alex war komplett ratlos.
Wieder wunderten sich später nur die Tiere, als laute Musik aus dem Forsthaus donnerte.
Ein fast unerwartetes Wiedersehen
M