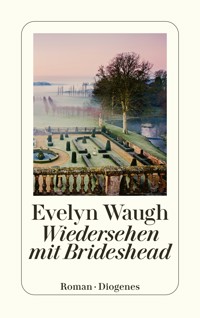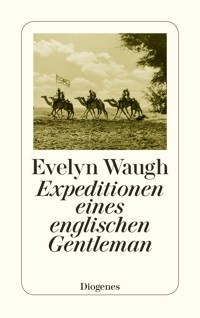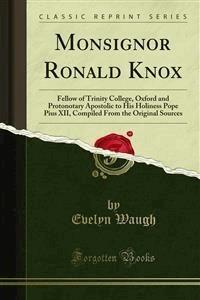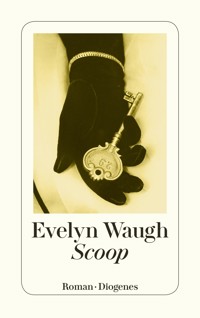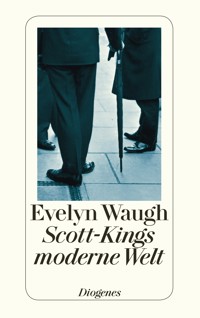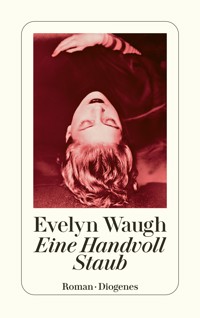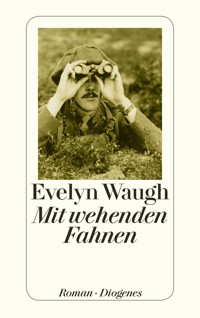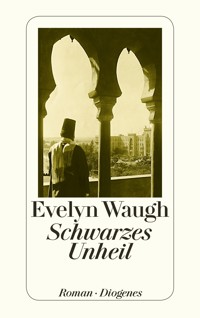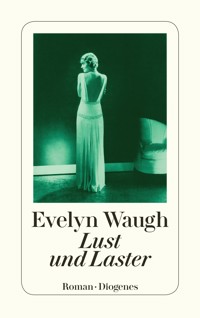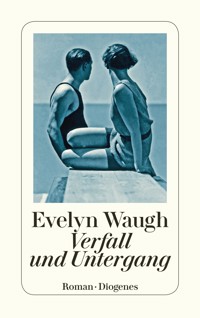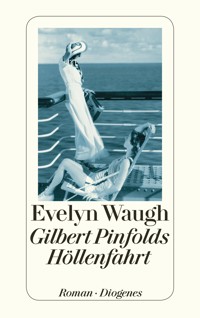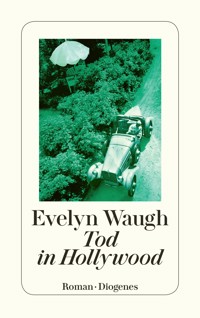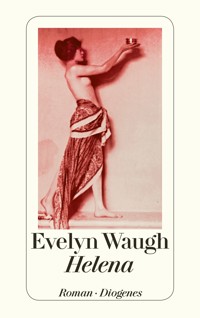14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist nicht leicht für Guy Crouchback, in den Wirren des Zweiten Weltkriegs Offizier zu sein und Gentleman zu bleiben – besonders in London, wo ihm seine flatterhafte Exfrau andauernd über den Weg läuft. An der Front, auf Kreta und in Jugoslawien, entdeckt er in sich nicht Heldentum, sondern Menschlichkeit. Und er merkt: Auch Siege kann man verlieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1222
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Evelyn Waugh
Ohne Furcht und Tadel
Roman
Aus dem Englischen von Werner Peterich
Diogenes
{7}FürCHRISTOPHER SYKESROBERT LAYCOCK undMARGARET FITZHERBERT in Liebe wie eh und je
{9}Vorwort des Autors
Die drei Bücher, aus denen dieser neu durchgesehene Band besteht, erschienen nacheinander innerhalb von zehn Jahren und mit dem wenig aufrichtigen (dem kommerziellen Interesse geschuldeten) Versprechen, dass jedes als eigenständiges, unabhängiges Werk gelesen werden könne. Vom Leser zu erwarten, sich die verschiedenen Charaktere zu merken, geschweige denn einer fortlaufenden und fortgeführten Handlung zu folgen, war unangemessen. Es kam zu Wiederholungen und Unstimmigkeiten, die in dieser Ausgabe hoffentlich beseitigt sind. Außerdem habe ich Passagen gestrichen, die beim erneuten Lesen langatmig wirkten.
Das Ergebnis soll (wie ursprünglich geplant) als eine einzige Geschichte gelesen werden. Mein Vorhaben war es, den Zweiten Weltkrieg aus der Sicht eines einzelnen, ziemlich untypischen Engländers zu beschreiben und dessen Auswirkungen auf ihn darzustellen. Zu diesem Zweck habe ich drei Clowns erfunden, die eine prominente Rolle in der Struktur der Geschichte einnehmen, aber nicht in ihrer Thematik.
Als ich nun das Buch las, erkannte ich, dass etwas entstanden war, das gar nicht meiner ursprünglichen Absicht entsprach. Ich hatte einen Nachruf auf die römisch-katholische Kirche in England geschrieben, wie es sie jahrhundertelang gegeben hat. Doch die Rituale und viele der Ansichten, die hier beschrieben werden, sind längst überholt. Mit Wiedersehen mit Brideshead verfasste ich ganz bewusst einen {10}Nachruf auf die dem Untergang geweihte englische Oberschicht. Aber als ich Ohne Furcht und Tadel schrieb, kam es mir nie in den Sinn, dass auch die Kirche dem Wandel unterworfen sein könnte. Das war ein Irrtum, und ich habe damals etwas als vorübergehend eingestuft, was eine Revolution mit dauerhaften Folgen sein sollte. Trotz vieler gläubiger Figuren war Ohne Furcht und Tadel kein ausgesprochen religiöses Buch. Aktuelle Entwicklungen haben daraus jedoch ein Dokument der katholischen Bräuche gemacht, wie es sie in meiner Jugend noch gab.
E.W.
Combe Florey 1964
{11}ISchwert der Ehre
1
Als Guy Crouchbacks Großeltern, Gervase und Hermione, in ihren Flitterwochen nach Italien kamen, hielten französische Truppen die Befestigungsanlagen von Rom besetzt, der Pontifex Maximus fuhr im offenen Wagen aus, und die Kardinale ritten im Damensattel auf dem Pincio spazieren.
Gervase und Hermione wurden in einer Reihe mit Fresken ausgemalter Palazzi willkommen geheißen. Papst Pius empfing sie bei einer Privataudienz und erteilte der Verbindung zweier englischer Familien, die für ihren Glauben gelitten, aber gleichwohl ein gutes Maß an materiellen Gütern behalten hatten, seinen ganz besonderen Segen. Die Kapelle in Broome hatte in all den Dürrejahren nie ohne Priester auskommen müssen, und die Ländereien von Broome erstreckten sich unvermindert und durch Hypotheken unbelastet von den Quantocks bis zu den Blackdown Hills. Vorfahren beider Familien waren auf dem Schafott gestorben. Die Stadt, mittlerweile von einer Welle illustrer Konvertiten überspült, erinnerte sich noch immer in aller Ehre ihrer alten Waffengefährten.
Gervase Crouchback strich sich über den Backenbart und fand respektvolle Zuhörer für seine Ansichten zur irischen Frage sowie zur katholischen Mission in Indien. Hermione stellte ihre Staffelei inmitten der Ruinen auf, und während sie malte, las Gervase ihr laut aus den Gedichten von Tennyson und Patmore vor. Sie war hübsch und sprach drei Sprachen; {12}er entsprach allem, was Römer sich von einem Engländer erwarteten. Überall wurde das glückliche Paar gepriesen und umworben, doch es war nicht alles eitel Sonnenschein bei den beiden. Kein Zeichen oder Hinweis verriet ihren Kummer, doch wenn die letzten Wagen davonrollten und sie in ihre ehelichen Gemächer hinaufstiegen, klaffte ein trauriger Abgrund zwischen ihnen, entstanden aus Bescheidenheit, Zartgefühl und Unschuld, von dem keiner der beiden sprach, außer im Gebet.
Später gesellten sie sich in Neapel zu anderen auf eine Yacht, dampften langsam die Küste hinauf und legten in wenig besuchten Häfen an. Und dort wurde, als sie eines Abends in ihrer Kabine saßen, endlich alles gut zwischen ihnen, und ihre Liebe fand freudige Erfüllung.
Vor dem Einschlafen spürten sie noch, wie die Maschinen stoppten und die Ankerkette hinunterrasselte, und als Gervase bei Morgengrauen an Deck kam, stellte er fest, dass das Schiff im Schutz einer hochragenden Halbinsel vor Anker lag. Er rief Hermione, und so standen sie Hand in Hand an der feuchten Heckreling, nahmen zum ersten Mal den Anblick von Santa Dulcina delle Rocce in sich auf und schlossen den Ort sowie seine Bewohner in ihr frohlockendes Herz.
Unten am Hafen wimmelte es von Menschen, als ob die Bewohner von einem Erdbeben aus dem Bett gescheucht worden wären. Klar drangen ihre Stimmen über das Wasser, die das fremde Schiff bewunderten. Steil ragten Häuser an der Hafenmauer auf; zwei Gebäude stachen aus den weißen und ockerfarbenen Mauern und rostbraunen Dachpfannen hervor; die kuppelgekrönte Kirche mit der verschnörkelten Fassade sowie eine Art Burg, die aus zwei Bastionen und einem zerfallenen Wachtturm bestand. Hinter der Stadt erstreckte sich der in Terrassen gegliederte, von Bauern beackerte Berghang, um weiter oben in ein Gewirr von Dorngestrüpp und {13}Felsbrocken überzugehen. Es gab ein Kartenspiel, das Gervase und Hermione im Schulzimmer immer gespielt hatten und bei dem derjenige, der mit einem bestimmten Trick durchkam, rief: »Alles mein!«
»Alles mein!«, rief Hermione, weil sie sehr glücklich war und von allem Besitz nahm, was sie sah.
Im Laufe des Vormittags gingen die Engländer an Land. Zwei Matrosen fuhren voraus, um jede Belästigung von Seiten der Einheimischen zu verhindern. Ihnen folgten vier Paare von Damen und Herren; dann die Diener mit Deckelkörben, Umhängen und Skizzenblöcken. Die Damen trugen Segelhüte und hielten die Röcke, damit sie nicht vom Kopfsteinpflaster schmutzig wurden; ein paar von ihnen trugen Lorgnetten. Die Herren schützten sie mit fransenbesetzten Sonnenschirmen. Es war eine Prozession, wie Santa Dulcina delle Rocce sie noch nie erlebt hatte. Sie bummelten durch die Arkaden, tauchten kurz in das kühle Zwielicht der Kirche und stiegen über die Stufen, die von der Piazza zu den Bastionen hinaufführten.
Davon war nicht mehr viel übrig. Die große, mit Steinplatten belegte Plattform war aufgerissen, und überall wuchsen Pinien und Ginster. Der Wachtturm war voller Geröll. Aus den schön behauenen Steinen der alten Burg hatte man am Hang zwei Hütten gebaut. Aus ihnen kamen zwei Bauernfamilien geeilt, um die Besucher mit Mimosensträußchen zu begrüßen. Das Mittagspicknick wurde auf ausgebreiteten Decken im Schatten eingenommen.
»Enttäuschend, wenn man oben ist«, sagte der Besitzer der Yacht in entschuldigendem Ton. »So ist es immer mit solchen Orten. Am besten sieht man sie sich aus der Ferne an.«
»Ich finde es hinreißend«, erklärte Hermione, »und wir werden hier leben. Bitte, kein Wort gegen unsere Burg.«
Gervase lachte nachsichtig mit den anderen, doch später, {14}nachdem sein Vater gestorben war und er sich reich fühlte, wurde das Vorhaben verwirklicht. Gervase holte Erkundigungen ein. Die Burg gehörte einem älteren Anwalt in Genua, der sie gern verkaufen wollte. Bald erhob sich ein schlichtes eckiges Haus über den Burgwällen, und liebliche Levkojen gesellten sich zu Myrte und Pinien. Gervase taufte sein neues Haus ›Villa Hermione‹, doch bürgerte sich der Name bei den Einheimischen nie recht ein. In großen geraden Lettern wurde er in die Torpfosten eingemeißelt, doch Geißblatt wucherte darüber und überdeckte ihn. Die Leute aus Santa Dulcina sprachen stets vom ›Castello Crauccibac‹, bis die Familie diesen Namen schließlich übernahm, und an Hermione, die stolze Braut, erinnerte hier nichts weiter.
Doch unter welchem Namen auch immer, die Burg bewahrte ihren ursprünglichen Charakter. Fünfzig Jahre hindurch, bis Schatten sich über die Familie Crouchback legten, war sie ein Ort der Freude und der Liebe. Hier verbrachte Guy mit seinen Geschwistern seine glücklichsten Ferien. Guys Vater und Guy selbst verbrachten hier ihre Flitterwochen. Immer wieder wurde die Burg jungverheirateten Cousins und Freunden zur Verfügung gestellt. Das Städtchen veränderte sich ein wenig, doch weder Eisenbahn noch Landstraße erschlossen sich die glückliche Halbinsel. Noch ein paar andere Fremde bauten sich dort eine Villa. Das Gasthaus wurde vergrößert, man ließ so etwas wie sanitäre Anlagen einbauen, ein Café-Restaurant legte sich den Namen Hotel Eden zu, um ihn dann unversehens während des Abessinienkriegs in Albergo del Sol umzuwandeln. Der Tankstellenbesitzer wurde Parteisekretär der Faschisten am Ort. Doch als Guy an seinem letzten Vormittag zur Piazza hinunterstieg, entdeckte er nur wenig, was Gervase und Hermione fremd gewesen wäre. Schon jetzt, eine Stunde vor Mittag, war es sehr heiß, doch er marschierte so munter dahin wie seine jungvermählten {15}Großeltern an jenem Morgen heimlichen Frohlockens. Genau wie bei ihnen hatte auch bei ihm eine frustrierte Liebe ihre erste Erfüllung gefunden. Er war für eine lange Reise bepackt und gekleidet und befand sich bereits auf dem Rückweg in seine Heimat, um dort seinem König zu dienen.
Erst vor sieben Tagen, als er die Morgenzeitung aufschlug, war ihm die Schlagzeile über das russisch-deutsche Bündnis ins Auge gesprungen. Nachrichten, die Politiker und junge Dichter in einem Dutzend Hauptstädte erschütterten, brachten tiefe Befriedigung für ein englisches Herz. Acht Jahre der Schande und Einsamkeit waren vorbei. Acht Jahre lang hatte sich Guy, von Leben und Liebe verlassen, von seinen Kameraden zurückgezogen. Er hatte Treue und Pflichterfüllung entbehren müssen, die ihm innerlich hätten Halt geben sollen. Er hatte in Italien den Faschismus aus zu großer Nähe erlebt, als dass er die oppositionelle Begeisterung seiner Landsleute hätte teilen können. Er betrachtete ihn weder als Unheil noch als Wiedergeburt, eher als eine grobe Improvisation. Ihm missfielen die Männer, die rücksichtslos um ihn herum an die Macht drängten, doch englische Anschuldigungen klangen einfältig und unaufrichtig, und in den letzten drei Jahren hatte er nicht einmal mehr englische Zeitungen gelesen. Die deutschen Nazis hielt er für verrückt und böse. Ihre Einmischung hatte die Sache Spaniens entehrt, doch das Unglück, das im Jahr zuvor über Böhmen hereingebrochen war, hatte ihn völlig kaltgelassen. Als Prag fiel, wusste er, dass ein Krieg unvermeidlich war. Er erwartete, dass sein Vaterland sich in den Krieg stürzen würde, von Panik ergriffen, aus den falschen Gründen oder aus überhaupt keinem Grund, mit den falschen Verbündeten und schwach gerüstet. Doch jetzt war alles herrlich klar geworden. Der Feind jedenfalls stand nun deutlich vor Augen, riesig und hassenswert, und hatte jede Maske fallenlassen. Es war die Moderne in Waffen. Wie {16}der Kampf auch ausgehen mochte – es gab einen Platz für ihn darin.
Im Castello war jetzt alles geregelt. Die förmlichen Abschiedsbesuche waren gemacht. Vorgestern hatte er dem Arciprete, dem Podestà, der Ehrwürdigen Mutter des Klosters, Mrs. Garry in der Villa Duratura, den Wilmots im Castelletto Musgrave und der Gräfin von Gluck in der Casa Gluck einen Besuch abgestattet. Jetzt war nur noch eines zu tun, eine ganz private Angelegenheit. Fünfunddreißig Jahre alt, schlank und schmuck, durchaus als Ausländer, aber nicht unbedingt als Engländer erkennbar, jung in Herz und Schritt, war er auf dem Weg, um von einem lebenslangen Freund Abschied zu nehmen, der, wie es sich für einen Mann gehörte, der seit über achthundert Jahren tot war, in der Pfarrkirche begraben lag.
St. Dulcina, Namenspatronin der Stadt, soll eines der Opfer Diokletians gewesen sein. Schmachtend ruhte ihr Antlitz aus Wachs in einer Vitrine unterm Hochaltar. Ihre Gebeine, die nach einem mittelalterlichen Raubzug von den griechischen Inseln hergebracht worden waren, lagen in einer reich verzierten Urne im Tresor der Sakristei. Jedes Jahr wurden sie einmal auf Schulterhöhe und unter einem Regen von Feuerwerk durch die Straßen getragen, doch bis auf ihren Festtag hatte sie keine große Bedeutung in der Stadt, der sie ihren Namen gegeben hatte. Der Platz als Wohltäterin war ihr von einer anderen Figur streitig gemacht worden, deren Grab stets mit zusammengerollten Bittschriften übersät, deren Finger und Zehen mit Schleifen aus farbiger Wolle als aides-mémoires umwunden waren. Mit Ausnahme der Gebeine der Heiligen Dulcina und einem vorchristlichen Donnerkeil, der hinter dem Altar verborgen lag (und dessen Existenz der Arciprete stets leugnete), war er älter als die Kirche. Sein gerade noch lesbarer Name lautete Roger of Waybroke, Ritter, ein Engländer; sein Wappen: fünf Falken. Sein Schwert sowie ein {17}Handschuh lagen noch neben ihm. Guys Onkel Peregrine, der in solchen Dingen sehr belesen war, hatte einiges von seiner Geschichte herausgefunden. Waybroke, heute Waybrook, lag in der Nähe von London. Rogers Herrenhaus war längst dahin und überbaut worden. Er hatte es mit dem zweiten Kreuzzug verlassen, hatte sich in Genua eingeschifft und an diesen Gestaden Schiffbruch erlitten. Hier schloss er sich dem örtlichen Grafen an, der versprach, ihn ins Heilige Land hinüberzubringen, ihn zunächst jedoch an einem Feldzug gegen einen Nachbarn teilnehmen ließ. An den Mauern von dessen Burg war er im Augenblick des Sieges gefallen. Der Graf hatte ihm ein ehrenvolles Begräbnis bereitet, und so hatte er jahrhundertelang hier gelegen. Die Kirche über ihm war zerfallen und neu wiederaufgebaut worden, und so lag er, fern von Jerusalem, fern von Waybroke, ein Mann, der noch immer eine große Reise vor sich hatte, sein Gelöbnis nicht hatte erfüllen können; doch die Bewohner von Santa Dulcina delle Rocce, denen die übernatürliche Ordnung der Dinge in allen ihren Verästelungen stets gegenwärtig, vor allem aber immer lebendiger war als die eintönige Welt um sie herum, nahmen sich dieses Sir Roger an, kanonisierten ihn aller Proteste der Geistlichkeit zum Trotz, kamen mit ihren Sorgen zu ihm und waren fest überzeugt, dass es Glück bringe, sein Schwert zu berühren, so dass dessen Schneide stets blank glänzte. Sein ganzes Leben lang, vor allem aber während der letzten Jahre, hatte Guy eine ganz besondere Verwandtschaft mit diesem ›Santo Inglese‹ empfunden. Heute, an seinem letzten Tag, ging er unverzüglich zum Grab und fuhr mit den Fingern über die Schneide seines Schwertes, wie es auch die Fischer taten. »Sir Roger, bete für mich!«, flüsterte er. »Und für unser Königreich, das in Gefahr ist!«
Der Beichtstuhl war an diesem Vormittag besetzt, denn es war der Tag, an dem Suora Tomasina die Schulkinder {18}herbrachte, damit sie ihrer Pflicht nachkamen. Sie hockten auf der Bank an der Wand aufgereiht, flüsterten und zwickten einander, während die Schwester flügelschlagend über ihnen wachte wie eine Glucke und sie eines nach dem anderen zum Sprechgitter führte und von dort zum Hochaltar, wo sie ihre Bußgebete verrichteten.
Der Eingebung des Augenblicks folgend – nicht weil sein Gewissen ihn plagte, sondern weil es ihm seit seiner Kindheit zur Gewohnheit geworden war, vor Antritt einer Reise zur Beichte zu gehen –, machte Guy der Schwester ein Zeichen und unterbrach die Reihenfolge der Bauernkinder.
»Beneditemi, padre, perché ho peccato …« Guy fiel es leicht, auf Italienisch zu beichten. Er konnte die Sprache gut, freilich ohne die feineren Unterschiede. Er lief keine Gefahr, mehr zu bekennen als seine paar Vergehen gegen die Zehn Gebote und seine gewohnheitsmäßigen Schwächen. Bis in jene Ödnis, in der seine Seele dahinkümmerte, vordringen konnte er nicht. Er hatte auch keine Worte, um sie zu beschreiben; dafür gab es in keiner Sprache Worte. Es gab auch gar nichts zu beschreiben – lediglich eine Leere. Er war kein ›interessanter Fall‹, dachte er. Kein kosmischer Kampf tobte in seiner traurigen Seele. Es war, als ob er vor acht Jahren einen sehr, sehr leichten Anfall von Lähmung erlitten hätte; alle seine spirituellen Fähigkeiten waren kaum merklich versehrt worden. Er war ›gehandicapt‹, wie Mrs. Garry aus der Villa Datura es genannt hätte. Es gab nichts dazu zu sagen.
Der Priester erteilte ihm die Absolution und bedachte ihn mit den traditionellen Worten der Entlassung: »Sia lodato Gesù Cristo«, woraufhin er mit einem »Oggi, sempre« antwortete. Er erhob sich von den Knien, sprach vor dem Wachsbild der Santa Dulcina drei Ave Maria und trat durch den Ledervorhang hinaus in das blendende Sonnenlicht auf der Piazza.
{19}Die Kinder, Enkel und Urenkel jener Bauern, die Gervase und Hermione damals begrüßt hatten, bewohnten noch immer die Hütten hinter dem Castello und beackerten die umliegenden Terrassen. Sie bauten Trauben an und kelterten Wein; sie verkauften Oliven; sie hielten eine nahezu bleiche Kuh in einem unterirdischen Stall, aus dem sie gelegentlich ausbrach, um die Gemüsebeete zu zertrampeln und über die niedrigen Mauern hinwegzuspringen, ehe sie unter riesigem Theater wieder eingefangen wurde. Ihre Pacht bezahlten die Bauern mit Früchten des Feldes und Dienstleistungen. Zwei Schwestern, Josefina und Bianca, verrichteten die Arbeit im Haus. Unter dem Orangenbaum hatten sie Guys Abschiedsmahl gedeckt. Er aß seine Spaghetti und trank seinen vino scelto, den bräunlichen, rasch zu Kopf steigenden Wein der Gegend. Danach brachte Josefina mit viel Aufhebens einen reich verzierten Kuchen, der eigens zur Feier seiner Abreise gebacken worden war. Sein bisschen Appetit war längst gestillt. Erschrocken schaute er zu, wie Josefina den Kuchen anschnitt. Er kostete, lobte und zerkrümelte ihn. Josefina und Bianca standen unerbittlich vor ihm, bis er den letzten Krümel aufgegessen hatte.
Das Taxi wartete. Es führte keine Auffahrt zum Castello hinauf. Das Tor ging vielmehr unten am Fuß einer Treppe auf eine Gasse hinaus. Als Guy sich erhob, versammelte sich sein gesamter, zwanzig Mann starker Haushalt, um ihm Lebwohl zu sagen. Sie würden bleiben, komme, was wolle. Alle küssten sie ihm die Hand, die meisten weinten. Die Kinder warfen Blumen in seinen Wagen. Josefina legte ihm den restlichen, in Zeitungspapier eingewickelten Kuchen auf den Schoß. Sie winkten, bis er außer Sicht war, dann kehrten sie zu ihrer Siesta zurück. Guy legte den Kuchen hinter sich auf den Rücksitz und wischte sich die Hände mit einem Taschentuch ab. Er war froh, dass diese Qual vorüber war, und wartete {20}schicksalsergeben darauf, dass der faschistische Parteisekretär eine Unterhaltung begann.
Er wurde nicht geliebt, das wusste Guy, weder von seinen Angestellten noch von den Leuten in der Stadt. Er wurde akzeptiert und respektiert, galt jedoch nicht als simpatico. Die Gräfin von Gluck, die kein Wort Italienisch sprach und unverhohlen in wilder Ehe mit ihrem Butler lebte, war simpatica. Und auch Mrs. Garry, die protestantische Traktätchen verteilte, sich darüber aufregte, wie die Fischer die Tintenfische totschlugen, und ihr Haus zu einem Hort streunender Katzen machte, war simpatica.
Guys Onkel Peregrine, ein international berüchtigter Langweiler, dessen gefürchtete Anwesenheit im Handumdrehen dafür sorgte, dass sich ein Zimmer in jedem Mittelpunkt des geistigen Lebens leerte – dieser Onkel Peregrine galt sogar als molto simpatico. Die Wilmots waren aufdringlich vulgäre Leute; sie benutzten Santa Dulcina nur als Ort, um ihren Vergnügungen nachzugehen, spendeten für keine der örtlichen Wohltätigkeitseinrichtungen, schmissen ausufernde Partys und liefen in unanständigen Klamotten herum, nannten die Einheimischen ›Itaker‹ und reisten oft nach dem Sommer ab, ohne ihre Rechnungen bei den Geschäftsleuten bezahlt zu haben – aber sie hatten vier ungebärdige und verwöhnte Töchter, die die Santa Dulcinesi hatten heranwachsen sehen. Und was noch mehr zählte: Sie hatten einen Sohn verloren, der beim Baden an den Klippen ertrunken war. An diesen Freuden und Kümmernissen nahmen die Santa Dulcinesi Anteil. Genüsslich beobachteten sie, wie sie am Ende der Ferien Hals über Kopf und klammheimlich abreisten. Sie waren simpatici. Selbst Musgrave, dem das Castelletto vor den Wilmots gehört und der ihm seinen Namen vererbt hatte – dieser Musgrave, dem man nachsagte, dass er wegen irgendwelcher Haftbefehle weder nach England noch nach Amerika zurückkonnte, {21}›Musgrave, das Monstrum‹, wie er bei den Crouchbacks hieß – selbst der war simpatico. Nur Guy, den sie von klein auf kannten, der ihre Sprache sprach und ihre Religion teilte, der stets sehr freigebig war und betont darauf achtete, sie bei nichts zu verletzen, dessen Großvater ihnen die Schule gebaut und dessen Mutter ihnen ein ganzes Prunkgewand gestiftet hatte, das von der Königlichen Handarbeitsschule extra für die jährliche Prozession der Gebeine der Heiligen Dulcina angefertigt worden war – nur Guy war ein Fremder unter ihnen geblieben.
Das Schwarzhemd sagte: »Fahren Sie lange weg?«
»Solange der Krieg dauert.«
»Es wird keinen Krieg geben. Kein Mensch will ihn. Wer hätte schon was davon?«
An jeder fensterlosen Mauer, an der sie vorbeifuhren, prangten das finster blickende, mit Schablone aufgesprühte Gesicht Mussolinis und die Unterschrift: Der Duce hat immer recht! Der faschistische Parteisekretär nahm die Hände vom Steuer, zündete sich eine Zigarette an und trat dabei aufs Gaspedal. Der Duce hat immer recht …
Der Duce hat immer recht flitzte es an ihnen vorüber und blieb im Staub zurück. »Krieg wäre Dummheit!« erklärte der unvollkommene Jünger. »Sie werden sehen. Es wird schon noch zu einer Einigung kommen.«
Guy ließ sich nicht auf eine Diskussion ein. Was der Taxifahrer sagte oder dachte, interessierte ihn nicht. Mrs. Garry hingegen hätte sich auf eine hitzige Diskussion eingelassen. Einmal – derselbe Mann hatte sie gefahren – hatte sie das Taxi halten lassen, war ausgestiegen und war den beschwerlichen, vier Kilometer langen Weg nach Hause zu Fuß gegangen, nur um ihm zu zeigen, wie sehr sie seine politische Philosophie verabscheute. Guy hingegen verspürte nicht den Wunsch, jemanden zu überreden oder zu überzeugen oder seine {22}Anschauungen zu teilen. Selbst in seinem Glauben empfand er keinerlei Brüderlichkeit. Oft wünschte er, er hätte in kargen Zeiten gelebt, als Broome noch ein einsamer Außenposten des Katholizismus inmitten der Fremde gewesen war. Manchmal malte er sich aus, wie er am Ende der Welt in einer Katakombe dem letzten Papst bei der Messe diente. Er ging niemals am Sonntag zur Kommunion, sondern schlich sich an Wochentagen in aller Herrgottsfrühe in die Kirche, wenn nur wenige andere da waren. Den Leuten in Santa Dulcina war ›Musgrave, das Monstrum‹ lieber gewesen. In den ersten Jahren nach seiner Scheidung hatte Guy ein paar jämmerliche Liebschaften gehabt, doch hatte er sie stets vor den Leuten im Ort verheimlicht. In letzter Zeit hatte er sich einer trockenen und negativen Keuschheit verschrieben, wie selbst die Priester sie nicht erbaulich fanden. Weder auf unterster noch auf oberster Stufe gab es Sympathie zwischen ihm und seinen Mitmenschen. Er konnte dem Taxifahrer nicht zuhören.
»Die Geschichte ist eine lebendige Kraft«, sagte der Taxifahrer und zitierte aus einem Artikel, den er vor kurzem gelesen hatte. »Niemand kann sie aufhalten und sagen: ›Von jetzt an kann es keine Veränderungen mehr geben.‹ Manche werden alt, das ist bei Völkern nicht anders als bei den Menschen. Manche haben zu viel, andere zu wenig. Folglich muss man sich arrangieren. Wenn es aber zum Krieg kommt, haben alle zu wenig. Sie wissen das. Sie wollen keinen Krieg!«
Guy hörte seine Stimme, ohne sich darüber zu ärgern. Nur eine kleine Frage bereitete ihm im Augenblick Kopfschmerzen: Wohin mit dem Kuchen? Im Auto konnte er ihn unmöglich lassen, das würden Bianca und Josefina erfahren. Im Zug würde er recht hinderlich sein. Er versuchte, sich zu erinnern, ob der Vizekonsul, mit dem er ein paar Einzelheiten über das Schließen des Castello besprechen musste, Kinder hatte, denen er den Kuchen mitbringen konnte. Wahrscheinlich schon.
{23}Abgesehen von diesem zuckerigen Hindernis schwebte Guy frei dahin: in seiner neugefundenen Zufriedenheit genauso unerreichbar wie in seiner alten Verzweiflung. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi, sempre. Heute ganz besonders, vor allem heute.
2
Die Crouchbacks waren bis vor vergleichsweise kurzer Zeit noch eine vielköpfige und reiche Familie gewesen, nunmehr waren sie jedoch sehr zusammengeschmolzen. Guy war der jüngste von ihnen, und es sah ganz so aus, als würde er auch der letzte bleiben. Seine Mutter war tot, sein Vater über siebzig. Sie waren vier Kinder gewesen. Angela, die älteste, dann kam Gervase, der vom Downside College direkt bei den Irish Guards eingetreten war und den gleich an seinem ersten Tag in Frankreich die Kugel eines Heckenschützen erwischt hatte, als er frisch gewaschen und ausgeruht, den Schwarzdornstock in der Hand, auf einer Planke durch den Schlamm geschritten war, um sich bei seinem Kompaniechef zu melden. Der dritte, Ivo, war nur ein Jahr älter als Guy, doch waren sie sich nie nahegekommen. Ivo war immer sonderbar gewesen, wurde immer wunderlicher und verschwand schließlich mit sechsundzwanzig von zu Hause. Monatelang hörten sie nichts von ihm. Dann fand man ihn, er hatte sich in einer Behausung in Cricklewood verschanzt und war buchstäblich im Begriff zu verhungern. Ausgemergelt und bereits im Delirium trugen sie ihn hinaus, völlig dem Wahn verfallen starb er ein paar Tage später. Das war 1931 gewesen. Ivos Tod wollte Guy bisweilen wie eine Karikatur seines eigenen Lebens erscheinen, das sich gerade damals zu einer einzigen Katastrophe verwandelte.
Ehe Ivos Wunderlichkeit Anlass zu ernster Besorgnis gab, {24}hatte Guy geheiratet, und zwar keine Katholikin, sondern eine strahlende, schicke junge Frau, die ganz anders war als alles, was seine Freunde und seine Familie von ihm erwartet hätten. Er nahm den ihm als jüngerem Sohn zustehenden Anteil des bereits geschrumpften Familienvermögens und ließ sich in Kenia nieder, wo er, wie es ihm hinterher erschien, in ungetrübt guter Laune neben einem Bergsee gelebt hatte: Die Luft war stets strahlend frisch, und die Flamingos flogen beim ersten Morgengrauen erst weiß, dann rosig auf, dann zogen sie als ein wirbelnder Schatten über den glühenden Himmel. Mit Fleiß warf er sich in die Landwirtschaft, und beinah war es so weit, dass sich die Sache rentierte. Doch dann erklärte seine Frau einigermaßen grundlos, ihre Gesundheit mache es erforderlich, dass sie für ein Jahr nach England gehe. Sie schrieb regelmäßig und liebevoll, bis sie ihn eines Tages – immer noch sehr liebevoll – davon in Kenntnis setzte, sie habe sich bis über beide Ohren in einen gemeinsamen Bekannten namens Tommy Blackhouse verliebt; Guy solle ihr deswegen nicht gram sein; sie ersuche ihn, in eine Scheidung einzuwilligen. Und bitte, schloss ihr Brief, Du brauchst Dich nicht als Ritter aufzuspielen und nach Brighton zu fahren, um dort aller Welt vorzuspielen, dass Du ›der Schuldige‹ seist. Das würde sechs Monate Trennung von Tommy bedeuten, und ich traue dem Halunken keine sechs Minuten, wenn ich ihn nicht im Blick habe.
Also hatte Guy Kenia verlassen, und kurz darauf verließ sein verwitweter Vater, der die Hoffnung auf einen Erben fahren ließ, Broome. Das Gut war damals bereits auf das Herrenhaus nebst Park und eine kleine dazugehörige Landwirtschaft zusammengeschmolzen. In letzter Zeit hatte es sogar eine gewisse Berühmtheit erlangt, stand es doch in dieser Zeit in England fast einzigartig da, denn es befand sich in ununterbrochener männlicher Erbfolge seit der Regierungszeit {25}Heinrichs I. im Besitz der Familie. Auch Mr. Crouchback verkaufte es nicht, sondern verpachtete es an einen Nonnenorden und setzte sich selbst in Matchet, einem nahegelegenen Seebad, zur Ruhe. So brannte das ewige Licht in Broome wie von alters her.
Niemand war sich des Niedergangs des Hauses Crouchback deutlicher bewusst als Guys Schwager, Arthur Box-Bender, der Angela 1914 geheiratet hatte, als Broome noch unveränderlich am Firmament zu strahlen schien wie ein Himmelskörper, der Tradition und unaufdringliche Autorität verströmte. Box-Bender selbst stammte nicht aus einer alten Familie und schätzte Angelas Stammbaum sehr. Einmal überlegte er sogar ernsthaft, ob er dem eigenen Namen nicht den von Crouchback hinzufügen sollte anstelle von Box oder Bender, die beide gleichermaßen entbehrlich schienen, doch brachten Mr. Crouchbacks Gleichgültigkeit, die wie eine kalte Dusche wirken konnte, sowie Angelas Spott für das Vorhaben ihn rasch wieder davon ab. Er war kein Katholik und hielt es für Guys selbstverständliche Pflicht, wieder zu heiraten, möglichst jemanden mit Geld, und für den Fortbestand der Familie zu sorgen. Er war kein sonderlich feinfühliger Mann und konnte es einfach nicht billigen, dass Guy sich verkroch. Er müsse die Landwirtschaft in Broome übernehmen, in die Politik einsteigen. Leute wie Guy, daraus machte er kein Hehl, waren ihrem Vaterland etwas schuldig. Doch als Guy im August 1939 in London erschien mit dem Vorsatz, diese Schuld zu begleichen, fand er bei Box-Bender dafür wenig Verständnis.
»Mein lieber Guy«, sagte er, »nun werd doch mal erwachsen!« Box-Bender war sechsundfünfzig und Parlamentsmitglied. Vor vielen Jahren hatte er durchaus löblich bei einem Schützenregiment gedient; sein Sohn verrichtete dort momentan seinen Dienst. Für seine Begriffe war das {26}Soldatendasein eine Sache der Jugend, so wie Karamellbonbons und Katapulte. Guy, der bald sechsunddreißig wurde, betrachtete sich noch als einen jungen Mann. Für ihn hatte die Zeit in den vergangenen acht Jahren stillgestanden. Für Box-Bender hingegen war sie geflogen.
»Kannst du dir allen Ernstes vorstellen, an der Spitze einer Kompanie voranzustürmen?«
»In der Tat«, sagte Guy, »genau das hatte ich mir vorgestellt.«
Für gewöhnlich wohnte Guy, wenn er in London war, bei Box-Bender am Lowndes Square. Jetzt war er von der Victoria Station unverzüglich dorthin gefahren, musste jedoch feststellen, dass seine Schwester Angela bereits auf dem Lande weilte und das Haus schon halb leer stand. Box-Benders Arbeitszimmer war das letzte, in dem noch nichts angerührt worden war. Dort saßen sie jetzt, ehe sie zum Dinner aufbrachen.
»Ich fürchte, du wirst keine große Unterstützung erfahren. 1914 ist all so was natürlich passiert – dass alte Colonels im Ruhestand sich das Haar färbten und als gemeine Soldaten wieder Dienst taten. Ich erinnere mich. Ich war dabei. Das war selbstverständlich alles sehr kühn und ritterlich, aber diesmal passiert so etwas nicht. Es ist alles vorausgeplant. Die Regierung weiß genau, mit wie viel Mann sie rechnen kann; sie weiß, wo sie sie herkriegen kann, und wird sie sich holen, wenn es so weit ist. Im Moment verfügen wir weder über die nötigen Unterbringungsmöglichkeiten noch über die Ausrüstung, um die Truppenstärke wesentlich zu vergrößern. Möglich, dass Leute fallen, gewiss, aber ich persönlich sehe die ganze Sache nicht als Soldatenkrieg. Wo sollen wir denn kämpfen? Kein Mensch, der seine fünf Sinne beisammenhat, würde versuchen, die Maginot-Linie oder den Westwall zu durchbrechen. So wie ich die Sache sehe, werden beide {27}Seiten sich nicht rühren, bis die wirtschaftlichen Schwierigkeiten anfangen. Den Deutschen fehlt es an fast allen Rohstoffen. Sobald sie erkennen, dass Mr. Hitler nur blufft, werden wir von ihm nicht mehr viel sehen. Das ist eine Angelegenheit, die die Deutschen unter sich regeln müssen. Selbstverständlich können wir mit der Räuberbande, die augenblicklich am Ruder ist, nicht verhandeln, aber sobald sie eine anständige Regierung auf die Beine stellen, können wir unsere Differenzen schon ausbügeln.«
»Das klingt fast wie das, was mein Taxifahrer mir gestern erzählt hat.«
»Selbstverständlich! Man sollte sich immer an Taxifahrer wenden, wenn man eine vernünftige, unvoreingenommene Meinung hören will. Ich habe gerade heute mit einem gesprochen. Er sagte: ›Wenn es erst mal Krieg gibt, ist der Zeitpunkt gekommen, über den Krieg zu sprechen. Aber im Augenblick haben wir keinen Krieg.‹ Sehr vernünftige Einstellung, finde ich.«
»Aber mir fällt auf, dass du doch sämtliche Vorsichtsmaßnahmen ergreifst.«
Box-Benders drei Töchter waren nach Amerika zu einem Geschäftspartner nach Connecticut verfrachtet worden. Das Haus am Lowndes Square wurde geräumt und die Fensterläden geschlossen. Etliches Mobiliar war aufs Land gebracht worden, der Rest wurde eingelagert. Box-Bender hatte einen Teil einer sehr großen, brandneuen Wohnung übernommen, die im Augenblick spottbillig waren. Mit zwei seiner Kollegen aus dem Unterhaus wollte er sich die Wohnung teilen und sie gemeinsam benutzen. Sein klügster Schachzug war es jedoch gewesen, sein Landhaus in seinem Wahlkreis zur Auslagerungsstelle für ›nationale Kunstschätze‹ deklarieren zu lassen. Fortan würde man keinerlei Scherereien mehr mit irgendwelchen Einquartierungen von militärischer oder ziviler Seite {28}haben. Über all diese Vorsichtsmaßnahmen hatte Box-Bender wenige Minuten zuvor noch voller Stolz gesprochen. Jetzt wandte er sich bloß einem Radioapparat zu und sagte: »Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich diesen Kasten kurz anstelle. Es könnte ja was Neues geben.«
Aber es gab nichts Neues. Von irgendwelcher Friedensbotschaft war natürlich auch nichts zu hören. Die Evakuierung der Großstädte ging weiter zügig vonstatten; glückliche Gruppen von Müttern und Kindern trafen pünktlich an ihrem Bestimmungsort ein und wurden in ihren neuen Unterkünften willkommen geheißen. Box-Bender stellte den Apparat ab.
»Nichts Neues seit heute Nachmittag. Komisch, wie oft man heutzutage diesen Kasten anstellt. Früher hatte ich nichts dafür übrig. Übrigens, Guy, das wäre doch etwas für dich, wenn du dich wirklich nützlich machen willst. Bei der BBC suchen sie händeringend Leute, die Fremdsprachen sprechen – zum Abhören und für Propagandazwecke und solche Sachen. Zugegeben, nicht sonderlich aufregend, aber irgendwer muss das ja tun, und ich würde meinen, dein Italienisch käme denen ganz gelegen.«
Die beiden Schwager waren sich nie besonders zugetan gewesen. Guy war es nie in den Sinn gekommen, sich Gedanken darüber zu machen, was sein Schwager wohl von ihm hielt. Es war ihm überhaupt nie in den Sinn gekommen, dass Box-Bender irgendwelche besonderen Ansichten vertrat. Tatsächlich hatte Box-Bender sogar ein paar Jahre lang angenommen – und daraus Angela gegenüber keinerlei Hehl gemacht –, dass Guy verrückt werden würde. Er war weder ein Mann mit viel Vorstellungskraft, noch ließ er sich von irgendetwas sonderlich beeindrucken. Bei der Suche nach Ivo und seiner grauenerregenden Auffindung hatte er sich jedoch sehr engagiert. Die ganze Sache hatte durchaus Eindruck auf {29}ihn gemacht. Guy und Ivo aber waren sich bemerkenswert ähnlich. Box-Bender erinnerte sich an Ivos Blick seinerzeit, als er noch am Rande des Wahns entlanggeschliddert war; wild war sein Blick wahrhaftig nicht gewesen, vielmehr eher selbstzufrieden und entschlossen, irgendwie hingebungsvoll-entschlossen. Ja, er hatte etwas an sich gehabt, das sehr viel Ähnlichkeit mit dem Ausdruck in Guys Augen hatte, wie er jetzt zu so ungelegener Zeit am Lowndes Square vor der Tür stand und in aller Gemütsruhe über die Irish Guards redete. Das verhieß nichts Gutes. Am besten war es, ihn bei etwas wie der BBC unterzubringen, damit er kein Unheil anrichtete.
An diesem Abend speisten sie bei Bellamy’s. Diesem Club hatte Guys Familie von jeher angehört. Gervases Name stand auf der Ehrentafel der Gefallenen des Ersten Weltkriegs in der Eingangshalle. Der arme wahnsinnige Ivo hatte hier oft am Erkerfenster gesessen und die Vorübergehenden mit seinem starren Blick erschreckt. Guy war bereits als junger Mann Mitglied geworden, hatte in den letzten Jahren freilich nur selten vom Club Gebrauch gemacht, die Mitgliedschaft jedoch weiterhin aufrechterhalten. Es handelte sich um ein historisches Gebäude. Früher waren hier betrunkene Spieler am Arm von Fackelträgern diese Stufen heruntergewankt und zu ihren Kutschen getorkelt. Jetzt tasteten Guy und Box-Bender sich in der Dunkelheit vorwärts. Die ersten Glastüren waren mit Farbe überstrichen worden. Um sie herum in dem kleinen Vestibül – ein spürbar unheimliches Leuchten. Hinter der zweiten Flügeltür herrschte helles Licht, Lärm, abgestandener Zigarrenqualm und Whiskydunst. In den ersten Tagen der Verdunkelung wusste man noch nicht, wie man die Lüftung regeln sollte.
Der Club hatte gerade an diesem Tag nach dem alljährlichen Hausputz wieder geöffnet. In normalen Zeiten wäre es um diese Jahreszeit recht leer gewesen. Jetzt herrschte eher {30}Gedränge. Sie sahen viele vertraute Gesichter, doch keine Freunde. Als Guy an einem Mitglied vorüberging, das ihn grüßte, drehte sich ein anderer um und fragte: »Wer war denn das? Ein Neuer?«
»Nein, der ist schon von jeher Mitglied. Aber du errätst nie, wer er ist. Virginia Troys erster Mann.«
»Wirklich? Ich dachte, sie war mit Tommy Blackhouse verheiratet.«
»Dieser Bursche hier war noch vor Tommy dran. Seinen Namen habe ich vergessen. Soviel ich weiß, lebt er in Kenia. Tommy hat sie ihm ausgespannt, dann hat sie ’ne Weile mit Gussie zusammengelebt, und schließlich hat Bert Troy sie sich geschnappt, als sie wieder ausgerastet ist.«
»Sie ist eine phantastische Frau! Der würde ich auch keinen Laufpass geben.«
In diesem Club herrschten keine einengenden Gepflogenheiten. Es wurde ungeniert über Frauen geredet, sie wurden offen beim Namen genannt.
Box-Bender und Guy speisten und tranken dann mit einer Gruppe, die sich den ganzen Abend veränderte, manche gingen, andere kamen neu hinzu. Die Unterhaltung war lebhaft und drehte sich um Aktuelles; auf diese Weise fing Guy an, mit dieser stark veränderten Stadt wieder vertraut zu werden. Sie sprachen über häusliche Vorkehrungen und Einschränkungen. Jeder schien fieberhaft damit beschäftigt, irgendwelche Verantwortungen loszuwerden. Box-Benders Vorkehrungen spiegelten im Kleinen, was überall im Lande vor sich ging. Überall wurden Häuser zugemacht, Möbel eingelagert, Kinder verschickt, Dienstboten entlassen, Rasen umgepflügt, Witwensitze und Jagdhäuser bis an den Rand des Zumutbaren mit neuen Bewohnern belegt, überall übernahmen Schwiegermütter und Kinderfrauen die Herrschaft.
Sie redeten über Zwischenfälle und Verbrechen, die {31}während der Verdunkelung verübt wurden. Die eine hatte ihre Zähne in einem Taxi liegen lassen. Ein anderer war in Hay Hill mit Sandsäcken niedergeschlagen und all seiner Poker-Gewinne beraubt worden. Wieder ein anderer war von einem Rotkreuz-Krankenwagen überfahren worden; man hatte ihn sterbend liegengelassen.
Sie redeten über verschiedene Formen des Dienstes am Vaterland. Die meisten trugen Uniform. Überall taten sich kleine Gruppen von guten Freunden zusammen und versuchten, es einzurichten, dass sie im Krieg zusammenbleiben konnten. So bestand zum Beispiel die ganze Bedienungsmannschaft einer Scheinwerferbatterie aus einer Gruppe modischer Ästheten, die ›das monströse Regiment der Gentlemen‹ genannt wurde. Börsenmakler und Weinhändler machten sich in den Büros des Bezirkskommandos London breit. Soldaten mussten sich bereithalten, binnen zwölf Stunden aktiv Dienst zu tun. Segler trugen Uniformen der Royal Navy Volunteer Reserve und ließen sich einen Bart stehen. Für Guy schien nirgendwo Platz.
»Mein Schwager sucht übrigens nach einem Job«, sagte Box-Bender.
»Sie kommen reichlich spät, wissen Sie. Alle sind mehr oder weniger untergebracht. Selbstverständlich wird wieder großer Bedarf sein, wenn die Bombe erst mal geplatzt ist. Bis dahin würde ich abwarten.«
Sie blieben lange sitzen, niemand verspürte sonderliche Lust, ins Dunkel hinauszugehen. Keiner versuchte, mit dem Auto zu fahren, und Taxis waren rar. Sie fanden sich zu Gruppen zusammen, um gemeinsam zu Fuß nach Hause zu gehen. Guy und Box-Bender schlossen sich zuletzt einer Gruppe an, die nach Belgravia ging. Zusammen tappten sie die Treppe hinunter und machten sich in die mitternächtliche Leere auf. Es war, als wäre die Zeit zweitausend Jahre zurückgedreht worden, als London nichts weiter gewesen war als eine {32}Ansammlung umzäunter Hütten unten am Fluss. Die Straßen, durch die sie gingen, glichen verschilftem, sumpfigem Gelände.
In den nächsten vierzehn Tagen verbrachte Guy die meiste Zeit über im Bellamy’s. Er zog in ein Hotel und ging Tag für Tag gleich nach dem Frühstück hinüber in die St. James’ Street wie jemand, der in sein Büro geht. Dort schrieb er in einer Ecke des Morgenzimmers jeden Tag einen ganzen Stapel Briefe, die ihm, wie er sich schamvoll eingestand, zunehmend leichter von der Hand gingen.
Lieber General Cutter – Verzeihen Sie, dass ich Sie in dieser Zeit, in der Sie gewiss äußerst beschäftigt sind, belästige. Ich hoffe, dass Sie sich wie ich an den glücklichen Tag erinnern, da die Bradshaves Sie in mein Haus in Santa Dulcina mitbrachten und wir im Boot hinausruderten, wo wir es schändlicherweise nicht schafften, pulpi mit dem Speer zu erwischen …
Lieber Colonel Glover – Ich schreibe Ihnen, weil ich weiß, dass Sie zusammen mit meinem Bruder Gervase gedient haben und mit ihm befreundet waren …
Lieber Sam – Obwohl wir uns seit Downside nicht mehr gesehen haben, habe ich doch aus der Ferne voller Bewunderung und Stolz Deine Karriere verfolgt …
Liebe Molly – Selbstverständlich weiß ich, dass ich es nicht wissen darf, trotzdem ist mir zu Ohren gekommen, dass Alex bei der Admiralität ein großes Tier ist, etwas ganz Geheimes. Und ich weiß, dass er Dir aus der Hand frisst. Meinst Du nicht, Du könntest ein Engel sein und …
{33}Er war zu einem professionellen Bittsteller geworden.
Für gewöhnlich bekam er Antwort: eine getippte Nachricht oder einen Anruf von einer Sekretärin oder einem Adjutanten, eine Verabredung oder eine Einladung. Überall wurde er auf die gleiche höfliche Weise abgewimmelt. »Als Chamberlain nach München flog, haben wir unseren Mitarbeiterstab stark reduziert. Zwar nehme ich an, dass wir wieder aufstocken werden, sobald wir wissen, woran wir sind, aber …«, hieß es bei den Zivilisten, oder: »Unsere jüngsten Vorschriften geben Anweisung, keine Neueinstellungen vorzunehmen. Ich werde Sie auf unsere Liste setzen und dafür sorgen, dass Sie Nachricht erhalten, sobald sich etwas ergibt …«
»Diesmal wollen wir kein Kanonenfutter«, kam es vom Militär. »Was das betrifft, haben wir 1914 unsere Lektion gelernt. Da haben wir die Blüte der Nation einfach hinwegmähen lassen. Darunter leiden wir noch heute …«
»Aber ich gehöre nicht zur Blüte der Nation«, sagte Guy. »Ich bin ganz normales Kanonenfutter. Ich habe niemanden, für den ich sorgen müsste, und verfüge über keine besonderen Fertigkeiten. Außerdem werde ich alt. Ich bin bereit, sofort verfüttert zu werden. Sie sollten jetzt die Fünfunddreißigjährigen nehmen und den jungen Leuten Zeit lassen, Söhne zu bekommen.«
»Ich fürchte, von offizieller Seite ist man da anderer Ansicht. Ich werde Sie auf unsere Liste setzen und dafür sorgen, dass Sie Nachricht erhalten, sobald sich etwas ergibt …«
In den folgenden Tagen wurde Guys Name auf so manche Liste gesetzt, seine wenigen Fähigkeiten zusammengefasst und all dies in Ordnern mit der Aufschrift ›Vertraulich‹ abgelegt, die dann in den folgenden langen Jahren ungelesen verstauben sollten.
England erklärte Deutschland den Krieg, doch das {34}änderte nicht das Geringste an Guys Anträgen und Gesprächen. Es fielen keine Bomben. Es regnete weder Gift noch Feuer. Dass man sich nach Einbruch der Dunkelheit die Knochen weiterhin brach, war alles. Im Club sah er sich unversehens als Angehöriger einer großen Schar von niedergeschlagenen Männern, alle älter als er, die ohne besonderen Ruhm im Ersten Weltkrieg gedient hatten. Die meisten von ihnen waren damals von der Schulbank direkt in den Schützengraben gegangen und hatten den Rest ihres Lebens damit verbracht, den Schlamm, die Läuse und das Getöse zu vergessen. Sie hatten Befehl, auf Befehle zu warten, und redeten traurig von den verschiedenen langweiligen Abschiebeposten, die sie auf Bahnhöfen, an den Quais und in irgendwelchen Kaffs erwarteten. Die Bombe war geplatzt, doch sie waren am Boden zurückgeblieben.
Die Russen marschierten in Polen ein. Guy fand bei diesen alten Soldaten keinerlei Verständnis für seine glühende Abscheu.
»Mein lieber Mann, wir haben doch schon so genug am Hals. Wir können schließlich nicht der ganzen Welt den Krieg erklären.«
»Wozu haben wir denn dann überhaupt den Krieg erklärt? Wenn es uns nur um den Wohlstand geht, dann wäre auch der schlimmste Kompromiss mit Hitler einem Sieg vorzuziehen. Geht es uns aber um Gerechtigkeit, dann sind die Russen genauso schuldig wie die Deutschen.«
»Gerechtigkeit?«, sagten die alten Soldaten. »Gerechtigkeit?«
»Außerdem«, sagte Box-Bender, als Guy mit ihm über diese Sache sprach, über die außer ihm sonst kein Mensch nachzudenken schien, »würde das Volk nie dahinterstehen. Die Sozialisten schreien zwar wegen der Nazis schon seit fünf Jahren Zeter und Mordio, aber im Grunde ihres Herzens sind {35}sie doch alle Pazifisten. Falls sie überhaupt so was wie Solidarität aufbringen, dann für Russland. Es würde zu einem allgemeinen Streik kommen, das Land würde zusammenbrechen, wenn wir uns hinstellten und gerecht sein wollten!«
»Aber warum kämpfen wir denn überhaupt?«
»Nun, das mussten wir, verstehst du. Die Sozialisten haben uns immer verdächtigt, für Hitler zu sein – warum, weiß der liebe Gott. Und in Spanien neutral zu bleiben, war gar nicht mal so leicht. Diese ganze Aufregung darüber hast du nicht mitgekriegt, weil du ja im Ausland warst. Und ob das heikel war, kann ich dir sagen! Wenn wir uns jetzt nicht rühren, gibt das ein Chaos. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass der Krieg sich in Grenzen hält, auf Europa beschränkt bleibt und sich nicht ausbreitet.«
Das Ende all dieser Diskussionen war die Dunkelheit, die beunruhigende Nacht, die auf der anderen Seite der Tür des Clubs herrschte. Wenn es Zeit war, nach Hause zu gehen, fanden die alten Soldaten, die jungen Soldaten und die Politiker sich immer zu den gleichen kleinen Gruppen zusammen, die gemeinsam nach Hause tappten. Es gab immer jemanden, der in dieselbe Richtung ging wie Guy, immer einen freundlichen Arm. Sein Herz aber blieb einsam.
Guy hörte von geheimnisvollen Institutionen und Behörden, die nur unter ihrer Abkürzung bekannt waren oder ›die Geheimagenten von Soundso‹ genannt wurden. Bankleute, Spieler, Männer von irgendwelchen Ölgesellschaften schienen dort unterzukommen, nicht aber Guy. Er traf einen Bekannten, einen Journalisten, der ihn einst in Kenia besucht hatte. Dieser Mann, Lord Kilbannock, hatte sich in letzter Zeit als Klatschkolumnist betätigt; jetzt trug er eine Air-Force-Uniform.
»Wie haben Sie das fertiggebracht?«, fragte Guy.
»Hm, eigentlich müsste man sich dafür schämen. Da gibt es {36}einen Air Marshal, dessen Frau mit meiner Frau Bridge spielt. Er ist von jeher verdammt scharf drauf gewesen, bei uns Mitglied zu werden. Ich hab ihn vorgeschlagen. Er ist wirklich widerlich.«
»Wird er denn aufgenommen?«
»Nein, nein, dafür hab ich schon gesorgt. Mit Sicherheit gibt es drei schwarze Kugeln. Nur kann er mich nicht aus der Air Force rauskriegen.«
»Was machen Sie denn da?«
»Auch das ist etwas, wofür man sich schämen müsste. Ich bin das, was man einen ›Liaison Officer‹, einen Verbindungsoffizier, nennt. Ich führe amerikanische Journalisten durch Jagdfliegerhorste. Aber ich finde bestimmt bald was anderes. Wichtig ist ja zunächst mal, an eine Uniform zu kommen. Dann kann man sich nach was Passendem umsehen. Bis jetzt ist es ein höchst exklusiver Krieg. Wer erst mal drin ist, dem steht alles offen. Ich habe ein Auge auf Indien oder Ägypten geworfen. Irgendwo, wo’s keine Verdunkelung gibt. Meinem Wohnungsnachbarn haben sie neulich Abend draußen auf der Treppe eins über den Schädel gezogen. Ist mir alles ein bisschen zu gefährlich. Auf Orden kann ich verzichten. Ich möchte als einer von den Verschonten in die Geschichte eingehen, die gut weggekommen sind, was den Krieg angeht. Kommen Sie, lassen Sie uns was trinken.«
So verging der Abend. Jeden Morgen wachte Guy in seinem Hotelzimmer zeitig und beklommen auf. Nach einem Monat beschloss er, London zu verlassen und seine Familie zu besuchen.
Zunächst fuhr er zu seiner Schwester Angela in jenes Haus in Gloucestershire, das Box-Bender gekauft hatte, als er für den dortigen Wahlkreis ins Unterhaus geschickt worden war.
»Wir leben in einem unvorstellbaren Elend«, sagte sie am {37}Telefon. »Wir können nicht mal mehr Leute aus Kemble abholen – kein Benzin. Du wirst also umsteigen und den Bummelzug nehmen müssen. Oder den Bus von Stroud, falls der noch fährt. Aber das glaube ich eher nicht.«
Doch in Kemble entdeckte er, als er aus dem Gang trat, auf dem er drei Stunden lang hatte stehen müssen, auf dem Bahnsteig seinen Neffen Tony, der gekommen war, ihn abzuholen. Er trug Zivil. Nur sein kurzgeschorenes Haar ließ ihn als Soldaten erkennen.
»Hallo, Onkel Guy. Hoffentlich ist das eine freudige Überraschung für dich. Ich bin gekommen, um dir den Bummelzug zu ersparen. Man hat uns Urlaub vor dem Verschiffen und ein paar Benzinmarken extra gegeben. Steig ein!«
»Solltest du nicht Uniform tragen?«
»Eigentlich schon. Aber das tut kein Mensch. Ich komme mir viel menschlicher vor, wenn ich sie ein paar Stunden lang nicht anhabe.«
»Ich glaube, wenn ich meine erst habe, ziehe ich sie überhaupt nicht mehr aus.«
Tony Box-Bender stieß ein unschuldiges Lachen aus. »Das würde ich liebend gerne sehen. Irgendwie kann ich mir dich als zügellosen Soldaten gar nicht vorstellen. Warum bist du aus Italien weg? Ich hätte gedacht, Santa Dulcina ist genau der richtige Ort, das Ende des Krieges abzuwarten. Wie sind sie denn alle verblieben?«
»Vorübergehend in Tränen aufgelöst.«
»Wetten, dass du ihnen fehlst?«
»Nicht wirklich. Denen kommen leicht die Tränen.«
Zwischen niedrigen Cotswold-Mauern schaukelten sie dahin. Schließlich tauchte tief unter ihnen das Berkeley Tal auf, und der Severn glänzte braun und golden in der Abendsonne.
»Freust du dich, nach Frankreich zu kommen?«
»Na klar! In der Kaserne ist es furchtbar, den ganzen Tag {38}wird man rumgescheucht. Zu Hause ist es nicht ganz so furchtbar – alles ist mit Kunstschätzen vollgestopft, und Mum hat das Kochen übernommen.«
Das Haus von Box-Bender war ein kleines, spitzgiebeliges Herrenhaus in einem recht fortschrittlichen Dorf, in dem die Hälfte der Cottages mit Bad und chintzbezogenen Möbeln ausgestattet war. Wohn- und Speisezimmer waren bis unter die Decke mit großen Kisten vollgestellt und unbenutzbar.
»War das eine Enttäuschung, Darling«, sagte Angela. »Da dachte ich, wir wären weiß Gott wie schlau gewesen, und hatte mir vorgestellt, wir bekämen die Wallace-Sammlung und könnten in Sèvres, kostbaren Intarsien und Bouchers schwelgen. Was für ein kulturell ansehnlicher Krieg, habe ich gedacht. Stattdessen hat man uns hethitische Tabletts aus dem Britischen Museum zugewiesen, die wir noch nicht mal heimlich ansehen dürfen – nicht, dass wir das wollten, weiß Gott. Es wird furchtbar unbequem für dich, Darling! Ich hab dich in der Bibliothek untergebracht. Das obere Stockwerk ist verriegelt, damit wir bei einem Bombenangriff nicht in Panik geraten und aus dem Fenster springen – das war Arthurs Idee. Er hat wirklich an alles gedacht. Er und ich, wir schlafen im Cottage. Wir brechen uns eines Nachts bestimmt noch den Hals, wenn wir durch den Garten ins Bett rübergehen müssen. Arthur ist furchtbar streng, was die Taschenlampen angeht. Das ist doch idiotisch, in den Garten reinsehen kann sowieso kein Mensch!«
Es kam Guy vor, als ob seine Schwester redseliger geworden wäre.
»Hätten wir nicht ein paar Leute einladen sollen, wo es doch dein letzter Abend daheim ist, Tony? Ich fürchte, es wird furchtbar langweilig – aber wer ist denn auch schon da? Außerdem haben wir ja selbst kaum Platz, uns umzudrehen, jetzt, wo wir in Arthurs Büro essen.«
{39}»Nein, Mum, ich finde es viel schöner, wenn wir ganz unter uns sind.«
»Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Uns ist es so natürlich recht, aber ich finde, sie hätten euch auch zwei Abende freigeben können.«
»Ich muss zum Wecken am Montag wieder zurück sein. Wenn ihr in London geblieben wärt …«
»Aber möchtest du an deinem letzten Abend wirklich zu Hause sein?«
»Wo immer du bist, Mum.«
»Ist er nicht ein lieber Junge, Guy?«
Die Bibliothek war jetzt das einzige Zimmer, das wirklich bewohnbar war. Das für Guy bereits aufgeschlagene Bett auf dem Sofa am äußersten Ende vertrug sich nicht recht mit dem Erd- und dem Himmelsglobus am Kopfende und zu seinen Füßen.
»Du und Tony, ihr müsst euch im Klo unter der Treppe waschen. Er schläft in der Blumenkammer, der Ärmste. Und ich muss jetzt gehen und mich ums Essen kümmern.«
»Das alles ist im Grunde gar nicht nötig«, sagte Tony. »Mum und Dad scheint es einen Riesenspaß zu machen, wenn alles kunterbunt durcheinandergeht. Vielleicht kommt das daher, weil bisher immer alles so superkorrekt war. Und natürlich ist Daddy immer ziemlich knauserig gewesen. Es ist ihm von jeher gegen den Strich gegangen, wenn er das Gefühl hatte, zahlen zu müssen. Und jetzt hat er einen wunderbaren Vorwand, um sparsam zu leben.«
Arthur Box-Bender kam mit einem Tablett herein. »Du siehst, wie wir uns einschränken und uns behelfen«, sagte er. »Wenn der Krieg weitergeht, werden in ein oder zwei Jahren alle so leben müssen wie wir. Wir fangen früh damit an. Das macht richtig Spaß.«
»Du bist doch nur am Wochenende hier«, sagte Tony. {40}»Soviel ich gehört hab, hast du es in der Arlington Street recht gemütlich.«
»Jetzt glaube ich aber doch, dass du deinen Urlaub lieber in London verbracht hättest.«
»Nicht wirklich«, sagte Tony.
»Für deine Mutter wäre in der Wohnung kein Zimmer gewesen. Keine Frauen – das haben wir so festgesetzt, als wir uns entschlossen, die Wohnung gemeinsam zu nehmen. Sherry, Guy? Ich bin gespannt, wie er dir schmeckt. Stammt aus Südafrika, bald werden ihn alle trinken.«
»Dieser Eifer, in der Mode tonangebend zu sein, ist ganz neu bei dir, Arthur.«
»Schmeckt er dir nicht?«
»Nicht sonderlich.«
»Je früher wir uns an ihn gewöhnen, umso besser. Aus Spanien kommt nichts mehr.«
»Für mich schmeckt alles gleich«, erklärte Tony.
»Nun, wir trinken ihn dir zu Ehren.«
Die Frau eines Gärtners sowie ein Mädchen aus dem Dorf waren jetzt die einzigen Bediensteten. Angela hatte sämtliche leichteren und weniger schmutzigen Arbeiten in der Küche selbst übernommen. Nach einer Weile rief sie zum Essen in das kleine Arbeitszimmer, das Arthur Box-Bender gern sein ›Kontor‹ nannte. In der Stadt besaß er ein weiträumiges Büro; sein Wahlkampfvertreter hatte sein Hauptquartier in der Kreisstadt aufgeschlagen, und sein Privatsekretär saß mit Aktenordnern, Schreibmaschine und zwei Telefonen in South West London. Niemals waren in diesem Raum, in dem sie jetzt saßen, irgendwelche Geschäfte getätigt worden, doch Box-Bender hatte die Bezeichnung ›Kontor‹ zum ersten Mal aus dem Mund von Mr. Crouchback gehört, der so den Raum nannte, in dem er in Broome alle schriftlichen Arbeiten erledigte, die mit der Bewirtschaftung des Gutes verbunden {41}waren. Das klang ländlich-gediegen, dachte Box-Bender sich zu Recht.
In Friedenszeiten hatte Box-Bender häufig nette kleine Gesellschaften gegeben und acht und zehn Menschen zum Abendessen geladen. Guy erinnerte sich an so manchen Abend bei Kerzenlicht, an denen ein recht strenges Regiment geherrscht hatte, was das Verhältnis zwischen Essen und Wein betraf. Box-Bender hatte wuchtig auf seinem Sessel gesessen und war Wortführer bei Unterhaltungen über irgendwelche aktuellen Themen gewesen. Als Angela und Tony heute Abend aber häufig aufstanden, um Teller und Schüsseln zu wechseln, schien ihm weniger wohl in seiner Haut zu sein. Sein Interesse galt immer noch vielerlei aktuellen Dingen, doch waren Guy und Tony mit ihren eigenen Sorgen beschäftigt.
»Schlimm, das mit den Abercrombies«, sagte er. »Hast du gehört? Sie haben gepackt und sind mit Kind und Kegel nach Jamaika.«
»Warum auch nicht?«, meinte Tony. »Hier wären sie sowieso nur ein paar hungrige Mäuler mehr.«
»Es sieht ganz so aus, als ob auch ich noch ein hungriges Maul mehr werde«, meinte Guy. »Aber das ist nun mal eine Gefühlssache, nehme ich an. In Kriegszeiten möchte man bei seinen Leuten sein.«
»Das seh ich nicht so«, sagte Tony.
»Es gibt jede Menge nützliche Arbeit für Zivilisten«, sagte Box-Bender.
»Die Leute, die die Prentices haben bei sich aufnehmen müssen, sind alle wieder beleidigt zurück nach Birmingham«, sagte Angela. »Die hatten immer so ein unverschämtes Glück. Wir dagegen müssen uns bis an unser Lebensende mit diesen hethitischen Scheußlichkeiten abfinden, das weiß ich genau.«
»Für die Männer ist es ganz furchtbar, nicht zu wissen, wo ihre Frauen und Kinder sind«, sagte Tony. »Unser Welfare {42}Officer, der für alles Soziale zuständig ist, tut den ganzen Tag nichts anderes, als zu versuchen, sie aufzuspüren, der Ärmste. Sechs Mann aus meiner Kompanie sind auf Urlaub gegangen, ohne zu wissen, ob sie ein Zuhause haben, zu dem sie fahren können, oder nicht.«
»Die alte Mrs. Sparrow ist vom Apfelboden runtergefallen und hat sich beide Beine gebrochen. Das Krankenhaus wollte sie nicht aufnehmen, weil sie alle Betten für Schwerverwundete von Luftangriffen bereitstellen.«
»Und wir müssen Tag und Nacht einen Mann vom Luftschutz Wache schieben lassen. Das ist schrecklich langweilig. Sie rufen jede Stunde an und melden: ›Alles ruhig!‹«
»Caroline Maiden ist in Stround von einem Polizisten angehalten worden, der sie gefragt hat, wieso sie keine Gasmaske bei sich habe.«
Tony kam aus einer ganz anderen Welt, ihre Probleme waren nicht die seinen. Guy gehörte zu keiner dieser beiden Welten.
»Ich habe jemanden sagen hören, dies sei ein höchst exklusiver Krieg.«
»Nun ja, Onkel Guy, je mehr sich da raushalten können, desto besser. Ihr Zivilisten wisst ja gar nicht, wie gut ihr dran seid.«
»Vielleicht möchten wir im Augenblick aber gar nicht besonders gut dran sein, Tony.«
»Ich weiß ganz genau, was ich will. Einen schönen Orden, und eine hübsche saubere Wunde. Dann kann ich mich für den Rest des Kriegs von schönen Krankenschwestern verwöhnen lassen.«
»Bitte, Tony!«
»Entschuldigung, Mum. Mach nicht ein so furchtbar ernstes Gesicht! Sonst wünsche ich mir doch noch, ich hätte meinen Urlaub in London verbracht.«
{43}»Und ich dachte, ich halte mich prächtig. Nur, Liebling, bitte, sprich nicht davon, dass du verwundet werden könntest.«
»Nun, das ist doch aber noch das Beste, was einem passieren kann, oder?«
»Hört mal«, sagte Box-Bender, »findet ihr nicht, das wird jetzt ein wenig morbide? Geh mit Onkel Guy hinaus, während ich mit Mutter den Tisch abräume.«
Guy und Tony gingen in die Bibliothek. Die verglasten Türen gingen auf den gepflasterten Garten hinaus. »Verdammt, wir müssen die Vorhänge zuziehen, ehe wir Licht anknipsen.«
»Lass uns doch ein Weilchen nach draußen gehen«, sagte Guy.
Es war gerade eben noch hell genug, um den Weg zu erkennen. Die Luft war erfüllt vom Duft unsichtbarer Magnolienblüten, die hoch in dem alten Baum aufgegangen waren, der das halbe Haus verdeckte.
»Ich bin mir in meinem ganzen Leben noch nie weniger morbid vorgekommen«, sagte Tony. Als er und Guy in die zunehmende Dunkelheit hinausschlenderten, brach er das Schweigen erneut und platzte unvermittelt heraus: »Sag mal, wie ist das eigentlich, wenn man verrückt wird. Sind viele aus Mums Familie plemplem?«
»Nein.«
»Da war doch aber Onkel Ivo, oder?«
»Ivo hat unter übermäßiger Schwermut gelitten.«
»Und das ist nicht erblich?«
»Nein, nein. Warum? Hast du das Gefühl, du verlierst den Verstand?«
»Noch nicht. Aber ich habe etwas gelesen – von einem Offizier im letzten Krieg, der ganz normal erschien, bis er an die Front kam. Da schnappte er total über, und sein Unteroffizier musste ihn erschießen.«
{44}»Übergeschnappt kann man Onkel Ivo nicht nennen. Er war in jeder Beziehung ein äußerst zurückhaltender Mensch.«
»Und wie steht es mit den anderen?«
»Sieh mich an. Sieh deinen Großvater an – und deinen Großonkel Peregrine, der ist doch geradezu erschreckend normal.«
»Er verbringt seine Tage damit, Ferngläser zu sammeln und sie ans Kriegsministerium zu schicken. Nennst du das normal?«
»Durchaus.«
»Bin ich froh, dass du das sagst.«
Endlich rief Angela sie. »Kommt rein, ihr beiden. Es ist schon ganz dunkel. Worüber redet ihr denn?«
»Tony glaubt, er wird verrückt.«
»Mrs. Groat ist es wirklich. Sie hat die Speisekammer nicht verdunkelt.«
Mit dem Rücken an Guys Bett gelehnt, saßen sie in der Bibliothek. Recht bald erhob Tony sich und sagte gute Nacht.
»Messe ist um acht«, sagte Angela. »Wir sollten zwanzig vor losfahren. Ich muss in Uley noch ein paar Evakuierte mitnehmen.«
»Ach, gibt’s denn nicht noch später eine? Ich hatte gedacht, ich könnte mal richtig ausschlafen.«
»Und ich dachte, wir könnten morgen früh alle zusammen zur Kommunion gehen. Komm doch mit, Tony.«
»Na schön, Mum, natürlich komm ich. Nur dann lieber um fünf nach halb. Ich muss noch unbedingt beichten – nach Wochen des sündhaften Lebens!«
Box-Bender machte ein verlegenes Gesicht, wie immer, wenn über religiöse Bräuche gesprochen wurde. Er konnte sich einfach nicht daran gewöhnen, an diesen selbstverständlichen Umgang mit dem Erhabenen.
»Ich bin im Geiste bei euch«, sagte er.
{45}Dann verabschiedete auch er sich und wankte durch den Garten zum Cottage. Angela und Guy waren allein.
»Er ist ein bezaubernder Junge, Angela.«
»Ja, nicht wahr? Und so ein ordentlicher Soldat! Und das in den wenigen Monaten! Er hat überhaupt nichts dagegen, nach Frankreich zu gehen.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Ach, Guy, du bist einfach zu jung, um dich noch zu erinnern. Ich bin mit dem Ersten Weltkrieg erwachsen geworden. Ich bin eines der jungen Mädchen, von denen du nur gelesen hast – die mit Männern getanzt haben, die dann fielen. Ich weiß noch, wie das Telegramm kam, in dem wir von Gervase erfuhren. Du warst nur ein kleiner Schuljunge, der nicht genug Süßigkeiten kriegen konnte, weil sie so knapp waren. Ich erinnere mich noch an die erste Gruppe, die auszog. Nicht einer davon ist wiedergekommen. Was für eine Chance hat denn ein Junge wie Tony, wo er von Anfang an dabei ist? Ich habe doch im Lazarett gearbeitet, wie du weißt. Deshalb war es mir unerträglich, als Tony von einer hübschen sauberen Verwundung redete und dass er von Krankenschwestern verhätschelt werden würde. Es gibt keine hübschen sauberen Verwundungen. Sie waren alle ganz scheußlich, und diesmal werden vermutlich auch noch alle möglichen chemischen Waffen eingesetzt. Er hat keine Ahnung, wie es sein wird. Und diesmal besteht ja noch nicht einmal Hoffnung, dass er in Gefangenschaft gerät. Unter dem Kaiser waren die Deutschen noch ein zivilisiertes Volk. Aber diese Wilden heute sind zu allem fähig.«
»Angela, ich kann nur sagen, du weißt ganz genau, dass du Tony kein bisschen anders haben möchtest. Du willst doch nicht, dass er zu diesen Feiglingen gehört, die auf und davon sind und sich nach Irland oder Amerika absetzen.«
»Das ist natürlich ganz und gar unvorstellbar.«
{46}»Na also, was dann?«
»Ich weiß, ich weiß. Es ist Zeit zum Schlafengehen. Ich fürchte, dein ganzes Zimmer ist verräuchert. Du kannst das Fenster aufmachen, nachdem du das Licht ausgeknipst hast. Gott sei Dank ist Arthur schon vorausgegangen. Da kann ich meine Taschenlampe benutzen, ohne mir vorwerfen lassen zu müssen, die Zeppeline anzulocken.«
In dieser Nacht lag Guy lange wach – hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis nach frischer Luft und nach Licht, bis er schließlich die frische Luft dem Lesen vorzog – und dachte: Warum Tony? Was für ein Wahnsinn, einen jungen Menschen sinnlos zu opfern und ihn am Leben zu lassen? Wurde man in China zu den Waffen gerufen, galt es als ehrenvoll, einen armen jungen Mann zu engagieren und ihn zu schicken, statt selbst zu gehen. Tony war reich an Liebe und einer verheißungsvollen Zukunft. Er selbst, Guy, war bar all dieser Dinge und besaß nichts als ein paar trockene Körnchen Glauben. Warum konnte nicht er an Tonys Stelle nach Frankreich gehen, sich die hübsche saubere Wunde holen oder in barbarische Gefangenschaft geraten?
Doch als er am nächsten Morgen zwischen Angela und Tony am Altargitter kniete, war ihm, als vernähme er die Antwort in den Worten der Messe: Domine, non sum dignus.
3
Guy hatte vorgehabt, zwei Tage zu bleiben und am Montag nach Matchet weiterzufahren, um seinen Vater zu besuchen. Doch stattdessen fuhr er bereits am Sonntag vor dem Mittagessen, um Angelas letzte Stunden mit Tony nicht zu stören. Die Fahrt hatte er schon oft gemacht. Box-Bender hatte ihn immer mit dem Auto bis Bristol gebracht und sein Vater {47}