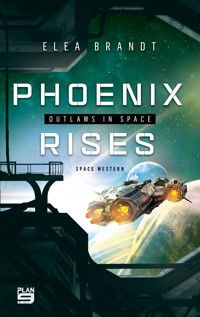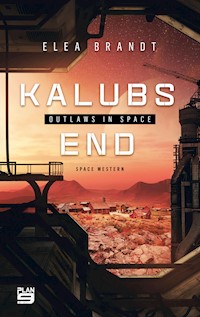Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mantikore-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In der Stadt des Blutigen Gottes herrscht das Recht des Stärkeren. Als der Assassine Varek angeheuert wird, einen Mord aufzuklären, klingt das nach einer willkommenen Abwechslung von seinem verhassten Tagewerk. Doch die einzige Zeugin, das Freudenmädchen Idra, weiß mehr, als sie preisgeben will. Um an ihre Informationen zu gelangen, geht Varek ein Bündnis mit ihr ein, das ihn schmerzhaft an bessere Zeiten erinnert. Die Spur des goldenen Skarabäus führt ihn schließlich zu einem grausamen Kult, der mehr als nur ein Blutopfer verlangt ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 576
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
OPFERMOND
– Deutsche Erstauflage –
1. AuflageVeröffentlicht durch denMANTIKORE-VERLAG NICOLAI BONCZYKFrankfurt am Main 2017www.mantikore-verlag.de
Copyright © der deutschsprachigen AusgabeMANTIKORE-VERLAG NICOLAI BONCZYKText © Elea Brandt
Lektorat & Korrektorat: Nora-Marie BorruschSatz: Karl-Heinz ZapfKarte: Hauke KockCovergestaltung: Rossitsa Atanassova & Matthias Lück
VP: 164-124-01-04-1017
eISBN: 978-3-945493-37-3
Elea Brandt
OPFERMOND
Roman
Inhalt
DANKSAGUNG
PROLOG
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
EPILOG
DANKSAGUNG
Wenn ihr, liebe Leser, diese Geschichte in Händen haltet, dann ist für mich ein langgehegter Traum in Erfüllung gegangen, nämlich der, meinen ersten Roman zu veröffentlichen. Auf diesem Weg haben mich sehr viele Menschen begleitet und unterstützt, und ich möchte es nicht versäumen, mich bei ihnen zu bedanken.
Zunächst gilt mein Dank meinem Verleger Nic für die Chance, mein Debüt bei Mantikore veröffentlichen zu dürfen. Ebenso danke ich meiner großartigen Lektorin Nora, die das Bestmögliche aus diesem Roman herausgelockt hat.
So weit wäre es aber gar nicht gekommen, gäbe es nicht den Tintenzirkel, in dessen motivierender und wertschätzender Atmosphäre »Opfermond« entstanden ist und ohne den ich es vermutlich nie gewagt hätte, mein Manuskript einem Verlag anzubieten. Danke für all die Jahre der Unterstützung, ihr seid großartig!
Ein besonderer Dank gilt auch meinen tapferen Beta-Lesern Christopher, Jakob, Markus, Mona und Tim, die sich durch abenteuerliche Rohfassungen dieses Romans kämpfen mussten und mich mit ihrem Lob, ihrer Kritik und ihrem konstruktiven Feedback angespornt haben, die Geschichte weiter zu optimieren.
Last but not least möchte ich mich bei den Menschen bedanken, die meinen Traum von der Schriftstellerei schon seit vielen Jahren mit mir träumen und mich immer in diesem Wunsch bestärkt haben: Bei meinen Eltern, die in mir die Liebe zur Literatur geweckt haben, bei meiner Schwester, die so viel Kreativität zu geben hat, und vor allem bei meinem Lebensgefährten Flo, der meinen Schreibwahnsinn nicht nur toleriert, sondern sogar nach Kräften unterstützt. Danke für alles!
Wenn ihr, liebe Leser, die Zeit findet, würde ich mich sehr über eine Rezension oder ein kurzes Feedback zu »Opfermond« freuen. Auch falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr gerne Kontakt zu mir aufnehmen, über Twitter, Facebook oder meine Homepage www.eleabrandt.com. Dort könnt ihr auch über weitere Projekte aus meiner Feder auf dem Laufenden bleiben.
Alles Liebe,Elea Brandt
PROLOG
Der Tod war ein ständiger Begleiter im Sha-Quai. Er lauerte in schimmligem Brot, in eitrigen Ausschlägen und in beißendem Hunger. Manchmal kam er schleichend, manchmal unvorhergesehen.
So wie für ihn.
Der Mörder hatte Idra den Rücken zugewandt. Hektisch durchsuchte er das Gewand des Toten und riss den Stoff auseinander. Das Knallen hölzerner Fensterläden in der Ferne ließ ihn zusammenfahren. Sein Blick wanderte in Idras Richtung, rastlos, panisch. Sie presste sich gegen die Häuserwand, wagte kaum, zu atmen. Warum ausgerechnet du? Angespannt lauschte sie in die Stille und vernahm schließlich Schritte, die sich entfernten und zwischen den engstehenden Häusern verhallten.
Vorsichtig verließ Idra ihr Versteck und lugte die Straße hinunter. Niemand war mehr zu sehen. Kein Wunder, kein Mensch, der bei Verstand war, trieb sich mitten in der Nacht in diesem Teil der Stadt herum. Abgesehen von dem Idioten, der vor Idra im Dreck lag, und der hatte die Rechnung dafür kassiert.
Blut aus einer tiefen Kopfwunde verklebte seine schwarzen Locken und zeichnete rostrote Schlieren in den Staub. Aus trüben Augen starrte der Tote ihr entgegen, während schon die ersten Ratten vom Gestank des Blutes angelockt wurden.
Idra musterte den Mann abschätzig. Wenn er versucht hatte, seine Herkunft mit dem billigen Leinenkaftan zu verschleiern, hatte er sich dabei beschissen dämlich angestellt. Saubere Fingernägel, gesunde Zähne, gepflegte Hände – niemand, der im Sha-Quai lebte, sah lange so aus.
Verstohlen blickte Idra sich um. Schnell, bevor andere Aasgeier ihr die Beute streitig machen konnten, kniete sie neben der Leiche nieder und durchsuchte mit flinken Fingern jede Stoffbahn des knöchellangen Gewandes. Der Mörder hatte sich wenig Zeit gelassen, gut möglich, dass er etwas übersehen hatte.
Da! Mit triumphierendem Lächeln fischte sie einen Ring aus einer Falte hervor und drehte ihn in den Fingern. Sah hübsch aus. Wahrscheinlich Gold mit einem Siegel darauf, verziert mit einem kleinen, grünen Stein. Idras Herz raste beim Gedanken daran, wie viel das Ding wert sein würde – Maruq zahlte ihr sicher zwei oder drei Drami dafür.
Dafür konnte sie mondelang Fladenbrot und Datteln kaufen – oder ihre Ersparnisse aufstocken, um endlich aus diesem Drecksloch zu verschwinden. Eilig schob sie die Beute in ihren Rock, während ihre Finger weiter nach verborgenen Taschen suchten.
Irgendwas war da, Idra spürte es genau. Sie zog ihr Messer aus dem Lederband um den Oberschenkel und zerschnitt das Obergewand des Toten. Sie durfte sich nicht ewig Zeit lassen. Jederzeit konnte ein Besoffener vorbeitorkeln und sie entdecken! Sie riss eine zweite Stoffbahn auseinander und hielt endlich das Objekt der Begierde in der Hand.
Verdammter Mist.
Enttäuschung überkam sie, als sie das in Leder gebundene Buch betrachtete, das kaum größer war als ihre Handfläche. Was bei Kaibath und allen Daimonen sollte sie mit einem beschissenen Buch? Sie schnaubte abfällig, drehte es in den Fingern und stopfte es schließlich in die Tasche ihres Kleides. Gelegenheiten musste man ergreifen, solange man konnte. Vielleicht war es ja doch noch zu was gut.
Sie musterte den Toten, als sie aufstand. War mal ein netter Anblick gewesen. Schlanke Hände, weiche, dunkle Augen, etwas kräftig um die Taille. Warum trieb sich einer wie der bei den Strichjungen herum? Sah nicht aus, als hätte er es nötig.
Ein Windstoß fuhr die Gasse hinunter, schoss unter Idras Kleider und jagte ihr eine Gänsehaut über den Rücken. Fröstelnd schlang sie sich die Arme um den Leib. So brüllend heiß die Tage waren, so schneidend kalt konnten die Nächte in Ghor-el-Chras sein.
Jetzt, wo die Anspannung abflaute, spürte Idra die Müdigkeit in ihren Knochen. Ihre Glieder waren schwer, ihre Augen brannten und ihr Unterleib fühlte sich an, als hätte ihr jemand einen Dolch zwischen die Beine gerammt. Unsicher warf sie einen Blick über die Schulter. War da ein Geräusch? Schritte? Oder doch nur das Jaulen des Wüstenwindes?
Die Härchen in ihrem Nacken richteten sich auf. Keine besonders kluge Idee, in den frühen Morgenstunden allein in den düsteren Ecken des Sha-Quai herumzulungern. In den letzten Wochen hatten die Rattenfänger regelmäßig verstümmelte Leichen aus dem Kanal gezogen, und Idra wollte keine davon werden.
Schwerfällig schleppte sie sich die Gasse hinunter und atmete erleichtert durch, als sie die beleuchtete Hurenstraße erreichte. Die Nacht war lang gewesen. Lang und widerlich. Zeit für ein wenig Schlaf.
1.
Die Dunkelheit kroch auf Varek zu wie ein lauerndes Raubtier. Sie schlich aus allen Ritzen und Nischen hervor und verdrängte das orangerote Licht des scheidenden Tages. Varek beschleunigte seine Schritte. Die Schatten fluteten die Schluchten zwischen den Lehmhäusern, die so dicht standen, dass kaum ein Sonnenstrahl dazwischen hindurchfiel. Hölzerne Anbauten, voll behangene Wäscheleinen und steinerne Erker verschluckten das letzte bisschen Licht.
Vareks Füße flogen über den Boden, wirbelten roten Sand auf. Es kribbelte in seinem Nacken, das Blut rauschte ihm in den Ohren. Nicht mehr weit.
Licht und Dunkelheit im steten Wechselspiel. Die Abendsonne malte groteske Schatten an die Hauswände: Klauen, nach Varek ausgestreckt, klagende Gesichter, zu Fratzen verzogen. Er rannte. Spürte die Kälte seinen Rücken hinunterlaufen, die Gewissheit, dass sich die Schatten zusammenzogen, ihn verschlangen, ihn bestrafen würden für jeden vergossenen Tropfen Blut.
Endlich! Varek trat auf den Marktplatz hinaus und hielt inne, lehnte sich gegen eine Häuserwand und genoss die warmen Sonnenstrahlen auf dem Gesicht. Das Geplapper der Menschen, Blöken der Kamele und Knarzen der Ochsenkarren umfing ihn wie eine Wolke, schirmte die Schatten von ihm ab, die er in den Gassen zurückließ.
Varek wischte sich den Schweiß von der Stirn und schalt sich in Gedanken für seine Schwäche. Wenn sie ihm jetzt entwischte, war es allein seine Schuld. Er straffte die Schultern und ließ den Blick schweifen, hielt Ausschau nach … Da! Ein dunkelviolettes Seidenkleid, das aus dem Meer schlichterer Farben regelrecht herausstach. Varek atmete auf. Die Abkürzung hatte sich also doch gelohnt.
Er stieß sich von der Mauer ab und ließ sich vom Strom der Menschen treiben, verschmolz mit ihm, als sei er ein Teil der Beute und nicht ihr Jäger. Im Grunde war es der perfekte Moment. Die Menschen erwarteten den Tod in dunklen Gassen, kalten Nächten oder zwielichtigen Spelunken, doch in den Abendstunden am belebten Basar wähnten sie ihn in weiter Ferne.
Zielstrebig bahnte Varek sich einen Weg durch die Menschenmenge. Hunderte Stände drängten sich in einem Meer aus Farben aneinander, eng in die kleinen Ladenbuchten gepresst, die die Straße säumten. Die Stimmen der Menschen und das Schnauben der Kamele wurden nur vom Geschrei der Händler übertönt, die mit schrillen Stimmen Feigen, Schmuck oder Handwerkskunst anpriesen. Über allem lag der schwere Dunst von Rauchkräutern und Gewürzen, der sich mit dem Schweiß der Menge vermischte.
Ein freudloses Lächeln zerrte an Vareks Mundwinkeln. Ja, der Basar war ein hervorragendes Bild für Ghor-el-Chras – überfüllt, laut, stinkend und stets von einer Ahnung des Betrugs umweht.
Varek behielt sein Ziel unbeirrt im Auge, folgte der Frau in angemessenem Abstand. Sein Herzschlag blieb dabei völlig ruhig. Flankiert von ihrem Leibwächter, einem übereifrigen Burschen, der kaum die zwanzig erreicht haben konnte, strich sie an der Auslage der Händler vorbei und ließ sich immer wieder in Gespräche verwickeln. Ein hübsches Tuch aus tirsanischer Seide band ihre Aufmerksamkeit. Begeistert ließ sie es durch ihre Finger gleiten und feilschte mit dem Händler, einem hageren Südländer, um den Preis.
Varek bahnte sich einen Weg durch die Menge, den Blick starr auf sein Ziel gerichtet. Alles um ihn her verblasste. Er sah keine Gesichter, hörte keine Gespräche, alles verschwamm zu einem monotonen Summen. Jetzt stand er direkt hinter ihr. Langes, schwarzes Haar, weich wie Seide, floss über ihre Schultern und fiel in lockigen Kaskaden weit auf ihren Rücken hinab. Ihr Haar duftete nach Rosen. Nach Rosen, genau wie bei …
Vareks Hände zitterten. Das Mädchen war noch jung. Vielleicht sechzehn oder siebzehn Jahre alt. Er hatte nicht gefragt, warum sie sterben sollte. Es brauchte ihn nicht zu interessieren. Lautlos zog er je einen Dolch aus seinen versteckten Lederscheiden. Seine Hände umschlangen die Griffe. Sein Puls stieg an.
Wie so oft in diesen Momenten erschien es ihm, als habe jemand die Zeit angehalten. Der Strom der Menschen um ihn her floss langsamer. Die Geräusche und Gerüche verloren an Intensität. Es gab nur sein Ziel und die weichen Stellen unter ihrem Rippenbogen.
Jetzt. Vareks lederner Handschuh verschloss ihren Mund. Im selben Moment drang die Klinge durch das Seidenkleid, durch die Haut und durch das Fleisch. Zwei saubere Nierenstiche, erst rechts, dann links. Nicht so offensichtlich wie ein Kehlenschnitt, aber nicht weniger tödlich. Der Schrei verkam zu einem Wimmern. Varek zog die Hand zurück, die Frau taumelte herum und ihre Blicke trafen sich.
Tiefe, dunkle Mandelaugen, die sich mit Tränen füllten.
Es war dieselbe stumme Frage, die ihm jeder in dieser Situation stellte: Warum?
Varek kannte die Antwort nicht. Blut tropfte zu Boden und tränkte das Seidenkleid mit schmutzigem Braun. Ihr Schicksal war besiegelt. Genau wie das des Ungeborenen, das sie gut sichtbar unter dem Herzen trug.
Varek stockte der Atem. Der Anblick des gewölbten Bauchs, der sich unter fließendem Stoff abzeichnete, ließ ihn erschaudern. Jede Faser seines Körpers schrie nach Flucht – und doch verharrte er einen Bruchteil zu lang. Er sah die Klinge des Leibwächters noch rechtzeitig, um zurückzuweichen. Das Stimmengewirr schwoll an zu einem Orkan. Frauen schrien, Männer brüllten. Er musste verschwinden. Ohne seinen Angreifer zu beachten, fuhr Varek herum, stieß einen Passanten beiseite und tauchte in der Menge unter. Sein Verfolger blieb rasch zurück. Er wusste schließlich noch nicht, dass seine Herrin und das Kind sterben würden. Aber Varek wusste es.
Rücksichtslos bahnte er sich einen Weg durch die Massen, bis er sich einfach vom Strom weitertragen ließ und mit ihm verschmolz. An einer Häuserecke verließ er den Basar und lehnte sich keuchend gegen die Wand. Er zog das Kopftuch herunter und genoss die kühle Brise, die angenehm über seine verschwitzte Haut strich. Sein Atem stabilisierte sich, sein Puls wurde ruhiger. An einem Lappen wischte er die Klingen sauber und ließ sie danach in die verborgenen Dolchscheiden zurückgleiten. Vor Einbruch der Dunkelheit. Wie abgemacht.
Für einen Moment legte er den Kopf zurück und schloss die Augen. Ein Kind. Niemand hatte von einem Kind gesprochen, verdammt! Weil es dich nichts angeht, Abschaum.
Varek ignorierte die hässliche Stimme in seinem Kopf und horchte nur auf seinen ruhiger werdenden Atem und das rhythmische Pochen seines Herzens. Noch vor wenigen Jahren hätte er länger gezögert. Er hätte sich gefragt, ob er einem jungen Mädchen das Leben nehmen durfte, das vermutlich nur beim falschen Mann gelegen hatte. Mittlerweile hatten selbst diese Fragen an Bedeutung verloren. Er wusste genau, wo er die Klinge anzusetzen hatte. In welchem Winkel er zustechen musste. Wie lange es dauerte, bis sein Opfer bewusstlos wurde. Du bist die Bestie geworden, die du zu sein verdienst.
Behäbig wandte Varek sich zum Gehen. Seine Beine waren schwer, die Energie, die ihn vom Tatort fortgetragen hatte, verebbte mit jedem Schritt. Der Weg zum alten Brunnen war noch weit, er musste sich beeilen. Wenn der Gong zum Sonnenuntergang erklang, sollte er am Treffpunkt sein. Die Schatten wurden immer dunkler. Nicht lange und sie würden ihn verschlingen.
»Wie vereinbart.«
Varek nickte und nahm den klirrenden Lederbeutel wortlos entgegen.
»Zwanzig Drami. Wollt Ihr es nicht nachzählen?«
»Nein.«
Der Kontaktmann zuckte die Schultern.
»Wie Ihr meint.«
»Ihr habt nichts von einem Kind gesagt.«
Überrascht hob der Fremde eine Augenbraue. Er war eine dieser nichtssagenden Gestalten, die man sofort vergaß, wenn sie dem Blickfeld entschwanden. Von normalem Wuchs mit gebräunter Haut, dunkelhaarig, in schlichten Kleidern mit einem roten Fez auf dem Haupt. »Was schert es Euch?«
Varek schüttelte den Kopf. »Nichts.« Er öffnete den Lederbeutel und ließ die goldenen Münzen langsam zwischen seinen Fingern hin und her gleiten. Ein kleines Vermögen für einen einfachen Auftrag. Die Hälfte davon ging an die Chras-Kirche, seinen Schirmherrn. Den Rest konnte er behalten.
»Mein Herr ist sehr zufrieden«, warf der Kontaktmann beflissen ein. »Er wird wieder auf Euch zurückkommen, sofern er Eurer Dienste bedarf.«
Varek nickte. Der abschätzige Blick seines Gegenübers war ihm nicht entgangen. Für die Menschen dieser Stadt waren die Unbestechlichen Abschaum, nicht mehr wert als der Dreck unter ihren Fingernägeln. Liebend gern sahen sie auf sie herab, bespuckten sie, nannten sie »Monster« und »Bestien« – und im selben Atemzug hinterließen sie einen Beutel Gold für einen Mord. Dreckige Heuchler.
»Danke«, entgegnete Varek verspätet. »Ihr wisst ja, wo Ihr mich findet.«
Der Kontaktmann nickte. Er ließ seinen Blick noch einmal über den Platz gleiten, bevor er sich umdrehte und hastig in der nächsten Straße verschwand. Varek steckte den Geldbeutel in eine Innentasche seines Gewands und ging.
Die Nacht war über Ghor-el-Chras hereingebrochen, ein fahler Mond beleuchtete die Dächer der niedrigen Lehmhäuser und die Laterne in Vareks Hand drängte die Schatten zurück. Gerade fiel es ihm leicht, die Panik zu bekämpfen, die Gedanken anderen Dingen zuzuwenden als der Angst vor dem, was im Dunkeln lauern konnte. Im Sha-Nuri wurde es nach Sonnenuntergang schnell ruhig, so, wie es die betuchten Bürger des Viertels schätzten, und diese Ruhe schien auch Vareks Gemüt zu besänftigen. Kerzenschein aus offenen Fenstern warf weiches Licht auf die Straße, während aus den Teehäusern Gelächter drang, gepaart mit dem Duft von Honiggebäck, Kardamom und Tabak.
Nur der eine oder andere Passant kreuzte Vareks Weg: Handwerker auf dem Weg nach Hause, Händler, die über das Tagesgeschäft plauderten. Niemand beachtete ihn, und das war gut so. Je weniger Menschen die Straßen füllten, desto weniger starrten ihn an.
Im Schatten einiger Palmen schlenderte Varek weiter und wich einer Schar ausgemergelter Sklaven aus, die unter dem strengen Blick eines blutrot gewandeten Aufsehers das Pflaster von Dreck und Kamelmist reinigten. Eine edle Profession, verglichen mit der seinen.
Kurz vor dem Eisernen Tor, das den Abschaum des Sha-Quai aus den inneren Stadtgürteln fernhielt, erreichte Varek sein Ziel. Er bog in eine Gasse ab und atmete genüsslich den vertrauten Dunst aus Alkoholdämpfen, Rauschkraut und Duftölen ein, der ihm entgegenzog. Erwartungsvoll schob er den Perlenvorhang beiseite und betrat die Traumhöhle. Das Summen von gedämpften Gesprächen und das Blubbern von Wasserpfeifen lag in der Luft, und in einer Ecke zupfte ein junger Mann mit dichtem Wangenbart eine unaufdringliche Melodie auf dem Qanun.
Die ruhige Atmosphäre der Teestube legte sich wie Balsam auf Vareks aufgewühltes Gemüt. Mit einem stillen Lächeln ließ er sich an einem der Tische im hinteren Teil des Lokals nieder und warf das rotgemusterte Kopftuch beiseite.
»Sei mir gegrüßt, mein Freund.« Mit zitternden Fingern platzierte der alte Bradhu einen Becher Dattelwein vor Varek auf dem Tisch und grinste ihn zahnlos an. »Das Übliche?«
»Ja. Danke.«
»Harten Tag gehabt?«
Varek seufzte. Er sprach nie über seine Arbeit, doch bei Bradhu machte er eine Ausnahme. Es tat gut, zu wissen, dass man ihn hier wie einen Menschen behandelte, nicht wie ein Tier. Der Alte strafte ihn nicht, er verurteilte ihn nicht – und dafür war ihm Varek dankbar. »Wie immer, Bradhu«, antwortete er ernst, während er einen tiefen Schluck Dattelwein nahm. Die schwere Süße stieg ihm schnell zu Kopf. Genau das, was er jetzt brauchte.
»Tisha bringt dir die Wasserpfeife«, erwiderte der Alte, ohne weitere Fragen zu stellen. »Soll sie dir Gesellschaft leisten?«
Varek zögerte, dann nickte er. »Warum nicht? Ist sie neu?«
»Hab sie von einem dieser Rohlinge aus dem Sha-Quai«, bejahte Bradhu. »Kommt aus einem der Sklavenhäuser, ich vermute, sie hat die letzten Jahre in irgendeinem Bordell verbracht. Hübsches Mädchen, sehr folgsam.«
Varek reichte ihm wortlos drei silberne Münzen, doch beim Versuch, sie in seine Geldkatze zu stecken, entglitten sie Bradhus zitternden Fingern.
»Wird schlimmer«, murmelte er, während Varek für ihn das Geld vom Boden aufhob. »Bald hat’s mich.«
»Unsinn, alter Mann.« Varek lächelte mild. »Ich wette, du wirst mich noch überleben.«
Bradhu grinste, sodass sich die Fältchen um seinen Mund in die dunkle, wettergegerbte Haut gruben. »Wir werden sehen.« Er schlurfte zum Tresen zurück und nur wenig später trug ein junges Mädchen eine Wasserpfeife an Vareks Tisch. Sie war eine pathranische Schönheit von vielleicht achtzehn Jahren mit bronzefarbener Haut, pechschwarzen Augen und den längsten Wimpern, die Varek je gesehen hatte. Wie für Sklaven üblich, war ihr Kopf kahl geschoren, nur weicher schwarzer Haarflaum spross darauf. Ein hauchdünnes Kleid umspielte ihren Körper und ließ ihre Rundungen verheißungsvoll hervortreten, doch zugleich enthüllten sie das Sklavenzeichen, das ihre Besitzer ihr in den Hals gebrannt hatten.
Sie platzierte die Wasserpfeife vor Varek und reichte ihm mit einer demütigen Verbeugung den Schlauch. »Mein Name ist Tisha.« Die klangvolle Sprachmelodie und die langgezogenen Vokale waren typisch für das Volk der Feuerinseln. »Ich stehe zu Eurer Verfügung, Herr.«
Varek deutete auf eines der Sitzkissen an seiner Seite. »Setz dich.«
Ihm entging nicht, dass sie seine Stirn intensiv musterte, während sie neben ihm Platz nahm. Das V-förmige Brandmal, durchkreuzt von einer waagerechten Linie, wies ihn unmissverständlich als das aus, was er war: Abschaum. Es war eine alte Sigille des Chras-Glaubens, die für »Gehorsam« stand, und damit kaum mehr als Sklavenzeichen.
»Fürchtest du dich vor mir?«, fragte Varek sacht, doch Tisha schüttelte hastig den Kopf.
»Nein, Herr. Nein, niemals.« Mit einem koketten Lächeln überspielte sie ihre Betroffenheit und legte die Hand anzüglich auf Vareks Oberschenkel. Als sie sich vornüberbeugte, gestattete sie ihm einen tiefen Blick in ihren Ausschnitt. »Ihr seid ein stattlicher Mann. Jede Frau würde sich glücklich schätzen, Euch zu Diensten sein zu dürfen.«
Varek seufzte, widersprach ihr aber nicht, dazu fehlte ihm heute die Kraft. Tisha hatte ihren Text gut gelernt – und er hatte keine Lust, ihre Worte zu hinterfragen.
Ich bin fast doppelt so alt wie du, Kleines, dachte Varek, während er einen tiefen Zug von der Wasserpfeife nahm. Wärst du frei, würdest du einen weiten Bogen um mich machen.
Er schürzte die Lippen und ließ den Rauch in langsamen Stößen entweichen, sodass er in Ringen bis zur Decke stieg und sich dort zerteilte. Der süßliche Geschmack des Shir-Sharak füllte Vareks Lungen und er spürte eine angenehme Ruhe in sich aufsteigen. Seufzend lehnte er den Kopf gegen die Wand und schloss die Augen.
Blut, das über seine Hand floss.
Anklagende Mandelaugen.
Ein schmerzerfüllter Schrei.
Ein sterbendes Mädchen.
»Geht es Euch gut, Herr?«
Varek richtete sich abrupt auf, Schweiß perlte von seiner Stirn. »Ja«, stieß er hervor und löste die Finger, die sich hektisch ins Sitzkissen gegraben hatten. »Alles bestens.«
Er zog ein weiteres Mal an der Wasserpfeife und lauschte versonnen auf das gleichmäßige Blubbern. Wärme erfasste seine Brust und ein leichtes, wohliges Schwindelgefühl ließ die Luft vor ihm flirren. Er legte den Kopf zurück und schloss die Augen – das Shir-Sharak tat seine Wirkung.
Diesmal waren die Bilder, in die er eintauchte, um ein Vielfaches angenehmer. Hell, freundlich, tröstend. Vor ihm tanzten bunte Funken, die in ungewöhnlichen Farben pulsierten, und in seinem Kopf ertönten Laute von so überirdischer Schönheit, dass sie ihm den Atem raubten. Die absonderlichsten Gerüche drangen an sein Ohr und er schmeckte die in Regenbogenfarben schimmernden Klänge auf der Zunge. Ein anregendes Prickeln erfasste seinen gesamten Körper, es schien ihm, als schwebe er auf Wolken. Es gab keinen Schmerz. Keine Trauer. Keine Dunkelheit.
Längst vergessene Erinnerungen an schönere Tage bahnten sich einen Weg in Vareks Bewusstsein. Er sah seinen Vater, einen braun gebrannten Mann mit breiten Schultern, der ihm mit stolzgeschwellter Brust seine erste Waffe überreichte. Wie von fern beobachtete er sich und seinen Bruder dabei, wie sie mit nackten Oberkörpern im seichten Ufer des Pirh nach Fischen jagten. Und er erblickte sich selbst im einvernehmlichen Handschlag mit dem Bar-Amin, der ihn als Leibwächter verpflichtete.
Er ließ sich fallen und versank gänzlich im weichen Meer der Erinnerungen. Ja, es hatte bessere Tage gegeben. Jene Tage, in denen er für das Wohl seiner Auftraggeber gekämpft und nicht das Blut unschuldiger Mädchen vergossen hatte. Tage, in denen er noch geliebt hatte.
Ein zärtliches Lächeln huschte über seine Lippen, als sich seine Gedanken Tirabeth zuwandten. Fünfzehn Jahre waren seither vergangen, und doch sah er sie noch so genau vor sich, als stünde sie ihm gegenüber. Ihr feines Gesicht, das einer Porzellanfigur glich. Das volle, dunkle Haar und vor allem die sanften, saphirblauen Augen, die wie Sterne leuchten konnten. Er rief sich ins Gedächtnis, wie sich ihre seidenen Haarsträhnen zwischen den Fingern anfühlten, wie es war, ihre Lippen zu küssen. Ihre weiche Stimme raunte in sein Ohr und er roch den Duft ihres Haares. Rosenblüten.
Doch just in dem Moment, als er Tirabeth berühren, die Hand nach ihr ausstrecken wollte, zersplitterte das Bild in tausend funkelnde Scherben.
Varek blinzelte. Die Konturen der Traumhöhle um ihn her verschwammen, nur die Kerzen und Öllampen waren als pulsierende Leuchtpunkte in der Ferne zu erkennen. Mit fahrigen Fingern griff er nach der Wasserpfeife und nahm einen weiteren tiefen Zug. Tisha saß immer noch neben ihm, an seine Schulter gelehnt, und streichelte sanft seine Brust. Gedankenverloren fuhr er mit den Fingerspitzen über ihren schwarzen Haarflaum, während die weichen, sonoren Farben der Lampions in seinen Ohren dröhnten. Mit einem genüsslichen Seufzer ließ er sich auf die Sitzkissen sinken und bettete seinen Kopf auf Tishas Schoß. Ihre Finger tanzten über seine Wange, seinen Hals hinunter, und er stellte sich vor, es wäre keine wildfremde Sklavin, sondern Tirabeth, die ihn liebkoste. So wie früher.
Varek hatte jedes Zeitgefühl verloren, als er eine harsche Berührung an der Schulter spürte. Die Wirkung des Shir-Sharak ließ bereits nach, ihn fröstelte. Seine Zunge wog schwer, ebenso sein Kopf, und schon das Licht der Öllampe stach ihm in den Augen.
Er setzte sich schwerfällig auf, bevor er sich umblickte. Tisha schien die ganze Zeit pflichtbewusst neben ihm gewacht zu haben, doch nicht sie hatte ihn so unsanft wachgerüttelt, sondern eine zweite Gestalt, die mit verschränkten Armen vor ihm stand.
»Guten Abend, mein Freund. Was dagegen, wenn ich Platz nehme?«
Varek blinzelte noch einmal, sein Blick wurde klarer und offenbarte ihm die Umrisse der Person vor ihm. Er brauchte nicht lange, um den kleingewachsenen Mann mit den kinnlangen, fettigen Haaren, den stechenden Froschaugen und der tiefen Narbe am Hals zu erkennen, der sich ungeniert neben ihm auf einem Kissen niederließ. Varek knurrte widerwillig. Der Kerl kroch immer im ungeeignetsten Moment aus seinem Loch hervor, genau wie der lästige Nager, den er sich als Spitznamen auserkoren hatte.
»Herzlichen Dank.« Der Mungo grinste und griff nach dem Schlauch der Wasserpfeife. »Bist ein echter Kumpel.« Als er zog, musste er enttäuscht feststellen, dass sich die Kohle auf dem Tontopf bereits gänzlich in Asche verwandelt hatte, und er legte den Schlauch beiseite.
Varek straffte seine Glieder und bat Tisha um ein Glas Wasser. Während die Sklavin zur Theke eilte, wandte er sich seinem ungebetenen Gast zu: »Was willst du?«
Der Mungo grinste und offenbarte dabei die fauligen Stumpen in seinem Mund. Interessiert prüfte er Vareks Weinglas, das zu seinem Missfallen leer war, und antwortete schließlich: »Glaub mir, ist nicht deine Nähe, die ich so schätze. Ich hab einen Auftrag für dich.«
Varek wartete, bis Tisha das Wasserglas brachte, und leerte es in einem Zug. Es klärte seinen Geist und rann angenehm kühl seine raue Kehle hinunter. »Schon wieder?«
»Ja, viel los zur Zeit.« Der Mungo zwinkerte. »Der Auftrag könnte dir aber gefallen. Ziemlich ungewöhnlich, für dich wahrscheinlich genau das Richtige.« Er lächelte gönnerhaft. »Drum komm ich ja zu dir, alter Freund, und nicht zu einem der anderen.«
Varek verdrehte genervt die Augen und stieß zwischen zusammengekniffenen Zähnen hervor: »Ich höre?«
»Na also. Viel weiß ich natürlich nicht, wie immer. Heißt, ein ziemlich hohes Tier hätte nach einem Unbestechlichen gesucht. Informationsgewinn, kein Mord. Und es ist dringend.«
Kein Mord. Die Worte hallten in Vareks Kopf wider. Das klang zu schön, um wahr zu sein. »Du weißt nicht, wer der Auftraggeber ist?«
»Nee, da sind die vorsichtig. Hab nur das, was ich dir eh gerade gesagt hab. Und einen Treffpunkt, wenn du einwilligst.«
Varek seufzte. Aufträge von ganz oben bedeuteten nie etwas Gutes. Je höher seine Klienten gestellt waren, desto abstruser und perverser waren ihre Anliegen. Doch die Aussicht, diesmal keinen Mord an einer unschuldigen jungen Frau oder einem aufstrebenden Burschen begehen zu müssen, war verlockend.
»Ich bin einverstanden«, erwiderte er schwerfällig. Seine Zunge wollte ihm immer noch nicht richtig gehorchen. »Wann und wo?«
»Morgen zur Mittagsstunde, im Rosenbad.«
Varek runzelte die Stirn. »Im Bad?«
Der Mungo zuckte die Schultern. »Komischer Ort für ne Anwerbung, was?« Er grinste anzüglich. »Vielleicht will dein künftiger Auftraggeber gleich mal deine speziellen Qualitäten sehen?«
Varek schnaubte. Er hasste es, wenn der Mungo seine Gedanken aussprach. »Losungswort?«
»Keines. Sag denen einfach, du wirst erwartet.«
Varek nickte und fischte aus seinem Geldbeutel eine Silbermünze, die er seinem Gegenüber hinwarf. »Danke. Du kannst gehen.«
»Großzügig wie immer.« Der Mungo ließ das Geld in seine Tasche gleiten und erhob sich. »Man sieht sich.«
Varek nickte abwesend und war froh, als der Kerl schlurfend um die Ecke verschwand. Sein Kopf dröhnte und seine Kehle fühlte sich trotz des Wassers trocken und rau an. Das war der Nachteil am Shir-Sharak. So angenehm seine Wirkung auch war, die Nachwehen spürte man oft noch Stunden später.
Tisha, die sich während des Gesprächs artig im Hintergrund gehalten hatte, ließ sich neben Varek nieder und lächelte ihn an. Auf ihrer Haut tanzten kleine, goldene Lichtfunken, und Varek hatte den Eindruck, als würden sich ihre langen Wimpern im Klang der fernen Musik bewegen.
»Fühlt Ihr Euch wohl, Herr?«
Varek nickte und betrachtete sie einen Moment. Ungeniert blieb sein Blick an den sanften Rundungen ihrer Brüste und den dunklen Knospen hängen, die sich unter dem Seidenstoff abzeichneten. Es brauchte nicht viel Fantasie, um sich ihren Körper nackt vorzustellen. Wie es wohl wäre, den Glanz in ihren schwarzen Augen zu sehen, wenn sie zum Höhepunkt kam?
Varek schüttelte sich energisch. Nein, nicht heute! Unter dem Einfluss des Shir-Sharak litt seine Willensstärke, das wusste er. Er sollte es nicht darauf ankommen lassen. Um weitere Versuchungen zu vermeiden, erhob er sich von seinem Sitzkissen und nickte Tisha zu. »Ich werde dann gehen.«
Sie verneigte sich tief und Angst zuckte über ihr Gesicht. »Ich hoffe, ich habe Euch nicht gelangweilt?«
»Mitnichten«, erwiderte Varek und schenkte ihr ein Lächeln. »Ich werde Bradhu sagen, dass ich sehr zufrieden war.«
Die Traumhöhle war mittlerweile deutlich leerer als bei Vareks Ankunft, nur vereinzelte Gestalten saßen noch beisammen und rauchten oder tranken Tee.
Bradhu selbst erweckte trotz seines Alters noch keinen Anschein von Müdigkeit. Eifrig füllte er gerade einen Becher mit Wein, als Varek zum Tresen trat. »Du willst schon gehen?«
Varek nickte. »Ich muss morgen bei Kräften sein. Danke für alles.« Er bezahlte für die Wasserpfeife, den Wein und das Wasser und legte noch ein ordentliches Trinkgeld nach.
»Die Kleine ist süß, nicht wahr?«, fragte Bradhu grinsend, während er das Geld in eine Schatulle packte. »Ein wahres Goldstück.«
»Zweifellos.«
»Du weißt, du kannst sie haben, wenn du …«
»Nein, danke«, unterbrach ihn Varek, bevor er es sich doch noch anders überlegte. »Nicht heute. Ich gehe nach Hause.«
Der Alte grinste zahnlos. »Wie du willst. Wir sehen uns.«
An einer Kerze im Eingangsbereich entzündete Varek seine Öllampe und verließ die Traumhöhle. Erst an der nächsten Biegung fiel ihm auf, dass er Bradhu doppelt für das Shir-Sharak und den Dattelwein bezahlt hatte. Er tat den Gedanken mit einem Schulterzucken ab. Geld bedeutete ihm nichts, sollte sich der Alte davon ein paar warme Decken gegen sein Gliederzittern gönnen.
Varek richtete seinen Blick starr nach vorne, wo der Schein der Lampe seinen Weg erhellte. Er mied es, an all die schwarzen Flecken und dunklen Nischen zu denken, konzentrierte seine Aufmerksamkeit ganz auf das beruhigende Flackerlicht der Kerze.
Da – war da nicht etwas in seinem Augenwinkel? Eine huschende Bewegung? Vareks unsteter Blick suchte irritiert nach der Quelle. Die Straße war menschenleer.
Er beschleunigte seine Schritte, zwang sich, die Augen unverwandt geradeaus zu richten. Hinter ihm, da war etwas! Das Geräusch von Stiefeln auf dem Kopfstein? Vareks Finger umschlossen den Griff seines Krummsäbels, doch eine tiefe, beängstigende Gewissheit ließ ihn erahnen, dass er mit einer Klinge gegen diese Dämonen nichts ausrichten konnte. Er sah sich nicht um. Seine Beine gehorchten kaum, er stolperte vorwärts, und erst als der Mond zwischen den Wolkenfetzen hervorbrach, gönnte er sich eine Pause. Das weiche, weiße Licht flutete die Straße und ließ die bedrohlichen Schatten zurückweichen. Varek konnte wieder atmen, der Druck auf seinen Lungen wich.
Es wurde schlimmer, Tag für Tag. Mit jedem Tropfen Blut, den er vergoss, mit jedem Leben, das er auslöschte, kroch die Dunkelheit näher. Irgendwann würde sie ihn verschlingen. Aber nicht heute!
Mit pochendem Herzen erreichte er das Tor zu seinem Haus, das sich unauffällig in die Häuserreihe einfügte. Er hatte die wenigen Treppenstufen zur Tür noch nicht erklommen, als sie bereits aufglitt.
»Willkommen zuhause, Herr.«
Hastig stolperte Varek an seinem Diener vorbei in den lichtdurchfluteten Eingangsraum und spürte Erleichterung in sich aufsteigen. Er war froh darüber, dass Ramid, sein Erster Diener, zu so später Stunde noch persönlich die Tür öffnete. Der Mann diente ihm lange genug, um seine Ängste zu kennen, und stellte keine unnötigen Fragen. Varek nahm einen tiefen Atemzug und schloss dann die Türe hinter sich. Seine Schultern brannten, so sehr hatte er sich verkrampft, und er fühlte immer noch die bedrohliche Enge in seiner Brust.
»Wünscht Ihr ein Bad, Herr?«
Varek schüttelte den Kopf. »Danke, aber ich ziehe mich zurück.«
»Es ist alles bereit, Herr.«
Varek schätzte die ruhige, knappe Art seines Dieners. Er war kein sonderlich emotionaler Mensch, kam all seinen Aufgaben pflichtbewusst nach und Anzüglichkeiten oder andere Sticheleien waren ihm fremd. Auch diesmal hatte er keinen Grund, seinen Diener zu tadeln. Obwohl er seit den Mittagsstunden außer Haus gewesen war, hatte man sein Bett gerichtet und das gesamte Zimmer mit drei Dutzend hell brennender Kerzen ausgeleuchtet.
Varek entledigte sich seiner Kleider und warf sie achtlos über einen Sessel, bevor er sich nackt aufs Bett fallen ließ. Wie jeden Abend hatte Ramid ihm einen Schlummertrunk auf den Nachttisch gestellt, eine Mischung aus Palmwein und Remian-Extrakt. Die einzige Chance, einigermaßen Schlaf zu finden. In einem Zug leerte Varek den Becher und versank dann zwischen den Bergen aus Samtkissen.
2.
»Er ist tot, Herrin.«
Alrha verharrte auf ihrem Platz und schwieg wie vom Donner gerührt. Wortlos starrte sie auf die schillernd polierte Platte des Teetisches zu ihren Füßen und versuchte, die Tragweite dieser Aussage zu begreifen. Ihre Stimme zitterte kaum, während sie sich auf dem Diwan aufrichtete. »Wie ist er gestorben?«
Der Sklave, der mit geneigtem Kopf am Boden kauerte, antwortete: »Er wurde erschlagen und ausgeraubt, Herrin. Man fand seinen Leichnam in einer Straße des Sha-Quai.«
Sie starrte den Sklaven an. Etwas Eiskaltes rann ihre Kehle hinunter und wollte ihr Herz am Schlagen hindern. Das war nicht möglich. Das durfte nicht sein. Am liebsten hätte sie einen Schrei ausgestoßen, beherrschte sich aber mühsam und grub die Finger in ein Kissen. Sklaven waren geschwätzig. Sie durfte sich nicht hinreißen lassen. »Ausgeraubt?«
Der Sklave nickte. »Gold und Schmuck wurden gestohlen.«
Alrhas Glieder zitterten vor Anspannung, trotzdem trat sie vor den Sklaven und brachte ihn mit einem eisigen Blick dazu, aufzustehen. »Was noch?«
»Herrin, ich …«
»Was noch?« Ihre Stimme schwoll an, sie grub die langen Fingernägel in den Oberarm des Sklaven, bis er aufschrie. »Rede! Hatte er ein Buch bei sich, als man ihn fand?«
»Nein, Herrin«, wimmerte der Sklave und schüttelte den Kopf. »Nein, der Herr hat nichts von einem Buch gesagt.«
Alrhas Atem stockte für einen Augenblick, dann begann ihr Puls zu rasen. Ihre Worte waren kaum mehr als ein Hauch.
»Es ist … weg?«
»Ich weiß nicht, Herrin«, stammelte der Sklave, der sich ängstlich vor ihr duckte. »Ich sollte Euch nur in Kenntnis setzen. Diesbezüglich müsst Ihr mit …«
»Schweig!« Ihr Körper zitterte so sehr, dass sie die Hände auf die Oberschenkel pressen musste, um sich zu beruhigen. Ihr Herz hämmerte schmerzhaft gegen ihre Rippen, sie konnte kaum atmen. Stille. Sie brauchte Stille, sie musste nachdenken. Ruhelos schritt sie im Teesalon auf und ab, holte tief Luft, verdrängte die Panik.
Tot. Das Rezeptbuch fort. Je länger sie nachdachte, desto heftigere Verzweiflung erfasste ihre Brust. Die Zeit lief ihnen davon, nur noch acht Tage! Und wenn jemand das Buch in die Finger bekam – sie durfte gar nicht daran denken! Der Sklave stand immer noch unschlüssig im Raum, zusammengekrümmt wie ein Häuflein Elend, als hätte man ihm gerade die schlechte Nachricht überbracht und nicht ihr. Erbärmliches Geschöpf. Alrhas Blick fiel auf den Tisch zu ihren Füßen, wo neben der Kanne mit Ingwertee auch eine Schale mit Blutorangen stand, daneben ein scharfes Messer. Ein Lächeln kräuselte ihre Lippen. So verlockend.
Eine kurze, scharfe Klinge, die mühelos durch die Kehle des Sklaven dringen würde. Sie könnte ihm beim Todeskampf zusehen, beobachten, wie das Leben Tropfen für Tropfen aus ihm herausschoss und den teuren Teppich unter ihren Füßen tränkte. Sie würde das Gefühl genießen, die unwerte Kreatur vor ihren Füßen leiden zu sehen, würde die Verzweiflung einfach mit seinem Blut hinwegwaschen …
Nein! Alrha straffte sich und hob das Kinn. So anregend der Gedanke war, es würde zu viel Aufmerksamkeit erregen. Und es würde ihr Problem nicht lösen, sondern die Sorgen nur für einen Moment ertränken.
»Es soll jemand angeheuert werden, Herrin«, wagte der Sklave nun vorsichtig zu sagen. »Jemand, der sich um die Angelegenheit kümmern soll.«
»Wer?«
»Ein Unbestechlicher.«
Alrha runzelte die Stirn. Ein Unbestechlicher, ausgerechnet? Jemand, der unter der Schirmherrschaft der Chras-Kirche agierte? Was hatte er sich dabei gedacht? Nervös wischte sich Alrha die schweißnassen Handflächen an ihrem Seidenkleid ab. Ob er etwas ahnte? Ob er wusste, dass sie und Kashir …? Nein. Das war ausgeschlossen. Sie wäre nicht mehr am Leben, wenn er auch nur den Hauch einer Ahnung hätte.
Mit bemüht fester Stimme schickte sie den Sklaven hinaus und ließ sich dann auf eines der Sitzkissen nieder. Wenigstens war sie allein, die Anwesenheit der anderen Frauen hätte sie gerade nicht ertragen. Naive, verwöhnte Weiber. Kein Umgang für sie.
Bebend tasteten Alrhas Finger nach dem Amulett um ihren Hals und umklammerten es. So viele Jahre der Vorbereitung und Planung. Sie durfte nicht scheitern, es hing so vieles davon ab. Alles. Sie brauchte das verdammte Rezeptbuch.
Zitternd goss sie sich kalten Tee ein und stürzte ihn hinunter. Es hatte keinen Sinn, die Nerven zu verlieren. Noch blieb Zeit. Noch war der Opfermond fern.
3.
Endlich!
Mit einem erlösenden Grunzen gruben sich seine Finger in Idras Haar und sein Schwanz erschlaffte wenig später zwischen ihren Lippen. Sie gönnte ihm noch einen Moment, bevor sie sich den Mund abwischte und ächzend aufstand. Ein spitzer Stein hatte sich in ihr Bein gebohrt und ihre Knie taten weh. Zum Glück war es vorbei. Während Askar zufrieden grinsend seine Hose hochzog, nahm Idra einen tiefen Schluck aus ihrem Flachmann, um den unangenehm bitteren Geschmack mit Anisschnaps zu überdecken, und spuckte den Inhalt auf den staubigen Boden der Gasse.
Askar schloss schwer atmend seinen Gürtel und schnürte das Hemd zu. Anstelle seiner Lederrüstung trug er heute einfache Leinenkleider, auffällig daran war nur das goldene Skarabäus-Amulett, das in dem Moment unter seinem Hemd verschwand.
Mit unruhigen Fingern kramte er einige Münzen aus seinem Beutel und drückte sie Idra in die Hand. Drei Sherkai. Immerhin war er großzügig und nicht so ungepflegt wie die anderen Kerle, mit denen sie es sonst trieb. Er stank nicht nach Schweiß und billigem Palmwein und in der Regel waren seine Eier gewaschen. Mit den breiten Schultern, den markanten Wangenknochen und den dunkelbraunen Augen sah er nicht einmal schlecht aus. Genau aus dem Grund fragte sich Idra auch, was ihn ausgerechnet zu ihr und in diesen dreckigen Winkel der Stadt führte, statt in eines der besseren Freudenhäuser. Ihr bestechender Charme konnte es wohl kaum sein.
»Willst du mehr?« Idra stellte die Frage aus Gewohnheit, war aber erleichtert, als Askar den Kopf schüttelte. Eine Pause war verlockend.
»Nein«, brummte er und kaute dabei nervös auf seiner Unterlippe. »Ich hatte genug.«
Idra runzelte irritiert die Stirn. Der unstete Blick und das seltsame Zucken in den Augenwinkeln passten überhaupt nicht zu einem Mann, der erst vor wenigen Augenblicken abgespritzt hatte. »Is noch was?«
Er druckste, zögerte mit der Antwort. »Du wirst mich wohl eine Weile nicht sehen.«
»Na und?« Sie lachte auf. »Denkst du, ich heul mich in den Schlaf, weil ich mich nach deinem Schwanz sehne?«
»Halt’s Maul«, knurrte Askar und griff erneut in den Lederbeutel, an dem er bisher nur herumgespielt hatte. »Du könntest mir einen kleinen Gefallen tun.«
»Wieso?«
»Du brauchst Geld, oder nicht? Außerdem könnte ich beim Khari ein gutes Wort für dich einlegen.«
Idra verzog keine Miene, um ihn ihre Gedanken nicht wissen zu lassen, doch ihr Herz schlug unruhig gegen ihren Brustkorb. Askar und ihr Zuhälter waren gute Freunde, sie sah die beiden regelmäßig in der Geißel beim Kartenspiel. Wenn Askar diesen Trumpf aus dem Ärmel zog, konnte das nur Ärger bedeuten. Welche kranke Scheiße willst du mit mir anstellen, he?
Sie mochte nur eine dahergelaufene Straßenhure sein, aber sie war immer noch eine freie Frau und keine Sklavin, mit der ein perverser Spinner alles machen konnte, was er wollte. Für einen Moment überkam sie ein Anflug von Panik. Wusste er es? Nein. Wenn dem so wäre, hätte er sie schon längst abgestochen. Oder?
Sie streckte den Rücken durch, hob den Kopf und reckte das Kinn empor. Nur keine Schwäche zeigen. »Und was soll ich dafür tun?«
»Ganz einfach«, erwiderte Askar. »Ich gebe dir fünf Rassiden und du erzählst niemandem, dass ich vor zwei Tagen bei dir war.«
Idras Augen weiteten sich bei der Summe und sie krallte die Finger in den Stoff ihres Rocks. »Das ist alles? Ich soll nur die Klappe halten?«
Askar nickte. »Genau das.« Er machte einen Schritt auf sie zu, Idra wich zurück. Ihr Rücken prallte gegen eine Hauswand. Kein Fluchtweg. Er packte ihren Oberarm und umschloss ihn wie eine Eisenschelle. Sein Gesicht kam ihr so nah, dass sie seinen heißen Atem auf der Wange spürte. »Versuch ja nicht, mich übers Ohr zu hauen. Ich denke, ich würde deine hübsche Nase sehr vermissen, wenn der Khari mit dir fertig ist.«
Idra entwand sich schnaubend seinem Griff und kämpfte den Drang nieder, Askar einen Tritt in die Eier zu verpassen. Keine gute Idee, die eigenen Stammfreier zu vergraulen. »Keine Sorge«, gab sie schnippisch zurück und leckte sich anzüglich über die Lippen. »Ich bin ein artiges Mädchen.« Mit gierigem Blick beobachtete sie, wie Askar die versprochenen fünf Rassiden aus seiner Geldkatze nahm. Fünf beschissene Silbermünzen! Heute war wirklich ihr Glückstag.
Grinsend zog Askar die Hand weg, als Idra danach greifen wollte. »Nicht so gierig, Kleines. Also, was wirst du tun?«
»Wenn jemand fragt, hab ich dich nicht gesehen, kenn deinen Namen nicht und hab dir nie einen geblasen.«
»Kluges Mädchen.« Zu Idras Missfallen warf er ihr das Geld achtlos vor die Füße, sodass es im Sand versank. »Und vergiss es nicht.«
Während er ging, bückte Idra sich fluchend nach den Münzen, die zu ihrem Glück silbern aus dem Dreck hervorschimmerten. Arrogantes Arschloch, dachte sie. Wenn du dich noch mal hier blicken lässt, beiß ich dir deinen Schwanz ab.
Sie rieb die Münzen an ihrem Rock ab und ein wohliger Schauer überkam sie. So viel verdiente sie sonst in drei Nächten nicht. Sie konnte ihren Zuhälter mit einer Rasside abspeisen, mehr wollte er nie. Und dann war da ja noch … Angespannt griff sie in die Tasche ihres Kleides und atmete erleichtert auf, als sie das kühle Metall des Schmuckstücks spürte. Sie konnte Maruq gleich jetzt einen Besuch abstatten, um ihm den Siegelring zu verkaufen. Sie freute sich auf den Besuch bei ihrem alten Freund und hoffte, dass er ihr – wie immer – eine Tasse Tee anbieten und etwas mit ihr plaudern würde. Freundliche Gesichter waren selten im Sha-Quai.
Zufrieden schlenderte sie die Hurenstraße hinunter, die nachts von Abschaum überlaufen war. Dutzende abgerissener Gestalten in verschlissenen Kleidern mit überschminkten, blassen Gesichtern säumten den Weg und warteten auf Kundschaft. Viele waren bei Weitem zu jung, um von geilen Böcken begafft zu werden, und andere zu alt, um überhaupt noch Kerle anzulocken. Hitzköpfe prügelten sich auf offener Straße um ein paar Kröten und aus den Spelunken drang dreckiges Gelächter und dichter Qualm.
Ja, das Typische am Sha-Quai war tatsächlich sein Gestank, der allgegenwärtige Mief von Pisse und billigem Schnaps. Idra dachte schon lange nicht mehr darüber nach, in wessen Scheiße sich ihre nackten Füße bewegten oder wessen Körper am Straßenrand von Kötern und Ratten zernagt wurde. Man musste hart werden, wenn man im Sha-Quai überleben wollte, und das war sie. Sie trug ihren Kopf aufrecht und sie konnte sich immer noch in die Augen sehen, ohne vor Scham im Boden zu versinken. In diesem Loch eine echt große Leistung.
Das Haus des Pfandleihers lag ein Stück von der Hurenstraße entfernt, sodass die Gassen in Dunkelheit getaucht waren. Einzig der fahle Mond erhellte die staubigen Straßen. Der Lärm der Betrunkenen und das Grölen der Freier erstarb langsam, machte drückender Stille Platz. Trotzdem verspürte Idra keine Angst, im Gegenteil, es überkam sie ein dumpfes Gefühl von Vertrautheit. Sie wählte den Weg, der am Badehaus vorbeiführte, denn der Duft des Jasminstrauchs, dessen Zweige dort über die Mauer lugten, überdeckte für eine Weile den Mief des Sha-Quai. Nur zwei Straßen weiter lag das Haus, in dem sie aufgewachsen war. Eine Mietskaserne mit winzigen Zimmern, die nach faulem Obst und Rattenscheiße gestunken hatten. Trotzdem erinnerte sich Idra auch an angenehme Gerüche. An den Duft des Linseneintopfs, den ihre Mutter gekocht hatte, wenn sie das Geld dafür erübrigen konnte. Oder an das schwere Räucherwerk, das sie nachts entzündet hatte, um böse Geister und Moskitos fernzuhalten. Und an den Gestank von Eiter und Fäulnis.
Idra wischte den Gedanken energisch beiseite und atmete tief durch, damit der Druck auf ihrer Brust verschwand. Dann beschleunigte sie ihre Schritte. Keine schweren Gedanken, nicht heute. Heute war ein guter Tag.
Maruqs Stube fiel unter all den niedrigen Lehmhäuschen kaum auf. Einzig das rostige Schild über der Tür verriet, dass man hier schnelles Geld machen konnte. Gedämpftes Licht drang durch die zugezogenen Vorhänge auf die Straße und Idra war überrascht, dass die morsche Holztür geschlossen war. Maruq machte den größten Umsatz mit verschuldeten Spielern, notgeilen Freiern und abgebrannten Sharakis, die für einen Topf Rauchkraut die eigene Mutter verkaufen würden. Mit Einbruch der Nacht konnte er sich vor Kunden meist gar nicht retten.
Was hatte Maruq dazu gebracht, seinen Laden zu schließen? Ob er in Schwierigkeiten steckte? Idra mochte den alten Mann, obwohl er mittlerweile sabberte und ständig ihren Namen vergaß. Nach dem Tod ihrer Mutter hatte Maruq ihr ein Dach über dem Kopf gegeben und dafür gesorgt, dass sie zu essen hatte, obwohl sie nichts weiter als ein verwahrlostes Kind aus der Nachbarschaft gewesen war.
Idra spitzte die Ohren. Ein dumpfes Knurren drang aus dem Inneren der Hütte, gefolgt von lautem Kläffen. Maruqs Hunde. Warum veranstalteten die Biester einen derartigen Lärm? Ein dumpfes Gefühl breitete sich in ihrem Magen aus, erfasste jede Faser ihres Körpers. Es war wie eine düstere Ahnung, wie eine gestaltlose Bedrohung, die ihre Klauen ausstreckte. Idra kannte dieses Gefühl gut, und es trog sie selten. Verstohlen blickte sie sich um. Kein Mensch zu sehen. Sollte sie einfach …?
Mit einem heftigen Ruck warf sie sich gegen die morsche Tür und ohne großen Widerstand gab sie nach. Idra fuhr herum, bereit, sofort wieder die Flucht anzutreten, doch von Maruqs Kötern war weit und breit nichts zu sehen. Das Kläffen kam aus dem Zwinger am Ende des Raumes, genau wie der Gestank von Fell, nassem Stroh und Hundescheiße. Idra legte die Stirn in Falten. Wieso sperrte Maruq die Tiere ein? Eigentlich waren sie der Hauptgrund, warum er nicht ständig von gierigen Schlägerbanden überfallen wurde.
»Maruq?« Idras Blick glitt über das menschenleere, dunkle Innere der Pfandleiherstube und sie setzte vorsichtig einen Fuß vor den anderen. »Maruq, bist du hier?«
Keine Antwort. Der kleine Raum roch muffig, nach modrigem Stoff und alten Menschen. Idras Blick glitt über den haarsträubenden Plunder, der den Raum noch kleiner wirken ließ, als er war. Verrostete Schilde hingen an der Wand, geborstene Spiegel, halb verbrannte Teppiche und ein riesiges, abstruses Gebilde, das Idra an das Geweih einer Springgazelle erinnerte. Um Diebe abzuschrecken, stellte Maruq im vorderen Teil seiner Stube nur wertlosen Kram zur Schau. Teurere Sachen fanden sich im Hinterzimmer.
Idra trat an den Tresen heran, auf dem sich Armreife, angelaufene Bronzeteller, mit Grünspan überzogene Löffel und fremdländische Münzen stapelten. Sie musste lächeln. Sie erinnerte sich noch gut daran, wie sie dem Pfandleiher als Mädchen geholfen hatte, seine Waren zu polieren und die Münzen zu zählen. Er hatte ihr dafür immer eine Kleinigkeit geschenkt, manchmal ein Spielzeug, das niemand ausgelöst hatte, später billige Schmuckstücke. Idra hatte ihn unzählige Male angebettelt, ihr Arbeit zu geben – vergebens. Mit trauriger Miene und einem Verweis auf seine eigene beschissene Lebenssituation hatte er sie abgewiesen. Sie machte ihm keinen Vorwurf, jeder musste sehen, wo er blieb. Immerhin hatte sie dank Maruq ein gutes Gespür für Wertsachen. Wenn sie etwas stahl, wusste sie immer, wie viel sie dafür bekommen konnte.
Sie umrundete den Tresen, klopfte vernehmlich an der Hintertür und horchte. Da, da war etwas! Ein leises Stöhnen, rasselnd, kaum menschlich. Hau ab, befahl ihr die vernünftige Stimme im Kopf. Verpiss dich. Jetzt.
Idra ignorierte sie. Beschissene Neugier, irgendwann würde die sie den Kopf kosten. Mit der rechten Hand zog sie ihr Messer hervor, mit der Linken griff sie nach der Klinke. Sie atmete tief durch, umfasste den Dolchgriff und stieß die Tür auf.
Staubige Dunkelheit gähnte ihr entgegen und eine Unordnung, die ihresgleichen suchte. Vorsichtig schlich sie in den Raum. Kleidertruhen und Geldschatullen stapelten sich bis fast unter die schiefe Decke, Pergamente lagen über den Boden verstreut und die Regale waren voll von Büchern, Schmuckkästchen und noch mehr Plunder. Ein Glück, dass Idra wusste, dass es unter Maruqs Dach immer so aussah, andernfalls hätte sie glauben können, jemand habe ihn ausgeraubt.
Sie räusperte sich vernehmlich. »Maruq?«
Keine Antwort.
»Maruq, bist du da? Ich bin’s, Idra.«
Vorsichtig trat sie einige Schritte in den Raum hinein, da spürte sie etwas Weiches unter ihrem nackten Fuß. Ein gequältes Stöhnen ließ sie zurückschrecken.
»Scheiße!« Hastig machte sie einen Satz zurück und starrte direkt in Maruqs Gesicht, auf das fahles Mondlicht fiel. Wirr stammelnd kniff er die Augen zusammen, und Idra entfuhr ein entsetztes Keuchen. Blut quoll in dünnen Fäden unter Maruqs Lidern hervor, verklebte die farblosen Wimpern und versickerte in seinem struppigen Bart. Selbst das Weiße in seinen Augen hatte sich rot verfärbt. Die Haut des Pfandleihers war so grau, wie Idra es nur von Todgeweihten kannte, und flammende Pusteln überzogen seine knochigen Arme. Reflexartig brachte Idra Abstand zwischen sich und den alten Mann und prallte mit dem Rücken gegen die Tür. Was auch immer er hatte, vielleicht war es ansteckend!
Maruq gab ein Japsen von sich, das in einen rasselnden Husten überging. Blut und Galle sprenkelten den Boden und Idra ahnte, dass der Alte aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen konnte.
Für einen Moment verharrte sie und blickte auf den gekrümmten Körper herab. Sie sollte verschwinden, um nicht selbst noch krank zu werden. Andererseits war es Maruq, der da vor ihr lag, nicht irgendein besoffener Freier. Sie erinnerte sich an den verschmitzten Blick, mit dem er ihr hier und da eine Münze zugesteckt hatte. Daran, wie er seine Hunde einmal auf eine Bande Schläger gehetzt hatte, die Idra direkt vor der Pfandleiherstube eingekesselt hatten. Nein, es kam ihr ungerecht vor, Maruq in seinem eigenen Dreck verenden zu lassen. Was, bei allen Daimonen, konnte er sich eingefangen haben?
Idra atmete tief durch, dann bückte sie sich, griff dem alten Mann um die Hüfte und zog ihn hoch. Mit seiner ausgemergelten Gestalt wog er kaum mehr als ein Sack Feigen. Wimmernd klammerte sich Maruq an Idra fest, ihm fehlte die Kraft, sich allein auf den Beinen zu halten. Mühsam schleppte Idra ihn durch die Schreibkammer bis zur Tür am hinteren Ende, die offen stand. Das Zimmer des Pfandleihers war winzig und beherbergte neben einem Bett nur noch eine Waschschüssel, einen morschen Schrank und einen Tisch mit zwei zerfressenen Sitzkissen. Außerdem stank es hier erbärmlich. Kein Wunder, dass er krank ist.
Ächzend ließ Idra den alten Mann auf sein Bett sinken und entzündete anschließend eine Öllampe, um etwas Licht zu machen. Bestialischer Gestank biss in ihren Augen und sie hatte den Grund dafür recht bald gefunden: eine Holzschüssel neben dem Bett, randvoll mit Erbrochenem. Angewidert warf sie die Schüssel mitsamt Inhalt durch das kleine Fenster nach draußen.
Maruq hatte sich zusammengekrümmt, er zitterte am ganzen Leib. Seine hüftlangen, zu dicken Filzsträhnen zusammengedrehten Haare klebten am Körper, der vor kaltem Schweiß glänzte, Sabber hing in seinem Vollbart und der grobe Leinenkaftan war mit Blut besprenkelt.
Armer alter Mann. Idra wusste, dass sie nicht bleiben sollte, doch das Mitgefühl mit Maruq hielt sie zurück. Im Sterben sollte man nicht allein sein.
Idra schauderte. Ihre Mutter hatte das gesagt, und bisher hatte sie es immer beherzigt. Seufzend musterte sie den alten Mann und sah das Leid in seinen blutunterlaufenen Augen. Den Schmerz, der ihn in Wellen schüttelte. Nein, Maruq hatte verdient, dass jemand bei ihm blieb, bis es vorbei war.
»Du wirst sterben, alter Mann«, flüsterte Idra. »Ich kann’s nicht ändern, aber vielleicht kann ich’s dir leichter machen.«
Maruq antwortete nicht, doch an der plötzlichen Ruhe seines Körpers ahnte Idra, dass er verstanden hatte. Seine eiskalte Hand tastete vor und umschloss die ihre. Es war ein merkwürdiger Moment. Auch wenn sie den Alten immer geschätzt hatte, wog die Nähe, die zwischen ihnen entstand, so schwer, dass sie Idra beinahe erdrückte.
Sie war wieder neun Jahre alt und saß am Bett ihrer Mutter, die vor Fieber kaum noch sprechen konnte und deren Haut wie Kohle glühte. Idra umklammerte angstvoll ihre Hand und flehte sie an, bei ihr zu bleiben.
Dann dieser eine Moment, in dem sich der schwitzende Körper ihrer Mutter ein letztes Mal aufbäumte, bevor Ruhe einkehrte. Bevor ihr Herz aufhörte zu rasen und sich ihre glasigen Augen für immer schlossen.
Idra schüttelte sich, um die Erinnerungen zu vertreiben. Das hier war nicht ihre Mutter. Alte Männer starben, so war es schon immer. Der Tod würde auch Maruq nicht verschonen. Wenn der Zeitpunkt gekommen war, dann konnte sie nichts daran ändern, so sehr sie es bedauerte.
Erneut krümmte sich der dürre Körper auf dem Lager. Kein Laut drang über Maruqs Lippen, von einem geplagten Keuchen abgesehen, doch Idra ahnte, dass er Schmerzen hatte.
»Ich kann dir den Abschied erleichtern, wenn du willst«, murmelte sie, ohne zu wissen, ob Maruq sie verstand. »Hast du irgendwelche Kräuter hier? Sharak? Remian? Oder Traumwein?«
Es folgte keine Reaktion.
Nun gut, dachte sie, dann eben anders. Sie nahm ihren Flachmann vom Gürtel und flößte Maruq in kleinen Schlucken den gesamten Anisschnaps ein. Das Gebräu war stark und in der Menge konnte es einen ausgewachsenen Elefanten umhauen. Tatsächlich dauerte es nur wenige Augenblicke, bis Maruqs Züge weicher wurden und der Schmerz aus seinem Gesicht wich. Wäre nicht immer noch Blut wie Tränen aus seinen Augen gesickert, hätte Idra denken können, er schliefe einen gesunden Schlaf.
Eine gefühlte Ewigkeit hockte sie an Maruqs Bettkante und irgendwann begann sie zu erzählen, um die drückende Stille zu durchbrechen. Geschichten, die ihre Mutter ihr erzählt hatte, Märchen und alte Geschichten aus dem Sha-Quai. Von den Mantikoren, die in den Katakomben hausten, von den Geistern der Alten Stadt und von der Käferkönigin, die tief unter der Erde schlummerte. Sie verstummte erst, als sich Maruqs Hand löste und ihr der beißende Geruch von Pisse in die Nase stieg.
»Hast es überstanden, alter Mann«, murmelte Idra sanft, während sie sich erhob. »Hoffentlich wird es besser, da, wo du bist.«
Sie hatte Maruq nie gefragt, welche Daimonen er verehrte, doch im Grunde spielte es keine Rolle. Sie nahm zwei Rassiden aus ihrem Geldbeutel und legte sie Maruq auf die Brust. Kaibath, der Rattengesichtige, ließ sich teuer bezahlen.
Seufzend wandte sie sich um und wollte eben die Kammer verlassen, als ihr etwas ins Auge fiel. Auf dem kleinen Tischchen standen zwei leere Holzbecher und daneben lag ein runder Gegenstand, der diffus im Licht der Öllampe schimmerte. Neugierig trat Idra näher und stellte überrascht fest, dass es sich um ein Amulett handelte. Eines, das sie erst heute bei Anbruch der Nacht zum letzten Mal gesehen hatte – um Askars Hals.
Irritiert nahm sie es auf und betrachtete es eingehend. Das runde, etwa fünf Finger breite Amulett schien aus massivem goldenem Metall zu bestehen. Es zeigte einen Skarabäus mit eingeklappten Flügeln, der von einem Ring aus Symbolen umgeben wurde. Das Zeichen eines Daimons? Wenn ja, dann war es keiner, den Idra kannte.
Egal, das Schmuckstück gefiel ihr, und wenn es tatsächlich aus Gold war, war es ein kleines Vermögen wert. Zwei Drami bestimmt. Sie seufzte. Sofern sie jemanden fand, der es ihr abkaufte, jetzt, wo Maruq tot war.
Sie ließ das Amulett in ihre Tasche gleiten, löschte die Öllampe und durchquerte die Schreibstube. Vor der Geldschatulle auf dem Schreibtisch blieb sie unschlüssig stehen und kramte dann unter dem Tresen nach dem Schlüssel. Maruq versteckte ihn immer am gleichen Ort, unter dem losen Brett einer Schublade. Ein großer Vertrauensbeweis, dass er ihr davon erzählt hatte. Als sie die Schatulle öffnete, kam sie sich für einen Augenblick vor wie ein Dieb, wischte den Gedanken aber rasch beiseite. Blödsinn. Maruq war tot, er brauchte kein Geld mehr. Nie wieder.
Zu Idras Enttäuschung war die Schatulle nicht so gut gefüllt, wie sie vermutet hatte. Ein paar silberne Rassiden lagen darin, ansonsten nur Kupfer- und Blechmünzen. Immerhin. Kleine Münzen fielen weniger auf. Eilig stopfte Idra das Geld in ihren Geldbeutel, zusammen mit einigen Ringen, die sie auf dem Tresen fand. Ein Mädchen muss eben sehen, wo es bleibt.
Sicherheitshalber verließ sie die Pfandleiherstube durch die Hintertür und schlich unbemerkt zwischen einigen Häusern hindurch zur nächsten Straße. Mitternacht war vermutlich schon vorüber und die kühle, frische Luft tat Idras Lungen gut. Sie bemerkte erst jetzt, welch elender Gestank in der kleinen Kammer geherrscht hatte und mittlerweile auch an ihren Haaren und ihrer Kleidung klebte. Sie sollte sich dringend waschen!
Während sie die Straße hinunterschlenderte, drängte sich ihr die Frage auf, woran Maruq gestorben war. Fieber kannte sie, sie hatte es oft gesehen, doch Maruqs Körper war eiskalt gewesen. Sicher, ein alter Mann wie er starb irgendwann, aber nicht mit blutenden Augen und ekligem Ausschlag. Idra seufzte. Vor zwei Tagen war Maruq noch völlig gesund gewesen. Lass den Scheiß, schalt sich Idra in Gedanken. Du hast genug Sorgen. Was scheren dich die der anderen und vor allem die eines Toten?
Bevor sie den Kanal erreichte, blieb sie in einer Seitengasse stehen und suchte einen trockenen Flecken Erde. Mit den Fingern grub sie ein kleines Loch und legte eine weitere Rasside hinein.
»Kaibath, Daimon der Listigen«, flüsterte sie. »Nimm mein Opfer und schenk mir Glück, damit ich nicht so beschissen enden muss wie der alte Maruq.«
Sie spuckte noch einmal auf die Münze, dann verschloss sie das Loch sorgfältig und klopfte die Erde fest. Es konnte nicht schaden.
Die Wohnstube war leer, als Idra eintrat. In der Feuerstelle glomm noch Asche und ein leichter Knoblauchgeruch lag in der Luft, doch von den anderen Mädchen war nichts zu sehen. Idra war froh darum. Freundinnen fand man in diesem Gewerbe nicht, nur Neiderinnen. Und davon hatte Idra eine ganze Menge. Sie wusste genau, wie sie ihre Freier zum Schnaufen brachte, damit sie wiederkamen. Außerdem war sie mit ihrem roten Haar eine Seltenheit unter all den schwarzhaarigen Frauen. Das einzige Geschenk ihres namenlosen Vaters, der vor ihrer Geburt schon das Weite gesucht hatte.
Sie durchquerte die karge Stube und stieg die Treppe ins Obergeschoss hinauf. Ein einziger, langer Raum mit einem Dutzend Betten und einigen Kleidertruhen – mehr besaßen die Huren hier nicht. Verschlissene Vorhänge hielten Staub und Sand vor dem Fenster, doch sonst scherte sich hier keiner um Sauberkeit. Die Laken waren mottenzerfressen, die Dielen morsch, und vom Abort zog ständig der Gestank herauf.
Idra sah sich verstohlen um. Rizem, Drina und Tabeia schliefen bereits. Auf Zehenspitzen schlich sie an ihnen vorbei, vermied die knarrenden Dielen, um ja kein Geräusch von sich zu geben, und hockte sich auf ihr Bett.
Angespannt sah sie sich im Raum um, dann schob sie die Münzen, die Ringe und das Amulett unter das Laken ihrer Strohmatratze. Eigentlich verbarg sie ihre Habseligkeiten immer an einem sicheren Ort außerhalb ihrer Wohnstatt, aber heute war sie zu erschöpft, um den langen Weg dorthin noch auf sich zu nehmen. Außerdem hatte sie gute Lust, sich morgen wenigstens etwas Anständiges zu essen und vielleicht ein neues Paar Sandalen davon zu kaufen. Du gönnst dir ja sonst nichts.
Tabeia neben ihr rekelte sich und drehte sich grunzend auf die andere Seite. Idra hielt den Atem an. Sie schlief noch immer. Ein Glück. Die geschwätzige Vettel hatte ihre Augen überall und kam sich besonders wichtig vor, wenn sie andere Huren beim Khari verpfeifen konnte.
Seufzend hängte Idra ihr nasses Kleid über den Bettpfosten und wickelte sich in das dünne Laken. Sie hasste es, nackt zu schlafen, aber besser als in den durchweichten Klamotten, die immer noch nach dem Mief in Maruqs Stube stanken. Hoffentlich hatte das Bad genügt, um sich nicht anzustecken. Mit pochendem Herzen starrte Idra an die Decke, immer noch das Bild von Maruqs schmerzverzerrtem Gesicht vor Augen. Armer alter Mann.
Im Halbschlaf ließ sie die Frage zu, was gewesen wäre, wenn sie bei Maruq geblieben wäre. Wenn er genug verdient hätte, um sie zu bezahlen. Keine ekelhaften Freier, keine schnellen Nummern auf der Straße, kein Khari. Ein normales Leben. Vielleicht wäre das möglich gewesen, wenn sich ihre Mutter vor ihrem Tod nicht in horrende Schulden gestürzt hätte. Idra drehte sich missmutig auf die Seite und zog sich die dünne Leinendecke bis zum Kinn. Was half es schon, über verschüttete Milch zu klagen? Ein Leben im Sha-Quai war so elend wie das andere. Und sie hatte immerhin noch Djarid.