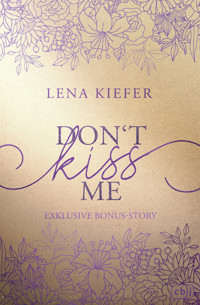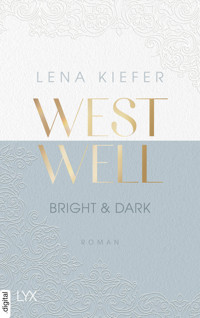8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Ophelia Scale-Reihe
- Sprache: Deutsch
Hoffnung ist stärker als Hass, Liebe ist stärker als Furcht
Die 18-jährige Ophelia Scale lebt im England einer nicht zu fernen Zukunft, in dem Technologie per Gesetz vom Regenten verboten ist. Die technikbegeisterte und mutige Kämpferin Ophelia hat sich dem Widerstand angeschlossen und wird auserkoren, sich beim royalen Geheimdienst zu bewerben. Gelingt es ihr, sich in dem harten Wettkampf durchzusetzen, wird sie als eine der Leibwachen in der Position sein, ein Attentat auf den Herrscher zu verüben. Doch im Schloss angekommen, verliebt sie sich unsterblich in den geheimnisvollen Lucien – den Bruder des Regenten. Und nun muss Ophelia sich entscheiden zwischen Loyalität und Verrat, Liebe und Hass ...
Alle Bände der Ophelia Scale-Trilogie:
Ophelia Scale – Die Welt wird brennen
Ophelia Scale – Der Himmel wird beben
Ophelia Scale – Die Sterne werden fallen
Ophelia Scale – Wie alles begann (Shortstory, nur als E-Book verfügbar)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
LENA KIEFER
DIE WELT WIRD BRENNEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2019 cbj Kinder- und Jugendbuchverlagin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Carolin Liepins, München
Covermotiv: Shutterstock.com (Bokeh Blur Background, Merggy, rvika, Potapov Alexander, ojka)
MP · Herstellung: AJ
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23095-1V003
www.cbj-verlag.de
Für Felix,weil du es schon immer gewusst hast
1
Es gibt Tage im Leben, da gelingt alles. Die schwierigsten Prüfungen, die unmöglichsten Aufgaben, die wahnwitzigsten Pläne. Was man auch anfasst, wird zu Gold.
»Jetzt mach schon, du blödes Ding!«
Heute war keiner dieser Tage.
Ich hing kopfüber von einem Dach, fünf Meter über dem Boden. Das, womit ich kämpfte, war die Scheibe eines halb blinden Fensters. Das, wozu das Fenster gehörte, war eine Lagerhalle am Rande der Stadt. Und das, was ich tat, war absolut verboten.
Seit zehn Minuten versuchte ich, ein Loch in das Fenster zu schneiden. Seit zehn Minuten scheiterte ich daran. Die Scheibe war dreckig und der Glasschneider fand darauf keinen Halt. Immer wenn ich ihn verankern wollte, rutschte er ab.
Ich keuchte. Mein Zopf hing schwer vom Hinterkopf herab und zerrte an meinem Nacken. Blut lief in meinen Kopf, Wut sickerte hinterher. Was nützte mir so ein Gerät, wenn es nur auf blitzsauberen Scheiben funktionierte? Hätte ich vorher eine Putzkolonne bestellen sollen? »Hey Jungs, macht mir doch kurz die Fenster sauber, damit ich dort einbrechen kann?« Super Idee.
»Letzter Versuch«, murmelte ich.
Ich wusste, was Knox in dieser Situation gesagt hätte. Komm schon, Ophelia. Ansetzen und drehen, langsam und mit Gefühl. Du kannst das.
Ich schnaubte. Knox war auch noch tiefenentspannt, wenn man uns direkt auf den Fersen war. Gewesen. Er war tiefenentspannt gewesen.Vergangenheitsform.
Ich atmete durch und versuchte es mit Gefühl. Es half nichts, natürlich. Ich war nicht er. Würde es nie sein. Ich war nur ein billiger Abklatsch – mit einer Mission, die scheiterte, bevor sie überhaupt begonnen hatte.
»Verdammter Mist!« Genervt hob ich die Faust und schlug gegen den Rahmen. Es knackte, dann war ein Quietschen zu hören.
Das Fenster schwang auf.
Ich starrte auf den Spalt. Sollte das ein Scherz sein? Aber Lagerhallen waren nicht für ihren Humor bekannt und ich hatte keine Zeit zum Lachen. Mit festem Griff packte ich die Dachrinne über mir und schwang mich auf das Sims. Dann hakte ich das Seil aus.
»Oha …« Alles drehte sich. Ich griff blind um mich und erwischte den Rahmen des Fensters. Der Schwindel legte sich. Dafür knarzte es bedrohlich. Die Scharniere hatten in diesem Moment beschlossen, den Geist aufzugeben.
Ich ließ los, keine Sekunde zu früh. Neben mir stürzte das Fenster zu Boden, landete mit einem dumpfen Krachen im Gestrüpp und zersplitterte in tausend Teile. Zwei Ratten und ein Eichhörnchen sausten ins Sonnenlicht. Erschrocken sah ich mich um, ob jemand den Lärm bemerkt hatte. Aber die Straße war verlassen. Noch. Das marode Fenster täuschte mich nicht darüber hinweg, dass es ein modernes Sicherheitssystem gab. Ab jetzt blieben mir etwa zwanzig Minuten. Dann traf die Wachmannschaft ein.
Ich setzte mich vorsichtig auf das Sims und spähte ins Innere der Halle. Es war darin weder dunkel noch hell – das typische fahle Zwielicht eines Raumes mit dreckigen Fenstern und hohen Decken. Tief unter mir stand eine Reihe Regale, daneben lagen alte Kartons. Ich stützte mich auf die Arme und spannte meine Muskeln an. Dann sprang ich.
Es ächzte dumpf, als ich landete. Die Pappe verwandelte sich beim Aufprall in einen Haufen Staub. Ich rollte mich ab, kam auf die Beine und sah mich um. Es war niemand da. Eilig lief ich los.
Ein strenger Geruch nach altem Öl und modrigem Holz hing in der Luft. Überall stapelten sich Paletten, die Regale waren größtenteils durchgerostet und zusammengebrochen. Kälte kroch mir in den verschwitzten Nacken und ich strich mir ein paar Strähnen aus dem Gesicht. Im Halbdunkel wirkte mein hellbrauner Zopf fast so schwarz wie meine Kleidung.
Neunzehn Minuten.
Mein Zielobjekt stand weiter hinten in der Halle. Es war ein grau glänzender Waggon mit Fenstern und schwarzer Kennnummer – eine Autonomous Transport Unit, TransUnit genannt. Es war eine der Beförderungseinheiten für die Bevölkerung, zur Verfügung gestellt von unserem König. In dem alten Gebäude wirkte sie, als hätten Außerirdische ihr Ufo vergessen.
Achtzehn Minuten.
Ich suchte eine Leiter, um an die Klappe in der Seitenwand zu kommen. TransUnits fuhren im Normalfall selbstständig mithilfe eines Programms, das ihre Routen verarbeitete und speicherte. Das Exemplar in dieser Halle war defekt und wartete auf den Abtransport ins Hauptdepot. Der Routenspeicher war jedoch intakt und wurde erst bei der Reparatur gelöscht. Genau das wollte ich ausnutzen. Mit diesen Daten konnten wir die Strecken überwachen, vielleicht sogar manipulieren.
Ich stieg hoch und zog den Operator aus meiner Tasche. Es war ein schmales Gerät, kaum größer als eines der alten Bücher aus Papier. Als ich ihn einschaltete, leuchtete ein blaustichiges Display auf. Ein Schauer jagte über meinen Rücken. Es war bei Strafe verboten, so etwas zu besitzen oder gar zu benutzen. Sehr hohen Strafen. Wir hatten ihn aus alten Teilen gebaut, die nicht konfisziert worden waren und schwarz gehandelt wurden. Heutzutage war der private Besitz solcher Technologie illegaler als eine Schusswaffe – und die nicht staatlich kontrollierte Benutzung schlimmer als Mord.
Ich schloss den Operator an den Screen der TransUnit an, tippte die Zugangsdaten ein und wartete, dass die Prozedur startete. Mit bangem Blick sah ich auf meine Uhr. Siebzehn Minuten.
Endlich zeigte der Operator etwas an.
<Eingabemodus bereit>
Ich atmete tief ein, dann drückte ich Aktivieren. Die Zugangsklappe der TransUnit öffnete sich und gab den Blick auf einen Screen frei. Er leuchtete schwach im Halbdunkel. Weiße Schrift erschien.
<Authentifikation erforderlich>
Ich begann, auf dem Operator eine lange Ziffernfolge einzugeben. Meine Finger fühlten sich klamm und steif an. Mein Zopf war nass vor Schweiß und drückte die verschwitzte Jacke an meinen Rücken. Jetzt, wo ich mich nicht mehr bewegte, wurde es mit jeder Minute kälter.
Fünfzehn Minuten.
<Eingabe akzeptiert. Diagnose läuft>
Eine Identifikationsnummer erschien auf dem Display des Operators und schaltete den Routenspeicher der TransUnit frei. Ich gab einen Befehl an das Programm, dann startete der Download. Nun musste ich warten.
Da ich nichts Besseres zu tun hatte, lehnte ich mich an die Leiter und ließ den Blick wandern. Die Halle hatte definitiv schon bessere Zeiten erlebt. Dreck in den Ecken, zerfallende Paletten, altes Verpackungsmaterial und überall Spinnweben. Ich sah hoch zu der Stelle, wo früher offensichtlich ein Logo angebracht gewesen war. Nur sehr schwach erkannte man die Konturen eines V, umschlungen von einer 3.
3V war der Name jener Firma gewesen, der dieses Gebäude früher gehört hatte: ValeVisualVirtues, ein Zungenbrecher mit Erfolgsgeschichte. Gregory Vale war der größte Produzent visueller Interfaces gewesen und damit so erfolgreich geworden, dass man die Stadt nach ihm benannt hatte: Vale City, Metropole der Zukunft. Er hatte ein Imperium erschaffen, mit Einnahmen in Milliardenhöhe und einem Eintrag an der Wall of Technology. Aber das war Jahre her. Heute war Vales Ruhm so verblasst wie sein Logo und die Stadt hieß wieder Brighton. Niemand verdiente noch mit Technologie Geld. So lauteten die Gesetze.
Ein hohes Piepen ertönte. Ich sah auf den Screen an der TransUnit. Schlagartig verdoppelte sich mein Puls.
<Vorgang abgebrochen. Authentifikation fehlerhaft>
»Neinneinnein!« Ich tippte hektisch auf das Display des Operators und versuchte, den Fehler zu finden. Was war schiefgelaufen? Ich hatte die Verbindung korrekt aufgebaut. Hatte eine gültige Berechtigung vorgetäuscht. Warum brach das verdammte Ding jetzt ab?
Die TransUnit piepte wieder, hochfrequent und unangenehm.
<Online-Diagnosemodus wird aktiviert in: 30 Sekunden>
<Online-Diagnosemodus wird aktiviert in: 29 Sekunden>
<Online-Diagnosemodus wird aktiviert in: 28 Sekunden>
Die Schrift verschwand und erschien erneut, wie der tödliche Pulsschlag eines Zeitzünders. Nicht gut. Gar nicht gut. Wobei das ungefähr so war, als würde man sagen, der Zweite Weltkrieg sei »nicht gut« gewesen.
Es war eine Katastrophe.
Wenn die Steuerung der TransUnit online ging, wurde jedes menschliche Wesen im Umkreis von fünfhundert Metern erfasst und die Identität an die königlichen Server gemeldet. Normalerweise war das kein Problem – wenn die TransUnit im Einsatz war. Aber jetzt befand sich nur ein menschliches Wesen in diesem Radius: ich. Genauso gut hätte ich direkt auf die Straße rennen und »Ich bin eine Verräterin« brüllen können.
Ich musste nachdenken. Nein, falsch. Ich musste handeln. Sofort.
Schnell gab ich auf dem Display des Operators den Befehl ein, alles abzuschalten. Nichts passierte. Ich versuchte es mit einem Reset. Die TransUnit blieb unbeeindruckt. Sie hatte den Operator einfach aus dem System geworfen.
<Online-Diagnosemodus wird aktiviert in: 23 Sekunden>, informierte der Screen mit stoischem Blinken. Mir war so heiß, als hätte jemand die Halle in Brand gesteckt. Meine Hände verkrampften sich, vor meinen Augen flimmerten Sterne. Der Schweiß lief mir in Strömen über den Rücken. Ich konnte das nicht schaffen. Sie würden mich erwischen und dann war es vorbei. Dann war alles vorbei.
Jetzt dreh nicht durch, ermahnte ich mich selbst. Zwanzig Sekunden. Ich ging fieberhaft meine Optionen durch.
Manipulation – gescheitert, warum auch immer
Abschaltung – funktioniert nicht
Überschreiben – zu spät
Abhauen – viel zu spät
Absturz verursachen – total irre
… aber möglich.
Ich wühlte in meiner Tasche und zog einen kleinen runden Gegenstand heraus, so groß wie eine Walnuss. Es war eine Burst-Kapsel, die mit einem Schlag jede Elektronik ausschaltete. Dagegen war auch eine königliche TransUnit nicht gerüstet. Zumindest war das meine Hoffnung. Und die starb schließlich zuletzt.
Es gab nur einen Haken: die Reichweite. Die Kapsel musste am Knotenpunkt des Systems gezündet werden, sonst funktionierte sie nicht. Wo dieser Punkt lag, wusste ich nicht. Aber ich kannte die Baupläne des Zugangspanels. Hinter dem Screen war ein Hohlraum für die Connecter, die ihn mit dem Rest der Unit verbanden und zur Energieversorgung führten. Wenn ich da herankam, konnte ich die Kapsel hineinwerfen.
Ich zog die Handschuhe aus und versuchte, den Screen der TransUnit mit den Fingernägeln zu packen. Keine Chance. Die Kanten waren passgenau und ich kam nicht in die Lücken. Da fiel mein Blick auf etwas an meinem Gürtel. Warum nicht? Verzweifelte Situationen verlangten nach verzweifelten Lösungen.
Ich nahm den Glasschneider, setzte ihn an und drehte den Griff. Diesmal hielt er perfekt. Mit einem Knacken riss der Screen aus der Verankerung und legte den Hohlraum frei. Ich aktivierte die Kapsel, warf sie in die Öffnung und hoffte auf ein Wunder. Den Operator hielt ich hinter meinem Rücken so weit wie möglich von der Unit weg, damit er von dem Impuls nicht erwischt wurde.
Ein Summen ertönte, als die Kapsel sich auflud. Der Ton schwoll an wie ein wütender Bienenschwarm. Dann fiel er ab. Ich starrte auf den Screen der Unit, der nun nur noch von den Kabeln gehalten wurde. Eine unerträglich lange Sekunde passierte nichts. Noch eine. Noch eine.
Dann flackerte der Screen und ging aus. Die TransUnit schaltete sich ab und sank in Tiefschlaf. Ich stieß die Luft aus. Glück gehabt.
Ich holte den Operator hinter meinem Rücken hervor und sah auf das Display. Der Fortschrittsbalken zeigte 54 Prozent an. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Noch acht Minuten, bis die Wachleute kamen. Reichte das für einen zweiten Versuch?
Das Risiko war groß. Es konnte sein, dass das System sein Gedächtnis nicht verloren hatte. Wenn der Prozess an der gleichen Stelle fortgesetzt wurde, meldete die TransUnit in zwei Sekunden den Online-Status, in zweieinhalb meine Anwesenheit. Aber wenn nicht, hatte ich genug Zeit, bevor das System wieder einen Fehler feststellte. Waren die Daten dieses Risiko wert? Julius, unser Anführer, hätte das verneint. Trotzig dachte ich daran, wie herzlich wenig ihn das bei Knox interessiert hatte. Das hier war immer noch eine Mission. Meine Mission. Ich musste es versuchen.
Entschlossen wischte ich mir den Schweiß von der Stirn und packte den Operator. Dann schaltete ich zurück zur Aktivierung des Systems, führte die gleichen Schritte noch einmal aus, um den Download fortzusetzen. Die TransUnit fuhr hoch. Ich war auf das Schlimmste gefasst.
Wieder bewegte sich die Klappe, ein trauriges Ruckeln, weil der herausgerissene Screen der TransUnit den Weg versperrte. Ich schob ihn ungeduldig zur Seite und wartete, betete zu allen Technikgöttern …
… und wurde belohnt. Die Fortschrittsanzeige bewegte sich wieder, kletterte auf 60, dann auf 70 Prozent. Schließlich erreichte sie die ersehnten 100 Prozent, ohne ein weiteres Mal mit dem Online-Modus zu drohen.
Ich warf einen Blick auf das Chaos, das ich verursacht hatte. Vor den Eingeweiden der TransUnit hing an einem Kabel der schwach leuchtende Screen, die Klappe war verbogen und stand zur Seite weg. Ich widerstand dem Drang, ein paar Teile mitzunehmen, und passte den Screen wieder ein. Dann schloss ich die Klappe, die dabei ein hässliches Knirschen von sich gab. Man würde bemerken, dass sich jemand daran zu schaffen gemacht hatte. Aber bis dahin war ich längst weg. Mir blieben immer noch fünf Minuten, um zu verschwinden.
Ich packte den Operator in meine Tasche und machte mich an den Abstieg von der Leiter. Da hallte ein lautes Schrammen durch das Gebäude. Es klang, als würde etwas Schweres über den Boden gezogen. Das Zugangstor, schoss es mir durch den Kopf. Das konnte nur eins bedeuten:
Ich hatte keine fünf Minuten.
Ich hatte nicht eine einzige.
2
Mein Schreck dauerte eine Sekunde, dann kam ich in Bewegung. Ich kletterte leise weiter hinunter und duckte mich in den Schatten der TransUnit. Vorsichtig spähte ich um die Ecke.
Zwei Männer in blauen Jacken hatten das Haupttor geöffnet und suchten den vorderen Teil der Halle ab. In der einen Hand hielten sie eine Lampe, in der anderen einen schmalen Gegenstand, so lang wie ein Lineal. Taser. Ich verzog das Gesicht.
Mein ursprünglicher Fluchtplan war gestorben. Die von innen verriegelte Seitentür war genau da, wo die Typen gerade suchten. Das Zugangstor lag dahinter. Ich konnte gegen die beiden kämpfen, sie vielleicht sogar besiegen, aber mit den Tasern war mir das zu heiß. Dann gab es noch die Fensterreihe – nur stand an der Wand nichts, was mir den Aufstieg erleichtert hätte. Spitze. Ich war eine gute Kletterin, aber für die Nummer hätte ich Spider-Mans Urenkelin sein müssen. Ob ich mich verstecken konnte, bis die Typen wieder weg waren?
Sie kamen in meine Richtung, ich hörte ihre Schritte. Damit war die Entscheidung gefallen. Ich drehte meinen Zopf ein und zog meine Kapuze darüber. Dann kletterte ich die Leiter wieder hoch, kroch auf das Dach der TransUnit und legte mich flach auf den Bauch. Mein Herz hämmerte gegen meine Rippen. Ich hielt die Luft an.
»Hier drüben! Da sind Spuren!« Einer der beiden Männer kam neben der Unit zum Stehen. Ich riskierte einen Blick. Er war jung und hatte schwarzes Haar mit widerspenstigen Wirbeln am Hinterkopf. Die blaue Jacke schlackerte um seine hageren Schultern. Wegen dieser Kluft hießen die Wachmannschaften Bluecoats, aber wir nannten sie Turncoats – Verräter. Das passte entschieden besser zu Menschen, die sich in den Dienst des Königs stellten, um die eigenen Leute zu bespitzeln.
»Hast du etwas gefunden?« Der zweite Wachmann kam dazu. Er hatte eine Glatze und war dicklich und klein. Skeptisch besah er sich die Spuren. »Das ist bestimmt seit Ewigkeiten dort«, winkte er ab und wischte sich mit einem Taschentuch über das Gesicht.
»Bist du sicher?« Der Hagere schien nicht überzeugt.
»Natürlich bin ich sicher. Wie lange mache ich das hier schon?« Der Dicke holte pumpend Luft.
Aus dem Augenwinkel sah ich eine Bewegung und unterdrückte einen Ekellaut: Direkt neben mir saß eine Spinne. Keine kleine, harmlose, nein. Dieses Vieh war so groß, dass nur ein Sattel gefehlt hätte, um auf ihr zu reiten. Ich wich ein Stückchen nach rechts. Dabei rutschte die Tasche an meiner Hüfte auf das Dach. Es gab ein dumpfes Geräusch.
»Was war das?« Der Dünne sah nach links und rechts. Schließlich fixierte er eine dunkle Ecke mit ein paar Fässern.
»Du wirst langsam paranoid, Owen. Das war bestimmt nur ein Fehlalarm.«
»Ein Fehlalarm macht keine Fenster kaputt.«
»Das Fenster war so alt, dass es wahrscheinlich von allein herausgefallen ist. Wer sollte denn hier einbrechen? Die wissen doch, was ihnen dann blüht.« Der Glatzkopf lachte tief und heiser. »Drei Minuten mit den Leuten vom Clearing-Team und zack, bist du Geschichte.«
Ich bekam eine Gänsehaut.
»Erinnerst du dich noch an den Jungen vom letzten Dezember?«, fuhr der Dicke fort. »Was mit ihm passiert ist, war den ganzen anderen Spinnern sicher eine Lehre.«
»Du meinst den Dunkelhaarigen? Das war doch der Sohn von den Odells. Nicholas, glaube ich.«
Zwei Meter über ihnen krampften sich meine Hände zusammen. Mein Herz tat es ihnen gleich. Ich kannte Nicholas Odell, nur hatte ich ihn nie so genannt. Jeder, der ihn mochte, benutzte seinen Spitznamen – Knox.
»Genau der.« Der Dicke nickte. »Arme Familie. Mit einem ganzen Schwung Steuereinheiten haben wir ihn aufgegriffen. Da war nichts mehr zu machen. Längstes Clearing, das wir je in der Gegend hatten.« Er spuckte auf den Boden. »Widerstand, dass ich nicht lache. Fehlgeleitete Irre allesamt, wenn du mich fragst.«
Der Dünne murmelte etwas, aber ich hörte es nicht. Ich spürte nur einen bekannten Schmerz aufsteigen, der sonst tief, aber beständig unter der Oberfläche pochte. Knox war kein kranker Irrer gewesen, sondern einer von denen, die diese verfluchte Welt besser gemacht hatten. Der Beste von allen. Am liebsten hätte ich mich auf die Turncoats gestürzt und ihnen das in ihre Schädel gehämmert.
Aber das ging nicht. Denn hätte ich es getan, wäre ich Knox direkt ins Nichts gefolgt. Manchmal vermisste ich ihn so sehr, dass es mir wie eine verlockende Idee vorkam. Nur würde ich dann verraten, wofür er gekämpft hatte. Das hätte er nicht gewollt.
»Ich glaube, wir können gehen.« Der Dicke wischte sich die Hände an der Hose ab. »Die sollen jemanden schicken, der das Fenster repariert. Kein Wunder, dass ständig Alarm ausgelöst wird, wenn sich keiner um die Instandhaltung kümmert.«
Ich war erleichtert – und spürte gleichzeitig etwas an meinem Arm. Die Spinne hatte beschlossen, nicht länger tatenlos herumzusitzen. Jetzt krabbelte sie eilig über den Ärmel, direkt auf mein Gesicht zu. Ich wimmerte, ohne es verhindern zu können.
»Hast du das gehört?« Owen war wieder auf der Pirsch. Verdammte Spinne.
»Jetzt hör aber auf! Wenn du so weitermachst, werden sie dich noch rauswerfen.« Der Dicke hatte genug. Aber ich hörte nur ein Paar Stiefel, das sich entfernte, und dazu etwas anderes: das Knarzen von Metall. Owen ist auf die Leiter gestiegen.
»Hier oben!«, rief er.
Jetzt musste ich schnell sein.
Mit einem kräftigen Schlag beförderte ich die Spinne von meiner Schulter, rollte mich zur Seite und ließ mich von der TransUnit fallen. Der Aufprall war hart, aber ich landete auf den Füßen.
»Halt, bleib sofort stehen!«
Der Dicke kam auf mich zu, der Dünne sprang hinter mir von der Leiter. Ich rannte in die einzige Richtung, die nicht versperrt war: zur Wand. Die Fensterreihe war in vier Meter Höhe, aber meine einzige Chance. Es wurde Zeit, Spider-Mans Urenkelin zu werden.
Aus vollem Lauf sprang ich auf einen Stapel Paletten, stieg dann auf ein rostzerfressenes Regal. Schlechte Idee. Es hielt eine Sekunde, bis es nachgab. Ich suchte Halt, aber da war nichts – außer einem dünnen Rohr an der Wand. Ich reagierte blitzschnell und stieß mich ab. Meine Finger knallten auf Metall. Das Regal brach polternd unter mir zusammen.
»Hol sie da runter!«, rief der Dicke seinem Kollegen zu.
Versuch es doch. Ich biss die Zähne zusammen und stemmte mich hoch. Stöhnend schaffte ich es in den Stütz, dann zog ich meine Beine hinauf. Das Rohr knackte, aber es hielt. Ein Sirren ertönte. Die Turncoats luden ihre Taser.
Ich richtete mich auf, meine Beine waren wie Gummi. Mit letzter Anstrengung hangelte ich mich auf das Sims und war am Fenster, als sie die Taser abfeuerten. Die Hochvolt-Projektile kamen nicht so weit und verfehlten alle ihr Ziel. Schnell trat ich die Scheibe ein und schlängelte mich durch das Loch. Eine der vorstehenden Scherben erwischte meine Kapuze und zog sie mir vom Kopf. Ungeduldig zerrte ich sie zurück an ihren Platz.
»Nach draußen!« Die beiden rannten los. Zeit zum Hinunterklettern hatte ich nicht. Hastig schwang ich herum und ließ mich vom Rand der Fensteröffnung hängen. Die Reste der Scheibe schnitten mir in die Handschuhe. Schnell ließ ich mich fallen.
Ich landete direkt auf den Scherben des zerstörten Fensters. Eine schlitzte meine Hose am Knie auf, verfehlte aber mein Bein. Gehetzt sah ich in Richtung des Tors. Die Halle war groß, draußen alles verwuchert und voller Gestrüpp. Der Dünne schaffte es vielleicht in dreißig Sekunden bis zu mir, der Dicke brauchte das Doppelte. Zwischen ihnen und mir hing mein verwaistes Seil vom Dach. Ich konnte es dort lassen, aber es provozierte Fragen, wenn wir ständig neues Equipment brauchten.
Mein Kopf rechnete.
Weg bis zum Seil – zehn Sekunden.
Seil lösen – drei Sekunden.
Aufwickeln – fünf Sekunden.
Darüber nachdenken, ob ich es tun soll – zweieinhalb Sekunden. Jetzt drei. Dreieinhalb.
Ich rannte los.
Während ich das Seil mit einem Ruck aus der Verankerung riss, war ich noch allein. Aber als ich es aufwickelte, schoss der Dünne um die Ecke und rannte auf mich zu. Meine Fluchtmöglichkeiten waren begrenzt: Zur Straße konnte ich nicht, in den Wald im Norden wollte ich nicht. Der einzige Weg führte mitten durch das Gestrüpp.
Ich sprintete los. Wildes Gras, Disteln und Fingerkraut zerrten an meinen Schuhen, an den Schnürsenkeln und dem Saum meiner Hose.
Der Dünne kam mir nach und schrie aus Leibeskräften, ich solle stehen bleiben. Glaubte der wirklich, ich sei so dämlich, mich freiwillig zu stellen? Einfache Turncoats hatten keine Aufspürgeräte, um jemanden auf Distanz zu tracken – oder Equipment, um DNA zu scannen. Das bedeutete, sie konnten mich nur dann identifizieren, wenn sie mich erwischten. Und ich hatte nicht vor, ihnen diesen Gefallen zu tun.
Ich rannte, so schnell ich konnte. Es würde nicht lange dauern, bis Verstärkung kam. Das alte Industriegebiet, heute beherrscht von runtergekommenen Lagerhallen und leer stehenden Gebäuden, war weitläufig und einsam. Ich musste es bis zum alten Golfplatz schaffen, wo ein Wohngebiet anfing. Dort konnte ich untertauchen.
Der Dünne war zäh – egal, wie schnell ich lief, es gelang mir nicht, ihn abzuschütteln. Meine Beine wurden schwer, ich war nass geschwitzt, und mein Kopf schmerzte tierisch. Die Tasche mit dem Operator schlug bei jedem Schritt gegen meine Hüfte, das Seil auf meiner Schulter wog eine Tonne. Alles in mir schrie nach einer Pause, aber ich brüllte innerlich dagegen an. Sie durften mich nicht kriegen. Wenn sie mich schnappten, war ich so gut wie tot.
Ein Stück lief ich an der verlassenen Straße entlang, um Kraft zu sparen. In der Ferne kam mir eine TransUnit entgegen. Verstärkung? Ich konnte die Passagiere nicht erkennen, aber das Risiko war zu groß. Rasselnd holte ich Luft und beschleunigte wieder. In einem günstigen Moment schlug ich mich seitwärts in die Büsche.
Keinen Augenblick zu früh.
Ich hörte das Rascheln zurückschlagender Äste, dann laute Rufe und Befehle, schließlich Schritte vieler Stiefel, deren Träger den Wald absuchten. Die Verstärkung war eingetroffen und hatte noch keinen Fünf-Kilometer-Lauf in den Knochen. Chancengleichheit sah anders aus.
Zu meinem Glück konnte ich bereits die Mauern der Siedlung sehen. Ich legte einen letzten Spurt ein, schlug Haken um zwei kleine Bäume und sprang über einen vermoderten Gartenzaun. Meine Sohlen streiften das Holz, ich strauchelte, fiel aber nicht. Schnell rannte ich um die nächste Ecke, verlangsamte dann meine Schritte und zog mir die Kapuze vom Kopf.
Vor mir lag eine Gruppe mehrgeschossiger Häuser mit schäbigen Fassaden und verwilderten Gärten. Hier wohnten die Idles, jene Menschen, die von der Grundversorgung lebten und zum Arbeiten zu alt, faul oder krank waren. Sie bekamen nicht viel, nicht einmal einen Namen für ihre Siedlung, die einfach nur das Viertel genannt wurde.
Es war ein trostloser Ort. Die Zäune verfielen langsam und die Eingangstüren hatten schon lange keine frische Farbe mehr gesehen. Viele Mauern waren grün vom Moosbefall, an manchen wucherte dunkler Efeu ungehindert zum Dach.
Auf einem kleinen Platz in der Mitte fand ein Markt statt, auf dem die Idles Kleidung tauschten oder sich mit selbst angebauten Lebensmitteln versorgten. Ich steuerte einen alten Schuppen an und verschwand hinter den grünlichen Brettern. Es roch nach Erde und feuchtem Holz.
Schnell warf ich das Seil in die Ecke und zog meine schwarze Jacke aus. Ich knüllte sie zusammen, steckte sie in eine Tonne mit Kompost und häufte halb verfaulte Kartoffelschalen darüber. Ein Zipfel der Jacke war jedoch widerspenstig und ragte heraus. Es war die Ecke mit dem Zeichen des Königs, einer stilisierten Lilie mit zwei gekreuzten Pfeilen, die ein X bildeten und deren Spitzen nach oben zeigten. Wütend griff ich danach und stopfte sie besonders tief in die Tonne. Ich stellte mir vor, dass es sein Rachen war.
»Was machst du da?«
Ich schreckte hoch und stieß mir an der niedrigen Decke des Schuppens den Kopf.
Au.
3
Als die Sterne vor meinen Augen zu tanzen aufhörten, erkannte ich zwei Augen auf halber Höhe. Erleichtert atmete ich aus. Es war nur ein Kind.
»Ah, hey, ich wollte nur eben meine Jacke entsorgen«, antwortete ich beiläufig. »Ich habe sie aus Versehen zerrissen.« Hoffentlich wusste das Kind nicht, dass man Kleidung aus künstlichem Material nicht in den Kompost stopfte.
Ein zerzaustes blondes Mädchen tauchte hinter der Tonne auf. »Oh je, das passiert mir auch manchmal. Dann schimpft meine Mama immer.«
Die Kleine sah zwar etwas schmuddelig aus, wirkte allerdings wohlgenährt und gesund. Das war’s dann aber auch schon, dachte ich bitter. Früher hätte diesem Mädchen die ganze Welt offengestanden, sie hätte alles tun und alles sein können. Und jetzt? Jetzt waren ausreichend Essen, medizinische Versorgung und ein Leben nach den Regeln des Königs alles, was die Zukunft ihr bot. Wir alle waren zu einem Leben in Unfreiheit verdammt. Es war zum Kotzen.
Das Mädchen sah mich ängstlich an. »Du verrätst den anderen doch nicht, dass ich mich hier versteckt habe, oder?«
»Nur, wenn du mich auch nicht verrätst.« Ich lächelte, löste meinen Zopf und schüttelte die langen Haare aus. Sie fielen mir glatt über die Schultern, noch feucht, aber nicht mehr schweißnass.
»Ich verspreche es.« Die Kleine nickte eifrig.
»Gut.« Ich griff nach meiner Tasche. Das Seil würde ich später holen müssen. »Wenn ich deine Freunde treffe, sage ich ihnen einfach, du wärst in den Wald gelaufen.« Die Kleine strahlte. Ich zeigte ihr den hochgereckten Daumen, dann spähte ich um die Ecke und trat ins Freie.
Ich brauchte dringend etwas anderes zum Anziehen. Die Jacke war ich zwar losgeworden, aber meine dunkle Hose und das schwarze Shirt waren trotzdem zu auffällig. In der Nähe sah ich einen Stand von zwei älteren Frauen, die Kleidung anboten. Sie stritten gerade mit einer jungen Mutter, ob drei Paar Socken ein angemessener Tauschpreis für einen Schal waren. Ich ging zur Rückseite des Standes und griff heimlich nach einem roten Pullover. Da drehte sich eine der Frauen um.
»Kann ich dir helfen?«, fragte sie misstrauisch.
»Ja, ich suche …« Ich griff nach etwas, das ganz oben auf dem Stapel lag. »So was hier. Die ist wirklich hübsch.« Ich hielt die bunte Jacke hoch. Sie war so hässlich, dass ich mir eher die Pulsadern aufgeschnitten hätte, als sie freiwillig zu tragen. Aber ich konnte nicht wählerisch sein.
»Ja, nicht wahr?« Der skeptische Ausdruck der Idle-Frau verschwand. »Die hat meine Schwester selbst gestrickt. Sie passt toll zu deinen Augen.« Sie deutete mit ihren stummeligen Fingern auf einen moosfarbenen Streifen, der keinerlei Ähnlichkeit mit meinen blattgrünen Augen hatte. Trotzdem nickte ich eifrig.
»Ja, das ist wirklich verblüffend. Als wäre sie für mich gemacht.« Ich strich sehnsüchtig über die kratzige Wolle.
»Du solltest sie anprobieren.« Sie lächelte, aber dann traf mich ein prüfender Blick. »Ich habe dich hier noch nie gesehen, oder?«
»Doch, sicher. Ich gehöre zu Frank.« Ich sagte es, als wäre ich verwundert, dass sie mich nicht erkannte. Es war eine sichere Wette. Irgendjemand hieß immer Frank.
»Ah, Frank Fortier, oder?« Ihr Gesicht hellte sich auf. »Man sieht die Ähnlichkeit. Bist du seine Tochter?«
Etwas in ihrer Stimme warnte mich davor, die Frage zu bejahen. »Nein«, antwortete ich. »Ich bin seine Nichte. Meine Mum hat mich vor einem Jahr aus Coventry hierhergeschickt. Wegen der Seeluft.«
»Seine Nichte, ah. Das ergibt Sinn, nach allem, was passiert ist.« Sie nickte und gab mir die Jacke. »Los, zieh sie an.«
Ich schlüpfte hinein und drehte mich einmal. Es war ein Stoff gewordener Albtraum. Die Jacke war unförmig, hatte zu lange Ärmel und die Farben passten nicht zusammen. Wenn die Schafe gewusst hätten, dass ihre Wolle für so eine Scheußlichkeit geopfert werden würde, hätten sie zu den Waffen gerufen. »Sie ist toll«, seufzte ich traurig. »Leider habe ich nichts zum Tauschen.«
»Ach, das ist in Ordnung.« Die Frau winkte ab. »Ich schenke sie dir. Mariette wird sich freuen, wenn jemand sie nimmt.«
Ich strahlte sie an.
»Super, danke! Das ist wahnsinnig nett.« Ich schloss die Knöpfe und zog meine Haare aus dem Kragen. Hoffentlich konnte ich das Ungetüm auf dem Heimweg entsorgen.
Ich wechselte noch ein paar Worte mit der Frau, dann verabschiedete ich mich und ging weiter. Von einem anderen Stand klaute ich ein Geschirrtuch und hängte es über meine Tasche, ein herrenloser Schal machte die Verwandlung zur harmlosen Bürgerin komplett. Gerade noch rechtzeitig: In dem Moment, als ich auf einen Stand mit Gemüse zuging, stürmten zehn Turncoats auf den Platz.
Niemand antwortete, als der Dünne lautstark nach jemandem in dunkler Kleidung und mit schwarzer Tasche fragte. Die Idles fürchteten die Wachleute und hätten sie nie angelogen. Aber da sie niemanden gesehen hatten, auf den die Beschreibung passte, blieben sie stumm. Ich setzte mich auf die Umrandung des alten Brunnens und hängte meine Tasche hinter mir in das leere Becken. Vielleicht hätte ich verschwinden können, aber es war nichts auffälliger als unauffälliges Verhalten. Also blieb ich und tat so, als wäre ich schon immer hier gewesen.
Die Turncoats begannen damit, Leute zu befragen, und kamen irgendwann zu mir. Ausgerechnet Owen wurde auf mich aufmerksam.
»Hey, du! Hast du etwas gesehen?« Er klang müde, hatte schweißnasse Haare und ein feuchtes Gesicht. Bei der Verfolgungsjagd musste er sich völlig verausgabt haben.
»Nein, Sir, nichts«, sagte ich verschüchtert. »Ich bin nur hier, weil ich etwas zum Anziehen gebraucht habe.« Ich zupfte am Ärmel meiner neuen Jacke.
»Und was ist in der Tasche?«, schnauzte er mich an.
»Nur Gemüse, Sir.« Schützend legte ich die Hände auf die Klappe.
»Mach sie auf.«
Ich zögerte.
»Nun mach schon!«, drängte er.
Ich gehorchte und öffnete die Tasche. Aber alles, was der Turncoat zu sehen bekam, waren ein paar Kartoffeln. Ich hatte sie in letzter Sekunde hineingeworfen, um den Operator zu verdecken.
»Räum sie aus«, befahl der Dünne.
»Jetzt hört aber auf!« Jemand schubste sich bis zu mir durch. Ich erkannte das Gesicht der Idle-Frau, die mir die Jacke gegeben hatte. Sie schien keine Angst vor den Turncoats zu haben. »Das ist Frank Fortiers Nichte, ihr Idioten. Glaubt ihr wirklich, dass sie verdächtig sein könnte?«
Ich hatte keinen blassen Schimmer, was sie meinte, aber ich atmete auf. Das Tragen der scheußlichen Jacke war ein fairer Preis für die Hilfe der Frau.
Der Dünne druckste herum, plötzlich ganz kleinlaut.
»Nein, natürlich nicht, ich hatte ja keine Ahnung …«
»Ja, das ist das Problem bei euch. Ihr habt nie irgendeine Ahnung!« Sie stellte sich vor mich. »Und jetzt hört auf, harmlose junge Mädchen zu belästigen.«
Normalerweise hätte ich mich gegen diese Bezeichnung gewehrt: Ich war vor zwei Monaten achtzehn geworden und zudem alles andere als harmlos. Trotzdem gab ich mir Mühe, nach beidem auszusehen.
Getuschel breitete sich aus und Wortfetzen flogen mir zu.
»Fortier? Der mit der toten Tochter?«
»Schlimme Sache war das.«
»Ist vom Pier gesprungen, mitten in der Nacht …«
Schnell reimte ich mir zusammen, dass die Tochter meines angeblichen Onkels Frank sich vor einigen Jahren umgebracht hatte, weil sie das Leben ohne Technologie nicht mehr ertragen hatte. Sie war kein Einzelfall, das wusste ich. Es hatte damals unzählige TechHeads wie sie gegeben – und es gab immer noch viele, die sich in der neuen Welt nicht zurechtfanden. Ich verstand nur nicht, wieso man den Tod wählte, wenn man auch für das kämpfen konnte, was man verloren hatte. Ich tat es. Alle hätten es tun sollen.
Im allgemeinen Wirrwarr schloss ich meine Tasche wieder und stand auf. Unter den Beileidsbekundungen der Leute nickte und lächelte ich, machte ein betroffenes Gesicht und konnte mich schließlich durch eine Lücke davonstehlen. Ich machte mir keine Sorgen, dass man mich doch noch verraten würde. Die Stadt war groß und Menschen sind katastrophal vergesslich. Selbst wenn ich in einer Woche erneut bei ihnen auftauchte, würde mich niemand mehr erkennen.
Der Weg nach Hause kam mir endlos vor, trotzdem blieb ich nicht stehen, um eine TransUnit zu ordern. Jede Fahrt wurde registriert. Ich wollte nicht mit dem Viertel in Verbindung gebracht werden.
Während ich lief, fuhr eine Unit nach der anderen an mir vorbei. Die Waggons sahen alle gleich aus, es gab keine Farb- oder Ausstattungsvarianten. Früher hatte es ein öffentliches System gegeben und zusätzlich eigene Wagen für Leute, die reich waren und luxusversessen. Heute existierten solche Begriffe wie »reich« oder »Luxus« nicht mehr.
Es gab eine Grundversorgung mit Wohnraum, Nahrungsmitteln, Kleidung und Medizin. Zusätzliche Entlohnung winkte allen, die ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stellten. Niemand musste mehr hungern, frieren, unter Brücken schlafen, betteln oder stehlen. Wirklich alle Menschen waren versorgt, das erste Mal in unserer Geschichte. Es klang wie das Paradies. Aber das war eine Lüge.
Über das schon seit fünfzig Jahren zentral regierte Europa herrschte jetzt ein einzelner Mann, der sich vor sechs Jahren selbst zum König ernannt hatte: Leopold de Marais. Innerhalb von Tagen war Europa mit allen Konsequenzen zu einer Monarchie mutiert, der alle Möglichkeiten eines modernen Überwachungsstaates zur Verfügung standen. Nicht, dass vorher tatsächlich ein demokratisches System geherrscht hätte, denn schon seit Jahren hatten die Big Ten, die zehn größten Unternehmen der Welt, über vieles bestimmt: Energie, Nahrung, Medizin, künstliche Intelligenz, Kommunikation. Wenn man ein Monopol hatte, konnte man eben vor allem eines: bestimmen. Aber obwohl die Regierungsmitglieder der Welt nur Marionetten in einem Theater gewesen waren, dessen Programm von den Konzernen vorgegeben wurde, hatten wir über unseren persönlichen Zugang zu all diesen Dingen selbst entscheiden können. Gegen Bezahlung natürlich, aber genau die hatte uns zu einem gewissen Grad mächtig gemacht. Denn wenn die Menschen nicht in eine neue Energietechnik, in ein neues Kommunikationssystem oder ein neues Virtual-Reality-Spiel investieren wollten, dann hatten auch die Konzerne sie nicht dazu zwingen können.
Jetzt war das anders. Es gab kein Mitspracherecht, keine Wahlen, keine Freiheit. Der König entschied, was wir essen, lernen oder denken durften. Aber vor allem setzte er mit aller Härte durch, was er als Notwendigkeit für unseren Fortbestand bezeichnete: das strenge Reglement jedweder Technologie durch den Staat.
Im Jahr 2134 waren wir praktisch wieder in der vortechnologischen Steinzeit angekommen. Freie digitale Kommunikation war untersagt, Informationszugang nicht mehr für jedermann verfügbar. WorldNet? Vergiss es. MediaLinks und ContentLinks? Keine Chance. Alles, was es noch gab, wurde vom König kontrolliert und von ihm nur eingesetzt, wenn es der Kontrolle der Bürger diente. Es war das Ende jeder freien Entfaltung, das Ende jeder objektiven Meinungsbildung. Das Streben nach Freiheit und Wissen, in den Industrienationen ehemals ein Geburtsrecht unserer Spezies, war absoluter Kontrolle gewichen. Das war kein Paradies. Es war die Hölle.
Offiziell nannte man es »Programm zur Rückbesinnung auf entscheidende Werte und soziales Zusammenleben«, weil die Menschen angeblich aggressiv und nicht mehr zu mitfühlendem Verhalten fähig gewesen waren. Aber so stand es nur in den offiziellen Berichten und Bekanntmachungen. In der Bevölkerung hatte sich ein anderer Ausdruck durchgesetzt. Wer jetzt über diese Zeit sprach, in der alle privaten Kommunikationsgeräte, Dateneinheiten und visuellen Implantate beschlagnahmt und zerstört worden waren, benutzte dafür nur einen Begriff: die Abkehr.
Ich werde nie den Tag vergessen, als die Abkehr in Kraft trat. Wir hatten in der Nähe von Paris gelebt, mein Bruder, meine Eltern und ich. An einem Dienstag im Frühjahr hatte es über alle Kanäle eine Mitteilung gegeben: Leopold de Marais habe die Macht in Europa übernommen. Ab jetzt würden andere Regeln gelten.
»Bitte händigen Sie jedes technische Gerät, das sich in Ihrem Besitz befindet, an die Kontrolleinheiten aus.« Der Satz hallte noch Tage später in meinen Ohren wider, als würde ich ihn über meine akustischen InterLinks empfangen. Aber die gab es da schon nicht mehr.
Ich war zwölf Jahre alt gewesen und hatte keine Ahnung gehabt, was diese Worte bedeuteten. Meine Mutter war in mein Zimmer gekommen, aufgewühlt und fahrig. Sie war sonst eine sehr beherrschte Frau. Ihre Unruhe hatte mir Angst gemacht.
»Ophelia, bitte pack deine Sachen zusammen. Sofort.«
»Was ist denn los? Welche Sachen?«
Ich hatte an meinem Holodesk gegessen, vor mir mein aktuelles Projekt. Es war ein Analysemodul zur Erkennung verschiedener Materialien gewesen, das ich mit meinem Dad entwickelt hatte. Meine Zukunft als Ingenieurin hatte zu diesem Zeitpunkt längst festgestanden.
»All deine Sachen, außer der Kleidung. Wir müssen alles abgeben, was technologiebasiert ist.«
»Alles? Aber –«
»Alles, Ophelia.«
»Ich kann aber doch nicht ohne meine Links, Mum!«, hatte ich protestiert. »Ohne sie kann ich nicht mehr nach draußen, weil ich ständig Schmerzen habe!« Angsterfüllt hatte ich sie angestarrt. Ein Kopfschütteln war die Antwort gewesen.
»Darum kümmern wir uns später. Beeil dich bitte.«
Dann war sie gegangen.
An diesem Tag waren meine Zukunftsträume gestorben, aber sie waren nicht das Einzige gewesen. Die Ehe meiner Eltern, beide hoch angesehene Ingenieure, überstand den Umbruch nicht. Nur zwei Jahre nachdem unsere Pads, Holodesks und sämtliche Hardware für künstliche Intelligenz aus dem Haus getragen worden waren, wurde die Trennung amtlich.
Mein Zwillingsbruder und ich zogen bald mit meinem Vater zurück ins ehemalige England und kurz darauf fand mein Dad wieder eine Freundin. Lexie Freeland war wie er Anglopäerin und lebte mit ihren beiden Kindern ebenfalls in Brighton, keinen Steinwurf von uns entfernt. Es dauerte nicht lange, bis wir bei ihr einzogen.
Das war mein Tiefpunkt gewesen.
Ich hatte versucht, mich an diese Situation zu gewöhnen, die in so vielerlei Hinsicht neu war. Aber zwecklos. Ich mochte die Leute in meiner neuen Schule nicht und wollte mich nicht an den analogen Unterricht gewöhnen. Lexies kleine Kinder fand ich genauso nervtötend wie sie selbst, die Stadt langweilig und farblos.
Mir fehlte das Leben mit den InterLinks für Ohren, Augen und Hände, obwohl meine Mutter damals bereits etwas gefunden hatte, das meine Symptome linderte. Ich war wütend gewesen, enttäuscht und allein.
Dann entdeckte ich eines Tages auf dem Nachhauseweg eine Gruppe von Jugendlichen, die zum Pier gingen. Da ich wusste, dass dort alles geschlossen hatte, folgte ich ihnen neugierig. Es dauerte nicht lange, bis sie mich bemerkten und einer von ihnen mich ansprach. Als überforderte Vierzehnjährige, die ich war, hatte ich etwas gestammelt und war weggerannt.
Das war mein erster Kontakt mit der Gruppe gewesen, die sich ReVerse nannte. Aber dabei war es nicht geblieben. Beim nächsten Mal lief ich nicht weg, als man mich ansprach. Eine Woche später nahm ich an meinem ersten offiziellen Treffen teil.
Einzelnen Aufruhr gab es öfter, aber ReVerse war der einzig ernst zu nehmende Widerstand im Land. Wir waren auf die Städte verteilt, untereinander vernetzt und gut organisiert.
Während andere Gruppen sinnlos demonstrierten oder wie die sogenannten Radicals Anschläge verübten, gingen wir gezielt vor und besorgten uns Informationen, mit denen wir dem König schaden und uns selbst helfen konnten. ReVerse ließ sich nicht zu unüberlegten Aktionen hinreißen, wir agierten im Verborgenen und warteten auf den richtigen Moment. Aber eines war klar: Wenn es an der Zeit war, würde der König nicht wissen, was ihn getroffen hatte. Und dann würde die Abkehr Geschichte sein.
4
Die QuarterSupply-Station war gut besucht, als ich dort ankam. Überall in der Stadt gab es diese Gebäude, eines für jedes Viertel. Man erhielt dort vorbestellte Lebensmittel und Kleidung aus dem königlichen Sortiment – denn wenn man nicht selbst stricken wollte, wie die Idles oder Lexie es taten, musste man auf die sogenannte Lilienkleidung zurückgreifen. Der König hatte jede Form von industrieller Produktion, die über den Eigenbedarf und kleineren Tauschhandel hinausging, unterbunden. Es war völlig egal, ob es dabei um Klamotten, Geschirr oder Möbel ging, seine Paranoia und sein Ego duldeten nichts, was auch nur entfernt mit Technologie zu tun hatte und nicht seiner Kontrolle unterlag. Aber natürlich war das nur zu unserem Besten. Bla, bla, bla.
Holte man etwas in der Supply-Station ab, gab es oft den neuesten Klatsch dazu. Seit man Nachrichten nur noch auf offiziellen Pads des Königs lesen konnte, wurden inoffizielle Neuigkeiten von Person zu Person weitergegeben. In erster Linie war es Zeitvertreib, weil es sonst nicht viel zu tun gab. Ich sah mich um. Unter diesen Menschen waren Wissenschaftler, Ingenieure und andere kluge Köpfe, die früher die Welt verändert hatten. Für sie war der Gang zur Supply-Station nun das traurige Highlight des Tages.
»Hey, Phee, alles klar?« Liora Pike, eine Freundin von mir, drängte sich durch die Menschen und kam mit einem schwer beladenen Korb auf mich zu. Sie lebte bei ihren Großeltern, die außerhalb wohnten und auf die öffentliche Versorgung angewiesen waren.
»Hi, das ist ja ein Zufall.« Ist es nicht. Wir taten nur so, damit die Übergabe der gestohlenen Daten unauffällig ablief. »Haben sie eure Station immer noch nicht wieder aufgebaut?« Die Radicals hatten die Vergabestelle am Stadtrand vor zwei Wochen niedergebrannt.
»Nein, es fehlt Material. So lange werden wir auf die anderen Stellen verteilt.« Liora hob die schmalen Schultern.
Wir hätten nicht unterschiedlicher aussehen können. Ich hatte haselnussbraune Haare und bekam in der Sonne schnell Farbe, mit 1,75m war ich recht groß, dazu schmal und durch das regelmäßige Training athletisch. Liora dagegen war kleiner und dunkelhaarig, hatte graue Augen und eine zerbrechliche Statur. Letztere täuschte allerdings: Meine Freundin war genauso lange beim Widerstand wie ich.
»Kommst du nachher auch zur Probe?«, fragte sie.
»Glaubst du, das lasse ich mir entgehen?« Ich grinste und deutete auf meine Tasche. »Ich habe übrigens deine Bücher mitgebracht, die alten Sagen über Odysseus. Sie sind ziemlich schwer. Ich hoffe, du kannst sie tragen.«
»Ach, das ist kein Problem. Ich fahre eh mit der TransUnit.« Liora streckte die Hand nach der Tasche aus und schob sich den Riemen über die Schulter. »Wir sehen uns später im Theater. Danke für die Bücher.« Sie hob die Hand und verschwand in Richtung des nächsten Terminals.
Ich fühlte mich leichter, als ich zum Eingang der Station ging, um meine Bestellung zu holen. Die Übergabe war geglückt, und nun lag es in Lioras Verantwortung, den Operator mit den Daten zu Julius zu bringen. Ich hatte es geschafft. ReVerse hatte es geschafft.
Das tiefe Glücksgefühl, das ich früher nach einer geglückten Aktion gehabt hatte, blieb jedoch aus. Es war an dem Tag verschwunden, als sie Knox festgenommen hatten – und wie er war es nie zu mir zurückgekehrt.
Ich brauchte nur wenige Minuten von der Supply-Station bis nach Hause. Seit vier Jahren war das ein zweistöckiger Backsteinbau, der zu einem ehemaligen Werksgelände gehörte. Über dem Haupttor war noch schwach der Schriftzug British Engineerium zu erkennen. Welch Ironie.
Unser Haus lag am Rande des Geländes, auf dem noch weitere Familien und ein paar Alleinstehende wohnten. Als ich über den Hof ging, war es ruhig – keine Stuhlkreise, kein Holzbildhauern, kein Selbsterfahrungskurs. Nur ein paar Kinder spielten neben der Rinderkoppel und winkten mir zu. Ich erwiderte die Geste müde und lächelte. Hier durfte ich niemals unhöflich sein oder mich unangemessen verhalten. Im Engineerium war ich ein Wolf unter Schafen. Niemand durfte meine Zähne sehen.
»Ich bin zu Hause!«, rief ich, als ich die Tür aufstieß und die Tasche mit den Lebensmitteln aus der Supply-Station abstellte. Gemächlich schnürte ich meine Stiefel auf, dann dehnte ich Rücken und Arme. Meine Schultern waren verspannt und die Stelle an meiner Hüfte pochte. Das würde ein enorm großer blauer Fleck werden.
»Endlich!«, rief meine Stiefmutter Lexie, die barfuß in der Küche herumwuselte. Mit ihrem lässig hochgebundenen blonden Haar, der roten Haremshose und dem übergroßen taubenblauen Pullover erinnerte sie mich einmal mehr an eine durchgedrehte Kunststudentin. »Hast du meinen Reis bekommen?«
Ich nahm die Tasche und trug sie zum Esstisch.
»Es ist alles hier, auch das ekelhafte Curry-Zeug, das du wolltest.«
»Du bist ein Schatz, Phee.« Lexie strahlte und steckte sich den Kochlöffel hinter das Ohr. »Auch wenn ich das ›ekelhaft‹ überhört habe. Curry ist gesund, wirkt entzündungshemmend und beugt Krankheiten vor.« Sie hob mahnend den Finger. Dann musterte sie mich. »Hübsche Farben. Du solltest öfter was Buntes tragen.«
Ich sah an mir herunter. Oh verdammt. Ich hatte vergessen, die Jacke des Grauens auf dem Heimweg zu entsorgen. Jetzt hatte mich die halbe Stadt in der Geschmacksverirrung gesehen.
»Ach, das«, sagte ich und zog den Albtraum schnell aus, »das gehört Liora. Mir war kalt und ich hatte nichts dabei.« Ich warf die Jacke in die Ecke zu den Stiefeln. Dann ließ ich mich auf einen Stuhl am Esstisch fallen.
In unserem Loft sah es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Das Wohnzimmer beherbergte nicht nur unzählige Bücherregale und drei bunte Sofas, sondern auch haufenweise Projekte von Lexie, die niemals fertig wurden: Strickzeug auf dem Couchtisch, Papierfetzen für eine Collage auf dem Boden, gefärbte Stoffstreifen an der Wendeltreppe, die zu den oberen Zimmern führte. Dazu kamen die Skulpturen und Zeichnungen meines Bruders Eneas – direkt vor mir lag ein Stapel Aktbilder – und der Kram von Lexies Kindern Fleur und Lion. Das war der Zustand an guten Tagen. An schlechten gab es schon mal lebende Hühner in der Küche oder eine Töpferwerkstatt im Wohnzimmer. Der Teppich war mein fleckiger Zeuge.
»Wann gibt es etwas zu essen?«, fragte ich.
Lexie drehte sich zu mir um. »Keine Sorge, es dauert nicht mehr la–«
»Phee! Ein Glück, du bist da!« Ein blonder Wirbelwind schoss heran und stoppte am Tisch. »Du musst mir den Pullover mit den kleinen Vögeln leihen. Bitteeee.« Herzzerreißend sah Fleur mich an. Sie hatte das Gesicht eines Engels und den Dickkopf eines Panzernashorns – und wusste mit ihren zwölf Jahren beides für sich zu nutzen.
»Der ist dir doch viel zu groß, Flo«, lachte ich.
»Das muss so! Nennt sich Heavysize Look. Auf welchem Planeten lebst du eigentlich?« Fleur verdrehte die Augen.
»Ich habe keine Ahnung«, antwortete ich, »in welcher Galaxie gibt es freche Mini-Blondinen, die ihren großen Schwestern Klamotten klauen?«
Fleur musste lachen. »Du bist so doof.«
»Nein, großzügig.« Ich knuffte sie in die Seite. »Du kannst den Pulli haben, wenn du willst.«
»Echt? Du bist die Größte!« Fleur fiel mir um den Hals und ließ erst los, als ich röchelnde Geräusche von mir gab. »Mum, ich geh dann nach dem Essen zu Sophia. Ich komme vor zehn zurück. Okay, vielleicht wird es auch halb elf.« Sie drückte mir einen Kuss auf die Wange und verschwand in Richtung Badezimmer.
»Warst du in dem Alter auch so?«, stöhnte Lexie, die am Herd stand und in zwei Töpfen gleichzeitig rührte.
Ich dachte kurz nach. Als ich zwölf gewesen war, hatte mich die Abkehr von einem zufriedenen Kind in einen hilflosen Teenager verwandelt. Aber das konnte ich Lexie nicht sagen. Sie hatte keine Ahnung, wie sehr ich das alles hasste.
»Ich hatte nach der Abkehr andere Probleme als Fleur«, antwortete ich ausweichend. »Aber das Verhältnis zu meiner Mutter war damals trotzdem nicht einfach.« Als wäre das irgendwann anders gewesen.
»Das beruhigt mich.« Lexie probierte den Inhalt des einen Topfes. »Aber sei froh, dass du noch jung warst, als die Abkehr ausgerufen wurde. So konntest du dich besser anpassen.«
»Mhm.« Mehr sagte ich nicht dazu. Die Mitglieder von ReVerse trugen ihre Ansichten nicht nach außen. Niemand, der halbwegs intelligent war, tat das. Erst recht nicht vor Leuten wie meiner Stiefmutter.
Lexie war eine Phobe. So nannte man den Teil der Bevölkerung, der schon vor der Abkehr Technologie abgelehnt hatte. Die Phobes hatten entschieden, ohne all das auszukommen, was das Leben lebenswert machte – zum Beispiel virtuelle Welten oder digitale Kommunikation. Sie bewohnten oft Enklaven wie das Engineerium, bauten ihr Gemüse selbst an, hielten sich Tiere und standen auf esoterisches Blabla wie Meditation und Naturanrufungen. Dazu kamen jede Menge absurde Ansichten: Phobes glaubten, das Schlachten von Tieren wäre besser als die synthetisch gezüchtete Variante, sie zogen das Waschen mit der Hand dem mit einer CleanUnit vor und strickten und webten ihre Kleidung selbst. Wenn man mich fragte, war das fast noch dämlicher als die Ansichten der Radicals. Die versuchten zwar, ihre Ziele mit Gewalt und Vandalismus durchzusetzen, aber sie hatten immerhin die richtige Grundidee.
Sobald das Thema jedoch aufkam, schwieg ich. Wenn auf Technologie geschimpft wurde, schwieg ich. Wenn die Errungenschaften der letzten hundert Jahre für Werke des Teufels gehalten wurden, schwieg ich. Obwohl alles in mir widersprechen wollte, hielt ich den Mund. Das war meine Verpflichtung als Mitglied von ReVerse. Wenn man seine Gedanken offen äußern wollte, musste man zu den Radicals gehen. Wenn man etwas bewegen wollte, kam man zu uns.
Lexie holte mich aus meinen Gedanken. »Würdest du deinem Vater Bescheid geben, dass wir in zehn Minuten essen?« Sie legte den Löffel beiseite und nahm einen der Töpfe vom Herd. »Andrew ist im Gewächshaus, er kümmert sich um die Tomaten. Sie wollen nicht wachsen.«
Das könnte daran liegen, dass er Ingenieur ist und kein verdammter Gärtner.
»Natürlich.« Ich lächelte und stand auf. Schweigen und Lächeln, das war mein tägliches Brot bei Lexie. Dabei mochte ich sie eigentlich gern – sie war ein netter Mensch und eine bessere Mutter als meine eigene. Nur ihre Ansichten bescherten mir regelmäßig Brechreiz.
Ich ging kurz in mein Zimmer, um mich umzuziehen und etwas gegen meine Kopfschmerzen zu nehmen. Dann lief ich zurück nach unten. Kühle Luft schlug mir entgegen, als ich die Tür zum Garten öffnete und in Lexies Gummistiefel schlüpfte.
Unser Garten bestand aus einem Stück wildem Rasen, ein paar Beeten und einer Terrasse. Am Rand stand ein kleines Gewächshaus mit sechseckigem Grundriss und fleckigen Scheiben. Als ich näher kam, entdeckte ich meinen Vater an einem Tisch. Er zupfte behutsam die verwelkten Blätter einer Tomatenpflanze ab und setzte sie in einen größeren Topf. Als er sich zur Seite drehte, sah ich den verlorenen Ausdruck auf seinem Gesicht. Unwillkürlich spürte ich einen Kloß im Hals.
Mein Vater, Andrew Scale, war einer der brillantesten Menschen unserer Zeit – oder eher jener Zeit, die mit der Abkehr beendet worden war. Er hatte für MedSol gearbeitet, den Medizintechnik-Konzern der Welt, einen der Big Ten. Für ihn hatte er intelligente Systeme entwickelt, die mittels Nanotechnologie Krankheiten aufspürten und heilten, lange bevor sie ausbrachen. Seine Arbeit hatte Tausenden das Leben gerettet.
Er war aber nicht nur ein Visionär gewesen, sondern vor allem der beste Lehrer der Welt. Ich hatte von ihm gelernt, wie man eine Circuit Printing Unit bediente und Layer erstellte – gedruckte Folien bestückt mit Schaltungen, Steuerungen und Informationen, das Herzstück jeder Technologie. Er hatte mir beigebracht, wie ich etwas erschaffen konnte, wenn ich Wissen und Wollen mit Logik kombinierte. Simple Mathematik hatte er das genannt.
Aber dann war die Abkehr gekommen, hatte ihm sein Lebenswerk genommen und seine Leidenschaft zu etwas Verbotenem erklärt. Die Tore von MedSol waren von einem Tag auf den anderen geschlossen worden. Er hätte danach bestimmt eine Stelle in der Entwicklungsabteilung des Königs bekommen können, denn medizinische Versorgung gab es immer noch, wenn auch auf einem anderen Niveau. Aber mein Vater hatte gesagt, seine Freiheit wäre ihm wichtiger. Jetzt arbeitete er zwanzig Stunden wöchentlich im Elektrizitätswerk, starrte auf einen altertümlichen Monitor und informierte einen Supervisor drei Städte weiter, wenn etwas nicht stimmte. Dazu versuchte er sich an allen Beschäftigungen, die Lexie ihm ans Herz legte. Wenn ich ihn so ansah, bezweifelte ich, dass er sich jetzt frei fühlte. Wahrscheinlich war er nie weiter davon entfernt gewesen. So wie wir alle.
Vorsichtig klopfte ich an den Rahmen der offenen Tür. Es roch nach Erde und Dünger – Rindermist vermutlich. Der Geruch trieb mir Tränen in die Augen.
»Hey, Dad. Lexie lässt ausrichten, dass es bald Essen gibt.«
Mein Vater drehte sich um und sein Gesicht hellte sich auf. Ich wusste nicht, ob er sich wirklich freute oder einfach eine Maske aufsetzte.
»Hi, Schatz. Ich komme sofort.« Er deutete auf die Pflanzen. Diejenige, die er gerade festgebunden hatte, ließ traurig den Kopf hängen. »Sie wollen nicht so, wie ich will. Ich fürchte, ich tauge nicht zum Gärtner.« Er zog die Schultern hoch.
»Wir wissen beide, dass es so ist.« Ich lächelte leicht und deutete auf seine dreckige Stirn. »Du hast da was.«
»Oh, wirklich?« Mein Vater wischte sich das Gesicht ab und schmierte die Erde dabei in seine dunklen Haare. »Das ist wohl die Rache der Natur.«
»Warum sagst du Lexie nicht, dass dir das Gärtnern keinen Spaß macht?«
»Ach, nein.« Er hob erneut die Schultern. Mit seiner hochgewachsenen, schlaksigen Gestalt sah er aus wie ein großer Junge. »Sie freut sich, wenn ich es versuche.«
»Bist du mal auf die Idee gekommen, etwas zu tun, das dir Freude macht?« Mein Ton geriet schärfer als beabsichtigt. Der Blick meines Vaters wurde wachsam.
»Und das wäre?«
»Das weißt du genau«, sagte ich.
Er seufzte. »Es sind jetzt sechs Jahre, Phee. Denkst du nicht, es wird Zeit, die Situation zu akzeptieren?«
»So wie du?« Ich schnaubte. »Soll ich vielleicht auch Tomaten pflanzen oder hässliche Kerzenleuchter töpfern? Glaubst du, davon geht es mir besser?«
Mein Vater sah erst die Pflanze und dann traurig mich an. »Ist dieses Leben denn wirklich so furchtbar für dich? Wir haben doch alles. Genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, ausreichend Zeit für Beschäftigung. Glaubst du, der König würde für all das sorgen, wenn wir ihm egal wären?«
»Der König hat seine Macht im Sinn, sonst nichts«, sagte ich. »Wieso verteidigst du diesen Despoten immer? Du warst selbst Teil der Welt, die er zerstört hat.« Ich hasste es, wenn mein Vater so tat, als ginge ihn das alles nichts an. Als wäre er nie mit Leib und Seele Ingenieur gewesen.
»Weil ich davon überzeugt bin, dass er seine Gründe hat. Gründe, die über das hinausgehen, was man uns sagt.« Mein Vater nickte. Wahrscheinlich redete er sich das jeden Tag ein. Oder Lexie tat es für ihn.
»Wenn er wirklich so tolle Gründe hätte, könnte er sie uns auch mitteilen«, sagte ich. »Warum sollte er uns etwas verschweigen, das dabei helfen könnte, seine bescheuerte Entscheidung zu verstehen?«
»Das weiß ich nicht.« Mein Vater schüttelte den Kopf. »Aber ich weiß, dass deine Wut niemandem hilft, Ophelia. Am allerwenigsten dir selbst.«
Er musterte mich mit diesem mitleidigen Blick, den ich so hasste. Es gab keinen Grund, warum ich ihm hätte leidtun müssen. Er war derjenige, der aufgegeben hatte. Er war derjenige, der sich von Lexie hatte weichkochen lassen und jetzt den Lügen des Königs glaubte.
Ich hätte noch so viel sagen können.
Zum Beispiel, dass es nicht in meinen Kopf wollte, warum wir in einer Welt fast ohne Technologie ausgerechnet an einem Ort lebten, wo es gar keine gab. Oder, dass seine Haltung jede Verbindung zwischen uns zerstörte. Aber es war sinnlos. Wir würden nie wieder das sein, was wir vor der Abkehr gewesen waren. Zu viel war seitdem passiert.
»Immerhin bringt meine Wut keine Pflanzen um«, antwortete ich abfällig. »Aber mach du nur weiter damit. Ich für meinen Teil werde mein Leben nicht mit etwas verbringen, das ich nicht kann.«
Ich ließ ihn nicht antworten, sondern drehte mich um und stapfte zurück zum Haus. Die fünf Meter Weg gehörten mir und meiner Wut – ich trat so heftig auf, dass mir die Fußsohlen wehtaten. An der Terrasse kickte ich die Stiefel von meinen Füßen, dann öffnete ich die Tür. Als ich hindurchging, atmete ich langsam aus und setzte ein Lächeln auf. Meine Wut blieb wie ein Mantel an der Garderobe zurück.
5
»Wo ist das Salz?«
»Ich brauche neue Stifte für meine Mappe.«
»Mum, Lion klaut immer meine Socken!«
»Schmeckt es euch? Das ist ein neues Rezept.«
»Deine Socken passen mir überhaupt nicht, du Kröte!«
»Es ist sehr gut, Liebling, hat so was … Erdiges.«
»Nenn mich nicht Kröte!«
»Ruhe jetzt, alle beide!«
Es war immer ein Chaos, wenn wir aßen. Fleur und Lion begannen zu streiten, Eneas beschwerte sich über irgendetwas, Lexie wollte schlichten, mein Vater schwieg – und ich versuchte, nicht durchzudrehen. Bei dieser Familie musste man taub und blind sein, um keinen Anfall zu bekommen.
»Habt ihr zwei schon einen Termin bei der Berufsberatung ausgemacht?«, fragte mein Vater und sah Eneas und mich an.
Ich überließ meinem Bruder die Antwort. Optisch waren wir uns so ähnlich, wie man es bei Zwillingen erwarten konnte – die schmale Nase, die grünen Augen, die hellbraunen, glatten und kräftigen Haare. Auch die scharfen Konturen unserer Gesichter waren gleich. Unser Charakter hätte jedoch nicht unterschiedlicher sein können. Eneas war ein Denker und Künstler. Er malte und zeichnete, sprach gerne über Philosophie und ergründete den Sinn des menschlichen Seins. Ich dagegen war analytisch und zielstrebig. Kreativität kannte ich nur, wenn es um Technik ging. Für Kunst hatte ich kein Talent.
»Mein Termin ist nächste Woche«, antwortete Eneas zwischen zwei Gabeln von Lexies Reisgemüsepampe. »Aber Phee hat noch keinen.« Er grinste mich an.
»Alte Petze«, murrte ich, aber ich war nicht ernsthaft verärgert, wie so oft. Vielleicht war das etwas Biologisches unter Zwillingen – genetische Friedfertigkeit, um einander nicht umzubringen.
»Du solltest es erledigen«, mahnte mein Vater. Er ließ sich nicht anmerken, dass ich ihn vorhin mies behandelt hatte. »Diese Termine sind verpflichtend.«
Ja, weil der König das so angeordnet hat. Und wir machen natürlich immer alles, was er uns befiehlt.
»Das weiß ich. Aber ich habe keine Ahnung, was ich denen sagen soll.« Ich schob das Essen auf dem Teller herum. Die Pampe sah nicht nur aus wie pürierter Frosch, sie schmeckte auch so.
»Deswegen nennt es sich ja Beratung, Schatz. Damit dir jemand hilft, das Passende für dich zu finden.«
»Tja, das gibt es seit sechs Jahren nicht mehr«, sagte ich.
»Das ist Unsinn, und das weißt du auch«, entgegnete mein Vater, als hätte es unseren Zusammenstoß im Gewächshaus nicht gegeben. »Es gibt für jeden einen Bereich, der ihm Freude macht.«
»Du könntest dich nach einem Geschichtsstudium erkundigen«, mischte sich Lexie ein. »Daran hast du doch Interesse.«
»Ja, vielleicht.« Ich presste die Lippen aufeinander. Alte und Neuere Geschichte war Knox’ Fach an der Uni gewesen. Seine Leidenschaft, nicht meine. Nichts auf der Welt hätte mich dazu gebracht, weiter daran festzuhalten, nun, wo er es nicht mehr konnte.
»Schön. Dann kannst du das bei deinem Termin sagen. In Ordnung?« Mein Vater sah mich nicht an, während er das sagte. Ich fragte mich, ob ihm klar war, dass ich niemals Geschichte studieren würde.
Zu Hause wurde nicht über Knox gesprochen. Lexie hatte es einmal versucht, aber die Gründe für Knox’ Festnahme machten es nahezu unmöglich, mit einer Phobe dergleichen zu besprechen. Sie hatte über ihn geredet, als wäre er ein Wahnsinniger gewesen und ich sein gutgläubiges Opfer. Beinahe wäre ich ihr dafür an die Gurgel gegangen. Da war mir das hilflose Schweigen der anderen lieber.
»Sicher.« Ich nickte, meinte aber das Gegenteil. Es wirkte trotzdem. Sofort wandte man sich anderen Gesprächsthemen zu.
»Gut. Lexie, was war das Problem bei den Flyern?«
»Dad, wie sieht es mit meinen Stiften aus?«
»Mum, wenn ich heute früher nach Hause komme, darf ich dann am Wochenende bei Sophia übernachten?«
Das Chaos am Tisch nahm seinen Fortgang. Ich aß noch drei Bissen von meiner Reispampe, damit ich mich nicht daran beteiligen musste. Oft fühlte ich mich in meiner Familie wie ein unbeteiligter Zuschauer. Manchmal fragte ich mich, ob ich überhaupt noch dazugehörte. Oder ob ich das wollte.
Eine Viertelstunde später war ich endlich erlöst.
»Ich muss los, wir haben um acht Uhr Probe.« Ich stand auf und trug meinen Teller zur Spüle. Natürlich hatten wir auch hier keine technische Unterstützung. Was fürchteten die Phobes eigentlich? Dass eine simple DishUnit eines Tages die Weltherrschaft übernahm?
»Ist das immer noch diese Theatergruppe?« Lexie sah auf. »Wann habt ihr eigentlich eine Aufführung? So oft, wie ihr probt, müsst ihr ja schon echte Profis sein.«
Ich ging zur Garderobe und griff nach meinen Stiefeln.