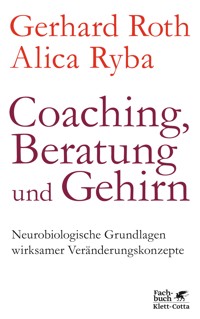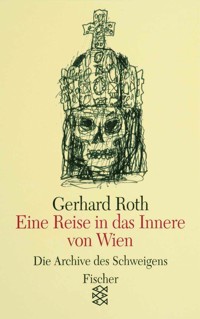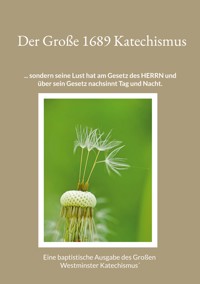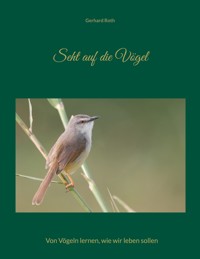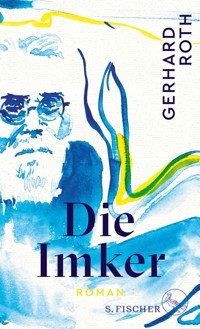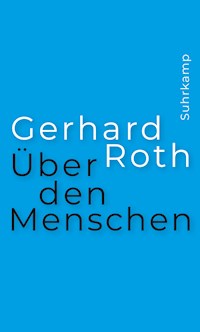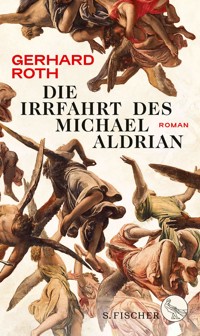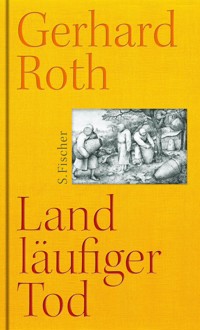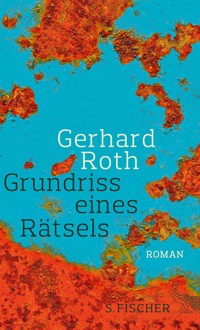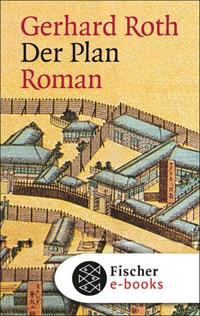9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
32 Jahre lang hat Gerhard Roth an seinen beiden Romanzyklen »Die Archive des Schweigens« und »Orkus« gearbeitet – ein einzigartiger Kosmos der Literatur und des Denkens, der neben klassischen Romanen auch dokumentarische und essayistische Bände umfasst. Der Band »Orkus« ist der Schlussstein dieser monumentalen Arbeit und nicht überbietbarer Endpunkt: ein autobiographischer Roman, in dem das Leben des Autors mit dem seiner Figuren auf faszinierende Weise verschmilzt. »Orkus« ist die Essenz eines Schriftstellerlebens: ein Buch über das Wesen des Menschen, die Wahrnehmung der Welt, die Suche nach einer anderen Wirklichkeit. Eine lange Reise zu den Toten und der grandiose Versuch, das Leben zu verstehen, ohne es zu zerstören. Zum Werk von Gerhard Roth gibt Auskunft der Materialienband »Die Zeit, das Schweigen und die Toten«, herausgegeben von Jürgen Hosemann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 756
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Gerhard Roth
Orkus
Reise zu den Toten
Über dieses Buch
32 Jahre lang hat Gerhard Roth an seinen beiden Romanzyklen »Die Archive des Schweigens« und »Orkus« gearbeitet – ein einzigartiger Kosmos der Literatur und des Denkens, der neben klassischen Romanen auch dokumentarische und essayistische Bände umfasst.
Der Band »Orkus« ist der Schlussstein dieser monumentalen Arbeit und nicht überbietbarer Endpunkt: ein autobiographischer Roman, in dem das Leben des Autors mit dem seiner Figuren auf faszinierende Weise verschmilzt. »Orkus« ist die Essenz eines Schriftstellerlebens: ein Buch über das Wesen des Menschen, die Wahrnehmung der Welt, die Suche nach einer anderen Wirklichkeit. Eine lange Reise zu den Toten und der grandiose Versuch, das Leben zu verstehen, ohne es zu zerstören.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Gerhard Roth, 1942 in Graz geboren, lebt als freier Schriftsteller in Wien und der Südsteiermark. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Erzählungen, Essays und Theaterstücke, darunter den 1991 abgeschlossenen siebenbändigen Zyklus »Die Archive des Schweigens«. Seitdem erschienen die Romane »Der See«, »Der Plan«, »Der Berg«, »Der Strom« und »Das Labyrinth«, der autobiographische Band »Das Alphabet der Zeit« sowie die literarischen Essays über Wien »Die Stadt« – ein zweiter Zyklus, der im Frühjahr 2011 mit dem Band »Orkus« abgeschlossen wurde.
Impressum
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Imke Schuppenhauer
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011
© 2011 by Gerhard Roth
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401324-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
»Jetzt steigen zu der düstern Welt wir nieder«,
Begann zu mir ganz totenbleich der Dichter,
»Ich selber geh’ voraus, du wirst mir folgen!«
Und ich, der seiner Farbe inne worden,
Sprach: »Wie komm ich hinab, wenn du erschauderst,
Der du mich sonst ermutigt, wenn ich zagte?«
Und er zu mir: »Es malt die Angst der Seelen
Dort unten wohl mir des Erbarmens Züge
Aufs Angesicht, wo Furcht du glaubst zu lesen.
Wohlan denn; fort! Uns treibt des Weges Länge!«
Dante, Die Göttliche Komödie
Die Hölle, Vierter Gesang
»Sonst wollte ich zeigen, wie sich an das Ende der Anfang knüpft, wie nämlich der Eros mit dem Tode in einem geheimen Zusammenhange steht, vermöge dessen der Orkus (…) also nicht nur der Nehmende, sondern auch der Gebende und der Tod das große Réservoir des Lebens ist. Daher also, daher, aus dem Orkus, kommt alles, und dort ist schon jedes gewesen, das jetzt Leben hat …«
Arthur Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit
Prolog
[*]
Ich war dreißig Jahre alt, als ich entdeckte, dass mein Leben eintönig und flach geworden war. Es wies nicht mehr die Dichte, den Schrecken, die Verzweiflung auf wie in meinen früheren Jahren, die ich fast vergessen hatte: In meiner Erinnerung bestanden sie aus düsteren Wolkenbildern, Blutflecken auf zerfleddertem Verbandsmull, aus Mauern, von denen Verputz abbröckelt, Fischschuppen, Kanälen voll Scheiße, Hühnerfedern, Tintenklecksen, gelben Bleistiften, entzündetem Zahnfleisch, Stille nach der Angst, erfundenen Ameisen, rostiger Luft, blühenden Briefmarken, aus bleichen Spermien, Erbrochenem, den Träumen von Embryos, gehäkelten Hakenkreuzen, den Rillen von Schellacks, aus von Adern durchzogenen Augäpfeln, aus obszönen Heiligenbildchen, vergifteten Buchstaben, der Sprache von Molekülen, der Urzeit der Farben, Waschbecken voller Ziffern, aus Mosaiken aufgespießter Insekten, orthopädischen Schuheinlagen, zerrissenen Fotografien, verstreuten Kinderliedern, Landkarten des Nonsens, dem Vaterunser der Küchenkredenz, aus verwesenden Kanarienvögeln, glucksenden Flaschenbürsten, Knochenpulver, Amok laufenden Eisverkäufern, Betten aus Gusseisen, der Einsamkeit des Hinterhauses, unerwarteten Geistesblitzen, künstlichen Würmern, aus der Moral der Tyrannen, kränkelnden Tagen und tanzenden Buchstaben, aus nächtlichen Gewässern, sprechenden Teppichen, dem Zischen des Bügeleisens, aus Reisen in den Handlinien, aus finsterem Zorn und schwebenden Walen, aus Sporen, Papierflugzeugen und Gemüsegärten, aus Dreier-Zigaretten und pfeifenden Zügen, aus schmutzigen Kragen, aus Katzen, aus Vegetariern, den Giftspinnen der Lügen, Gebissen in Trinkgläsern, aus Schweißflecken, Verstopfung, Provinzpolitikern, hölzernen Aborten, Requisiten der Eitelkeit, Gaunern, klatschenden Ehepaaren, Fieberblasen, Kapiteln der Gemeinheit und abstrakten Gemälden von Gefühlen, aus Qualen, Salz und Altären, Monstranzen, Pfingstrosen und Wundsalben, kalligraphischen Schulheften, Schachfiguren, Ellipsen, hektischen Trickfilmen, Wassergras, kindlichen Märtyrern, Echos von Stimmen, fröhlichen Gliederschmerzen, aus Küssen, die nach Seeigeln schmeckten, spitzen Kieselsteinen, schlaflosen Spiegeln, aus monotonen Würfelspielen, aus Schlachthöfen der Armut, aus stummen Telegrammen und einer endlosen Flut unzusammenhängender Bilder, Sätze, Geräusche und Gerüche.
Mein Gehirn war zu einer Müllhalde der Erinnerungen geworden, die sich transformierten, miteinander verbanden oder in Luft auflösten. Manchmal zogen Gerüche über die versickernde Welt, es roch nach dem Kampfer der Schulhefte, dem Weihrauch der Blätter, dem Naphthalin von Vogelkot, dem Persil der Kuckucksuhren, es roch nach saurem Fisch, sobald der Donauwalzer im Radio spielte, nach Tod beim Flug der Vögel, nach Bensdorpschokolade am 1. Mai, nach Malz im Frühling, es roch nach Notenschlüsseln in den Schulferien, und es stank nach nassen Hunden am Morgen, nach verbrannter Milch während der Beichte und nach Mäusekot am Geburtstag, es roch nach Bilderbüchern, als Omi starb, nach Karies beim »Mensch ärgere dich nicht!«-Spiel, nach Schaukelpferden in der Schule, nach Straßenbahn, wenn wir die Zeitung aufschlugen, und nach Kork, sobald wir das Haus betraten.
Aber die Buchstaben, die nach Jod rochen, die Vokale, Konsonanten, die Verben und Substantive, die Adjektive und Pronomen hatten sich verflüchtigt, die Sätze, Beistriche, Ruf- und Fragezeichen, die Strichpunkte und Doppelpunkte waren ebenso verschwunden wie Mutters Nähmaschine, die Teller mit der Buchstabensuppe, die Urinflecken mitsamt den Unterhosen, das Stethoskop meines Vaters, die Vogelmotive mit der Blumenvase, der Asthmainhalator, der Gugelhupf und die sozialdemokratische »Neue Zeit«. Meine Erinnerung an die Kindheit war wie eine Litfaßsäule, die von den bunten Schnipseln abgerissener Plakate übersät ist und wie im Traum in der Luft schwebt, umspült von Gerüchen. Aber da war noch etwas, das ich aus der Vergangenheit kannte und das den Zerfallsprozess überdauert hatte: meine Neugierde auf das Unglück.
Fußnoten
[*]
Eben noch hatte eine Papierschnitzelmaschine weiße und schwarze Flocken aus Buchstaben in mein Gehirn geschneit, die sich zu seltsamen Erinnerungsbildern zusammenfügten, als habe sie ein magischer Wirbelwind geordnet. Plötzlich aber hatten sich die Partikel wieder in ein Geflimmer verwandelt, das einem schnell zurückspulenden Film glich, den ich jedoch auf der Leinwand meiner Vorstellungskraft nicht entziffern konnte, da ich durch die Geschwindigkeit, mit der er rückwärts ablief, nur »hell-dunkel« und »Bewegung« zu unterscheiden vermochte: Wolken von Licht- und Schattenplankton, von Elektronen, mikroskopischen Bildchen, die im Zeitraffer abgespielt wurden und die allmählich von mir als Erythrozyten, Zellen und Synapsen erkannt wurden, als Muskelfasern, Hautschuppen, Kapillaren, welche langsam Farbe annahmen und jetzt in Zeitlupe vor meinen Augen erschienen und schließlich ganz zum Stillstand kamen … Ich saß als Medizinstudent vor dem Mikroskop und starrte im histologischen Praktikum – das Lehrbuch vor mir aufgeschlagen – auf das Präparat (graue Gehirnzellen) und prägte mir ihre Form ein …
Über das Unglück
Solange ich denken kann, zog mich das Unglück an – der Tod, der Selbstmord, das Verbrechen, der Hass, der Wahnsinn. Was diese Eigenschaft betrifft, bin ich nie erwachsen geworden, denn ich gebe noch immer meiner Neugierde nach und erschrecke dabei wie eh und je, ohne dass ich davon lassen kann. Im Unglück sehe ich das eigentliche Leben. Ich durchforschte schon in meiner Jugend die Biographien von Malern und Dichtern, Komponisten und Philosophen nach Unglücksfällen, las später bereits aus Gewohnheit zuerst die Abschnitte über deren Krankheiten und Tod, und je mehr sie gelitten hatten, desto wahrhaftiger erschienen mir nachträglich ihre Existenz und ihre Kunst. Ich hielt das Leben für eine Irrfahrt in den Schmerz, an den Rand des Todes und des Wahnsinns.[*] In den Romanen und Erzählungen, die ich als Student las, suchte ich die Rebellion, das Aufbegehren – die in meinem eigenen Leben fehlten –, überhaupt alles Fehlende: Beischlaf und Unabhängigkeit, Spiritualität und urbane Abenteuerlichkeit, mit einem Wort die Intensität der Daseinserfahrung. Ich war auch auf der Suche nach Einsamkeit und Leiden und einem anderen Blick auf die Welt, nach der Auflösung gewohnter Zusammenhänge und dem Fremden – und vor allem nach meiner eigenen Sprache.
Bald schon bekam ich die zweibändige, in grobes gelbes Leinen gebundene Ausgabe der Briefe von Vincent van Gogh in die Hände und fasste bei der Lektüre den Entschluss, unabhängig von meinem Alltag ein zweites Leben zu führen. Nach außen würde ich unauffällig bleiben, aber mein wahres Ich würde ich im Geheimen, in meinen Gedanken ausleben, auf der Suche nach dem Wahn, die zugleich auch eine Suche nach dem verlorenen Paradies ist. Van Gogh, begriff ich erst später, beschrieb und malte nicht, was der Wahn ihm eingab, sondern seine Suche nach dem Paradies, die ihn in die Umnachtung führte. Was ich in den Briefen las, war mir unbekannt, aber nicht fremd – jeder Satz, jede Beobachtung erschien mir im Gegenteil wie eine Bestätigung dessen, was ich nicht gewusst, aber geahnt hatte.[*] Van Gogh, erschien es mir damals, hatte das Unglück gesucht, oder es hatte ihn gefunden, weil er es begehrt hatte, um auf der Erde das Paradiesische zu entdecken und mehr und mehr vom Leben zu spüren – so viel er nur ertragen konnte. Wer phantasiert in seiner Kindheit und Jugend nicht dramatische Wendungen herbei, in denen das Unglück zu Glück wird? Wer begeistert sich nicht daran, wenn seine Verzweiflung zu Hass wird? Selbst das eigene Sterben vermittelt in der Vorstellung eine – wenn auch verzerrte – Intensität von Lebenserfahrung, die der monotone Alltag verweigert.
Viele Jahre später sah ich im Ägyptischen Museum in Kairo auf einen Sarg, auf dessen Bodenbrettern ein Wegeplan für die verstorbene Seele gemalt war, der ihr zur Orientierung im Jenseits dienen sollte, ein buntes, naives Gemälde, das meinen jugendlichen Gedanken ähnelte wie die Zeichnungen und Gemälde, die Wörter und Sätze in van Goghs Briefen.
Fußnoten
[*]
Heute betrachte ich diese Biographien, die ich damals gelesen habe, wie die Identitätsausweise aus meiner Universitätszeit – das Studienbuch, die zerfledderte Straßenbahnmonatskarte, den abgelaufenen und überstempelten Pass – oder wie Gegenstände aus meiner Schreibtischlade, die die Zeit überdauert haben: den alten Haustorschlüssel, die Pelikanfüllfeder, die Schwarzweißfotografien meiner Familie, den gläsernen Briefbeschwerer, das rote Schweizer Messer. Mein Ich, das ich damals war, ist hingegen verschwunden.
[*]
Während ich dies festhalte, kapituliere ich vor dem alten Problem der Linearität des Schreibens gegenüber der Gleichzeitigkeit, aus der die Wirklichkeit besteht, und dem zeitlichen Chaos in meinem Kopf, das die wunderbare Anarchie des Gesprächs hervorbringt.
Die gelbe Farbe
Van Gogh ist ein Künstler, der den Zauber des Alltäglichen zum Vorschein bringt. Noch im Gewöhnlichsten macht er einen Funken der Schöpfung sichtbar. Gerade dort, begriff ich, wo man zur Erklärung seiner Bilder den Wahn zu Hilfe nahm: in der Darstellung des Sternenhimmels, der Felder, der Zypressen, ja sogar der Möbel in einem Zimmer. Vor allem aber mit der Farbe Gelb brachte er das verborgene Leben der Atome und Moleküle in den Dingen und Pflanzen zum Vorschein, die innere, für das Auge unsichtbare Bewegung im Festen, seine pulsierende Struktur, seine fortlaufende Veränderung in der Zeit. Van Goghs Bilder sind wie stehende Fische in durchsichtigem Gewässer oder mit offenen Augen träumende Menschen. Damals dachte ich, dass nur ein Wahnsinniger, ein Selbstmörder, ein Verfolgter die Welt so sehen und verstehen könne. Ich wünschte mir, wenn ich in den beiden Briefbänden las und die Abbildungen betrachtete, dass die Wände meines Zimmers atmeten und ihre Farbe mit jedem Luftholen veränderten oder dass sich die Anatomie von Mensch, Tier und Pflanze und die physiologischen Abläufe in ihrem Inneren vor meinen Augen entfalteten und ich die unsichtbare Wirklichkeit zusammen mit der sichtbaren erkennen könnte. Ich stellte mir eine eigene irrationale Welt vor, keine phantastische, sondern eine, die ihre Geheimnisse offenbarte. Nach meiner Rigorosumsprüfung in Physik dachte ich an den »Eddington’schen Tisch«, der für den Wissenschaftler aus beweglichen Molekülen und Atomen bestand. Und nachdem ich das menschliche Gehirn studiert hatte, versuchte ich – wenn ich mit jemandem sprach – mir den Denkprozess in allen Einzelheiten vorzustellen, und ich grübelte darüber nach, wie sich meine Erinnerungen veränderten oder aus meinem Gedächtnis verschwanden, als seien sie fotografische Bilder, die dem Sonnenlicht ausgesetzt, oder Tonbänder, die mit einem Magneten in Berührung gekommen waren. Doch ging es mir nicht um wissenschaftliches Verständnis, sondern um eine poetische Zusammenschau verschiedener Sichtweisen, die den Dingen und Lebewesen erst ihre Geheimnisse und Einzigartigkeit verlieh. Es waren Ahnungen, keine Gewissheiten, mit denen ich mich beschäftigte. Van Goghs Bildern wohnte etwas Religiöses inne, sie schienen zu beweisen, dass die Schöpfung etwas Heiliges war, das sich dem Verstand nicht offenbarte. Er unterschied nicht zwischen Wichtigem und Nebensächlichem, nicht zwischen Schönem und Hässlichem, sondern vermittelte die Magie, die dem Nebensächlichen, dem Unauffälligen, dem Banalen innewohnt. Das traf mich, wie man sagt, mitten ins Herz und weckte etwas in mir, das ich schon gewusst, aber noch nicht gedacht hatte. Das Flimmern der Welt war mir zwar schon durch die Bilder der Impressionisten bekannt gewesen – vor allem durch Monet –, aber niemand hat es so existentiell und gleichzeitig rätselhaft gemalt wie van Gogh. Besonders faszinierten mich seine Aufenthalte in den Irrenhäusern von Auvers und Saint-Rémy, und ich empfand eine geheime Sehnsucht nach dem Wahn und der Gedankenfreiheit der Irren, von der ich bald schon wusste, dass es sie nicht gab und dass die Originalität, die mir auffiel, das Ergebnis innerer Zwänge war. Auch wenn ich mit den Jahren mehr und mehr Einblick in das Leben von Geisteskranken gewann, so gab und gibt es doch immer noch Momente der vorbehaltlosen Bewunderung, auch wenn ich sie mir nicht mehr eingestehen mag. Diese romantische Vorstellung war und ist der Antrieb für mein nie nachlassendes Interesse an ihnen, und es war mir oft, als würde ich einen tiefen Blick in das eigene Unbewusste werfen und nicht in das von sogenannten Narren. Das Unbewusste der Patienten, denke ich mir, hat durch einen krankhaften Prozess die Oberhand über ihr Bewusstsein gewonnen, so dass sie mit offenen Augen traumwandeln wie die von van Gogh Portraitierten oder er selbst auf seinen Bildern. Wenn ich glaubte, einen Blick in das Unbewusste zu werfen, hatte ich auch das Gefühl, im nächsten Moment Gedanken lesen zu können – ein weiterer durchaus lächerlicher Irrtum, den ich nur festhalte, um Einblick in meine eigenen Gedanken zu geben. So wie man in Gesellschaft einer Hauskatze oder eines Hundes, der sein Dasein mit einem teilt, immer wieder das Gefühl hat, diese würden sogleich zu sprechen anfangen, so nahe wähnte ich mich auch dem Zeitpunkt, endlich die Gedanken von Menschen lesen zu können. Natürlich war es ein Glaube, den mir mein Verstand verbat, doch gab es Augenblicke, in denen ich schon vorher wusste, was mir ein Mensch später sagen würde oder wie sich eine Situation weiterentwickelte. Das nahm ich immer mit einem Gefühl der Irritation wahr.
Ich war fest davon überzeugt, dass die Dinge – wie in van Goghs Bildern – lebten, aber ich erfuhr die Bestätigung meiner These nur in Ansätzen. Selbstverständlich hielt ich mich nicht für verrückt, ich vermutete allerdings, dass die meisten Menschen diese Eigenschaft besaßen, aber unterdrückten, weil sie Angst davor hatten. Erst während meiner Erkrankung an Depressionen im Alter von fünfzig Jahren erfuhr ich die lang gesuchte und erahnte Welt selbst und das Grauen, das damit verbunden ist. Ich lag ausgestreckt auf meinem Bett – jeder noch so unbedeutende Gedanke kostete mich Mühe und erschöpfte mich. In meinem Zustand der Trostlosigkeit und bald auch der Hoffnungslosigkeit erschien mir alles leer und sinnlos. Aber die Falten meiner Decke, bildete ich mir ein, die Maserung des Parkettbodens, das Muster der Tapeten, meine Fingernägel hatten plötzlich eine Bedeutung, die ich vergeblich zu enträtseln suchte. Der Gedanke, dass diese Dinge auch anders sein könnten, als sie offensichtlich waren, bestürzte mich damals, denn er war mit dem Verlust der Selbstverständlichkeit verbunden. Die gesuchte Bedeutung bezog ich allerdings nicht auf mich, sondern ich erfuhr, dass es Zusammenhänge gab, die ich nicht begriff, und bildete mir ein, dass mich die Dingwelt deshalb verhöhnte. Durch das angelehnte Fenster drang ein aufdringlicher Küchengeruch in das Zimmer und verband sich mit dem Schuh, den ich zwischen zwei Sesselbeinen erblickte, der Spiegelung des Raums in der weißen Kugellampe über meinem Kopf, einem Stapel Bücher auf dem Tisch, von denen ich nur die Rücken sah, verband sich mit dem Gasheizkörper, dem Titelblatt des Magazins »Der Spiegel«, das mir vorkam wie eine Nachricht der Außenwelt, und einigen Seiten meines Manuskriptes, an dem ich gearbeitet hatte und von dem ein Schriftwirbel ausging, der gleich darauf in sich zusammenbrach – ein Massengrab der Wörter und Sätze, wie ich dachte. Ich bewegte meinen Kopf nicht und glotzte immer nur die gleichen Dinge an, die sich nicht veränderten, aber etwas bedeuteten, das mir lange verschlossen blieb, bis ich begriff, dass sie mein Ende verkündeten. Es war eine nüchterne Erkenntnis, ohne Schrecken, ohne Gefühle – ich würde zu einem Ding werden, wenn ich es nicht schon war. Und wirklich war mein Kopf so müde, dass ich meinen Körper nicht mehr spürte, obwohl ich meine Beine, den Brustkorb unter dem Hemd und meine Hände sah, die aber nicht zu mir gehörten. Ich dachte an Selbstmord, nicht um die Qual zu beenden, sondern weil es das Naheliegende war. Ich verwarf aber jede Methode, die mir einfiel, weil sie mit Anstrengung verbunden war, vermutlich auch, weil ich nicht den Mut aufbrachte, es zu tun. Van Gogh hatte in einem solchen Augenblick zur Pistole gegriffen, nehme ich an, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass er den Tod suchte, sondern dass er – neben seinen existentiellen Problemen, die ihm ausweglos erschienen – vielleicht verwirrt war über die Zusammenhänge der Dinge, die er beim Malen entdeckt hatte, erschrocken und voller Zweifel über das, was er auf der Leinwand vor sich sah, über die Offenbarungen seines Unbewussten, das er nicht kannte, obwohl er sich ihm anvertraut hatte. Er hatte, vermutete ich, sich in den Kopf geschossen wie ein Kind, das mit einer Pistole spielt und neugierig ist, was geschieht, wenn es abdrückt. Zumindest aber, dachte ich weiter, war ebenso viel Neugierde und eine Form von Spiel dabei gewesen wie der dringliche Wunsch zu sterben. Die Sucht, das wahre Leben zu spüren, das verlorene Paradies zu entdecken, hatte ihn immer auswegloser in das Elend geführt. Aber wie stand es mit mir selbst? Ich spürte ja keine Verzweiflung, nur Kraftlosigkeit. Wie mein Körper zu einem Ding geworden war, war auch mein Denken langsam abgestorben und dinghafter geworden, dem Augenblick verhaftet, als sei ich ein Nussknacker aus Holz. Ich lag jetzt wirklich wie ein Ding in einer Spielzeuglade. Später verstand ich, wie so oft in meinem Leben, dass die Märchenwelt nur eine schlafende, vergessene Welt ist, die allmählich durch die Wissenschaft bestätigt wird: In der Mathematik und Physik, den Forschungen der Psychiatrie, der Pharmakologie und Biologie erwacht diese Märchenwelt und gewinnt eine neue Bedeutung, auch wenn die Begriffe, mit denen man sie beschreibt, andere geworden sind.
Ich hörte damals aber keine Tiere sprechen, sondern war in ein Objekt verwandelt und musste die banale Last der Sinnlosigkeit erfahren. Als ich wieder zu mir kam, nach Wochen und Monaten, in denen ich alles nur als Mühe empfunden hatte, selbst die geringsten und alltäglichsten Handgriffe, zweifelte ich daran, ob das, was ich erlebt hatte, überhaupt Wirklichkeit gewesen war. Andererseits war ich nicht mehr der, der ich vorher gewesen war, denn das Wissen um den Abgrund, der sich hinter meinem Rücken aufgetan hatte und in den ich fast gestürzt war, ließ mich von da an mitunter auch in Momenten der Freude die Bewegungslosigkeit und Einsamkeit spüren, denen ich ausgesetzt gewesen war. Nur zögernd konnte ich mich dazu entschließen, meine Erlebnisse als etwas zu betrachten, das zu meinem Leben gehörte, und sie schließlich als Daseinserfahrung aufzufassen, die ich nachträglich nicht missen wollte.
Das Leben in einer Luftblase
Ich beschreibe, fällt mir auf, nicht meine Suche nach dem Wahn, sondern meine lebenslange Kindheit, meine lebenslange Angst, meine zweite und unsichtbare Existenz, neben der sichtbaren. Das Lesen vor allem, aber auch das Kino, die Musik, Oper und Schauspiel beschäftigten mich ebenso wie mein Dasein in der sogenannten Wirklichkeit. Ich spaltete mich auf, lebte manchmal beide Ichs zugleich, das äußere und das innere, die Fassade und das, wie ich mir sagte, Eigentliche, das Ich und das Ich selbst – alles in allem nichts Ungewöhnliches. Das Ich in meinem Kopf lebte wie in einer Luftblase unter der Eisdecke eines dunklen Flusses. Der Sauerstoff war begrenzt, und es würde nur eine Frage der Zeit sein, bis auch ich zu Eis werden würde. Viel zu spät erkannte ich, dass es das größte Verhängnis ist, Erwartungen zu erfüllen und gleichzeitig zu hoffen, dass man seinem Schicksal entkommt.
Unsichtbare Reisen
Ich wollte vor allem die Zeit ausschalten, sie aus meinem Gedächtnis verbannen oder wenigstens sie zertrümmern, sie in die entgegengesetzte Richtung abspulen oder sie stillstehen lassen. Das gelang mir am besten beim Schreiben. Ich verwendete dafür ein fest gebundenes schwarzes Heft mit der Aufschrift »Abrechnungsbuch«, dessen Seiten wie ein Vokabelheft in drei Spalten unterteilt waren, die von roten Längsstrichen gebildet wurden. Es gehörte eigentlich meiner Mutter, aber sie hatte keine Verwendung dafür gehabt. Die Kolonnen waren für Soll, Haben und den Saldo vorgesehen, und ich dachte sofort: »Saldo mortale«, tödlicher Saldo, denn mir graut vor allem, was mit Buchhaltung zusammenhängt. Die Ähnlichkeit mit einem Vokabelheft und die Vorstellung einer Abrechnung, bei der es um jede Zahl ging, suggerierten mir, dass es auch beim Schreiben um jedes Wort ging, und ich wusste inzwischen, dass die Wörter ein Eigenleben führen. Ich fing beispielsweise mit dem Wort »GELB« an, weil mein Blick gerade auf die zweibändige Ausgabe der Briefe Vincent van Goghs fiel, und suchte dann nach einem Wort, das mit GELB in keinem Zusammenhang stand, wie STUNDE, und anschließend noch etwas, das von STUNDE unabhängig war, wie ADJEKTIVE: »Die gelbe Stunde der Adjektive.« Oder ich schrieb einfach Wörter auf, die mir durch den Kopf gingen: Schuhe, Aster, Migräne, Hund, Februar, Stalin, Münze, Kirschen, Suizid, Hochzeit, Urin, Parabel, Sarg, Landkarte, Melanzani, Nephritis, Hitze, Tapete, Buchstabe. Aus diesen Wörtern versuchte ich dann einen Text zu machen. Oft waren es auch nur Bezeichnungen von Gegenständen, die ich gerade im Zimmer oder durch das Fenster sah: Schirm, Fahrrad, Hut, Bett, Fotoapparat, Messer, Vorhang, Hamsun, Hunger. Doch beschreibe ich damit die Höhepunkte meines damaligen Alltags, nicht die langen Perioden der sogenannten Normalität, die ich erst jetzt, im Alter, zu schätzen gelernt habe, damals aber als Qual empfand. Einzig die Sexualität interessierte mich am Erwachsenenleben, alles andere war mir gleichgültig oder zuwider. Ich war nur ein unbedeutender, winziger Fisch in einem riesigen Schwarm, dessen Bewegung ich angestrengt mitmachte und der sich bemühte, sich nichts anmerken zu lassen, ja, den Eindruck erweckte, zu denen zu gehören, die die Richtung vorgaben. Ich wurde zu einem raffinierten und ebenso verlogenen Täuscher meiner Umwelt, einem Schauspieler des Alltags und wusste schließlich selbst nicht mehr, wann ich jemandem etwas vorgaukelte und wann ich bei mir selbst war. Schließlich wurden sogar meine Rolle ich selbst und ich selbst meine Rolle. Bruchlos integrierte ich beide Welten, meine Kopfwelt und meine Alltagswelt, in einen Bewusstseinsstrom, der zumeist ein Bewusstlosigkeitsstrom war oder eine ebenso elende wie vollkommen vorgeführte Schmierenkomödie. Ich war der, den ich gerade darstellte, und stellte gerade den dar, der ich war, ohne es aber wirklich zu sein. Meine Verlogenheit war so vollkommen, dass ich sie nicht mehr als Verlogenheit wahrnahm. Nur wenn ich vom Alltag verletzt wurde, wenn ich seelischen Schmerz oder Scham empfand, spürte ich, welche Kunstfigur ich war und dass ich Marionettenspieler und Marionette in einem war. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht glücklich sein konnte oder ohne Freude war, ich begreife erst jetzt, dass mein ganzes Leben und vermutlich auch das von anderen Menschen voller Widersprüche ist und dass in Widersprüchen zu leben ein möglicher Ausweg aus Bedrängnis ist. Mein zweites Leben hielt ich so geheim, dass ich es vor mir selbst verbarg, und oft genug war es mit Schuldgefühlen verbunden, weil ich mich verpflichtet glaubte, mein Medizinstudium abzuschließen und Geld zu verdienen. Ich schwankte zwischen Selbstverachtung und Selbstüberschätzung, weil ich nicht mehr wusste, was ich eigentlich wirklich wollte. In solchen Momenten der Unsicherheit und eines Gefühls der Ausweglosigkeit las ich am intensivsten. Ich stürzte mich kopflos in die zweite Welt, die voller geistiger Abenteuer war. Ich entdeckte damals, glaube ich, T. S. Eliots »The Waste Land«, Ezra Pounds »Pisaner Cantos« und beschäftigte mich mit James Joyce’ »Ulysses«. Die Werke dieser Autoren erschlossen sich mir sofort und vollständig über das Nichtverstehen, und ich musste erhebliche Mühe aufwenden, um ausdrücken zu können, was ich von den Büchern begriffen und in ihnen entdeckt hätte, ähnlich einem Musikliebhaber, der nichts von Kompositionslehre versteht, der nicht einmal Noten lesen kann, dem sich aber trotzdem eine Symphonie, ein Streichquartett, eine Oper erschließen. Ich suchte begierig nach weiteren Büchern, die ich mit meinem Denken nur schwer dechiffrieren konnte, so kam ich auf die »Göttliche Komödie« Dantes, die »Ilias« und die »Odyssee« Homers, auf Mallarmé, Laurence Sternes »Tristram Shandy« und später auf Konrad Bayers »Der sechste Sinn«, H. C. Artmanns »ein lilienweißer brief aus lincolnshire« und Oswald Wieners »die verbesserung von mitteleuropa«.
Der weiße Tod
Das Buch, das ich jedoch seit meiner Kindheit las und verstand und das mir trotzdem immer ein Rätsel blieb, das ich besser und besser verstand und dessen Rätselhaftigkeit zugleich wuchs, war Herman Melvilles »Moby Dick«. An viele Bücher, die ich gelesen habe, habe ich nur noch eine bruchstückhafte Erinnerung. Bücher verblassen mit der Zeit im Kopf, es bleiben nur noch Fragmente erhalten: eine einzelne Szene, eine sprachliche Wendung, eine Beschreibung. Weniges prägte sich mir so tief ein, dass es Teil meines eigenen Lebens wurde: Malcolm Lowrys »Unter dem Vulkan«, Joseph Conrads »Herz der Finsternis«, Louis-Ferdinand Célines »Reise ans Ende der Nacht«, Günter Grass’ »Die Blechtrommel«, Gustave Flauberts Reisetagebücher, William Shakespeares »Hamlet«, »König Lear« und »Sturm«, Robert Musils »Der Mann ohne Eigenschaften« und Thomas Bernhards »Frost«, vor allem aber, wie gesagt, Herman Melvilles »Moby Dick«, die Jagd des von Rache besessenen Kapitäns Ahab auf den weißen Wal, der ihn zum Krüppel gemacht hat. Melville verwandelte Wirklichkeit in Literatur und lotete zugleich mit einer Abenteuer- und Seegeschichte das Unbewusste und die sprachlichen Möglichkeiten des Schreibens aus. Er schöpfte aus vielen Quellen, die dann in seinem Werk zu einem bewegten Meer zusammenflossen, und er brachte eigene Erfahrungen mit, fuhr er doch selbst als Matrose mehrfach auf Walfängern. 1840, als 21-Jähriger, desertierte er auf den Marquesas in Polynesien von der »Acushnet« und verfasste darüber sein erstes und erfolgreichstes Buch »Typee – der Mann, der unter Kannibalen lebte« und später die ebenfalls erfolgreiche Fortsetzung »Omoo«. In Arrowhead, als Nachbar des von ihm verehrten Nathaniel Hawthorne, schrieb er den 1851 erschienenen Roman »Moby Dick«. Er griff dabei, wie Tim Severin in »Der weiße Gott der Meere« festhält, auf den Erlebnisbericht des Ersten Maats der »Essex«, Owen Chase, zurück, der den Untergang des Walfängers im November 1820 schildert. Tausend Meilen vor der Küste von Chile hatte die Mannschaft versucht, einen Wal zu harpunieren, der jedoch das Schiff angriff und so schwer beschädigte, dass die zwanzig Mann Besatzung sich in drei Rettungsbooten in Sicherheit bringen mussten. Auf der abenteuerlichen Fahrt, die fünfzehn Mann das Leben kostete, kam es auch zu einem Fall von Kannibalismus, den Owen Chase in seinem Buch ausführlich schildert. 1842, an Bord der »Lima«, erzählte dessen 16-jähriger Sohn die Geschichte Herman Melville und gab ihm das Buch seines Vaters. 1810 war der weiße Wal vor der südchilenischen Insel Mocha zum ersten Mal gesehen worden und hatte deshalb den Namen »Mocha Dick« erhalten. Er griff im Lauf der folgenden Jahre zwei amerikanische und ein russisches Walfängerschiff an, die es auf ihn abgesehen hatten, und versenkte vor der japanischen Küste drei weitere Walfänger, außerdem zerbiss er mehrere Fangboote. Erst 1859 harpunierte ein schwedischer Walfänger vor Brasilien den berüchtigten »Mocha Dick«, er hatte ein Gewicht von hundert Tonnen und eine Länge von dreißig Metern. Sein Maul war acht Meter groß, und in seinem Rücken steckten neunzehn Harpunen. Die Farbe Weiß verlieh dem Seeungeheuer eine mythische Aura. Melville war sich dessen bewusst: Im Kapitel 42, das die Überschrift »Das Weiß des Wals« hat und das ich immer wieder gelesen habe, schreibt er: »Ist es so, dass das Weiß durch seine Unbestimmtheit die herzlose Leere und unermessliche Weite des Weltalls andeutet und uns so den Gedanken an Vernichtung wie einen Dolch in den Rücken stößt, wenn wir in die weißen Tiefen der Milchstraße blicken? Oder ist es so, dass das Weiß seinem Wesen nach nicht so sehr eine Farbe ist als vielmehr die sichtbare Abwesenheit von Farbe und zugleich die Summe aller Farben, dass deshalb eine weite Schneelandschaft dem Auge eine so öde Leere bietet, die doch voller Bedeutung ist – eine farblose Allfarbe der Gottlosigkeit, vor der wir zurückschrecken? Und wenn wir jene andere Theorie der Naturwissenschaftler bedenken, dass alle anderen Farben dieser Erde – alles stattliche oder anmutige Gepränge, die lieblichen Tönungen der Wolken und Wälder bei Sonnenuntergang fürwahr und der güldene Samt der Schmetterlinge und die Schmetterlingswangen junger Mädchen –, dass alles das nur arglistige Täuschungen sind, die den Dingen nicht wirklich innewohnen, sondern ihnen bloß von außen aufgetragen sind, so dass die ganze vergötterte Natur sich in Wahrheit anmalt wie die Hure, deren verlockende Reize nur das Leichenhaus in ihr verdecken; und wenn wir noch weiter gehen und bedenken, dass das geheimnisvolle Kosmetikum, das alle ihre Farben erzeugt – das große Prinzip des Lichts –, selbst für immer weiß und farblos bleibt, und, so es ohne Medium auf die Materie einwirkte, alles, ja sogar Tulpen und Rosen, mit seiner eigenen, leeren Blässe überzöge –, wenn wir das alles erwägen, so liegt das gichtbrüchige Universum vor uns wie ein Aussätziger, und wie ein mutwillig Reisender in Lappland, der sich weigert, farbige und färbende Augengläser zu tragen, so starrt sich der elendig Ungläubige blind, da er den Blick nicht vom endlosen weißen Leichentuche wenden kann, das alles, was er ringsum sieht, verhüllt. Und für all dies war der Albinowal das Symbol!«
Kannte, fragte ich mich, Melville Edgar Allan Poes »Arthur Gordon Pym«, der 1844 erschien? Die phantastische Reise des Titelhelden endet bekanntlich mit den chaotischen Tagebuchaufzeichnungen einer Fahrt in die Antarktis, zuletzt mit einem Boot auf dem Meer in dunkler Nacht: »Die Finsternis war immer dichter geworden«, schließt Poe, »und nur der Widerschein des Wassers auf dem weißen Riesenvorhang belebte flirrend die Meeresnacht. Viele ungeheure und gespenstisch bleiche Vögel flogen jetzt unablässig aus jenem Schleier hervor, und während sie sich den Blicken entzogen, schrillte noch ihr ewiges Teke-li! in unseren Ohren … Und jetzt rasten wir den Umarmungen des Wassersturzes entgegen, dort hin, wo sich eine Spalte auftat, um uns zu empfangen. Aber in diesem Augenblick erhob sich mitten in unserem Wege eine verhüllte, menschliche Gestalt, doch weit gewaltiger in allen Maßen als die Kinder der Erde. Und ihre Haut war von weißer Farbe, von der Farbe des leuchtendsten, blendendsten ewigen Schnees –––.«
Herman Melville dekonstruierte wie Laurence Sterne den Roman, er griff auf die Bibel, auf Homers »Odyssee« und Vergils »Aeneis«, Miltons »Das verlorene Paradies« und Thomas Hobbes’ »Leviathan« zurück (sogar auf den lächerlichen Schwulst von Cornelius Mathews Roman über prähistorische Einwohner, die ein Mastodon bis an die Meeresküste verfolgen). Er schuf einen literarischen Turm zu Babel aus verschiedenen Stilformen: etymologischen Erklärungen, einer naturwissenschaftlichen Abhandlung über Walkunde (Cetologie), Monologen, Gleichnissen, Prophezeiungen, Orakeln, Chroniken, Predigten, einem Chor der Seeleute und so weiter, und es gelang ihm, durch scheinbare Willkürlichkeit der Mittel eine ungeheure, eine kosmische Geschichte zu erzählen. Nur die Namensgebungen in seinem Roman weisen auf die universalen Zusammenhänge hin, die er in der Erzählung selbst aber penibel versteckte. Das Walfängerschiff, das zuletzt untergeht, heißt Pequod, nach einem von den Puritanern ausgerotteten Indianerstamm. Kapitän Ahab ist nach einer Figur aus dem Alten Testament benannt, dem König, der 850 v.Chr. Israel regierte und die phönizische Priesterin Isebel zur Frau nahm. Er ließ eigens für sie, da sie den Gott Baal anbetete, einen Tempel bauen, worauf der Prophet Elias das Land mit drei Jahren Dürre bestrafte. Ahab war ein Mörder, und er raubte Nabots Weinberg. Wie von Elias prophezeit, kam er bei einer Schlacht ums Leben, und Hunde leckten sein Blut vom Kampfwagen.
Ismael heißt der Erzähler im Roman, wie der Sohn Abrahams und der Magd Hagar Urbild des Ausgestoßenen, »ein Mensch wie ein Wildesel, seine Hand gegen alle, alle gegen ihn«. Als Sara, Abrahams Frau, später Isaak, den Stammvater der Israeliten, zur Welt bringt, überredet sie ihren Mann, Ismael mit Hagar in die Wüste zu schicken, wo sie aber von Gott gerettet werden. Mit Abraham errichtet Ismael später die Kaaba und wird Stammvater der zwölf Stämme der Araber. In »Moby Dick« ist Ismael ohne Vorgeschichte und Verbindung zu anderen Menschen. Sein späterer Freund, der polynesische Harpunier Quiqueg, ist eine Anspielung auf James Fenimore Coopers »Lederstrumpf«, dessen Hauptfigur Natty Bumppo mit dem Mohikaner Chingachgook befreundet ist, und der weiße Wal findet im biblischen »Leviathan« sein Gegenstück. Die Harpuniere wiederum stammen aus verschiedenen Teilen der Erde: Tashtego ist Indianer, Daggoo Afrikaner, Fedallah ein Parse und Feueranbeter, dessen 6-köpfige Mannschaft aus Malaien besteht, während die Steuermänner Starbuck, Stubb und Flask Weiße sind.
Melville befürchtete deshalb auch, dass sein Buch als »monströse Fabel betrachtet werden könnte oder – noch schlimmer und abscheulicher – als eine scheußliche und unerträgliche Allegorie«. Doch neigte er selbst zum Grübeln und vertiefte sich in metaphysische Fragen. D. H. Lawrence befand, »Moby Dick« sei eines der seltsamsten und erstaunlichsten Bücher der Welt. »Natürlich ist es ein Symbol – wofür? Ich bezweifle, dass Melville es gewusst hat«, schrieb er. Albert Camus meinte: »Das Kind wie der Weise finden darin, was sie brauchen.« Und Joseph Conrad, der wie Melville selbst Jahre auf See verbracht hatte, fand darin »keine einzige echte Zeile aus dem Seemannsleben«. Während William Faulkner und C. G. Jung es für das größte Buch der amerikanischen Literatur hielten, bemerkte der deutsche Übersetzer Friedhelm Rathjen, der Roman sei die literarische Wirrnis schlechthin. »Moby Dick« erschien zuerst in Amerika mit Hunderten Druckfehlern, war ein Misserfolg und wurde eingestampft. Melville starb als Zöllner 1891 im Alter von 72 Jahren. Sein Buch war bis zu seiner Wiederentdeckung 1920 vergessen. Alles, was man bei seinem Erscheinen kritisierte, macht heute seine ungebrochene Modernität aus. Es handelt von Angst, Hass, Gewalt und Einsamkeit, von Gefahr und Tod. »Das Böse ist die chronische Krankheit des Universums«, meinte Melville.
Das Abc der Welt
Marquis de Sade, Pier Paolo Pasolini
Ich las, wie andere Menschen wandern, Berge besteigen, sich in fremden Städten verirren oder von Kontinent zu Kontinent fliegen. Ich war abwechselnd ein Wanderer, ein Reisender und ein Flüchtling in einer fremden Welt. Mit wachsendem Unbehagen lernte ich »Justine«, »Juliette« und vor allem »Die 120 Tage von Sodom« des Marquis de Sade kennen, die alles, was ich an Grausamkeiten gelesen hatte oder mir ausdenken konnte, übertrafen. Und doch verließ mich dabei nie das Gefühl, tief in das Menschengehirn hineinzusehen. Ich erfuhr aus den Texten die menschliche Lust am Schänden, am Malträtieren, am Morden, am Erniedrigen, am Quälen, am Unterdrücken, und ich dachte an Hinrichtungen, Verbrennungen auf Scheiterhaufen, an Schlachtfelder, Konzentrationslager, an verwestes Fleisch, Bordelle, Kinderprostitution, an Erstickende, Schreiende, an Panik, an Folterkammern und Vergewaltigungen. Ich wusste, dass ich mich in das Universum des Bösen begeben hatte, und doch erweiterte es mein Denken. Nackte Menschen verwandelten sich in Fleisch, und die Geschlechtsteile hatten die Bedeutung von Götterstatuen angenommen, die angebetet oder geschändet wurden. Ich dachte an die Bilder von Hieronymus Bosch, die mir jetzt wie poetische Albträume vorkamen, an die Radierungen Goyas und die Höllenbilder Pieter Brueghel d.Ä., an George Grosz und Alfred Kubin. Mir war, als träumte ich die Orgien Caligulas und die Morde, die Gilles de Rais an Kindern verübte. Bis heute stößt mich die Lektüre ab, doch zugleich weiß ich, dass es die Begegnung mit der verborgenen, der anderen Seite im Menschen ist. Ich roch den unverwechselbaren Gestank von vergossenem Blut. Als ich Pasolinis Verfilmung »Salò oder die 120 Tage von Sodom« sah, fiel es mir schwer, das Dargestellte zu ertragen, obwohl ich den Ablauf der Ereignisse kannte.[*] Alle Schrecknisse sind in meinem Gedächtnis geblieben, dennoch oder vielleicht gerade darum wurde der Film für mich zusammen mit de Sades Büchern zu einem Schlüssel für die Macht der Triebe und gab mir zuletzt den Hinweis, auch mir selbst zu misstrauen.
Fußnoten
[*]
Pasolini selbst hatte zu seinem Film gesagt: »Die Mächtigen sind immer Sadisten, und wer Macht erdulden muss, dessen Körper wird zur Sache, zur Ware.«
Albert Camus
Was de Sade für die Unheimlichkeit des Menschen ist, ist Albert Camus für dessen Einsamkeit. In seinen Büchern ging es Camus um diese Einsamkeit, die er weder heroisierte noch romantisierte, sondern normalisierte. Auf diese Weise machte er sie wiedererkennbar. Ich sah mich beim Lesen als Schatten Meursaults in »Der Fremde«. Seine Existenz ist alltäglich, seine Unbeteiligtheit großartig. Schon der Anfang des Buches geht vom Eigentlichen aus: »Heute ist Mama gestorben.« Der Satz umfasst den Tod eines geliebten Menschen und den eigenen. Ich las das Buch wie eine Begegnung mit dem Tod, und ich verstand die Einsamkeit Meursaults als meine eigene, ja, ich begriff sie erst durch Camus’ Roman. Und ich entdeckte gleichzeitig, dass die Selbstverständlichkeit, mit der ich sie hinnahm, verhindert hatte, dass ich sie erkannte. Diese Entdeckung war mit der Erkenntnis verbunden, dass ich ein eigenes Leben führte, auch wenn es mir nicht so erschien. Jede Art Leben, begriff ich, war ein einsames Leben, und es war die Einsamkeit der Existenz, die Meursault zum Mörder werden ließ und die Hauptfigur des Romans »Die Pest«, Dr. Bernard Rieux, zum anonymen Helden des Alltags. Neben der Einsamkeit entdeckte ich beim Lesen auch die Macht des Banalen, die dahinter versteckten Fallen und Intrigen, Lügen und Wahrheiten, Tragödien und Dramen, Verbrechen und Leidenschaften. Camus’ Romane sind bis aufs äußerste verknappte, durch die Reduktion der Sprache durchsichtig-klare Kunststücke, sie gleichen geordneten Werkzeugkästen und Ärztetaschen, Gesetzbüchern oder Chroniken. Ich habe nie aufgehört, sie zu lesen.
Georg Büchner
Büchner hatte Medizin studiert und war Arzt gewesen, Dozent für vergleichende Anatomie in Zürich. Außerdem beruhte seine Arbeit auf biographischem Material, dem Leben des Soldaten »Woyzeck« und des Dichters des Sturm und Drang, Lenz, und überdies befassten sich sowohl die Erzählung »Lenz« als auch das Drama »Woyzeck« mit dem Wahn. Ich fand darin allerdings weniger die Schrecknisse des Wahns als dessen Großartigkeit, zudem betörte mich die Sprache des jungen Büchner, die mit Shakespeare verwandt und ihm gleichwertig ist. Ihr Rhythmus hat etwas von der Lakonik der tickenden Uhr, ist jedoch nicht mechanisch, sondern ähnelt mehr dem Atem: Es ist ein gehetzter Atem, ein erregter, der aus einem Bett in einem Krankenzimmer zu hören ist und uns an fiebrige Phantasien denken lässt, an saugende Abflusslöcher, an verstörende Stimmen, die man zu hören vermeint, an Selbstgespräche des Dichters. Der Wahn verhindert die Möglichkeit, zu verstehen und verstanden zu werden, er bildet ein Labyrinth aus Missverständnissen und Täuschungen, Einbildungen und Unwissenheit, falschen Vorstellungen und jähen Ängsten. Diese lassen eine neue Wirklichkeit entstehen, die den geistig Erkrankten seinen Ängsten und der Verzweiflung ausliefert, abkapselt von Zusammenhängen, nach denen er panisch sucht. In das düstere Schreckenskabinett der Bedrohungen und absurden Fehlschlüsse, der Visionen und zugleich Beschränktheit des Wahns kann ihm niemand folgen, der sich nicht entschlossen hat, sich zu verirren. Büchner, der Hellsichtige, ließ sich darauf ein und erlernte die fremde Sprache des Irrsinns, wie er dessen verzerrte Sicht auf die Dinge sichtbar machte. Seine Szenen und seine Prosa sind dicht und atonal wie die Quartette Schönbergs, die mikromusikalischen Stücke Weberns und die Oper »Woyzeck« Alban Bergs. Ich stand in Zürich an Büchners Grab, neben der Straße, auf der Autos fuhren und Fußgänger mit Regenschirmen vorübereilten. Es liegt unter einem alten Laubbaum und ist von einem Eisenzaun umgeben; der Friedhof sind die Häuser, Villen, Wiesen und Bäume ringsum. Unter der Erde sind Hunderte, Tausende Wörter und Sätze, Gedanken und Ideen begraben, die nie geschrieben und gesprochen wurden, denn die Sprache des Todes ist das Schweigen.
Franz Kafka, Robert Walser
Die Sätze Kafkas zerfallen wundersam in ihre einzelnen Wörter – schlägt man ein Buch auf, ist ein Gesumm und Geschabe zu hören. Wie kleine Bauklötzchen sind die Wörter nach einem bestimmten Muster angeordnet. Es war mir beim Lesen allmählich, als betrachtete ich aufgespießte schwarze Insekten in Schmitt-Kästen, Tausende und Abertausende, und in meinem Kopf erwachten sie zum Leben und scharrten und kratzten darin herum, begatteten sich, legten Eier, begannen mit rasenden Flügelschlägen aufzufliegen und tasteten sich mit ihren schwerelosen Fühlern in mein Denken hinein, wo sie meine Vorstellungskraft in Gang setzten. Der Landvermesser K. und »Das Schloß« gewannen ebenso wie »Der Prozeß« ein Eigenleben in meiner Kopfwelt, ich kannte die K.s aus meiner Kindheit, als ich wie jeder und jede selbst einer gewesen war, und aus den Jahren der Erfolglosigkeit, als ich wie alle Erfolglosen gegen verschlossene Türen rannte. Ich spürte auch den Wahn, der sich zwischen den Wörtern, zwischen jedem Buchstaben, jedem Beistrich und jedem Punkt verbarg. Doch sind es keine Albträume, die Kafka daraus entstehen lässt, sondern Untersuchungen über die Krankheit der Welt in Form von Fallbeschreibungen, Berichten, Protokollen, Akten. In der Erzählung »In der Strafkolonie« führt Kafka vor, wie Gewalt in der Anonymität bizarre Ausmaße annimmt, wenn das Opfer zum Objekt geworden ist und der Täter sich zum Werkzeug einer diktatorischen Macht degradiert hat. Er zeigt die Aussichtslosigkeit des Opfers genauso wie die Identifikation des Täters mit seinem Tun, und er öffnet den Blick auf die Mechanik, die dadurch entsteht – das Uhrwerk der Folter. Das Ungeheure, das Unheimliche und Grausame des Quälens beschreibt Kafka sachlich wie ein physikalisches Experiment oder eine wissenschaftliche Studie. Die seltsamste und zugleich alltäglichste Wahnbeschreibung fand ich in »Die Verwandlung«. Kafka greift darin auf das Märchen zurück – die Verwandlung eines Menschen in ein Tier –, beschreibt diese aber in Form eines Tatsachenberichts. Gregor Samsas Metamorphose, seine Mutation in ein Ungeziefer, hinterlässt eine schleimig-silbrige Schneckenspur im Gehirn des Lesers und untergräbt dort mit jeder weiteren Seite die Logik, bis man sie wie in Trance nicht mehr vermisst.
Robert Walser, Kafkas literarischer Vorfahre und Bruder im Geiste, schreibt hingegen nicht Märchen, die Wirklichkeit werden, sondern stellt die Wirklichkeit als kryptisches Märchen dar. Als wäre ein Mäusebuchhalter Mensch geworden, aber sein Zeitempfinden wie seine Wahrnehmung nagetierlich geblieben. Nur langsam, kaum merklich bewegen sich seine Figuren in diesem Mäuse-Universum, und alles wird größer beschrieben und aufgefasst, als es für den Leser ist. Dadurch entdeckt Walser auch das Kleine und Kleinste, das für ihn Erbauung oder Hindernis ist, je nachdem. Walser ist ständig bedroht, diese Bedrohung ist für ihn aber nichts Besonderes, weshalb er ihr keine Zeile widmet. Sie gehört zu seinem Leben, er lebt mit ihr, ohne ein Wort über sie zu verlieren. Er weiß, dass es Fallen gibt, die zuschnappen können, Feinde, die ihn verschlingen wollen, Gift, das ihn töten soll, doch nimmt er es mit der Gelassenheit eines Fußgängers im Straßenverkehr hin. Darüber Sätze zu bilden käme ihm banal vor. Die »Spaziergänge mit Robert Walser« las ich, als meine Mutter sich nach einem Schlaganfall im Grazer Feldhof, der heutigen Sigmund-Freud-Klinik, befand. Sie starb dort in der Geronto-Psychiatrie, in tiefer Verzweiflung über den Verlust ihrer Sprache. Oft schob ich sie mit dem Rollstuhl durch das Gelände der Anstalt bis zu den Feldern, hinter denen der »rote Blitz«, die Graz-Köflacher-Eisenbahn mit tönender Sirene vorbeifuhr. Ich las Carl Seeligs Buch über den armen Dichter, wie ein Kind Walt-Disney-Trickfilme anschaut, zugleich überglücklich und den Tränen nah, auf jeder Seite zwischen beiden Extremen schwankend und voller Begeisterung für den kleinen, komplizierten Mann, der von einem fremden Stern zu uns gekommen war. Für mich lebte Walser in diesem Büchlein fort wie für ein Kind vielleicht eine Figur aus einem Aufklapp-Bilderbuch – er war mir »zum Greifen nah«.
Adalbert Stifter
Ich habe Stifters »Nachsommer« nicht gelesen, wie man sonst ein Buch liest. Ich habe es, wenn es mir gerade einfiel, aufgeblättert und mich kürzer oder länger den hypnotischen Beschreibungen überlassen, die wie Drogenbilder vor meinem inneren Auge Gestalt annahmen: Kleider, Möbelstücke, Landschaften, Himmelsstimmungen, Gärten, Pflanzen, alles zeigt sich wie zum ersten Mal, als habe ein Blinder plötzlich das Augenlicht erlangt und könne kein Ende finden mit seiner Bewunderung für das Wahrgenommene. Es hat den Anschein, als wolle Stifter nicht wahrhaben, dass das Paradies verschwunden, verloren ist, und als wolle er es mit jedem Detail heraufbeschwören, denn nur in der vollkommenen Beschreibung des Details, hat es den Anschein, könne es sich, wenn auch nur für einen Augenblick, offenbaren. Stifter umgibt alles, was er festhält, mit der Aura der Einzigartigkeit und Unwiederholbarkeit, das verleiht seiner Literatur etwas Spirituelles. Sein Problem ist jedoch die Zeit, er will sie zum Stillstand bringen, denn wer das Paradies will, muss auch die Ewigkeit finden, die es wiederum nur im Tod gibt.
Selbstbeschreibung
Wenn ich an die Schriftsteller denke, die ich aufgezählt habe, so ergibt sich eine merkwürdige Nähe zu Wahn und Tod. Marquis de Sade saß den Großteil seines Lebens im Gefängnis und starb im Irrenhaus Charenton, Albert Camus kam mit 47 Jahren bei einem Autounfall ums Leben, Georg Büchner starb mit 24 Jahren, Franz Kafka mit 41 an Kehlkopftuberkulose, Robert Walser in einer Anstalt für Geisteskranke, Stifter schnitt sich die Kehle durch. Oft genug kam ich erst über die Lebensumstände eines Dichters zu seinem Werk, wie zu »Zeno Cosini« und Italo Svevo, über den ich von einem Freund erfuhr, dass er Sekretär von James Joyce gewesen und, wie Camus, bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Als ob ich der Überzeugung gewesen wäre, dass nur Unglückliche die Bücher schreiben, die mich so verändern konnten, dass ich selbst für die Dauer des Lesevorgangs zu einer literarischen Figur wurde: Hölderlin, Kleist, Trakl, Celan, Rimbaud, Villon, Baudelaire, Wilde, Mandelstam, Joseph Roth, Anna Achmatowa, Lermontow, Gogol oder William Burroughs. Ich ließ mich vom Buchstabenmeer so weit hinaustragen, dass ich kein Land mehr sah, und ich hasste die Heimkehr wie ein Junkie, der aus seinen pharmazeutischen Träumen erwacht. August Strindberg beispielsweise zog mich wegen seiner Absichten und Forschungen an, wegen seiner paranoiden Existenz, seinen grandiosen Versuchen zu malen, den Himmel zu fotografieren und nicht zuletzt wegen seiner autobiographischen Schriften, die vom Verfolgungswahn bestimmt sind. Allerdings lernte ich durch seinen »Totentanz« und das »Fräulein Julie« auch die schöpferische Kraft des Hasses kennen, die Ästhetik des Negativen, die später Louis-Ferdinand Céline in seiner Prosa so virtuos beherrschte.
Ich entdeckte »Die Welt als Labyrinth« von Gustav René Hocke, eine betörende Geschichte des Manierismus, und lernte neue Kontinente kennen voller Rätsel und Sinnestäuschungen, eine zweite Wirklichkeit aus Konvex- und Konkavspiegeln, Traumbildern und Imagination. Ich studierte Maurice Nadeaus »Geschichte des Surrealismus« halb ungläubig, wie ich als Jugendlicher »Gullivers Reisen« gelesen hatte, in der Überzeugung, dass »oben« und »unten«, »groß« und »klein« aufgehört hatten zu existieren. Meine sexuellen Phantasien erregten sich an Henry Millers »Wendekreis des Krebses«, »Wendekreis des Steinbocks« und »Stille Tage in Clichy«, Wahn und Tod fand ich nicht in seiner Biographie, sondern nur in seinen Büchern, in der atemlosen Schilderung anarchistischen Lebens. Ich studierte das Lehrbuch der Psychiatrie von Bleuler und fahndete in Lange-Eichbaums »Genie, Irrsinn und Ruhm« nach dem Unglück großer Künstler, die ich insgeheim darum beneidete.
Hans und Otto Gross
(Eine Zwischenbemerkung)
An einem heißen Sommertag kaufte ich die zweibändige Ausgabe von Hans Gross’ »Handbuch für Untersuchungsrichter« im Antiquariat Wildner in der Grazer Stempfergasse. Gross selbst war Untersuchungsrichter, Richter und zuletzt Professor in Graz gewesen und Begründer der »Kriminologie«, die sozusagen das Denken von Sherlock Holmes mit naturwissenschaftlichen Methoden verband. Ich erfuhr auch, dass der Wissenschaftler einen Sohn, Otto, gehabt hatte, der ein bedeutender Psychiater gewesen war, dessen radikale Meinungen und Erkenntnisse in der Öffentlichkeit unterdrückt worden waren. Er war deshalb mit seinem Vater in Konflikt geraten. Hans Gross veranlasste sogar, dass sein Sohn Otto wegen dessen anarchistischer Umtriebe in Berlin von drei deutschen Polizeibeamten festgenommen, nach Österreich gebracht und in die Irrenanstalt Tulln eingeliefert wurde. Beide, Hans und Otto Gross, waren mit Sigmund Freud und Franz Kafka bekannt gewesen. Der Vater hatte Erkenntnisse der Psychiatrie in seine von ihm begründete Wissenschaft eingeführt und Anfang des 20. Jahrhunderts ein Buch mit dem Titel »Criminalpsychologie« veröffentlicht, eine Lehre, die stark vom Zeitgeist geprägt war, weshalb sie nach einem fulminanten Siegeszug um die halbe Welt allmählich in Verruf geriet. Hans Gross war auch Universitätsprofessor in Prag gewesen, wo Franz Kafka im fünften, sechsten und siebenten Semester seines Studiums der Rechtswissenschaften sechzehn Wochenstunden in den Sparten Strafrecht, Strafprozess und Rechtsphilosophie bei ihm belegt hatte. Fast augenblicklich, als ich davon hörte, veränderten sich in mir der Roman »Der Prozeß« und die Erzählungen »In der Strafkolonie« und »Vor dem Gesetz« – ich verstand jetzt, woher sie kamen und was Kafka dazu angeregt haben konnte. Gross selbst hatte ja Strafkolonien für Rückfalltäter gefordert. Allmählich begann ich, in dem Grazer Kriminologen einen rechthaberischen Dämon, der andere zugrunde gerichtet hatte, zu sehen, einen Patriarchen. Mich irritierte besonders das Apodiktische, das ich bald als einen Grundzug der Väter- und Großvätergeneration ausmachte. Heute noch ist es das Apodiktische, das in mir das Gefühl zu ersticken hervorruft und das ich in allen Ideologien und Religionen finde. Ich glaube, deshalb nie ausreichend zum Schüler oder zum Untertan geeignet gewesen zu sein. Otto Gross, der Sohn und Psychiater, hatte Franz Kafka hingegen auf einer längeren Eisenbahnfahrt kennengelernt und den Dichter mit seiner Monomanie und endlosem Gerede verwirrt, wie Kafka selbst festhält. Trotzdem planten sie gemeinsam die Herausgabe einer Zeitschrift mit dem Titel »Blätter zur Bekämpfung des Machtwillens«. Angeblich war Otto Gross ein Schüler von Sigmund Freud, und er wurde auch in einer Blitzanalyse von C. G. Jung behandelt. Otto war morphiumsüchtig gewesen und deshalb wiederholt zu Entziehungskuren in Anstalten eingeliefert worden. Er hatte eine offene Ehe geführt und zahllose Frauenbekanntschaften gemacht, las ich, darunter auch die der beiden Richthofen-Schwestern (von denen eine, Frieda, später D. H. Lawrence heiratete) sowie der Schwester des Satirikers Anton Kuh. Otto und seine Frau hatten die unehelichen Kinder aus ihren Liebschaften als eheliche angenommen. Wegen seines Lebenswandels und seiner Behandlungsmethoden wurde er von seinen Kollegen jedoch angefeindet, so begünstigte er bei zwei Patientinnen, die auch seine Geliebten gewesen waren, deren Selbstmord, einer von ihnen stellte er sogar das Gift zur Verfügung. Mit seiner Lebensweise wollte er nach eigener Aussage die patriarchalische Gesellschaft verstören, und er veranstaltete in der damals berühmten Kommune von Ascona, wo er eine Schule für Anarchisten hatte gründen wollen, Orgien. Folgerichtig hatte ihn auch sein Vater wegen anarchistischer Umtriebe verhaften lassen können. Otto Gross starb 1920 im Alter von 43 Jahren in Berlin, nachdem man ihn halb erfroren und fast verhungert in einem Hauseingang gefunden hatte. Seine Schriftstellerfreunde, die Dadaisten Franz Jung und Raoul Hausmann, der Expressionist Karl Otten sowie Franz Werfel, der über ihn den Roman »Barbara oder die Frömmigkeit« verfasste, sahen in ihm einen Zeit- und Gesinnungsgenossen, der besessen davon gewesen war, die Verlogenheit der bürgerlichen Werte zu bekämpfen. Ich dachte oft an Hans und Otto Gross, in meiner Vorstellung aber ging mit der Zeit die seelische Krankheit des Sohnes auf den Vater über. Ich stellte mir immer mehr einen verrückten Untersuchungsrichter und despotischen Psychiater vor. Beide beschäftigten sich ja mit einer ähnlichen Materie, Hans auf Seiten der Justiz, der Rechtsordnung, und Otto auf Seiten des einzelnen Individuums. Otto hatte das Dilemma seines Berufs begriffen, dass nämlich auch die psychiatrische Heilmethode auf ein Normalisieren hinauslief, auf ein der Gesellschaft angepasstes Leben, als sei diese zeitlos und nicht in Frage zu stellen. Gerade dagegen aber hatte er sein Leben lang aufbegehrt, und daran war er auch zerbrochen.
Das Kriminalmuseum
Ein Freund, der Jusstudent Sonnenberg, vermittelte mich eines Tages an den Assistenten des Kriminologischen Instituts der Universität Graz, der mir die von Gross begonnene Lehrmittelsammlung, welche inzwischen museale Ausmaße angenommen hatte, zeigen sollte. Dr. Bachhiesl war ein mittelgroßer Mann, mit einer Trachtenjoppe bekleidet und einer Brille auf der Nase. Die Lehrmittelsammlung befand sich in einem Nebengebäude der Universität, im sogenannten Meerscheinschlössl, bevor sie in einem Trakt der gegenüberliegenden Kinderklinik untergebracht wurde, wo ich sie in Begleitung von Sonnenberg und Dr. Bachhiesl gesehen habe – die Umstände waren jedoch unerfreulich. Dr. Bachhiesl erklärte uns nämlich, dass wir uns in der sogenannten Kinderpathologie befänden, umgeben von herausgeschnittenen Organen, die hier in Glasbehältern aufbewahrt würden, ein Umstand, der allein schon bedrückend war. (Wir bekamen allerdings nichts davon zu Gesicht.) Die großen, dunkelbraunen Holzschränke des Kriminalmuseums waren geschlossen, nur die Vitrinen in der Mitte gaben den Blick frei auf die Überbleibsel vergangener Verbrechen. Zwei der mit schwarzen Buchstaben auf weißen Schildchen beschrifteten Schränke waren den Schusswaffen – Gewehren und Pistolen – gewidmet, ein anderer mit Hunderten Apothekerfläschchen und Herbarien den Giften, ein weiterer Gipsabdrücken von Fußspuren. Dr. Bachhiesl zog sich zurück, und Sonnenberg, mit Dr. Bachhiesl befreundet, öffnete die verglasten Türen der Vitrinen und hielt in rasendem Tempo einen Vortrag, dem ich nur zum Teil folgen konnte. Zu jedem der zahllosen Objekte wusste er eine Geschichte, die er in aller Ausführlichkeit, doch in enervierender Hektik erzählte, zu jedem der zahlreichen Spazierstöcke, jeder Feile, jedem Messer, jeder gezinkten Spielkarte, jeder gefälschten Banknote. Er zeigte mir den schwarzen Tatortkoffer des Untersuchungsrichters Hans Gross, den dieser zur Spurensicherung mit sich führte und in dem alle Geräte griffbereit in Fächern geordnet waren: Lupe, Zirkel, Kompass, Schnur, eine kombinierte Zange mit Hammer, Hacke und Schraubenzieher, ferner Pinsel, Bleistift, Briefpapier, Umschläge, Amtssiegel, Messband und sogar eine kleine Blechdose mit Bonbons für Kinder, deren Aussagen benötigt wurden, eine Zündholzschachtel, ein Stück Seife sowie Kerzen und ein Kreuz, um Zeugen an Ort und Stelle zu vereidigen. Des Weiteren eine Feder, ein Fläschchen Nigrosin[*] zur Erzeugung von schwarzer Tinte, Pauspapier, Pausleinwand, ein Fläschchen Gips, ein Fläschchen Öl und eine kleine zusammenlegbare Taschenlaterne. Außerdem Klebstoff, eine Handbürste und verschiedene Chemikalien, verkorkte Fläschchen, zwei Glasröhrchen, eine Eprouvette mit einem Totenkopf und der Aufschrift »Sublimat-Gift«, Medikamente und sogar einen Schrittzähler. Ich erinnere mich auch an mehrere Stäbe und Dosen, habe aber vergessen, wozu sie gut waren. Verwirrt von der Vielfalt der Objekte, muss ich wohl, wie immer in solchen Fällen, abwesend gewirkt haben, und Sonnenberg, ein aufmerksamer Beobachter, holte aus einer Lade eine mit Schreibmaschine verfasste Liste heraus und las sie mir vor. Ich besitze diese Liste heute noch, da Sonnenberg sie mir übergab und ich sie in den ersten Band des »Handbuchs für Untersuchungsrichter« gesteckt habe, wo ich sie erst nach Jahren wiederfand. Außerdem lag noch eine Seite mit sechs Schwarzweißfotografien der Sammlung dabei, die zusammengenommen einen improvisierten Führer durch das damalige »Kriminalmuseum« ergaben. Auf der Liste sind die 31 Punkte festgehalten, nach denen Gross die Aufstellung der Lehrmittelsammlung vornehmen wollte. Einer seiner Nachfolger, Ernst Seelig, ließ in der Zeit des Nationalsozialismus die Sammlung nach geänderten Gesichtspunkten ordnen, nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie dann provisorisch im Meerscheinschlössl und in der Kinderklinik untergebracht, und wie alle Provisorien hält in Österreich eine »vorläufige Lösung« bekanntlich mehrere Jahrzehnte lang.
Gross’ Lehrmittelsammlung begann, las mir Sonnenberg vor, mit der Forensischen Medizin, die zertrümmerte Knochen, das zugehörige Tatwerkzeug, präparierte Hautstücke mit Strangulierungsmerkmalen, Einschussöffnungen und anderes mehr umfasste. Es folgten als Zweites Präparate von Blut, Eiter und Samen sowie Menschenhaare im Vergleich zu Tierhaaren. Als Drittes, las Sonnenberg, kamen Giftstoffe hinzu und hierauf »Instrumente, mit denen eine Körperverletzung zugefügt wurde«, daneben Projektile, die an Tatorten sichergestellt worden waren, mit der Beschreibung ihrer Wirkung auf das Opfer sowie der verwendeten Waffe. Beispielsweise »Rundkugel, Spitzkugel, Geschoss mit Treibspiegel, Patronen mit Randzündung beziehungsweise mit Stift- oder Zentralzündung und Schrot«, ereiferte sich Sonnenberg. Als Sechstes, fuhr er fort, Blutspuren, dazu Muster von Tüchern, Stoffen, Papieren, Tapeten, Holzarten und Steinsorten, die mit Ochsenblut bespritzt wurden, um zu zeigen, wie verschieden Blutspuren auf den jeweiligen Untergründen aussehen können. Außerdem eine Sammlung von Spuren unterschiedlicher Substanzen die Blut vortäuschen konnten, wie Rost, Kautabak, rote Tinte oder gewisse Schimmelpilze. Punkt sieben betraf, so Sonnenberg, Blutspuren, die von Mauern, Steinen und Holz abgenommen und konserviert worden waren, acht: Fußspuren in Gips, Lehm, Wachs, Zement oder sogar Brotkrumen. Außerdem Papillarlinien von Fingern. Unter Punkt zehn, fasste Sonnenberg zusammen, waren »sonstige Spuren« aufgezählt, zum Beispiel ein Stück Holz, das von einer Gewehrkugel gestreift worden war, Glasscherben von durch Schrotschüsse zertrümmerten Scheiben oder durch verschiedene Waffen beschädigte Kleidungsstücke. Hierauf Spielkarten, markiert oder gefälscht, gezinkte Würfel und sonstige Requisiten von Falschspielern sowie Falsifikate von Urkunden, Siegeln, Stempeln, Maßen und Gewichten samt den Apparaten, mit denen sie hergestellt worden waren, dazu Werkzeuge von Einbrechern wie der Dietrich, für den Taschendiebstahl oder von Wilderern und als spezieller Punkt »unechte Kunstgegenstände, Antiquitäten und derlei Fälschungen«. Sonnenberg machte eine kurze Pause, kratzte sich am Kopf und las dann schnell und leise, wie für sich selbst. Ein anderes Kapitel wiederum betraf »Brandlegungsapparate und das dazugehörige Werkzeug«, das folgende »Mittel für Sprengungen und Explosionen« und ein eigenes »Fotografien von Verbrechen mit möglichst genauen Angaben« und »Handschriften von Verbrechern, Querulanteneingaben und sonstige gerichtliche Eingaben von Narren« sowie »Chiffrenunterschriften« (was immer das sein mochte). Punkt zwanzig betraf Lokalaufnahmen von wichtigen Tatorten und »Kopien von besonders guten und mustergültigen Aufnahmen im Zuge von Lokalaugenscheinen«, es folgten »Restaurierungen von zerrissenem, aufgeweichtem, vergilbtem oder verkohltem Papier mit Angabe der dabei verwendeten Methoden«. Punkt dreiundzwanzig beinhaltete Waffen verschiedenster Art als Demonstrationsobjekte, vierundzwanzig: Gaunersprache, fünfundzwanzig: »sogenannte Gaunerzinken – Verständigungszeichen der Gauner, die an Wegkreuzungen, Kapellen oder Scheunen zu finden« waren, während Punkt sechsundzwanzig sich mit Dingen des Aberglaubens befasste, da, wie es heißt, »nur durch sie in vielen Fällen Art und Weise seiner Verübung aufgeklärt werden können«. Unter siebenundzwanzig waren »bei Zigeunern beschlagnahmte Gegenstände« zusammengefasst: »Diebswerkzeuge« oder »Apparate zum Wahrsagen etc.«. Nummer achtundzwanzig war »Verstellungskünsten und ihren Vorrichtungen« gewidmet, worunter »falsche Bärte, Arme, Bartfärbemittel etc.« verstanden wurden. Als Nächstes »Gefängniszeugnisse zum Zwecke gegenseitiger Verständigung in den Untersuchungen. Geheimschriften und bei Fluchtversuchen verwendetes Werkzeug. Als dreißigsten und vorletzten Punkt beinhaltete die Sammlung »Tätowierungen aufgefundener Leichen«, als einunddreißigsten »Vergleichsobjekte, die nicht direkt mit einer Strafsache zusammenhängen, sondern entweder anderweitig entstanden sind oder speziell hierfür erzeugt wurden«, und zur Sicherheit existierte auch noch ein »Pseudopunkt zweiunddreißig« unter dem Begriff »Varia hier nirgends eingeteilter Gegenstände«. Ich saß eine Weile mit der Liste, die mir Sonnenberg übergeben hatte, in einem knarrenden Thonetstuhl, ging dann schweigend im großen Raum herum und betrachtete die Gegenstände, bis Sonnenberg mich nach einem Seufzer fragte, ob wir fortfahren könnten. Voller Eifer führte er mich zu weiteren Vitrinen und Kästen, und wir hätten uns wohl in den Hunderten, ja Tausenden Einzelheiten verzettelt, wenn Sonnenberg sich nicht selbst von den Ausstellungsstücken immer wieder mit der Bemerkung losgerissen hätte, er habe zu Mittag eine Verabredung. Zugleich erlag er aber schon der Faszination des nächsten Ausstellungsstücks, von dem er nicht nur die Geschichte genau kannte, sondern über das er auch eine Fülle von Einzelheiten wusste. Er sprach mit mir ausführlich über »Kriminalbiologie« und die acht Typen der Kriminellen, die der »spätere Nationalsozialist« Ernst Seelig erkannt zu haben glaubte: »Arbeitsscheue Berufsverbrecher«, zitierte Sonnenberg aus einem Buch, das zusammen mit anderen auf dem Schreibtisch stand, »deren Charakteristikum eine asoziale Lebensform« sei, »arbeitsscheue Kleinkriminelle, wie Landstreicher und Dirnen«, sodann »Vermögensverbrecher aus geringer Widerstandskraft«, wie »diebische Dienstnehmer, Defraudanten, unredliche Beamten und weiters: Verbrecher aus Angriffssucht, unter anderem bäuerliche Wirtshausraufer, Krakeeler und Messerstecher«. Die vierte Gruppe umfasste »Verbrecher aus sexueller Unbeherrschtheit« und »Notzüchter, Blutschänder, Pädophile und Exhibitionisten«, die fünfte »Krisenverbrecher«, wie zum Beispiel »Mörder der schwangeren Geliebten« oder aus einer »Pubertätskrise« heraus, »Verbrecher aus Hörigkeit«, sowie »Rezeptfälscher und Vermögensverbrecher aus Rauschgiftsucht«. Der sechste Typ des unse(e)ligen Dr. Seelig umfasste »primitivreaktive Verbrecher, wie zum Beispiel blindwütige Rächer oder Pyromane«. Als siebenten nannte er »Überzeugungsverbrecher«, wie »politische Attentäter« oder »religiöse Sektierer«, und als letzten Typ den »Verbrecher aus Mangel an Gemeinschaftsdisziplin«, worunter er »Übertreter von Kriegsvorschriften, Wirtschaftssaboteure«, aber auch »Verkehrssünder« und »leichtsinnige Raucher« zählte.
Sonnenberg klappte das Buch zu und wies mich noch einmal darauf hin, dass diese Aufstellung »unwissenschaftlich und weltanschaulich motiviert« gewesen sei, und betonte, dass jede Gesellschaft ihre eigene Ansicht von Verbrechen entwickele und dass daraus wiederum Rückschlüsse auf die Gesellschaft möglich seien.