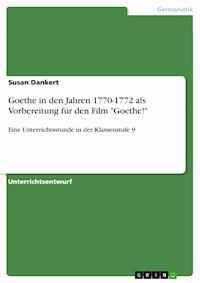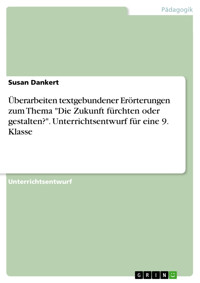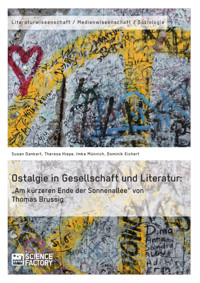
Ostalgie in Gesellschaft und Literatur: „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ von Thomas Brussig E-Book
Susan Dankert
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Ob Revival alter DDR-Produkte oder nostalgische Verklärung des ostdeutschen Alltags vor dem Mauerfall – Literatur, Film und Fernsehen erwecken gerne eine Zeit zu neuem Leben, die man zuvor zu vergessen suchte. Dieses Buch geht dem Phänomen "Ostalgie" im Allgemeinen sowie auf dem Gebiet der deutschen Gegenwartsliteratur nach. Im Fokus steht dabei Thomas Brussigs Roman „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ und seine Verfilmung von 1999. Inwiefern geht es hier um die Darstellung typischer Alltagsumstände, inwiefern um die Abbildung eines Lebensgefühls? Sind diese Erinnerungen an die DDR-Vergangenheit Komödie, Dokumentation oder Persiflage? Aus dem Inhalt: Werkgenese und Erzählstruktur von Thomas Brussigs „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“; Motivik und Intertextualität, Motivkomplex Ost-West-Problematik; Verfilmung und Umsetzung von "Sonnenallee"; DDR-Alltag und DDR-Kritik; Komik in der "Sonnenallee" – Lachen über die DDR?; Komiktheorien nach Henri Bergson und Michail Bachtin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © 2016 ScienceFactory
Ein Imprint der GRIN Verlags GmbH
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Ostalgie in Gesellschaft und Literatur
„Am kürzeren Ende der Sonnenallee“ von Thomas Brussig
Dominik Eichert (2016): Der alltägliche Blick zurück. Zum Umgang mit der DDR-Geschichte, am Beispiel der Ostalgie. 7
Einleitung. 8
Erinnerungstheorien. 11
Das Phänomen derDDR-Nostalgie. 15
Heutige Bilder von derDDR. 23
Resümee. 25
Quellen- und Literaturverzeichnis27
Susan Dankert (2005): Eine Interpretation von Thomas Brussigs „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“. 30
Vorwort31
Literarische Form und Struktur33
Erzähler und Erzählstruktur37
Erzählte Zeit und Erzählgeschwindigkeit41
Sprache. 44
Motivation, Motivik und Intertextualität50
Analyse wichtiger “Stellen“ im Roman. 59
Resümee / Interpretationsansatz. 68
Literaturverzeichnis74
Theresa Hiepe (2009): Eine Darstellung der Einschränkungen des täglichen Lebens in der DDR anhand Thomas Brussigs Roman „Am kürzeren Ende der Sonnenallee“. 75
Einleitung. 77
Brussigs Roman Am kürzeren Ende der Sonnenallee. 79
Einschränkungen des täglichen Lebens in der DDR. 98
Schlussbetrachtung. 117
Literaturverzeichnis119
Anhang. 122
Anonym (2008): Komiktheoretische Annäherungen an Leander Haußmanns „Sonnenallee“. Darf man das? Lachen über den Osten. 125
Einleitung. 126
Leander Haußmanns Sonnenallee. 129
Die Komödie Sonnenallee. 135
Fazit148
Bibliografie. 150
Einzelpublikationen. 153
Dominik Eichert (2016): Der alltägliche Blick zurück. Zum Umgang mit der DDR-Geschichte, am Beispiel der Ostalgie
Einleitung
„The past is never dead. lt s not even past.“
William Faulkner
Welche Folgen hat es für den Alltag eines Bürgers, wenn dieser permanent beobachtet und abgehört wird? Was bedeutet es, niemandem trauen zu können, – auch nicht der eigenen Familie – da der Gegenüber möglicherweise mit der Stasi zusammenarbeitet? Was heißt es, wenn man aus Angst vor Verurteilung und Inhaftierung seine Meinung nicht laut bzw. öffentlich äußern kann? Diese und weitere Fragen haben mich dazu veranlasst, mich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Der in einigen Teilen der Gesellschaft und der Literatur verbreitete verklärende Rückblick auf die DDR erzeugte bei mir ein Unverständnis und regte mich an, über diese Thematik nachzudenken. Getreu der Redewendung "Es ist nicht alles Gold was glänzt", muss aber auch nicht alles bezüglich der DDR schlecht gewesen sein. Der andere deutsche Staat ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert Geschichte. Nach Martens (2011) lebt die DDR aber in vielen Erinnerungen und Erzählungen weiter und wirkt als scheinbar Vergangenes weiterhin auf die Gegenwart, indem sie die Menschen in ihren Vorstellungen und ihrem Handeln noch heute prägt. In diesem Kontext verdeutlicht das Zitat des US-amerikanischen Schriftstellers W. Faulkner sehr zutreffend, dass die Vergangenheit niemals wirklich vergangen oder gar endgültig abgeschlossen sei. Fast 27 Jahre nach dem Mauerfall von 1989 sind die Fragen nach dem Umgang mit der DDR-Vergangenheit und nach dem Verhältnis der (Ost-)Deutschen gegenüber dem ehemaligen Diktaturstaat ebenso zahlreich wie auch vielfältig. Diesbezüglich sind eine Vielzahl von journalistischen Publikationen sowie wissenschaftlichen Veröffentlichungen zur DDR-Geschichte vorzufinden. Dabei geht es nicht ausschließlich um die faktenbegründete Auseinandersetzung mit der DDR. Vielmehr stehen hier Aspekte der Vergangenheitsaufarbeitung, der Identitätssuche oder des emotionalen Erinnerns im Vordergrund (vgl. Berth & Kollegen 2010), wie beispielsweise in den sog. Ostalgie-Shows, die kurz nach der Jahrtausendwende ihren Höhepunkt im TV erlebten (vgl. Neller 2006). Diese Shows spiegeln dabei eine kollektive „positive Orientierung gegenüber der ehemaligen DDR" (ebd., S. 37) wider, welche von Neller (ebd.) als DDR-Nostalgie bezeichnet wird und die im Zentrum dieser Ausarbeitung stehen soll. Es soll an dieser Stelle außerdem herausgearbeitet werden, welches Bild der ehemaligen DDR heutzutage in der deutschen Bevölkerung existiert? Da diesbezüglich vor allemder Beschäftigung mit Erinnerung und Gedächtnis eine große Bedeutung zukommt, befasst sich diese Arbeit in Kapitel 2 zunächst mit zwei grundlegenden Erinnerungstheorien, um zu verdeutlichen wie Wahrnehmung und Erinnerung sowohl auf individueller, als auch auf gesellschaftlicher Ebene im Kontext der Ostalgie stattfindet. Im Anschluss daran wird in Kapitel 3 und seinen Unterkapiteln zum einen die historische Entwicklung der Nostalgie über die DDR-Nostalgie bis hin zur Ostalgie in den Blick genommen und zum anderen eine definitorische Unterscheidung der Begriffe Ostidentität, Nostalgie sowie Ostalgie vorgenommen. Diese Differenzierungen erscheinen für die Wissenschaftlichkeit dieser Arbeit von hoher Bedeutung, da die Begriffe im öffentlichen Diskurs oft fälschlicherweise als Synonym verwendet werden (vgl. Neller 2006). Auf diese sollen inhaltliche Irrtümer vermieden werden. Kapitel 3.2 und die anschließenden Unterkapitel geben einen zusammenfassenden Überblick über die ökonomischen Ausprägungen der Ostalgie am Beispiel von Filmen, Serien sowie Unterhaltungsshows und anhand typischer Ostprodukte. Darüber hinaus werden in Kapitel 4 Befragungsergebnisse verschiedener Studien vorgestellt, die zum einen das vermittelte romantische Bild mancher Medien über die DDR widerspiegeln und zum anderen auch kritische Ansichten hervorbringen. Abgeschlossen wird diese Arbeit schließlich mit einem Resümee in Kapitel 5, in dem die Ergebnisse zusammengefasst und geordnet werden.
Erinnerungstheorien
Wie vollzieht sich das Erinnern und wie werden Erinnerungen weitergegeben? Wie wird etwa im Familiengespräch Vergangenheit gebildet? Und wie verändert sich zum Beispiel die Wahrnehmung und Geschichtsschreibung der DDR mit wachsendem Abstand?
Um die Rückblickseuphorie, die kennzeichnend für die Ostalgie ist (vgl. ebd.), besser verstehen zu können, soll die Beschäftigung mit der Erinnerung den zentralen Ausgangspunkt dieses Kapitels darstellen. Insbesondere bei historischen Transformationsprozessen wie der deutschen Wiedervereinigung, erscheint es sinnvoll sich mit der sozial- und kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung intensiver zu beschäftigen (vgl. Moller 2010). Aber auch im Hinblick auf die Aufarbeitung der diktatorischen Vergangenheit und Erinnerungskultur der (Ost-)Deutschen kann es hilfreich sein, gedächtnistheoretische Überlegungen mit einzubeziehen. Zwar ist das Unrechtsregime DDR schon relativ lange beendet, jedoch tragen auch noch heutzutage die Gespenster der DDR-Vergangenheit zu gesellschaftlichen Debatten bei. Prof. Dr. Osterle (2002), der Sprecher des Sonderforschungsbereich Erinnerungskulturen sagte einst: „Die Erinnerungskultur einer Gesellschaft ist der Spiegel ihrer Gegenwart" (https://idw-online.de/de/news56845, letzter Zugriff: 29.04.16). Um den persönlichen wie auch den kollektiven Umgang mit der Vergangenheit sowie im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Sehnsucht nach der DDR besser nachvollziehen zu können, werden nun die Erinnerungstheorien von drei ausgesuchten Wissenschaftlern vorgestellt. Dabei zählen Harald Welzerund die Eheleute Jan und Aleida Assmann zu den zentralen deutschsprachigen Forschern in diesem Bereich. Ihre Überlegungen werden im Folgenden als theoretische Grundlage vorgestellt.
Das soziale Gedächtnis
Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen unterscheiden zwischen unterschiedlichen Formen des Gedächtnisses. Die bekanntesten sind das individuelle, das soziale, das kollektive, das kulturelle und das kommunikative Gedächtnis. Aufgrund des inhaltlich gelegten Schwerpunktes dieser Ausarbeitung, wird sich in diesem Kapitel auf das soziale Gedächtnis fokussiert und das individuelle Gedächtnis stattdessen ausgeblendet, da es in das soziale wie auch das kollektive Gedächtnis eingebettet ist und von diesen geformt wird (vgl. J. Assmann 2005). Und er (2007) ergänzt, dass im strengen Sinne nur die Empfindungen individuell sind, nicht aber die Erinnerungen des Einzelnen. Die Erinnerungen sind stattdessen sozial vermittelt (vgl. J. Assmann 2005). Der Begriff des sozialen Gedächtnis wurde von Harald Welzer geprägt und umfasst die kurzfristigen Erinnerungen, die sich mit dem Tode der lebendigen Träger immer wieder auflösen. Das soziale Gedächtnis "lebt vom und im kommunikativen Austausch am Leben", so A. Assmann (o. J., S. 2). Es beschreibt all das, was in sozialen Gruppen unbewusst sowie absichtslos bzw. nicht-intentional Vergangenheit transportiert und vermittelt, also nicht zu Zwecken der Traditionsbildung entstanden ist (vgl. Welzer 2001). Anders als bei Peter Burke (1991), konzentriert sich bei Welzer das soziale Gedächtnis auf die folgenden vier Medien: Interaktionen, Aufzeichnungen, Bilder und Räume (vgl. Welzer 2001.), "[D]enn alle vier Medien transportieren und bilden Vergangenheit, ohne dass ein bewusstes – intentionales – Moment von Geschichtsvermittlung oder Traditionsbildung damit verknüpft sein müsste." (ebd., S. 16). Unter Interaktion(en), dem wichtigsten und stärkstem Medium (vgl. Assmann o. J.), versteht Welzer (2001) kommunikative Praktiken, die per se oder aber en passant Vergangenheit thematisieren. Die Kommunikation bzw. das thematisieren vergangener Ereignisse, Erlebnisse und Handlungen bezeichnet er als memory talk und orientiert sich dabei an dem von K. Nelson geprägten Begriff (vgl. ebd.). Zur besseren Ilustration nennt er Familientreffen bzw. -gespräche, in denen "(...) im Hintergrund des intentionalen Plots zugleich so etwas wie ein historischer Assoziationsraum der Umstände, des Zeitkolorits, des Habitus der historischen Akteure etc. vermittelt wird." (S. 17). Dabei wird vom Erzähler unbewusst, beiläufig sowie absichtslos Geschichte tradiert, da mit den Erzählungen ein Subtext bzw. ein Bild der Vergangenheit transportiert wird. Dasselbe gilt für Aufzeichnungen, Bilder und Räume (vgl. ebd.). Wobei zum einen Fotos und Videos "diese subtextuelle Eigenschaft in besonders hohem Maße(...)" (S. 17) besitzen und zum anderen Räume "in Beton, Stein und Asphalt materialisierte historische Zeiten repräsentieren" (S. 17), so Welzer. Am Beispiel der DDR kann dann im Gespräch mit dem Großvater über seine Jugendzeit in Vereinen und Gruppen, wie etwa der FDJ, bei dem Zuhörer das Bild von Menschlichkeit, Solidarität und sozialem Zusammenhalt entstehen, welches der Zuhörer infolgedessen mit der DDR automatisch und unbewusst assoziiert. Fotos in FDJ-Uniform in geselliger Runde am Lagerfeuer können diese und ähnliche positive Assoziationen mit der DDR dann entsprechend verstärken.
Das kollektive Gedächtnis
Das kollektive Gedächtnis wurde zum einen vom französischen Soziologen M. Halbwachs und zum anderen durch die Eheleute A. Und J. Assmann geprägt. Im Gegensatz zum sozialen Gedächtnis ist das kollektive Gedächtnis darauf angelegt längere Zeiträume zu überdauern. Wie aber kann das Gedächtnis, welches jedes Individuums besitzt, kollektiv sein? "Zwar haben Kollektive kein Gedächtnis, aber sie bestimmen das Gedächtnis ihrer Glieder." (2007, S. 36), hält J. Assmann in seinem Werk Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen fest. In einem früheren Werk führt er (2005) aus, dass jedes Individuum die Gesellschaft als Innenwelt in sich trägt, etwa in Form von Sprache, Bewusstsein oder eben Gedächtnis. Infolgedessen stellt das Gedächtnis des Kollektivs die Bedingung für die individuelle Erinnerung dar. A. Erll (2005, S. 6) definiert es beispielsweise als: "Oberbegriff für all jene Vorgänge organischer, medialer und institutioneller Art, denen Bedeutung bei der wechselseitigen Beeinflussung von Vergangenem und Gegenwärtigem in soziokulturellen Kontexten zukommt." Das Kollektiv bzw. die sozialen Gruppen werden von M. Halbwachs als soziale Rahmen bezeichnet (vgl. Halbwachs in J. Assmann 2005). Durch den Austausch mit anderen Menschen entstehen so die Inhalte der jeweiligen Gruppe, des kollektiven Gedächtnis. Die Erinnerungen der sozialen Gruppe festigen sich dabei durch ihren emotionalen Gehalt. Erinnert wird das, was als auffällig wahrgenommen wurde, was einen tiefen Eindruck gemacht hat oder was durch bzw. für die soziale Gruppe als bedeutsam erfahren wurde (vgl. A. Assmann o.J.). Auch eine (ehemalige) Nation wie die DDR stellt in diesem Kontext einen sozialen Rahmen dar, in dem sich die Ostdeutschen etwa in antiquarischer Weise an ihren Versorgungsstaat erinnern und sich beispielsweise die Versorgung mit kostenfreien Gesundheitsleistungen oder die umfassenden staatlichen Kinderbetreuungsangebote zurücksehnen. Schließlich entsteht durch den verklärenden (Rück-)Blick auf die DDR eine Verniedlichung und damit zugleich eine Bagatellisierung des früherenUnrechtsstaates.
Das Phänomen der DDR-Nostalgie
Die DDR und die damit verbundene Sehnsucht nach ihr sind laut Neller (2006) immer noch wichtiger Bestandteil im Alltagsleben mancher Bürger. Das Phänomen der Ostalgie ist dabei ein noch recht junges Ereignis, welches sich durch die und nach der deutsche(n) Wiedervereinigung entwickelt hat. Allerdings haben Berth & Kollegen (2010) festgestellt, dass nicht etwa die DDR als solche zurückgewünscht wird, sondern vielmehr ihre Kultur, typische Ostprodukte oder dass landescharakteristische Rituale und Traditionen im Mittelpunkt der Rückorientierung zur DDR stehen. Die Gründe für die positive Retrospesktivbewertung der (Ost-)Deutschen variieren, können aber in einigen Aspekten zusammengefasst und auch verallgemeinert dargestellt werden. Sie sollen für die Arbeit nicht von allzu großer Bedeutung sein und werden deshalb nur am Rande zur Untermauerung einzelner Aspekte herangezogen. Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, dass je negativer sich die Gegenwart des Einzelnen gestaltet, desto mehr braucht das Individuum den Glauben an eine positive Vergangenheit. Neller nennt in ihrem Werk DDR-Nostalgie. Dimensionen der orientierungen der Ostdeutschen gegenüber der ehemaligen DDR, ihre Ursachen und politischen Konnotationen noch einen anderen Grund: "Um negativen Lebensphasen nachträglich einen Wert zu verleihen, werden unangenehme Aspekte verdrängt und die in diesem Zeitabschnitt erlebten Dinge systematisch aufgewertet." (2006, S. 46). Darüber hinaus besitzt die nostalgische Hinwendung zur DDR eine identitätsstiftende Eigenschaft, die immer ein (sich) Erinnernimpliziert – ganz gleich ob im persönlichen Rahmen oder im Kollektiv – und deshalb immer auch in einem sozialen Kontext, genauer in einem sozialen Rahmen stattfindet.
Begriffsbestimmung – Zeitliche Einordnung – Definition
Die Sehnsucht nach der DDR-Vergangenheit, welche Fritze (1995) im Umkehrschluss als Flucht vor der Gegenwart interpretiert, wird in der öffentlich-publizistischen Diskussion am häufigsten mit den Bezeichnungen Ostidentität, DDR-Nostalgie oder mit dem Neologismus Ostalgie umschrieben. Allerdings soll an dieser Stelle eine genauere Unterscheidung der Begriffe vorgenommen werden, um der Gefahr von Missverständnissen, die die übliche austauschbare Begriffsverwendung birgt, entgegen zu wirken. Dafür wird zunächst einmal ein Blick auf die historische Herleitung, die ursprüngliche Bedeutung und aktuelle Verwendung der Begriffe geworfen, bevor näher auf das Phänomen der Ostalgie eingegangen wird.
Ostidentität
Wie bereits erwähnt, wird der Begriff Ostidentität häufig in enger Verbindung oder sogar als Synonym für die Rückblickseuphorie der Ostdeutschen gebraucht (vgl. Neller 2006). Neller (ebd.) stellt dabei fest, dass dieser Terminus in der Literatur zum Teil oft Gegensätzliches umfasst. Daher wird sich nun genauer mit diesem Konzept auseinandergesetzt.
Neller bezeichnet Ostidentität als "Separatbewusstsein der Ostdeutschen" (2006, S. 53), welches eine teilnationale Identifikation zum Ausdruck bringt, die sich eben nicht auf die gesamte, sondern nur auf einen Teil der politischen Gemeinschaft nach der Wiedervereinigung bezieht. Bezüglich der Fragestellung, ob sich die Ostidentität erst nach der Wiedervereinigung herausgebildet hat oder ob sie schon vor der Wende existierte, gibt es unterschiedliche Auffassungen (vgl. ebd.). Misselwitz etwa beschreibt die Ostidentität als "reflexive, neu erworbene Identität der Ostdeutschen, die auf einer Mischung aus DDR-Erfahrungen und Erfahrungen im wiedervereinigten Deutschland basiert" (1993, S. 111) und sich daher erst nach 1990 entwickelte. Des Weiteren repräsentiert sie das "neue Selbstbewußtsein der Ostdeutschen" (1996 in Neller 2006, S. 54), so Misselwitz. Kollmorgen (2005 in Neller 2006) bewertet dies gänzlich anders: Ihm zufolge ist die Ostidentität auf die 1960er Jahre zurückzuführen und entstand somit vor der deutsch-deutschen Wiedervereinigung. Es gibt aber auch zahlreiche Wissenschaftler, die die Ostidentität zum einen als "Produkt der Wiedervereinigung" (Pollack & Pickel 1998 in Neller 2006, S. 54) ansehen und zum anderen als (Teil-)Ergebnis sozialistischer Prägungen bewerten wie etwa Fritze und weitere (vgl. ebd.). Zusammengefasst kann die Ostidentität als "nachgeholte Identität" (Greiffenhagen & Greiffenhagen 1993 in Neller 2006, S. 54) der ehemaligen DDR-Bürger bezeichnet werden, die danach strebt, das unterschwellige Bedürfnis nach dem untergegangenen Wir-Gefühl der DDR zu kompensieren.
(DDR-)Nostalgie
Das Wort Nostalgie kommt aus dem griechischen und lässt sich von den Wörtern n6stos (Heimkehr) und algos (Schmerz) ableiten (vgl. http://www.duden.de/rechtschreibung/Nostalgie, letzter Zugriff: 29.04.16). Erstmals tauchte der Begriff im medizinischen Zusammenhang durch den Schweizer Arzt Johannes Hofer auf und bezeichnete in seinem ursprünglichen Sinne "ein krankmachendes Heimweh" (https://de.wikipedia.org/wiki/Nostalgie#cite_note-1, letzter Zugriff: 29.04.16). Im Laufe der Jahrhunderte veränderte sich dessen Bedeutung und das Phänomen der Nostalgie wurde nicht mehr als Krankheit betrachtet. Heutzutage beschreibt die Nostalgie eine "vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich in einer Rückwendung zu einer vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit äußert, deren Mode, Kunst, Musik o. Ä. man wieder belebt" (http://www.duden.de/rechtschreibung/Nostalgie, letzter Zugriff: 29.04.16). Auf die DDR bezogen, kann die Wortschöpfung DDR-Nostalgie als "die positive Sicht Ostdeutscher auf die frühere DDR" (2004, in Neller 2006, S. 43) interpretiert werden, so Westle. Bergem dagegen wird konkreter und beschreibt die DDR-Nostalgie als die von "diffuser Sehnsucht und Melancholie geprägte Rückwendung zu einer verklärten und in Requisiten fixierten Vergangenheit (...), die eine Ignoranz gegenüber dem Unrechtscharakter der DDR nicht nur ermöglicht, sondern geradezu nahe legt." (2004, in Neller 2006, S. 43). Es wird in jedem Fall deutlich, dass es sich um eine positive Hinwendung, zum Teil sogar um eine Sehnsucht zu bzw. nach bestimmten Aspekten der DDR handelt.
Ostalgie
Die Wortkreation Ostalgie ist eine Kombination der beiden Wörter Osten sowie Nostalgie und beschreibt "die Sehnsucht nach bestimmten Lebensformen und Gegenständen der DDR" (Berth & Kollegen 2010, S. 24). Es charakterisiert demnach eine Art Heimweh nach dem Osten bzw. der ehemaligen DDR und spiegelt eine Idealisierung des einstigen Diktaturstaates wider. Zurückgeführt wird der Neologismus auf den Dresdener Kabarettisten U. Steimle (vgl. ebd.). Obwohl die Termini Ostalgie und DDR-Nostalgie in der öffentlichen Debatte häufig synonym verwendet werden, betont Bergem (2004, in Neller 2006), dass beide Begriffe unterdessen einen völlig unterschiedlichen Bedeutungsgehalt erlangt haben. Einer dieser Unterschiede ist etwa, dass das Phänomen der Ostalgie als eine gesamtdeutsche Erscheinung interpretiert wird, wohingegen sich die DDR- Nostalgie nur auf die ehemalige DDR-Bevölkerung bezieht (vgl. ebd.). Neller (ebd.) unterteilt beide Phänomene in Mikro- und Makroebene. Das Phänomen der DDR-Nostalgie ordnet sie der Mikroebene zu, da es sich ausschließlich auf die Einstellungsmuster der Ostdeutschen bezieht, wohingegen das Phänomen der Ostalgie sich sowohl der Mikro- als auch der Makroebene zuordnen lässt, weil es zum Beispiel ein Konsumverhalten widerspiegelt (vgl. ebd.). Es gibt aber auch kritische Auffassungen. Herles etwa bezeichnet die Ostalgie als "nur eine von vielen mit der Einheit verbundenen Formen des Selbstbetrugs..." (2004, in Neller 2006, S. 50), da die idealisierte Retropesktive nichts mit dem tatsächlichen Leben in der DDR zu tun hat. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Ostalgie als eine kommunikative Form einzuordnen ist, in der mit Erinnerungen umgegangen und Vergangenheit bearbeitet wird.
Ausprägungen derOstalgie
Nachdem noch zu Beginn der deutsch-deutschen Wiedervereinigung hauptsächlich West-produkte aufgrund ihres besseren Image im Einkaufswagen der ostdeutschen Bevölkerung landeten, änderte sich dies Mitte der 1990er Jahre zunehmend und der Konsum von Ost-produkten erlebte einen starken Aufschwung (vgl. ebd.; Berth & Kollegen 2010; und weitere). Auch Produkte, denen vor dem Mauerfall wenig Beachtung geschenkt wurde, erfreuten sich nun erhöhter Beliebtheit. Neben der Ostmarkenbeliebtheit nahm jetzt auch die nostalgische Auseinandersetzung mit der DDR- Vergangenheit in TV und Kino ungewöhnlich stark zu und erlebte, wie bereits erwähnt, zur Jahrtausendwende ihren absoluten Höhepunkt (vgl. Neller 2006). Aber auch der Onlinehandel mit typischen Ostprodukten jeglicher Art gewann an Popularität. Ebenso der Verkauf von DDR- Symbolen, wie zum Beispiel das Ampelmännchen oder die DDR-Landesflagge. Später stillisierte sich diese Entwicklung bis zu den sogenannten Ostalgie-Partys und der Messe Ostpro-Berlin hin, "wo über 100 Unternehmen aus den neuen Bundesländern ihre Produkte und Dienstleistungen" anbieten (https://www.berlin.de/wirtschaft/service/information/messe/1618464-1612022-