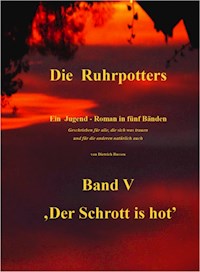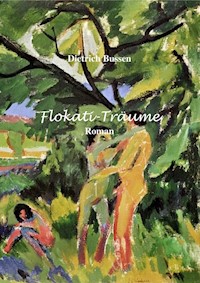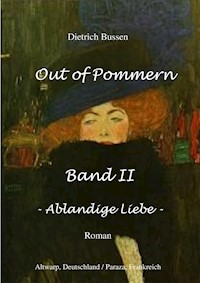Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
1948: Nach der Flucht aus Pommern kommt Heidelinde, eine attraktive junge Frau, mit ihrem zehnjährigen unehelichen Sohn in einem Dorf in Westfalen an. Tief verankerte Heimatliebe - insbesondere Heidelindes Sehnsucht nach der Ostsee und dem Haff -, Sorgen ums Überleben, aufkeimendes Glück in einer neuen Liebesbeziehung, aber auch religiöser Eifer und Angst vor fremden Einflüssen bestimmen das Zusammentreffen der erwachsenen Hauptfiguren. Zwischen dem Sohn der Flüchtlingsfrau und einem einheimischen Jungen entwickelt sich hingegen eine unbeschwerte Freundschaft. Dennoch kommt es zur Katastrophe…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dietrich Bussen
Out of Pommern
Band I
- Die Liebe zum Wasser -
Roman
Altwarp, Deutschland / Paraza, Frankreich
Gott ist gefährlich. Ein neues Zeitalter der Verfinsterung droht.
Die Gesundheitsminister warnen: Religion darf an Jugendliche
unter 18 Jahren nicht weitergegeben werden.
1. Kapitel
„... bei Sandmanns im Kirschbaum“, hörte er seinen Vater, als er in die Küche kam. Er sah die Mutter am Fenster, mit der Hand vor dem Mund, neben ihr den Vater, der ihn ansah, dass er am liebsten gleich wieder gegangen wäre. Johannes überlegte, was er rausgekriegt haben könnte; irgendwie war ja immer was.
‚Hast du uns nichts zu sagen?‘, darauf wartete er jetzt. Stattdessen sagte die Mutter, dass er noch spielen dürfe, draußen, bis zur Maiandacht um halb acht, und er solle nicht vergessen, sich Hände und Gesicht vorher zu waschen, und er solle an das Gesangbuch denken.
Die Küche roch noch nach den Bratkartoffeln zum Abendessen. Johannes bekam Hunger, fragte aber nicht, ob er noch was zu essen haben könnte, er wollte lieber schnell wieder raus; der Vater sah so aus, als ob er die Frage doch noch stellen könnte. Nach der Maiandacht könnte er vielleicht noch heimlich an den Brotkasten. Die Eltern machten dann meistens noch die Runde durch den Garten. Mit Sandmanns Kirschbaum hatte er nichts zu tun, da war er sich ganz sicher, nicht in diesem Jahr und schon gar nicht Anfang Mai. Aber irgendwas musste mit dem Baum sein.
Vielleicht, dass die Maibolzen in der Nacht da was hochgezogen haben, was man so schnell nicht mehr runterkriegt; oder Frauenunterwäsche, wie im vorigen Jahr in Müllers Pappeln, so hoch, dass sie mit der Feuerwehr kommen mussten.
Er hatte das mit seinen Freunden aus sicherer Entfernung beobachtet. Beinahe wäre noch einer von der Leiter gefallen, und Frau Müller hatte immer geschrien, dass sie sich beeilen sollten, und sie würde alle anzeigen. Nur die älteste Tochter von Müllers hatte sich das in aller Ruhe mit angesehen, hatte sogar gelacht und den Kopf hoch gehoben dabei, und den großen Busen hatte er richtig gesehen unter dem Pullover, der immer hochrutschte, wenn sie den Kopf in den Nacken warf.
Aber über die wurde sowieso alles Mögliche erzählt im Dorf, was er nicht verstand. Was Gutes war es jedenfalls nicht, soviel war klar.
Die sei ‚schlecht‘, hatte er mal gehört und dabei an faules Obst im Keller gedacht, das man regelmäßig aussortieren muss.
Vom Schulhof schräg gegenüber hörte er Stimmen, Fußball.
Einer rief „gib ab Pissnelke“.
Wenn der mitspielt, kann ich vielleicht auch noch, überlegte er.
Sonst waren um diese Zeit immer die Großen auf dem Platz. Aber dann dürfte Pissnelke nicht, drittes Schuljahr wie er. Die Kleinen verließen freiwillig das Feld, wenn die Großen aus den letzten Volksschulklassen kamen. Aber heute waren die Großen nicht da, obwohl es ihre Zeit war; in die Maiandacht gingen die auch nicht mehr.
Vielleicht haben die bei den Maibolzen mitgemacht gestern Nacht und sind jetzt bei Krögers in der alten Scheune und geben an, was sie alles angestellt haben.
Er lief über die Straße zum Schulhof, sah Robert, der an die Mauer gelehnt auf dem sandigen Boden saß, wollte sich zu ihm setzen, blieb dann doch lieber stehen wegen der Hose und der Maiandacht.
„Wir sind voll“, rief einer.
„Wir sind jetzt zwei, einer für jede Mannschaft“, rief Johannes zurück.
„Robert will keiner, musste früher kommen, außerdem ist gleich Kirche.“
„Warst du bei ‚Piss - Pott‘ schon da?“, fragte Johannes
„Ich war über“, sagte Robert und fummelte an einem Holzstück herum.
Mit dem ‚Piss - Pott - Verfahren‘ wurden die Mannschaften gebildet. Zwei Mannschaftsführer, die von vorneherein feststanden, weil sie sich in den Kampfritualen während und nach der Schule als die Stärksten bewiesen hatten, gingen Fuß an Fuß setzend und dabei abwechselnd ‚piss‘ und ‚pott‘ rufend aufeinander zu. Den Zugriff auf den ersten Spieler hatte der, der als Letzter seinen Fuß gerade in die letzte Lücke setzen konnte. Schrägstellungen oder andere Tricks, um seinen Fuß doch noch in die Lücke zu bekommen, wurden nicht geduldet, dafür sorgten schon die Umstehenden. Das Recht auf den ersten Spieler war begehrt. Man schrieb ihm spielentscheidende Auswirkungen zu, wenn Anton im Angebot war, sowieso. An den traute sich keiner, selbst, wenn der barfuß spielte, nicht. Der ‚Erstgewählte‘ zu sein, war immer etwas Besonderes, eine Auszeichnung, die einen heraushob und stolz machte. Spott und Hohngelächter begleiteten hingegen die, die als Letzte aufgerufen wurden. Sie wurden geduldet und mussten meistens in der ungeliebten Hintermannschaft spielen. Wenn man verlor, wusste man, wer schuld war. Dann gab es da noch ein paar, die immer damit rechnen mussten, dass sie stehen gelassen wurden. Zu denen gehörten Pissnelke und Robert. Pissnelke, weil er halb blind war und die Bälle meistens unkontrolliert in die Gegend haute, wenn er sie überhaupt traf. Andererseits verfügte er über eine gewisse abschreckende Wirkung, weil er mangels klarer Sicht auch dann zum Tritt ausholte, wenn sich ihm ein Gegenspieler ohne Ball näherte. Er wurde meistens großräumig umspielt, was seinen Mitspielern Zeit gab, die Verteidigung zahlenmäßig zu stabilisieren. Diesem Begleitumstand verdankte er seinen gelegentlichen Einsatz.
Robert hingegen war fußballerisch ordentliches Mittelmaß, wäre also - wie viele andere auch - wählbar gewesen, kam aber aus den Baracken, wo die aus der ‚kalten Heimat‘ ‚hausten‘, und er war evangelisch, was ihm im Monat der Maiandachten doppelt übel genommen wurde. Er war nur im äußersten Notfall verwendbar. Zwei Tatbestände wurden bisher als Einsatzgrund akzeptiert: Erstens, wenn in einer Mannschaft keiner den Torwart machen wollte, weil im gegnerischen Sturm Anton spielte oder Heinemanns Willi, der als Einziger richtige Fußballschuhe hatte und in Tornähe auf alles trat, was sich bewegte. Robert nahm dies in Kauf, Hauptsache, er durfte mitspielen.
Zweitens, wenn ohne ihn eine Mannschaft die Mindestzahl von sechs Spielern nicht zusammengekriegt hätte.
Robert kam immer wieder, manchmal klappte es ja. Außerdem traf er meistens Johannes, der ihm sogar schon mal seine Höhle gezeigt hatte.
Er hätte Johannes auch gern zu sich mitgenommen, aber seine Mutter wollte das nicht, erst, wenn sie eine richtige Wohnung hätten, jetzt nicht. Und im Wäldchen hinter den Baracken konnte man auch nichts machen, das hielten Jugendliche aus dem großen Lager bei Altenhausen besetzt, und die drohten nicht nur mit ‚Senge‘.
Einmal und nicht wieder. Brennende Holzscheite hatten sie nach ihm geworfen, als er ihnen zu nahe gekommen war. Die Hose hatten sie ihm runtergezogen, als er gestolpert war bei seiner Flucht, und mit den Holzscheiten hatten sie über ihm herumgefuchtelt, dass er sich vor Angst in die Unterhose gemacht hatte; die Überziehhose hatte nichts abgekriegt, stellte er erleichtert fest, als er sie wieder hochzog.
„Ich geh zur Hecke“, sagte Johannes, „du kannst auch Hannes zu mir sagen, sagen die anderen auch.“
„Ich geh auch“, sagte Robert.
Die Hecke trennte eine Seite des Schulhofes von einem angrenzenden Garten. Dichtes Buschwerk hatte sich gebildet, für das sich niemand zuständig fühlte. Die Sträucher wucherten vor sich hin, weit ausladend an manchen Stellen, mit Zufallsgehölzen bewachsen, dicht und ein fast sicherer Unterschlupf, wenn Gefahr von Erwachsenen drohte. Die kannten die blickdichten Stellen nicht, die man nur kriechend erreichen konnte.
„Mit Robert geht das nicht“, sagte Robert.
„Was geht nicht?“
„Nicht wie bei dir, aus Johannes ‚Hannes‘. ‚Rob‘ hört sich doof an.“
„Rob ist Kacke“, stimmte Johannes zu.
Sie gingen weiter, dachten an Namen und wie man sie verändern könnte; dass seine Mutter ihn ‚Robbi‘ nannte, fiel ihm nicht ein, als ob der Name reserviert wäre für sie, nicht verfügbar für eine andere Beziehung.
Sie merkten nicht, dass es auf dem Fußballplatz plötzlich ganz still geworden war, bis einer rief: „Otto hat Eier, an der Mauer, an der Straße.“
Johannes und Robert drehten sich um und sahen Heinemanns Otto - den größeren Bruder von ‚Willi mit den Fußballschuhen‘ - breitbeinig vor der Mauer, die Arme hochgereckt, in jeder Hand zwei Eier.
„Richtige Hühnereier“, sagte Johannes.
„Ob der die geklaut hat?“, fragte Robert.
„Auf jeden Fall“, sagte Johannes, „so, wie der Fußball spielt. Der klaut wie ein Rabe, auf jeden Fall.“
Die Fußballspieler verließen den Schulhof, rannten in Richtung ‚Otto mit den Eiern‘; vielleicht gab’s da was zu holen. Hunger hatten sie fast alle, fast immer, im Mai 1948. Auch auf Johannes und Robert wirkten die erhobenen Eier.
Wenigstens gucken, was da los ist, sagten sie sich. Hunger hatten sie sowieso, erst recht bei dem Anblick, den der dicke Otto bot mit den trophäenhaft erhobenen Eiern.
„Da sind noch sieben“, sagte Otto und neigte seinen Kopf seitlich nach unten zu einer Stelle neben sich. Dort lagen sie in einem Nest zwischen hohen Gräsern und Brennnesseln.
Offene Münder, gierige Blicke und ein breites Ottogrinsen richteten sich auf das Nest. Sprachlose Kinder für ein paar Sekunden.
„Für jeden eins“, sagte Jürgen, ein schmächtiger zehnjähriger Viertklässler, während er sich noch auf seine Finger konzentrierte, mit deren Hilfe er zu diesem Ergebnis gelangt war. Dann lächelte er in die Runde, zufrieden mit sich und seinen mathematischen Fähigkeiten. Wieder angespannte Stille; es wurde nachgerechnet, Jürgen galt als eher doof.
„Stimmt nicht“, rief einer.
„Stimmt doch“, rief Jürgen zurück, „Robert zählt nicht, und Hannes ist auch zu spät gekommen.“
Wieder wurde gerechnet. Einige, die es mit dem Rechnen nicht so hatten, versuchten durch angestrengte Gesichter ihre Überforderung in dieser Angelegenheit zu kaschieren.
„Und was ist mit Otto?“
„Die haben selber Hühner, jede Menge, versuchte Jürgen den erneuten Angriff auf sein Ergebnis abzuwehren.
„Für jeden eins“, wiederholte er und lächelte wieder in die Runde.
Robert sagte: „Sieben und vier ist …“
„Zwölf“, unterbrach ihn Jürgen mit fester Stimme.
„Schnauze“, rief Otto.
„Für jede Mannschaft sechs“, sagte Jürgen mutig gegen Ottos Befehl in die verstummte Runde.
Gleich gibt’s Keile, dachte Hannes und, rechnen kann der nich.
Robert stieß Hannes an und flüsterte mit Blick auf Jürgen: „Plem, plem; total plem, plem. Den haben se zu spät trocken jelegt, Staunässe im Jehirn.“
„Wieso?“, Hannes hatte außer ‚plem, plem‘ nichts verstanden.
„Sagt meine Mutter immer.“
„Ach so“, flüsterte Hannes.
„Also, wer ist der Beste in Rechnen?“, rief Otto.
„Hannes“, schrien die Drittklässler.
Die aus der vierten Klasse einigten sich auf ‚Bomber‘.
Jetzt kam wieder Bewegung in die Jungen.
„Schlengers Mia ist besser, das weiß jeder“, sagte Jürgen.
„Dass du doof bist, weiß auch jeder“, wies ihn Otto zurecht, „dreidemensierter Doofkopp, klar?“
Bewundernde Blicke richteten sich auf Otto, der offensichtlich ‚ausländisch‘ konnte und die Situation souverän beherrschte.
„Hannes, dein Vater is Lehrer“, Otto hob die rechte Hand mit noch immer zwei Eiern hoch.
„Wie viel und was macht das für jeden?“
Hannes hatte nichts gegen Jürgen aber alles gegen Otto, diesen ‚üblen Burschen‘ - wie sein Vater ihn nannte -, der mit Mädchen rummachte, nicht zur Kirche ging, dicke Wurstbrote mit zur Schule brachte, die er - wenn er keinen Hunger mehr hatte - auf dem Schulhof im Kreise knurrender Mägen zertrampelte.
Warum sagt der das nicht selber, dachte Hannes, der ist doch schon in der achten?
Alle sahen jetzt auf Hannes.
Jürgen versuchte ein Lächeln, Willi grinste, Hannes dachte ‚Scheiße‘ und hoffte auf Hilfe von wo auch immer.
Er sah zu Robert.
„Komm, wir hauen ab“, riet der.
„Na, was is Streber, oder kannse nich?“. Willis Grinsen wurde immer breiter.
„Los, komm“, flüsterte Robert, der spürte, dass Hannes nicht mehr weiter wusste.
Da geschah das Wunder.
„Johannes, höchste Zeit für die Andacht“, rief seine Mutter.
Hannes und Robert sahen sich an.
Hannes sagte: „Ich muss jetzt nach Hause“, und beide rannten los.
„Robert ist doch Heide“, sagte einer.
„Nee, evangelisch“, sagte ein anderer.
„Das ist dasselbe“, stellte Otto klar.
Auf dem Hof vor dem Lehrerhaus, das gleich hinter der Mauer mit dem Nest lag, hörten sie Ottos Stimme: „Dann machen wir das eben so.“
Hinter einem Fliederbusch versteckt verfolgten Robert und Hannes den Fortgang der Dinge. Sie sahen, wie Otto den rechten Arm - mit den beiden Eiern in der Hand - bis über seinen Kopf hob und ausholte. Dann hörten sie einen Klatsch und ein Knistern; sehen konnten sie nicht, was sich ereignet hatte. Erst der herabsinkende Arm - diesmal ohne Eier in der Hand - kam wieder in ihren Blickwinkel. Dann ging es Schlag auf Schlag: Klatsch - Knistern, Klatsch - Knistern, Klatsch - Knistern.
„Mir ist ganz komisch“, sagte Hannes und griff nach Roberts Schulter. Nach jedem ‚Klatsch‘ zuckten seine Finger, wie in einem kurzen Krampf.
„He du kneifst“, flüsterte Robert.
„Macht der die Eier ...?“
„Achtundneunzigprozentig, eins nach dem andern, haste nich gehört?“
„Prozentig?“, fragte Hannes.
„Sagt meine Mutter immer.“
„Und achtundneunzig?“
„Zwei in Reserve, man weiß ja nie.“
„Auch deine Mutter, oder?“
„Na klar; stell dir mal den Pfannkuchen vor, von elf Eiern!“
Und während Hannes sagte, dass das nicht ginge, weil es so große Pfannen nicht gäbe, hörten sie: „Johannes, jetzt wird es aber höchste Zeit, was machst du denn da noch?“ und dazwischen Ottos Stimme, der die Jungen aufforderte abzuhauen.
„Meine Mutter, ich muss jetzt, kommste mit?“
„Zu euch?“
„Nee, in die Andacht.“
„Ich darf nicht.“
„Nun beeil dich, allerhöchste Zeit“, rief seine Mutter.
„Ich komme“, rief Hannes.
„Warum darfst du nicht?“, und bevor Robert antworten konnte, sagte Hannes: „Ach so, ich weiß schon“, lief los, drehte sich im Laufen noch einmal nach hinten und rief mit gedämpfter Stimme: „Bis morgen.“
Seine Mutter forderte ihn auf - nachdem sie kopfschüttelnd den andachtuntauglichen Allgemeinzustand ihres Sohnes betrachtet hatte - sich gründlich zu waschen, die Schuhe zu putzen und den Dreck von der Hose zu bürsten.
„Aber dalli, Regina ist schon weg.“
Dann ist wenigstens das Badezimmer frei, dachte Hannes.
Einsetzendes Glockengeläut von der gegenüberliegenden Kirche mahnte nun auch zu höchster Eile.
Er ging gern zu den Abendandachten im Mai, dem Marienmonat, sang gern die Marienlieder, wo sich ‚ich dich grüße‘ auf ‚du Süße‘ reimte, die Altäre prächtig geschmückt waren, besonders natürlich der mit dem lebensgroßen Bild der Mutter Gottes. Ein Blumenstrauß stand da neben dem anderen - im vorigen Jahr war er beim Durchzählen einmal bis auf dreizehn gekommen - in unterschiedlichen Höhen und in allen Farben des Frühlings.
„Darf ich zu Papa auf die Orgel?“, rief er auf der Treppe zur Wohnung.
„Zu spät, Papa ist auch schon zur Kirche.“
Schade, dachte er.
Das war toll auf der Empore; und dann die Lieder, man hörte seine Stimme richtig, wie sie über dem Gesang der anderen dahinglitt, sich am Ende jeder Strophe langsam auflöste und von neuem in die hohen Gewölbe schwebte, wenn die Orgel wieder einsetzte. Außerdem war er stolz, dass sein Vater die Orgel spielte und er als Einziger mit auf die Empore durfte, allerdings nur mit der ausdrücklichen Genehmigung seines Vaters, um die er jedes Mal neu bitten musste. Heute also nicht.
Für die Empore stand er sogar freiwillig mitten in der Woche morgens um sechs Uhr auf.
In der Frühmesse, in der nur wenige Besucher seinen Gesang störten, spürte er noch intensiver die geheimnisvollen Schwingungen des heiligen Ortes, und seine Knabenstimme strahlte wie poliert bis zum Priester am Altar. In solchen Augenblicken wusste er, dass er Missionar in Afrika werden wollte.
Heute jedoch dachte er nicht an die zu missionierenden Heidenkinder im Urwald. Auch die Marienlieder sang er nur so vor sich hin mit, wie die meisten anderen Jungen auch. Ihm lagen die Eier im Magen, die zerschlagen in einem glibbrigen Haufen an der Mauer lagen und über die sich jetzt im Augenblick wahrscheinlich gerade Hunde und Katzen hermachten.
Elf Eier, dachte er und erinnerte sich an sein letztes ganzes Ei zum Frühstück, Ostern nach dem Hochamt (feierlicher Gottesdienst). Dann spürte er Schwindel.
Frische Luft, schoss es ihm durch den Kopf - seine Mutter hatte ihm das einmal als Heilmittel bei solchen Anfällen empfohlen -, und er stolperte an einer endlosen Reihe von Jungenbeinen vorbei aus der Kirchenbank. Er hörte noch, wie einer sagte „musste pissen?“, beschleunigte dann seine Schritte, wobei er sich bemühte nicht ins Laufen zu kommen, denn das war in der Kirche verboten.
Die frische Luft half tatsächlich.
Jetzt wieder zurück in die Kirche ist doof, dachte er. Aber die Eier, vielleicht kann ich ja doch noch was retten, und er beschloss nach Hause zu laufen, einen Topf und eine Kelle aus der Küche zu holen und dann zur Mauer.
Die Eltern würden staunen, wenn sie nach Hause kämen, und erst seine Schwester und sein großer Bruder. Ein Gefühl, fast wie auf der Empore, breitete sich in ihm aus.
2. Kapitel
Robert wäre gern mit in die Kirche gegangen, schon wegen Hannes. Der hänselte ihn wenigstens nicht, wie die anderen. Besonders, wenn sie zu mehreren waren, konnte er sich oft nur durch Flucht vor ihren Schmährufen und Drohungen in Sicherheit bringen.
‚Pommernscheißer - Robert heißt er‘ und ‚Barackenstinker‘, das machte ihn am meisten wütend. Nach der ersten Schlägerei, bei der sie über ihn hergefallen waren, ihn mit Fäusten und Füßen bearbeitet hatten, wehrte er sich nicht mehr. Er lief dann weg und versteckte sich, bis die Luft wieder rein war. Ein Glück, dass Hannes mit seinem Vater gedroht hatte, dass er ihn rufen würde, wenn sie nicht aufhörten, sonst hätten die mir noch alle Knochen gebrochen, dachte er auf seinem Weg zu den Baracken.
„Falke“, hatte einer gerufen, und alle waren abgehauen.
Vor ‚Falke‘ hatten sie einen Heidenrespekt, der fackelte nicht lange, der Herr Lehrer Falkenmeier. Fast alle hatten sie schon seinen Rohrstock zu spüren bekommen, mit dem war nicht zu spaßen.
Robert spielte Fußball mit Schottersteinen, die auf dem schmalen Sandweg lagen. Er hatte es jetzt nicht mehr eilig. Seine Widersacher sangen entweder in der Kirche fromme Lieder oder machten sich zuhause fürs Bett fertig. Auf jeden Fall durften sie allein um diese Zeit nicht mehr ins Dorf, seitdem die Engländer hier waren. Sogar Neger wollten einige schon gesehen haben. Die würden Kindern die Bäuche aufschlitzen, die Neger, erzählten die Großen auf dem Schulhof. Und die Engländer würden sich an Mädchen ‚vergreifen’. Aber manchmal verteilten sie auch Kaugummi, das wussten alle, auch die aus den unteren Klassen. Fast jeder hatte schon mal eins bekommen, da konnte das mit dem ‚Vergreifen‘ auch nicht so schlimm sein. Es sagte einem sowieso keiner, was das bedeuten sollte - ‚vergreifen‘.
„Das ist ein ‚Tuwort‘“, hatte Jürgen aus der Vierten erklärt.
Auf jeden Fall hatte es mit irgendwas zu tun, das die Erwachsenen nicht gut fanden, aber die schimpften sowieso über alles.
Trotzdem, vorsichtig musste man schon sein, auch bei den Engländern, weil, katholisch waren die nicht, und darauf stand die Hölle, da konnten sie noch so viel Kaugummi verteilen, soviel stand auch fest.
Robert trödelte weiter vor sich hin. Er hatte es nicht eilig, auch nicht auf diesem Stück des Weges, direkt hinter dem Friedhof. Vor dem Dunkelwerden brauchte er nicht in der Baracke zu sein. Seine Mutter hatte keine Angst vor Negern und Engländern und das hatte sie ihm auch gesagt. Auch Robert konnte die Männer in ihren tollen Uniformen besser leiden als so manche Erwachsene aus dem Dorf, die so taten, als ob es ihn gar nicht gäbe.
Und nur wegen diesem blöden Fehler, hatte seine Mutter einmal gesagt, das würde ihr nicht nochmal passieren. Was hätten sie nicht alles geschafft, sie beide. Den ganzen weiten Weg von Pommern bis hierher nach Hermannsdorf - dabei hatte sie ihn ganz fest in die Arme genommen -, und dann dieser blöde Fehler. Aber auch das würde sie wieder hinkriegen, da solle er sich man keine Sorgen machen. Es würde alles gut, das hätte auch Onkel Tom gesagt.
Und der weiß mehr, als alle im Dorf zusammen, dachte Robert, der ist Offizier und kommt aus London und seine Orden, die er mir mal gezeigt hat, und die Briefmarken, die er mir manchmal mitbringt, die hat von denen noch keiner gesehen, nicht mal Hannes.
Er holte wieder aus, diesmal besonders kräftig. Ein Schotterstein flog über die Friedhofsmauer, prallte auf einen Grabstein, einem eingemeißelten Engel mitten auf die Stirn.
Der hat jetzt drei Augen, dachte er, drehte sich um, sah niemanden und schnitt dem dreiäugigen Himmelsboten eine Fratze. Ihm fielen noch einmal die Eier ein, die Heinemanns Otto an die Mauer geklatscht hatte.
Elf Eier an die Mauer, er schüttelte den Kopf, warum nicht in eine Pfanne, dann braten, und dann hätte jeder ein gleich großes Stück gekriegt, oder verkaufen, und dann das Geld teilen, oder tauschen gegen Zigaretten und Zigaretten gegen Schokolade und Schokolade gegen - er überlegte - gegen einen Fußball, einen richtigen Fußball.
Er stellte sich vor, wie sie ihn beneiden würden, wie sie betteln würden, dass sie mitspielen dürften, und dass jeder sein Freund sein wollte, wenn er die Eier gefunden hätte und getauscht hätte, bis zum Fußball.
Mama hätte wahrscheinlich auch getauscht, dachte er, achtundneunzigprozentig. Mit Onkel Tom tauscht sie auch immer, wenn er was zu essen mitbringt. Was sie ihm dafür gab, wollte sie ihm nicht sagen, das sei ihr Geheimnis. Ihm war es auch egal, Hauptsache, sie hatten was zu essen. Auch auf der Flucht hatte sie ihm manchmal gesagt, dass sie mal kurz weg müsste ‚tauschen gehen‘; meistens, wenn sie auf einem Bauernhof übernachteten. Sie hatte dann fast immer was zu essen und zu trinken mitgebracht.
Bei dem Gedanken an seine Mutter fühlte er sich wohl. Er setzte sich in das Gras neben dem Weg, zu dem die Leute aus dem Dorf ‚Pädchen‘ sagten. Kopf und Rücken lehnte er an die Friedhofsmauer, sah die untergehende Sonne durch ‚Holmeiers Busch‘ blinzeln, wie zum Abschied bis zum nächsten Morgen.
Er schloss die Augen, dachte an seine Mutter, wie weich und warm sie war, wenn er sich vor dem Einschlafen an sie schob. Und wenn sie dann den Arm auf ihn legte und ihm einen Gute-Nacht-Kuss gab, fühlte er sich auf den dreigeteilten Strohmatratzen wie in einem Nest, sicher und geborgen und vergaß manchmal sogar, dass er wieder einmal nicht mitspielen durfte.
Bald würde es dunkel sein. Robert stand auf. Jetzt lief er immer mal wieder ein kurzes Stück. Er wollte noch im Hellen die Baracke erreichen. Darauf bestand seine Mutter, das musste er ihr versprechen. Was hatte sie sich aufgeregt, als er das einmal nicht geschafft hatte, wo sie doch sonst nichts aus der Fassung bringen konnte.
Beinah hätte sie geheult, dachte er, und das wollte er nicht noch einmal riskieren.
Ob Onkel Tom heute da war, und ob er was mitgebracht hat für mich? Onkel Tom ist ‚okay‘, dachte er.
Das mit dem ‚okay‘ hatte er von ihm. Alles, was Onkel Tom gefiel, war erstmal ‚okay‘, Robert inklusive.
Bei seiner Mutter machte er eine Ausnahme. Zu der sagte er ‚lawlie‘ und ‚swiet‘ und ‚intelligent‘.
Das seien Komplimente hatte seine Mutter gesagt, als Robert sie gefragt hatte, und Komplimente seien gut, über die könne man sich freuen. Seitdem war er sich sicher, dass auch Onkel Tom ‚okay‘ war.
Frau Jankowski unterhielt sich mit der Frau, die mit ihrem Vater in den zwei Zimmern an der gegenüber liegenden Seite des Flures untergekommen war. Sie hatten sich Stühle nach draußen gestellt. Die Frau von gegenüber ribbelte an einem alten Pullover. Roberts Mutter hatte sich keine Arbeit mit vor die Tür genommen. Sie saß auf ihrem Stuhl, die Beine von sich gestreckt. Den Rock hatte sie so weit hochgeschoben, wie es ihre Unterwäsche zuließ. Die Holzklotschen lagen neben ihren Füßen.
Frau Steguweit hatte Mühe sich auf die schlichten Handgriffe ihrer Ribbeltätigkeit zu konzentrieren. Immer wieder sah sie auf das anatomische Wunderwerk neben sich. Beine von solcher nicht enden
wollenden Vollkommenheit wirkten auch auf sie magisch anziehend.
Kein Wunder, das mit dem Engländer, dachte sie. Und der neue Arzt kommt in der letzten Zeit auch verdächtig oft zu Vater und klopft bei ihr an, wenn er wieder geht. Ich könnte das nich, schon wegen Vater und dann vielleicht noch schwanger werden, nee, mit mir nich.
Frau Jankowski strich über ihre Oberschenkel. Sie spürte die letzten Sonnenstrahlen auf ihrer Haut. Den Kopf an die Barackenwand gelehnt genoss sie den lauen Frühlingsabend. Es kam nicht oft vor, dass sie sich so ruhig und wohltuend müde fühlte. Eigentlich nur, wenn Tom dagewesen war und es besonders schön gewesen war mit ihm auf ihrer schäbigen Matratze, und sie von einer Zukunft mit ihm träumte. Dann lösten sich ihre Sorgen auf und machten Bildern einer glücklichen Zukunft Platz. Doch die hielten nicht lange, dafür sorgte schon der Ehering an der Hand des Engländers, und die Frau und die Kinder, die damit verbunden waren. Aber sie genoss diese Augenblicke, trotzdem.
Heute war Tom nicht gekommen.
Sie hatte Blumen gepflückt - die Wegränder wurden nun von Tag zu Tag bunter - und den Raum neben der Küche, den mit den Matratzen, mit ihnen geschmückt. Ein angenehm frischer Duft hatte sich ausgebreitet, aber leider nicht für Tom, heute nicht. Sie wusste, dass er nicht immer so konnte, wie er wollte, dass plötzlich geänderte Befehle oder Launen von Vorgesetzten keine Rücksicht auf seine üblichen Dienstzeiten nahmen. Er würde wiederkommen, und er würde auch einen Weg finden sie zu benachrichtigen, damit sie sich rechtzeitig für Robbi was einfallen lassen konnte, schon in seinem eigenen Interesse, da war sie sich ganz sicher. Er hielt es nicht lange aus, ohne sie. Sie erinnerte sich an das erste Mal, als sie sich vor ihm ausgezogen und ihn zu sich gewunken hatte. Wie ein Kind, dem am Heiligabend zum ersten Mal der festlich geschmückte Weihnachtsbaum entgegenleuchtet mit der Krippe unter den Zweigen und den glitzernd verpackten Geschenken mit ungewissem Inhalt daneben, so hatte er vor ihr gestanden, der tapfere Soldat und Eroberer: Staunend und freudig erregt und ein bisschen unbeholfen, wie ihr schien. Als er seine Uniform wieder angezogen hatte an diesem Tag, wusste sie, dass es ihn erwischt hatte, dass er so schnell nicht von ihr loskommen würde.
‚Bis morgen, please‘, hatte er sich verabschiedet, wie ‚bitte bitte‘ hatte es geklungen.
Auf der Flucht hatte sie gelernt mit Männern umzugehen, worauf sie standen und wann ihnen der Verstand zwischen die Beine fiel. So hatte sie sich und ihren Sohn durchgebracht auf dem langen Weg von Kamin an der Ostsee bis hierher, mitten in Westfalen, über ein Jahr lang; aber sie hatte es geschafft mit ihrem Sohn, alles andere zählte nicht.
Sie strich sich durch die Haare, lehnte den Kopf zur Seite und sah ihren Sohn neben Holmeiers Busch in Rufweite. Sie winkte ihm zu. Er hatte sich an ihre Abmachung gehalten.
Ein schöner Abend heute, dachte sie, auch ohne Tom.
„Okay“, sagte sie, schlüpfte in ihre Holzklotschen und ging ihrem
Sohn entgegen.
3. Kapitel
Robert erzählte von Johannes, dass der in eine Andacht gegangen wäre, und dass der ihn gefragt hätte ...
„Was hat er gefragt?“, unterbrach ihn seine Mutter.
„Ob ich mitkommen wollte. Warum darf ich eigentlich nicht? Das ist doch nichts Schlimmes, sonst würde Hannes auch nicht hingehen, der ist nämlich nett, und alle die anderen gehen auch.“
„Ach, ich versteh das auch nicht so richtig.“
Sie hatte keine Lust, sich den Abend durch dieses Thema vermiesen zu lassen. Es kam selten genug vor, dass sie sich so zufrieden fühlte wie heute, mit sich und ihrer Umgebung im Reinen, stolz auf ihren Sohn, der sich auch nicht unterkriegen ließ und stolz auch auf sich selbst, dass sie das alles bis jetzt geschafft hatte. Und die Baracke, na ja, es hätte auch schlimmer kommen können.
Die Andacht erinnerte sie daran, dass auch sie Fehler gemacht hatte und dazu einen besonders dämlichen, und ihre gute Laune wäre dahin, wenn sie sich darauf einlassen würde.
Also, nicht heute, mein lieber Sohn, dachte sie sich.
„Komm, ich mach uns was warm, von heute Mittag, die leckere Suppe. Du kannst schon mal die Teller holen, oder sollen wir“, sie machte eine Pause, „sollen wir zusammen aus dem Topf, und die Teller können uns gestohlen bleiben?“
Sie wusste, dass sie ihn damit ködern konnte. Darauf fuhr er ab. Und dann noch eine Geschichte von Störtebeker und seinen wilden Gesellen. Ihre schäbige Baracke würde sich wie von Geisterhand, Satz für Satz, in ein komfortables Versteck für Abenteurer verwandeln, in dem sie sicher waren vor den Gefahren, die um sie herum lauerten. Robert fühlte sich dann ganz eng mit seiner Mutter verbunden. Sie beide waren in solchen Augenblicken der Mittelpunkt der Welt, und die blöden Scheißer vom Schulhof standen um sie herum voller Bewunderung und Neid und wären gern an seiner Stelle gewesen.
Auch heute vergaß Robert die Andacht, ließ sich einfangen von Stürmen und vom Meeresrauschen, von Helden und Heldengesängen und von Matrosen, die trunken in benebelten Schlaf versanken. Etwas blieb aber in seinem Kopf, was an diesem Abend den Gefahren der Meere und den Helden auf den Schiffen nicht weichen wollte. Er erzählte von den Eiern an der Mauer, und was Otto damit angestellt hatte.
Blöder Bauerntölpel, dachte seine Mutter.
„Du hättest doch auch getauscht, oder?“
„Aber natürlich, was denn sonst, achtundneunzigprozentig.“
„Mit zwei in Reserve?“
„Genau so, mein Kleiner.“
Frau Jankowski legte sich zu ihrem Sohn auf die Matratzen. Beide überboten sich nun in waghalsigsten Tauschgeschäften. Als sie schließlich ein ‚neues Klo‘ vorschlug, protestierte er heftig und setzte seinen Fußball dagegen und ließ sich nicht mehr davon abbringen.
„Ein neuer Ball“, murmelte er und schlief ein, und als Frau Jankowski auf dem Gesicht ihres Sohnes ein kurzes Lächeln sah, dachte sie, Tom oder Tauschen gehen, darauf wird es hinauslaufen; hoffentlich Tom.
Und während ‚Tom‘ und ‚Tauschengehen‘ in ihrem Kopf kreiste, drehte sie sich zu ihrem Sohn, legte ihren Arm auf ihn und stellte am nächsten Morgen fest, dass sie vergessen hatte sich zur Nacht umzuziehen.
Nicht mal das Kleid, dachte sie, als sie über den verkrausten Stoff strich.
Für alle genug ‚Spiegeleier mit Bratkartoffeln‘, von mir für alle.
Hannes spürte schon jetzt die bewundernden Blicke, die sich auf ihn richten würden. Vielleicht würde sein Vater ihm sogar die Hand schütteln, wie bei einer Siegerehrung, wenn man es bis unter die ersten drei geschafft hat, und seine Mutter würde ihn in den Arm nehmen und voller Dankbarkeit über das Haar streicheln, begleitet vom Beifall seiner beiden Geschwister, die älter waren als er, schon richtig erwachsen - seine Schwester jedenfalls -.
Und Sandmanns Kirschbaum? An der Kirche vorbei, an den Lichtspielen rechts rein, dann nur noch ein paar Meter; das kann ich auch schaffen, dachte er.
Mama war jedenfalls ganz komisch und Papa eben auch am Fenster, wie Diebe, wenn sie beim Einbruch überrascht werden. Ausgerechnet Papa und Mama, er schüttelte den Kopf und überlegte, ob er das auch beichten müsste, wenn es so weit wäre, dass er zur Beichte gehen dürfte und zur ersten Heiligen Kommunion. Aber das dauerte leider noch fast ein ganzes Jahr.
Nein, jetzt waren die Eier wichtiger. Das würde ein Fest. Missionar im Urwald könnte nicht schöner sein, vielleicht noch ein bisschen aufregender wegen der Neger, die immer darauf aus waren, Missionare in Kessel mit kochendem Wasser zu schmeißen, natürlich nur so lange, wie sie nicht getauft waren, denn nach der Taufe waren sie ja katholisch, zwar noch Neger, aber keine richtigen Neger mehr, denn jetzt konnten sie ja auch in den Himmel kommen. In einem Missionsheft hatte er gelesen, dass in besonders schwierigen Fällen - wenn sich einer hartnäckig weigerte zum Beispiel, oder einer besonders gefährlich war - sogar heimlich Taufen vorgenommen würden, ohne dass die überhaupt was davon mitkriegten zunächst und erst dann was merkten, wenn sich der Heilige Geist langsam in ihnen ausbreitete.
Das ist ganz schön spannend, dachte er, während er sich dem Gras- und Brennnesselbusch näherte, in den die zerschlagenen Eier heruntergelaufen sein mussten.
„Spiegeleier mit Bratkartoffeln“, hauchte er nach einem tiefen Atemzug aus sich heraus.
Missionare, getaufte und ungetaufte Neger verschwanden nun ebenso schnell, wie sie aufgetaucht waren. Jetzt galt es sich der Beute unauffällig zu nähern, sich ihrer noch unauffälliger zu bemächtigen und sie in Windeseile in Sicherheit zu bringen. Alles sprach für ein glückliches Gelingen. Kein Mensch weit und breit. Nur eine Katze hatte sich ein Stückchen weiter an die Mauer gestreckt. Die Maiandacht würde noch eine Weile dauern.
Mit jedem Schritt, der ihn seinem Ziel näher brachte, blähte sich sein Vorhaben zu einem Abenteuer, das - wenn überhaupt jemand - nur er bestehen konnte. Als Ritter ohne Furcht und Tadel fühlte er sich, siegreich im listigen Kampf gegen seine Widersacher: Willi, Pissnelke und vor allem Otto, diesen ‚üblen Burschen‘.
An dem oberen Teil der Mauer sah er Reste der heruntergelaufenen Eidotter.
Jetzt muss ich alles richtig machen, dachte er, keinen Fehler, nicht stolpern, dass der Topf auf die Steine fällt und die Kelle, und es scheppert, und es kommt noch jemand wegen dem Krach.
Er sah noch einmal in alle Richtungen, duckte sich, drückte den Topf mit der Kelle fest an seinen Bauch und arbeitete sich im Kniegang bis zu den zerbrochenen Eiern vor. Als er durch die Brennnesseln und die hohen Grashalme erste Eierschalen - zum Greifen nah - sah, ließ er sich auf die Knie fallen, nahm mit der rechten Hand die Kelle aus dem Topf, hielt mit der anderen den Topf einfüllbereit an den Rand der Brennnesseln und Gräser und beugte sich über den zu bergenden Schatz.
Nur nichts verplempern, dachte er beim Anblick der zerbrochenen Eierschalen, bis ihm klar wurde, dass er tatsächlich nur Schalen sah, weiße und braune Eierschalen. Von gelbem Dotter oder schlierigem Eiweiß keine Spur.
Sicher unter den Schalen, dachte er, stellte den Topf beiseite und schob die Schalen vorsichtig auseinander; in der rechten Hand hielt er noch immer die Kelle zum Schöpfen bereit.
Irgendwo muss es doch sein, dachte er.
Seine Handbewegungen wurden heftiger, erste Schalenstückchen flogen durch die Luft, eines traf die Katze, die ihren Kopf leicht anhob, zu Hannes herüber sah, sich das Maul leckte und den Kopf wieder sinken ließ. Wieder lag sie hingestreckt an der Mauer, zufrieden mit sich und dem heutigen Nahrungsangebot, das sie mühelos gewittert und in aller Ruhe verzehrt hatte. Von dem inzwischen wild im Gras herumfuchtelnden Hannes ließ sie sich nicht stören, nicht nach dieser Mahlzeit.
Er wollte es nicht wahrhaben.
Das war doch hier, da oben klebt doch noch was Gelbes, dachte er. Er versuchte mit der Hand die Dotterstreifen zu erreichen, was auch nach mehrmaligem Springen gelang, leckte den Dotter, der haften geblieben war, ab und schmeckte, dass es Eigelb war. Dann fiel sein Blick auf die Katze, wie sie dalag, an der Mauer, sah, wie sich der Bauch langsam hob und senkte, wie sie sich noch ein wenig länger streckte und mit dem Schwanz an einem Grasstängel hoch- und runterfuhr, als ob sie sich vor dem Einschlafen noch eine Streicheleinheit abholen wollte, und wie sie sich noch einmal das Maul leckte.