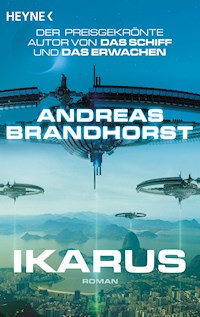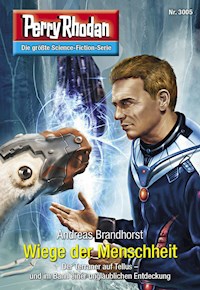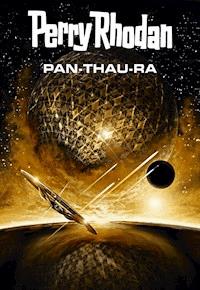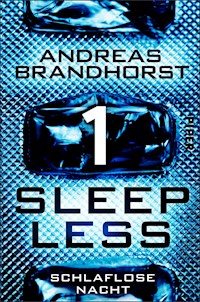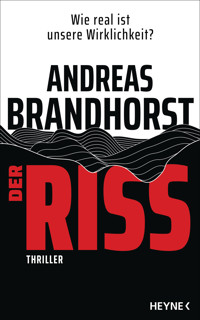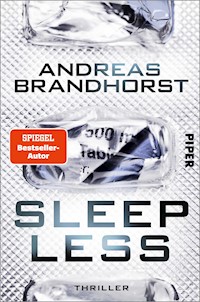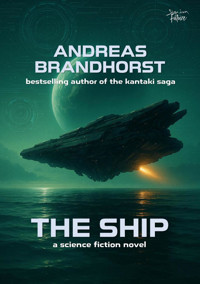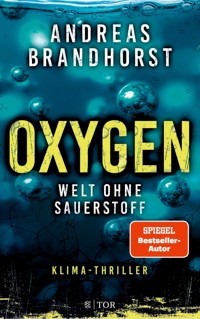
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Spannend, informativ – und absolut furchterregend. Der Thriller zur Klimakrise von Bestseller-Autor Andreas Brandhorst. Es hätte alles so schön werden können. Durch die Förderung regenerativer Energiequellen und den Einsatz neuer Technologien zeichnet sich eine Lösung der Klimakrise bereits am Horizont ab. Doch dann macht die Meeresbiologin Laura Lombardi eine beunruhigende Entdeckung: Das Plankton in den Weltmeeren, das für einen großen Teil der globalen Sauerstoffproduktion verantwortlich ist, verliert die Fähigkeit zur Fotosynthese. Was zuerst nach einem Messfehler aussieht, dann nach einer regionalen Anomalie, entwickelt sich zur größten Katastrophe in der Geschichte der Menschheit: Der Welt scheint die Luft auszugehen, und Suche nach einem Gegenmittel ist schwieriger als gedacht. Für Leser*innen von Andreas Eschbach und Wolf Harlander
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Andreas Brandhorst
Oxygen
Welt ohne Sauerstoff
Klimathriller
Über dieses Buch
Es hätte alles so schön werden können. Durch die Förderung regenerativer Energiequellen und den Einsatz neuer Technologien zeichnet sich eine Lösung der Klimakrise bereits am Horizont ab.
Doch dann macht die Meeresbiologin Laura Lombardi eine beunruhigende Entdeckung: Das Plankton in den Weltmeeren, das für einen großen Teil der globalen Sauerstoffproduktion verantwortlich ist, verliert die Fähigkeit zur Fotosynthese. Was zuerst nach einem Messfehler aussieht, dann nach einer regionalen Anomalie, entwickelt sich zur größten Katastrophe in der Geschichte der Menschheit: Der Welt scheint die Luft auszugehen, und Suche nach einem Gegenmittel ist schwieriger als gedacht.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Andreas Brandhorst, geboren 1956 im norddeutschen Sielhorst, zählt mit Thrillern wie »Das Erwachen«, »Die Eskalation« und »Sleepless« und Science-Fiction-Romanen wie »Das Schiff« und »Omni« zu den erfolgreichsten Autoren unserer Zeit. Spektakuläre Zukunftsvisionen sind sein Markenzeichen. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Literaturpreise. Andreas Brandhorst hat dreißig Jahre in Italien gelebt und ist inzwischen in seine alte Heimat in Norddeutschland zurückgekehrt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2022 Andreas Brandorst
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Textbaby Medienagentur, www.textbaby.de
Für die Erstausgabe:
© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung und -abbildung: Johannes Wiebel | punchdesign unter Verwendung von Motiven von AdobeStock
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491592-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
Prolog Vor 32 Jahren
Heute Erstes Jahr
1 Laura Lombardi
2
3
4
5 Tayo Aneke
6
7
8 Hudson Chamberlain
9 Virginia Del Rey
10
11 Laura Lombardi
12
13
14 Hudson Chamberlain
15 Laura Lombardi
16 Tayo Aneke
17 Leopold Magnussen
18 Laura Lombardi
19
20 Virginia Del Rey
21
22 Laura Lombardi
23
24
25 Hudson Chamberlain
26
27 Leopold Magnussen
28 Slobodan Ković
29 Virginia Del Rey
30 Hudson Chamberlain
31 Laura Lombardi
Sieben Monate später Zweites Jahr
32 Laura Lombardi
33
34 Hudson Chamberlain
35
36 Laura Lombardi
37
38 Joycelin Hayes
39
40 Virginia Del Rey
41
42
43 Tayo Aneke
44
45
46
47 Laura Lombardi
48 Hudson Chamberlain
49 Joycelin Hayes
50
51
52 Virginia Del Rey
53 Laura Lombardi
54
55
56 Joycelin Hayes
57
58 David Finley
59
60 Virginia Del Rey
61
62 Laura Lombardi
63
64
65
66 David Finley
67
68 Virginia Del Rey
69
70
71
72
73 Leopold Magnussen
74
75 Joycelin Hayes
76 Laura Lombardi
77 Virginia Del Rey
78
79
80 Laura Lombardi
81
82 Joycelin Hayes
83
84
85 Emmerson White
86 Laura Lombardi
87
88
Drittes Jahr
89 Laura Lombardi
90
91
92
93 Joycelin Hayes
94
95 Virginia Del Rey
96
97
98
99 David Finley
100 Joycelin Hayes
101 Laura Lombardi
102
103
104
105
106 David Finley
107
108 Laura Lombardi
109
110 David Finley
111
112
113
114 Hudson Chamberlain
115 Laura Lombardi
116
117 David Finley
118 Laura Lombardi
119 Hudson Chamberlain
120 Laura Lombardi
121
Was sein wird
Kontakt mit dem Autor
»Die Menschen führen ein langfristiges geophysikalisches Experiment einer Art aus, die in der Vergangenheit nicht möglich gewesen wäre und in der Zukunft nicht wiederholbar sein wird.«
Roger Revell, Direktor der Scipps Institution of Oceanography, Kalifornien, 1957
PrologVor 32 Jahren
Catania, Sizilien
»Wo ist denn das Geburtstagskind?«, tönte Tante Margheritas hohe Stimme durch die offene Tür. »Na, wo ist es denn?«
Laura saß auf der Terrasse, im Schatten der Markise, und bemerkte den Blick ihrer Mutter. Hab Geduld, baten ihre nussbraunen Augen, die Laura von ihr geerbt hatte. Es passiert nur einmal im Jahr.
Niemand hatte öfter als einmal im Jahr Geburtstag, aber Tante Margherita aus Mailand und ihr Slobodan, der aus Novigrad in Kroatien stammte und für eine Firma namens Corrico arbeitete, machten immer eine ganze Woche daraus, denn für sie war es eine gute Gelegenheit für Urlaub im sizilianischen Catania. Sie kamen im Gästehaus von Lauras Eltern unter, mit Blick aufs Meer, und natürlich waren Kost und Logis gratis. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dachte der Schelm in Laura.
»Ah, da ist die junge Dame, ich hab sie gefunden!«, quiekte Tante Margherita vergnügt und schob sich seitlich durch die offene Tür. Sie trug ein fußlanges himmelblaues Kleid, das aussah, als hätte sie ein Stück vom Himmel eingefangen, und einen großen Strohhut. Hinter ihr, wie in ihrem Schatten, kam Slobodan, halb so breit und etwas kleiner. Laura verglich ihn mit einem Hering, der einen großen, dicken Thunfisch begleitete, vielleicht sogar einen Wal. Wenn der Thunfisch – oder der Wal – zuschnappte, musste der Hering gut aufpassen, sonst war es um ihn geschehen.
Laura lächelte bei dieser Vorstellung, genau zum richtigen Zeitpunkt: Tante Margherita glaubte, dass sie sich freute. In Wirklichkeit wartete sie nur auf das Zeichen ihrer Mutter, die aufstand, um ihre Schwester zu begrüßen.
»Annalisa«, schnaufte Margherita, »endlich sehen wir uns wieder, meine Liebe!«
Die beiden Schwestern – eine schlank und dunkelhaarig, die andere wie ein zu stark aufgequollener Teig, das Haar feuerrot – umarmten sich. Slobodan blieb ein Stück abseits stehen, ein blasser Mann in einer bunten Welt, so kam es Laura vor.
»Und deine Tochter, wie groß sie geworden ist!«, juchzte Tante Margherita und wandte sich Laura zu. »Na komm, lass dich ebenfalls umarmen.«
Der Wal schlang seine Arme um sie, und Laura hielt unwillkürlich die Luft an. Tante Margherita schwitzte, obwohl es gar nicht heiß war, nur dreiundzwanzig Grad.
»Zehn, die erste Null, mein Kind.« Tante Margherita hielt sie an den Schultern. »Und sehen wir nicht schon aus wie zwölf oder dreizehn? Bald wirst du eine junge Frau.«
»Das hat noch etwas Zeit«, lachte Annalisa.
»Ich hab dir was Hübsches mitgebracht«, verkündete Tante Margherita. »Ein Geschenk für das Geburtstagskind.« Sie löste die Hände von Lauras Schultern und streckte die rechte Slobodan entgegen, der ihr ein Päckchen reichte, in goldenes Glanzpapier gewickelt und mit rosaroter Schleife. »Hier, das ist für dich.«
Laura nahm das Päckchen entgegen und betrachtete es. Ein Buch wäre eine angenehme Überraschung gewesen, über Biologie oder Ozeanographie, aber Bücher durfte man von Tante Margherita nicht erwarten.
»Na, mach es schon auf, Kind!«
Laura löste die Schleife, öffnete das Glanzpapier und fand darunter eine rechteckige Schachtel, die bestimmt kein Buch enthielt. Sie nahm den Deckel ab.
»Na?«, fragte Tante Margherita glücklich. »Na, was sagst du? Freust du dich?«
»Ein Game Boy«, sagte Laura, ohne das kleine Gerät aus der Schachtel zu nehmen.
»Bei uns in Mailand spielen alle Kinder damit. Ich glaube, es gibt dafür auch Spiele mit Tieren und Delfinen und so.«
Ihre Mutter kam und nahm das Geschenk. »Sie ist sprachlos«, sagte sie und lachte erneut. »Du hast sie wirklich überrascht, Margherita.« Sie nickte ihrer Tochter kurz zu.
Das war das Zeichen.
»Vielen, vielen Dank, Tante Margherita«, sagte Laura und eilte zur Terrassentür. »Ich muss jetzt los, wir sehen uns später.«
Sie floh durchs stille Haus, verließ es durch den Nebeneingang, schwang sich aufs Rad und fuhr über die Hangstraße.
Links standen weißgraue Wolken über dem Gipfel des Ätnas, rechts glänzte blau das Mittelmeer. Nur wenige Kilometer weiter südlich, direkt an der See gelegen, zeigten sich die weißen Gebäude des Ozeanographischen Instituts Minerva, das Annalisa und Francesco Lombardi gegründet hatten und das von einer privaten Stiftung finanziert wurde. Laura lächelte, von den Zwängen des Geburtstags befreit, und trat fester in die Pedale. Joey wartete bestimmt schon auf sie.
Als sie das Institut wenig später erreichte, stand Ruggero in der Tür, der neue Wissenschaftliche Assistent, der erst vor wenigen Monaten sein Studium beendet hatte. Er lächelte nicht wie sonst, sondern wirkte betroffen.
»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag«, sagte er traurig. »Dein Vater lässt dir ausrichten, dass du besser etwas später kommen solltest. Derzeit haben wir alle viel zu tun.«
Etwas stimmte nicht, das spürte Laura sofort. »Was ist passiert?«
»Nichts«, log Ruggero, und man sah ihm die Lüge an. »Es ist nichts passiert. Wir haben nur viel Arbeit und …«
Laura lief an ihm vorbei zu den großen Becken, die leer waren – der Zugang zum Meer stand offen. Sie eilte weiter, ohne jemandem zu begegnen; in den Büros und Laboratorien hielt sich niemand auf.
Stimmen hörte sie erst, als sie das Hauptgebäude auf der anderen Seite verließ. Männer und Frauen, manche von ihnen in Badekleidung, andere in weißen Kitteln, standen beim Steg, der weit wie ein Bootsanleger ins Meer reichte. Ihr Vater, so groß wie Tante Margherita, bemerkte sie fast sofort und kam ihr entgegen.
»Laura …«, begann er und suchte nach Worten.
»Was ist denn?«, fragte sie verwirrt. Durch eine Lücke zwischen zwei Personen am Ufer sah sie einen Delfin. »Joey?«
Ihr Vater, der große, immer freundliche Francesco, wollte ihr die Hand auf die Schulter legen und sie vielleicht sogar festhalten, aber Laura lief schon wieder, erreichte den Delfin und sank neben ihm auf die Knie. Er lag halb im Wasser und halb im Sand, zusammen mit einigen Artgenossen.
»Helft mir!«, rief Laura den Leuten zu. »Er muss ins Wasser zurück!«
Niemand half ihr, denn es konnte niemand mehr helfen, weil es bereits zu spät war. Joey lebte nicht mehr.
Vor sechs Jahren, als Vierjährige, hatte Laura seine Geburt erlebt. Sie war mit ihm aufgewachsen, hatte mit ihm gespielt und mit ihm gesprochen. Sein Schnattern war ihr seither so vertraut geworden wie die Stimme eines Menschen.
Francesco näherte sich und ging neben ihr in die Hocke. »Wir konnten nichts für ihn tun, glaub mir«, sagte er leise und strich ihr sanft übers Haar. »Er starb vor wenigen Minuten, ebenso wie die anderen.«
Laura starrte fassungslos auf ihren toten Freund hinab. »Aber … warum?«
»Wir vermuten, es war etwas im Wasser.«
Am Abend, als Tante Margherita und ihr Slobodan zu einer Tour durch die Stadt aufgebrochen waren, saßen Laura und ihre Eltern auf der Terrasse am Tisch. Auf der linken Seite, nach Norden hin, lag der Lichterteppich von Catania, mit dem Vulkan im Nordwesten. Vorn, nach Osten hin, erstreckte sich das Mittelmeer. Wenn man an die Brüstung der Terrasse trat, konnte man unten im Südosten die Gebäude des Instituts am Ufer sehen.
»Dies ist der traurigste Geburtstag meines Lebens«, klagte Laura.
»Du hast einen guten Freund verloren«, sagte ihre Mutter voller Anteilnahme. »Das tut mir sehr, sehr leid.«
»Ich kann nie wieder mit Joey schwimmen.« Laura fühlte neue Tränen kommen. »Nie wieder.«
»Das macht der Tod«, erklärte ihr Vater ernst. »Manchmal nimmt er, was uns am liebsten ist.«
»Aber warum?«, fragte Laura erneut und spürte, wie ihre Wangen feucht wurden. »Warum musste Joey sterben?«
»Schwer zu sagen«, antwortete ihr Vater. »Wir sind noch dabei, die möglichen Ursachen zu untersuchen.«
»Etwas im Wasser, hast du gesagt.«
»Ja. Vielleicht ein Frachter, der auf dem Weg nach Messina die Tanks ausgespült hat. Oder einer der Industriebetriebe im Norden, die manchmal eine teure Entsorgung vermeiden, indem sie ihre Abwässer ins Meer leiten.«
»Gift für die Delfine.« Laura sah, wie aus ihren Händen Fäuste wurden, eine links von ihrem Teller, die andere rechts.
»Nicht nur für sie, Laura.« Francesco Lombardis ernste Stimme bekam einen traurigen Unterton. »Es wird immer schlimmer mit der Umweltverschmutzung. Wir brennen Wälder ab und kippen Müll ins Meer, der über die Fische zu uns zurückkehrt. Ein neues großes Artensterben hat begonnen, an Land ebenso wie im Ozean. Der Mensch ist auf dem besten Weg, seine eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Wenn wir so weitermachen, steht uns eine gewaltige ökologische Katastrophe bevor. Wir werden es vielleicht nicht mehr erleben«, er deutete auf Annalisa und sich selbst, »aber du schon. Du bist jung genug, um Zeugin einer Zeitenwende zu werden.«
Laura glaubte zu verstehen. »Eure Arbeit im Institut … Ihr versucht, die Welt zu retten, ja?«
»Man könnte es tatsächlich so benennen«, stimmte ihr Annalisa zu.
Laura traf eine Entscheidung. Sie brauchte nicht lange zu überlegen, alles stand sofort fest.
»Ich möchte helfen«, sagte sie. »Ich werde das Abitur machen und Ozeanographie studieren, wie du, Mama. Und wenn ich den Abschluss habe, arbeite ich mit euch zusammen im Institut.«
Der Vater ergriff ihre linke Hand, die Mutter ihre rechte.
»Das wäre gut«, sagte Francesco. »Dann können wir gemeinsam versuchen, die Welt zu retten.«
HeuteErstes Jahr
Die Welt wird grau
1Laura Lombardi
Bei der Insel Pantelleria, zwischen Sizilien und Tunesien
Das Meer lag glatt wie Glas, die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel. Dr. Laura Lombardi schloss die Augen und stellte sich vor, irgendwo an Land zu stehen – die Trieste bewegte sich kaum.
»Erst neun Uhr und schon ziemlich warm«, vernahm sie eine Stimme hinter sich. »Es wird ein weiterer zu heißer Tag auf einem zu warmen Meer. Und das im März.«
Sie befanden sich nordwestlich der italienischen Insel Pantelleria, zwischen Sizilien und Tunesien. Die Trieste – ihr Name eine Hommage an den Bathyskaph Trieste, mit dem Jacques Piccard und Don Walsh am 23. Januar 1960 im pazifischen Marianengraben 10910 Meter tief getaucht waren – wartete auf die Rückkehr ihrer beiden kleinen Tauchroboter. Im Labor war alles für eine erste Untersuchung der Proben vorbereitet, und Richard würde zugleich mit seinem Computer die aufgezeichneten Daten auswerten.
Laura öffnete die Augen und blinzelte im Sonnenschein. »Dies ist das Mittelmeer. Hier ist es immer warm.«
»Ich habe mir erst gestern die Temperaturkurven angesehen«, sagte die zweiundzwanzig Jahre junge Olivia Marchesi, Studentin aus Turin und Herzblut-Ökologistin. Man nannte sie auch »Diamond«, weil ihre blauen Augen manchmal wie Diamanten funkelten. »Die Werte sind noch immer ziemlich hoch.«
»Das werden sie auch bleiben, für die nächsten zehn oder zwanzig Jahre.« Laura blickte übers Meer. »Das Klima ist träge, von seinen Launen ganz zu schweigen. Die neuen Maßnahmen können nicht sofort wirken, das braucht seine Zeit. Aber …« Sie lächelte. »Es sieht alles vielversprechend aus. Vielleicht haben wir wirklich einen Weg aus der Krise gefunden. Ich bin gespannt, was uns die neuen Proben erzählen.«
Sie hielt Ausschau, konnte jedoch die beiden kleinen Tauchroboter noch nicht ausmachen. Ob Richard sie schon auf seinem Ortungsschirm hatte?
»Wenn du mich fragst, Laura …« Olivia seufzte und trat neben sie an die Reling. Sie trug ein weißes T-Shirt mit dem Schriftzug Istituto Oceanografico Minerva und einen Greenpeace-Sticker. »Corricos neue Methoden werden zu oft und an zu vielen Orten für eine Art Freibrief gehalten. Man hört und liest es immer wieder: Wir haben es geschafft, das Schlimmste ist überstanden, es wird alles gut. Aber die Probleme mit Umwelt und Klima sind lange noch nicht gelöst.«
»Deshalb sind wir hier.« Laura breitete die Arme aus. »Um Daten zu sammeln. Um herauszufinden, wie es um unseren Planeten bestellt ist.«
»Ich fürchte, wir sind nicht nur deshalb hier«, sagte die junge Olivia und strich sich eine Strähne ihres blonden Haars aus der Stirn. »Lorenz scheint eine eigene Agenda zu haben.«
Sie meinte Lorenz Winkler aus Deutschland, Gesandter von Kochal, Broderbund & Althaus, einer deutsch-niederländischen Firmengruppe, die als Sponsor die neue Forschungsfahrt der Trieste unterstützte.
»Es geht ihm nicht um Meer und Klima, sondern um Geld«, sagte Olivia. Es klang nach etwas Ekligem.
»Genau. Das nämlich bekommen wir von ihm und seinen Auftraggebern.«
»Vielleicht will er uns bald einen neuen Auftrag geben«, prophezeite Olivia düster. »Er ist ein Schatzsucher. Er benutzt uns, um vielversprechende Wracks aufzuspüren. So sparen seine Mandanten Suchschiffe und Mannschaften.«
Lorenz Winkler, den Laura auf gut fünfzig schätzte, hatte sich von Anfang an mit kühler Freundlichkeit bemüht, im Hintergrund zu bleiben und niemanden zu stören, wie es seiner Rolle entsprach. Es gab nichts, was Laura an ihm kritisieren konnte.
»Ich hab’s auf seinen Karten gesehen«, fuhr Olivia fort. »Er sucht insbesondere Galeeren von Rom und Karthago, aber auch spanische und portugiesische Galeonen. Hauptsache, die Fracht lohnt sich.«
»Er hat dir seine Karten gezeigt?«
»Sie lagen ganz offen da«, wich Olivia aus.
»Wo?«
»In seiner Kabine.«
»Hat er dich zu sich eingeladen?«
»Ich wollte ihm Kaffee bringen.«
»Lass mich raten«, sagte Laura. »Während er an Deck war.«
»Ich hab angeklopft.«
»Obwohl du oben seine Stimme gehört hast.«
Olivia zuckte mit den Schultern. »Wie auch immer, ich hab die Karten gesehen. Jetzt wissen wir Bescheid. Wenn er uns heute oder morgen bittet, die Trieste auf einen neuen Kurs zu steuern, kennen wir den Grund. Mit Wissenschaft hat das nichts zu tun.«
»Die Entscheidung über den Kurs liegt bei mir und beim Skipper«, betonte Laura. So ließ sich der alte Gianni Nardi nennen, Skipper, obwohl die Trieste keine elegante Segelyacht war, sondern ein zweiundvierzig Meter langes und fünfzehn Meter breites Motorschiff.
»Ich sag ja nur.« Olivia senkte die Stimme ein wenig. »Übrigens, vielleicht bahnt sich was zwischen ihnen an.«
»Zwischen wem?«
»Dem Herrn Lorenz Winkler und Amelia«, sagte Olivia. »Bis tief in die Nacht haben sie auf dem Achterdeck gesessen. Ich hab sie gehört, als sie die Kajütentreppe heruntergekommen sind. Bist du sicher, dass Amelia für Repubblica und Protecta arbeitet? Vielleicht stecken sie unter einer Decke. Ich meine, auch im übertragenen Sinn.«
Laura sah auf die Uhr. Inzwischen hätten die beiden Tauchroboter eigentlich zurück sein müssen.
»Ja, ich bin sicher«, erwiderte sie. Manchmal tratschte Olivia gern. Laura hielt es für ein Zeichen ihres Vertrauens und nahm es hin, solange sie nicht übertrieb. »Sie arbeitet an einem großen Bericht über unsere Forschungen. Repubblica bringt ihn kommenden Monat in mehreren Teilen, und Protecta wird einen langen Fachartikel veröffentlichen.«
La Repubblica war eine der wichtigsten italienischen Tageszeitungen und hatte noch immer erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung in Italien. Bei Protecta handelte es sich um ein angesehenes Wissenschaftsmagazin, das sich an ein eher intellektuelles Publikum wandte.
»Ich sag ja nur.« Olivia sprach noch immer leise. »Nicht, dass sie nachher über versunkene Schiffe und Schatzsucher schreibt anstatt über die Klimakrise und immer noch viel zu warme Meere.«
Voraus geriet das Wasser in Bewegung. Zuerst dachte Laura an Delfine und vielleicht sogar einen Wal, doch dann tauchten zwei Roboter auf, der eine gelb, der andere orangefarben.
»Huey und Dewey sind zurück, wurde auch Zeit«, sagte sie zufrieden. »Komm, helfen wir Skipper Nardi, sie an Bord zu holen.«
2
Eine Stunde später saßen sie im Labor: Laura und die junge Olivia am neuen Rasterelektronenmikroskop, das seit kurzer Zeit zur technischen Ausrüstung der Trieste gehörte, und Richard – Dr. Richard Jay Compton, Meeresbiologe aus Birmingham – am Computerschirm. Laura hatte gerade begonnen, sich die Phytoplankton-Proben anzusehen, als Amelia De Santis und Lorenz Winkler hereinkamen. Sie gingen nicht Hand in Hand und wechselten auch keinen liebevollen Blick, aber Laura spürte etwas zwischen ihnen.
»Hat sich schon was ergeben?«, fragte die Journalistin. Sie war einige Jahre jünger als Lorenz Winkler, Mitte vierzig, und hatte dunkles, welliges Haar, das ihr bis auf die Schultern reichte. Eine atemberaubende Schönheit war sie nicht, soweit Laura das beurteilen konnte, aber eine Aura klassischer Eleganz umgab sie und kam auch in ihren geschmeidigen Bewegungen zum Ausdruck.
Laura nickte den Neuankömmlingen freundlich zu. »Die ersten Untersuchungen finden gerade statt.«
Amelia setzte sich an den kleinen Tisch hinter Laura und Olivia und holte ihr Handy hervor. »Wenn Sie gestatten …«
»Natürlich«, sagte Laura. Die Journalistin hatte schon mehrmals Aufzeichnungen mit ihrem Handy gemacht. Zweifellos waren sie ihr eine große Hilfe beim Schreiben der Berichte.
Lorenz nahm nicht neben ihr am Tisch Platz, sondern weiter hinten, auf einem Stuhl an der Wand. Von dort aus hatte er alles im Blick.
»Es hat sich tatsächlich schon was ergeben«, wandte sich Olivia an Amelia. »Und es bestätigt, worüber wir gestern gesprochen haben. Die Temperaturen sind noch immer viel zu hoch. Richard?«
Der immer ruhige und gelassene Richard J. Compton ließ sich nicht anmerken, ob es ihm gefiel, von Olivia für ihre Sache eingespannt zu werden. Er war einundvierzig Jahre alt und Single, fand Frauen offenbar ebenso langweilig wie Männer. Die Artenmigration in den Ozeanen und seine Computer schienen ihn weit mehr zu interessieren als alles andere.
Vielleicht erging es ihm ebenso wie ihr, dachte Laura manchmal. Nach Pierre war sie niemandem begegnet, der geeignet schien, den Platz an ihrer Seite einzunehmen. Und je länger dieser Platz leer blieb, desto mehr Aufmerksamkeit beanspruchte die Ozeanographie.
»Huey und Dewey haben in den vergangenen vierundzwanzig Stunden immer wieder die Temperatur des Meerwassers gemessen, in unterschiedlichen Tiefen.« Tasten klickten unter Richards Fingern, und auf dem breiten, gewölbten Monitor vor ihm erschien eine Zackenlinie. »Daraus ergibt sich eine mittlere Oberflächentemperatur von vierundzwanzig Komma zwei Grad, und selbst in einer Tiefe von hundert Metern liegt sie noch um die zwanzig Grad. Das ist sehr ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel vor Mallorcas Küste im Sommer Temperaturen zwischen sechsundzwanzig und siebenundzwanzig Grad gemessen werden.«
»Und darf ich daran erinnern, dass wir erst März haben und noch nicht August.«, betonte Olivia. »In fünf Monaten könnten wir bei zweiunddreißig, dreiunddreißig oder mehr Grad sein. Mit anderen Worten: Das Mittelmeer wird tropisch, mit Temperaturen wie in der Karibik. Was sich natürlich auch auf die Arten auswirkt. Einheimische Spezies emigrieren oder sterben aus, tropische Arten immigrieren durch die Meerenge von Gibraltar, durch den Suezkanal und in den Ballasttanks großer Frachter. Stimmt’s, Richard?«
Daraufhin begann der Biologe mit einem seiner Vorträge. Laura ließ sich davon nicht ablenken und setzte die Untersuchung der Phytoplankton-Proben fort, die Huey und Dewey während ihrer Tauchfahrt gesammelt hatten. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend. Steigende Meerestemperaturen hatten das Wachstum der photoautotrophen Organismen verlangsamt, aber nach der Düngung der Ozeane durch Corrico und andere Klima-Unternehmen nahm ihre Anzahl wieder zu.
»Das sieht gut aus«, murmelte sie. Olivia wandte sich ihr sofort zu, und Laura deutete auf den Bildschirm. »Das Phytoplankton erholt sich, sogar schneller als erwartet.«
Richard Compton unterbrach seinen Vortrag, den er für Lorenz und Amelia hielt, als Skipper Nardi in der Tür erschien: ein kleiner, drahtiger Mann an die siebzig, mit zotteligem grauweißem Haar und einem Dreitagebart. Das zerfurchte Gesicht wirkte ledrig, die dunklen Augen darin flink und lebhaft.
»Alles in Ordnung bei euch?«, fragte er.
Laura winkte ihm zu. »Alles bestens.«
»Am frühen Nachmittag könnte es schlechtes Wetter geben«, sagte Gianni Nardi. »Eine Unwetterfront zieht von Süden heran.«
Es fiel Laura schwer, den Blick vom Monitor des Rasterelektronenmikroskops abzuwenden. Ihr war etwas aufgefallen. »Können wir ausweichen?«
»Ich denke schon«, meinte Skipper Nardi. »Wohin?«
Lorenz Winkler räusperte sich. »Wenn ich einen Vorschlag machen darf …«
»Ja?«
»Ich habe mir die neuen Wetterkarten vorhin angesehen«, sagte der Deutsche. »Wir könnten nach Osten fahren, hundert Seemeilen weit. Das sollte genügen.«
Olivia warf Laura einen warnenden Blick zu.
Sie überlegte kurz und musterte Lorenz dabei. Dessen Miene verriet nichts. Er hatte zu wenige Falten für sein Alter, ebenso wie die Kleidung, die wie frisch gebügelt wirkte: knielange beigefarbene Shorts mit leeren Werkzeugtaschen und ein dazu passendes cremefarbenes Hemd, das er über den Shorts trug. Mit einem Tropenhelm hätte er sich einer Safari anschließen können, ohne jemandem aufzufallen. Das galt ohnehin für ihn – man nahm ihn erst richtig wahr, wenn der Blick etwas länger auf ihm verweilte, dann gab ihn die Kulisse, der Hintergrund, als Person preis. Wie er es anstellte, so unauffällig zu sein, obwohl es ihm nicht an Attraktivität und Selbstbewusstsein mangelte, blieb sein Geheimnis.
»Nein«, entschied Laura. »Wir fahren nach Norden, nach Marsala. Im Hafen dort sind wir vor Unwettern geschützt. Wir können die Daten weitergeben und Amelia ihren ersten Bericht.«
Skipper Nardi hob die Hand zur Mütze und ging.
Laura wandte sich wieder dem Monitor zu und sah genauer hin. »Hier stimmt was nicht«, sagte sie laut und deutlich.
Damit weckte sie das Interesse der anderen. Richard drehte sich zu ihr um. Lorenz Winkler hob die Brauen. Olivia beugte sich vor. Und Amelia fragte: »Was ist los?«
»Kommen Sie«, lud Laura die Journalistin ein. »Sehen Sie es sich aus der Nähe an. Ich dachte zunächst, ich hätte mich geirrt, aber …« Sie verstummte.
Amelia verließ ihren Platz am Tisch und sank auf den Stuhl rechts von Laura. Richard Compton stand auf, kam näher und blieb hinter ihnen stehen, mit Blick auf den Monitor des elektronischen Mikroskops. Lorenz gesellte sich an seine Seite.
»Kennen Sie sich mit Phytoplankton aus, Amelia?« Laura drückte Tasten, die Bilder auf dem Monitor wechselten und zeigten verschiedene Organismen. Die Daten unter den Bildern wiesen auf eine Entwicklung hin, die sie alle betraf.
»Ein bisschen«, entgegnete die Journalistin vorsichtig.
Laura überlegte kurz und sprach dann wie bei einer Vorlesung an der Universität von Catania. »Photoautotrophes Phytoplankton bildet das Fundament der Nahrungskette in den Ozeanen. Die winzigen Organismen betreiben Fotosynthese, das heißt, sie produzieren Zucker, Stärke und Sauerstoff aus Nährstoffen im Wasser sowie Sonnenlicht und Kohlendioxid. Das Phytoplankton ist die Nahrung des Zooplanktons, das wiederum von Fischen gefressen wird. Und wir verdanken ihm einen großen, wenn nicht den größten Teil des Sauerstoffs in der Atmosphäre, bis zu siebzig oder achtzig Prozent.«
Amelia nickte und vergewisserte sich mit einem Blick auf ihr Handy, dass es alles aufzeichnete.
Laura deutete auf den Monitor, auf dem ganz oben eine Scheibe zu sehen war, die man mit etwas Phantasie für eine geriffelte Tablette halten konnte. Die Bilder darunter präsentierten Organismen, die aussahen wie gepanzerte Nüsse.
»Ganz oben sehen Sie eine Kieselalge«, erklärte Laura. »Kieselalgen beziehungsweise Diatomeen zählen ebenso zum Phytoplankton wie die darunter abgebildeten Dinoflagellaten, auch Panzeralgen oder Panzergeißler genannt. Sie sind hier im Mittelmeer recht häufig, wie zum Beispiel Podolampas bipes, Ceratium limulus und Blepharocysta splendor-maris.« Sie tippte mit dem Zeigefinger auf den Bildschirm, auf etwas, das einer Eichel mit einem Fledermausflügel ähnelte. »Das ist Ornithocercus magnificus, ein Dinoflagellat mit Segeln anstatt mit Geißeln, ein Einzeller, der in Symbiose mit Cyanobakterien lebt, die ebenfalls zum Phytoplankton zählen.«
Sie drückte eine Taste, die Bilder wechselten, Querschnitte erschienen, Teile von Einzellern, die wie ausgefranst oder zerrissen wirkten. Daneben erschienen Zahlen, die sich in Abständen von einigen Sekunden veränderten.
Amelia beugte sich vor. »Was ist das?«
»Ich dachte zunächst, es beträfe nur einzelne Organismen«, sagte Laura ernst. »Vielleicht ein durch ultraviolette Strahlen hervorgerufener Schaden. So was kommt vor. Eine Art Sonnenbrand beim Plankton, das zu lange zu dicht unter der Wasseroberfläche treibt. Sie wissen ja, dass wir Probleme mit der Ozonschicht hatten, bis das Klimakonsortium unter der Führung von Corrico vor einem Jahr die ersten Aerosolen eingesetzt hat.«
Amelia nickte. »Das ist bekannt. Man hat eine Lösung für das Problem gefunden.«
»Ja«, bestätigte Laura. »Die Ozonschicht, die uns alle vor schädlicher UV-Strahlung schützt, hat sich stabilisiert, das kann also nicht die Erklärung sein.«
Sie blickte wieder auf den Monitor, und allmählich dämmerte ihr, was sie entdeckt hatte. Wenn dies kein Einzelfall war, sondern der Beginn einer neuen Entwicklung …
»Ein großer Teil des photoautotrophen Planktons in den von Huey und Dewey gesammelten Proben weist Zellschäden auf«, sagte sie. »Soweit ich das sehe, sind vor allem die Chlorophyll-Moleküle betroffen.«
»Was bedeutet das?«, fragte die Journalistin, als Laura nicht weitersprach, sondern wiederholt die Bildlauftaste drückte und sich stumm die anderen Aufnahmen des Rasterelektronenmikroskops ansah. »Sterben die betroffenen Einzeller?«
»Sie brauchen das Chlorophyll für die Fotosynthese, die sie mit Zucker und Stärke versorgt«, antwortete Laura. »Wenn die Fotosynthese des Planktons nicht mehr funktioniert … ja, dann stirbt es.« Laura verstummte erneut, um ihre Gedanken zu sammeln. »Es muss etwas Neues sein«, fuhr sie dann fort, »eine neue Entwicklung, denn bisher haben wir ein Wachstum beim Phytoplankton beobachtet. Die Zellschäden betreffen alle Proben, die von den beiden Tauchrobotern an verschiedenen Stellen in unterschiedlichen Tiefen genommen wurden. Olivia?«
Die junge Frau an ihrer Seite nickte. Sie hatte die Bilder und ersten Analyseergebnisse miteinander verglichen. »Offenbar haben zwischen fünfzig und sechzig Prozent des Phytoplanktons entweder gar kein Chlorophyll mehr oder nur noch kleine Reste.«
»Könnte man daraus schließen, dass es sich um einen allgemeinen Vorgang handelt?«, fragte Amelia.
»Für eine solche Aussage ist es noch zu früh. Aber wenn das stimmt, wenn die Fotosynthese des Phytoplanktons nicht nur hier gestört ist, sondern überall im Mittelmeer und vielleicht sogar in den Ozeanen …«
»Dann bekommen wir klareres Wasser, nicht wahr? Ich meine, weniger Phytoplankton bedeutet auch weniger Algen und weniger übermäßige Algenblüten.« Scherzhaft fügte Amelia hinzu: »Die Menschen an den Badestränden werden sich freuen.«
Laura bedachte die Journalistin mit einem ernsten Blick. »Sie verstehen nicht. Wenn dies mehr ist als ein unglücklicher Zufall, der sich auf unsere Proben beschränkt, wenn wir es tatsächlich mit einer allgemeinen Entwicklung zu tun haben … Dann stehen wir vor einem Riesenproblem.«
Amelias Lächeln verblasste, als sie sich erinnerte. »Oh. Sie meinen die Sauerstoffproduktion.«
»Siebzig bis achtzig Prozent des Sauerstoffs in unserer Atmosphäre stammen vom Phytoplankton«, wiederholte Laura. »Wenn es keinen Nachschub gibt, geht uns allen die Luft aus.«
Amelia De Santis dachte darüber nach, dann sagte sie leise: »Meine Güte.«
»Ja.« Laura nickte und klatschte plötzlich in die Hände. »Also gut, Leute, machen wir uns an die Arbeit. Wir brauchen eine solidere Datenbasis. Wenn wir in Marsala sind, fragen wir bei unseren Kollegen rund um den Globus nach.« Sie sah auf die Uhr. »In einigen Stunden wissen wir hoffentlich mehr.«
3
Laura sah nachdenklich aus dem Fenster des Centro Studi Marittimi von Marsala, des »Zentrums für Meeresforschung«, unweit des kleinen Yachthafens. Sie beobachtete die dunklen Wolken im Süden über dem Meer und bemerkte das Flackern eines Blitzes. Wind war aufgekommen, die Boote im Hafen schaukelten auf unruhig gewordenem Wasser, und Laura glaubte fast, das Knarren von Seilen und das Knattern nicht richtig festgezurrter Segelplanen zu hören.
Hinter ihr wurde die Tür geöffnet, und jemand betrat das Laboratorium, in dem Laura die letzten Stunden verbracht hatte. Sie rechnete mit Olivia und war überrascht, als sie die Stimme eines Mannes vernahm.
»Bist du müde?«, fragte Richard Jay Compton.
Sie drehte sich halb zu ihm um. »Oh, du bist’s. Ja, ich gestehe, ich bin ein bisschen müde.« Sie lächelte schief. »Ich wünschte, ich wäre so jung wie unsere eifrige Olivia. Eigentlich habe ich sie erwartet und nicht dich. Sie wollte mir die letzten Berichte bringen.«
Richard hob eine Mappe. »Ich hab sie hier. Olivia ist bei Professor Zamberti und erläutert ihm deine Zusammenfassung.«
Laura nickte und nahm die Mappe entgegen.
Richard setzte sich auf einen nahen Stuhl und deutete aus dem Fenster, als in der Ferne ein weiterer Blitz aufleuchtete. »Dort draußen geht es jetzt ziemlich ungemütlich zu. Zum Glück ist die Trieste hier sicher.«
»Wenn wir Pech haben, gibt es bald auf der ganzen Erde keinen sicheren Ort mehr.« Laura blätterte durch die Ausdrucke in der Mappe. Die Aufstellungen, die sie sah, verbesserten ihre Stimmung nicht. »Es ist also tatsächlich eine allgemeine Entwicklung, nicht wahr?«
»Darauf deutet alles hin«, bestätigte Richard. Er war ein Ruhepol, ein Fels in der Brandung, fand Laura. Nicht zum ersten Mal beneidete sie ihn um seine Unerschütterlichkeit. »Atlantik und Pazifik, das Japanische Meer, der Indische Ozean, das Nordmeer und die antarktischen Gewässer … Überall bietet sich ein ähnliches Bild.«
»Was bedeutet, dass es keine jahreszeitlichen Einflüsse sind«, murmelte Laura.
»Die Unterschiede sind marginal«, sagte Richard ruhig. »In der Antarktis sind die Abweichungen von den normalen Werten etwas geringer, im Nordmeer etwas höher. Das könnte tatsächlich etwas mit Temperatur und Jahreszeit zu tun haben. Aber entsprechende Schlussfolgerungen wären voreilig, erst müssen weitere Untersuchungen stattfinden.«
»Wenn es brennt, sollte man die Feuerwehr sofort verständigen und nicht warten, bis man vor einem Großbrand steht.« Laura las in einer der Listen. »Die ersten Meldungen sind etwa sechs Wochen alt und stammen aus Forschungsberichten, bei denen es um Krill und den Roten Thun geht. Bei der Analyse entsprechender Wasserproben stieß man auf ›degeneriertes Phytoplankton‹, auf Einzeller ohne Chlorophyll. Aber es waren nur einige wenige Dinoflagellaten betroffen, man hielt die ›Degeneration‹ für eine Folge lokaler Umweltverschmutzung. Das deckt sich mit meiner Online-Recherche und Nachfragen bei Kollegen in den USA und auf den Philippinen. Es begann also vor etwa sechs Wochen. Zwei wichtige Fragen lauten: Was ist die Ursache? Und was können wir dagegen unternehmen?«
Laura merkte plötzlich, dass Richards Präsenz beruhigend auf sie wirkte. Ihre Gedanken bewegten sich nicht mehr in einem wilden Tanz, ein Teil der Anspannung wich von ihr. In seinen blaugrauen Augen sah sie so etwas wie Vater oder Bruder – und vielleicht noch etwas anderes, das sie nicht genau zu definieren wusste.
»Bitte sag mir, dass alles gut wird«, forderte sie halb im Scherz.
Richard hob die Brauen. »Erwarte keine Lügen von mir«, erwiderte er sanft. »Ich weiß nicht, ob alles gut wird. Oft ist das der Fall, manchmal nicht. Wir sind Wissenschaftler und Forscher. Finden wir mehr heraus.«
Die Tür öffnete sich erneut, und die junge Olivia kam herein. Sie wirkte ein wenig abgekämpft, als hätte sie gerade eine hitzige Diskussion hinter sich. Ihr folgten Professor Zamberti, Leiter des CSM von Marsala, und Amelia und Lorenz.
Olivia hob die Arme und ließ sie wieder sinken. »Er wollte unbedingt mit dir reden, ich konnte es nicht verhindern.«
»Warum auch?«, gab Laura freundlich zurück.
Zamberti blieb stehen, die anderen setzten sich an den Tisch. Der Professor war kaum älter als Lorenz Winkler, doch die hagere, fast ausgemergelt wirkende Statur und das von zahlreichen Falten durchzogene Gesicht ließen ihn viel älter aussehen. Er trug einen alten mausgrauen Anzug, der ihm eine Nummer zu groß schien.
»Haben Sie sich schon an die Öffentlichkeit gewandt, Dottoressa Lombardi?« Er nahm kurz den Hefter mit der Zusammenfassung und legte ihn dann zwischen Amelia und Olivia auf den Tisch.
»Noch nicht«, antwortete Laura.
»Aber das sollten wir so bald wie möglich tun«, sagte Olivia mit Nachdruck.
Zamberti seufzte tief und schwer. »Vielleicht ist es besser, noch ein bisschen damit zu warten. Das gilt auch und insbesondere für Sie, Signora De Santis.«
»Warum?«, fragte Laura.
»Es sind schwere Zeiten für uns.« Der Professor sprach leise, aber seine Worte waren klar und deutlich. »Für vergleichsweise kleine Institute wie die unsrigen, meine ich. Die großen, lukrativen Forschungsaufträge gehen an internationale Firmen und die multinationalen Konsortien wie das von Corrico. Wir müssen unsere Glaubwürdigkeit bewahren. Deshalb achte ich für das CSM immer darauf, dass die Daten unserer veröffentlichten Berichte hieb- und stichfest sind.«
Laura deutete erst auf die Mappe, die Richard gebracht hatte, und dann auf den Hefter zwischen Olivia und der Journalistin. »Wir haben alles überprüft. Die Daten sind bestätigt, auch von Forschungsergebnissen in anderen Teilen der Welt.«
Zamberti blickte kurz zu den noch freien Stühlen und überlegte vielleicht, ob er Platz nehmen sollte. Wenn dem so war, entschied er sich dagegen. »Sie wissen, dass wir staatliche Zuschüsse und Sponsoren brauchen, Dottoressa«, fuhr er fort. »Man könnte uns vorwerfen, Aufmerksamkeit erregen zu wollen, um unsere Bilanzen aufzubessern.«
Laura glaubte, ihren Ohren nicht trauen zu können, und starrte den Professor an. »Es geht hier um Wissenschaft, nicht um irgendwelche Bilanzen.«
»Sowohl als auch, Dottoressa«, sagte Zamberti niedergeschlagen. »Das eine lässt sich leider nicht vom anderen trennen. Wenn unsere Bilanzen nicht in Ordnung sind, können wir keine Wissenschaft mehr betreiben.«
Die anderen schwiegen, stellte Laura fest. Sie überließen ihr das Feld. Richard saß ruhig da, sein Blick vermittelte Gelassenheit und Zuversicht. Nur zu, schien er ihr sagen zu wollen. Lass dich nicht unterkriegen.
»Ist Ihnen wirklich klar, womit wir es zu tun haben?« Laura zwang sich, nicht zu schnell zu sprechen. »Wenn es stimmt, dass das Phytoplankton sein Chlorophyll verliert, steuern wir geradewegs auf eine Katastrophe zu, neben der sich alles, was uns die Klimakrise beschert hat, wie ein Kindergeburtstag ausnimmt. Wenn keine Fotosynthese mehr stattfindet, wird der Sauerstoffanteil unserer Luft drastisch sinken. Nicht in ein paar Jahrzehnten, sondern viel, viel schneller. Ständig wird überall auf der Welt Sauerstoff verbraucht. Denken Sie an die nach wie vor weit verbreiteten Verbrennungsmotoren …«
»Weltweit sind noch immer über eine Milliarde Autos unterwegs, deren Motoren Sauerstoff für die Verbrennung fossiler Treibstoffe benötigen«, warf Richard ein.
»Hinzu kommen Industrie, natürliche Oxydation und die Atmung der Lebewesen, unter ihnen die von wie vielen Milliarden Menschen? Acht? Neun? Oder sind es schon zehn? Jeden Tag werden Millionen Tonnen Sauerstoff verbraucht, und ohne Nachschub werden wir die Verringerung des Sauerstoffgehalts in unserer Atemluft schon in wenigen Monaten zu spüren bekommen.«
»Vielleicht ist es ein vorübergehendes Ereignis«, wandte Zamberti ein. »Möglicherweise erholt sich das betroffene Phytoplankton bald wieder. Es wäre nicht das erste Phänomen, das plötzlich erscheint, uns erschreckt und dann wieder verschwindet. Wir wissen noch zu wenig, um den Weltuntergang zu verkünden und die Menschen rund um den Globus in Panik zu versetzen. Außerdem bleibt uns die Fotosynthese der Landpflanzen, der Regenwälder und des borealen Nadelwalds. Wir haben also noch Zeit, selbst wenn sich Ihre Befürchtungen bewahrheiten.«
»Wenn es brennt« sagte Richard langsam, »sollte man die Feuerwehr sofort verständigen und nicht warten, bis man vor einem Großbrand steht.«
Laura hörte ihre eigenen Worte und fügte hinzu: »Untätigkeit hat noch nie die Welt gerettet. Sie hat auch nichts mit Besonnenheit zu tun, höchstens mit mangelndem Verantwortungsgefühl. Wir müssen die drohende Gefahr beim Namen nennen, und zwar laut genug, damit etwas dagegen unternommen wird.«
Zamberti seufzte erneut. »Ihrem Institut geht es nicht besonders gut, oder?«
Laura blinzelte verwirrt. »Wie bitte?«
»Zu Lebzeiten Ihrer Eltern genoss das Istituto Oceanografico Minerva einen exzellenten Ruf und konnte zwischen zahlreichen Forschungsaufträgen wählen. Das hat sich inzwischen geändert. Die Kosten wachsen Ihnen immer mehr über den Kopf. Sie brauchen Sponsoren.« Er nickte in Richtung Lorenz Winkler, der bisher nur zugehört und sich im Hintergrund gehalten hatte, so wie es seine Art war.
»Die Gründe dafür haben Sie eben selbst genannt«, sagte Laura. »Die großen Klimafirmen …«
»In diesem besonderen Fall sind Sie der Grund, Dottoressa«, erklärte Zamberti. »Man wirft Ihnen Einseitigkeit vor, sogar Ideologie.«
Olivia schnaufte leise.
»Es wäre nicht das erste Mal, dass Sie mit … nun, gewagten Berichten und Thesen an die Öffentlichkeit treten.«
»Thesen?«, wiederholte Laura konsterniert.
»Sie gelten als Unruhestifterin und die Arbeit Ihres Instituts als tendenziös«, fuhr Zamberti mit der Stimme eines Trauerredners fort. »Es begann während Ihres Studiums in Catania und setzte sich später fort, bei Ihrer Tätigkeit als Fluchthelferin für die NGO Sea-Eye …«
»Hören Sie eigentlich, was Sie da sagen?«, entfuhr es Laura. »Das Wort ›Fluchthelfer‹ kommt ›Schleuser‹ recht nahe. Die rechten italienischen Medien haben beide Begriffe oft synonym verwendet. Sie sollten es besser wissen, Professor. Sea-Eye hat Menschen aus Seenot gerettet, und zwar nicht weit von hier, zwischen Libyen und Sizilien. Ja, es waren Flüchtlinge, sie sind vor politischer Verfolgung und bitterer Armut geflohen. Und ja, wir haben ihnen geholfen, waren also ›Flüchtlingshelfer‹. Was manchen Leuten nicht in den Kram passte. Sie nannten uns auch abfällig ›Gutmenschen‹, was zeigt, wie sehr man die Sprache vergewaltigen kann. Aber was spielt das alles für eine Rolle, wenn …«
»Es spielt sehr wohl eine Rolle, Dottoressa«, unterbrach Zamberti. »Die Reste Ihrer Glaubwürdigkeit stehen auf dem Spiel. Wenn Sie sich jetzt an die Öffentlichkeit wenden und behaupten, das Ende der Welt wäre nahe, und wenn sich dann herausstellt, dass alles halb so schlimm ist … oder zumindest nicht so schlimm wie von Ihnen dargestellt … Dann ist Ihre Glaubwürdigkeit endgültig dahin. Dann haben Sie Minerva vollends ruiniert. Und unser CSM obendrein, wenn wir Sie dabei unterstützen.«
Laura atmete tief durch. »Was Sie nicht vorhaben, nehme ich an.«
»Warten Sie noch etwas.« Zamberti ging zur Tür, drehte sich dort aber noch einmal um. »Stellen Sie weitere Untersuchungen an. Gedulden Sie sich, bis renommierte Forschungsinstitute in anderen Teilen der Welt Ihre Daten bestätigen. Dann können wir überlegen, wann und in welcher Form wir uns an die Öffentlichkeit wenden. Alles andere wäre schädlicher Alarmismus. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag.«
4
Ein Blitz flackerte in der Ferne, passend zum Abgang des Professors. Erste Regentropfen klatschten gegen die Fensterscheiben – Marsala bekam die Ausläufer des Unwetters zu spüren.
»Es ist eine Bitte, nicht wahr?«, fragte Amelia und überprüfte ihr Smartphone. »Ich meine, niemand von uns ist zum Schweigen verpflichtet, oder?«
»Wir sind unabhängig«, ließ sich Lorenz Winkler vernehmen, der sich plötzlich wieder zu Wort meldete, und Laura staunte kurz über das »wir«. »Er kann uns keine Anweisungen erteilen.«
»Unsere Daten sprechen eine klare, deutliche Sprache«, sagte Olivia. »Sie sind weder rechts noch links, schwarz oder weiß. Sie teilen uns mit: Etwas Großes ist im Gang, es betrifft die ganze Welt, und es könnte sehr, sehr gefährlich für uns werden, für uns alle.«
»Zamberti ist nicht in erster Linie Wissenschaftler, sondern ein Mann von Verwaltung und Politik«, sagte Richard Compton ruhig. »Er will es sich mit niemandem verderben.«
»Außer mit uns!«, warf Olivia ein.
»Darf ich jetzt meine Artikel veröffentlichen oder nicht?«, fragte Amelia.
Einige Sekunden lang sprach niemand. Man hörte nur den Regen, der gegen die Fenster prasselte.
»Mit der Unterstützung des CSM dürfen wir offenbar nicht rechnen«, sagte Laura schließlich, und es klang enttäuscht.
»Brauchen wir die?«, entgegnete Richard. »Ist die unbedingt nötig?«
Laura gestand sich ein, was am meisten schmerzte: die Behauptung von Professor Zamberti … nein, sein Hinweis darauf, dass sie das Ozeanographische Institut Minerva heruntergewirtschaftet hatte.
»Verantwortung«, betonte Olivia. »Darum geht es letztendlich. Du hast es eben selbst gesagt, Laura. Wissenschaft steht nicht wertfrei irgendwo im leeren Raum. Neue Erkenntnisse bedeuten Verantwortung. Wir haben etwas entdeckt, von dem wir wissen, dass es eine große Gefahr sein könnte. Persönliche Erwägungen wie Ruf, Reputation und Glaubwürdigkeit sollten dabei keine Rolle spielen. Und wirtschaftliche Erwägungen, gleich welcher Art, erst recht nicht. Die einzige Frage sollte sein: Was richtet größeren Schaden an, ein Fehlalarm oder zu langes Zögern vor der Warnung?«
»Was meine Frage betrifft …«, begann Amelia erneut.
»Das Beste, was uns passieren kann, der Welt und auch uns persönlich, ist, dass wir uns irren«, sagte Richard.
»Aber wir irren uns nicht, oder?«, fragte Laura.
»Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering«, meinte er. »Und selbst wenn nicht … Wir sollten versuchen, die Welt zu warnen. Damit man rund um den Globus alle Anstrengungen unternimmt, der Sache auf den Grund zu gehen, und im Notfall Maßnahmen ergriffen werden können.«
»Versuchen?«, schnaufte Olivia. »Ein Versuch genügt nicht. Wir müssen uns dahinterklemmen, so richtig. Wir müssen alle Möglichkeiten nutzen, die uns zur Verfügung stehen, mit vollem Engagement.«
Laura nickte Amelia zu. »Da haben Sie Ihre Antwort. Leute …« Sie holte tief Luft. »Ich möchte dies nicht allein entscheiden. Olivia und Richard, ihr sitzt mit mir im Minerva-Boot, und allein das gibt euch Stimmrecht bei der Entscheidung. Amelia, Sie wollen über unsere Arbeit berichten und sind deshalb ebenfalls betroffen. Und Sie, Lorenz … Es ist Ihr Geld, das unsere Forschungsfahrt finanziert hat. Sie sind ebenfalls beteiligt.«
Der Deutsche nickte. »Ich bin in jedem Fall mit von der Partie. Sie haben meine volle Unterstützung. Immerhin bin ich Ihr Sponsor.«
Amelia lächelte ihm zu.
»Also gut«, sagte Laura. »Wer ist dafür, dass wir nicht warten und die Sache sofort publik machen?«
Lorenz Winkler hob als Erster die Hand, sofort gefolgt von Olivia und Amelia. Richards rechte Hand kam ein oder zwei Sekunden später nach oben.
Auch Laura hob die Hand. »Ich schätze, die Gegenprobe können wir uns sparen. Es ist also entschieden: Wir gehen an die Öffentlichkeit. Mit allem, was wir haben. Das volle Programm. Soziale Medien, Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Fernsehen, alles, was Aufmerksamkeit erregt. Wir schlagen die Trommel, laut genug, dass uns die ganze Welt hört.«
5Tayo Aneke
Wüste von Mauretanien
Draußen war es so heiß, dass die Luft zu brennen schien. Im Innern des Flugwagens, des großen E-Kopters mit sechs leistungsstarken Rotoren, herrschten angenehme zweiundzwanzig Grad. Für Tayo Aneke aus Nigeria war es fast zu kühl.
»Ich habe ein wenig recherchiert«, sagte der Mann im zweiten großen Passagiersessel. »Ihr Vorname bedeutet ›geboren zum Glücklichsein‹. Sind Sie glücklich, Mister Secretary?«
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, der vor einer Woche darauf verzichtet hatte, seinen siebenundsiebzigsten Geburtstag zu feiern, blickte aus dem Fenster, während der Kopter höher stieg. Wo sich noch vor einigen Jahren endlos die Wüste erstreckt hatte, gelbbraun und weiß im grellen, heißen, erbarmungslosen Schein der Sonne, reihten sich nun ebenso endlos Sonnenkollektoren, Solarpanels und die Parabolrinnen von Solarfarmkraftwerken. Hier und dort ragten Absorber-Türme auf, die hochkonzentriertes Sonnenlicht empfingen; der Kopter flog in sicherem Abstand an ihnen vorbei.
»Das Glück ist relativ, Mister Chamberlain«, entgegnete er. »Jeder Mensch muss für sich entscheiden, was ihn glücklich macht.«
»Was würde Sie glücklich machen?«
Hudson Chamberlain, Geschäftsführer von Corrico und damit auch CEO des Klimakonsortiums mit dem Motto »We Save the World«, versuchte nicht, sich klug zu geben oder geistreich zu klingen. So etwas hatte er auch nicht nötig. Er war ein kultivierter, eleganter Mann Mitte fünfzig, mit kurzem grauem Haar, stahlgrauen Augen und nicht einem Pfund zu viel am Leib. Ganz gleich, was er sagte und wie er sprach und sich bewegte, alles brachte Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit zum Ausdruck, ohne dass er jemals arrogant oder anmaßend wirkte. Hudson Chamberlain, zu dessen Vorfahren auch kanadische Cree gehörten, wusste immer genau, was er tat, und nie schien er dabei auch nur einen Hauch von Zweifel zu empfinden. Er war jemand, dem viele Menschen intuitiv vertrauten, weil er ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Richtigkeit gab.
»Was mich glücklich machen würde …«, murmelte Tayo Aneke und beobachtete die Tausende von Hektar großen Solarkraftwerke, die emissionsfreien Strom für Europa lieferten. »Vielleicht wäre ich glücklich, wenn ich dabei helfen könnte, die vielen Probleme dieser Welt zu lösen.«
»Vielleicht, Mister Secretary?«
Aneke lächelte. »Und dreißig weitere Lebensjahre bei bester Gesundheit und mit viel Kraft wären nicht schlecht. Um zu sehen, ob unsere Bemühungen wirklich den gewünschten Erfolg haben.«
Chamberlain schmunzelte. »Was sind heute siebenundsiebzig Jahre? Ein reifes Alter. Ich rechne fest damit, dass ich bei Ihrem hundertsten Geburtstag zugegen sein kann. Und was die Ergebnisse unserer Arbeit betrifft …« Er deutete nach draußen, ins grelle Licht, eingefangen von den Kollektoren. »Das ist ein wichtiger Schritt in eine bessere Zukunft. Unsere Anlagen gehen weit über das hinaus, was Desertec vor knapp zwanzig Jahren geplant hat. Strom aus der nordafrikanischen Wüste, in einem noch viel größeren Ausmaß und ohne ein einziges Gramm CO2. Wir sind bereits bei fünfundzwanzig Prozent, und in wenigen Monaten, nach Inbetriebnahme der Solarkraftwerke hier in Mauretanien und Mali und Niger, können wir fast vierzig Prozent des Strombedarfs von Europa decken.«
Tayo Aneke wandte den Kopf und blickte Chamberlain in die Augen. »Was ist mit Ihnen? Was wäre Ihr Glück?«
»Mir geht es wie Ihnen, Mister Secretary. Ich habe mich voll und ganz dieser Sache verschrieben, ich stehe und falle mit ihr.«
»Die Rettung der Welt ist Ihr Glück?«
Chamberlain lächelte. Es war ein ehrliches, aufrichtiges Lächeln, nicht Teil einer Maske, die etwas verbarg. »Überrascht Sie das? Sollten wir uns nicht alle freuen, wenn die Welt gerettet wird?«
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen nickte bedächtig. »Da haben Sie zweifellos recht. Aber Sie verdienen auch viel Geld damit, nicht wahr?«
»Ich bin immer der Meinung gewesen, dass gute Arbeit gut bezahlt werden sollte«, sagte Hudson Chamberlain, und es klang absolut ehrlich. »Ja, ich verdiene viel Geld, aber ich habe mich auch ganz und gar unserer Sache verschrieben, mit Haut und Haar, vierundzwanzig Stunden am Tag. Corrico hat schon vor dreißig Jahren massiv in den Klimaschutz und entsprechende Technologien investiert, als sich andere Firmen vor allem um Sonderregeln für die Emissionen ihrer Produkte bemüht haben und nur sehr zögerlich bereit waren, gegen den Klimawandel aktiv zu werden.«
»Das gab Ihnen und Ihrem Konsortium einen Wettbewerbsvorteil.«
»Zweifellos. Aber damals war es kein besonders lohnendes Geschäft, wenn man allein wirtschaftliche Maßstäbe anlegt. Heute sieht das etwas anders aus.« Chamberlain vollführte eine Geste, die den Solarkraftwerken galt. »Der Verkauf von sauberer Elektrizität deckt inzwischen unsere Kosten und bedeutet auch gutes Geld für die beteiligten Staaten, nicht nur hier in Afrika, sondern auch in Asien und Mittelamerika. Doch wie Sie wissen, bilden die erneuerbaren Energien nur einen kleinen Teil unseres Maßnahmenkatalogs. Um in wenigen Jahren den Schaden zu beheben, der seit Beginn der ersten industriellen Revolution auf der Erde angerichtet wurde, sind weitaus größere Anstrengungen nötig, und Geld lässt sich damit nicht verdienen. Ganz im Gegenteil. Die Entwicklung der notwendigen Technologien kostet, ebenso ihr Einsatz. Zum Glück haben wir die Unterstützung einzelner Staaten und insbesondere der UNO.«
Tayo Aneke nickte erneut. »Deshalb bin ich hier. Weil Sie mehr Unterstützung brauchen als bisher veranschlagt.«
»So ist es leider, Mister Secretary«, gestand Chamberlain. »Das Konsortium gerät an seine finanziellen Grenzen. Die Albedo-Satelliten haben mehr gekostet als vorgesehen, einige beteiligte Firmen schreiben seit Monaten rote Zahlen. Es stehen nicht nur viele Arbeitsplätze auf dem Spiel, auch entscheidende Fortschritte bei unseren Maßnahmen sind gefährdet. Wir haben eine Präsentation vorbereitet. Wenn Sie gestatten …«
»Ja«, sagte Aneke. »Ich habe genug von den Anlagen gesehen. Zeigen Sie mir die neuesten Zahlen. Erklären Sie mir, wie weit wir damit gekommen sind, die Welt zu retten.«
6
Im Präsentationssaal des Gebäudes, das sich langgezogen und mit Solarkollektoren ausgestattet neben einem der großen Absorber-Türme erstreckte, schien es noch etwas kühler zu sein als im Flugwagen.
Tayo Aneke trank heißen Kaffee und hörte geduldig zu, während Fachleute einzelne Projekte vorstellten und erläuterten. Mehr als zwanzig Männer und Frauen, viele von ihnen jung, hatten sich eingefunden, um ihm einen Eindruck vom Status quo zu vermitteln. Er folgte ihren Ausführungen, nickte freundlich, lächelte höflich und war, wenn nicht glücklich, so doch sehr zufrieden, denn alles deutete darauf hin, dass in seiner Amtszeit entscheidende Fortschritte bei der Bewältigung der Klimakrise erzielt wurden. Es gab eindeutig Licht am Ende des Tunnels; die langfristige oder sogar mittelfristige Lösung des Problems schien tatsächlich möglich.
»Unsere Albedo-Satelliten haben uns einen großen Schritt weitergebracht«, erklärte eine junge Australierin namens Joycelin. Sie war mal ernst und mal voller Freude, eine Mischung, die Aneke gefiel. »Ihre jeweils mehrere Hektar großen Segel aus ultraleichtem Material reflektieren das einfallende Licht, wodurch etwa sieben Prozent weniger Sonnenenergie die Erde erreicht. Diese sieben Prozent gelangen nicht in die Atmosphäre, tragen also auch nicht zur Erderwärmung bei. Wir haben dadurch gelegentlich Probleme mit dem amerikanischen Satellitennavigationssystem GPS, dem europäischen Galileo, dem chinesischen Beidou und Glonass von der Russischen Föderation, und hinzu kommen Verbindungsabbrüche bei Starlink von SpaceX, aber das ist ein geringer Preis, den wir für den Albedo-Erfolg zahlen, und die UN haben den betroffenen Firmen Schadenersatz versprochen.«
»Vor allem in Form von ehrenvoller Anerkennung«, kommentierte Aneke würdevoll.
Die jungen Männer und Frauen lachten, die etwas älteren Repräsentanten von Corrico und des Klimakonsortiums, unter ihnen Hudson Chamberlain, lächelten.
»Ich hoffe, dass wir mehr bekommen als nur Anerkennung.« Joycelin schmunzelte und richtete den Blick wieder auf die Unterlagen vor ihr. »Eine ebenso wichtige Rolle wie die Albedo-Satelliten spielen unsere Kohlendioxidsenken. Wir verwenden dabei insbesondere Basalt, ein Gestein, dass praktisch überall auf der Welt zur Verfügung steht. Basaltstaub hat sich als recht effektiv erwiesen, wenn es darum geht, der Atmosphäre CO2 zu entziehen und zu binden.«
Hudson Chamberlain hob die Hand.
»Mister Chamberlain«, sagte Joycelin.
Er nickte ihr zu und wandte sich dann direkt an Tayo Aneke. »Es genügt nicht zu verhindern, dass noch mehr CO2 und andere Treibhausgase wie Methan in die Atmosphäre gelangen. Wenn wir die weitere globale Erwärmung nicht nur aufhalten, sondern auch rückgängig machen wollen, um das Extremwetter zu bekämpfen, brauchen wir negative Emissionen. Dieser Punkt kann gar nicht oft genug betont werden. Wir müssen der Atmosphäre in großem Maßstab Treibhausgase entziehen.«
»Ich verstehe«, sagte Aneke geduldig.
»Was uns zum Geoengineering bringt«, fuhr die junge Joycelin mit melodischer Stimme fort. »Es gibt fünf Methoden, um den Anteil von Kohlendioxid in der Atmosphäre zu verringern. Durch Aufforstung, durch direkte Abscheidung aus der Luft mit Hilfe von Air-Capture, durch Trennung aus den Abgasen bei Biomasseverbrennung und durch chemische Verwitterung von Gestein. Wir wenden letztere Methode an und nutzen dabei die Reaktion von Silikatmineralen mit dem im Bodenwasser gelösten Kohlendioxid, wobei kohlenstoffhaltige Karbonate entstehen. Als Karbonat-Ionen gelangen sie schließlich in Flüsse und Meere, werden dort von schalenbildenden Organismen aufgenommen oder lagern sich in Sedimenten ab, wodurch das betreffende Kohlendioxid dauerhaft gebunden wird.«
Aneke fiel auf, dass sie von fünf Methoden gesprochen, aber nur vier erwähnt hatte.
Auf der großen Leinwand hinter Joycelin erschien eine graphische Darstellung. »Wir machen uns auf diese Weise den Silikat-Karbonat-Kreislauf zunutze, der zum natürlichen weltweiten Kohlenstoffkreislauf gehört und in der Geschichte der Erde schon mehrmals entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung des Klimas genommen hat. Er ist zum Beispiel die wahrscheinliche Ursache für die Vereisung der Antarktis. Schon vor der Zeit von Corrico und unseres Klimakonsortiums hat man Überlegungen angestellt, die Gesteinsverwitterung zu nutzen, und man dachte dabei vor allem an die Verwendung von Olivin. Wir hingegen arbeiten mit pulverisiertem Basaltgestein und schlagen dabei gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe.« Joycelin lächelte erneut.
Aneke mochte ihr offenes Lächeln. Sie war eine Frau, die fest an eine gute Zukunft glaubte, die sie selbst mitgestaltete.
»Ein Kilogramm Basaltstaub hat eine viel größere Oberfläche als dieselbe Masse in Form eines Steins. Und wir entziehen der Atmosphäre damit nicht nur Kohlendioxid, sondern düngen gleichzeitig den Boden für besseres Pflanzenwachstum. Rein theoretisch ließen sich auf diese Weise global etwa zweieinhalb Milliarden Tonnen Kohlendioxid pro Jahr aufnehmen, was etwa dem jährlichen CO2-Ausstoß von Indien entspricht. Wie gesagt, das ist ein theoretischer Wert, in der Praxis unerreichbar, weil wir nicht überall auf der Welt Basalt ausstreuen können. Und Basaltstaub hat einen Nachteil: Er wirkt nur mittelfristig, nicht unmittelbar oder zeitnahe. Es dauert fast fünfzig Jahre, bis er größtenteils verwittert ist, und so viel Zeit haben wir nicht.«
»Ich nehme an, hier kommt die fünfte Methode ins Spiel«, warf Aneke ein, als Joycelin eine Pause einlegte. »Sozusagen das Ass in Corricos Ärmel.«
Erneut lächelte Joycelin, wahrscheinlich weil Aneke damit bewies, wie aufmerksam er ihr zugehört hatte. »Mister Chamberlain«, sagte sie, »vielleicht möchten Sie das selbst übernehmen.«
Hudson Chamberlain stand auf, ging nach vorn und nahm den Platz der jungen Frau am Podium ein, die es für ihn geräumt hatte. Er drückte einige Tasten des Notebooks, und die graphische Darstellung des Silikat-Karbonat-Kreislaufs verschwand von der Leinwand. Dafür erschien eine Wiesenlandschaft mit vielen Blumen und aufsteigenden bunten Luftballons.
»Corrico hat lange an einer Methode gearbeitet, mit der sich das Kohlendioxid in der Atmosphäre in chemisch neutralen Staub umwandeln lässt. Ich nenne sie WMDT: Weg mit dem Treibhausgas.« Das rief ein allgemeines Schmunzeln hervor. »Unsere Wissenschaftler sprechen von KOSA, von ›Kohlenstoff-Sauerstoff-Aktuatoren‹. Das Agens, der Wirkstoff, muss nicht von Satelliten oder Flugzeugen verteilt werden, deren Einsatz Treibstoff verbraucht und somit nicht emissionsfrei ist. Bis zur Stratosphäre aufsteigende Ballons genügen völlig. Selbst kleine Mengen des Wirkstoffs können große Mengen Kohlendioxid neutralisieren.«
Chamberlain sah vom Pult auf und begegnete Anekes aufmerksamem Blick.
»KOSA ist unsere neueste und wirksamste Waffe gegen den Klimawandel. Vor wenigen Jahren galt der Kampf als verloren, aber ich sage Ihnen: Wir werden ihn gewinnen. Wir versprechen Ihnen das Ende der Klimakrise in zehn Jahren, Mister Secretary. Und innerhalb von zwei Jahrzehnten können wir die Atmosphäre unseres Planeten in den Zustand zurückversetzen, den sie zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts hatte. Die Gletscher werden nicht weiter abschmelzen. Die Atlantische Umwälzströmung AMOC, zu der auch der Golfstrom gehört, dem Mittel- und Nordeuropa ein vergleichsweise mildes Klima verdanken, wird sich wieder stabilisieren. Die globalen Durchschnittstemperaturen werden sinken. Extremwetter werden nachlassen. Die Wüsten in den Subtropen werden bald wieder fruchtbar sein. Mit anderen Worten, Mister Secretary: Wir sind tatsächlich auf dem besten Weg, die Welt zu retten.«
7
Im Empfangssaal gab es ein kaltes Buffet und eine Bar, Kellner schritten umher und boten den Gästen eisgekühlten Sekt an. Tayo Aneke bevorzugte Orangensaft und fragte sich, ob er nach draußen auf die Terrasse gehen sollte, um den Journalisten und der Kühle zu entkommen. Er nickte freundlich, nahm Glückwünsche entgegen, ertrug den üblichen Smalltalk und nahm die Bemerkungen von zwei oder drei Politikern hin, die sich bei ihm einschmeicheln wollten.
Schließlich erschien Chamberlain an seiner Seite. »Sie sehen wie jemand aus, der sich nach Rettung sehnt«, sagte er. »Kommen Sie.«
Er führte Aneke durch einen kleinen Flur in ein Arbeitszimmer mit grauem Schreibtisch, einem PC und Bildern an den Wänden, die einzelne Bauphasen der Solarkraftwerke zeigten. In der Ecke standen ein runder Tisch aus Holzimitat und zwei Sessel.
Chamberlain deutete auf einen davon und sank in den anderen. »Ihnen war’s zu kalt, nicht wahr? Und Sie haben all das Gerede satt.«
Tayo Aneke seufzte und stellte das Glas Orangensaft, das er mitgenommen hatte, auf den Tisch. »Manche Menschen versuchen, zu viel Wärme mit zu viel Kälte zu kompensieren.«
Chamberlain lehnte sich zurück und faltete die Hände im Schoß. »Wenn ich fragen darf, Mister Secretary … Wie sind Ihre Eindrücke?«
»Ich hoffe, Sie haben recht«, erwiderte Aneke. »Es klang einfach und sehr optimistisch.«
»Oh, ich bin sehr optimistisch, aber einfach war und ist das alles bestimmt nicht. Es handelt sich um ein riesiges Projekt, vermutlich das größte, das die Menschheit bisher unternommen hat, und es besteht aus zahlreichen einzelnen Maßnahmen. Jede von ihnen leistet einen eigenen kleinen Beitrag, und zusammen ergeben sie eine große Wirkung. KOSA ist gewissermaßen die Krönung. Wir schaffen es. In zehn Jahren haben wir das Gröbste hinter uns.«
»Aber?«, fragte Aneke.
Chamberlain lächelte. »Insbesondere die Entwicklung der Kohlenstoff-Sauerstoff-Aktuatoren war sehr teuer, und das gilt auch für ihre Produktion. Von den anderen Maßnahmen, die wir Ihnen vorgestellt haben, ganz zu schweigen. Corrico und das Klimakonsortium haben viel Geld investiert, doch in diesem besonderen Fall sind da keine Kunden, mit denen wir Einnahmen generieren können. Wir bieten kein Produkt für den Verkauf in Supermärkten an.«
»Sie bitten um weitere finanzielle Unterstützung.«
»Wir brauchen mehr Kapital, Mister Secretary«, sagte Chamberlain offen. »Wir sind inzwischen an unsere finanziellen Grenzen gestoßen. Es stehen, wie Sie wissen, auch viele Arbeitsplätze auf dem Spiel. Ich möchte niemanden, nicht eine einzelne Person, entlassen müssen.«
»Die Welt ist Ihnen zu Dank verpflichtet«, erklärte Aneke. »Ich werde sehen, was ich tun kann.«
»Das weiß ich sehr zu schätzen, Mister Secretary. Ich habe Ihrem Büro eine Aufstellung unserer Kosten zukommen lassen.«
Tayo Aneke erhob sich. »Ich glaube, ich sollte mich allmählich auf den Rückweg machen.«
Chamberlain stand ebenfalls auf. »Einer unserer Kopter steht für Sie bereit.« Er ging zur Tür. »Ich begleite Sie.«
Einige Minuten später, als der große Flugwagen in einer Höhe von mehreren hundert Metern über die Sonnenkollektoren und Solarpanels hinwegflog, empfing Tayo Anekes Smartphone eine verschlüsselte Nachricht über die sichere Verbindung. Er holte es hervor und öffnete den Messenger.
Die Mitteilung stammte von seinem Assistenten Ismail, der in Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott auf ihn wartete. Sie war als dringend gekennzeichnet und lautete: »Wir haben ein Problem.«
8Hudson Chamberlain
Wüste von Mauretanien
Auf der Terrasse war es selbst im Schatten heiß, aber ein leichter Westwind machte die Hitze erträglicher. Chamberlain sah dem Kopter nach, der den Generalsekretär der Vereinten Nationen nach Nouakchott brachte.
Hinter ihm öffnete sich die Tür, und für einige Sekunden drang das Stimmengewirr im Empfangssaal nach draußen. Dann wurde die Tür wieder geschlossen.
Jemand näherte sich, Chamberlain hörte leichte, leise Schritte.
»Es ist gut gelaufen, glaube ich«, sagte Joycelin. Sie trat neben ihn.
»Du hast gut gesprochen«, erwiderte er.
Sie lächelte, er sah es aus dem Augenwinkel.
»Wird er uns unterstützen?«, fragte Joycelin.
»Das wird er, kein Zweifel. Immerhin haben wir die Welt gerettet, nicht wahr?«
»Fast.«
»Es ist schon jetzt viel besser geworden«, meinte Chamberlain. »In zwanzig Jahren haben wir alles überstanden.«
Die junge Australierin nickte. »Es wäre schön, wenn wir mehr Geld damit verdienen könnten.«