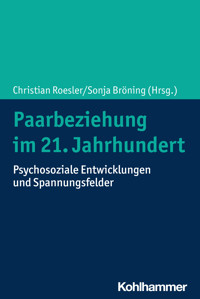
Paarbeziehung im 21. Jahrhundert E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wie gestaltet sich Paarbeziehung heute angesichts hoher Scheidungsraten, abnehmender Bindungsfähigkeit, technologischer Entwicklungen (Online-Dating, Sexroboter) und neuer Beziehungsformen? Der Band diskutiert Grundlagen und aktuelle Entwicklungen in der Psychologie und Soziologie von Paarbeziehungen und untersucht die Auswirkungen gesellschaftlicher Diskurse sowie technologischer Neuerungen auf die Erscheinungsformen und gelebte Praxis von Paarbeziehung. Es zeigen sich zahlreiche Spannungsfelder, für die die AutorInnen sowohl auf Gewinne als auch auf Risiken hinweisen und Lösungsvorschläge entwickeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
I Grundlagen
1 Einleitung: Paarbeziehung im 21. Jahrhundert: Vielfalt – und Verunsicherung?
Literatur
2 Entwicklungspsychologische Perspektiven auf Paarbeziehungen
2.1 Psychologische Perspektiven auf Paarbeziehungen
2.2 Einfluss von Bindung auf Paarbeziehungen
2.3 Einfluss von Attraktion und sexuellem Begehren auf die Paarbeziehung
2.4 Entwicklungsperspektiven auf Partnerschaft
2.4.1 Das Fundament der Liebe – Kindheit und Jugend
2.4.2 Erwachsen werden: Partnerwahl und Institutionalisierung der Liebe
2.4.3 Erwachsen sein: Familiengründung und das Leben in der festen Partnerschaft
2.4.4 Übergänge, Trennungen und Neuanfänge
2.4.5 Paarbeziehung im höheren Erwachsenenalter
2.5 Schlussfolgerungen und Fazit
Literatur
3 Biologisch angelegt und sozial konstruiert. Biokulturelle Grundlagen der spätmodernen Paargesellschaft
3.1 Liebe und Paarbindung: Ein Teil unseres evolutionären Erbes
3.2 Biokulturelle Doppelnatur des Menschen
3.3 Verbindlichkeit und Exklusivität: Spätmoderne Neukonstruktionen des Liebens
3.4 Fazit
Literatur
II Gesellschaftliche Entwicklungen
4 Die Zukunft von Sexualität und Beziehung im 21. Jahrhundert: Wo stehen wir und wo wollen wir sein?
4.1 Highlights aus der Vergangenheit/Erinnerungen an die Arbeit früher Pioniere
4.2 Soziopolitische Determinanten sexueller Freiheit, sexuellen Ausdrucks und sexueller Erfahrungen
4.2.1 Soziale Faktoren
4.2.2 Sex, Lust und Beziehungen
4.2.3 Wirtschaftliche Faktoren und Klimawandel
4.2.4 Unfruchtbarkeit
4.2.5 Medikalisierung und der Einfluss der Technologie auf die Sexualität
4.3 »Wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.« (Santayana, 1905)
4.4 Wie können wir eine positive Vision für die Zukunft schaffen?
4.5 Schlussfolgerung
Literatur
5 Radikale Diskurse, aber (ziemlich) konventionelle Praxis? Versuch einer Analyse der gesellschaftlichen Diskurse um Paarbeziehung
5.1 Eine Geschichte von Entkoppelungen
5.1.1 Die institutionalisierte Beziehungsform: Das goldene Zeitalter der Ehe
5.1.2 Mononormativität und Heteronormativität
5.1.3 Deinstitutionalisierung: Entkoppelung von Liebesbeziehung und Sexualität einerseits und Ehe/Elternschaft andererseits
5.1.4 Die reine Beziehung oder absolute Liebesbeziehung
5.1.5 Überhöhung – und Überforderung der Paarbeziehung?
5.1.6 Krise der romantischen Beziehung
5.1.7 Neosexualitäten, Grenzüberschreitungen und sexueller Konsens
5.1.8 Neue Unübersichtlichkeit: Paradoxa und Widersprüche
5.2 Flucht vor Intimität
5.3 Zwischenfazit
5.4 Ist also die Monogamie am Ende?
5.4.1 Die Frage der Verbindlichkeit
5.4.2 Polyamore und/oder offene Beziehungsformen
5.5 Zur Komplementarität des Geschlechterverhältnisses: Naturgegeben oder sozial konstruiert?
5.5.1 Biokulturelle Argumentation
5.5.2 Geschlechtsidentitäten: Diversity vs. Machbarkeitswahn
5.5.3 Unzeitgemäße Betrachtungen
5.6 Die Suche nach der wahren Identität
5.6.1 Das Narrativ von der Befreiung
5.6.2 Gleichzeitigkeit von Bedürfnissen nach Selbstverwirklichung und nach Zweisamkeit
5.7 Wie steht es überhaupt um Paarbeziehungen?
5.7.1 Populationsstatistische und sozialwissenschaftliche Fakten und Daten
5.7.2 Differenz zwischen Diskursen und konventioneller Praxis
5.8 Fazit: einerseits Sehnsucht, andererseits Skepsis
Literatur
6 Love has no boundaries: Die Vielfalt der Liebes- und Sexualbeziehungen
6.1 Die (schwindende) Dominanz monogamer Beziehungen
6.2 Vielfalt der Beziehungsmodelle
6.3 Einvernehmlich nicht-monogame Beziehungen
6.4 Thinking outside the box: Fluidität im sexuellen Begehren
6.5 Kurzes Resümee
Literatur
III Technologisierung
7 Bedeutung, Gefahren und Chancen von mobilem Online-Dating im Kontext von Partnersuche und Beziehungen
7.1 Onlinedating und Gesundheit
7.2 Datingpraxis im Wandel
7.3 Bedeutung und Effekte des Mobilen Online-Dating für Subjekte, Beziehungen und Gesellschaft
7.3.1 Mobile-Dating-Applikationen und die digitale Architektur
7.3.2 Nutzungsverhalten
7.3.3 Das Selbst und die Anderen
7.3.4 Hyperstimulation, Langeweile und Tindersex
7.3.5 Chancen und positive Effekte vom mobilen Online-Dating
7.3.6 Das Ringen mit MODA
7.3.7 MODA entgrenzen sich
7.3.8 Mobiles Online-Dating ist (nicht) anders
7.3.9 Marginalisierte Gruppen und gefährdete Subjekte
7.4 Implikationen
7.4.1 Zwischen Gefährdung und Chancen
7.4.2 Implikationen für die therapeutische Praxis
Literatur
8 Chancen und Probleme digitaler Mediennutzung in bestehenden Partnerschaften
8.1 Chancen
8.1.1 Medienunterstützte Binnenkommunikation
8.1.2 Sexualität
8.1.3 Hilfe bei Beziehungsproblemen
8.2 Probleme
8.2.1 Online-Eifersucht
8.2.2 Cybersexsucht des Partners
8.3 Diskussion
Literatur
9 Überlegungen zu Zweier- und Dreierbeziehungen mit Liebespuppen und Sexrobotern
9.1 Einleitung
9.2 Merkmale von Zweierbeziehungen
9.3 Liebespuppen, Sexroboter und Cyborgs
9.3.1 Liebespuppen
9.3.2 Sexroboter
9.3.3 Cyborgs und umgekehrte Cyborgs
9.4 Beziehungen zu Liebespuppen, Sexrobotern und Cyborgs
9.4.1 Zweier-, Dreier- und Viererbeziehungen
9.4.2 Nichtaustauschbarkeit und Langfristigkeit
9.4.3 Kommunikation
9.4.4 Symbolische Interaktion und partnerschaftliche Semantik
9.4.5 Bezug zum Geschlecht
9.4.6 Ausübung von Sexualität
9.4.7 Verbindlichkeit und Vertrauenswürdigkeit
9.4.8 Zuwendung, Zuneigung und Liebe
9.4.9 Machtausübung
9.4.10 Ritualisierung
9.4.11 Kolokalität und Koresidenz
9.5 Diskussion
9.6 Die Realität der Beziehungen
9.7 Zusammenfassung und Ausblick
Literatur
IV Ausblick
10 Paartherapie und die Versorgung von Paarproblemen: Gegenwart und Zukunft
10.1 Scheidung und ihre Folgen
10.2 Paarbeziehung und Gesundheit
10.3 Paartherapie im deutschen Versorgungssystem
10.4 Überblick über die Wirkungsforschung zur Paartherapie
10.5 Verbesserte Kommunikation verbessert nicht die Paarbeziehung
10.6 Wirkfaktoren der Paartherapie: Ist Integration immer gut, und wenn ja, welche Art von Integration?
10.7 Ein forschungsbasiertes Modell von Paarbeziehung und Paardynamik
10.7.1 Paarinteraktionsforschung von John Gottman
10.7.2 Neuroaffektive Theorie
10.7.3 Mentalisierung und der Switchpoint
10.7.4 Paarbeziehungen als Bindungsbeziehungen – der Beitrag der Bindungstheorie
10.8 Konsequenzen für die Praxis der Paartherapie
10.9 Paarbeziehungen als Bindungsbeziehungen: Die Integration der Bindungstheorie in neuere Paartherapiemodelle
10.10 Integration bindungstheoretischer Erkenntnisse in die psychodynamische Paartherapie
10.11 Manualisierte Paartherapieansätze
10.12 Mentalisierungsbasierte Paartherapie
10.13 Emotionsfokussierte Paartherapie
10.14 Wirksamkeit in der realen Praxis geringer
10.15 Paartherapie bei psychischen und körperlichen Erkrankungen
10.16 Wie lässt sich die begrenzte Wirksamkeit von Paartherapie in der Praxis erklären?
10.17 Prävention
10.18 Innovative Strategien zur Verbreitung von Präventionsangeboten
10.19 Eine Zukunftsvision
Literatur
11 Epilog zum Herausgeberband »Paarbeziehung im 21. Jahrhundert:« Spannungsfelder und Entwicklungsperspektiven
11.1 Diversitätsdebatten
11.1.1 Sehnsucht nach Eindeutigkeit und Identität
11.1.2 Diversität: Sehnsucht nach Akzeptanz und Zugehörigkeit
11.1.3 Sehnsucht nach Singularität bei wachsender Sensibilität
11.1.4 Zwischenfazit zum Spannungsfeld 1: Diversität
11.2 Diversität: Entwicklungsperspektiven
11.2.1 Stärkung von Vielfalt: Diversität ist unteilbar
11.2.2 Liebe und Partnerschaft: Von der Vielfalt lernen
11.2.3 Prävention, Beratung und Therapie: Vielfalt integrieren
11.3 Technologisierung: Schaffung neuer Beziehungsoptionen oder Deformierung menschlicher Beziehungen?
11.3.1 Schattenseiten der Technologisierung von Beziehungen
11.3.2 Einflüsse der Technologie auf Partnerwahl und Beziehungsdynamik
11.3.3 Zwischenfazit zum Spannungsfeld 2: Technologisierung
11.4 Technologisierung: Entwicklungsperspektiven
11.4.1 Handlungsfähigkeit im Umgang mit der Technologie
11.4.2 Rehabilitierung physischer Begegnungsmöglichkeiten
11.5 Selbstverwirklichung: (Wie) Ist sie mit dauerhafter Bezogenheit vereinbar?
11.5.1 Der Reiz des Neuen als Trennungsgrund – sind »offene Beziehungen« die Lösung?
11.6 Langzeitbeziehung: Entwicklungsperspektiven
11.6.1 Neue Beziehungsmodelle rufen zu reflektierter Beziehungsgestaltung auf
11.6.2 Ein Plädoyer für den langen Atem
11.6.3 Langzeitperspektiven für Paare
11.7 Individuelle Lebensentwürfe – wie passen sie zur Verantwortung für Kinder?
11.8 Verantwortung für Kinder: Entwicklungsperspektiven
11.8.1 Beziehungskompetenz
11.8.2 Müssen Scheidungen über ein juristisch-streitiges Verfahren laufen?
11.9 Schlusspunkt
Literatur
V Verzeichnisse
Autorinnen- und Autorenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Der Herausgeber und die Herausgeberin
Prof. Dr. Christian Roesler, Prof. Dr. habil. Dipl.-Psych., Psychologischer Psychotherapeut, Psychoanalytiker (C. G. Jung-Institut Zürich) ist Professor für Klinische Psychologie an der Katholischen Hochschule Freiburg und für Analytische Psychologie an der Fakultät für Psychologie der Universität Basel sowie Privatdozent für Psychotherapiewissenschaft an der Sigmund-Freud-Universität Linz. Dozent an den C. G. Jung-Instituten Zürich und Stuttgart sowie Lehranalytiker am Aus- und Weiterbildungsinstitut für Psychoanalytische und Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg (DGPT). Privatpraxis für Analytische Psychotherapie und Paartherapie in Freiburg.
Prof. Dr. Sonja Bröning, Prof. Dr. phil., ist Professorin für Entwicklungspsychologie an der Medical School Hamburg (MSH) und Systemische (Sexual-)Therapeutin (DGSF, DGfS) sowie Mediatorin (BM) in freier Praxis. Sie forscht und lehrt zum Einfluss digitaler Medien auf intime Beziehungen sowie zu den vielfältigen Erscheinungsformen von Partnerschaft, Liebe und Sexualität. Ein Schwerpunkt ihrer paartherapeutischen Praxis liegt auf der Arbeit mit queeren und nicht-monogamen Beziehungen.
Christian RoeslerSonja Bröning
Paarbeziehung im 21. Jahrhundert
Psychosoziale Entwicklungen und Spannungsfelder
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Pharmakologische Daten, d. h. u. a. Angaben von Medikamenten, ihren Dosierungen und Applikationen, verändern sich fortlaufend durch klinische Erfahrung, pharmakologische Forschung und Änderung von Produktionsverfahren. Verlag und Autoren haben große Sorgfalt darauf gelegt, dass alle in diesem Buch gemachten Angaben dem derzeitigen Wissensstand entsprechen. Da jedoch die Medizin als Wissenschaft ständig im Fluss ist, da menschliche Irrtümer und Druckfehler nie völlig auszuschließen sind, können Verlag und Autoren hierfür jedoch keine Gewähr und Haftung übernehmen. Jeder Benutzer ist daher dringend angehalten, die gemachten Angaben, insbesondere in Hinsicht auf Arzneimittelnamen, enthaltene Wirkstoffe, spezifische Anwendungsbereiche und Dosierungen anhand des Medikamentenbeipackzettels und der entsprechenden Fachinformationen zu überprüfen und in eigener Verantwortung im Bereich der Patientenversorgung zu handeln. Aufgrund der Auswahl häufig angewendeter Arzneimittel besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2024
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-041464-8
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-041465-5epub: ISBN 978-3-17-041466-2
I Grundlagen
1 Einleitung: Paarbeziehung im 21. Jahrhundert: Vielfalt – und Verunsicherung?
Christian Roesler und Sonja Bröning
Dieses Buch entstand in einer Zeit erheblicher Verunsicherung, geprägt durch Corona-Pandemie, Klimawandel, Ukraine-Krieg und die sich abzeichnende Energie-Krise. Bestehende Quellen menschlichen Unglücks wie Leistungsdruck in der Arbeitswelt, soziale Ungleichheit und das Wegbrechen sozialen Zusammenhalts in familiären und religiösen Gemeinschaften werden hierdurch verschärft. Diese und weitere global relevante Entwicklungen werfen Fragen auf. Worauf ist in der Gegenwart Verlass? Wohin soll die Zukunft gerichtet werden? Und: Wie soll der Mensch so glücklich werden? In unserer individualistischen Gesellschaft ist jeder seines Glückes Schmied. Und nach wie vor zählt Paarbeziehung für die meisten Menschen in unserer Kultur zu der wichtigsten Quelle von Zufriedenheit und Lebensglück. Für junge Menschen ist Familie auch 2019 noch die mit Abstand wichtigste Wertorientierung (18. Shell-Jugendstudie; Albert et al., 2019). Und nicht nur in der Wunschvorstellung, sondern auch empirisch haben gelingende Paarbeziehungen eine enorme Bedeutung für die psychische und körperliche Gesundheit der Partner sowie, wenn Kinder vorhanden sind, für deren Entwicklung. Daher erscheint es nicht verwunderlich, dass Liebe und Partnerschaft keineswegs am Ende sind, wie von manchen angesichts sinkender Heiratsneigung und hoher Scheidungsraten befürchtet (Mortelmans, 2020). Auch wenn der Anteil der nicht-ehelichen Partnerschaften gegenüber den Ehen in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen hat, lebt praktisch jeder zweite in einer Partnerschaft im gemeinsamen Haushalt (Horn, 2021). Seit 2015 lässt sich sogar ein kontinuierlicher Anstieg der Eheschließungszahl feststellen, während gleichzeitig die Zahl der Scheidungen sinkt (ebenda). Auch die Ehe für Alle hat zu dieser Entwicklung beigetragen, die von manchen als Renaissance von Heirat und Ehe betrachtet wird. Allerdings sind die Trennungsraten nicht-verheirateter Paare nicht erfasst, so dass diese Aussage mit Vorsicht zu betrachten ist. Auf europäischer Ebene lässt sich jedenfalls feststellen, dass die Beziehungsstabilität abgenommen hat und weiter abnimmt (Mortelmans, 2020).
In Spannung zueinander stehen bei Trennungsüberlegungen bei Paaren mit Kindern häufig die Bedürfnisse betroffener Kinder nach Stabilität und Kontinuität mit dem Diktat der Individualisierung, d. h., den Bedürfnissen der Erwachsenen nach Neuanfang und Weiterentwicklung, danach, ihr persönliches (Liebes-)Glück zu finden und ihrer Wege zu ziehen. Doch auch die Belastungen für Erwachsene, die aus einer Trennung entstehen, sind – je nach familiären Ressourcen – häufig weitreichend, was im Vorwege einer solchen Entscheidung nicht immer bedacht wird. Vieles spricht für eine Aufwertung von Langzeitbeziehungen und die Überwindung partnerschaftlicher Schwierigkeiten. Dies steht jedoch im Kontrast zur schlechten Versorgungslage im Bereich Paarprävention und -therapie in Deutschland. Der Ausbau schulischer und außerschulischer präventiver Förderung von Beziehungskompetenzen erscheint ebenfalls dringend geboten. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie verschärfen diesen Bedarf noch. Familien mit geringen Ressourcen waren von den Einschränkungen im Bereich Beruf, Kinderbetreuung und Schule besonders betroffen (Bröning & Clüver, 2022), und es gibt Hinweise auf erhöhte Partnerschaftskonflikte und -gewalt in dieser Zeit. Die psychische Mehrbelastung von Kindern und Jugendlichen durch die Pandemie ist bereits evident (Ravens-Sieberer et al., 2021), was nicht nur die Gefahr von Kindeswohlgefährdung im häuslichen Setting erhöht, sondern auch für die beginnenden Liebesbeziehungen dieser Generation ein Gefährdungspotenzial darstellen dürfte.
Während durch alle Gesellschaftsschichten hindurch auch weiterhin geliebt, geheiratet und getrennt wird, verändern sich kulturelle Vorstellungen darüber, wie Paarbeziehung gestaltet sein sollte, und auch die gelebte Praxis aktuell in teilweise rasantem Tempo. Ein Grund hierfür ist die Technologisierung. So kommt ein erheblicher Prozentsatz der Paarbeziehungen auch in Deutschland mittlerweile über digitale Kontaktplattformen zustande. Online Dating ist mittlerweile nicht nur quantitativ ein Massenphänomen geworden, sondern darüber hinaus eine gesellschaftlich akzeptierte Form der Kontaktanbahnung (Aretz et al., 2017). Allerdings wird dies von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, z. B. unterschiedlichen Altersgruppen, sehr unterschiedlich genutzt, und mit einigen Nutzungsformen scheinen auch Gefahrenpotenziale verbunden. Auch etablierte Paarbeziehungen pflegen mittlerweile ihren Kontakt über digitale Medien und virtuelle Kanäle, nicht nur in beruflich bedingten Fernbeziehungen. Sie erleben ebenfalls Gewinne, aber auch Risiken der Medien, wie die Möglichkeit, den anderen online zu stalken und zu kontrollieren. Durch technologische Weiterentwicklungen ist mittlerweile sogar virtueller Sex möglich. Künstliche Sexpuppen werden mit künstlicher Intelligenz ausgestattet und werden zu Sexrobotern, wobei die gelebte Praxis zeigt, dass zu diesen künstlichen Wesen tatsächlich auch romantische Beziehungen entstehen.
»Eine enge, verbindliche und auf Dauer angelegte Beziehung zweier Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechtes, die sich durch eine besondere Zuwendung auszeichnet und die Praxis sexueller Interaktion einschließt.« (Lenz, 2003, S. 16)
»Eine Paarbeziehung ist eine enge, persönliche und intime, auf Dauer angelegte, exklusive Beziehung zwischen erwachsenen Personen unterschiedlichen oder gleichen Geschlechts. Typischerweise zeichnet sich eine Paarbeziehung durch Liebe, persönliches Vertrauen und sexuelle Interaktion aus.« (Huinink & Konietzka, 2007)
»Paarbeziehungen werden als Institution einer sozialen Beziehung zweier Personen verstanden, welche auf Reziprozität sowie individueller Einzigartigkeit fußt und über ein relativ hohes Maß an Verbindlichkeit, Dauerhaftigkeit, Exklusivität und Zuwendung, Interdependenz sowie Affektivität charakterisiert ist. Dabei gehen die Partner in diese thematisch unbegrenzte diffuse Sozialbeziehung als ganze Person ein und nicht nur begrenzt auf eine soziale Rolle.« (Wutzler & Klesse, 2021, S. 23)
Und hier im Kontrast dazu eine aktuelle Definition, die versucht, den vielfältig aufgebrochenen postmodernen Diskursen um Paarbeziehung gerecht zu werden:
»Deshalb schlage ich vor, weiterhin auf Basis der konstitutiven Reziprozität der Partner und der praktischen Prozesshaftigkeit des Sozialen, Paarbeziehungen als gesellschaftliche Institution einer Beziehung zwischen zwei Personen zu verstehen, die ein hohes Potenzial dahingehend aufweist, das zwei Personen reziprok unter den Möglichkeitsbedingungen der je historischen und sozialen Titulierung – der gesellschaftlichen Ordnung der Intimität – ein hohes Maß an Intimität herausbilden und unterschiedliche Dimensionen der Intimität in verschiedenen Weisen und hinsichtlich unterschiedlicher Solidarität assoziieren. Daraus kann keine normative Überlegenheit einer Paarbeziehungsform abgeleitet werden und anstatt einer präskriptiven starren Grenzziehung sind die Übergänge und Verbindungen zu anderen Beziehungen zunächst diffus, denn sie müssen praktisch gezogen und gelebt werden. Aus der je konkreten Praxis und Potentialitätsentfaltung geht eine Eigenkomplexität als Paar hervor.« (Wutzler, 2021, S. 37)
Das Ende des Spektrums bilden Positionen, die die Begriffe Paarbeziehung und Paartherapie ohnehin angesichts möglicher polyamorer Konstellationen für ein Auslaufmodell halten.
Die oben beschriebenen Entwicklungen werfen eine ganze Reihe von Fragen auf, die nicht nur für einen akademischen Diskurs interessant sind, sondern große Relevanz für die gelebte Praxis von Paarbeziehung, für Paartherapie und -beratung sowie die gesellschaftliche Entwicklung insgesamt haben. Einige wichtige seien hier genannt: Wie verändern sich Liebesbeziehungen durch aktuelle Entwicklungen im Bereich Digitalisierung, Technisierung, neuer Beziehungsvorstellungen, Individualisierung etc.? Was können mögliche Gewinne sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene sein, wo liegen vielleicht aber auch Risiken bzw. zeichnen sich problematische Entwicklungen ab? Sind diese Entwicklungen und die dabei entstehenden neuen Beziehungsformen dem Menschen gemäß? Gibt es nicht auch eine biologische Grundlage von Paarbeziehung? Oder sind Formen von Paarbeziehungen grundsätzlich sozial konstruiert und können insofern durch neue soziale Entwicklungen auch verändert, neu geschaffen oder abgeschafft werden? Wie entwickeln sich junge Menschen in diese Vielfalt von Beziehungsmodellen hinein? Woran orientieren sich heutige Paare bei der Frage, was sie als gelingende Beziehung und als befriedigende Sexualität erleben – Pornographie, Beziehungsratgeber, Präventionsprogramme, kirchliche Ehevorbereitungsseminare? Was bedeutet das für den Bereich der Erziehung? Bilden bestehende sexualpädagogische Programme die sich abzeichnende Vielfalt angemessen ab? Inwiefern verändern diese Entwicklungen die Anforderungen an den Bereich der beraterischen und therapeutischen Intervention? Und nicht zuletzt: welche zusätzlichen Kenntnisse und Kompetenzen müssen Berater und Paartherapeuten heute besitzen, um die auftauchenden Anfragen angemessen versorgen zu können?
Der hier vorgestellte Band stellt den Versuch dar, die Wirklichkeit von Paarbeziehung und sich abzeichnende Entwicklungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts möglichst realistisch wiederzugeben, sowohl in ihrer Vielfalt in der gelebten Praxis als auch die sich darum gruppierenden Diskurse, theoretischen Konzepte, Debatten und gesellschaftlichen Bewegungen. Wir wollen einen wissenschaftlichen Überblick geben über neue Beziehungsformen und -modelle, die gelebte Praxis von Paarbeziehung und Sexualitäten sowie die Einflüsse von Digitalisierung, Technisierung und Individualisierung. Dies verbindet sich jeweils mit der Frage, wie sich Paarbeziehung in diesen Feldern entwickelt, welche Problemstellungen dadurch entstehen bzw. auch welche neuen Möglichkeiten gewonnen werden. Hierfür reicht die Beschränkung auf eine Wissenschaft allein (wie es z. B. manche Soziologen für die soziologische Beschreibung der aktuellen Paarbeziehungslandschaft fordern) nicht aus. Natürlich sind die gelebte Praxis von Paarbeziehung sowie die Vorstellungen, die Individuen in einer Gesellschaft darüber im Kopf haben, durch gesellschaftliche Prozesse, Werthaltungen, Idealisierungen und Normen beeinflusst. Ebenso wird die Realität von Paarbeziehungen aber auch durch psychologische Grundbedürfnisse bestimmt, die sich allein durch gesellschaftswissenschaftliche Konzepte nicht beschreiben lassen. Wir sind der Auffassung, dass man die Formen, in denen sich Paarbeziehung heute findet, nicht auf allein soziale Konstruktionen reduzieren kann, sondern sie sozusagen eine anthropologisch-biologische Grundlage haben. Daher wollen wir in diesem Herausgeberband viele Perspektiven zu Wort kommen lassen und diese in eine interdisziplinäre Betrachtung darüber münden lassen, wie sich die gelebte Praxis als auch die Vorstellungen von Paarbeziehung in einer konkreten Gesellschaft wie der unseren zu Beginn des 21. Jahrhunderts gerade aus dem Wechselspiel der genannten Kräfte gestaltet.
Die Kapitel und ihre Inhalte
Wir sind froh über die vielfältigen und differenzierten Beiträge dieses Bandes. Diese spannen den Bogen von den Grundlagen menschlicher Paarbeziehungen, über neuere gesellschaftliche Entwicklungen im Bereich Liebe, Partnerschaft und Sexualität, über Trends im Bereich der Technologisierung bis hin zu einem Ausblick in die Zukunft von Paarbeziehungen. Die in den Kapiteln vertretenen Auffassungen sind vielfältig und spiegeln nicht immer die Meinung der Herausgeber wider. Fast ebenso vielfältig wie die Beiträge sind die dort vertretenden Varianten des Umgangs mit der Genderproblematik in Texten. Wir haben dies bewusst nicht vereinheitlicht, sondern möchten jedem Autor, jeder Autorin die Freiheit lassen, dies nach Gutdünken zu gestalten. Wir weisen darauf hin, dass beim Verzicht auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung dies aus Gründen der besseren Lesbarkeit geschah. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.
I Grundlagen
Psychologische Perspektive: Paardynamik über die Lebensspanne (S. Bröning und S. Walper)Was macht Menschen in intimen Beziehungen glücklich oder unglücklich? Sonja Bröning und Sabine Walper stellen aktuelle Forschungsbefunde vor und beziehen dabei auch neurobiologische Erkenntnisse mit ein.
Biologisch angelegt und sozial konstruiert. Biokulturelle Grundlagen der spätmodernen Paargesellschaft (T. Müller-Schneider)Ist eine bestimmte Form von Paarbeziehung biologisch präformiert? Thomas Müller-Schneider (s. a. 2019) präsentiert in seinem Beitrag eine detaillierte Darstellung einer biokulturellen Theorie der Paarbeziehung.
II Gesellschaftliche Entwicklungen
Die Zukunft von Sexualität und Beziehung im 21. Jahrhundert: Wo stehen wir und wo wollen wir sein? (P. J. Kleinplatz, M. Charest, H. DiCaita und K. Rayne)Der Beitrag der kanadischen Autorinnen Peggy J. Kleinplatz, Maxime Charest, Hailey DiCaita & Karen Rayne skizziert wichtige Herausforderungen und Entwicklungen des 21. Jahrhunderts: Von existenziellen Bedrohungen wie der Klimakrise bis hin zu Erfreulichem wie dem gesetzlichen Schutz für sexuelle und geschlechtliche Minderheiten.
Radikale Diskurse, aber (ziemlich) konventionelle Praxis? Versuch einer Analyse der gesellschaftlichen Diskurse um Paarbeziehung (C. Roesler)In seiner Übersicht über gesellschaftliche Diskurse beschreibt Christian Roesler maßgebliche Veränderungen hinsichtlich der gesellschaftlichen Konstruktion von Paarbeziehung in den letzten Jahrzehnten.
Love has no boundaries: Die Vielfalt der Liebes- und Sexualbeziehungen (A. Mazziotta und B. Möller-Kallista)Die Vielfalt der Liebes- und Sexualbeziehung, die (schwindende?) Dominanz der Monogamie und alternative Gestaltungsmöglichkeiten von Partnerschaft sind Themen des Beitrags von Agostino Mazziotta und Birgit Möller-Kallista.
III Technologisierung
Bedeutung, Gefahren und Chancen von mobilem Online-Dating im Kontext von Partnersuche und Beziehungen (J. Degen)Vermittlungsinstanzen bei der Partnersuche sind nicht neu, jedoch ergeben sich durch mobile Applikationen wie Tinder und deren Aufbau neue Nutzungspraktiken. Johanna Degen zeigt in ihrem Beitrag auf, welche Logiken sich im Kontext von mobilem Online-Dating (MODA) entwickeln und welche Bedeutung diese für Subjekte und Beziehungen haben.
Chancen und Probleme digitaler Mediennutzung in bestehenden Partnerschaften (C. Eichenberg)Christiane Eichenberg bezeichnet in ihrem Beitrag die Wirkung neuer Medien auf (bestehende) Paarbeziehungen pointiert als dialektisch. Die Existenz neuer Medien bringt viele Vorteile, doch sie erhöht auch die zu bewältigende Komplexität in Paarbeziehungen z. B. im Hinblick auf das Aushandeln von Grenzen.
Überlegungen zu Zweier- und Dreierbeziehungen mit Liebespuppen und Sexrobotern (O. Bendel)Oliver Bendel (2021 und in diesem Band) zeigt empirische Erkenntnisse und Entwicklungen in dem jungen Forschungsfeld zu Sex-Robotern und Liebespuppen auf, führt ein in die technologischen Möglichkeiten und fasst philosophische, weltanschauliche und ethische Diskussionen aus dem Bereich des Transhumanismus in Bezug auf Beziehungen zusammen.
IV Ausblick
Paartherapie und die Versorgung von Paarproblemen – Gegenwart und Zukunft (C. Roesler)Für die Paartherapie stellt die zunehmende Vielfalt der Beziehungsformen und -vorstellungen eine enorme Herausforderung dar. Christian Roesler gibt einen Überblick über die Versorgung von Paarproblemen mit Paartherapie und entwickelt vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Notwendigkeit einer guten Versorgung ein Zukunftsmodell.
Epilog (C. Roesler und S. Bröning)Im letzten Kapitel wird der Versuch unternommen, die Inhalte und Perspektiven der Beiträge zu bündeln und zu diskutieren. Diese Diskussion erfolgt entlang der oben bereits angesprochenen großen Spannungsfelder der Technologisierung, der Diversitätsdebatte, und der Selbstverwirklichung, die oft im Widerspruch zu partnerschaftlicher und familiärer Bezogenheit zu stehen scheint. Für jeden dieser Bereiche werden Optionen entwickelt und Bedarfe aufgezeigt, dort, wo problematische Situationen Weiterentwicklungen erfordern.
Literatur
Albert, M., Hurrelmann, K. & Quenzel, G. (2019). Jugend 2019 – 18. Shell Jugendstudie: Eine Generation meldet sich zu Wort. Weinheim: Beltz.
Aretz, W., Gansen-Ammann, D. N., Mierke, K. & Musiol, A. (2017). Date me if you can: Ein systematischer Überblick über den aktuellen Forschungsstand von Online-Dating. Zeitschrift für Sexualforschung, 30(01), 7 – 34.
Horn, C. (2021): »und jetzt hat man eben manchmal das Gefühl, dass die Entscheidung zur Ehe eine Entscheidung gegen den gesellschaftlichen mainstream is«. Ehe im Zeitalter der Singularisierung. In: Buschmeyer, A. & Zerle-Elsässer, C. (Hg.) (2020): Komplexe Familienverhältnisse. Wie sich das Konzept Familie im 21. Jahrhundert wandelt (S. 123 – 149). Münster: Verlag westfälisches Dampfboot.
Mortelmans, D. (2020). Divorce in Europe. New insights in trends, causes and consequences of relation break-ups. Cham: Springer Open.
Ravens-Sieberer, U., Kaman, A., Erhart, M., Otto, C., Devine, J., Löffler, C., ... & Hölling, H. (2021). Quality of life and mental health in children and adolescents during the first year of the COVID-19 pandemic: results of a two-wave nationwide population-based study. European child & adolescent psychiatry, 1 – 14.
2 Entwicklungspsychologische Perspektiven auf Paarbeziehungen
Sonja Bröning und Sabine Walper
Nichts illustriert die Hoffnungen und Sehnsüchte, die sich an eine Paarbeziehung richten, besser als der Hashtag »#couplegoals« auf Instagram. Dort finden sich (meist junge) Paare im Sonnenuntergang, beim Heiratsantrag, im Brautkleid am Strand, beim Einrichten der gemeinsamen Wohnung und an traumhaften Urlaubsorten. Paarbeziehung ist ein Sehnsuchtsort, das zeigen auch Daten der aktuellen, repräsentativen ElitePartner-Umfrage (2022): Über 70 % der Befragten wünschen sich jeweils Folgendes von ihrer Liebesbeziehung (die Reihenfolge entspricht der Rangfolge): (1) sich gegenseitig treu sein, (2) Harmonie und Ruhe finden, (3) sich öffnen, (4) über Gefühle sprechen, (5) ausreichend Freiraum, Zeit für sich selbst haben, (6) sich durch die Beziehung persönlich weiterentwickeln, (7) sich gegenseitig zu Neuem ermutigen, (8) dauerhaft zusammenbleiben, möglichst ein Leben lang, (9) den besten Freund im anderen haben, (10) tiefsinnige und gesellschaftliche Gespräche führen. Erst auf Platz 12 finden sich »Erotik/guten Sex haben«, während »gemeinsam materiellen Besitz schaffen« und »gemeinsam Kinder bekommen« das Schlusslicht der Bedürfnisliste bilden. Paarbeziehung im 21. Jahrhundert? Zumindest in Europa und anderen westlichen Kulturen wird die psychologische Bedeutung der Paarbeziehung sehr hoch bewertet. Paarbeziehung soll uns glücklich machen. Ein gängiges (eher US-amerikanisch geprägtes) Stereotyp sieht dabei zunächst vor, The One zu finden, d. h. die eine einzigartige Person, die uns glücklich machen kann. Für den Rest des Lebens soll die Beziehung dann ein Heilmittel sein: Gegen den Stress der Leistungsgesellschaft, die Heimatlosigkeit in der globalisierten Welt, die Beziehungslosigkeit durch aufgelöste Großfamilienbande, die Orientierungslosigkeit im Selbstverwirklichungsdschungel der individualisierten Gesellschaft.
Mit dieser immer weiter voranschreitenden Entwicklung des Funktionswandels weg von der Versorgungs- und Reproduktionsgemeinschaft hin zu der Erfüllung emotionaler und sozialer Bedürfnisse durch die Partnerschaft steigt auch der Anspruch an die sozialen und emotionalen Kompetenzen jedes Individuums. Eine lebenslange, glückliche Beziehung zu führen, in der die eigenen Bedürfnisse und die des Partners gewinnbringend vereinbart werden, die dafür nötige Autonomie und Verbundenheit dabei geschickt balanciert wird (Bröning, 2009), während der Alltagsstress gemeinsam gemeistert wird – das ist Spitzenleistung auf höchstem psychologischem Niveau. Gleichzeitig wird nach Finkel und Kollegen (2015) immer weniger an Zeit und Ressourcen in die Beziehung investiert, was die Autoren zur Formulierung ihres »Suffocation Model of Marriage« (Erstickungsmodell der Ehe) führte: Wenn auf dem Gipfel der Ansprüche immer weniger belebender »Sauerstoff« für die Beziehung (z. B. in Form von Zuwendung) zugeführt wird, muss die Liebe ersticken.
Wenn die Ansprüche, den Berggipfel erreichen, auf dem – im Bilde gesprochen – immer mehr Sauerstoff zum Atmen benötigt wird, gleichzeitig aber immer weniger Sauerstoff zugeführt wird, dann erstickt die Partnerschaft. Bedenkt man dazu noch, dass die Ausstiegsbarrieren aus einer Paarbeziehung stetig sinken – z. B. durch die zunehmende Berufstätigkeit und finanzielle Unabhängigkeit der Frau – erscheinen hohe Trennungsraten plötzlich fast weniger verwunderlich als der weiterhin nicht unerhebliche Prozentsatz von Paaren, die zusammenbleiben.
Eine Fülle psychologischer Forschung untersucht, was Menschen in intimen Beziehungen glücklich oder unglücklich macht. Sie betrachtet dies als ein multifaktorielles Geschehen und bezieht aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wie die fortschreitenden Digitalisierungsprozesse ebenso mit ein wie Persönlichkeits- und weitere Kontextfaktoren sowie neurobiologische Erkenntnisse zu Bindung, Partnerwahl, sexuelle Anziehung, Traum und Stress. Was lässt sich aus den Ergebnissen dieser Forschung über Paarbeziehungen im 21. Jahrhundert schlussfolgern? Wie lässt sich damit die Beratung und Begleitung von Paaren und Familien verbessern? Dieser Frage widmet sich der nachfolgende Beitrag. Dabei werden (1) grundlegende psychologische Perspektiven auf Paarbeziehungen vorgestellt, (2) die wesentlichen Fundamente der Liebe, nämlich Bindung und Sexualität beleuchtet und (3) lebensphasentypische Aspekte von Partnerschaft erörtert. Den Abschluss bildet ein Ausblick auf Entwicklungspotenziale von Liebe und Partnerschaft im 21. Jahrhundert.
2.1 Psychologische Perspektiven auf Paarbeziehungen
Bei aller Unterschiedlichkeit gegenwärtiger Beziehungsentwürfe existiert doch ein gemeinsamer Nenner: es sollte Liebe im Spiel sein. Sternberg (1988) postuliert drei Komponenten von Liebe: Leidenschaft, d. h. sexuelle Anziehung und Erregung und romantische Gefühle, Intimität, d. h. Gefühle von Wärme, Verbundenheit, Vertrauen und Wertschätzung, und Commitment1, d. h. Entscheidung für eine Person und Festlegung auf Verantwortung und Partnerschaft. Sind alle drei Komponenten in hoher Ausprägung vorhanden, handelt es sich seine Theorie zufolge um die »vollkommene Liebe« – diese Variante entspricht dem romantischen Ideal der Gegenwart.
Auch wenn sich Vorstellungen von Liebe gewandelt haben, sind Liebesgefühle kein rein westliches, modernes Phänomen, wie gelegentlich fälschlicherweise behauptet wird. Liebe wurde im Verlauf der Geschichte in so gut wie allen menschlichen Kulturen dokumentiert (Jankowiak & Fisher, 1992). Über Kulturen hinweg zeigen verliebte Menschen ähnliche Hirnaktivitäten (Acevedo & Aron, 2014). Dies deutet darauf hin, dass Liebe Bestandteil unseres evolutionären Erbes ist (Sigelman & Rider, 2022). Physiologische Ähnlichkeiten zwischen romantischer Liebe und dem Bonding, d. h., dem Entstehungsprozess der besonders starken emotionalen Verbundenheit zwischen der Mutter und dem Säugling, legt nahe, dass romantische Liebesgefühle durch einen Ko-Options-Prozess der Eltern-Kind-Bindung entstanden sein könnten (Numan & Young, 2016). Ko-Option ist ein bekannter evolutionärer Vorgang, bei dem ein Merkmal übernommen, aber umgewidmet wird, d. h. eine andere Funktion übernimmt als die bisherige (McLennan, 2008).2 Vielfach werden Paarbeziehungen daher als Fortsetzung früher Bindungserfahrungen betrachtet (Hazan & Shaver, 1987; ▸ Kap. 3). Sie übernehmen im späteren Leben die Funktion der emotionalen Versorgung und Wiederherstellung psychischer Sicherheit. Bindung findet hier, im Gegensatz zur Eltern-Kind-Beziehung, prinzipiell symmetrisch statt, das heißt, die Partner können sich gegenseitig unterstützen und emotional regulieren.
Bindung ist aber nur ein Bestandteil der Liebe. Die Anthropologin Helen Fisher (2006) fügt der Bindung noch zwei weitere evolutionär gewachsene Emotions- und Motivationssysteme hinzu, die in der Liebe wirksam werden: Das sexuelle Begehren motiviert Menschen dazu, sich zu reproduzieren, und die Attraktion, d. h. das sich Hingezogen fühlen zu einem bestimmten Partner, motiviert sie, eine möglichst geeignete Partnerwahl zu treffen. Den drei Triebfedern der Liebe, Bindung, Attraktion und Begehren, können unterschiedliche physiologische Prozesse zugeordnet werden. So spielt bei der Attraktion das Hormon Dopamin eine zentrale Rolle, das auch für Belohnungsgefühle beim Konsum von Schokolade oder Drogen sorgt. Das sexuelle Begehren entsteht ebenfalls im Belohnungszentrum. Beim Ausleben genussvoller Sexualität werden Endorphine freigesetzt, die für ein Stimmungshoch sorgen. Beim Orgasmus wird der Körper mit den Hormonen Oxytocin, Vasopressin und Serotonin geflutet, die für positive Gefühle sorgen. Oxytocin und Vasopressin wiederum fördern auch die die Bindung zwischen zwei Menschen, die dann als oben beschriebene Regulationshilfe dient: Körperkontakt mit dem Partner hilft, in schwierigen Situationen Stresshormone abzubauen (Coan et al., 2017).
Deutlich aus dieser neurobiologischen Analyse wird erstens die prinzipielle Verschiedenheit dieser drei Triebfedern der Liebe. So ist es möglich, sich mit einem langjährigen Partner verbunden zu fühlen, in eine zweite Person rasend verliebt zu sein und abends in einer Bar spontan eine dritte Person sexuell zu begehren. Genauso deutlich wird zweitens, dass die Motivationssysteme nicht unabhängig voneinander sind, sondern dass sich Attraktion, Bindung und Sexualität gegenseitig verstärken: So begünstigt das Dopamin der Verliebtheit auch den Genusscharakter sexueller Handlungen, was wiederum Botenstoffe freisetzt, die für den Aufbau von Bindung (s. u.) sorgen.3 Erahnen lässt sich hier drittens der zwangsläufig angelegte Veränderungscharakter von Liebesbeziehungen. Bindung baut sich über die ersten zwei Beziehungsjahre erst auf (Fraley & Davis, 1997), während Dopaminausschüttung (und damit Verliebtheitsgefühle) über die Zeit abnimmt. Die Zeitdauer dieses Abklingens wird – je nach Studie – mit zwischen sechs Monaten und drei Jahren angegeben (Bode & Kushnick, 2021). Besteht die Paarbeziehung danach fort, kann eine neue Verliebtheit in eine andere Person große emotionale Wirkung entfalten und den Eindruck vermitteln, die alte Liebe sei beendet.4 Findet jedoch eine Trennung statt, stellen beide Partner häufig fest, dass sie intensive Gefühle von Trauer und Verlust spüren – das Bindungssystem wurde aktiviert. Dennoch – eine neue Liebe ist genauso möglich wie der Aufbau neuer Bindungen über die Zeit. So scheint die Tendenz zu langfristigem Commitment zwar im Menschen angelegt zu sein, jedoch scheint sie – genau wie Attraktion und Begehren – von ihrer Funktion her nicht unbedingt auf eine Aufrechterhaltung über die gesamte Lebensspanne (und heute übliche lange Lebensdauer) hinweg angelegt.
Die tägliche Gestaltung von Liebesbeziehungen lässt sich gut aus der Perspektive der Interdependenztheorie (Kelley & Thibaut, 1978) betrachten, die von der systemischen Paartherapie aufgegriffen wurde (Retzer, 2004). Liebesbeziehungen werden hier als ein eng verflochtenes System gesehen, in dem die wechselseitige emotionale Abhängigkeit der Partner voneinander ständig im Fluss ist. Aus den vielen alltäglichen Interaktionen eines Paares schälen sich über die Zeit wiederkehrende Beziehungsmuster heraus, die konstruktiv oder destruktiv sein können, und letztlich über Glück und Unglück entscheiden. Diese kommunikative Eigendynamik des Paarwesens ist für Paartherapeuten von Anfang einer Beratung an deutlich spürbar. Normen und Werte, der soziale Kontext, aktuelle Rahmenbedingungen, die Persönlichkeit beider Partner, sie alle fließen als Zutaten in dieses Paargemisch ein. In dieser speziellen, sich immer weiter entfaltenden Alchemie der Paarbeziehung stellen Bindung und Sexualität besonders potente Zutaten dar.
2.2 Einfluss von Bindung auf Paarbeziehungen
Die Bindungsforschung belegt, dass die Summe früher Erfahrungen mit nahen Bezugspersonen die emotionale Qualität von Liebesbeziehungen nachhaltig beeinflusst (Treboux, Crowell & Waters, 2004; Givertz et al., 2013; Karantzas et al., 2014). Eine bindungssichere Person fühlt sich im Allgemeinen emotional eng mit ihrer Bezugsperson verbunden. Sie vertraut darauf, dass diese Nähe erwidert wird und dass der andere angemessen reagiert, wenn seine Hilfe gebraucht wird. Eine unsichere Bindung ist entweder durch Bindungsangst (allgemeine Angst vor Ablehnung und Verlassenwerden) oder durch bindungsbezogene Vermeidung (allgemeines Unbehagen gegenüber Nähe und Abhängigkeit und Vorliebe für ein hohes Maß an Selbstständigkeit; Mikulincer & Shaver, 2012) gekennzeichnet. Die Übertragung früherer Bindungserfahrungen in die Paarbeziehung erfolgt vor allem durch emotionale Kompetenzen. So ist eine unsichere Bindung mit größerer Stresssensitivität und verringerter Fähigkeit zur emotionalen Regulation assoziiert (Cooke, et al., 2019). Soziale Unterstützung wird als weniger lohnend empfunden (Ein-Dor, Mikulincer, Doron & Shaver, 2010). Diese Einflüsse führen zu Unterschieden in der Kommunikation je nach Bindungstyp (Ein-Dor, Mikulincer, Doron & Shaver, 2010). Sicher gebundene Menschen sind offener gegenüber eigenen Gefühlen und denen des anderen. Ihre Interaktionen zeigen mehr Annäherung und kooperative Problemlösung als diejenigen von unsicher gebundenen Menschen (Girme et al., 2021). Vor allem im Konflikt wird das Bindungsprogramm durch negativen Affekt aktiviert, und der Versuch, das emotionale Gleichgewicht wiederherzustellen, fällt sehr unterschiedlich aus (Gottman & Levenson, 1992). Neben dem Bindungstyp spielen hierbei auch Kulturaspekte eine Rolle, so zeigen sich deutliche Variationen zwischen Kulturen, z. B. bezogen auf die Priorisierung von Streitbarkeit versus Harmonie. Bei Langzeitpaaren findet eine Entwicklung in der Bindungssicherheit statt: Langzeitpaare sind sich im Bindungstyp eher ähnlicher, die Sicherheit in stabilen Partnerschaften nimmt in der Tendenz zu (Hudson et al., 2014).
2.3 Einfluss von Attraktion und sexuellem Begehren auf die Paarbeziehung
Sexuelle Lust zeigt sich schon in der frühen Kindheit (de Graaf & Rademakers, 2011). Anzeichen einer physiologischen sexuellen Reaktion sind fast von Geburt an erkennbar (Lehmiller, 2017). Erste Gefühle sexueller Anziehung zu einem anderen Menschen werden meist ab dem Alter von ca. 10 Jahren berichtet. Erste sexuelle Erfahrungen mit einer anderen Person machen Teenager in Deutschland in der Zeitspanne zwischen 14 und 19 Jahren (BzgA, 2020).
Eine Vielfalt sich entwickelnder Einflüsse prägt das sexuelle Begehren und Verhalten. Dazu zählen einerseits angeborene Faktoren wie Persönlichkeitseigenschaften, z. B. Extraversion, Sensation Seeking, (d. h. das Streben nach einem hohen Erregungsniveau) und Neurotizismus (d. h. emotionale Instabilität), aber auch Erfahrungen und Lerneffekte (Lehmiller, 2017). Auch der unbewusst ablaufende Erwerb kultureller Werte und Normen zu Paarbeziehung, Sexualität und Geschlechterrollen zählt als Lerneffekt. Eine Studie über 53 Nationen hinweg fand stabile Geschlechtsunterschiede im sexuellen Begehren: Männer wiesen im Durchschnitt einen ausgeprägteren selbst berichteten Sexualtrieb5 auf (Lippa, 2009). Die Entstehung sexueller Vorlieben verorten Psychoanalytiker wie Jean Laplanche und Ilka Quindeau in frühen sensumotorischen Lernerfahrungen, wie gehalten, gestreichelt und gestillt werden. Die eigene körperliche und emotionale Reaktion darauf hinterlässt Quindeau (2013) zufolge eine vorsprachliche Erinnerungsspur im Körper, die während der Pubertät reaktiviert und sexuell aufgeladen wird. Sehr frühe Erfahrungen dieser Art sind schwer empirisch überprüfbar und nicht hinreichend erforscht.6 Doch scheinen sexuelle Erlebnisse und Erfahrungen in der Kindheit und Jugend die spätere Sexualität entscheidend zu prägen. Das Ergebnis sexueller Formierungsprozesse im Kindes- und Jugendalter ist die Lovemap eines Menschen (Money, 1986), d. h. das Spektrum seiner sexuellen Erregbarkeit. Letzteres ist das nach Abschluss der Pubertät kaum veränderbar (Briken, 2019).
Mit diesen Entwicklungsaspekten von Sexualität sind Risiken für die partnerschaftliche Sexualität verbunden. Die aktuelle Debatte um Missbrauchserfahrungen und Trauma im Kindes- und Jugendalter zeigt eindeutige Risiken für die Sexualentwicklung aller Altersstufen auf. Seelische und körperliche Verletzungen im Kindesalter sind verbreitet, so erlebten einer internationalen Übersichtsarbeit zufolge 20 % aller Frauen vor dem 18. Lebensjahr sexuelle Gewalt (Pereda et al., 2009), die nicht nur von Erwachsenen, sondern auch von Gleichaltrigen ausgeübt wurde. Sexualisierte Gewalt verstört das epistemische Vertrauen von Kindern in Erwachsene und führt zu Defiziten oder Stillstand in vielfältigen Entwicklungsbereichen (ebenda).7 Sie steigert das Risiko für psychische Probleme und für sexuelle Probleme in der Partnerschaft (Büttner et al., 2014).
Aktuell wird außerdem die erfahrungsbildende Wirkung früher Nutzung von Pornografie diskutiert, die Kindern im digitalen Zeitalter in der Regel bereits vor den ersten eigenen sexuellen Erfahrungen zugänglich ist. Kliniker beklagen die »Pornografisierung« der Gesellschaft und den bei jungen Menschen entstehenden Druck, harte Sexpraktiken auszuüben. Am stärksten belegt die Forschung den Zusammenhang zwischen häufigem oder sehr frühem Pornografiekonsum und traditionellen Geschlechterstereotypen hinsichtlich Macht und Dominanz (Massey, Burns & Franz, 2021). Manche Autoren betonen aber auch den informativen Charakter von Pornografie als positiven Aspekt und weisen darauf hin, dass sich junge Menschen häufig der Tatsache bewusst seien, dass Pornografie die Realität nicht hinreichend abbilde (Litsou, Byron, McKee & Ingham, 2021). Dies ist sicher alters- und entwicklungsabhängig.
Schließlich hat die Vielfalt sexuellen Begehrens den öffentlichen Diskurs über intime Beziehungen in den letzten Jahrzehnten stark mitbestimmt. Etwa 3 – 4 % der Bevölkerung in Deutschland bezeichnen sich als lesbisch, schwul oder bisexuell (Briken et al., 2021). Der Anteil der Personen, die sich als nicht ausschließlich heterosexuell bezeichnen, ist höher und liegt bei Frauen zwischen 11 und 22 % und bei Männern zwischen 10 und 14 % (Pöge et al., 2020). Hierunter fallen auch weitere sexuelle Identitäten wie pansexuell und asexuell. Sexuelles Begehren und romantische Attraktion jenseits der Hetero- und Mononormativität wurden über die Menschheitsgeschichte hinweg vielfach dokumentiert, jedoch auch über lange Zeit kriminalisiert oder pathologisiert. Aggressionen gegen queere Menschen in westlichen Ländern haben abgenommen, sind aber lange noch nicht eliminiert (Wilson, 2020). Junge Menschen, die sich meist in der Pubertät ihrer Zugehörigkeit zu einer sexuellen Minderheit bewusstwerden, stehen vor besonderen Herausforderungen, was die Akzeptanz ihrer eigenen Identität, erste Liebesbeziehungen und ihr sexuelles Debüt in der Familie und bei Gleichaltrigen angeht. Für manche Jugendliche ist auch verwirrend, dass sie bezogen auf ihr sexuelles Begehren oder ihre Geschlechtsidentität Fluidität verspüren, d. h., sie sich je nach Kontext und Person unterschiedlich orientieren (Diamond, 2021).8 Der Ausbau von Internet-Ressourcen, -Beratungsmöglichkeiten und -Netzwerken trägt zunehmend zur Entlastung und Orientierung bei, doch kann auch Anpassungsdruck an bestimmte Körperbilder oder Identitätsvorlagen entstehen. Alle Formen der Stigmatisierung können das Selbstwertgefühl beeinträchtigen und Psychopathologie fördern (Hatzenbühler, Phelan & Link, 2013).
Zahlreiche Forschungsergebnisse belegen durch den entstehenden Minoritätenstress eine schlechtere psychische Gesundheit und ein geringeres Wohlbefinden bei sexuellen Minderheiten aller Altersstufen (Plöderl & Tremblay, 2015).9 Diese Faktoren können gleichgeschlechtliche Paare belasten, aber auch zusammenschweißen. Viele finden im großen Zelt der queeren Community eine logische Familie, die sie besser unterstützt als die biologische Familie. Zu ersterer gehört dann auch der Partner – ein verbindender Faktor. Trotz dieser Besonderheiten überwiegen in LGBTQ+-Beziehungen die oben beschriebenen, universellen Mechanismen von Bindung und Beziehung, auch wenn diese Gemeinsamkeiten im Diskurs über verschiedene Identitäten häufig aus dem Fokus geraten. Forschung zu queeren Beziehungen zeigt nur wenig Unterschiede zu gegengeschlechtlichen Beziehungen auf, was Partnerschaftsprozesse, -qualität und -dynamik angeht (z. B. Joyner, Manning & Prince, 2019). Ein nennenswerter Unterschied ist der erhebliche Prozentsatz an LGBTQ+-Menschen, der in verschiedenen Arten von einvernehmlich nicht monogamen Beziehungen lebt, wie etwa offene, swingende oder polyamore Beziehungen (mehr hierzu ▸ Kap. 6).
Statistisch auffällig ist eine Überschneidung zwischen sexuell vielfältigen Populationen und geschlechtlich vielfältigen Populationen wie trans*, genderqueer und nicht-binären Identitäten.10 Die Anzahl junger Menschen, die sich als geschlechtsdivers und/oder sexuell fluide definieren, nimmt zu.11 Über den Verlauf der Liebesbeziehungen von geschlechtsdiversen Menschen ist kaum etwas bekannt. In ihren Jugendjahren weisen sie Klinikern zufolge häufig negative Körperbilder auf, die den Einstieg in partnerschaftliche Sexualität erschweren könnten. Die australische »Trans & Gender Diverse Sexual Health«-Studie (Holt et al., 2021) untersuchte über 1.600 Teilnehmende, die sich als trans* und/oder nicht-binär identifizierten. Über die Hälfte war in einer festen Beziehung. Die sexuelle und romantische Zufriedenheit war eher niedrig. Dies war vor allem bei älteren Menschen mit wenig Zugang zu trans*-affirmativer Beratung und zur queeren Community der Fall. Ca. 39 % der Teilnehmenden gaben an, besorgte und ängstliche Gefühle gegenüber partnerschaftlicher Sexualität zu verspüren.
2.4 Entwicklungsperspektiven auf Partnerschaft
2.4.1 Das Fundament der Liebe – Kindheit und Jugend
Attraktion im Sinne leidenschaftlicher Verliebtheit in einen anderen Menschen lässt sich bereits weit vor Einsetzen der Pubertät feststellen (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Kaltiala, 2019). Im Jugendalter ist leidenschaftliche Verliebtheit dann sogar weiter verbreitet als im jungen Erwachsenenalter (Hill, Blakemoore & Drumm, 1997). Dennoch sind beginnende intime Beziehungen im Jugendalter zunächst noch mehr auf die Stärkung des eigenen Selbstkonzepts und des sozialen Status ausgerichtet. Der Beziehungscharakter wird erst schrittweise ausgebaut. Hierfür bieten Familienbeziehungen einen zentralen Ausgangspunkt. Ein positives Familienklima und starker familiärer Zusammenhalt in der Herkunftsfamilie fördern wesentliche Beziehungskompetenzen wie prosoziales Verhalten, Kommunikationsfähigkeiten und Empathie (Fosco, Van Ryzin, Xia & Feinberg, 2016). Heranwachsende in solchen Familien haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, später enge, intime und befriedigende Beziehungen einzugehen (z. B. Masarik et al., 2013). Ein konfliktbelastetes Aufwachsen und ein rigider Erziehungsstil bringen hingegen jeweils ein erhöhtes Risiko für schlechtere Problemlösung und geringeres Engagement in der Liebesbeziehung mit sich (Topham, Larson & Holman, 2015). Freundschaften mit Gleichaltrigen, die zunehmend von Kommunikation und gegenseitiger Unterstützung geprägt sind, stellen einen wichtigen Schritt in Richtung Liebesbeziehung dar, denn in ihnen können zwischenmenschliche Kompetenzen sich emotional verfestigen und ausgebaut werden (Adamczyk & Segrin, 2016). In Längsschnittstudien lassen sich mittlerweile Ketten der Beziehungsfähigkeit ablesen: Von sicherer Bindung im Säuglingsalter über positive Beziehungen zu Gleichaltrigen und ersten Liebesbeziehungen bis hin zu emotional stabilen Beziehungen im frühen Erwachsenenalter (Simpson, Collins, Tran & Haydon, 2007; Kansky, Allen & Diener, 2019). Gleichzeitig sind diese Ketten nicht so stark, dass von einem schlichten Determinismus auszugehen wäre. Neue Partner ermöglichen auch neue Erfahrungen, die Beziehungskompetenzen stärken können.
Forschung zur Kindheit in belasteten Familiensituationen wie Armut, Suchtbelastung oder chronischer gesundheitlicher Beeinträchtigung zeigt, dass die Auswirkungen dieser Risikolagen auf die Kinder ebenfalls oft über familiäre Beziehungen transportiert werden (Conger, Conger & Martin, 2010; Bröning, 2023). Sind diese Beziehungen weiterhin intakt, verliert der spezifische Risikofaktor allein deutlich an Bedeutung (Hohm et al., 2017). Und auch andersherum stimmt diese Gleichung: Erfahrungen von Misshandlung und Vernachlässigung durch nahe Bezugspersonen bergen kulturübergreifend und unabhängig von der sozialen Lage der Familie ein Risiko für die sozialen und emotionalen Kompetenzen der Betroffenen im Erwachsenenalter (Raby et al., 2019;).
Zur Bedeutung elterlicher Trennung und Neuverpartnerung im Kindes- und Jugendalter für die spätere Liebesbeziehung wurde intensiv geforscht. Nachdem sich in den 1980er und 1990er Jahren herausstellte, dass der Erhalt bestehender Bindungen für bessere Entwicklungsergebnisse sorgte, wurde das Recht des Kindes auf Kontakt zu seinen Bezugspersonen 1998 in Deutschland rechtlich verankert. Die daraus resultierende Frage nach dem Wohnort des Kindes, der Organisation multilokaler Betreuung, der Verteilung finanzieller Ressourcen und der emotionalen Bewältigung der Trennung bei fortgesetztem Kontakt fordern Familien in der Trennungssituation weiterhin sehr heraus (Walper, Entleitner-Phleps, & Langmeyer, 2020). Die meisten Kinder zeigen zunächst Belastungssymptome, deren Intensität davon abhängt, wie viele solcher Stressoren im Zuge der Trennung auftreten, und wie viele protektive Faktoren (z. B. soziale Unterstützung durch Freunde und Familie) dem entgegen stehen (Walper, Amberg & Langmeyer, 2022). Ob die Entwicklung der Kinder langfristig beeinträchtigt bleibt, hängt auch hier wieder maßgeblich von der psychischen Verfassung der Eltern (vor allem der Mutter, die oft die Hauptbetreuungsperson bleibt), der Erziehungsqualität und der Qualität der Eltern-Kind-Beziehungen, zum Teil auch von der Finanzlage der Familie ab. Die psychische Verarbeitung der Trennung durch die leiblichen Eltern und deren Kooperation in der Elternrolle spielen eine zentrale Rolle (Hadfield et al., 2018). Ebenfalls bedeutsam sind die Ausgangsbedingungen vor der Trennung (Selektion), d. h., das Vorhandensein problematischer Merkmale schon vor der Trennung (Fomby & Cherlin, 2007), die die Entwicklung der Kinder auch über die Trennung hinweg beeinflussen und reine Trennungseffekte relativieren.
Für Jugendliche fällt die Auswirkung familiärer Einflüsse deutlich geringer aus, was die Bedeutung früher Beziehungserfahrungen unterstreicht. Nach 1 – 2 Jahren erholen sich die meisten Kinder von einer elterlichen Trennung (Amato, 2010) und unterscheiden sich als Gesamtgruppe in vielen Studien nicht mehr von Kindern nicht getrennter Eltern (Walper & Wendt, 2010). Nachhaltig betroffen sind sozioökonomisch benachteiligte Kinder, bei denen die familiären Ressourcen nicht ausreichen, um den Effekt einer Trennung abzufedern (Zartler, 2021). Der Einfluss neuer Partner und des Aufwachsens in zusammengesetzten Familien ist uneinheitlich, es lassen sich in Summe weder klare Vorteile noch klare Nachteile erkennen. Auch hier ist ausschlaggebend, ob die Familienbeziehungen sich dadurch insgesamt verbessern oder nicht (Raley & Sweeney, 2020). Häufige Wechsel sind aus Bindungsperspektive eher problematisch, und das gemeinsame Erziehen fällt in Stieffamilien etwas schwerer als in Kernfamilien (Heintz-Martin, Entleitner-Phlebs & Langmeyer, 2015). Einige Studien fanden, dass die Liebesbeziehungen von erwachsenen Kindern getrennter Eltern instabiler waren (Zartler, 2021). Amato und Patterson (2017) zeigten, dass sich für jede Trennung der Eltern die Wahrscheinlichkeit eigener Trennung um 16 % erhöhte. Allerdings zeigte ihre Analyse auch, dass das Aufwachsen in einer konfliktbelasteten Kernfamilie diese Wahrscheinlichkeit um 22 % erhöhte. In solchen Lagen werden wichtige Beziehungsfertigkeiten nicht gelernt (Beckh, Bröning, Walper & Wendt, 2013). Auch negative Erwartungen an Liebesbeziehungen können hier entstehen, die weitreichende Konsequenzen für das eigene Beziehungsleben haben (Arocho, 2021). Wenngleich auch hier Selektion und genetische Vulnerabilität eine Rolle spielen dürften, so ist die Forschungslage an dieser Stelle doch eindeutig: Fortgesetzte und intensive elterliche Konflikte in der elterlichen Zusammenarbeit (»Co-Parenting«) fördern Bindungsunsicherheit in Kindern, unterminieren die emotionale Sicherheit des Kindes und richten die Aufmerksamkeit der Eltern weg von ihren Kindern (van Eldik et al., 2020; Lux, Christ & Walper, 2021). Die Folgen aus diesem Erleben machen sich in zukünftigen Liebesbeziehungen bemerkbar (Braithwaite et al., 2016).
2.4.2 Erwachsen werden: Partnerwahl und Institutionalisierung der Liebe
Wege in eine Partnerschaft sind selbstbestimmter geworden. Das Internet und soziale Medien ermöglichen es, vielfältige Lebensstile kennenzulernen und sich auch partnerschaftlich auszuprobieren. Nicht sehr verändert haben sich hingegen Partnerwahlkriterien. Eine große Studie in 45 Ländern (Walter et al., 2020) bestätigte erneut, was frühere Studien zur Partnerwahl herausfanden: Global gesehen bevorzugen Männer nach wie vor attraktive, jüngere Partnerinnen, während Frauen etwas ältere Männer mit finanziellen Ressourcen bevorzugen. Freundlichkeit, Intelligenz und Gesundheit waren für beide Geschlechter wichtige Partnerwahlkriterien. Begegnen sich zwei Menschen in der realen (oder auch zunächst in der digitalen Welt, z. B. über eine Dating-App), ist die subjektive Attraktivität zunächst von großer Bedeutung. Dennoch spielt psychologisch gesehen auch wahrgenommene Ähnlichkeit von Beginn an eine große Rolle, wenn auch häufig unbewusst. Ist diese sichergestellt, wird auch Komplimentarität bedeutsam, d. h. ein potenzieller Partner weist Merkmale auf, die das eigene Profil vermissen lässt. Dieser Filterprozess erfolgt bei gegen- und gleichgeschlechtlicher Partnerwahl gleichermaßen (Diamond & Butterworth, 2008). Warum funktionieren die Algorithmen der Dating-Portale dann nicht besser? Sigelmann & Rider (2014) spekulieren, dass Dating-Portale die Dynamik der Interaktionen zwischen den potenziellen Partnern nicht vorhersagen können: Die (Al-)Chemie muss stimmen. Offenbar ist das Wahrnehmen eines potenziellen Partners mit allen Sinnen zu einem möglichst frühen Stadium sinnvoll, um auch intuitiv wahrgenommene, unbewusste Komponenten der Kompatibilität mit einzubeziehen.
Ist ein Partner gefunden, der sich für ein langfristiges Commitment eignet, steht grundsätzlich die Frage an, ob auch geheiratet werden sollte. Oder lieber unverheiratet zusammenleben? In Deutschland gaben im Jahr 2020 74 % der Befragten an, heiraten sei generell noch zeitgemäß (Statista, 2022). Weithin überwiegt die Präferenz für eine lebenslange Partnerschaft, jedoch sind alternative Modelle verfügbarer und erreichbarer. In einer Studie mit jungen Erwachsenen im Großraum von New York City (Gerson, 2010) zeigte sich, dass die große Mehrheit der Befragten das Ideal einer dauerhaften, egalitären Partnerschaft teilte. Aber die Befragten hielten sich einen Plan B offen und bemühten sich um finanzielle Unabhängigkeit, falls eine egalitäre Partnerschaft nicht funktioniere. Das romantische Ideal scheint dennoch ungebrochen: Hochzeiten werden als Fest der Liebe gefeiert, häufig im Kreis der Verwandten und Freunde. Die Verweildauer im Flitterwochenglück ist allerdings im Durchschnitt eher kurz. So stellen z. B. Asselmann und Specht (2022) fest, dass die Lebenszufriedenheit in den Jahren vor dem Zusammenziehen eines Paares oder der Hochzeit zunahm, etwa ein Jahr später aber wieder abnahm.
Unterm Strich legen die meisten vergleichenden Studien, die sich mit der Ehe befassen, Positives nahe: Verheiratete Menschen haben einen besseren allgemeinen Gesundheitszustand und weniger psychische Probleme als nicht-verheiratete Menschen (Kalmijn, 2017). Bei getrenntlebenden Paaren (ungefähr 6 – 10 % der Paarbeziehungen) sind die Studien uneinheitlicher. Auswirkungen dieses Lebensmodells auf das Wohlbefinden scheinen vom Alter des Paares abzuhängen und davon, ob das Modell selbst gewählt ist oder durch Lebensumstände wie berufliche Notwendigkeiten entsteht. Es mehren sich die Forschungshinweise darauf, dass sich die Unterschiede im Wohlbefinden zwischen verheirateten und unverheiratet zusammenlebenden Menschen in Europa angleichen (Perelli-Harris, Hoherz, Lappegård & Evans, 2019).
2.4.3 Erwachsen sein: Familiengründung und das Leben in der festen Partnerschaft
Nicht alle Paare können oder wollen Familien gründen. Ungewollte Kinderlosigkeit kann eine sehr schwierige Erfahrung sein, jedoch sind kinderlose Paare im Schnitt nicht unzufriedener als Paare mit Kindern (Bures et al., 2009). In den Jahren der Kindererziehung sind sie sogar zufriedener (Hansen, 2012). Der Übergang zur Elternschaft bringt für eine Partnerschaft häufig nicht nur Erfüllung und einen Beitrag zur persönlichen Entwicklung mit sich, sondern auch Stress und Belastung. Es gilt, die Mehrarbeit und die finanzielle Belastung zu schultern sowie die Kinderbetreuung zu organisieren, körperliche Veränderungen durch die Schwangerschaft zu verarbeiten, in die neue Identität als Elternteil hineinzuwachsen. Die Partnerschaftszufriedenheit sinkt im ersten Jahr nach der Geburt des Kindes und auch im weiteren Verlauf ab (van Scheppingen et al., 2018). Wie gravierend der Einschnitt ist, hängt im Bevölkerungsvergleich von vorhandenen sozialen und finanziellen Ressourcen ab. Das Vorhandensein von familienfreundlichen gesetzlichen Regelungen ist ebenfalls ein wichtiger Einflussfaktor (Berger & Carlson, 2020).
Zu beobachten ist in dieser Phase eine Verschiebung in Richtung traditioneller Geschlechtsrollen und Arbeitsteilung, die auch als der elterliche Imperativ bezeichnet wird, d. h., Frauen spezialisieren sich in Kinderbetreuungsaufgaben und übernehmen deutlich mehr Aufgaben im Haushalt, während Männer sich auf ihre Rolle als Ernährer fokussieren. Fragen von Gerechtigkeit, Fairness und beruflicher Selbstverwirklichung werden dadurch relevanter. Diese Aufteilung, die immer noch auch ideologisch gerahmt wird (»das Kind gehört zur Mutter«), ist auch eine Folge noch unzureichender Kinderbetreuungsstrukturen im Krippenbereich, deren Ausbau hinter dem wachsenden Bedarf herhinkt (Bergmann, Scheele & Sorger, 2019; Meiner-Teubner & Kopp, 2023). Auch wenn sich diese Rollenverteilung in Deutschland langsam abschwächt, ist sie nach wie vor vorhanden und manifestiert sich z. B. durch den damit einhergehenden Karriereknick bei Frauen, zu deren Ungunsten sich Machtverhältnisse und somit auch die Beziehungszufriedenheit nach Geburt eines Kindes eher verschieben (Thomeer, Umberson & Reczek, 2020). Doch es trifft beide Partner: Paare, die in dieser Phase in traditionellen Geschlechterrollen agieren, sind unzufriedener als egalitär organisierte Paare, bei denen die Elternrolle von beiden Eltern ausgefüllt wird (McClain & Brown, 2017).
Nach wie vor sind Frauen typischerweise aktiver in der Beziehungspflege (Umberson et al, 2016). In vielen Studien zeigen sich Merkmale von Frauen als einflussreicher für die Paarbeziehungsqualität (van Egeren, 2003). Sie werden als die »Architekten« der elterlichen Zusammenarbeit beschrieben (Mangelsdorf et al., 2011). Die höhere Beziehungslast für Frauen bietet auch Erklärungspotenzial für Konflikte in (heterosexuellen) Paarbeziehungen – Frauen trennen sich häufiger und sind häufiger unzufrieden in der Beziehung (Kalmijn & Poortman, 2006). Im Verlauf einer Liebesbeziehung werden partnerschaftliche Merkmale wie gemeinsame Werte und Einstellungen, Kommunikation und Problemlösung, Häufigkeit von gemeinsamen Aktivitäten und Gesprächen, Ausgewogenheit gegenseitiger Unterstützung für die Paarzufriedenheit im Vergleich zu emotionaler Intensität und physischer Attraktivität immer bedeutsamer (Schmitt, Kliegel & Shapiro, 2007). Die Kräfte der oben mit der Metapher der Alchemie bezeichneten partnerschaftlichen Interdependenz bilden in allen Bereichen zunehmend stabilerer Muster. Immer deutlicher schält sich heraus, dass Menschen in langfristigen Partnerschaften linked lives, d. h. verknüpfte Leben führen. Die enge gegenseitige Beeinflussung ist dabei weitreichend und betrifft nicht nur die oben dargestellte Bindungsdynamik, sondern auch emotionale Stabilität (Proulx, Ermer & Kanter, 2017), Sexualität, berufliche Entwicklung (Solomon & Jackson, 2014) und den Umgang mit Stress.
Vor allem die partnerschaftliche Stressbewältigung hat sich angesichts des gesellschaftlichen Leistungsdrucks, familiärer Anforderungen und Stress erzeugenden Ereignissen wie die Covid-19-Pandemie als zentrales Merkmal langfristiger partnerschaftlicher Zufriedenheit herausgestellt (Bodenmann & Cina, 2006). Paare können Stress durch Arbeitslosigkeit, Kindererziehung oder Krisen gemeinsam bewältigen, indem sie Bewältigungsstrategien wie das Kommunizieren von Stressgefühlen oder gegenseitige emotionale oder praktische Unterstützung anwenden (Bodenmann, Randall & Falconier, 2016). In einer Untersuchung über fünf Jahre hinweg konnte Guy Bodenmann an Hinweisen auf erfolgreiche Stressbewältigung über 73 % der Paare richtig den Kategorien »stabil-zufrieden, stabil-unglücklich, getrennt/geschieden« zuordnen (Bodenmann & Cina, 2006). Damit hat die gemeinsame Bewältigung von Stress einen starken Einfluss auf die Zukunft einer Partnerschaft. Bindungssichere Paare tun dies erfolgreicher (Gagliardi et al., 2013). Nicht zu unterschätzen ist hierbei der biopsychologische Einfluss von Bindung als Beruhigungsform. Ditzen et al. (2008) fanden in einer Tagebuchstudie mit Paaren, dass der Hormonspiegel des Stresshormons Cortisol bei Zärtlichkeiten im Alltag signifikant niedriger war, vermutlich durch das Hormon Oxytocin, das bei Körperkontakt ausgeschüttet wird – so wie zwischen Mutter und Kind.
Eng mit Bindung und Verbundenheit, aber auch mit Alltagsbewältigung und -stress verknüpft ist die Entwicklung der Sexualität in längeren Beziehungen. Hier zeigt sich eine große Bandbreite und Vielfalt in der Sexualfrequenz, den Sexualpraktiken und dem Stellenwert von Sexualität zwischen Personen. Gleichzeitig ist generell eine Abnahme der sexuellen Aktivität über die Zeit zu sehen, die auch an das Lebensalter geknüpft ist (Briken, 2021). Bezüglich der sexuellen Zufriedenheit ist die Datenlage uneinheitlich. In der repräsentativen GESiD-Studie (Briken, 2021) zeigten sich sexuell aktive Alleinstehende mit ihrer Sexualität deutlich unzufriedener als Befragte in einer festen Partnerschaft, wobei die Zufriedenheit mit der Sexualität über die Beziehungsdauer hinweg abnahm. In einer Befragung zu »Optimaler Sexualität« waren es häufiger ältere Langzeitpaare, die äußerst zufrieden mit ihrer Sexualität waren und diese als intensiv, verschmelzend und sogar transzendent bezeichneten (Kleinplatz et al., 2009). Im Kontrast dazu verglich Kislev (2020) Verheiratete, unverheiratet Zusammenlebende und weitere Personengruppen (Singles, geschieden-zusammenlebend etc.) des pairfam-Panels (einer umfangreichen Längsschnittstudie aus Deutschland) bezogen auf ihre Lebenszufriedenheit und ihre sexuelle Zufriedenheit und stellte fest, dass verheiratete Personen niedrigere Werte aufwiesen als die anderen Gruppen, z. B. bezogen auf sexuelle Kommunikation, sexuellen Selbstwert und Sexualfrequenz. Singles berichteten bessere Werte in sexueller Kommunikation und sexuellem Selbstwert.12 Ihre Unzufriedenheit mit der Sexualität war nur mit der Sexualfrequenz verbunden. Kishlev schließt daraus, dass die Ehe als Institution nicht zwingend die Sexualität verbessert, sondern lediglich (so wie nicht-verheiratete Formen der Partnerschaft) die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich ein Sexualpartner in Reichweite befindet.
Probleme im Bereich der partnerschaftlichen Sexualität sind ein Teil der Beziehungsdynamik (Birnbaum, 2019). Themen wie Macht, Versorgung, Enttäuschung nehmen Einfluss auf die partnerschaftliche Sexualität, genau wie weitere Einflüsse: Die individuelle Lovemap, die vielleicht in der Partnerschaft nicht vollständig gelebt werden kann, Vorstellungen über Geschlechterrollen in der Sexualität (z. B. Männer begehren, Frauen werden begehrt) oder (sub-)kulturelle Vorstellungen von Sexualität, wie sie sich z. B. in der queeren Community ausprägen. Zu wenig Beachtung finden häufig die Folgen früher Traumatisierungen und sexualisierter Gewalt (Büttner et al., 2014; Witting & Busby, 2019). Solche Erlebnisse sind weit verbreitet. Jede 13.–14. Frau erlebte einer Repräsentativbefragung zufolge bis zum ihrem 16. Lebensjahr sexuellen Missbrauch mit Berührung, während es bei den Männern »nur« jeder 67. Mann war (Stadler, Bieneck & Wetzels, 2012). Daraus resultierende Traumafolgen beinhalten häufiger Aversion gegen körperliche Berührung und Vermeidung von Sexualität, seltener riskantes Sexualverhalten und damit potenzielle Reviktimisierung innerhalb der Partnerschaft (Büttner, 2014; Claassen, Palesh & Aggarwal, 2005). Sexuelle Übergriffe, genau wie auch weitere Gewalterfahrungen, beeinträchtigen nicht nur das Erleben genussvoller Sexualität, sondern haben tiefgreifende Wirkung auf Persönlichkeit und Gefühlsleben.
2.4.4 Übergänge, Trennungen und Neuanfänge
Zufriedenheitsverläufe in Partnerschaft und Familie erweisen sich in neuerer Forschung als vielfältiger als noch vor kurzem gedacht. Die Mehrheit der Personen in bestehenden Partnerschaften ist und bleibt insgesamt zufrieden (Karney & Bradbury, 2020). Hierfür haben Menschen, die als junge Erwachsene positive intime Beziehungen führen, die besten Chancen (Adamczyk & Segrin, 2016). Huston (2009) stellte dagegen fest, dass, verglichen mit Paaren, die nach 13 Jahren noch glücklich verheiratet waren, unglücklich verheiratete Paare schon von Anfang an eine eher niedrige Beziehungsqualität berichteten. Auch Persönlichkeitseigenschaften wirken sich auf die Beziehungszufriedenheit aus, wie z. B. Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit (negativ) sowie Offenheit für neue Erfahrungen (positiv; White, Hendrick & Hendrick, 2004). Das Fehlen positiver Beziehungsmuster und -ressourcen ist ein zentraler Trennungsgrund, seltener auch ein Vorstellungsgrund in der Paartherapie, die häufig erst als letztes Mittel aufgesucht wird. Darunter liegen oft tiefer gehende Differenzen in Themenbereichen wie Beziehungsgerechtigkeit, Machtgefälle, Verständnis, Unterstützung und Versorgung. Vielfach musste das Paar mit mehreren Stressoren wie Krankheit, Schwierigkeiten in der Erziehung oder finanziellen Problemen kämpfen, so dass sich ungute Strukturen und emotionale Distanzierung ohne ausreichende Gegenwehr verfestigen konnten.
Meston und Buss (2007) stellen fest, dass der Wunsch nach emotionaler Nähe und intensiver Beziehung einer der häufigsten Gründe dafür ist, Sex zu haben. Und so stellt eine heimliche Außenbeziehung dann einen verbreiteten (oft unbewussten) Lösungsversuch zur Deckung der in der Partnerschaft wahrgenommenen Defizite dar. In der Paartherapie beschreiben Menschen mit Affären, dass sie sich durch diese wieder lebendig fühlen. Die Aufdeckung oder das Geständnis außerehelichen Sexualverkehrs hat negative emotionale Konsequenzen für den Partner, geht mit Gefühlen von Wut und Scham einher und löst häufig eine Trennung aus (Frisco, Wenger, & Kreager, 2017). Bei einer Umfrage von Elite-Partner (2017; »Wann würden Sie sich am ehesten trennen?«) belegte »eine längere Affäre« den ersten Platz, 77 % der Repräsentativstichprobe würde sich deshalb trennen (im Vergleich: nur 22 % würden sich »wegen anhaltender Sex-Flaute« trennen).
Unumstritten ist auch der Selektionseffekt beim Zustandekommen einer Trennung/Scheidung: Negative Einflüsse im Vorfeld der Trennung (z. B. Bindungsunsicherheit, hohes Konfliktniveau, Psychopathologie) erhöhen gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit einer Trennung, eines schwereren Verlaufs und eines dauerhaft niedrigeren Wohlbefindens (Cherlin, Kiernan & Chase-Lansdale, 1995). Eltern mit mehr als einem Kind trennen sich hingegen seltener. Auch hier ist Selektion im Spiel, weil Paare mit niedrigerem Commitment weniger Kinder zusammen bekommen (Loter, Arránz Becker, Mikucka & Wolf, 2019). Die erhöhte psychische Vulnerabilität (s. o.) sexueller Minoritäten dürfte deren höhere Trennungsrate begünstigen, jedoch wurden die genauen Gründe für letztere bislang zu wenig untersucht.
Aktuell beträgt die durchschnittliche Ehedauer bei einer Scheidung 14,5 Jahre, Trennungen finden daher – bei einem durchschnittlichen Heiratsalter von 32,3 Jahren für Frauen und 34,8 Jahren für Männer – im mittleren Erwachsenenalter statt. Die Scheidungsrate (Zahl der Ehescheidungen relativ zur Zahl der Eheschließungen) betrug in Deutschland im Jahr 2021 knapp 40 %.13 Wer sich trennt, ist also in guter Gesellschaft. Trotzdem wird eine Trennung nach einer Langzeitbeziehung von den meisten Menschen als krisenhaft erlebt, denn sie führt typischerweise innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums zu einer Kumulation von Belastungsfaktoren. Der Verlust einer Bindungs- und Bezugsperson, oft auch von Freundschaften und sozialer und emotionaler Unterstützung, sowie die Anpassungsleistung daran, allein zu leben, erhöhen das Risiko negativer Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden (Amato, 2000; Leopold & Kalmijn, 2016; Tosi & van den Broek, 2020). Eine Vielzahl von Studien fand im Zuge von Trennungen und Scheidungen negative Folgen für die physische und psychische Gesundheit, das Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit (Hewitt and Turrell, 2011; Hewitt et al., 2012; Sbarra et al., 2014; Sbarra, 2015; Leopold & Kalmijn, 2016; Hald et al., 2020).
Bei der Frage nach langfristigen Trennungsfolgen gehen die Forschungsmeinungen auseinander: Das chronische Belastungsmodell geht davon aus, dass die Kumulation von Belastungsfaktoren über die Zeit zu einem zu einem dauerhaft niedrigeren Niveau bezüglich Gesundheit und Wohlbefinden führt, weil sie sich auf die Fähigkeit auswirken kann, wie mit zukünftigen belastenden Lebensereignissen umgegangen wird. Das Krisenmodell geht davon aus, dass sich das Wohlbefinden nach einer Anpassungsphase wieder auf den individuellen »Sollwert des Individuums« zurückbewegt, der durch Gene und stabile Persönlichkeitsfaktoren ein stabiles Ausgangsniveau hat (Lucas, 2016). Bislang sprechen mehr Befunde für das Krisenmodell, auch bei älteren Populationen (Tosi & van den Broek, 2020).
Einige Studien weisen darauf hin, dass Elternschaft ein wichtiger Moderator für die Bewältigung einer Trennung ist. Ungefähr die Hälfte aller Ehescheidungen betrifft minderjährige Kinder.14





























