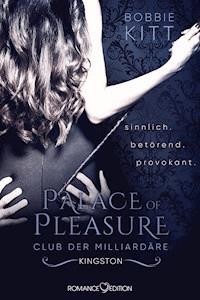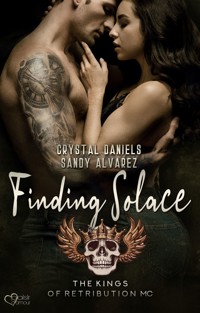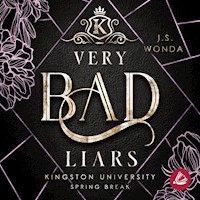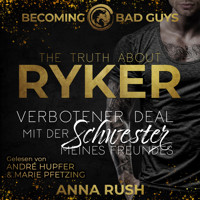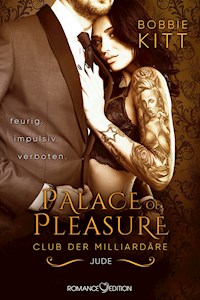
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Romance Edition Verlag
- Kategorie: Erotik
- Serie: Palace of Pleasure
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Seit ein Skandal seine Karriere als Baseballprofi beendet hat, hält sich Jude Myers aus dem Rampenlicht fern – und nach Möglichkeit auch von hübschen Frauen. Seine Devise lautet: Keine Dates und keine Affären außerhalb des Pleasure Clubs, da dieser für seine Diskretion bekannt ist. Als die Tochter seines verstorbenen Bruders eine Freundin einlädt, den Sommer auf dem gemeinsamen Familienanwesen zu verbringen, gerät sein Grundsatz allerdings ins Wanken. Die achtzehn Jahre jüngere Jamie ist mörderisch sexy, gefährlich vorlaut und sie weiß mit ihren Reizen zu spielen. Jude setzt alles daran, nicht noch mal für negatives Aufsehen zu sorgen und Jamie zu widerstehen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Besonders, wenn man eine lange Zeit als der größte Playboy Texas' galt und die süße Draufgängerin keinen Hehl daraus macht, dass ihr Ziel das Bett in seinem Schlafzimmer ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 726
Ähnliche
Für Steffi, die eigentlich zu cool für Schnulzen ist,lieber Schurken jagt oder sich nachtsmit Jesus im Wald trifft.Stell dir einfach vor,ich hätte dir einen Zombieroman mitSuperhelden gewidmet.
BOBBIE KITT
PALACEOFPLEASURE
CLUB DER MILLIARDÄRE 4
JUDE
Erotic Romance
PALACE OF PLEASURE: JUDE
Bobbie Kitt
© 2020 Romance Edition Verlagsgesellschaft mbH8712 Niklasdorf, Austria
Covergestaltung: © SturmmöwenTitelabbildung: © alexvolotLektorat und Korrektorat: Romance Edition
ISBN-Taschenbuch: 978-3-903130-48-7ISBN-EPUB: 978-3-903130-49-4
www.romance-edition.com
Inhalt
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
38. KAPITEL
39. KAPITEL
40. KAPITEL
41. KAPITEL
EPILOG
DIE AUTORIN
It doesn’t matter who you love,as long as you do it with your whole heart.
1. KAPITEL
Jamie
Das Leben steckt voller Überraschungen. Einige sind angenehm, andere weniger schön, und ab und zu passiert dir etwas, das gleichzeitig supercool und bedauernswert ist.
Ein Beispiel?
Stell dir vor, du ergatterst an einem heißen Junitag die letzte gekühlte Coke light an der Raststätte. Supercool, oder? Die Welt ist auf deiner Seite. Doch beim Versuch, die Dose zu öffnen, explodiert sie quasi in deiner Hand und verteilt sich auf deinem einzigen sauberen T-Shirt. Bedauernswert. Aber so richtig beklagen darfst du dich erst, wenn du drei Stunden später in deinem von oben bis unten mit Cola bespritzten Minnie Mouse-Outfit unerwartet vor einer Legende stehst. Vor einem Mann, der sein halbes Leben lang von der gesamten Nation angebetet wurde und der zufällig auch noch der schärfste Typ auf Gottes Erdboden ist. Selbst das wäre allerdings noch irgendwie zu verkraften, wäre dein Name nicht Jamie Wallace. Wenn er nämlich Jamie Wallace lautet, hast du ein Riesentalent dafür, eine bedauerliche Situation in eine verheerende zu verwandeln.
»Heilige Scheiße, Bex, du hättest mir sagen müssen, dass du mit Jude-ultrasexy-Myers verwandt bist«, stoße ich aus, und zwar ungeachtet der Tatsache, dass der ultrasexy Kerl mich hören kann. Die meiste Zeit über habe ich keine Kontrolle über meine Zunge, und meine Gedanken stolpern viel zu oft enthemmt aus meinem Mund – ohne Rücksicht auf mein leicht zu entbrennendes Schamempfinden. Ich sag ja, ich zaubere die Katastrophen geradezu aus dem Ärmel.
»Ähm … Habe ich das nie erwähnt?«, fragt meine Freundin, die mich ihrem berühmten Verwandten gerade als ihre Mitbewohnerin vom College vorgestellt hat.
Der blonde Kerl – Verzeihung, Gott! Jude Myers ist ein Gott! –, der mit nacktem Oberkörper neben seinem Bike in der Sonne kniet, sieht mich verstört an. Wahrscheinlich würde ich auch entgeistert dreinschauen, wenn ich ein einschüchternder, abgeklärter Ex-Baseballprofi von Ende dreißig wäre und ein zwanzigjähriges Mädchen im fleckigen Mäuse-Shirt auf meinem Grundstück auftauchen und mich als ultrasexy bezeichnen würde.
»Tut mir leid. Das wollte ich nicht sagen. Also nicht, dass Sie nicht ultrascharf wären, wahrscheinlich wissen Sie genau, dass Sie sowas wie ein Sexsymbol sind. Aber ich hätte nicht …« Ich presse die Lippen aufeinander und spüre, wie meine Ohren heiß werden. Ich rede mich um Kopf und Kragen. »Ich halte jetzt vermutlich besser die Klappe. Vielleicht können wir alle die letzten zwei Minuten aus unserem Gedächtnis streichen und noch mal neu anfangen?«, frage ich und strecke ihm todesmutig eine Hand entgegen. »Hi, ich bin Jamie Wallace, und es ist wirklich nett von Ihnen, dass Sie Bex erlaubt haben, mich mit nach Hause zu bringen.« Am liebsten würde ich mich in Luft auflösen, aber das machen die physikalischen Eigenschaften meines Körpers unmöglich. Vielleicht klappt verflüssigen? Der Mensch besteht doch zu sechzig Prozent aus Wasser, nicht wahr?
Jude Myers – Hölle noch mal, ich kann nicht glauben, dass der Kerl Bex’ Onkel ist – wirft den Schraubenschlüssel in den Werkzeugkasten, mit dem er eben noch an seinem Motorrad gebastelt hat. Eine Ducati Monster, das Baby hat 145 PS. Ich würde mein Leben dafür geben, nur einmal mit dieser Maschine zu fahren. Mein Dad war Biker, er hat seine Harley mindestens so geliebt wie mich und mir alles über Motorräder beigebracht.
Ich beobachte, wie Mister Gottgleiches-Sexsymbol nach einem Lappen neben sich greift, seine ölverschmierten Finger daran abwischt und schließlich ein Basecap vom Boden aufhebt, es anzieht und sich aufrichtet. Er ist groß. So riesig, dass ich mir mit meinen ein Meter zweiundsechzig bedeutungslos vorkomme. Wie ein Atom im Weltall. Über solche Dinge denkt man nicht nach, wenn Menschen über den Bildschirm des Fernsehers flimmern.
Er nimmt höflich meine ausgestreckte Hand. Ich wünschte, ich wäre in der Lage, ihm in die Augen zu sehen, doch ich kann den Blick nicht von seiner verschwitzten Brust abwenden. Oder von seinem trainierten Bauch. Seine Haut ist so wunderschön sonnengeküsst, sein Körper massiv, fest und glänzend. Die straffen Muskeln wölben sich, als er einen winzigen Schritt auf mich zumacht und knapp meine Hand drückt. Zu knapp. Von mir aus könnte er sie eine Stunde lang festhalten. Außerdem will ich unbedingt an seinem Bauchnabel lecken oder – als mein Blick tiefer gleitet – in seine Waden beißen. Ich wusste nicht, dass Männerbeine dermaßen sexy sein oder so wahnsinnig anziehend auf mich wirken können. Ich muss mich wirklich zusammenreißen, nicht in die Hocke zu sinken und meine Lippen an ihnen zu reiben. So fantastisch aussehende Kerle dürften keine Dreiviertelhosen tragen, die auch noch anstößig tief auf den Hüften sitzen. Das ist der weiblichen Bevölkerung gegenüber einfach nicht fair.
»Jude«, nennt er mir überflüssigerweise seinen Vornamen, bevor er sich abwendet und den Werkzeugkasten schließt. »Rebecca hat nicht gesagt, dass sie einen Gast mitbringt. Sie muss mich nicht um Erlaubnis bitten, das Haus gehört ihr ebenso wie mir.«
Oh wow, seine Stimme. Sie ist tief, männlich und mit einem kleinen rauen Nachhall. Die Härchen an meinen tätowierten Armen richten sich auf, und das, obwohl er sich nicht glücklich darüber anhört, dass Bex mich eingeladen hat.
Vielleicht gehen ihm Groupies auf die Nerven. Dass ich mich wie ein peinliches Fangirl aufführe, lässt sich kaum abstreiten. Nicht, dass ich ein Fan wäre, mit Baseball habe ich nicht sonderlich viel am Hut, aber mein Vater war einer. Würde er noch leben, müsste ich mir die Blöße geben, den Kerl vor die Linse meiner Handykamera zu bitten. Mein Dad hat immer gesagt, dass unser Land nie einen besseren Schlagmann gesehen hat; Myers wurde nach nicht mal zehn Jahren als MLB-Profi in den 500 Home Run Club aufgenommen. Selbst mir, einem Mädchen, das nicht viel von diesem Spiel versteht, ist klar, dass das eine ordentliche Leistung sein muss. Die meisten Spieler machen in ihrer zwanzigjährigen Karriere diese Zahl nicht voll.
Myers schnappt sich den Werkzeugkasten. Ich erhasche einen Blick auf sein seitliches Profil, seinen kräftigen Bizeps und sein Gesicht, das durch den Schirm der Kappe im Schatten liegt. Der seit drei oder vier Tagen stehende Bart ist ein bisschen heller als seine gebräunte Haut, und ich schwöre, der Mann sieht in natura noch tausendmal besser aus als auf jedem Foto. Es ist eine Weile her, dass er ständig von der Presse abgelichtet auf den Titelseiten der Zeitungen prangte, damals war ich fast noch ein Kind. Aber selbst mein fünfzehnjähriges Ich fand den Kerl schon zum Anbeißen.
Er geht zu einer ein paar Meter entfernten Garage, Wagenhalle … was auch immer. Das Flachdachgebäude wirkt riesig, wie der Rest des Myers-Anwesen. Bex und ihre Familie schwimmen im Geld, zu ihrem Landsitz gehört ein drei Hektar großes Grundstück, auf dem sich unter anderem Pferdeställe befinden. Ich sehe seiner nicht minderattraktiven Rückseite zu, wie sie durch das offene Tor verschwindet, und ja, mir entfährt ein schmachtendes Seufzen, bevor ich im Augenwinkel registriere, dass Bex mich anstarrt.
»Selbst für deine Verhältnisse war das ziemlich schräg. Dir ist klar, dass du dich in nächster Zeit besser im Gästezimmer einschließen und dich in Grund und Boden schämen solltest?« Meine Freundin lacht. Nett, dass sie meinen Auftritt komisch findet. »Nachdem du dich gerade übertrieben lächerlich gemacht hast, kannst du meinem Onkel nämlich kein zweites Mal unter die Augen treten.«
»Wie konntest du mir verschweigen, dass du mit einer Legende verwandt bist?«, schimpfe ich.
Sie hätte mich darauf vorbereiten müssen. Ich wäre gern eingeweiht gewesen. Dann hätte ich vor unserer Abfahrt noch eine Maschine Wäsche waschen können, um dem Kerl in einem T-Shirt ohne Strasssteinmaus und vor allem ohne Flecken gegenüberzutreten. Ich hätte mir die Haare glattgeföhnt, anstatt sie zu einem wilden, schwarzbraunen Knäul auf dem Kopf zu tragen, und mir verdammt noch mal weniger peinliche Worte zurechtgelegt.
… wahrscheinlich wissen Sie genau, dass Sie sowas wie ein Sexsymbol sind … Der Typ muss denken, ich wäre verrückt.
»Dein Verhalten ist wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, warum ich lieber niemandem auf die Nase binde, mit Jude Myers unter einem Dach zu wohnen«, informiert sie mich. »Die meisten Menschen geraten nämlich aus dem Häuschen, und dann gibt es kein anderes Thema mehr als Baseball. Wobei, manchmal werden die Leute auch gemein und fragen, ob meine Mom den Verstand verloren hätte, weil sie mich mit sechzehn bei einem Perversling zurückließ.«
»Ernsthaft?«, will ich wissen. Das ist schockierend.
Sie zuckt mit den Schultern. »Über fünfhundert Home Runs, aber alles, woran sich manche Idioten erinnern, ist dieser eine Fehler.«
Jude Myers Karriere endete frühzeitig und mit einem Knall. Ich weiß noch gut, wie die Presse über ihn herfiel, nachdem er nach einem Spiel mit einem minderjährigen Mädchen in einer heiklen Situation erwischt wurde. Mein Dad war außer sich, als bekannt wurde, dass er nicht mehr aufs Spielfeld gehen würde. Auch meiner Meinung nach sollte man niemanden vorschnell verurteilen, aber wie das so ist nach der Jahrtausendwende: Medien und soziale Netzwerke brechen einem mitunter schon vor einem Schuldspruch das Genick.
»Lass uns das Auto ausladen. Danach führe ich dich durchs Haus. Das heißt, ich zeige dir das Zimmer, in dem du dich den Sommer über peinlich berührt verkriechen kannst.« Bex klemmt sich das kinnlange blonde Haar hinter die Ohren und deutet mit einer Kopfbewegung zur Auffahrt.
Ich folge ihr zur Vorderseite der verwinkelten Villa, wo sie ihr Cabriolet abgestellt hat. Das Verdeck steht offen, die Nachmittagssonne brennt auf die schwarzen Ledersitze. Wir nehmen den Großteil unseres Zeugs aus dem Wagen – die Kartons mit den Büchern und meinem Notebook bleiben im Kofferraum – dann steuern wir die zwei Stufen des Eingangs an.
Bex und ich kennen uns erst seit knapp einem Jahr. In unserem dritten Semester an der Brown haben wir beide einen Kurs belegt, in dem die Geschlechterrollen im Wandel der Zeit beleuchtet wurden. Weder sie noch ich können mit diesem Wissen irgendwas anfangen. Bex legt es auf einen Abschluss in Wirtschaft an, ich arbeite auf einen in Geowissenschaften hin. Also haben wir die Stunde in der Regel damit verbracht, uns zu unterhalten, und uns auf Anhieb gut verstanden. Obwohl wir aus zwei völlig unterschiedlichen Welten kommen, sind wir uns ähnlich, beziehungsweise haben wir eine ähnliche Geschichte: Wir sind beide Einzelkinder. Ihr Dad starb vor fünf Jahren an Leukämie, meiner kam vor vier bei einem Motorradunfall ums Leben. Ihre Mom ging nach dem Tod ihres Mannes nach Irland, meine Mutter haute zurück nach Tokio ab, als ich zweieinhalb war. Als ich Bex sagte, dass ich nicht weiß, wo ich den Sommer verbringen soll, da ich dank einer unschönen Trennung ohne Obdach bin und erst nach den Ferien ein Zimmer auf dem Campus beziehen kann, lud sie mich ein, mit ihr nach Texas zu fahren. Zumindest für eine kurze Zeit ist meine Situation gerettet. In anderthalb Wochen besucht sie für den Rest des Sommers ihre Mom, und ich werde mir etwas einfallen lassen müssen. Aber bis dahin …
»Fühl dich ganz wie zu Hause«, meint sie, als sie die breite Tür aufschließt und wir schwer bepackt die Villa betreten.
Mir bleibt für einen Moment die Luft weg. Es ist, als würde ich in einer sehr luxuriösen Bahnhofshalle stehen. Ich kann nicht sagen, was ich irritierender finde. Dass die schwarz geflieste Eingangshalle so groß wie das gesamte Apartment ist, das ich in den letzten zwei Jahren zusammen mit Conan bewohnt habe, oder dass eine rothaarige junge Frau im dunkelblauen Dienstmädchendress herbeigeeilt kommt, als Bex mit der Ferse die Tür hinter sich zudrückt.
»Rebecca, wie schön, dass Sie gesund angekommen sind«, begrüßt sie meine Freundin mit einer viel tieferen und resoluteren Stimme, als ich der kleinen Person auf Anhieb zugetraut hätte.
»Schon gut, Rosanna, wir schleppen unseren Kram allein. Sie wissen doch, dass ich Sie nicht als Packesel missbrauche«, hält Bex sie davon ab, ihr auch nur eine ihrer drei Reisetaschen abzunehmen. »Jamie, das ist Rosanna, unsere Hausfee. Jamie studiert mit mir in Rhode Island und ist eine Weile unser Gast, Rosanna.«
»Willkommen auf Cedar Hill.« Sie lächelt mich freundlich an, und mir fällt auf, wie hübsch sie ist. Ich glaube nicht, dass sie die Dreißig schon überschritten hat. Ihre Augen sind strahlend grün, und ihre helle Haut hat keinen einzigen Makel. Ich kann den Gedanken nicht abschütteln, ob Mister Myers sie eingestellt hat und vielleicht ihr Aussehen der Grund dafür war. Wäre ich ein reicher, heißer Baseballprofi – oder Exprofi –; ich würde jedenfalls bewusst schöne Frauen für mich arbeiten lassen.
»Ich bin ein bisschen zu überwältigt, um eine vernünftige Begrüßung zu formulieren«, deute ich an, mich wie Cinderella zu fühlen, die gerade den königlichen Ballsaal betreten hat. Bex wohnt in einem verdammten Palast.
Ihr Lächeln wird breiter, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder Bex widmet. »Falls Sie irgendwas brauchen, finden Sie mich in der Küche. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass heute der perfekte Tag wäre, zum Abendessen eine Lasagne in den Ofen zu schieben.« Rosanna zwinkert, als wüsste sie genau, dass meine Freundin auf Lasagne abfährt. Dann wendet sie sich ab und schlägt die Richtung ein, aus der sie gekommen ist. Die offenstehende Flügeltür muss in die Küche oder Wirtschaftsräume führen.
»Ihr habt ein Hausmädchen«, bringe ich ungläubig hervor. »Und einen Springbrunnen im Foyer. Bex, verdammt. Als du gesagt hast, dass deine Familie Geld besitzt, dachte ich nicht, dass du meintest, du wärst eine halbe Prinzessin.«
»Als ich noch klein war, schwammen da Goldfische drin«, klärt sie mich auf, während wir an dem Brunnen vorbeilaufen. »Aber Moms Perserkatzen haben sich dauernd einen geschnappt und gefressen.«
Ich mustere das riesige Becken, in dessen Mitte eine stufige Steinsäule aufragt. Wasser rinnt die Staffeln hinab. Die Vorstellung, die Sandalen auszuziehen und meine Füße in dem Bassin abzukühlen, ist verdammt verlockend. Allerdings bezweifle ich, dass das Teil hier steht, damit Leute wie ich ihre Zehen hineinstecken. Es dient vermutlich nur der Dekoration.
»Die Schlafräume sind oben. Allerdings macht es Sinn, wenn wir die Klamotten, die gewaschen werden müssen, hier unten lassen. Sonst schleppen wir sie rauf und runter.« Bex stellt ihr Gepäck auf den Boden.
Ich lasse den Seesack, den ich mir über eine Schulter geworfen hatte, vom Rücken gleiten und lege ihn zusammen mit einer Reisetasche neben der gigantischen Treppe ab. Nur den Rucksack mit meinen Kosmetikartikeln behalte ich in der Hand.
»Du musst mir ein Shirt leihen. Die Maus war mein letztes sauberes, und die Betonung liegt seit dem Rastplatz auf war.«
Ich habe die vergangenen drei Wochen in Bex’ Apartment übernachtet und noch jede Menge Kram bei Conan. Ich konnte nicht alles mitnehmen, als ich aus unserer Wohnung geflüchtet bin. Außerdem war anfangs ganz und gar nicht sicher, ob ich nicht doch wieder weich werden und zu ihm zurückgehen würde. Wir sind nicht zum ersten Mal getrennt, der Kerl baut schließlich ständig Mist, aber diesmal bin ich entschlossen, mich nicht wieder von ihm um den Finger wickeln zu lassen.
»Kein Problem. Mein Schrank ist dein Schrank«, gibt sie zurück, während wir nach oben gehen.
»Der Gästebereich liegt im Südflügel, hier den Flur entlang.« Bex führt mich links durch einen Rundbogen, als wir das erste Stockwerk erreichen. »Du kannst dir eins der drei Schlafzimmer aussuchen. Ich würde direkt das erste nehmen, von dem dazugehörigen Balkon aus hat man den schönsten Ausblick über das Grundstück.«
Die Schlafzimmer besitzen einen Balkon? Ehrlich, ich stamme nicht aus einem Slumviertel oder so, ich bin nicht in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Meinem Dad und mir gehörte ein kleines Haus in Portland, er hatte einen gutbezahlten Job am Hafen, und ich würde behaupten, dass er mich eher verwöhnt hat. Seit seinem Tod muss ich zwar aufs Geld achten, doch mir geht es nicht schlecht. Aber als Bex die Tür zu dem Raum öffnet, der die nächsten Tage mein Zuhause sein wird, fühle ich mich in meinem beschmutzten T-Shirt völlig deplatziert. Er ist strahlend weiß, so hell, dass es fast in den Augen schmerzt. Ein – vermutlich ziemlich teurer – Wuschelteppich liegt vor einem Himmelbett, in dem getrost vier Leute schlafen könnten. Eine Schrankwand zieht sich die rechte Längsseite des Zimmers entlang, und das Ölgemälde über der antikwirkenden Kommode sollte besser in einem Museum hängen. Zwischen den bodentiefen Sprossenfenstern führt eine Glasflügeltür auf den erwähnten Balkon, und gottverdammt; da ist ein Kronleuchter an der Decke.
»Besuchen euch manchmal die Vanderbilts oder Kennedys, und übernachtet einer von ihnen dann in diesem Zimmer?«, scherze ich. »Ich schätze, selbst die englische Königin würde vor Neid erblassen, wenn sie wüsste, dass jemand wie ich mich mit meinem einfältigen Arsch durch dieses Bett wühlen darf. Vielleicht sollte ich auf dem Teppich mein Nachtlager aufschlagen. Nur um sicherzugehen, keinen Krieg mit Großbritannien anzuzetteln.«
Bex lacht. »Wir haben selten Besuch, und falls alle Jubeljahre doch mal jemand vorbeischaut, heißt der nicht Vanderbilt oder Kennedy. Und ganz gewiss hat das englische Königshaus nicht die Macht, einen Krieg zu beginnen. Du kannst also sorglos das Bett benutzen. Oder das Bad. Hinter der Schiebetür dort vorn findest du eine Toilette und Dusche.«
Natürlich grenzt an dieses Zimmer ein Bad. Logisch. Wahrscheinlich gehört auch noch ein Landeplatz mit Helikopter dazu.
Ich durchquere den Raum und ziehe die besagte Tür auf. Ich muss nicht erwähnen, dass dort getrost jemand einziehen könnte, wenn man ihm ein Bett und einen Herd hineinstellen würde? »Das nennst du eine Dusche? Für mich ist das ein halber Wellnesstempel. Ich habe mich spontan verliebt und werde wohl das Wochenende unter dieser Brause verbringen. Ich meine Brausen. Mehrzahl. Da oben kommt doch das Wasser raus, richtig?« Ich zeige mit einem Finger an die Decke der begehbaren Kabine, an der ich mehrere Düsen ausmache. Dieselben wie in der Wand. Echt jetzt – spontan verliebt ist weit mehr als untertrieben.
»Tu dir keinen Zwang an. Um ehrlich zu sein, könnte ich nach der Fahrt auch eine Ladung Wasser vertragen. Was hältst du davon, wenn ich dich mit dem Baby alleinlasse? Wenn du fertig bist, kommst du zu mir. Ich borge dir dann was zum Anziehen.«
»Deal.« Der Vorschlag begeistert mich. »Brauche ich einen Gebäudeplan, um dein Zimmer zu finden?«
»Südflügel, selbe Etage. Die dritte Tür rechts«, erweitert Bex meinen geistigen Horizont.
»Klingt, als käme ich ohne Navigationssystem klar.«
»Frische Handtücher findest du im Regal neben den Waschbecken, ein Bademantel hängt im Schlafzimmerschrank. Falls du Duschzeug oder irgendwas Ähnliches brauchst; steht alles auf der Ablage dort.« Sie verweist auf einen Mauervorsprung unter dem Fenster.
Dreißig Minuten später stehe ich in ein gleißend weißes Frotteehandtuch gewickelt vor dem monströsen Spiegel der Schrankwand und rubble mein Haar trocken. Das Haus ist klimatisiert, ich konnte nicht wiederstehen, die Strahlen der Massagedusche so heiß einzustellen, dass meine Haut ganz rot ist. Das heißt, überall da, wo ich nicht tätowiert bin.
Das erste Motiv habe ich mir mit fünfzehn stechen lassen. Simba, den König der Löwen. Das Raubkatzenkind ziert mein linkes Schulterblatt. Einundzwanzig weitere Disney-Bilder sind seither hinzugekommen. Jedes einzelne davon erinnert mich an meinen Dad, drei davon hat er noch kennengelernt.
Wenn es eine Auszeichnung für den weltbesten Vater gäbe; er hätte sie in jedem Jahr verdient gehabt. Meine Mom und er waren jung, als sie mich ungeplant in die Welt setzten. Das mit ihnen war nicht die große Liebe. Weil meine Mutter schwanger war, steckte er ihr trotzdem einen Ring an den Finger. Er wollte immer alles richtigmachen, seinem Baby eine Familie bieten. Doch das mit den beiden funktionierte nicht gut. Als die Eltern meiner Mom in ihre Heimat nach Japan zurückgingen, beschloss sie, mit ihnen die Staaten zu verlassen. Ich blieb bei meinem Dad.
Er hat meistens über fünfzig Stunden die Woche gearbeitet und trotzdem immer Zeit gefunden, etwas mit mir zu unternehmen. Ich ging nie ohne eine Gute-Nacht-Geschichte ins Bett. Jeden zweiten Sonntag hatte er seinen freien Tag, er nahm mich mit zum Fischen, zeigte mir das Eisenbahnmuseum, oder wir schauten uns im Stadion ein Baseballspiel der Sea Dogs an. Na ja, okay, er sah sich das Spiel an, während ich einen Hot Dog verdrückte und ihm beim Jubeln und Fluchen beobachtete.
Ich war fünf Jahre alt, als er sich einen Oldtimer lieh und wir einen Roadtrip machten, als ich acht war nahmen wir das erste Mal seine Maschine. Sommer für Sommer zeigte er mir die Strecken, die er bereits vor meiner Geburt mit seinem Bike gefahren war. Wir waren am Grand Canyon, fuhren die Pazifikküste runter, schliefen in Motels. Wir durchkreuzten alle Bundesstaaten, aber ganz egal, wie die Route aussah: Jede Tour endete mit einem Besuch in Disney World.
Ich vermisse ihn, mir fehlen unsere Sommer-Trips, und ich glaube, er würde sich scheckiglachen, wenn er wüsste, dass ich in einem schneeweißen Luxus-Gästezimmer stehe und mich plötzlich nach einem der heruntergekommenen Motels sehne, in die wir während unserer Ausflüge eincheckten. Er würde mir sagen, ich wäre verrückt, und ich würde antworten, dass meine Verrücktheit erblich bedingt sei und seine Gene verantwortlich wären.
Ich öffne den Schrank und suche den Bademantel, der hier irgendwo sein muss. Aber wie es aussieht, hat mir Bex eine falsche Info gegeben. Weder hinter dieser noch hinter einer der elf – ja, elf! – anderen Türen kann ich das Teil entdecken. Allerdings ist das Handtuch, in das ich eingewickelt bin, beinah groß genug, um zwei Menschen meiner Maße zu verstecken. Also verschwinde ich zurück ins Bad, um das zweite in einen Korb zu werfen, der hoffentlich für benutzte Wäsche gedacht ist, und meine Haare zu bürsten. Dann mache ich mich auf den Weg zu Bex’ Zimmer. Südflügel, selbe Etage. Die dritte Tür rechts.
Ich komme an der Treppe vorbei und müsste damit eigentlich schon im richtigen Gebäudeteil sein. Die dritte Tür befindet sich am Ende des monströsen Flurs. Doch die vorderste steht offen, und obwohl ich mein Ziel vor Augen habe, sorgt ein imaginäres Seil dafür, dass ich einfach stehenbleibe. Ein Pokal zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Er steht hinter dem Türbogen in einer Vitrine.
Hätte ich meinen Blick doch bloß geradeaus gerichtet.
Neugier ist eine heikle Sache. Wenn du ein Kind bist, will dir alle Welt weismachen, dass Wissensdurst gesund und gut für deine Entwicklung ist. Hast du aber erst mal ein gewisses Alter erreicht, heißt es, du sollst dich gefälligst nur um deinen eigenen Kram scheren. Ich bin wirklich niemand, der seine Nase ständig in fremde Angelegenheiten steckt oder im Leben anderer Leute herumschnüffelt. Aber verdammt, ich halte mich im Haus von Jude Myers auf, und wenn das kein Rechtfertigungsgrund ist, einen Korridor zu betreten, um sich eine Trophäe anzusehen …
Ich biege in den Flur, obwohl sich der Raum vielleicht besser als eine Art eigener kleiner Eingangsbereich beschreiben lässt. Er muss zu einer separaten Suite gehören. Zumindest sprechen Schuhschrank und Garderobenhaken dafür. In fünf Schritten gelange ich zu der halbhohen Vitrine und registriere, dass außer dem Pokal, der ihn als besten Allstar-Player 2009 benennt, noch ein Baseballschläger und ein achteckiges, flaches … Irgendwas den Ausstellungskasten schmücken. Wertvollster Spieler der American League 2011. Mit dem Schläger hat er den Rangers wohl ein Jahr zuvor den Einzug in die World Series beschert.
»Jepp, du bist definitiv eine große Nummer, Jude Myers«, flüstere ich vor mich hin, bevor ich mich von dem Glasschrank abwende und einen Blick in eins der drei Zimmer riskiere, die vom Eingangsbereich der Suite abgehen. Mir ist klar, dass ich mich in seinen privaten Räumlichkeiten befinde und keine Erlaubnis habe, mich hier umzuschauen … Aber wie es scheint, bin ich allein, und ich muss meine Neugier befriedigen. Wer würde nicht wissen wollen, wie das Zuhause einer Sportlegende aussieht?
Mister Myers ist offensichtlich kein Fan von bunten Farben. Sein Wohnzimmer – ich nehme zumindest an, dass es sich um das Wohnzimmer handelt, immerhin hängt ein ultragroßer Flachbildfernseher an der Wand – ist schwarz-weiß gehalten. Dunkle Möbel, helle Fliesen. Es gibt eine Bar, hinter der allerhand Whiskyflaschen stehen, und über der ledernen Sofalandschaft hängen mindestens zwanzig Bilder. Fotos von ihm … Sie wirken wie ein Magnet auf mich. Ich kann meine Beine nicht davon abhalten, einen Fuß vor den anderen zu setzen, bis ich vor ihnen stehe.
Auf jeder Ablichtung hält er einen Schläger in der Hand, einige sind offensichtlich während wichtigen Spielen entstanden. Die Zuschauertribünen sind voll besetzt. Andere zeigen ihn während des Colleges, und da ist sogar eine Fotografie, auf der er kaum das Schulalter erreicht haben dürfte.
Ich komme zu der Auffassung, dass er schon damals ein süßer Bengel war, und das ist ein verdammt großes Lob. Ich kann mit Kindern nicht so viel anfangen. Tierbabys, wie junge Hunde oder Katzenkinder, bringen mich zum Schmelzen, aber sobald kleine Menschen aus den Windeln rausgewachsen sind, lassen sie mich nicht mehr quietschen und seufzen.
»Die Bedeutung des Wortes Privatsphäre wird wohl selbst an Eliteunis nicht mehr gelehrt.«
Ich fahre zusammen und drehe mich zu der verärgerten Stimme um. Jude Myers steht im Türrahmen, seine muskulöse, schwer gebaute Gestalt füllt ihn beinah komplett aus. Hier, in der Suite, wirkt er auf mich noch größer als draußen auf dem weitläufigen Grundstück des Anwesens. Größer und … bedrohlich. Nicht in Form von Er könnte mir irgendwas anhaben, die Bedrohung geht eher von seiner maßlosen Anziehungskraft aus.
Er ist immer noch halbnackt, wobei der Gedanke ein bisschen lächerlich ist, immerhin trägt er Hosen, während ich nur mit einem Handtuch ausgestattet bin.
»Es ist nicht das, wonach es aussieht«, sage ich schnell.
»Es sieht so aus, als würden Sie in meinem Wohnzimmer stehen und meine Fotos inspizieren.«
»Dann … ist es vielleicht doch das, wonach es aussieht«, räume ich ein. »Es tut mir leid. Ich hätte Ihre Räumlichkeiten nicht ungefragt betreten dürfen. Aber da war diese Vitrine und der Pokal, und ich … Ich sollte wohl unbedingt an meinen Ausreden feilen.« Ich verlagere das Gewicht auf mein anderes Bein. »Ist es zu spät, um zu behaupten, ich hätte mich in der Tür geirrt und sei eigentlich auf der Suche nach Bex’ Zimmer? Ganz gelogen wäre das nicht. Ich wollte mir wirklich etwas zum Anziehen von Ihrer Nichte leihen.«
Er sagt dazu nichts, mustert mich jedoch mit finsterem Blick. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass er finster ist, denn seine vollen Lippen sind zusammengepresst, der Ausdruck seiner Augen hingegen lässt sich dank der tief ins Gesicht gezogenen Cap nicht klar definieren. Doch dann kommt er näher, bewegt sich auf mich zu, bis er direkt vor mir steht. Und mit direkt meine ich, dass er sich so dicht vor mir aufbaut, dass vielleicht eine Handbreit Abstand besteht. Ja, ich unterschreibe, dass sein Blick düster ist, ich lag goldrichtig mit meiner Vermutung.
»Ich hätte nicht gedacht, dass sich die peinliche Katastrophe unserer ersten Begegnung noch toppen lässt, aber ich versichere Ihnen, Mister Myers … das hier ist die unangenehmste Situation, in die ich jemals geraten bin«, entledige ich mich meinen Gedanken, ohne es wirklich zu wollen… »Logisch, bisher hatte ich auch nicht die Chance, mich mit einem Handtuch umwickelt in das Villenapartment eines Superstars zu schleichen und dabei erwischen zu lassen.«
Er sieht mir in die Augen, und Jesus … seine sind superblau und grau an den Rändern, was sie ein bisschen dunkler erscheinen lässt, als sie tatsächlich sind. Sie schimmern, als hätte jemand glitzernden Feenstaub hineingepustet, und mir fällt eine kleine Narbe neben seiner rechten Braue auf.
Ich werde selten nervös. Ich bin ein gefestigter Mensch, habe Selbstvertrauen und Courage. Mein Dad hat mich so erzogen. Aber während Jude Myers vor mir steht und mit seinem ernsten Blick den meinen fesselt, spüre ich, wie die Schläge meines Herzens erst schnell und dann unregelmäßig werden.
Ich bin wahrlich neidisch auf seine Hosen. Wieso habe ich keine an? Was zur Hölle hat mich geritten, ohne Unterwäsche in sein Wohnzimmer zu marschieren?
»Du solltest jetzt besser gehen, Bambi.« Er sagt das leise. Der Ärger ist aus seiner Stimme gewichen.
Ich blinzle und begreife nicht sofort, warum er mich Bambi nennt. Ich verstehe jedoch die Aufforderung, mich aus seiner Suite zu verziehen, und komme dem Rausschmiss natürlich nach. »Ja, klar. Das sollte ich.« Ich senke den Blick und lasse ihn dabei noch mal über seinen anbetungswürdigen Oberkörper gleiten, bevor ich an ihm vorbeigehe – auf merkwürdig weichen Knien.
Ich bin schon fast bei der Tür, als es mir langsam dämmert. Mir wird klar, weshalb er mir den Spitznamen verpasst hat.
Ach du liebe Zeit, er muss mir …
Ich spähe an mir hinab und vergewissere mich, mit dem Gedanken richtigzuliegen. Das Disney-Rehkitz auf meiner linken Brust ist komplett zu sehen. Das Handtuch verdeckt nicht einen Millimeter der kleinen Tätowierung.
Jude Myers hat mein Dekolleté abgecheckt.
Das ist erheiternd und ziemlich gut fürs Ego. Mal abgesehen vom Promibonus; der Kerl ist unglaublich sexy, und wenn ein wahnsinnig heißer Typ deine Oberweite bemerkt, bedeutet das vielleicht, sie kann sich sehen lassen.
Ich drehe mich noch mal um. Er weiß, dass mir gerade ein Licht aufgegangen ist, denn er schenkt mir ein winziges Lächeln. Unbeabsichtigt. Ich gewinne den Eindruck, dass er es sich lieber verbeißen will, ihm das aber nicht wirklich gelingt.
»Sie sollten erst Tinker Bell sehen«, teile ich ihm mit, dass noch mehr interessante Körperstellen von mir mit Bildern verziert sind. Neben den offensichtlichen Tattoos, verschönert beispielsweise die ungezogene Nimmerfee meinen Hintern.
»Den Ausgang, Miss Wallace, finden Sie rechts durch die Tür.«
2. KAPITEL
Jude
Sie ist klein, vorlaut und voller Walt Disney-Tattoos, und mein oberstes Prinzip lautet: kleinen, vorlauten Frauen, die sich Zeichentrickfiguren unter die Haut stechen lassen, nicht auf den Hintern zu starren. Schön, diese Regel existiert noch keine zwei Minuten, aber deswegen wäre ein Verstoß gegen sie dennoch nicht gut. Erfahrungsgemäß bringen Regelverstöße einem nichts als Schwierigkeiten. Außerdem ist sie Rebeccas Freundin, blutjung, und allein aus diesem Grund hat mich ihr Hintern nicht zu interessieren.
Mein Blick ist also fest auf ihre schlanken Schultern gerichtet, als Jamie Wallace barfuß und – von dem Handtuch mal abgesehen – nackt aus meinem Wohnzimmer verschwindet.
Lieber Gott! Ich reibe mir über das Gesicht und streife das Basecap ab, um es auf den Glastisch zu werfen. Ich werde definitiv mit meiner Nichte reden müssen. Es kann nicht sein, dass ihr Besuch ohne zu fragen in meine Privaträume eindringt. Mein Apartment ist Tabubezirk, meine Intimsphäre mir heilig. Seit ich vor fünf Jahren zurück nach Duncanville gezogen bin, habe ich nicht mal eigene Gäste hier oben empfangen.
Ich überlege, mir einen Drink einzuschütten, gehe dann aber erst ins Bad, um mir die Hände zu waschen. Den halben Tag habe ich damit verbracht, mein Bike zu warten; der Öl- und Filterwechsel war eine schmutzige Angelegenheit. Auf dem Rückweg halte ich kurz im Schlafzimmer an und suche das schnurlose Telefon, da ich inzwischen akzeptiert habe, dass es sich nie im Büro auf der Basis befindet. Ich bin fest überzeugt, dass sich das Teil kurz nach der Anschaffung ein Paar Beine zugelegt hat und außerdem ein Cleat Chaser ist. Wie eine Baseball-Schlampe schleicht es sich ständig in mein Wasserbett.
»Ich wusste, ich finde dich hier.« Ich fische den Hörer zwischen den Laken hervor.
Der Akku muss dringend aufgeladen werden, aber für einen Anruf bei Elliot sollte der Saft noch reichen. Ich halte meinen ehemaligen Agenten bereits seit Montag hin, habe ihn zweimal am Telefon abgewimmelt und versprochen, mich am Wochenende zurückzumelden.
Ich kenne seine Nummer auswendig, seit meiner Collegezeit hat mich der Mann vertreten, meine Verträge ausgehandelt und dafür gesorgt, dass mein Gesicht oft als Produktfürsprecher in irgendwelchen Werbespots und auf Reklametafeln zu sehen war. Es gab eine Zeit, da war Elliot Fuller eine Art zweiter Vater für mich.
»Jude, endlich«, begrüßt er mich, als er nach dem vierten Klingeln abhebt.
»Das Wochenende hat gerade erst angefangen«, entgegne ich, obwohl der Samstag fast um ist. Es geht immerhin auf sechs Uhr zu.
»Den Luxus solcher Worte leisten sich nur Leute, die nicht Montagmorgen ab sieben Uhr mit Anrufen bombardiert werden, weil zwanzig Menschen in Erfahrung bringen wollen, ob man mit seinen Jungs gesprochen hat.«
»Ich gehöre nicht mehr zu deinen Jungs, Elliot.«
»Du wirst immer zu meinen Jungs gehören«, stellt er richtig. »Und damit ich an dieser Behauptung auch noch mal was verdiene, hätte ich einen Job für dich.«
Verdammt, ich hatte es befürchtet.
»Ich habe bereits einen Job«, erinnere ich ihn. »Ich bin Geschäftsführer der Firma meines verstorbenen Bruders.« Seit beinah fünf Jahren.
»Jude Myers als CEO eines Werbe- und Medienkonzerns. Du kannst mir nicht weismachen, dass du bis zum Ende deiner Tage mit Seidenkrawatte in irgendwelchen Meetings herumhängen willst. Du hast lang genug den Reumütigen gespielt, Jude. Ich glaube, du solltest dich allmählich zurück in dein Leben trauen.«
Ich amte hart aus, sage nichts dazu. Ich verstehe, warum sich Elliot wünscht, dass ich noch mal eine Art Comeback starte, mich in irgendeiner Form wieder in die Welt des Sports integriere und ins Rampenlicht stelle. Ich war sein Aushängeschild. Aber diese Ära ist nun mal Geschichte.
»Vielleicht sollte ich es anders formulieren: Man will dich als Testimonial für eine landesweite Produktkampagne«, gibt er nicht auf.
»Ich werde mein Gesicht nicht wieder vor eine Kamera halten.« Ich verlasse das Schlafzimmer in der Absicht, mir jetzt einen Drink zu genehmigen. Ich war eben schon scharf auf ein Glas Scotch, dank dieses Gesprächs sehne ich mich nach der kompletten Flasche.
»Du willst dir nicht mal die Details anhören?«
»Richtig, das will ich nicht.«
Fast fünf Jahre lang habe ich jeden Auftritt in der Öffentlichkeit vermieden. Das letzte Mal, dass ich einem Interview zustimmte, war an dem Tag, als ich verkündet habe, dass ich mich aus dem Profisport zurückziehe und meine Karriere an den Nagel hänge. Bei Gott, ich hatte die allerbesten Gründe für diese Entscheidung, und ich werde mich garantiert nicht noch mal als Marketinginstrument verkaufen, jetzt, wo alles schon so lang vorbei ist.
»Sie würden vierhundert Riesen für dich auf den Tisch legen«, versucht Elliot mich mit Geld zu locken.
»Welcher Idiot blättert bitte vierhunderttausend Dollar hin, um seine Marke in den Dreck zu ziehen? Wir wissen beide, dass mein Hintern den Großteil der Nation eher davon abhalten würde, ein Produkt zu kaufen. Aber halt, nein. Behalte die Antwort für dich. Ich will gar nicht wissen, wer dieser Idiot ist.«
»Der Idiot heißt Beyond Four, und sie wollen dich für eine Safer-Sex-Kampagne.«
Das ist beinah lustig. »Ich soll Werbung für Pariser machen? Komm schon, El, lach dich mit mir kaputt.«
»Ich wüsste nicht, was daran komisch sein soll. Sich für Safer Sex einzusetzen ist eine gute Sache. Es wäre förderlich für dein Image und würde den Leuten zeigen, wer Jude Myers heute ist. Diese Kampagne eignet sich hervorragend für einen Neustart.«
Ich umrunde die Bar und schnappe mir ein Glas von der Ablage über der Spüle. »Ich kann dir sagen, was daran komisch ist. Als mein Name das letzte Mal mit dem Wort Sex öffentlich in Verbindung gebracht wurde, war ein nicht mal sechzehn Jahre altes Mädchen im Spiel.«
Meine Worte erzielen den gewollten Effekt. Elliot gerät aus seinem Überzeugungskonzept.
Ich halte das Glas unter den Spülkran, fülle es randvoll mit Wasser und kippe dieses in den Eiswürfelspender. Da ich keine zehn Minuten warten kann, bis die Maschine gefrorene Würfel ausspuckt, verzichte ich beim ersten Drink darauf. Ein siebzig Jahre alter Macallan lässt sich notfalls auch ungekühlt trinken.
»Willst du dich für immer auf der Ranch deines Bruders verkriechen? Dieser Vorfall ist eine Ewigkeit her«, setzt Elliot nach, als er meine Äußerung offenbar verdaut hat. »Die Leute haben inzwischen vergessen, was damals passiert ist.«
»Ich verkrieche mich nicht, Cedar Hill ist keine Ranch, und niemand vergisst das Unverzeihliche, El.« Am wenigsten ich.
»Ist das dein letztes Wort?«
»Ich weiß, du meinst es gut. Aber ja, in dieser Angelegenheit schon.« Ich stürze den Drink hinunter und schenke mir direkt noch mal nach.
»Ich bin nicht nur dein Agent, ich bin dein Freund. Und als dieser sage ich dir, dass du es eines Tages bereuen wirst, das Lenkrad nicht noch mal rumgerissen zu haben. Du bist auf einem Weg, der dich nicht glücklich machen kann.«
»Ob ich glücklich bin oder nicht spielt keine Rolle. Ich halte keine zweite Hexenjagd aus.«
Wir schweigen uns an. Das Telefon piept bedrohlich, weil der Akku kurz vor dem Streiken steht. Ich trinke den zweiten Scotch in nur einem Zug und lasse anschließend ein paar Eiswürfel aus dem Spender ins Glas fallen. Innen sind sie noch nicht gefroren.
»Lass uns nächste Woche Essen gehen«, schlägt Elliot vor.
»Für ein Essen bin ich immer zu haben.«
»Gut, ich reserviere einen Tisch und gebe dir über das Wo und Wann Bescheid. Und denk noch mal über die Sache nach. Ein paar Tage kann ich Beyond Four sicher auf deine Antwort warten lassen.«
»Sag ihnen ab«, beende ich mit Nachdruck das Gespräch.
Ich lege das Telefon auf die Bar anstatt es – wie ich sollte – zur Basis zu bringen. Frust klebt an meinen Eingeweiden. Elliot schafft es immer, dass ich mich fühle wie nach einem verlorenen Spiel. Ich will auf irgendwas draufschlagen, kann aber aus Erfahrung berichten, dass die Wut, Enttäuschung und der Selbsthass davon nicht weggehen. Deshalb gieße ich noch einen Doppelten auf das Eis und besiege den Impuls, die Flasche Scotch anschließend gegen die Wand zu werfen. Ich nehme sie lieber mit auf den Balkon, um mir die Möglichkeit offenzulassen, sie im Laufe des Abends auszutrinken. Würde mich der Mann öfter anrufen als alle paar Wochen, hätte ich wahrscheinlich ein ausgewachsenes Alkoholproblem.
Die Sonne hat sich um die Hausecke verzogen, und ich lasse mich draußen auf einen der Liegestühle im Schatten fallen. Ich will nicht über die Vergangenheit nachdenken oder mich mit Was-wäre-wenn-Fragen beschäftigen. Die ändern auch nichts daran, dass ich mir mein Leben versaut habe. Denn ja, es geht mehr als deine Karriere kaputt, wenn du aus der Zeitung erfährst, dass die Kleine, der du am Tag zuvor fast dein Ding reingesteckt hättest, noch keine sechzehn Jahre alt war.
Ich könnte behaupten, dass sie nicht so jung aussah. Tat sie nicht. Ich könnte erklären, dass ich sie vorher schon auf unzähligen privaten Siegesfeiern des Teams gesehen hatte und definitiv nicht der erste Kerl war, der ihr zu nah kam. War ich nicht. Ich könnte die Schuld von mir weisen und mich daran erinnern, dass sie völlig abgeklärt wirkte und ziemlich genau wusste, was sie da tat, als sie mich gegen die Spinde der Umkleide stieß. Wusste sie.
Aber die Wahrheit ist, dass ich mir die Scheiße ganz allein eingebrockt habe und es keine Entschuldigung oder Ausrede dafür gibt, mich auf ein minderjähriges Mädchen eingelassen zu haben. Denn wäre ich nicht so ein verdammter Hurensohn gewesen, der eine Frau nicht mal nach ihrem Namen fragt, bevor er sie flachlegt, wäre mir sehr wahrscheinlich aufgefallen, dass sich unter den zwei Pfund Make-up ein viel zu junges Ding verbirgt. Während einer Unterhaltung bemerkt man sowas. Ich hätte den Frauen, die mir allein wegen eines auffordernden Lächelns ins Schlafzimmer folgten, einfach nur ein bisschen mehr Respekt und Interesse entgegenbringen müssen, um niemals in eine so verfängliche Situation zu geraten. Aber das habe ich nicht, deshalb – schuldig im Sinne der Anklage.
Ich hebe das Glas und trinke auf Leila Richardson, die Zeitungsreporterin der Times, die sich durch eine glückliche Fügung des Schicksals rechtzeitig in die Mannschaftskabine mogeln konnte, um durch ihr Reinplatzen zu verhindern, dass es zwischen mir und der Kleinen zum Äußersten kam. Nicht, dass mir das irgendwer geglaubt hätte, aber das spielt auch kaum eine Rolle. Ihre Hand war in meiner Hose, ihre Finger an meinem Schwanz, und ich hätte das Mädchen gefickt, wenn wir nicht unterbrochen worden wären.
Auch wenn alle Welt davon ausgeht, dass ich die Journalistin, die mich am nächsten Tag als perverses Schwein durch die Presse jagte, abgrundtief hassen muss, tue ich genau das nicht. Ich bin ihr dankbar. Die Vorstellung, dass ich es ohne ihr Auftauchen mit dieser Kleinen getrieben und irgendwann durch Zufall erfahren hätte, wie alt sie war, ist nicht zu ertragen. Wäre es so gekommen, ich schwöre, ich hätte mir mit eigenen Händen den Schwanz abgehackt.
Ich leere das Glas und stelle es zusammen mit der Flasche neben mir auf den Fliesen ab. Zwischen den Säulen der Balkonbalustrade habe ich die Zufahrt zum Anwesen im Blick. Ein silberner Truck nähert sich unserem Haus, und während ich mich frage, was ein Lastwagen auf unserer Privatstraße zu suchen hat, fällt mir ein, dass Bas, unser Mann für die Pferde, gestern Abend nach Santa Fe aufgebrochen ist, um die drei Mustangs abzuholen, die wir bis zum Herbst für einen Freund beherbergen.
Scheiße, ich hatte das total vergessen.
Ich hieve mich aus dem Liegestuhl und gehe ins Schlafzimmer, um mir ein Shirt überzustreifen. Ich kann Bas nicht allein drei unbändige Jährlinge ausladen lassen. Die Tiere stammen aus einem Wildpark, der aufgelöst wurde, und sind vermutlich alles andere als handzahm.
»Wohin des Weges so eilig?«, will Rebecca wissen, als ich die Treppe runterlaufe. Sie und ihre Freundin, die glücklicherweise inzwischen ein Kleid am Leib trägt, schleppen gerade irgendwelche Gepäcktaschen durch die Eingangshalle.
»Raus, wir kriegen Pferde«, antworte ich ohne stehenzubleiben.
»Was? Wieso kriegen wir Pferde?«
»Weil ich gutherziger Trottel Reed angeboten habe, die drei Viecher hier unterzustellen, bis er sein Western-Hotel aufmacht oder wenigstens die Bauarbeiten auf dem Grundstück fertig sind.«
»Reed eröffnet ein Western-Hotel?«
Ich ziehe die Haustür auf und bin eine Minute später bei den Stallungen. Eileen, meine Schwägerin, hat früher Quarter Horses gezüchtet, dieses Hobby jedoch aufgegeben, als mein Bruder krank wurde. Vier Stuten sind auf dem Anwesen geblieben, wir haben also massig Platz für ein paar tierische Gäste.
»Die Fahrt war ein Albtraum«, flucht Bas, als er aus der Kabine des Trucks springt. »Irgendwann auf halber Strecke hat das Beruhigungsmittel seine Wirkung aufgegeben; die drei Rotzlöffel da hinten sind am Durchdrehen. Ich hatte Angst, dass sie aus den Boxen ausbrechen, die Ladeklappe auftreten und plötzlich über den Highway galoppieren.«
»Scheint als wären die ganz schön nervös«, bestätige ich. Das Poltern und die unruhigen Schnauflaute, die aus dem Transportraum dringen, klingen nicht gerade vertrauenerweckend.
Bas zieht sich den Stetson vom Kopf und rauft sich durch das am Kopf klebende schwarze Haar. »Ich bin erledigt. Die letzten zwei Stunden habe ich Blut und Wasser geschwitzt. Ich befürchte, dass die uns tottrampeln, sobald wir zu ihnen in die Boxen steigen.«
»Wir können sie hier nicht rausholen. Du musst den Transporter auf eine der Weiden fahren. Am besten packen wir sie erst mal auf die kleine Wiese hinten am Bach. Das ist weit genug weg von den Stuten. Deine Ladung ist nämlich potent.«
»Für die Tour schuldest du mir ein dickes Weihnachtsgeld«, meint er. »Ich verlange das Dreifache vom letzten Mal.«
Ich ziehe die Brauen hoch. Der drahtige Kerl ist eine Marke für sich. Bas ist mit Susanna verheiratet, sie arbeitete schon ein Jahr für uns, bevor ihr Mann den Job übernahm, sich um die Pferde zu kümmern. Bereits am Vorstellungstag hat er mich mit meinem Vornamen angesprochen, klargemacht, dass er nicht unter einem Gehalt von siebenhundertfünfzig Dollar pro Woche hier anfängt, und mir gesagt, dass er das Handtuch wirft, wenn ich nicht auch gelegentlich anpacke.
»Ich bin sicher, wir werden uns einig, Kumpel. Fahr die Wildfänge zur Weide, und ich sehe zu, dass Strom auf dem Zaun ist, bevor wir die Laderampe runterklappen«, weise ich ihn an, während im Truck Hufe gegen die Alutrennwände der Boxen donnern.
»Da sind wirklich Pferde drin? Hört sich eher an, als hätte jemand eine Horde wilder Büffel verladen.« Rebecca kommt über das Gelände, Bambi im Schlepptau.
»Das sind drei junge Mustangs, die noch nie eingesperrt waren. Sie waren ruhiggestellt, aber der Tierarzt hat wohl die Dosierung vergeigt«, erkläre ich, während Bas zurück in den Truck steigt. »Wir bringen sie hinten zum Bach. Wenn ihr zusehen wollt, dann mit Abstand. Die stehen schon ohne Publikum kurz vor einem Panikausbruch.«
Ich gehe ins Stallgebäude, um an den Boxen vorbei zur angrenzenden Scheune zu gelangen. Irgendwo bei den Werkzeugen und Gerätschaften, mit denen Bas das Grundstück instand hält, müssen die Stromgeneratoren für die Zäune liegen. Unsere Weiden sind mit Holzlatten umschlossen, aber sicherheitshalber auch noch mal mit einem Stromband umgrenzt.
Ich finde einen Apparat in einem der Schränke, und hole draußen die vor der Garage stehende Ducati, um nicht noch mehr Zeit zu verschwenden. Die Tiere müssen aus dem Fahrzeug raus, wenn kein Unglück geschehen soll, und zu Fuß brauche ich zur Koppel am Bach über fünf Minuten.
Bas hat den Transporttruck bereits durch das Tor auf die Wiese gefahren und wartet neben der Fahrertür. Ich steige vor dem Gatter von der Maschine und laufe ein paar Meter den Zaun entlang, um zu der Stelle zu gelangen, wo man das Elektrogerät anschließt. Als das Bandanschlusskabel mit dem Generator verbunden ist, schalte ich diesen ein und hoffe, dass alles seine Richtigkeit hat und das Teil funktioniert. Ich will wirklich nicht durch Anfassen überprüfen, ob der Strom fließt.
»Die Jungs stehen diagonal zur Fahrtrichtung im Laderaum. Wir müssen das erste Pferd rausholen, bevor wir die Trennwand zum zweiten entfernen und es freilassen«, erklärt Bas, als wir uns an der Ladeklappe treffen. »Ich bezweifle, dass die sich da einfach rausführen lassen.«
»Und ich bezweifle, dass da überhaupt noch eine Trennwand steht. Vielleicht sollte besser erst mal einer von uns sein Glück versuchen, damit die uns nicht direkt beide niedertrampeln.« Aus dem Transportraum dringen immer noch Geräusche, als würden die drei drinnen einen Boxkampf veranstalten.
»Wie immer sprüht er vor Optimismus.« Er deutet mit einer Geste an, dass ich beiseite gehen soll. »Aber schön, ich lass mir zuerst die Knochen brechen.«
»Nein, ich mach das.« Nichts für ungut, aber Bas bringt keine hundertsechzig Pfund auf die Waage. Er hat einem panischen Pferd nicht genug entgegenzusetzen.
Ich vergewissere mich mit einem Blick, ob ich das Tor zugemacht habe und der Stromkreis des Zauns geschlossen ist. Scheint beides der Fall zu sein. Rebecca und Bambi stehen vor der Weide. Sensationslust olé. Bas verzieht sich zur Seite, und ich entsichere die beiden Hebel der Klappe, drehe sie einen nach dem anderen im Uhrzeigersinn rum und lasse die Rampe vorsichtig runter.
Die Trennwände stehen noch, die Frage ist, wie lang. Der vorderste Rappen wirft unruhig den Kopf und schlägt schnaubend mit den Hinterbeinen aus, als er sieht, dass ich auf die Ladebühne springe. Er versucht zurückzuweichen, eine Möglichkeit zu finden, vor mir zu fliehen, und kracht gegen die Barriere zum Hintermann, der daraufhin ebenfalls zu entkommen versucht.
Okay, das hier muss schnell gehen. Das Pferd ist mit zwei Stricken an runden Halterungen befestigt. Eigentlich sollte das ein Kinderspiel sein, aber das Tier ist kopfscheu und steigt nach oben, als ich mich bemühe, einen der Panikhaken zu erwischen. Ich muss ihn zunächst am Halfter packen, was dank der Wand vor mir ein schwieriges Unterfangen ist, aber ich strecke den Arm so weit es geht aus und benutze all meine Kraft, das Tier zu zwingen, die Vorderhufe auf dem Boden zu lassen. Der Mistkerl scheut noch mal zurück und renkt mir beinah die Schulter aus, aber schließlich kann ich ihn von den Stricken lösen. Die zusammenklappbare Boxenwand ist kein Hindernis mehr. Ich hebe sie aus der Verankerung, und er wirft mich fast von den Füßen, als er sich zwischen der entstandenen Lücke in die vermeintliche Freiheit drängt. An Rausführen ist nicht zu denken, er stürmt einfach die Rampe hinunter.
»Ach du Scheiße«, flucht Bas hinter mir.
Der zweite Gaul ist genauso ängstlich und rutscht ein paarmal mit den Hufen weg, während er scheut. Ich sehe schon kommen, dass er sich den Hals bricht. Aber dann ist er unversehrt draußen und folgt seinem Freund irgendwohin, wo ich sie vom Truck aus nicht sehen kann.
Na das wird jetzt lustig.
Der letzte Halbstarke, ein Falbe, ist ein richtiger Wildfang und absolut panisch. Das Befreien der anderen hat ihn in Stimmung gebracht. Ich bin bestimmt kein Pferdeprofi, bis ich nach Cedar Hill kam, hatte ich mit Tieren nicht viel am Hut, aber ich habe noch nie gehört, dass ein Gaul die Zähne zum Einsatz bringt. Er versucht, mich zu beißen, schlägt mit Vorder- und Hinterläufen in meine Richtung, und das Donnern der Hufe gegen die Wände bringt ihn noch weiter in Rage. Als er das nächste Mal hochsteigt und den Kopf ruckt, reißt er die Befestigungsvorrichtung aus der Wand.
»Soll ich dir helfen?«, ruft Bas.
»Nein, dann gerät er noch mehr in Panik.«
Mir bleibt keine Wahl, ich muss die Trennwand diesmal zuerst entfernen, um überhaupt eine Chance zu haben, an ihn heranzukommen. Mir ist bereits klar, dass das kein gutes Ende nehmen kann, als ich die eingedellte Barriere löse und zusammenschiebe.
Es heißt doch, Pferde wären Fluchttiere, doch davon ist in diesem Moment nicht viel zu sehen. Der Junge vor mir glaubt offensichtlich, ein Bulldozer zu sein. Wort drauf, da ist ein angriffslustiges Funkeln in seinen Augen, bevor er sich so blitzschnell herumwirft, dass ich keine Möglichkeit habe, noch auszuweichen. Er haut mich mit der Flanke gegen den Truck und bringt sein komplettes Gewicht zum Einsatz, in dem Vorhaben, mich wie eine Fliege zu zerquetschen.
Mir ist kotzschlecht und ich drücke dagegen, um mich aus meiner misslichen Lage zu befreien. Aus unerklärlichen Gründen scheint er kein Interesse daran zu haben, sich loszureißen und seinen Arsch ins Freie zu schaffen. Ich muss Gewalt anwenden und ihm wehtun, während ich ihn von mir stoße, und dann ist Bas plötzlich da und zieht an den Schiebeverschlüssen der Stricke.
»Komm schon, raus mit dir«, brüllt er das Pferd an.
Gott sei Dank scheint das Monstrum zu dem Entschluss zu kommen, es nicht mit zwei Männern aufnehmen zu wollen. Er dreht sich im Hochsteigen um, gibt mir allerdings noch ein Andenken mit auf den Weg. Nein, zwei. Er beißt mir in die Hand – Scheiße, der Arsch langt wirklich mit den Zähnen zu –, und einer seiner Hufe donnert gegen mein Schulterblatt, als er vorn und hinten hochgehend zur Laderampe schießt und sie mehr hinuntersegelt als galoppiert.
Ich packe meine schmerzhaft pochende Hand und kann nicht sagen, was sich schlimmer anfühlt. Mein geprellter Rücken, die von dem Pferdemaul zusammengenquetschten Finger oder meine Schulter, die morgen grün und blau sein wird. Im ersten Moment ist mir ein bisschen schummrig, und Himmel, ich kann sonst einiges wegstecken. Aber der Schwindel vergeht, wie er gekommen ist, und ein verspätetes Aufstöhnen verlässt meine Lippen.
»Ich taufe den Gaul offiziell Killer. Reed soll sich wagen, ihn umzubenennen«, stoße ich aus. Der Mann steht bis zum Rest seines Lebens in meiner Schuld. So viel ist klar.
Bas reibt sich die Stirn, über die sich eine längliche Schürfwunde zieht. Das mordlüsterne Ungeheuer muss ihn auch erwischt haben. »Nein, die nächsten zwei Minuten keine Witze. Der Bastard hat mir gegen den Kopf getreten. Ich kann nicht klar genug denken, um mich über den Scheiß jetzt schon lustig zu machen.«
Ich verkneife mir ein Lachen. Mir geht’s hundeelend, aber dennoch ist es erheiternd, dass wir fast von einem Pferd ausgeknockt wurden. Meine Knochen schieben sich langsam zurück an ihren angedachten Platz, als ich mich jämmerlich mitgenommen zur Laderampe bewege.
»Lass uns den Truck von der Wiese schaffen und hier verschwinden. Wir können bei einem Bier unsere Rache planen. Vielleicht laden wir ein Gewehr und schießen dem Mistkerl in den Arsch. Wenn, üben wir Vergeltung aus weiter Ferne.«
Bas sieht mich an, als hätte ich den Verstand verloren, folgt mir aber nach draußen. Zu zweit schließen wir die Klappe, da ich die kaputte Hand nicht richtig benutzen kann.
»Fühlst du dich in der Lage, zu fahren?«, will ich von Bas wissen.
»Wird schon gehen«, behauptet er und klingt dabei nicht besonders zuversichtlich.
Die drei Junghengste laufen im nördlichen Teil der Koppel den Zaun ab. Sie suchen offenbar einen Weg, sich in den dahinter beginnenden Wald zu verdrücken. Es ist besser, sie allein und zur Ruhe kommen zu lassen. Ich denke nicht, dass sie es schaffen können, auszubrechen.
»Rebecca, öffne das Tor, wenn Bas mit dem Truck vorfährt«, weise ich meine Nichte an. Die beiden Mädels stehen am Gatter.
»Mach ich. Ist alles in Ordnung? Das sah gerade ziemlich gefährlich aus.«
»Halb so schlimm«, beteuere ich, obwohl ich nicht mit Gewissheit sagen kann, ob mir der Falbe nicht ein paar Finger gebrochen hat. Die Hand ist angeschwollen und die Abdrücke der Zähne deutlich zu sehen.
Bas ist in den Truck geklettert. Wahrscheinlich hat er hämmernde Kopfschmerzen, allerdings wendet er das Fahrzeug ohne Schwierigkeiten. Ich hoffe, dass er keine Gehirnerschütterung hat. Falls er sich krankmeldet, bin ich aufgeschmissen. Seit unsere gute Seele Thatcher pensioniert wurde, ist er allein für die Tiere und den Außenbereich des Anwesens verantwortlich.
Rebecca öffnet das Tor, damit Bas hindurchfahren kann, und schließt es hinter mir.
»Du musst mein Baby zum Haus zurückfahren«, bitte ich sie und fische umständlich den Schlüssel aus der rechten Hosentasche. Das Gas zu bedienen, kann ich vergessen, ich brauch es nicht zu versuchen.
»Ich? Genauso gut könnest du von mir verlangen, dieses durchknallte Pferd zu den Ställen zu reiten. Ich saß noch nie auf einem Motorrad.«
»Du wohnst seit fünf Jahren mit mir zusammen. Wie ist es möglich, dass du noch nie ein Bike gefahren bist?«
»Das könnte daran liegen, dass du mir irgendwann mal gedroht hast, mich gehäutet und mariniert zum Barbecue zu servieren, wenn ich auch nur einen Finger an eine deiner Schätze lege«, erklärt sie mit selbstgefälligem Unterton. Ihr Blick gleitet über meine Hand. »Und die sieht aus, als sollte ein Arzt draufschauen.«
Richtig. Häuten und Marinieren. Zu meiner Verteidigung sei zu sagen, dass ich sogar Sorge habe, wenn sie sich hinter das Lenkrad eines Autos setzt. Konzentration ist nicht ihre Stärke. »Das ist jetzt wirklich beschissen, Rebecca.«
»Ich könnte zum Haus zurückfahren«, bietet Bambi an und lenkt damit meine Aufmerksamkeit auf sich. Als ob ihr plötzlich irgendwas einfallen würde, rümpft sie ihre Nase und fügt hinzu: »Theoretisch.«
Ich beäuge sie kritisch – oder viel mehr ihr Kleid. Es ist lila, kurz, definitiv unpassend, um ein Bike zu reiten, und ich glaube, es gehört Rebecca. An Miss Wallace’ hinreißendem Körper sieht es allerdings sehr viel netter aus.
Stopp, hinreißendem streichen. Ich finde natürlich nicht, dass ihr Körper hinreißend ist. Auch wenn ihre rundgewölbten Brüste – trägt sie keinen BH? – den Stoff hübsch ausfüllen, der Schnitt ihre feminine Taille betont und ihre Knie … Ich fürchte, das Pferd hat nicht nur Bas gegen den Kopf getreten.
Das Mädchen bedeutet Ärger, Myers.
Ich drücke ihr die Schlüssel in die Hand. »Das ist eine Halbautomatik. Auch wenn ich gut versichert bin … versuch, sie nicht zu Schrott zu fahren, ja?« Ich hänge an der Kiste, aber was soll auf fünfhundert Metern schon groß passieren?
Ich wende mich ab, um nicht dabei zusehen zu müssen, wie sie auf die Ducati steigt. Ich finde Frauen auf Motorrädern wahnsinnig sexy, und es wäre nicht gesund, mir ein solches Bild von ihr in den Kopf zu pflanzen.
Meine Hand schreit nach einem Eisbeutel, ich mache mich auf den Weg zum Haus. Doch nach nicht mal fünf Schritten hält mich Bambi am Arm zurück.
»Ich sagte, dass ich fahren könnte. Theoretisch. Nicht, dass ich kann.«
Ich bin verwirrt und setze einen genau solchen Blick auf. Sie hingegen sieht zerknirscht aus. Ihr Gesicht sagt mir, dass ihr der Moment unangenehm ist. Ihre braunen Augen sind mit einem Mal riesig, als wäre sie tatsächlich ein Reh.
»Drück dich mal klarer aus. Bist du in der Lage, das Ding zu fahren oder nicht?«
»Eigentlich schon, aber …« Bambi schaut zur Seite, wie um sich zu vergewissern, dass sich Rebecca außer Hörweite befindet. Sie steht neben dem Bike und wartet darauf, dass ihre Freundin den Hintern auf den Duke schwingt. Offenbar will sie mitfahren. »Ich habe kein Höschen an und dieses Kleid ist … kurz.«
Ich werde mir ein Grab schaufeln. Bald. Und dann werde ich jemanden bitten, mir in den Kopf zu schießen.
»Hätte ich mir denken können.« Jepp, das sage ich wirklich, und mein Blick fällt auf das Bambi-Tattoo, gleitet tiefer. Sie trägt keinen BH, warum sollte sie also einen verdammten Slip am Arsch haben?
»Hat dir nie jemand beigebracht, dass manche Dinge lieber unerwähnt bleiben?«, frage ich barsch. Und überhaupt, was ist mit der Kleinen los? Gehört sie dem Club der Nudisten an? Zuerst erwische ich sie quasi nackt in meinem Wohnzimmer und jetzt rennt sie ohne Unterwäsche über mein Grundstück. Wenn sie keine Schraube locker hat, ist das der schrägste Anmachversuch aller Zeiten.
»Meine Sachen müssen gewaschen werden. Alle. Bex hat mir ein Kleid geliehen, aber ich wollte sie nicht nach einem Schlüpfer fragen«, rechtfertigt sie sich, als würde sie irrtümlicherweise glauben, mir eine Erklärung zu schulden.
Verdammt noch mal, das will ich nicht wissen.
Ich bemühe mich, meine Aufmerksamkeit auf ihr Gesicht gerichtet zu lassen. Sie hat ein hübsches Gesicht, weich, weiblich, irgendwann könnte sie asiatische Vorfahren gehabt haben. Ihr beinah schwarzes, seidiges Haar spricht ebenfalls dafür. Und sie besitzt genug Anstand, charmant zu erröten. Sie wirkt nicht wie jemand, der schnell in Verlegenheit zu bringen ist, was ich bedauernswert finde. Erhitzte Wangen stehen ihr nämlich gut.
»Ich werde mich jetzt betrinken gehen«, setze ich sie in Kenntnis darüber, dass ich nichts mehr von ihrem nackten Hintern hören will. »Finde eine Lösung für dein Problem, lass das Baby stehen … was auch immer.«
Sie hält mich nicht noch mal auf, als ich meinen Weg zum Haus fortsetze. Ich kann eine Menge verkraften, aber mein Plan, diese Flasche Scotch auf dem Balkon zu leeren, kommt mir noch verlockender vor als während des Telefonats mit Elliot. Ich muss diesen Tag schnellstens aus meinem Kopf löschen.
3. KAPITEL
Jamie
Falls es einen Menschen auf dieser Welt gibt, der sich noch ungeschickter als ich darin anstellt, einen vernünftigen ersten Eindruck abzugeben, muss ich ihn unbedingt kennenlernen. Es täte gut, zu wissen, dass ich nicht die einzige Idiotin des Planeten bin, die es sich mit fünfzig Prozent aller Leute gleich zu Anfang verscherzt.
Vor zwei Sekunden haben die Worte Dich habe ich mir ganz anders vorgestellt meinen Mund verlassen. Sie gelten Bex’ Lover Miller, der heute Morgen in Duncanville angekommen ist und mit uns unter dem Baldachin auf der Terrasse beim Französischen Frühstück sitzt. Ich bin dem Kerl noch nie zuvor begegnet. Logisch. Er war bisher in Dartmouth auf dem College und wechselt erst nach diesem Sommer für ein Aufbaustudium zu uns an die Brown. Seine steinreichen Politikereltern wohnen irgendwo hier in der Gegend.
»Aha«, gibt er zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass in drei winzigen Buchstaben eine so große Portion Abfälligkeit liegen könnte. Er spricht die zwei Silben aus, als wären sie ein Code für ein besonders schlimmes Schimpfwort. Aber eigentlich … betont er bisher jeden Satz so.
»Ähm, das war jetzt nicht irgendwie negativ gemeint«, füge ich an, für den Fall, dass ich ihm durch meine Äußerung auf den Schlips getreten bin. Immerhin wäre das möglich. Der Typ trägt einen einwandfrei gebügelten Anzug mit dazugehörigen Accessoires – bei sonnigen dreißig Grad. »Ich wollte sagen, dass Bex viel von dir erzählt hat. Ich habe mir deshalb ein Bild von dir gemacht, das nicht hundertprozentig zutrifft. Du weißt schon, wie bei einer Buchverfilmung. Man liest einen Roman, stellt sich die Charaktere vor, und dann erscheint der Film dazu und die Schauspieler weichen von der Vorstellung ab. Aber … das macht den Film nicht schlecht.«
Er lächelt auf eine Weise, als könnte er mich damit zum Schweigen bringen. Ich bin sicher, ihm gelingt das öfter. Dieses Lächeln hat etwas Wölfisches an sich.
Ich gebe auf, seinen Eindruck von mir geraderücken zu wollen, denn meine spontane Meinung über ihn lautet Der Kerl ist die Mühe nicht wert