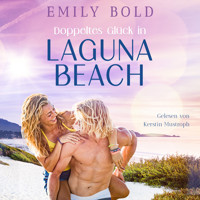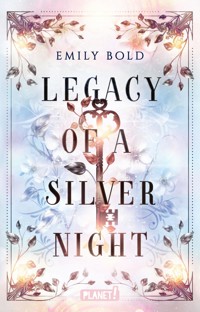12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Bist du bereit für die Wahrheit hinter dem Palast der Lügen?
Für Sophie Dubois und ihre Familie zählt nur eines: Wann immer auf dem Pergament der Schuld wie von Zauberhand eine neue Aufgabe erscheint, gilt es, durch die Zeit zu reisen und den Auftrag zu erfüllen – bis Sophies Bruder eines Tages verschwindet. Als sie sich kurzerhand selbst in die Vergangenheit begibt, landet Sophie mitten im Paris von 1688 und am Hofe des Palasts von Versailles. Der entpuppt sich nicht nur als gefährlich für eine junge Frau, sondern auch ihr mysteriöser Auftraggeber scheint ihr nicht zu trauen. Ungefragt stellt er ihr einen Fremden zur Seite: den geheimnisvollen Valentin Delacroix. Dabei sind die Gefühle, die er in ihr weckt, alles andere als hilfreich …
Hinter schillernden Palastmauern und prunkvollen Gärten erwarten dich im Auftakt von Emily Bolds mitreißender Zeitreise-Dilogie vielschichtige, interessante Charaktere und eine knisternde Liebesgeschichte – nur merke dir: Es ist nicht alles Gold, was glänzt!
//Dies ist der erste Band der »Palast der Lügen«-Reihe. Alle Romane der spannenden Liebesgeschichte im Planet!-Verlag:
-- Band 1: Vergangen ist nicht vorbei
-- Band 2: Frühjahr 2023//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Valentin blieb stehen und blickte mir in die Augen. »Niemand in Versailles tut etwas ohne guten Grund. Auch ich habe meine Gründe – aber würdet Ihr darauf bestehen, sie Euch zu nennen – müsste ich lügen.«»Und das gebt Ihr so offen zu?«»Warum nicht? In Versailles lügen alle, Mademoiselle Dubois.«Ich erstarrte. »Ich dachte, Ihr wisst nichts über mich. Meinen Familiennamen habe ich Euch nämlich nicht genannt«, erinnerte ich ihn erschrocken.Valentin Delacroix zuckte mit den Schultern und bedeckte meine Hand mit seiner, damit ich nicht vor ihm zurückweichen konnte. Er beugte sich näher zu mir und flüsterte: »Dann weiß ich vielleicht doch mehr, als ich zugebe.«
Bis du bereit für die Wahrheit hinter dem Palast der Lügen?
Die Autorin
© Privat
Emily Bold, Jahrgang 1980, schreibt Romane für Jugendliche und Erwachsene. Ob historisch, zeitgenössisch oder fantastisch: In den Büchern der fränkischen Autorin ist Liebe das bestimmende Thema. Nach diversen englischen Übersetzungen sind Emily Bolds Romane mittlerweile auch ins Türkische, Ungarische und Tschechische übersetzt worden, etliche ihrer Bücher gibt es außerdem als Hörbuch. Wenn sie mal nicht am Schreibtisch an neuen Buchideen feilt, reist sie am liebsten mit ihrer Familie in der Welt umher, um neue Sehnsuchtsorte zu entdecken.
Mehr über Emily Bold:www.emilybold.de
Emily Bold auf Twitter:@emily_bold
Emily Bold auf Facebook:www.facebook.com/emilybold
Emily Bold auf Instagram:www.instagram.com/emily.bold/
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor*innen und Übersetzer*innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator*innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher, Autor*innen und Illustrator*innen:www.planet-verlag.de
Planet! auf Facebook:www.facebook.com/thienemann.esslinger
Planet! auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemannesslinger_booklove
Viel Spaß beim Lesen!
Lü·ge
Substantiv, feminin [die]
Falsche Aussage, die bewusst gemacht wird und jemanden täuschen soll.
Die fünf Regeln der Lüge
Kindern wird immer gesagt, sie sollen nicht lügen. Darüber kann ich nur lachen. Ich bin Sophie. Und ich lüge. Täglich. Warum? Um die Wahrheit zu verbergen. Warum auch sonst? Niemand würde die Wahrheit verstehen. Und darum war es wichtig, nein, lebensnotwendig, zu lügen.
Und es ist leicht.
Eine Lüge ist oft nur ein Wort.
Wie vorhin, als ich Joel, den Freund meines Bruders vor der Apotheke getroffen habe.
»Hi Sophie! Wie geht’s?«, hat er wissen wollen.
Ich hätte ihm viel erzählen können. Von meinen Sorgen, meiner Unruhe, weil … lassen wir das. Ich habe ihm gesagt, es ginge mir gut.
»Gut.« – So einfach war das. Und obwohl Joel mich schon lange kennt, hat er mir geglaubt. Aber lügen ist mehr, es endet nicht, weil Menschen nicht aufhören, Fragen zu stellen. So wie Joel.
Er hat gewartet, bis ich die Tasche mit Medikamenten am Henkel meines Fahrrads befestigt hatte, ehe er mehr erfahren wollte.
»Wo steckt denn Elian? Er war heute wieder nicht beim Fechttraining.«
Mein Bruder focht. Aus gutem Grund. Ein Grund, den Joel nicht kannte. Den niemand kannte. Ein Grund, der Lügen erforderte.
Ich war ein Profi in dieser Disziplin. Nicht im Fechten. Im Lügen. Es gab fünf einfache Regeln, um im Alltag überzeugend zu lügen. Und ich befolgte sie. Immer. Auch wenn die Lüge noch so klein war.
Regel Nummer 1:
Sieh deinem Gegenüber dabei direkt in die Augen.
Joel hatte braune Augen. Etwas zu blass, um interessant zu sein. Doch das würde ich ihm nicht sagen. Auch eine Art zu lügen – die Wahrheit zu verschweigen.
Regel Nummer 2:
Halte dich, soweit es geht, an die Wahrheit.
»Ich schätze, Elian hat die Zeit mal wieder nicht auf dem Radar.«
Wie nah an der Wahrheit diese Antwort möglicherweise lag, würde Joel nie erfahren.
Regel Nummer 3:
Lenke ab, wenn die Lüge ausgesprochen ist.
Das ist leicht, weil die meisten gerne von sich selbst sprechen.
»Ich habe gehört, du hast jetzt eine Freundin?«, hat in Joels Fall zweifellos funktioniert. Er hat mir von Camille aus der Zwölften erzählt. Ich habe genickt. Und gelächelt. Das ist keine Regel, aber zu lächeln hilft.
Regel Nummer 4:
Löse dich aus der kritischen Situation, sobald sich die Gelegenheit ergibt.
»Ich muss jetzt weiter.« Ein Fingerzeig auf die Tasche an meinem Lenker unterstrich meine Behauptung. Aber manche Menschen waren eben anhänglicher als andere. Ein Fingerzeig reichte da nicht. Auch nicht bei Joel.
»Was hast du denn heute noch vor?« Und das bringt uns zur letzten Regel in der Kunst des Lügens.
Regel Nummer 5:
Niemals zittern – egal wie gewaltig die Lüge ist.
Ich habe nicht gezittert. Und Joel würde nie erfahren, wie gewaltig die Lüge meiner nächsten Worte war. Vielleicht, weil ich es zu diesem Zeitpunkt selbst noch nicht gewusst hatte:
»Ach, eigentlich nichts Besonderes …«
Die Nacht des Unheils
In der Nähe von Paris, 1685
Ein Blitz zuckte über den nächtlichen Himmel und das Donnergrollen ließ die Luft vibrieren. Albert Dubois stemmte sich mit ganzer Kraft in die Polster seiner Kutsche. Jedes Rumpeln auf den vom Regen ausgewaschenen Straßen war wie ein Dolchstoß in seinen krummen Rücken, und der Regen prasselte so laut aufs Kutschdach, dass Rémi, der Junge auf dem Kutschbock, seine Befehle nicht verstand. Darum öffnete Albert das Kutschfenster und streckte seinen Kopf in die sturmumtoste Nacht. Regen schlug ihm ins Gesicht und der Wind riss an seiner schwarz gelockten Perücke, die er sich mit einer Hand verzweifelt auf den Kopf presste. »Schneller!«, brüllte er über den Sturm hinweg und schlug dabei mit seinem Gehstock gegen die Kutschwand. »Rémi! Beeilung!«
Der Kutscher sah sich fragend nach ihm um. Wasser troff dem armen Wicht von der braunen Kappe in den Kragen seines gewachsten Umhangs.
»Treib die Pferde an!«, schrie Albert noch einmal und Rémi nickte. Der wischte sich den Regen aus dem Gesicht und ließ die Peitsche knallen. Die vier Pferde rissen an den Gurten und der Satz nach vorne stieß Albert zurück in die Kutsche. Er kippte vom Polster und krachte auf den Boden. Schmerz schoss ihm die Wirbelsäule hinauf und er kam nur mühsam auf alle viere.
Was er hier tat, war lebensmüde! Das war ihm klar. Die Kutsche fuhr viel zu schnell. Und doch ging es ihm noch zu langsam. Er hievte sich ächzend aufs edle Polster zurück und streckte sich nach dem geöffneten Fenster, durch das nach wie vor regelrechte Wassermassen ins Kutscheninnere schlugen. Der Wind hatte die Vorhänge nach außen gerissen und sie flatterten nun übers Kutschdach. Sie waren triefendnass und vermutlich nicht zu retten. Kurzerhand zerrte Albert den roten Samtstoff von der Verkleidung und opferte ihn dem Sturm. Dann zog er die Scheibe herunter und der kurze Moment der Stille, die ihn daraufhin umfing, ließ ihn durchatmen. Er umklammerte den Gehstock zitternd und versuchte, mit den Beinen die harten Stöße der wilden Fahrt abzufedern, während draußen ein weiterer Blitz die Dunkelheit taghell erleuchtete.
Nur ein Wahnsinniger würde in so einer Nacht das Haus verlassen. Ein Wahnsinniger, oder jemand, der keine Wahl hatte. So wie Albert Dubois. Donner grollte über den Himmel und vermischte sich mit dem lauten Hämmern seines Herzschlags. Er hatte Angst. Nicht vor dem Gewitter. Sondern vor dem, was ihn aus dem Haus getrieben hatte. Der qualvolle Schrei seiner Frau Estelle.
Albert schlug sich die Hand vor den Mund, um ein Schluchzen zu unterdrücken. »Estelle«, wisperte er, doch das Brüllen der Naturgewalten verschluckte seine Worte. Er betete für sie. Für sie und das Kind, das sie unter ihrem Herzen trug. Er sah an sich hinab. Gab sich dem Schmerz hin, der in seinem einst gebrochenen Rücken wütete. Er würde keine weitere Chance auf ein Kind bekommen, das wusste er. Keinen Erben haben, wenn Estelle und dem Baby etwas zustoßen würde. All das Land, durch das die Kutsche sich in dieser Nacht des Unheils kämpfte, war Land der Dubois. Doch ohne Erben war das bedeutungslos.
Donner grollte und die Pferde wieherten panisch. Rémi stieß einen Pfiff aus und das Rucken der Kutsche zeigte, dass die Tiere scheuten. Albert klammerte sich an den Sitz. Nichts hatte mehr Bedeutung, wenn er Estelle nicht helfen konnte. Er hatte alles versucht. Mediziner, Handaufleger, Scharlatane mit ihren Wundertränken, Wahrsager, die ihm ein gesundes Kind prophezeit hatten, nur um mit einem Beutel Gold belohnt zu werden. Keiner von ihnen hatte ihn vor dem, was in dieser Nacht geschehen würde, bewahrt oder auch nur gewarnt. Vor den Schreien. Den Schmerzen und der Verzweiflung im Gesicht seiner geliebten Ehefrau.
Das Rumpeln wurde langsamer, das Geräusch der Räder veränderte sich, und als die Kutsche schließlich anhielt, stieß Albert die Kutschtür auf und schnappte nach Luft. Die Stadtmauer von Paris ragte vor ihnen auf. Das Tor war geschlossen, wie jede Nacht.
Rémi war bereits vom Bock geklettert und hämmerte mit den Fäusten gegen das Stadttor. »Aufmachen!«, hörte Albert ihn durch den Sturm hindurch. »Bei Gott, öffnet meinem Herrn das Tor!«
Ein Verschlag, nicht größer als die Hand eines Mannes, wurde aufgestoßen und das Gesicht eines Torwächters erschien dahinter. »Die Tore sind geschlossen! Versucht es am Morgen noch einmal!« Er wollte den Verschlag schon wieder zuziehen, da streckte Rémi die Hand hindurch.
»Wartet!«, flehte er, während Albert sich aus der Kutsche mühte. Der Wind riss an seinem Umhang und seine Stiefel versanken im Matsch, aber das spürte er kaum. Ebenso wenig wie das Ziehen in seinem Rücken. Er hastete, so schnell es sein lahmes Bein zuließ, zu seinem Kutscher ans Tor. »Was kostet es, das Tor zu öffnen?«, rief er über ein Donnern hinweg und stemmte sich gegen das Holz. »Ich zahle jeden Preis – nur öffnet meiner Kutsche das Tor!«
»Das ist unmöglich«, erwiderte der Torwärter entschieden. »Erst bei Sonnenaufgang …«
»Seht Ihr nicht, dass mein Herr in Not ist?«, fuhr Rémi den Wärter an. »Öffnet das Tor!«
Der Mann schüttelte den Kopf. »Ich kann keine Kutsche hindurchlassen – selbst wenn ich wollte. Einen Fußgänger – das ginge. Aber kein Gespann mit vier Pferden.«
»Dann lasst mich durch!«, keuchte Albert und schob hektisch einen Beutel mit Münzen durch den Verschlag. »Macht schon auf! Es geht um Leben und Tod!«
Der Verschlag wurde geschlossen und für einen Moment war auf der anderen Seite nichts zu hören.
»Herr, glaubt ihr, er hat das Geld genommen und …«, fragte Rémi und nahm die durchweichte Kappe ab. Er schlug sie gegen seine nasse Hose, um das Wasser abzuschütteln, und setzte sie dann wieder auf.
Albert verließ langsam der Mut. Er hatte sich durch das Unwetter gequält, seine Frau verlassen in ihrer größten Not und hatte doch keine Gewissheit auf Erfolg. Was sollte er nur tun, wenn er nicht in die Stadt käme? »Dann versuchen wir es am nächsten Tor – und am übernächsten, bis uns einer einlässt!«, presste er verzweifelt hervor, wohl wissend, dass jeder Augenblick zählte. »Und wenn nichts anderes hilft, dann fahren wir zum anderen Ende von Paris, dort lässt der König die Stadtmauern schon einreißen. Dort kommen wir in jedem Fall durch«, überlegte Albert, noch nicht bereit, einfach aufzugeben.
Holz kratzte auf Holz, Metall knirschte. Dann schwang eine Seite des doppelflügeligen Stadttors auf. »Einer kann rein – nicht beide.«
Albert nickte und zwängte sich schon durch die Öffnung. »Bleib bei den Pferden!«, wies er den Kutscher an. Schließlich machte er sich auf den Weg. Ein Blitz erhellte die Gassen der Stadt, ehe er sie in erneute Dunkelheit stieß. Die Straßenlaternen waren längst gelöscht, die Fensterläden der Häuser geschlossen. Kein Lichtstrahl gelangte bis zum Boden. Trotzdem kämpfte Albert sich unbeirrt weiter. Dies war die Stunde für Mörder und Diebe, für zwielichtiges Pack und allerlei Sünder. Doch selbst die hielten sich bei solch einem Wetter zurück. Soweit er sagen konnte, war Albert allein unterwegs. Hinter einer Tür bellte ein Hund – von irgendwoher vernahm er das Heulen eines Babys. Ansonsten nur das Gurgeln des Wassers im Rinnstein und das Pfeifen des Windes.
Trotz seines gewachsten Umhangs drang ihm der Regen bis auf die Haut. Die Perücke hing ihm wie eine tote Ratte vom Kopf und er fand auf den glitschigen Pflastersteinen kaum Halt. Endlos kamen ihm die Gassen vor. Wieder und wieder bog er ab, der Beschreibung folgend, die er einst in einem Wirtshaus am Nebentisch belauscht hatte. Die Beschreibung zu einem Haus, das niemand aufsuchte, der bei Verstand war. Ein Haus, über das niemand sprach, dem sein Leben lieb war.
Atemlos stützte Albert sich an der nächsten Hausecke ab. Sein verkümmerter Rücken stand in Flammen. Es war, als würden Bienen jeden Millimeter seines schwachen Beins mit Stichen übersäen. Er keuchte und beugte sich schwer atmend über seinen Gehstock. Der Blick die Gasse entlang zeigte, dass er es fast geschafft hatte. Es war die dunkelste aller Gassen, die sich wie der Schlund eines Monsters vor ihm auftat. Dunkel und unheilvoll. Die Häuser standen dicht beisammen und es schien, als würden sich die Dächer einander zuneigen. Der Regen spülte Unrat die Gasse hinab und gelbe Augen leuchteten ihm aus den Ecken entgegen. Hier ein Huschen, dort ein Fiepen. Dann – je weiter er kam, nur noch Stille. Selbst der Regen ließ nach, als fürchtete er sich vor diesem Ort. Alberts Herz hämmerte ihm angstvoll in der Brust. Der Schweiß lief ihm unter seinem besten Hemd und der feinen Weste, die er zur Geburt seines Erben gewählt hatte, die Wirbelsäule hinunter. Jeder Knochen im Leib protestierte, als wollte sein Innerstes selbst verhindern, dass er tat, weshalb er hergekommen war.
Er erreichte die Tür, deren Beschreibung er in dem Wirtshaus aufgeschnappt hatte. Nicht ahnend, dass er sich dieser Tür je gegenübersehen würde. Und vielleicht war er ein Narr, sich überhaupt hierher aufgemacht zu haben, anstatt bei Estelle zu bleiben und ihr beizustehen.
Er hob die Hand und klopfte mit ganzer Kraft an die mit pechschwarzer Farbe gestrichene Tür. Vielleicht war er ein Narr – er würde es gleich erfahren.
Ein Krimi zur Ablenkung
Maison de Dubois, in der Nähe von Paris, heute
Die kleine Papiertasche, die mir der Apotheker mitgegeben hatte, baumelte am Lenker meines Fahrrads, und der Wind blies mir die blonden Haare ins Gesicht, als ich den Hügel zu unserem Haus hinauffuhr. Von oben konnte man den Stadtrand von Paris sehen. Doch ich drehte mich nicht um, um die Aussicht zu genießen. Ich musste fester in die Pedale treten, um den finalen Anstieg zu meistern. Atemlos bog ich auf die mit privat gekennzeichnete lange Einfahrt ab, die zum Haus führte. Eine ordentlich getrimmte Ligusterhecke säumte die Auffahrt auf beiden Seiten, bis zum eisernen Tor. Dort stieg ich ab, öffnete eine Seite des doppelflügeligen Tors und schob mein Rad hindurch. Erst dann wagte ich es durchzuatmen. Nur hier, hinter den hohen Mauern, die das Anwesen meiner Familie umliefen, konnte ich ich selbst sein. Nur hier gab es keine Lügen.
Die Maison de Dubois war der einzige Ort, an dem die Wahrheit Raum fand.
Ich lehnte mein Rad an die Hauswand des ehemaligen Torhäuschens und nahm die Papiertasche vom Lenker. Dann schlenderte ich den kopfsteingepflasterten Weg zum Haus hinauf. Die eierschalenweiße Fassade des zweistöckigen Stadthauses lag bereits im Schatten der mächtigen Bäume, die es umgaben. Trotzdem wirkte es einladend, was vermutlich an den großen Sprossenfenstern mit den hübschen hellgrauen Fensterläden lag, die links und rechts von der Haustür die ganze Front schmückten. Zur mit Glas durchsetzten Haustür selbst führten ein Dutzend breite Stufen hinauf. Der Charme der vergangenen Jahrhunderte war in jedem Stein, der hier verbaut worden war, spürbar. Ich ging ins Haus, durchquerte die helle Eingangshalle und trat an den unteren Treppenpfosten der sich halbrund nach oben windenden Marmortreppe.
»Papa?«, rief ich hinauf, stellte die Tasche ab und schlüpfte aus meiner Jeansjacke. »Elian? Ist jemand zu Hause?« Ich hängte die Jacke übers Geländer und ging ins Wohnzimmer. Die Türen zum Garten standen offen. »Papa?«
Er saß in einem weißen Sessel aus Korbgeflecht auf der Terrasse und war in ein Buch vertieft. »Papa?«, sprach ich ihn erneut an und trat zu ihm. Eine leichte Brise wehte durch die üppig blühenden Rosen, die an der Fassade emporwuchsen, und trug deren süßlichen Duft mit sich. »Ich habe deine Medikamente.«
Er sah auf und schenkte mir ein Lächeln. »Danke, Sophie. Die Kopfschmerzen sind heute wieder unerträglich.« Gequält rieb er sich die Stirn und seine Finger ertasteten die Narbe, die unter seinem schlohweißen Haaransatz verborgen war. »Ich versuche zu lesen, aber die Buchstaben verschwimmen mir vor Augen.«
Ich ging zu ihm und nahm das Buch auf, das er auf seinem Schoß liegen hatte. Ein Kriminalroman. Ich runzelte die Stirn. »Ist Elian noch nicht zurück?«, fragte ich besorgt, denn Clément Dubois griff nur zu Spannungslektüre, wenn er sich ablenken wollte.
»Nein. Ist er nicht.« Mein Vater setzte sich aufrechter hin und strich sich über den kurzen Vollbart.
»Elian hat doch gesagt, der Auftrag wäre schnell erledigt«, erinnerte ich ihn verwundert und setzte mich in einen Korbsessel gegenüber. »Joel hat schon gefragt, warum er heute nicht beim Training war.«
»Was hast du ihm gesagt?« Papas Augenbrauen, die um etliches dunkler waren als sein Haar, hoben sich neugierig.
Ich rollte mit den Augen. »Was glaubst du wohl? Dass ich ihm erzähle, Elian würde in der Vergangenheit einen nicht ganz ungefährlichen Auftrag erfüllen?« Ich warf seinen Krimi auf den Glastisch mit den Löwenbeinen und schüttelte den Kopf. »Ich hab ihm gesagt, dass Elian vermutlich nur die Zeit verpennt hat.«
Papa schmunzelte. »Das mag sogar stimmen. Er sollte längst zurück sein.«
Obwohl Papa so tat, als würde er das locker nehmen, sah ich ihm seine Sorge an. Seine Wangen waren unter dem Bart fahler als gewöhnlich und über seiner Nasenwurzel hatte sich eine tiefe Furche eingegraben. Entweder von den Schmerzen, oder vor Sorge.
»Warum gehen wir nicht in die Küche, ich schieb ein Hühnchen in den Ofen, mit leckeren Rosmarinkartoffeln, und wenn Elian kommt, essen wir drei gemeinsam. Er wird hungrig sein.«
Mein Vater nickte. Er fasste sich an die Stirn und verzog gequält das Gesicht. »Das mit dem Hühnchen klingt gut. Aber ich leg mich vor dem Essen besser noch etwas hin.« Er streckte mir die Hand entgegen und ich half ihm auf die Beine. Er stand wackelig, sodass ich ihn stützen musste.
»Alles gut?« Ich hasste es, ihn so zu sehen.
»Ja, ja, alles gut, Sophie. Mach dir keine Sorgen. Du weißt doch, mein Gleichgewicht …«
Im Grunde war es wirklich nichts Ungewöhnliches, dass Papa wankte. Er hatte gute und schlechte Tage. Doch wenn er sich Sorgen machte, dann setzte ihm das immer sehr zu. Und dass er sich Sorgen machte, das konnte ich ihm nicht verübeln. Ich selbst malte mir jedes Mal, wenn Elian einen Auftrag antrat, aus, dass er – genau wie unser Vater – eines Tages schwer verwundet werden könnte. Vielleicht überhaupt nicht mehr wiederkommen würde, weil ihm etwas zustieß. Papa war nur knapp mit dem Leben davongekommen, als er selbst noch die Schuld beglichen hatte, die das Erbe unserer Familie war. Diese verdammte niemals endende Schuld.
Eine halbe Stunde später schob ich den Bräter in den Ofen und stellte mir einen Timer, damit ich nicht verpasste, die Kartoffeln dazuzugeben. Anschließend ging ich leise die Treppe hinauf. Papa hatte sich hingelegt und ich wollte ihn nicht wecken. Im ersten Stock blieb ich kurz stehen und warf einen Blick durch die geöffnete Tür in sein Schlafzimmer. Die Vorhänge waren zugezogen und nur ein schmaler Lichtstreifen fiel durch die Fenster auf sein Bett. Ich ballte die Fäuste, denn selbst im Schlaf glättete sich die Falte über Papas Nasenwurzel nicht. Die Sorge ließ offenbar keine Sekunde von ihm ab.
Auf Zehenspitzen setzte ich meinen Weg fort. Mit der Hand auf dem metallenen Handlauf stieg ich die deutlich schmalere Treppe in das Dachgeschoss hinauf. Die Decken waren hier abgeschrägt, aber durch die Erkerfenster, die zum Garten hin viel Licht einließen, wirkte das Stockwerk dennoch luftig. Zielstrebig steuerte ich zu dem Zimmer, das aus gutem Grund ganz oben untergebracht war. Niemand, der nicht Teil dieser Familie war, hatte diesen verbotenen Raum je betreten. Ich öffnete die Tür.
»Elian?« Eigentlich war meine Frage überflüssig. Warum sollte er hier oben sitzen? Er würde herunterkommen, sobald er zurück wäre. Dieses Zimmer war nicht dazu gemacht, seine Zeit hier zu verbringen. Im Gegenteil. Dieses Zimmer … es war die Zeit. Die unendliche Zeit, die verformbare Zeit. Die Zeit, die immer wieder meine Familie zerriss.
Wie erwartet bekam ich keine Antwort. Ich trat zögernd ein und schloss die Tür hinter mir. Das Parkett unter meinen Füßen knarzte leise. Obwohl die Sonne durch das Erkerfenster fiel, fröstelte ich, als ich mich dem Schreibtisch aus Ebenholz näherte, auf dem sich nichts weiter befand als ein altmodisches Tintenfass samt eleganter Schreibfeder und ein ausgerolltes Stück cremefarbenen Pergaments. Ein Schaudern lief mir den Rücken hinunter. Trotzdem ging ich näher heran. Es war nur ein Bogen Pergament – zumindest auf den ersten Blick. Das wäre es für jeden, der hier unbefugt hereinkäme. Ein unbeschriebener Bogen altes Papier, an den Kanten bereits rissig.
Ich schluckte. Dann hob ich die Hand und strich vorsichtig mit dem Finger über das Pergament. Es fühlte sich an, als würde Strom ganz schwach durch meine Fingerspitzen zucken. Als würde ich etwas berühren, auf dem eine schwache Spannung lag. Dort, wo ich es berührte, drängte schwarze Tusche an die Oberfläche. Fein geschwungene Wortfragmente wurden sichtbar, verblassten aber wieder, sobald mein Finger weiterzog. Mein Puls beschleunigte sich. Was hier geschrieben stand, war nicht für meine Augen bestimmt. Ich war kein männlicher Nachfahre von Albert Dubois.
Ein bisschen frustriert, weil die Macht dieses Raums den Männern der Familie vorbehalten war, zog ich meine Hand zurück, aber das Kribbeln in meiner Fingerspitze blieb. Ich würde nicht lesen, was da stand. Noch nicht. Elian würde sich ja schon aufregen, wenn er wüsste, dass ich nur hier drinnen war.
Mein Blick wanderte zu der fast einen Meter hohen Sanduhr, die in einem metallenen Gestell an der Wand aufgehängt war. Drei Tage dauerte es, bis jedes einzelne Sandkorn von oben durch die Verengung bis in den unteren Bauch der Uhr gewandert war. Drei Tage, die fast verstrichen waren, wenn man die wenigen Körner betrachtete, die noch im oberen Glas der Sanduhr hingen.
Ich strich über das Glas und fragte mich, warum Elian so lange brauchte. War der Auftrag, den er erfüllte, doch schwerer als gedacht? Wieder glitt meine Aufmerksamkeit zum Schreibtisch. Es stand auf dem Pergament. Die Schuld, die wir zu begleichen hatten – sie stand dort geschrieben.
»Auf dem Pergament der Schuld«, wisperte ich ehrfürchtig und trat dann langsam rückwärts aus der Tür. Irgendwie hatte ich Angst, die Kräfte, die hier zugange waren, würden mich verschlingen, würde ich ihnen den Rücken zuwenden. Beinahe hektisch zog ich die Tür zu und legte meine Hand flach gegen das Türblatt. »Komm nach Hause, Elian«, flüsterte ich und lehnte besorgt die Stirn gegen das Holz. »Das Essen ist fertig.«
Mein Herr empfängt Euch jetzt
Paris, 1685
Auf sein erstes Klopfen regte sich nichts. Albert Dubois bekam es mit der Angst zu tun. Was, wenn er einem Märchen aufgesessen war? Wenn die Kerle im Wirtshaus in ihrem Suff nur Geschichten erfunden hatten? Oder er etwas von dem, was er an jenem Abend dort in der Schenke belauscht hatte, falsch deutete? Was, wenn er seine Frau in ihrer größten Not verlassen hatte, um …
Verzweifelt hämmerte er mit dem Griff seines Gehstocks gegen die Tür. »Aufmachen! Ist da jemand?!« Alberts schwaches Bein zitterte vor Anstrengung, und die Nässe, die durch seine Kleidung drang, verkrampfte seine Muskeln. »Aufmach–«
Ein Riegel hinter der Tür wurde zurückgezogen.
Albert schnappte nach Luft. Er wischte sich den Regen aus dem Gesicht und rückte sich hektisch die Perücke zurecht. Dann wurde ihm geöffnet. Er hatte mit vielem gerechnet. Mit einer dunklen Gestalt, einem dämonischen Herrn, einem Zauberer vielleicht. Doch nicht mit dem, dem er sich nun gegenübersah.
»Ihr seid ja ganz nass, Monsieur«, staunte das kleine Mädchen in ihrem bodenlangen Nachtgewand mit der gerüschten Haube auf dem Kopf und den weichen Pantoffeln an den bloßen Füßen. Blonde Zöpfe ragten unter der Haube hervor. Das Kind, das ihm kaum bis zum Bauchnabel reichte, hielt eine kleine Öllampe in der Hand und machte große Augen.
Albert beugte sich nach vorne. Das musste ein Irrtum sein! Er spähte in den finsteren Gang hinter dem Kind, doch nur eine weitere flackernde Flamme irgendwo im Haus sandte schwaches Licht aus.
»Kommt doch herein«, bot das Mädchen an und trat höflich beiseite.
»Wo … bin ich hier?«, fragte Albert und kam sich dumm dabei vor.
Das Kind kicherte. »Monsieur, Ihr habt doch hier geklopft. Sicher wisst Ihr, wo Ihr seid.«
Albert war sich da nicht so sicher. Er stützte sich auf seinen Stock. »Wo sind deine Eltern? Wer … wohnt hier? Ich … bin in Eile, und …« Seine Worte klangen selbst für ihn wirr und zusammenhanglos und etwas in seinem Innersten sagte ihm, dass er hier falsch sein musste. Und wenn er hier falsch war, dann vergeudete er kostbare Zeit. Er lehnte sich zurück und spähte noch einmal die dunkle Gasse entlang. Er stand vor der einzigen nachtschwarz gestrichenen Tür – er musste richtig sein. Doch warum dieses Mädchen? Sie hielt sich die Hand vor den Mund, um ihr Kichern zu verstecken. Als hätte er etwas Lustiges gesagt. Und tatsächlich lachten sogar ihre Augen, als sie ihn betrachtete.
»Monsieur, Ihr macht vielleicht Späße.« Sie winkte ihm, ihr zu folgen, und ging den Flur hinunter. »Tretet Eure Stiefel ab, wenn Ihr hereinkommt. Ihr seid ganz nass.«
»Lässt du jeden Fremden ein?«, rief er ihr nach, denn die winzige Flamme ihrer Kerze vermochte es kaum, die Haustür zu erhellen. »Willst du nicht wissen, wer ich bin – oder warum ich hier bin?«
Wieder lachte das Mädchen. Sie zuckte mit den Schultern – zumindest nahm er das an, denn die Flamme hob und senkte sich. »Wollt Ihr zu mir, Monsieur?«, fragte sie und das Licht glitt weich über ihr kindliches Gesicht. »Non? Dann muss ich nicht wissen, wer Ihr seid.« Sie winkte ihm erneut. Am Himmel über ihm zuckte ein Blitz und das Donnergrollen ließ nicht lange auf sich warten.
Da Albert nicht wusste, was er sonst hätte tun sollen, trat er ein. Seine nassen Stiefel schmatzten auf dem Steinboden, und als er die Tür hinter sich schloss und das Unwetter aussperrte, umfing ihn gespenstische Stille. Sein lauter Herzschlag war das einzige Geräusch, das er wahrnahm. Er schluckte und stützte sich mit der einen Hand auf seinen Stock, mit der anderen an der Wand ab, um im Dunkeln nirgendwo dagegenzulaufen. »Warte!«, rief er dem Kind nach, denn es ging bereits voran und der Schein der Kerze wurde schwächer. Die Situation war derart unwirklich, dass Albert langsam den Eindruck bekam, vielleicht doch richtig zu sein.
Er setzte sich in Bewegung und folgte dem flackernden Lichtschein der Kerze durch das Haus. Eine knarzende Treppe hinauf, eine andere wieder hinunter. Vorbei an etlichen Türen, die allesamt verschlossen waren, immer weiter dem Mädchen mit dem Licht hinterher. Sie ging zu weit voraus, als dass er sie etwas hätte fragen können, und wann immer er sich beeilte, zu ihr aufzuschließen, beschleunigte auch sie ihre Schritte. Es kam ihm vor, als würden Stunden vergehen. So viele Flure, so viele Treppen. Ihm war klar, dass er sich längst nicht mehr in dem Haus mit der schwarzen Tür befand. Doch wo war er? Es gab keine Fenster, die ihm dies hätten verraten können, und selbst der Weg zurück … Er fragte sich, ob er ihn ohne das Kind und im Dunkeln überhaupt wieder finden würde. Jeder Knochen im Leib tat ihm weh und sein Rücken, den er sich als Knabe beim Sturz vom Pferd mehrfach gebrochen hatte, brannte wie Feuer.
»Monsieur.« Das Mädchen war stehen geblieben und Albert ging zu ihr. Sie gähnte müde, ehe sie ihm lächelnd eine Tür öffnete. »Bitte tretet ein.« Der Raum war mit mehreren Kerzen erhellt und im Kamin prasselte ein Feuer. Ein Hund lag auf dem Teppich vor dem Kamin und spitzte nur die Ohren, als das Mädchen näher kam. Sie deutete auf einen gemusterten Sessel mit gedrechselten Füßen. »Nehmt Platz.« Vorsichtig stellte sie ihre Lampe ab. Dann kam sie zu ihm, nahm seine Hand und führte ihn zum Sessel. »Ihr müsst Euch setzen, Monsieur.« Anschließend griff sie nach einem Weinkrug und einem Zinnbecher, die auf dem Kaminsims standen, und kam damit zu ihm zurück. Wortlos drückte sie ihm den Becher in die Hand und goss ihm dunklen roten Wein ein. Mit einem höflichen Knicks trat sie zurück. »Trinkt, Monsieur.« Sie stellte die Karaffe zurück auf den Kamin und ging zu einer angrenzenden doppelflügeligen Tür. Zwei Mal klopfte sie, ehe sie die beiden Flügel weit öffnete. Albert beugte sich nach vorne. Er wollte durch die Tür spähen, lauschte angestrengt, doch weder vernahm er ein Geräusch, noch sah er etwas, denn ein schwerer Samtvorhang mit goldenen Quasten verschloss den Durchgang.
»Wo sind wir hier?«, fragte er, aber das Mädchen zuckte lediglich mit den Schultern.
»Trinkt«, wiederholte sie. Dann kam sie näher und schob ihn mit mehr Kraft, als er ihr zugetraut hätte, zurück in den Sessel, bis er die Lehne an seinem geschundenen Rücken spürte. »Trinkt. Mein Herr ist ein guter Gastgeber. Er wird nicht erfreut sein, wenn Ihr seinen Wein ablehnt«, flüsterte sie und führte ihm entschieden den Becher an die Lippen. Albert nahm einige große Schlucke, die ihm sogleich zu Kopf stiegen. Süß im Geschmack, aber betäubend in der Wirkung. Er berührte seine Lippe, die schon taub wurde. »Wer ist dein Herr?«, stieß er ängstlich hervor, und trotz des prasselnden Feuers und des Alkohols in seinem Blut überlief es ihn eiskalt.
Das Mädchen kicherte wieder. Dann machte sie einen Schritt nach hinten und verneigte sich vor dem leichten Rascheln des Vorhangs. Sie senkte die Stimme. »Ihr wisst, wer mein Herr ist. Ihr seid doch seinetwegen hier.« Sie wich an die Tür zurück, zu der sie ihn hereingeführt hatte. »Monsieur, der Teufel von Paris empfängt euch jetzt.«
Blut auf dem Parkett
Maison de Dubois, heute
Ich verspürte keinen Appetit. Das Hühnchen war golden gebräunt und im ganzen Haus roch es köstlich nach Rosmarin. Trotzdem saßen Papa und ich vor halbvollen Tellern. Ich hatte zarte weiße Hühnerbrust auf meiner Gabel. Aber ich brachte kaum einen Bissen hinunter.
»Es kommt nicht oft vor, dass Elian sich so viel Zeit lässt«, warf ich ein und zwang mich, das Stück Fleisch zu essen. Die knusprige Haut schmeckte würzig nach Paprika, trotzdem konnte ich das nicht genießen. »Als du noch die Aufträge erfüllt hast, da bist du fast immer aktiv nach Hause zurückgekehrt, richtig? Du hast nie gewartet, bis … die Zeit abgelaufen ist, oder?«, fragte ich mit vollem Mund.
Papa legte das Besteck aus der Hand und tupfte sich den Mund mit der Serviette ab. »Es gibt Aufträge, da braucht man jede Minute, um sie zu erfüllen. Du weißt selbst, dass manchmal die Zeit nicht reicht und wir um Aufschub bitten.« Mein Vater atmete tief durch. Dann suchte er über den Tisch meinen Blick. »Manchmal hindert uns etwas daran, selbst den Rückweg anzutreten.«
Ich würgte das Fleisch meine Kehle hinunter und packte meine Gabel fester. »Denkst du, ihm ist etwas passiert? Denkst du, Elian wurde verletzt?«
Papa schluckte. Er wischte sich mit der Serviette über den Nacken. Offenbar schwitzte er. »Ich hoffe nicht.«
»Und wenn doch?« Ich schob meinen Stuhl zurück und stand auf. Das Essen war vorbei. »Ich hole meine Tasche. Nur zur Sicherheit«, erklärte ich, ehe ich die Treppe hinauf in mein Zimmer rannte. Das ungute Gefühl, das mich bereits den ganzen Tag verfolgt hatte, wurde zunehmend stärker. Irgendetwas stimmte nicht.
Hektisch schob ich die Kissen von der Truhenbank unter dem Fenster und klappte den Deckel auf. Es war meine Notfalltruhe. Ich wühlte mich durch etliche Rollen Verbandszeug und die Bücher zum Thema Wundversorgung, bis ich meine Tasche fand. Ich riss sie heraus und hastete, ohne die nun auf dem Boden liegenden Kissen zu beachten, zurück in den Flur. Mein Vater war inzwischen die Stufen heraufgekommen und ich hakte mich bei ihm unter, da er wankte. »Kommst du mit hoch?«, fragte ich ängstlich. Ich hoffte es, denn falls Elian wirklich etwas zugestoßen sein sollte, dann würde ich Hilfe brauchen.
»Er wird uns auslachen, für unsere Sorge«, meinte Papa, wandte sich aber der Treppe ins Dachgeschoss zu. »Vermutlich hat er eine hübsche Mademoiselle kennengelernt, von der er sich nicht losreißen kann«, mutmaßte er, wobei der Schweiß auf seiner Stirn zeigte, dass er daran kaum selbst glaubte.
»Ich bring ihn um, wenn er uns wegen eines Mädchens so eine Angst macht«, rief ich, als ein lautes Poltern über uns mich plötzlich erstarren ließ. Ein Krachen, dumpf und laut – dann ein heiseres Keuchen.
»Elian!«, schrie ich und ließ Papa los. Ohne auf ihn zu warten, hastete ich immer zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppe hinauf. Die Tasche schlug mir gegens Schienbein, als ich die Tür zum verbotenen Zimmer aufstieß.
Das Erste, das ich wahrnahm, war das Blut auf dem Parkett.
Da war überall Blut.
Feucht glänzend war es über den Boden verschmiert, bis zu der reglosen Gestalt, die zusammengekauert vor der durchgelaufenen Sanduhr lag. Ich ließ die Tasche los. »Elian«, keuchte ich und warf mich neben die in Lumpen gekleidete Gestalt. »Elian, was zum Teufel ist passiert?« Ich packte ihn an den Schultern und drehte ihn auf den Rücken. Dann strich ich ihm das halblange, verfilzte Haar aus der Stirn und –
Schreiend wich ich zurück. Ich schnappte nach Luft, verstand die Welt nicht mehr. Panisch presste ich mir die Hand aufs Herz und starrte entsetzt in das mir vollkommen fremde Gesicht.
»Wer ist das?«, stieß Papa in diesem Moment von der Tür aus hervor. »Wo ist Elian?«
Ich war überrascht, dass er die Fragen, die mir wie ein Wirbelsturm durch den Kopf jagten, aussprechen konnte. Ich selbst war zu keinem klaren Gedanken fähig.
Der Fremde, dessen Blut sich unaufhörlich auf unser Parkett ergoss, atmete gurgelnd ein. Mit angstgeweiteten Augen starrte er blicklos zur Decke und seine Finger zuckten suchend über den Boden.
»Sophie!« Papa klang drängend. »Wo ist Elian?«
»Was weiß denn ich?«, fuhr ich ihn an. Mein Herz hämmerte so hart, dass ich Angst hatte, das Haus würde deshalb einstürzen. Ein fremder Mann verblutete vor unseren Augen.
Ich schnappte nach Luft. Es war, als würde ich das Blut metallisch auf meinen Lippen schmecken. »Was weiß denn ich«, wiederholte ich flüsternd. Dann nahm ich meinen Mut zusammen und kroch wieder näher an den Mann, der definitiv nicht Elian war. Es wunderte mich, dass mir das nicht sofort aufgefallen war. Elians Haar war zwar wie das des Fremden etwa schulterlang und leicht gelockt, doch es war heller. Dunkles Blond. Nicht schmutzverklebt und braun. Und der Kerl war viel älter als mein achtzehnjähriger Bruder. Er hatte eine Hakennase, und als er wimmernd Atem holte, offenbarte er ein lückenhaftes Gebiss schwarzer Stumpen. Die Fingernägel starrten vor Dreck, als er die Hand an seinen blutenden Bauch hob und etwas Unverständliches keuchte.
»Er braucht Hilfe!«, japste ich, und so langsam nahm mein Gehirn seinen Dienst wieder auf. Wer auch immer das war – er brauchte dringend Hilfe. »Gib mir meine Verbandstasche!«, wies ich meinen Vater an, während ich zitternd auf den Kerl zutrat. »Und ruf den Notarzt!« Der Fremde trug einen ledernen Umhang, der mit feuchter Erde verklebt und blutbefleckt war. Das Hemd aus grober Wolle darunter war in keinem besseren Zustand. Ein schmutzverkrustetes Halstuch war unter der Kehle des Kerls gebunden und der Ärmel seiner Jacke war zerschlissen. Ich sah nicht auf, als Papa meine Tasche neben mich stellte. Hektisch kramte ich nach Handschuhen und streifte sie mir über. Dann erst schob ich den Umhang des Unbekannten auseinander und suchte nach der Ursache für das viele Blut. Ich riss das Hemd auf und schnappte entsetzt nach Luft. »Guter Gott!«, entfuhr es mir, als ich den Schnitt entdeckte, der sich über den gesamten Bauch des Mannes zog.
Papa legte mir die Hand auf die Schulter. Er klang bedauernd, wenn auch mitfühlend. »Es ist zu spät. Er wird –«
»Er ist der Einzige, der weiß, was mit Elian passiert ist! Er darf nicht sterben!«
Die Lider des Kerls flatterten schwach, aber er regte sich nicht, als ich mit ganzer Kraft versuchte, die Blutung abzudrücken. »Wo ist Elian?«, wiederholte ich kreischend, wobei mir klar wurde, dass ich von dem Mann vor mir keine Antwort erhalten würde. »Ruf den Arzt!«, schrie ich Papa wieder an, doch der kniete sich neben mich und durchsuchte stattdessen die Taschen des Fremden. Röchelnd schnappte dieser nach Luft und mein Vater wich ein Stück zurück. Ich riss erschrocken die Hände nach oben. Die schmutzigen Stiefel des Kerls kratzten über den Boden, verschmierten das Blut. Ich konnte meinen Blick nicht von ihm wenden. Er spuckte einen Schwall Blut auf sein Hemd, ehe sein Kopf kraftlos nach hinten gegen die Wand kippte. Das gurgelnde Röcheln erstarb.
»Papa!« Ich zitterte am ganzen Leib. »Was …?«
Ein letztes Mal zuckten die Beine, dann erschlaffte der ganze Körper.
Einen Moment wagte niemand auch nur zu atmen. Die plötzliche Stille hatte etwas Endgültiges an sich und der fehlende rasselnde Atem war erschreckend. Papa beugte sich über den Fremden und fühlte an dessen Kehle nach einem Puls. Dann beäugte er mich und schüttelte den Kopf.
»Oh Gott!« Ich ließ die Arme sinken und wich weiter von dem Kerl weg. »Ist er tot?« Es war unnötig zu fragen, aber ich konnte es einfach nicht glauben. Das Ganze war so schnell gegangen. Vermutlich keine Minute. Und trotzdem kam es mir vor, als säße ich bereits seit Stunden im Blut dieses Mannes.
Mein Vater nickte. Anschließend tastete er die Brust des Toten ab und durchstöberte weiter dessen Kleidung.
»Was machst du denn?«, rief ich entgeistert.
Er blickte nicht auf. »Er muss den Chronographen bei sich haben«, klärte er mich auf. »Nur wer im Besitz des Chronographen ist, kann durch die Zeit gehen. Das weißt du doch.«
Das wusste ich. Aber in diesem Moment hatte ich daran überhaupt nicht gedacht.
Papa rümpfte beim Durchforsten der Jacke des Fremden die Nase. Elender Gestank entstieg seiner Kleidung. Der Kerl hatte sich sicher Wochen nicht gewaschen. Ich schlüpfte aus den blutverschmierten Handschuhen und rieb mir dann übers Gesicht. Das war alles zu viel für mich. Mein Magen rebellierte und ich kämpfte gegen den Drang an, mich zu übergeben.
Mein Vater erstarrte. Dann drehte er sich langsam zu mir um. Er hielt den Chronographen der Zeit in Händen. Das kupferne Gerät, einer Taschenuhr nicht unähnlich, mit den vielen Zahnrädern, Gewinden und dem Zeiger, der wie eine goldene Schlange geformt war, lag reglos in der Hand meines Vaters. Es war eindeutig Elians Chronograph.
»Er hatte ihn in seiner Brusttasche«, keuchte Papa und mit einem Mal wich alle Kraft aus ihm. »Er hatte Elians Chronographen.«
Wir beide wussten, was das bedeutete. Elian würde nicht zurückkommen können.
»Er ist in Schwierigkeiten«, überlegte Papa laut und wurde ganz blass unter seinem Bart. Er sah nicht so aus, als würde er mich überhaupt wahrnehmen, als ich zu ihm krabbelte und ihm den Chronographen abnahm. Das Metall war warm und mich schauderte. Warm vom Körper des Toten. Ich vermied es, den Leichnam anzuschauen, wandte mich stattdessen meinem Vater zu.
»Und jetzt?«, fragte ich. »Was wird jetzt aus Elian? Wenn er nicht zurückkommen kann, dann …«
Papa ließ die Schultern nach vorne sacken und fasste sich an die Stirn. Ich wusste, ihn schmerzte die alte Narbe. »Wir müssen nachdenken«, meinte er matt und zuckte mit den Schultern. »Wir müssen überlegen, wie ich Elian helfen kann.« Dann widmete er sich der Gestalt, die ich ganz bewusst versuchte auszublenden. »Und um den da müssen wir uns auch kümmern.«
Ich stieß ein ungläubiges Keuchen aus. »Kümmern? Wie willst du dich um eine Leiche kümmern?« Ich zwang mich, den Toten anzusehen. Mein Blick glitt über dessen unzeitgemäße Kleidung und sein verruchtes Äußeres.
Papa kämpfte sich vom Boden hoch. Er winkte mich zu sich, um ihn zu stützen, dabei trugen mich meine Beine kaum selbst.
»Es gibt nur einen Mann, an den wir uns nun wenden können«, murmelte mein Vater.
»Einen Mann? Wen meinst du? Wer kann denn bitte Tote verschwinden lassen?« Ich war mit den Nerven am Ende.
»Er«, meinte Vater geheimnisvoll und ich erstarrte.
»Du meinst …?« Ein Schaudern rann mir über den Rücken. »Du meinst nicht wirklich …«
Papa musterte mich. »Wen sollte ich sonst meinen? Wir müssen ihn informieren. Wir müssen ihm sagen, was geschehen ist. Er muss uns helfen!«
Ich schüttelte den Kopf. »Das ist Wahnsinn, Papa!«, erinnerte ich ihn. »Schulden wir diesem Mann nicht schon genug? Willst du gerade ihn um einen weiteren Gefallen bitten?«
Clément Dubois straffte die Schultern. »Das Gute an einer unendlichen Schuld ist – es kann fast nicht mehr schlimmer kommen.« Er schluckte. »Ohne Elian können wir unsere Schuld nicht begleichen. Wir haben keine andere Wahl.«
»Das ist Wahnsinn!«, flüsterte ich ungläubig und rieb mir über die mit Gänsehaut überzogenen Arme.
Als hätten wir das Unheil beschworen, fing die Luft an zu surren, und wie von Geisterhand erschienen schwarze Lettern auf dem Pergament neben uns auf dem Tisch.
Der Auftrag wurde nicht erfüllt, war zu lesen. Die Schuld der Dubois wurde nicht beglichen. Der Pakt gebrochen. Tragt nun die Konsequenzen.
»Wir müssen um Aufschub bitten!«, stieß ich panisch hervor und riss mit wild klopfendem Herz die Feder aus dem Tintenfass. Schwarze Tusche tropfte auf das Pergament, als ich hektisch die Spitze aufsetzte.
Der Tote auf dem Boden war nicht länger unser größtes Problem.
Aufschub
Zur Begleichung der Schuld wird um Aufschub gebeten.
Meine krakelige Schrift verblasste auf dem Pergament, während die Tinte trocknete. Mir hämmerte das Herz bis unter den Haaransatz und ich hätte mir am liebsten die Schläfen massiert, so wie Papa es neben mir gerade tat. Seine Haut war aschfahl und der Schweiß stand ihm auf der Stirn. Auf dem Boden lag ein Toter, und doch hatten wir größere Probleme.
»Um ein Haar …«, murmelte mein Vater und starrte blicklos aufs Pergament. »Wir haben unsere Schuld nicht beglichen – er wird …« Ihm blieben die Worte im Hals stecken und er senkte den Kopf in die Hände. »Er wird doch nicht …«
Ich legte ihm den Arm um die Schultern und führte ihn hinaus. Der Tote machte mich nervös und verhinderte jeden klaren Gedanken. Dabei mussten wir gerade jetzt einen klaren Kopf bewahren.
»Der Teufel von Paris wird uns Aufschub gewähren«, beruhigte ich Papa und hoffte zugleich, dass das auch tatsächlich stimmte. Ich wusste es nicht wirklich. Ich wusste überhaupt viel zu wenig. Seit Jahren stritt ich mit Papa darüber, dass sie mich viel zu wenig in die Geheimnisse einweihten, die unsere Familie hütete. Immer wieder nur die gleiche nervige Antwort: Du bist kein Mann, Sophie, dich betrifft das nicht.
Aber so ganz stimmte das natürlich nicht. Es betraf mich wohl! Denn ich würde die Konsequenzen mittragen müssen. Trotzdem verbot mir mein Vater jede Einmischung. So war es gewesen, seit ich denken konnte. Stell keine Fragen, Sophie, das musst du nicht wissen, Sophie, halt dich raus, Sophie …
Ich ballte die Fäuste, weil ich mich jetzt genau deswegen so hilflos fühlte. Es musste doch etwas geben, das ich tun konnte.
Mein Vater murmelte vor sich hin. »Ich muss mir etwas überlegen. Ich muss dorthin. Muss Elian finden.«
Ich hätte gelacht, wenn es nicht sein voller Ernst gewesen wäre.
»Wie soll das gehen?«, fragte ich ungläubig. »Ich musste dich stützen, damit du die Treppen hier heraufgekommen bist. Wie willst du in der Lage sein, dorthin zu gelangen, wo Elian gerade ist? Wie willst du in deinem Zustand …?«
»Ich habe doch keine Wahl, Sophie! Er hat den Chronographen verloren – ohne ihn kann er nicht nach Hause kommen!« Papa riss sich von mir los und stieg demonstrativ ohne meine Hilfe die Treppe in den ersten Stock hinunter. Er wankte in Elians Zimmer und öffnete dessen Kleiderschrank. Unter einem Stapel nicht gerade ordentlich zusammengelegter Jeans befand sich eine Truhe. Papa öffnete den Deckel und starrte auf die verschiedenen Waffen. Allesamt historische Stücke. Und doch regelmäßig in Gebrauch.
»Elian hat seinen Degen und sein Kurzmesser dabei«, erfasste mein Vater die fehlenden Waffen. »Und den kurzen Vorderlader.«
Mir wurde schlecht. »Ganz schön viele Waffen, für einen einfachen Auftrag«, meinte ich und sah Papa ängstlich an. Es war unvorstellbar, dass er Elian folgte. Er konnte kaum länger als ein paar Minuten stehen, ohne dass ihm seine Kopfverletzung zusetzte.
Mein Vater beugte sich in die Truhe und nahm sich einen der Degen heraus. Er wog die Waffe in der Hand und nickte schließlich. »Zu dieser Zeit lauerte die Gefahr überall. Elian kannte das Risiko und hat sich bewaffnet. Das war klug von ihm. Er wird durchhalten, bis ich ihn finde! Er hat sich gut vorbereitet.«
»Er war vorbereitet – und trotzdem ist ihm etwas zugestoßen!«, erinnerte ich meinen Vater ängstlich. Es erschreckte mich, dass er offenbar ernsthaft glaubte, Elian helfen zu können. »Elian ist im Gegensatz zu dir fit. Er kann kämpfen, ist trainiert. Wie willst du …?« Ich wollte nicht aussprechen, dass Papa seit vielen Jahren nicht mehr in der Verfassung war, zu tun, was er nun offenbar beabsichtigte.
»Meinst du, ich weiß nicht, dass das riskant ist?«, fuhr er mich an und ich schrak zurück. Er war nicht oft aufbrausend. »Aber es gibt niemanden sonst, der an meiner Stelle gehen könnte. Ich weiß, dass ich deinen Bruder nicht allein finden kann. Denkst du, ich bin lebensmüde? Unser Urahn Albert wird mir helfen, Elian aufzuspüren.«
Mein Vater hastete mit ausgestreckten Armen für ein besseres Gleichgewicht aus dem Zimmer meines Bruders, über den Flur in sein Schlafzimmer. Dort riss er die Schranktür auf und warf seine Hemden achtlos auf den Boden, um die dahinter fein säuberlich bereitgelegten Kleidungsstücke hervorzuholen. Eine Kniebundhose, mehrere Hemden in verschiedenen Qualitäten. Leuchtend blaue Kniestrümpfe, bunte Halstücher, feine Gehröcke und Westen.
»Zum Glück habe ich das alles aufbewahrt, auch wenn ich nicht erwartet habe, die Sachen noch einmal zu tragen.«
»Das ist doch verrückt, Papa! Du kannst nicht …«
»Ich muss!«, rief er und sah mich unnachgiebig an. »Ich muss.«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Ist dir klar, wie lächerlich das klingt?«, schrie ich zornig und den Tränen nahe. Warum hörte er mir nicht zu?
»Geh in Elians Zimmer. In der Truhe mit den Waffen muss ein Beutel mit Dukaten liegen. Und ich brauche meine Schmerztabletten. Sonst wird das nichts.«
»Wenn du meinst, du kannst durch die Zeit gehen und Elian suchen, dann hol dir doch selbst, was du brauchst. Ich werde dir nicht dabei helfen, dich umzubringen!« Ich funkelte ihn drohend an. »Was du da vorhast, ist Selbstmord! Und du weißt es!« Es musste einen anderen Weg geben.
Papas Züge verhärteten sich. »Ich weiß nur, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um Elian nach Hause zu holen. Niemand sonst kann das tun.«
»Was, wenn er tot ist?« Ich wollte das nicht aussprechen, doch der Gedanke ließ mich nicht los. »Was, wenn er überhaupt nicht mehr lebt? Ihm muss etwas zugestoßen sein, sonst wäre er hier, und nicht dieser … dieser …«
»Ich will das nie wieder hören!«, donnerte mein Vater lauter, als ich ihn je hatte schreien hören. »Wir halten deinen Bruder erst dann für tot, wenn wir seinen Leichnam vor uns sehen! Und keinen Augenblick früher! Hast du das verstanden?!«
»Ja«, presste ich heraus und fühlte mich tatsächlich furchtbar.
»Ich bringe ihn nach Hause – und wenn es das Letzte ist, was ich tue.«
»Was ist mit mir? Kann ich das nicht?«
Mein Vater schnaubte. »Mach dich nicht lächerlich, Sophie. Du bist ein Mädchen.«
»Und was?« Es war ja wohl kaum lächerlicher als die Vorstellung, dass er sich das zutraute. »Was hat das damit zu tun?«
Er schaute mich an, als wäre ich bescheuert. »Mädchen haben in dieser Zeit nichts verloren. Außerdem ist es unmöglich. Ich würde nie zulassen, dass du …« Er winkte ab. »Du verstehst das nicht. Du … weißt nicht, wie die Dinge funktionieren, Sophie! Es ist viel zu gefährlich!«
»Und für dich ist es nicht gefährlich?«
Clément Dubois straffte die Schultern und blickte mich entschieden an. »Ich bin ein Mann! Ich kann fechten, habe früher jeden Kampf gewonnen und weiß, wie man sich in dieser Zeit bewegt, ohne aufzufallen. Außerdem diskutiere ich das nicht mit dir, Sophie«, erklärte er streng. »Und jetzt stell keine Fragen, sondern hol die Münzen, und dann hilf mir, mich fertig zu machen.« Er hob den Chronographen hoch, dessen Zahnräder sich in diesem Moment anfingen zu drehen. »Der Teufel von Paris gewährt uns Aufschub«, deutete er die sich in Bewegung setzende Mechanik. Die Zahnrädchen waren in Aufruhr und das leise Ticken elektrisierte die Luft. »Mir bleiben drei Tage.«
Zitternd entwich mir der Atem. Ich wurde immer panischer. Dabei war es wichtig, ruhig zu bleiben, doch es tauchten nur schreckliche Bilder vor meinem geistigen Auge auf. Elian, der verwundet sein musste, oder Schlimmeres. Mein Vater, der sich wankend durch die Zeit bewegte und dabei noch schwerer verletzt wurde. Den Teufel von Paris, wie er unsere Blutlinie kappte, wenn sein Auftrag nicht erfüllt werden würde. Und dazu der Tote über uns. Mich schüttelte es und ich schlang mir die Arme um den Oberkörper, weil ich mich so verloren fühlte.
»Und was wird aus mir, wenn dir was zustößt? Einen Stock über uns liegt ein Leichnam, der bereits stinkt, ohne dass er am Verwesen ist! Was soll ich mit ihm tun, wenn du weg bist? Ich kann nicht mit einem Toten im Haus –«
»Ich werde mich darum kümmern!«, schnitt Papa mir das Wort ab. »Der Teufel von Paris kann solche Dinge regeln!«