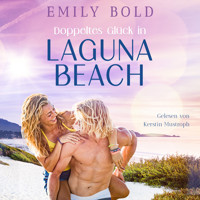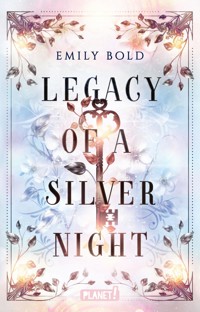12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
+++ FARBIGER BUCHSCHNITT IN LIMITIERTER AUFLAGE +++
Eine magische Fantasy-Liebesgeschichte aus der Feder von Emily Bold, der Autorin von Silberschwingen und The Curse.
Wenn der erste Junge, den du küsst, deine Seele stehlen will, dann läuft etwas gewaltig schief. So wie bei Abby Woods. Sie hat schon viele Fehler begangen. Diese haben sie nach Darkenhall geführt, eine Londoner Schule, die sich rühmt, auch aus den unbezähmbarsten Schülern bessere Menschen zu machen. Als sie dort dem charismatischen Tristan und seinem geheimnisvollen Bruder Bastian begegnet, begeht sie einen noch viel größeren Fehler. Sie stiehlt Bastians Ring, nicht ahnend, welche Kraft sie damit entfesselt. Denn die Tremblays sind keine gewöhnlichen Schüler, und der Ring kein einfaches Schmuckstück. Abby gerät in große Gefahr und sie muss erkennen: Einen Tremblay küsst man nicht.
Band 1 der Stolen-Trilogie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Wenn der erste Junge, den du küsst, deine Seele stehlen will, dann läuft etwas gewaltig schief. So wie bei Abby Woods. Sie hat schon viele Fehler begangen. Diese haben sie nach Darkenhall geführt, eine Londoner Schule, die sich rühmt, auch aus den unbezähmbarsten Schülern bessere Menschen zu machen. Als sie dort dem charismatischen Tristan und seinem geheimnisvollen Bruder Bastian begegnet, begeht sie einen noch viel größeren Fehler. Sie stiehlt Bastians Ring, nicht ahnend, welche Kraft sie damit entfesselt. Denn die beiden Tremblays sind keine gewöhnlichen Schüler, und der Ring ist kein einfaches Schmuckstück. Abby gerät in große Gefahr und sie muss erkennen: Einen Tremblay küsst man nicht.
Eine magische Fantasy-Liebesgeschichte von der Silberschwingen- und The-Curse-Autorin
Die Autorin
© privat
Emily Bold, Jahrgang 1980, schreibt Romane für Jugendliche und Erwachsene. Ob historisch, zeitgenössisch oder fantastisch: In den Büchern der fränkischen Autorin ist Liebe das bestimmende Thema. Nach diversen englischen Übersetzungen sind Emily Bolds Romane mittlerweile auch ins Türkische, Ungarische und Tschechische übersetzt worden, etliche ihrer Bücher gibt es außerdem als Hörbuch. Wenn sie mal nicht am Schreibtisch an neuen Buchideen feilt, reist sie am liebsten mit ihrer Familie in der Welt umher, um neue Sehnsuchtsorte zu entdecken.
Mehr Informationen gibt es unter: www.emilybold.de
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH auch! Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autoren und Übersetzern, gestalten sie gemeinsam mit Illustratoren und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher, Autoren und Illustratoren: www.planet-verlag.de
Planet! auf Facebook: www.facebook.com/thienemann.esslinger
Planet! auf Instagram:www.instagram.com/thienemann_esslinger_verlag/
Viel Spaß beim Lesen!
Prolog
Bastian Tremblay sank auf die Knie. Er zitterte, denn das Wüten in ihm drängte danach, dem Mädchen zu folgen. Es fühlte sich an, als wäre er ein Wolf, der hinter dem blutenden Reh herwollte, in dessen Fleisch er seine Zähne gerade gegraben hatte.
»NEIN!«, knurrte er und grub die Fingernägel in den Boden. Sein Atem kam hart und gepresst. Die Leere in ihm verlangte nach mehr, als nur diesem Hauch von Abigails Weben. Dabei hatte er überhaupt nicht vorgehabt, sich diesen auch nur zu nähern. Er hatte nicht vorgehabt, sie in sich aufzunehmen.
Gequält sog Bastian den Atem in seine Lunge und schloss die Augen. Doch das Bild ihrer zitternden Lippen, ihrer angstvoll geweiteten Pupillen ließ sich nicht verdrängen. Er sah ganz deutlich, wie seine Berührung sie zeichnete. Dunklen Ranken gleich, hatten sich ihre Seelenweben an die Oberfläche gewagt, um sich ihm anzubieten. Hatten ihre Haut vom Nacken aus mit einem wabernden Netz überzogen und sie so zu einem Teil von ihm gemacht.
Es würde nie wieder sein wie vorher.
Bastian ballte die Fäuste so fest zusammen, dass seine Nägel halbmondförmige Abdrücke auf seiner Haut hinterließen.
Dann riss er zornig sein Hemd auf und betrachtete, was der Moment der Schwäche mit ihm anrichtete. Das Wüten tobte in ihm wie ein Orkan und sein Körper war über und über mit schwarz schillernden Weben übersät. Sie drängten sich unter seine Haut, als wollten sie aus ihm herausbrechen. Und Bastian wusste, dass es genau so war.
Er presste die Hand auf die Narbe an seinem Herzen, und zwang sich zur Ruhe.
Er musste die Kontrolle behalten.
Und er musste einen Weg finden, Abigail Woods’ Weben zu nehmen, ohne dabei sich – oder sie – zu zerstören.
Letzte Chance
Zuvor
Das war meine letzte Chance! Immer wieder musste ich mir diese Worte vorsagen, um nicht laut zu protestieren, als das Taxi in die als Privat gekennzeichnete Einfahrt von Darkenhall einbog. Die Mauern aus gelbem Backstein ragten vor mir auf und ich beugte mich leicht nach vorne, um besser zu sehen.
Meine letzte Chance!
Eine Grille zerschellte auf der Windschutzscheibe und ich lehnte mich angewidert zurück in den Sitz.
Das unebene Kopfsteinpflaster knirschte unter den Reifen, als der Fahrer auf die Bremse trat. Ich sah ihn an, in der Hoffnung, er möge meine Gedanken lesen und mich schnell wieder von hier fortbringen.
»Wapping High Street, Darkenhall«, bestätigte er in nasal-indischer Tonlage und drückte sogleich am Taxameter herum. Hinter mir kramte Florence in ihrer Handtasche nach der Geldbörse. Mit einem Zittern in der Brust löste ich den Gurt und öffnete die Tür. Mein Blick glitt über das herrschaftliche Anwesen mit den weißen Sprossenfenstern und Mauervorsprüngen. Drei Stockwerke hoch, mit spitzem Dach aus grauen Schindeln, die im Licht der Mittagssonne silbern schimmerten. Gegenüber dem Eingang erstreckte sich eine parkähnliche Anlage und im Süden schimmerte die Themse durch das Blätterdach der Bäume.
»Ist das nicht toll!«, staunte Florence und wuchtete hinter mir unser Gepäck von der Rückbank des Taxis. »So eine schöne Anlage! Da muss ja ein besserer Mensch aus einem werden!«
Ich nahm ihr den Rucksack und meine Reisetasche ab, ohne etwas zu erwidern. Teure Autos standen aneinandergereiht in den Parkbuchten neben dem großen schmiedeeisernen Tor an der Einfahrt. Mir drängte sich der Gedanke auf, dass es einen hohen Preis kostete, ein besserer Mensch zu werden.
»Ich gehöre hierher wie das Haar in die Suppe«, murrte ich und schulterte meine Tasche. Sie war schwer, denn ich würde eine ganze Weile auf dieser Schule bleiben müssen, wie es aussah.
Darkenhall war meine letzte Chance!
»Nimm’s nicht so schwer, Abby«, versuchte meine Pflegemutter Florence mich aufzumuntern. Sie rückte sich den türkisfarbenen Hut zurecht und straffte die Schultern. Wie immer hatte sie eine Hutkreation gewählt, die sie größer wirken ließ, denn ohne Kopfbedeckung reichte sie selbst mir nur bis zum Kinn. »Das ist eine wunderbare Schule!«
»Sicher …«, brummte ich emotionslos.
Florence’ Züge wurden weicher. Sie drückte mich kurz und ich las die gleiche Unsicherheit, die ich empfand, auch in ihrem Blick. Dann hängte sie sich die Handtasche über den Unterarm und lächelte mich mitfühlend an.
»Es wird Zeit.« Sie sah die Eingangstreppe hinauf. »Du weißt, was für ein Glück es war, dich überhaupt hier unterzubringen«, erinnerte sie mich leise und ich spürte, dass sie sich wünschte, ich würde mehr Begeisterung zeigen. Schließlich hatte uns das Schicksal mit Darkenhall einen wirklich guten Dienst erwiesen – das waren zumindest Florence’ Worte.
Und deshalb – oder war es, weil sie fürchtete, der Abschied könne sonst noch härter werden – trippelte sie mit kleinen Schritten und einem motivierten Lächeln auf den Lippen die breite Eingangstreppe hinauf.
Der Kopf des Geländers wurde von aus Stein gehauenen Drachenköpfen verziert. Übelst kitschig, wie ich fand, und ein echter Stilbruch zum modernen Wintergarten, der weiter hinten zum Wasser hin angebaut worden war. Aber Geld verlieh ja nicht immer auch Geschmack …
Neben dem zähnefletschenden Maul des Drachen wandte Florence sich zu mir um und wirkte nun doch so langsam ungeduldig. Ihre Lippen bewegten sich, aber ich verstand nicht, was sie sagte. Denken konnte ich es mir trotzdem.
»Dann ist es jetzt wohl so weit!«, murrte ich, wickelte einen Kaugummi aus dem Silberpapier und steckte ihn mir in den Mund. Ich griff meinen Rucksack und prüfte den Sitz meiner Schultertasche. Ich hatte alles, was ich brauchte. Es gab keinen Grund, noch länger zu warten. Und doch waren meine Beine wie angeklebt. Ich wollte da nicht rein!
Aber die Sonne brannte mir unbarmherzig in den Nacken und unter den Schulterriemen meines Rucksacks brach mir der Schweiß aus. Ich hatte keine Wahl. Ich strich mir die Haare aus dem Gesicht und machte gerade einen ersten Schritt in mein unwillkommenes neues Leben, als ich zu meiner Linken plötzlich laute Stimmen vernahm: »Ich will dich nie wieder sehen, du Arsch!«, kreischte ein Mädchen hinter einer Gruppe Jungs her.
»Das klang auf der Party am Freitag aber noch ganz anders!«, zog einer der jungen Männer sie auf. »Da konntest du nicht genug bekommen!«
Das Gelächter der Gruppe stieß mir übel auf und ich verspürte echtes Mitleid mit dem Mädchen.
»Was glotzt du so?«, schrie die mich an und mein Mitleid verflüchtigte sich.
»Das fängt ja gut an«, murmelte ich und schleppte meine Taschen zum Eingang. So viel also zum Thema bessere Menschen …
Ich sah der Gruppe wandelndem Testosteron hinterher und schwor mir direkt, diesen Kerlen aus dem Weg zu gehen. Ich sollte allen Problemen aus dem Weg gehen!
Immerhin war das meine letzte Chance.
Als ich schließlich durch die Tür trat, war von Florence nichts mehr zu sehen. »Mist«, stöhnte ich und versuchte mich zu orientieren. Ich strich mir die aubergine gefärbten Haare aus der Stirn und ließ meinen Blick durch die weitläufige Halle schweifen. Direkt vor mir führte eine gewundene und mit dunkelblauem Läufer bedeckte Treppe in die nächste Etage. Links und rechts der Eingangshalle zweigten lange Flure ab. Die Decke spannte sich hoch über meinem Kopf, die Dachbalken waren gut zu erkennen, und über jedem Türsturz waren irgendwelche lateinischen Inschriften eingemeißelt.
»Wo bin ich denn hier gelandet?«, flüsterte ich, denn die Stille war regelrecht erdrückend. Schnell, ehe sich der Gedanke festsetzte, dass mir das hier kein bisschen gefiel, fasste ich meine Taschen fester und folgte dem Wegweiser zum Direktorat in Richtung Nordbau.
Die Mittagssonne, die durch die Bogenfenster hereinfiel, malte helle Lichtbahnen auf den honigfarbenen Holzboden und meine Schritte hallten dumpf in der Stille wider, als ich dem schier endlosen Gang immer weiter folgte. Ich war erleichtert, als ich eine Nische mit einer gepolsterten Sitzbank gegenüber einer ebenfalls verschlossenen Tür erreichte. Direktorat stand auf einem Schild. So weit, so gut!
Ich sah mich etwas ratlos um. Sollte ich klopfen? Oder einfach hineingehen? Von Florence fehlte jede Spur. War sie schon ohne mich eingetreten?
»Gibt’s hier nicht mal ’ne Vorzimmerdame, oder was?«, murmelte ich schlecht gelaunt und ließ meine Tasche vor der Bank auf den Boden fallen. Unsicher strich ich mir die Haare zurück. Ich hatte Schweißflecken unter den Achseln und verschränkte deshalb die Arme vor der Brust.
»Reingehen oder warten?«, wog ich ab und versuchte, die dunklen Flecken auf meinem Shirt zu verbergen. Ich trat näher an die Tür und lauschte.
»Es lässt sich nicht schönreden«, hörte ich die Stimme meiner Pflegemutter gedämpft durch das Holz. »Abigail hat Probleme.«
Na klar!
Ich machte eine Kaugummiblase und schaute den menschenleeren Gang entlang. Die Schweißflecken verloren an Bedeutung. Ich hatte andere Probleme …
So war das eben mit mir. Entweder machte ich Probleme oder ich hatte welche. Das war nichts Neues. Trotzdem tat es weh, das aus Florence’ Mund zu hören.
»Sie hatte es nicht leicht und ich wünsche mir wirklich, dass sie es endlich schafft, irgendwo anzukommen.«
Ich rollte mit den Augen. Ich war schon oft irgendwo angekommen. Zu oft. Neue Schule, neue Pflegefamilie, neue Umgebung. Genau wie jetzt.
Seufzend riss ich mich von der Tür los und ließ mich auf die Bank fallen. Ich steckte mir einen meiner Kopfhörer ins Ohr, um nicht noch mehr von diesem Unsinn hören zu müssen.
Natürlich wusste ich, dass Florence sich wirklich um mich sorgte. Von allen Pflegeeltern, mit denen ich zu tun hatte, war Florence wirklich die … die Beste. Ich glaube, sie mochte mich wirklich. Und ich mochte sie ja auch. Ich mochte ihr Atelier. Ihre Hüte. Und durch sie hatte ich meine Leidenschaft fürs Zeichnen wiederentdeckt. Als Kind hatte ich leidenschaftlich gerne gezeichnet. Ich war gut darin gewesen, hatte mich regelrecht in meinen Bildern verloren. In den Pflegefamilien hatte ich es dann aufgegeben. Ich hatte mich aufgegeben und beinahe vergessen, wie glücklich mich ein Stift und ein Blatt Papier immer gemacht hatten. Erst Florence hatte mich daran erinnert. Nicht, dass Florence zeichnete – ausgenommen die Entwürfe ihrer Hüte. Unfassbare Hüte. Nicht nach meinem Geschmack, aber der gesamte Dunstkreis rund ums Königshaus war besessen von ihren Kreationen. Jeder liebte Florence. Ich auch. Und trotzdem hatte ich es verkackt. Mal wieder.
Ich sollte Dankbarkeit empfinden, dass sie mich hierherbrachte. Sie hätte es sich auch viel leichter machen, und mich einfach wieder dem Jugendamt überantworten können. Stattessen hatte sie viel Geld investiert, um mich an dieser Schule unterzubringen. Ich stöhnte leise.
»Schule für problembehaftete Jugendliche!«, echote ich missmutig die Erklärung nach, die Florence mir gegeben hatte.
Dabei sollte ich ihr wirklich hoch anrechnen, dass sie diese Kosten und Mühen auf sich nahm. Doch ich konnte es nicht. Es fühlte sich für mich einfach nur an, als würde sie mich abschieben. Als würde sie mich fallen lassen, wie es immer alle getan hatten, sobald es schwierig geworden war.
Ich blies mir den Pony aus den plötzlich feuchten Augen und zog mit dem Kaugummi einen langen Faden, den ich mir um den Finger wickelte, ehe ich ihn weiterkaute.
Ich rang die doofen Gefühle in mir nieder und konzentrierte mich darauf, wie furchtbar es hier war. Das war allemal besser, als meine oder Florence’ Taten zu analysieren. Oder unsere Absichten.
Ich lauschte der Musik in meinem Ohr, als könne sie meine Einsamkeit, meine Sehnsucht nach Geborgenheit, lindern. Florence wollte, dass ich irgendwo ankam. Dass ich ein Zuhause fand, wie sie mir erklärt hatte. Aber wie sollte ich das ausgerechnet hier tun? Darkenhall! Wie das schon klang …
Ich hatte absolut keine Lust, auf eine Friedhofsschule zu gehen, in der eine Grabesstille herrschte und das größte Problem meiner Mitschüler vermutlich darin bestand, mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden zu sein.
Ich stellte die Playlist mit meinen Lieblingsliedern an meinem Handy lauter und hob leicht den Arm, um mich zu vergewissern, dass ich zu den furchtbaren Flecken nicht auch noch übel roch, während ich die Gänge nach dem kleinsten Anzeichen von Leben absuchte. Die Mauern der Schule strahlten strenge Erhabenheit aus. Einschüchternd irgendwie.
Mir fiel das Wappen auf, das über der Eingangstür prangte. Ich kannte es, weil ich die Schule gegoogelt hatte. Es war das Familienwappen der Tremblays, die diese Schule seit Generationen leiteten. Ich hatte direkt ein Bild vor Augen. Knorrige alte Spießer, die meinten, mich zurück auf den rechten Weg führen zu können. Dabei brauchte ich überhaupt keinen Weg, denn ich wollte nirgendwohin. Ich wollte einfach nur bei Florence im Atelier sitzen und zeichnen.
Frustriert stand ich auf und streckte die Beine durch. Vom langen Sitzen war mir der Hintern eingeschlafen und ich machte einige dehnende Schritte. Die innere Unruhe fraß mich auf, aber vermutlich war diese Warterei schon Teil irgend so einer fragwürdigen Therapiemaßnahme …
Ich trat an eines der Bogenfenster und schaute hinaus.
Die Mädchen, die durch den Park zum gegenüberliegenden Gebäudeteil schlenderten, das eine spiegelverkehrte Kopie dieses Baus hier war, trugen teure Taschen, und die Sonnenbrillen in ihren Haaren dienten eher einem modischen Zweck als dem Schutz vor der Sonne. Von hier aus konnte ich das Bootshaus unten am Wasser sehen. Die Trauerweiden des Parks hingen weit über die Kaimauer, sodass es wirkte, als wollten sie das Wasser berühren. Auf der anderen Seite zur Straße hin befand sich das schmiedeeiserne Tor, das die Einfahrt zu dem von Mauern umgebenen Anwesen bildete. Es bewegte sich leicht im Wind. Ein Luftzug drang durch die alten Fenster und trotz der Wärme überzog eine Gänsehaut meine Arme. Unbehaglich wandte ich mich ab.
Ein Acrylglasständer mit Broschüren über die Schule seitlich der Sitzbank zog meinen Blick auf sich und ich nahm eines der farbig gedruckten Infohefte heraus. Das Papier fühlte sich wertig an, erlesen, so, wie die ganze Aufmachung der Broschüre auch. Nicht, dass ich etwas anderes erwartet hätte.
»Darkenhall«, las ich leise und schlug die erste Seite auf, obwohl die Inhalte sich kaum von der Webseite unterschieden, die ich mir angesehen hatte. »Die im Herzen Londons gelegene Privatschule stellt vor allem für schwierige Jugendliche oftmals die letzte Chance dar. Der Wohlstand unserer Gesellschaft macht es den Kindern nicht immer leicht. Mit viel Engagement, Geduld und ungewöhnlichen Therapieansätzen eröffnen wir diesen Schülern eine Perspektive. Glückliche Jugendliche und bessere Menschen sind unser Ziel.«
Ich nahm den Kaugummi aus dem Mund und drückte ihn in den Prospekt mit den Bildern von fröhlich lachenden Teenagern. Man sah sie beim Rudern, beim Musizieren und aufmerksam in ihren Klassenzimmern.
Klar, die hatten es echt schwer! Mit ihren teuren Uhren, den angesagten Smartphones, den Sonnenbrillen … Wohlstand konnte ein Kind schon echt fertigmachen!
Ich schüttelte den Kopf und steckte den Prospekt zurück in den Ständer.
Als ich einen Schritt zurück machte, stieß ich gegen etwas. Oder besser gesagt, gegen jemanden.
»Huch!«, entfuhr es mir und ich hob entschuldigend die Hände. »Sorry!«
Ich war so in die Betrachtung der Zombie-Grins-Teenies in der Broschur vertieft gewesen, dass ich überhaupt nicht bemerkt hatte, dass ein Schüler den Flur entlanggekommen war.
»Pass doch auf, Bitch!«, maulte er mich an und schlurfte mit einer Sporttasche über der Schulter weiter.
Wie bitte?
Mein Mund ging auf, aber kein Laut kam heraus. Hatte der mich gerade ernsthaft Bitch genannt? Hier? In Darkenhall? Wo einem doch die Sonne aus dem Allerwertesten scheinen sollte?
Nicht, dass ich nicht ein klein wenig Befriedigung darüber empfand, dass hier doch nicht alles Gold war, was glänzte. Immerhin schlurfte dieser Typ und hatte zumindest auf den ersten Blick recht wenig mit den Grinsebacken aus dem Prospekt gemeinsam. Er trug zwar die dunkelblaue Schuluniform, aber die unordentliche Art, mit der er das tat, entsprach genau meiner Vorstellung davon, wie man so eine verdammte Unterdrückung jeglicher Individualität zu tragen hatte! Sein Haar war kurz geschnitten, als hätte jemand versucht, einen ordentlichen Jungen aus ihm zu machen, aber so strubbelig, wie es ihm vom Kopf abstand, zeigte sich auch hier ein rebellischer Geist.
»Bitch …«, wiederholte ich leise seinen Fluch und sank nachdenklich zurück auf die Bank. Die Psychologin vom Jugendamt hätte das sicher unterschwellig ausgelebte Aggression genannt. Oder vielleicht war es auch nicht ganz sooo unterschwellig. Um das beurteilen zu können, hätte ich in jedem Fall eine Brille auf meiner Nasenspitze gebraucht und ein mit dickem Leder eingebundenes Klemmbrett für Notizen.
Seufzend fischte ich den kleinen Bleistift aus der hinteren Hosentasche meiner Jeans und betrachtete skeptisch die stumpfe Mine. Ich zückte das winzige Klappmesser, das ich in einer ebenso kleinen Lederscheide immer zusammen mit dem Stift bei mir trug, und spitzte konzentriert das Grafit an. Ruhe überkam mich, als die hauchdünnen Holzspäne und schwarzer Grafitstaub auf den Boden rieselten. Ich roch das frische Holz regelrecht, und Vorfreude erfasste mich, wie jedes Mal, wenn ich diese Vorbereitungen traf. Um meine Spuren zu verwischen, schob ich die Späne mit dem Fuß unter die Bank. Dann öffnete ich den Rucksack und holte meinen kleinen Zeichenblock heraus. Er war kein ledergebundenes Klemmbrett, aber besser als jede Therapiesitzung.
Schon während ich das Deckblatt umschlug, überkam mich innere Ruhe.
Diese Schule war scheiße! Ein Abstellgleis für die verzogenen Rotzgören neureicher Eltern, die die Chance auf ein gutes College für ihre Kinder noch nicht aufgegeben hatten. Vermutlich allesamt Typen, von denen ich mich besser fernhalten sollte. Ich lehnte mich leicht nach vorne, um dem Jungen mit der unterschwelligen oder vielleicht doch nicht ganz so unterschwellig ausgelebten Aggression aus dem Schutz meiner mir ins Gesicht hängenden Haare heraus hinterherzublicken. Mein Stift berührte das Papier und ich fing an zu zeichnen. Schnelle Striche, knappe Bewegungen.
Am Ende des Flurs blieb der Typ schließlich stehen und lehnte sich an die Wand, um irgendwas in sein Handy zu tippen. Dabei stellte er den Fuß an die altehrwürdige Mauer, die Sporttasche lässig über der Schulter. Ihm gegenüber befand sich eine weitere Tür, aber von meinem Platz aus konnte ich nicht lesen, was auf dem Schild stand. Es war auch nicht wichtig. Wichtig war nur, den rebellischen Geist des Jungen einzufangen, damit ich wusste, ich war hier nicht allein. Die Schule hatte den Ruf, mit jedem Kind fertigzuwerden. Jeden noch so unzähmbaren Geist zu bändigen. Und davor hatte ich Angst. Ich wollte nicht gezähmt werden. Ich wollte einfach nur ich sein. Und dieser Pisser dort …
Ich rollte mit den Augen – jaja, ich merkte es selbst! Nun war ich leicht unterschwellig aggressiv, aber immerhin hatte der Arsch mich Bitch genannt!
Mein Stift flog förmlich übers Papier und mit jedem Quantum Grafit, das sich von der Mine abrieb und das auf dem Papier zurückblieb, wusste ich, dass nicht alle hier gezähmt waren.
Als mein Mitschüler schließlich durch die Tür trat, hätte ich am liebsten protestiert, denn er verschwand darin, ohne sich auch nur noch einmal zu mir umzudrehen. Er ging hinein, und ich war wieder allein. Wieder die Einzige in diesem Flur, die … Probleme hatte, wie Florence so schön sagte.
Gelächter aus Richtung der Halle ließ mich den Kopf drehen. Schnell legte ich das Deckblatt über meine Zeichnung, als müsste ich meine Erkenntnis beschützen.
»Es wäre keine Party, wenn ich Loser wie dich einladen würde!«, rief einer der Jungen. Er war nicht allein, sondern umringt von mindestens drei weiteren Schülern, aber nur er fiel mir ins Auge. Er war groß und blond. Trug das Haar etwas zu lang für meinen Geschmack, aber die arrogante Art, wie er es sich aus der Stirn strich, gefiel mir. »Vergiss es, Gwynedd! Deine Alten müssten glatt ihre Jacht vor Monaco verhökern, um mich zu bestechen, dich einzuladen!«
Seine Begleiter lachten. Alle, bis auf einen.
»Fick dich, Tristan!« Er war stark übergewichtig und hatte rotes Haar. Trotzdem schlug er sich mit der Hand selbstbewusst auf die Brust. »Irgendwann kommst du schon und brauchst was von mir. Das tun alle!«
Der Blonde lachte abfällig und hob in einer hilflosen Geste die Hände. »Selbst wenn ich wollte, Gwynedd – ich kann dich nicht einladen. Die Schließzeiten … du verstehst. Sorry!«
Man hörte genau, dass es ihm kein bisschen leidtat. Zu diesem Schluss kam wohl auch Gwynedd, denn er streckte dem Blonden den Mittelfinger entgegen und stampfte davon. Der Blonde drehte sich lachend um, genau in meine Richtung.
Ich hätte den Blick senken sollen, denn Typen wie er waren ganz sicher nicht gut für meine letzte Chance …
Aber ich konnte nicht. Dummerweise war ich regelrecht angezogen von der Arroganz meines Mitschülers.
Unsere Blicke trafen sich, und er klopfte seinen Kumpels zum Abschied auf die Schultern.
»Frischfleisch«, hörte ich ihn raunen, ehe er in meine Richtung abbog.
So ein Arsch! Schon jetzt war er mir unsympathisch. Die marinefarbene Schuluniform saß bei ihm wie angegossen. Er sah aus wie geleckt. Schon aus der Ferne war das eisige Blau seiner Augen nicht zu übersehen und wenn überhaupt möglich, betonte die silberne Krawatte deren arrogantes Strahlen noch. Er musterte mich interessiert. Vermutlich, weil ich nicht dem typischen Klientel der Schule entsprach – die Tasche zu meinen Füßen war aus dem Sportgeschäft, nicht von Gucci. Vielleicht auch nur, weil er mich für »Frischfleisch« hielt.
Schnell senkte ich den Blick, um zu verhindern, dass er mich ansprach.
»Einer von den Zombies …«, murrte ich und legte schützend die Hände auf meinen Block.
Willkommen in Darkenhall
Ich senkte den Kopf, um den Zombie nicht zu ermutigen, mich anzusprechen, aber offenbar war es nicht seine Stärke, Körpersprache zu deuten. Oder es interessierte ihn einfach nicht, was andere dachten.
Seine beinahe federnden Schritte erstarben direkt vor mir und er räusperte sich.
Seufzend blickte ich auf. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen konnte, war banaler Small Talk mit einem selbstverliebten Lackaffen, aber irgendwie wollte ich auch nicht gleich am ersten Tag zu einem meiner neuen Mitschüler unhöflich sein.
»Hey!«, presste ich deshalb halbherzig heraus.
Er war tatsächlich direkt vor mir stehen geblieben und musterte mich jetzt, als wäre ich ein unbekanntes Insekt.
»Du musst Abigail Woods sein. Ich bin Tristan.« Seine Stimme klang arrogant, und ich hatte das Gefühl, als checkte er mich ab. Ob er die Schweißflecken unter meinen Armen bemerkte? Ich spürte, wie mir das Blut in die Wangen stieg.
Und ich hasste es!
»Ging wohl ein Rundschreiben raus, oder wie?«
Es gefiel mir gar nicht, dass er meinen Namen kannte. Hatten die hier noch nie was von Datenschutz gehört?
Doch anstatt sich von meiner schroffen Erwiderung abschrecken zu lassen, grinste dieser Zombie auch noch. Dabei offenbarte er perfekte Zähne.
»Nicht ganz«, bekannte er und deutete mit einem Kopfnicken in Richtung Direktorat. »Aber wenn jemand Neues dazukommt, dann erfährt man das schon.«
»Mega.« Die Ironie troff regelrecht aus meiner Stimme. »Dann weißt du ja schon alles.« Ich senkte den Blick und trommelte unruhig mit den Fingern auf meinen Block. Konnte er nicht einfach weitergehen? Und seine blauen Augen mitnehmen? Zombie-Tristan brauchte einen Moment, um meine, wie ich hoffte, deutliche Körpersprache zu verarbeiten. Schließlich nickte er wortlos und setzte seinen Weg fort. Nach wenigen Schritten wandte er sich noch mal zu mir um.
»Wir sehen uns!«, rief er und als ich aufsah, zwinkerte er mir verführerisch zu.
»Kann ich wohl kaum verhindern«, murmelte ich und ärgerte mich dabei über mich selbst, denn das Grinsen dieses Primaten ließ mich fast vergessen, wie schrecklich hier alles war. Er eingeschlossen!
Ich seufzte und steckte gerade meinen Block ein, als die Tür vor mir aufging und Florence zusammen mit einer großen blonden Frau auf mich zukam.
»Das ist Abigail«, stellte Florence mich vor und sah mich dabei beinahe flehentlich an. Ich sollte mich offenbar von meiner besten Seite zeigen, darum griff ich höflich die mir angebotene Hand und nickte der Fremden zu.
»Mein Name ist Margaret-Maud Tremblay. Ich bin die Schulleiterin hier in Darkenhall. Es ist schön, dich kennenzulernen, Abigail.«
»Ebenfalls«, presste ich heraus und ging unter ihrem festen Händedruck beinahe in die Knie. Diese Frau hatte einen stechenden Blick und eine etwas zu lange Nase, was die Strenge in ihren Zügen unterstrich. Ihr dunkelblondes Haar trug sie am Hinterkopf aufgesteckt und sie hatte eine Brille auf dem Kopf, die sie just in diesem Moment herunternahm und aufsetzte.
»Sehr schön, sehr schön«, überbrückte sie die Stille, während sie eine Faltmappe unter ihrem Arm zum Vorschein brachte und mir überreichte. Das goldene Armband an ihrem Handgelenk war vermutlich genug wert, um die Ladenmiete für Florence’ Hutgeschäft für ein Jahr bezahlen zu können. Es klimperte, als ich ihr die Mappe abnahm.
»Dies sind alle Informationen, die du brauchst, Abigail«, erklärte sie. »Der Schulhausplan, die Wohnraumaufteilung, der Regelkatalog und die Trainingstermine im Anti-Aggressions-Raum, die ich dir auf Seite drei eingetragen habe. Diese Termine sind verpflichtend. Außerdem noch ein Hinweis zu den Schließungszeiten der Tore.« Sie sah mich an. »Die Schließungszeiten sind strikt einzuhalten!«
Ich nickte brav, was Florence auch zu erwarten schien. Sie legte mir fürsorglich die Hand auf die Schulter und beugte sich zu mir herüber. »Das machst du schon«, beteuerte sie leise, während ihre Hutkrempe meine Wange streifte.
»Klar«, versicherte ich den beiden. Allerdings bereitete mir der gefühlt tausend Seiten umfassende Regelkatalog Kopfschmerzen. Ich hasste Regeln!
»Dann ist jetzt die Zeit gekommen, dir dein Zimmer zu zeigen«, schloss Margaret-Maud ihre Erklärungen ab und machte eine Handbewegung, die sagte, ich solle vorausgehen. »Bitte hier entlang.«
Florence hob meine Reisetasche an, aber Mrs Tremblay schüttelte den Kopf. »Bedaure. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass der Abschied unnötig erschwert wird, wenn wir ihn hinauszögern.«
»Ich möchte doch gerne sehen, wie Abby für den Rest des Schuljahres wohnen wird«, warf Florence ein.
Margaret-Maud schüttelte den Kopf. »Seien Sie versichert, dass es Abigail an nichts fehlen wird.« Sie nahm meiner Pflegemutter die Tasche aus der Hand und lächelte sie freundlich, aber entschieden, an. »Nehmen Sie nun Abschied. Abigail wird es mit Sicherheit kaum erwarten können, sich hier alles genau anzusehen.«
Wenn sie sich da mal nicht täuschte!
Ich zwang mich zu einem Lächeln, als Florence etwas verunsichert durch Mrs Tremblays Ansage die Arme um mich legte.
»Es wird dir gefallen«, versicherte sie mir mit belegter Stimme.
»Bestimmt«, log ich. Etwas anderes blieb mir ja auch nicht übrig.
»Es ist allemal besser als das Jugendgefängnis.« Ich wusste nicht, wem Florence damit mehr Mut machen wollte. Mir, oder sich selbst.
»Ich komm schon klar«, versicherte ich ihr und versuchte vergeblich, den Kloß in meinem Hals hinunterzuschlucken. Ich ließ es nicht oft zu, dass mich jemand umarmte. War nicht gerade ein Fan von übertriebener Zärtlichkeit, aber gerade jetzt wollte ich nicht, dass Florence mich losließ. Sie rieb meinen Rücken und drückte dabei mein Gesicht in ihre Dauerwelle, die weich wie eine Wolke unter ihrem Hut hervorschaute. Der Duft ihres Haarsprays kitzelte in meiner Nase, aber ich wusste, ich würde ihn vermissen, wenn sie fort war.
»Versuch, keine Dummheiten zu machen, Abby«, schluchzte sie und umfasste mein Gesicht. Sie sah mir in die Augen und ich las tiefe Zuneigung darin. »Ich will wirklich nicht, dass man dich mir wegnimmt, hörst du? Aber du musst mir helfen. Du musst jetzt das Richtige tun.« Sie streichelte meine Wange, dabei rannen die Tränen doch über ihre. »Ich hab dich lieb, Abigail. Vergiss das nicht.«
»Schon okay.« Warum tat das Schlucken nur so verdammt weh? Warum fühlte ich mich, als würde ich in Stücke gerissen? Und warum zum Teufel brachte ich es nicht über mich, ihr zu sagen, dass ich sie ebenfalls lieb hatte? Warum presste ich nur so ein nichtssagendes schon okay heraus, wo ich bei dem Gedanken, hier allein zurückzubleiben, doch regelrecht in Panik verfiel?
Ich trat zurück, griff mir meinen Rucksack und rieb meine plötzlich eiskalten Arme.
»Wenn das erledigt ist, dann kann es für dich ja nun losgehen«, sagte Margaret-Maud fröhlich und reichte mir meine Reisetasche.
Na klar! Wenn das erledigt war …
Ich schüttelte unmerklich den Kopf über so viel fehlendes Feingefühl – und das bei einer Schulleiterin – und biss auf meine Lippe, um das Zittern zu verbergen.
»Bis bald, Abby«, schluchzte Florence und winkte.
»Bis bald«, flüsterte ich und folgte Margaret-Maud den Gang entlang in mein neues Leben. Ein glückliches Leben, wenn ich dem Hochglanzprospekt glauben durfte.
Das Wüten in ihm
Bastian Tremblay stand am Fenster des Trainingsraums. Des Anti-Aggressions-Raums, wie die Schule die vier Wände nannte. Der Schweiß lief ihm den Rücken hinab und seine Fäuste pulsierten noch von den harten Trainingsschlägen in den Boxsack. Auf dem Schulhof unter ihm fuhr gerade ein Taxi durch das Tor davon. Doch das interessierte ihn nicht. Sein Blick hing vielmehr gebannt an dem Mädchen mit den lilafarbenen Haaren, das ziemlich verloren in der Auffahrt stand. Sie war von etwas umgeben, das Bastian nur zu vertraut war, von dem sie selbst aber keine Ahnung hatte.
Trotz der Schmerzen in den Fingern ballte Bastian erneut die Fäuste, denn das Wüten in ihm schwoll seit Tagen an. Er spürte es wie ein Brüllen in seinem Blut, wie ein Fieber in seinen Gedanken. Es würde immer stärker werden, bis es ihn vollends beherrschte – wenn er es nicht beherrschte. Von einer tiefen inneren Wut getrieben, riss er die Kette aus dem Halsausschnitt seines Shirts und umschloss fest den Ring, den er daran trug.
Sein Atem kam hart und gepresst. Das Mädchen würde hierherkommen. Bald. Er würde mit ihr hier in diesem Raum trainieren, und …
Bastian stieß ein Keuchen aus, denn das Wüten in ihm verursachte ihm Schmerzen. Er ballte die Faust fester um den Ring, bis das Metall hart in sein Fleisch schnitt. Er bekam keine Luft. Wie so oft, wenn er den Hunger in sich zu lange ignoriert hatte, wurde ihm die Brust eng. Er öffnete das Fenster und stemmte sich mit beiden Händen auf den Sims. Das Mädchen war weg. Hineingegangen. Sie war jetzt hier, wie all die anderen. Und doch … war etwas an ihr, das …
Wieder riss das Verlangen in ihm mit aller Macht eine Wunde in seine Selbstbeherrschung und Bastian stieß ein gefährliches Knurren aus. Er blickte auf seine Hände, auf die Finger, die sich in den Stein krallten, während die dunklen Weben wie Tattoos unter seiner Haut schimmerten. Sie pulsierten über seine Unterarme wie anschwellende Adern.
Bastian atmete tief durch.
»Nicht jetzt!«, befahl er sich selbst leise und steckte die Kette mit dem Ring zurück unter sein Shirt. Dann drückte er den Rücken durch und rieb seine Hände aneinander, bis die verräterischen Weben wieder verschwunden waren.
»Ich kann das kontrollieren!«, versicherte er sich selbst, und tatsächlich nahm seine Haut wieder ihre normale, gesunde Farbe an. Zwei tiefe Atemzüge später hatte er sich wieder im Griff. Sein Puls ging gleichmäßiger und die Schmerzen in seiner Brust waren abgeklungen. Er hob die Hand, um das Fenster zu schließen, als er seinen Bruder hinter einer blonden Schülerin her durch den Park joggen sah.
Als Tristan das Mädchen erreicht hatte, tippte er ihr auf die Schulter und sie wandte sich überrascht, aber erfreut zu ihm um.
Bastians Miene verhärtete sich. Er hörte nicht, was die beiden miteinander sprachen, aber das musste er auch gar nicht. Was er sah, sprach eine deutliche Sprache.
Tristan war geschickt, das musste er neidlos zugeben. Er nahm sich, wonach es ihn verzehrte. Und er nahm es sich, wann immer und wo immer er gerade wollte.
Bastian stieß einen Fluch aus und kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen. Ihm gefiel nicht, dass Tristan das Mädchen kichernd hinter sich her in den Schutz der Bäume zog, sodass man sie vom Weg aus nicht mehr sehen konnte. Ihm gefiel noch weniger, wie Tristan das Gesicht des Mädchens umfasste und seine Lippen auf ihre legte. Doch was ihm am wenigsten gefiel, war das nachtschwarze Pulsieren auf Tristans Händen, der Strom an Weben, der anwuchs, je länger der Kuss andauerte.
»Verflucht noch mal!«, brummte er und Tristan löste sich von dem Mädchen, als hätte er ihn gehört.
Beinahe schien es so, denn sein Bruder drehte den Kopf und blickte in seine Richtung. Er grinste, ehe er aus der Deckung der Bäume trat, als hätte er nicht gerade das Wüten in sich mit diesem Kuss gestillt. Mitten am Tag. Mitten auf dem Schulgelände.
Bastian wusste, dass Tristan seine Missbilligung nicht entgangen sein konnte. Doch als eine Gruppe Schüler aus dem Wintergarten kam und Tristan umringte, war es schon, als wäre das alles nicht wirklich passiert. Tristan und seine Kumpels foppten wie immer Gwynedd und verschwanden schon im nächsten Moment durch den Haupteingang.
Wieder begehrte das Wüten in Bastian auf, doch diesmal hatte er sich besser unter Kontrolle. Er hatte gelernt, sich zu beherrschen. Denn anders als sein Bruder trug er nicht nur das Wüten in sich, sondern dazu noch eine große Verantwortung. Er hatte lernen müssen, sein Erbe bewusst einzusetzen – im Gegensatz zu Tristan, der alles mit einer Leichtigkeit hinnehmen konnte. Er hatte verstanden, dass ihre Fähigkeit, die Seelenweben anderer Menschen in sich aufzunehmen, eine Verantwortung in sich barg. Und dieser Verantwortung war er sich mehr als bewusst. Trotzdem war er nun mal, was er war. Genau wie Tristan. Und als er nun Geräusche aus der Umkleide vor dem Anti-Aggressions-Raum wahrnahm, erweckte dies das Wüten in ihm erneut zum Leben. Brüllend und mit einem Hunger, den er kaum beherrschen konnte, verlangten die Weben in ihm nach mehr.
»Hi, Ben.« Er versuchte, seine Stimme normal klingen zu lassen, als er sich zu dem Jungen umdrehte, der mit seinen siebzehn Jahren nur ein Jahr jünger war als er selbst.
Bens Weben würden seinen Hunger stillen, seinen Schmerz lindern. Und er rechtfertigte dies mit der Tatsache, dass dem Teenager ebenfalls geholfen würde. Es war richtig, es so zu machen, wie er es tat. Richtig und gut.
»Die Lehrer sagen, du brauchst noch ein paar Trainingseinheiten hier«, setzte Bastian an.
»Die können mich mal«, fauchte Ben und warf ihm einen zornigen Blick zu. »Ich lass mich von denen nicht so verbiegen wie du!«
»Niemand verbiegt hier jemanden.«
Ben lachte. »Dann bist du hier falsch, Mann. Du bist nicht wie die anderen. Ich hab dich noch nie ausflippen sehen.«
Bastian wartete, bis Ben seine Boxhandschuhe angelegt hatte. »Sei froh«, murmelte er und für einen kurzen Moment war er sich darüber im Klaren, dass die Ähnlichkeit zwischen ihm selbst und Tristan größer war, als ihm lieb war. Sie konnten beide nicht aus ihrer Haut. Und waren beide getrieben von der gleichen Bestimmung. Er sah Ben in die widerspenstigen Augen, in deren Tiefen noch weit mehr lag als nur Wut. »Und du irrst dich. Ich bin hier nicht falsch. Ich bin hier genau richtig.« Er trat hinter Ben und zeigte ihm, wie er die richtige Position am Boxsack einnahm. Dabei berührte er dessen Schulter und das Wüten in ihm schwoll an.
Es tat ihm nicht leid, was gleich geschehen würde. Der Junge vor ihm hatte Probleme. Er würde Dinge tun, von denen nur Bastian etwas wusste. Böse Dinge. Dinge, die verhindert werden mussten. Und nur er konnte dies verhindern. Er half Ben. Ihm, und sich selbst.
Bastian Tremblay atmete tief ein und die Weben unter seiner Haut pulsierten in freudiger Erwartung.
Tapetenleim
Ein Dreibettzimmer! Ich konnte noch immer nur den Kopf darüber schütteln. Das hier war doch eine teure Privatschule. Und dann gab es nur Dreibettzimmer? Wie sollte das dazu beitragen, einen besseren Menschen aus einem zu machen? Es gab auf diesem Planeten vermutlich nicht einen einzigen Teenager, den ein Dreibettzimmer glücklich machte! Und waren glückliche Menschen nicht auch bessere Menschen? So weit hatte man hier wohl noch nicht gedacht.
Ich blieb stehen und betrachtete den Hausplan. Hielt ich ihn richtig herum? Ich befand mich in einem Flur, von dem in jede Richtung ein weiterer Gang abzweigte. Direkt vor mir befand sich eine gläserne Vitrine mit Pokalen, Medaillen und farbigen Fotografien der Rudermannschaft von Darkenhall. Ich ging näher heran und betrachtete die Bilder: Die Sportler trugen helle Shorts und meerblaue Trikots mit dem Wappen der Tremblays auf der Brust. Ihr Siegeswille war selbst durch die Kameralinse zu fühlen. Ich hatte für Mannschaftssport nicht so viel übrig. Darum trat ich zurück und widmete mich wieder meinem Plan. Wo genau musste ich hin? Ich drehte mich einmal um mich selbst, als das Schlagen einer Glocke durch das Gebäude hallte. Vor und hinter mir wurden zeitgleich Türen geöffnet. Es sah aus, als spuckten die Räume ihre Schüler aus, die in ihrer einheitlichen Schuluniform vollkommen austauschbar wirkten. Ich wich an die Seite, um meinen Mitschülern Platz zu machen, die allesamt recht zielstrebig in die Richtung strömten, aus der ich gerade kam. Sie alle hatten eines gemeinsam. Den arroganten Ausdruck in ihren Gesichtern. Vermutlich waren das alles Söhne und Töchter der Londoner Oberschicht. Nicht einer schenkte mir Beachtung, doch das war gar nicht mal so schlecht.
Um Unauffälligkeit bemüht, lehnte ich mich an die Wand und beobachtete meine neuen Mitschüler. Fast alle schienen in meinem Alter zu sein. Ich schätzte sie auf etwa siebzehn.
Wie überall bildeten einige von ihnen Cliquen und Grüppchen, wohingegen andere eher Einzelgänger zu sein schienen. Ich fragte mich, wie meine Zimmergenossinnen wohl waren. Hoffentlich keine blonden Barbies mit hüftlangen Extensions, falschen Wimpern und aufgespritzten Lippen, wie die beiden, die gerade an mir vorbeikamen. Ich rollte unauffällig mit den Augen. Auf solche Tussen hatte ich überhaupt keine Lust. Überhaupt hatte ich die Erfahrung gemacht, dass sich andere Mädchen mit mir eher schwertaten. Irgendwie … schreckte ich sie ab. Nicht, dass ich es darauf anlegte, es ergab sich nur irgendwie immer so. Und da sich mein Taschengeldbudget von ihrem vermutlich um Welten unterschied, rechnete ich auch nicht damit, dass meine Mitschülerinnen und ich die dicksten Freundinnen werden würden.
Hätte nicht irgendjemand, den Florence dank ihrer Hutkreationen kannte, in Darkenhall ein gutes Wort für mich eingelegt, wäre ich ja überhaupt nicht hier.
Ich klammerte mich an meinen Hausplan und wartete, bis sich die Gänge wieder etwas geleert hatten. Abgesehen von einigen neugierigen Blicken ließ man mich in Ruhe. Bestimmt hätte mir jemand den Weg zur Kantine gezeigt, wenn ich gefragt hätte, aber so weit war ich noch nicht. Es fühlte sich komisch und fremd an, an dieser Schule zu sein. Und obwohl ich an sich nicht schüchtern war, spürte ich eine unterschwellige Angst in mir lauern. Mit diesen Rich-Kids konnte ich nicht mithalten.
Florence dachte, ich könnte hier ankommen … dabei fühlte es sich eher so an, als würde ich aus einem fahrenden Wagen geschleudert. Ankommen und glücklich sein, wie sollte das gehen, wenn man dabei die Windschutzscheibe durchschlug und gegen die Wand eines marineblau tapezierten Dreibettzimmers krachte?
Um mich zu beruhigen, vertiefte ich mich erneut in die Betrachtung des Plans. Ich musste geradeaus, wenn ich zur Kantine wollte. Und das wollte ich. Ich brauchte unbedingt einen Schokoriegel, um meine Laune zu verbessern. Ich folgte also dem Plan und versuchte mir dabei den Weg einzuprägen, damit ich mir beim nächsten Mal nicht wieder so verloren vorkommen würde.
»Von meinem Zimmer aus die Treppe runter, dann links an dem Schrein für die Rudermannschaft vorbei und immer geradeaus … und dort vorne noch um die Ecke …«, murmelte ich vor mich hin. Die Fenster in diesem Flügel des Gebäudes blickten nach Süden und man hatte eine unvergleichliche Aussicht auf die Themse, bis zum anderen Ufer hinüber, wo sich die Kings Stairs Gardens befanden. Trotzdem fragte ich mich, ob die Nähe zum Wasser bei schlechtem Wetter nicht unheimlich und dunkel sein würde. Wie ein nasses, kaltes Grab.
»Ich brauch jetzt was Süßes!«, fluchte ich leise, schob das Kribbeln in meinen Knochen auf mangelnde Energie, und beschleunigte meinen Schritt. Diese alten Mauern waren wie dafür gemacht, die Fantasie mit einem durchgehen zu lassen.
Ich bog um die Ecke und atmete erleichtert auf. Die Kantine. Ich hatte sie gefunden. Ich faltete den Plan zusammen und steckte ihn zu meinem Bleistift und der Lederscheide mit dem winzigen Spitzmesser in die Hosentasche. Dann trat ich durch die Tür. Der Speisesaal befand sich in dem modernen Wintergarten, den ich schon bei meiner Ankunft gesehen hatte. Er war hell und warm und die Aussicht auf die Themse war hier noch um einiges beeindruckender. Man konnte die schillernde Fassade des weit in den Himmel reichenden dreieckigen Shard-Gebäudes erkennen und den südlichen Turm der Tower Bridge.
Zugegebenermaßen war ich beeindruckt.
Es war inzwischen nach vier und nur wenige Tische waren besetzt. Ganz vorne saßen einige Jungs in Rudertrikots auf der Tischplatte und feierten sich selbst. Sie hoben nicht mal die Köpfe, als ich den Raum betrat. Ich war froh darum, denn ich machte sofort einen blonden Schopf mit zu langem Haar inmitten der Typen aus.
Direkt neben dem Eingang ging plötzlich lautstark ein Handgemenge los.
»Gib her! Da ist mein Referat drauf!«, schrie ein Schüler und fischte nach dem Arm des rothaarigen Dicken, den ich heute schon mal gesehen hatte. Vermutlich musste er seine Männlichkeit nach der Abfuhr unter Beweis stellen, indem er sich an jemand körperlich Schmächtigerem abreagierte.
Er hielt einen USB-Stick hoch, ließ ihn in die Tasche seines Sakkos fallen und klopfte sich dann zufrieden auf die Brust. »Du meinst, da ist mein Referat drauf«, höhnte er und versetzte dem Schmächtigeren einen Stoß, sodass dem die Brille fast von der Nase flog.
Ich ballte die Fäuste und ging weiter. Was mich anging, war ich von dem Schulkonzept noch nicht wirklich überzeugt. Glücklich war wohl ein dehnbarer Begriff …
Weiter vorne waren ebenfalls einige Tische besetzt und links von mir erstarb bei meinem Eintreten ein Gespräch zwischen einer Gruppe Mädchen. Models, verbesserte ich mich im Geiste. Hager, langbeinig und so viel Make-up im Gesicht, dass sie beinahe aussahen wie eineiige Fünflinge.
Sie glotzten mich an und ich tat so, als bemerkte ich sie gar nicht. Während ich mich fragte, was sie verbrochen hatten, um hier zu landen, folgte ich dem Gang, der die Tischreihen in der Mitte teilte, bis nach vorne durch und nahm mir ein Tablett. An der Essensausgabe musste ich warten. Ich ließ die Hauptspeisen links liegen und entschied mich für einen Obstsalat und einen Schokopudding, schließlich litt ich ganz eindeutig an Unterzuckerung. Nur das erklärte meine überreizten Nerven. Ein neongelbes Schild wies darauf hin, dass »Nur ein Süßgetränk / Pudding pro Tag!« erlaubt war.
Klar, nicht, dass die Mädels dort drüben nachher nicht mehr in die neueste Kollektion von Victoria Beckhams Size-Zero-Jeans passen würden.
Gerade fragte ich mich, wie viele Wattebäusche die Mädels wohl stattdessen am Tag aßen, als ein Schatten über mein Tablett fiel.
»Abigail Woods«, sprach mich der Junge an, der sich mir vor dem Direktorat als Tristan vorgestellt hatte. Wieder strich er sich breit grinsend die Haare aus der Stirn. Er lehnte so lässig am Tresen, als wäre er ebenfalls im Angebot. »Hast du dich schon eingelebt?«
»Eingelebt?« Ich schüttelte innerlich den Kopf über diese Frage. »Ich bin gerade mal seit zwei Stunden hier!«, erinnerte ich ihn.
»Ja klar!« Er lachte und schob sein Tablett weiter. »Ich meine … hast du dein Zimmer schon bezogen? Das … Bett schon getestet?«
Ich nahm meinen streng rationierten Pudding entgegen und hob das Tablett an. Seinen süffisanten Ton überging ich, ebenso seine zweideutige Anspielung. »Ist ein Dreibettzimmer«, antwortete ich nüchtern. »Wen muss man bestechen, um ein Einzelzimmer zu bekommen?«
Das amüsierte Funkeln in seinen Augen ließ mich vermuten, etwas Falsches gesagt zu haben.
»Was hast du denn so vor, im Bett … dass dir keiner dabei zusehen soll?«
Wieder stieg mir das Blut in die Wangen und ich umklammerte mein Tablett fester. Zu allem Überfluss nahm er sich ebenfalls einen Pudding.
»Nichts! Ich bin nur gern für mich«, presste ich heraus und beeilte mich, weiterzukommen, aber er blieb mir auf den Fersen.
»Ist halt kein Hotel«, stellte er mit einem Zwinkern fest. »Wo man die Honeymoonsuite buchen kann und Schokolade aufs Kopfkissen gelegt bekommt.«
»Ach nicht? Verdammt!« Ich machte ein entrüstetes Gesicht. »Dann bin ich hier ja vollkommen falsch.«
Tristan wirkte amüsiert. Er schlenderte an mir vorbei zu einem der langen Tische. Von seinen Teamkollegen war nichts mehr zu sehen. Er stieg von hinten über die Bank und stellte das Tablett vor sich ab. »Genau wie ich«, scherzte er und tunkte den Löffel in den Pudding.
Ich nahm mir Besteck aus dem Besteckkasten und zögerte. Von allen Schülern hier in der Kantine schien er der arroganteste. Und doch war er der Einzige, der mich angesprochen hatte.
Ausgerechnet er! Er war so schleimig, dass man auf seiner Schleimspur hätte ausrutschen können. Aber der Abschied von Florence hatte mich härter getroffen als gedacht, und so war ich, was meine Gesellschaft anging, momentan nicht besonders wählerisch.
Schnell, ehe ich es mir noch anders überlegte, trat ich an seinen Tisch und setzte mich ihm gegenüber.
»HEY!«, scholl ein Ruf durch den Raum und ich fuhr herum. »Die Mädchen sitzen auf der anderen Seite!«
»Was?« Ich folgte dem Fingerzeig des übergewichtigen Rotschopfs in Richtung der Mädchenclique.
»Halt die Füße still, Gwynedd!«, warnte Tristan den Dicken, der vor einem überquellenden Tablett mit Speisen saß.
»Sie soll sich da rüber setzen!«, protestierte er vehement.
»Was will der denn?«, fragte ich irritiert und sah Tristan stirnrunzelnd an.
»Eigentlich sitzen Jungen und Mädchen in der Kantine getrennt«, gab der unbeeindruckt zu, bedeutete mir aber sitzen zu bleiben.
»Ich kann mich ja –«
»Nein. Setz dich einfach wieder«, meinte Tristan und funkelte den Dicken an. »Und du, Gwynedd, kümmere dich um deine Angelegenheiten.«
»Die Regeln gelten für ALLE!«, begehrte der wiederum auf und donnerte beide Fäuste auf den Tisch. Inzwischen sah jeder im Raum zu uns herüber.
»Heute nicht!«, gab Tristan knapp zurück und wandte sich erneut mir zu. »Vergiss ihn. Der hat nichts zu melden.«
Ich legte den Kopf schief. »Und du schon, oder wie?«
Er zwinkerte. »Zumindest mehr als der.«
»Na, da bin ich ja beruhigt«, antwortete ich skeptisch und kostete den Pudding. Er schmeckte zwar nach Schokolade, aber ihm fehlte jede Süße. »Verflucht, was ist denn das für ein Zeug? Schmeckt ja wie Tapetenleim!«
»Ist es auch. Sie mischen nur braune Farbe rein, damit es nicht so offensichtlich ist«, vertraute Tristan mir mit gesenkter Stimme an und ich musste mich zusammenreißen, um nicht über seinen Spruch zu lachen.
Mir gefiel, wie sich sein Gesichtsausdruck änderte, wenn er lächelte. Er wirkte dann bei Weitem nicht mehr so überheblich.
»Steht das in den Einführungsunterlagen?«, spielte ich mit und kratzte mich nachdenklich am Kinn. »Denn bisher hatte ich noch nicht die Zeit, die alle durchzusehen.«
Tristan nickte ernst. Eine Strähne hing ihm ins Auge, und es kribbelte mich in den Fingern, sie ihm hinters Ohr zu streichen. »Steht im Kleingedruckten auf Seite siebenundfünfzig. Alle Speisen, die in Darkenhall serviert werden, bestehen zu hundert Prozent aus natürlichem Bio-Tapetenleim oder Pressspan. Vollkommen frei von Zucker, Geschmack und Gluten. Und dabei absolut vegan. Echt erlesenes Zeug.«
»Ach wirklich! Bekommt man deshalb nur einen? Weil einem sonst der Magen verklebt?« Ich tat beeindruckt und löffelte meinen fragwürdigen Pudding weiter. In Kombination mit dem Obstsalat war er genießbar. »Und die Würstchen? Dort drüben gab’s Würstchen«, hakte ich nach.
Tristan nickte bedeutungsschwer. »Reiner Pressspan – mit Tapetenleim.«
Ich verbarg mein Kichern, indem ich so tat, als ob ich husten musste, und schluckte schnell hinunter. »Wenn das so ist, dann bezahlt meine Pflegemutter deutlich zu viel für diese Schule!«
Tristans Lächeln wurde schwächer. »Deine Pflegemutter? Du lebst in einer Pflegefamilie?«
Der Pudding in meinem Mund verwandelte sich zu einem Klumpen und ich hatte Mühe, ihn hinunterzuschlucken. Warum hatte ich das denn gesagt? War ich bescheuert? Gingen meine Familienverhältnisse diesen protzigen Angeber irgendwas an?
Als hätte er meine Gedanken gelesen, hob er die Hände und ruderte zurück. »Sorry. Blöde Frage. Geht mich ja auch nichts an.«
Ich hätte mich ohrfeigen können! Gerade war die Stimmung noch so gut gewesen und durch meine unbedachten Worte hatte ich es mal wieder geschafft, alles zu ruinieren. Ich stellte meine beiden leeren Schälchen ineinander und schleckte den Löffel ab, ehe ich Tristan wieder ansah. »Schon okay. Meine Eltern … sind …« Ich stockte und stand auf. »Vergiss es einfach. Ich rede nicht gern darüber.«
»Abigail, warte«, rief Tristan und beeilte sich, ebenfalls aufzustehen. Mit zwei großen Schritten hatte er mich eingeholt und mir das Tablett abgenommen. »Hey, sorry. Das war doof. Ich wollte nicht …«
Ich zwang mich, nicht einfach davonzurennen. Ich fühlte mich, als würde ich in Dunkelheit stürzen, als würde mich die Schwärze wie erstickender Nebel jagen und umhüllen. Das Atmen tat mir weh und der giftige Nebel brannte hinter meinen Lidern. »Ist okay«, winkte ich ab und wartete, bis er die beiden Tabletts in den dafür vorgesehenen Metallwagen geschoben hatte. »Ich muss jetzt los. Tasche auspacken, Schuluniform anprobieren, Regelkatalog studieren und so«, erklärte ich fahrig, während ich mir mit den Fingern durch meine lila Haarsträhnen kämmte.
Ich musste schleunigst hier weg. Wenn ich eines in meinem bisherigen Leben gelernt hatte, dann, dass es ein Fehler war, Schwäche zu zeigen. Besonders vor Menschen, die jede Schwäche mit Geld aus der Welt schaffen konnten.
Ich wollte nicht wissen, was bei Tristan in der Familie oder im Leben schiefgelaufen war, dass seine Eltern ihn nach Darkenhall geschickt hatten. Aber was bei mir schieflief, das wusste ich. Und ich wollte jetzt nicht daran denken. Jetzt nicht – und überhaupt niemals.
»Na dann.« Tristan schob die Unterlippe vor. »Wir sehen uns.«
Ich nickte, denn meine Stimme würde verraten, dass ich kurz davor stand, in Tränen auszubrechen. Schnell drehte ich mich um und krachte frontal in eine der Barbie-Fünflinge.
»Pass doch auf, du Freak!«, mokierte sie sich, ohne mich anzuschauen. Ihre ganze Aufmerksamkeit ruhte auf Tristan. »Hey, Tristan!«, flötete sie und nickte in Richtung der übrigen vier Mädchen. »Lust, euren Trainingserfolg zu feiern?«, fragte sie und legte kokett die Hand an seine Krawatte.
Ich stöhnte. Hätte ich nicht eben ohnehin schon gehen wollen, hätte mich diese Nummer definitiv die Flucht ergreifen lassen.
»Na dann«, flüsterte ich und rieb mir den Arm, mit dem ich gegen Blondie geknallt war. Entschlossen trat ich einige Schritte zurück.
»Hey, Abigail«, rief Tristan mir zum Leidwesen seiner neuen Begleiterin hinterher. »Wir sehen uns.«
Natürlich. So wie ich das sah, war das schwer zu vermeiden. Mein künstliches Grinsen fühlte sich an, als würde mir ein Zahn gezogen, denn obwohl Tristan mir nachsah, wanderte seine Hand im Rücken der Blondine tiefer, bis auf ihren Po.
Ich hörte sie kichern und beschleunigte meinen Schritt.
Es war ja nicht so, als würde mir das etwas ausmachen. Es war nicht so, als … bräuchte ich jemanden, um mich hier nicht allein zu fühlen. Und ganz sicher war es nicht so, dass dieser blonde, selbstverliebte, arrogante Typ dieser Jemand wäre!
Ich spürte, wie Verzweiflung in mir aufstieg. Ich kannte dieses Gefühl. Diese … Angst vor dem Alleinsein. Und wie immer musste ich tief durchatmen, um sie zu beherrschen. Ich biss die Zähne zusammen und versuchte, sie in etwas zu verwandeln, mit dem ich umgehen konnte.
Ich ballte die Fäuste, dann blies ich mir die Haare aus der Stirn und stapfte auf den dicken Rothaarigen zu. Wut war so viel besser als Angst. Die Dunkelheit, die sich in mir ausbreitete, war mir vertraut. Sie ließ meinen Puls in die Höhe schnellen und meinen Atem heiß durch meine Lunge strömen.
Als ich aufsah, lächelte ich.
Auf Gwynedds Tablett türmte sich das Essen und zudem ein silberner Flachmann mit eingravierten Initialen, der garantiert keinen Apfelsaft enthielt. Ich erfasste das alles auf einen Blick. Auch seine Verwirrung, weil ich direkt vor ihm stehen blieb, war schwer zu übersehen.
Ich setzte mich auf die Tischkante und schob dabei sein Tablett etwas von mir weg. Der Ausschnitt meiner Bluse befand sich auf seiner Augenhöhe, aber ich tat so, als würde ich nicht merken, wie er mich anstarrte.
»Hey, ich …« Ich wickelte mir eine Strähne meines Haars um den Finger. »Ich bin Abby. Ist mein erster Tag und ich wollte nichts falsch machen«, erklärte ich reumütig und blickte ihm tief in die Augen.
Ich registrierte, dass Tristan sich zu mir umdrehte. Wenn die Dunkelheit mich lenkte, mich antrieb, dann entging mir kaum etwas, das um mich herum geschah.
Mir entging nicht, dass er die Stirn runzelte, als ich Gwynedds Schulter berührte. Dass dem daraufhin der Schweiß ausbrach, entging vermutlich niemandem.
Gwynedd drückte die Brust raus und kam mir etwas mit dem Oberkörper entgegen. Er stellte den Flachmann ab.
»Die Regeln gelten für alle!«, wiederholte er seinen Vorwurf von zuvor und kniff die Augen missgünstig zusammen. »Auch für die Neuen!« Er bleckte die Zähne. »Besonders für die Neuen.«
Ich verzichtete, ihn darauf hinzuweisen, dass der Flachmann garantiert ebenfalls ein Verstoß gegen die Regeln war, auf die er so pochte.
»Sicher, das ist mir klar. Ich … hatte gehofft … wir könnten … noch mal ganz von vorne anfangen. Und das mit der Sitzordnung … vergessen.«
Gott, wie ich es hasste, diesem Widerling in den Arsch zu kriechen. Und doch setzte ich noch einen drauf und nahm meine Unterlippe zwischen die Zähne. Ich kam mir vor wie eine schlechte Schauspielerin, aber wenn ich Gwynedd richtig einschätzte, hatte man ihm zeit seines Lebens schon so oft Zucker in den Arsch geblasen, dass er ohnehin nicht auf die Idee kam, ich könnte ihm etwas vormachen.
Er straffte die Schultern und legte seine wulstigen Finger auf meinen Oberschenkel.
»Du bist niedlich. Nur deshalb …«, er betatschte mein Knie, »… nur deshalb höre ich dir überhaupt zu. Aber du bist … leider TPTD. Also …« Er nahm seinen Flachmann und gönnte sich einen Schluck, ehe er mit verächtlich zusammengekniffenen Augen zu Tristan hinübersah. »Es gibt hier Kandidaten, die keine Ansprüche stellen. Halte dich an die!«
Ich hatte keine Ahnung, was TPTD war, aber die abfällige Art, wie er es sagte, war unschwer zu deuten. Ich zwang mich zu einem Lächeln, stand auf und strich ihm noch einmal übers Hemd.
»Wie schade«, trällerte ich ganz im Barbie-Stil der Blondinen von Tisch eins, und hielt mich an Tristans Lieblingssatz. »Wir sehen uns …«
Ich hopste von seinem Tisch und schlenderte in Richtung Ausgang. Die Dunkelheit in mir drehte sich in schnellen Spiralen, fast wie ein Tornado. Ich liebte dieses Gefühl. Es machte mich stark. Und unverwundbar. Zufrieden mit meinem Erfolg schloss ich fest die Faust um meine Beute.
Am Tisch des Jungen, mit dem Gwynedd zuvor die Auseinandersetzung gehabt hatte, verharrte ich kurz.
»Ich glaube, das gehört dir«, flüsterte ich und legte den USB-Stick auf sein Tablett. Ohne ihn noch einmal anzusehen, wandte ich mich ab und trat durch die Schwingtür hinaus in den Flur. Erst jetzt, wo ich allein war, ließ ich das Lachen aus meiner Brust aufsteigen, presste mir die Hände aufs Herz und genoss den Moment. Diesen Moment, wenn man nicht erwischt worden war.