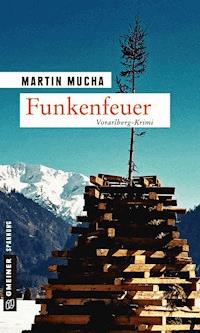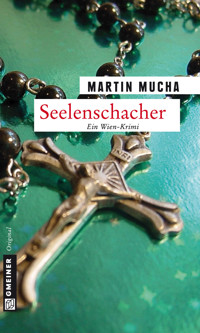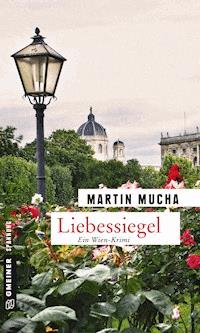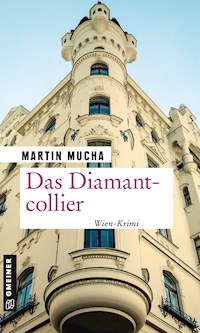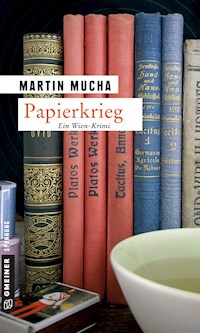
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Universitätslektor Linder
- Sprache: Deutsch
Arno Linder, Anfang dreißig, lebt im schönen Wien. Als Doktor der klassischen Philologie ist er aufgrund desaströser Universitätsreformen stark armutsgefährdet - nur mit mehr oder weniger legalen Nebenjobs kann er sich notdürftig über Wasser halten. In einer eisigen Märznacht stolpert Arno auf dem Heimweg über ein betrunkenes Mädchen. Als er beschließt, die Schöne nach Hause zu fahren, stellt er fest, dass das Töchterchen aus reichem Hause offenbar in einen Mordfall verwickelt ist. In der Hoffnung, für sein Schweigen gut bezahlt zu werden, beginnt sich Arno für die Hintergründe der Affäre zu interessieren und entwendet dem Ermordeten Handy und Notebook. Doch damit beginnen seinen Schwierigkeiten erst richtig: Mit der Mordwaffe in seinem Besitz wird er von der Polizei in die Mangel genommen. Seine Anstellung an der Uni droht verloren zu gehen. Und dann taucht auch noch ein serbischer Kunsthändler namens Mihailovic auf, der Arno eine antike Papyrusrolle zweifelhafter Herkunft anbietet …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Martin Mucha
Papierkrieg
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2010 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 07575/2095-0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2010
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung / Korrekturen: Daniela Hönig / Doreen Fröhlich
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
Foto: Lutz Eberle, Stuttgart
ISBN 978-3-8392-3478-5
Zitat
»Had me a whiskey, and I chased it,
Got me some trouble, gonna face it,
But if I had a trump card, I would place it,
That’s for sure …«
Rory Gallagher
Raymond Aronokfsy appears courtesy of Thomas Welte.
Kapitel 1
Vor mir lag ein Zehneuroschein. Nagelneu, geradezu druckfrisch. Noch mit dieser besonderen Steife und der angenehm strukturierten Oberfläche, von der die Finger nicht mehr lassen können. Verschiedene Rosatöne, ein Rundbogen, ein silberner Sicherheitsstreifen mit Hologramm. Seriennummer N16167872334.
I
Bei einer Lehrverpflichtung von vier Stunden die Woche hat man jede Menge Zeit, und so erledigte ich eines schönen Märztages für einen Freund einen Auftrag. Er hatte mich gebeten, DVDs zu kaufen, eine Spindel mit 100 Stück der silberglänzenden Scheiben. Er hatte ein unschlagbares Angebot aufgetan und nun war ich auf dem Weg zum Reumannplatz. ComServe2000 hieß die Firma, Leibnizgasse 31, Stiege I, Tür 6. Das war irgendwo in Favoriten, ich wollte gegen 10 Uhr vormittags dort sein.
Als ich in Favoriten den U-Bahn-Schacht hinaufkam, blies mir ein eisiger Wind entgegen und die Passanten duckten sich in ihre aufgestellten Kragen. Vor ein paar Tagen war es noch frühlingshaft gewesen, aber der Winter war zurückgekehrt und er hatte mächtig schlechte Laune. Die Straßen waren nass und ich suchte mit dem Adresszettel in der Hand nach dem Laden.
Als ich dann vor einem heruntergekommenen Gemeindebau stand, hatte ich die Nässe in meinen Schuhen und in meinen Socken, und meine Zehen fühlten sich wie Überlebende der Titanic-Katastrophe, die irgendwo im Nordatlantik treiben und langsam erfrieren. Immerhin mussten sie in den ausgetretenen Latschen keinen weißen Hai fürchten.
Der Gemeindebau stammte aus den 50ern, war grau und unansehnlich. Er hatte zwar die richtige Hausnummer, aber einen Hinweis auf ComServe2000 konnte ich nirgends entdecken. Ich ging einmal um den alten Betonkasten herum. Das ganze Gebäude war abgewohnt und trostlos. Die Klingelanlage war total verschmiert, sodass kein Name mehr zu lesen war. Also läutete ich einfach bei der im Prospekt angegebenen Nummer. Eine undeutliche Stimme bellte mir ein »Ja, bitte?« entgegen. Ich erklärte mein Anliegen und nach einer misstrauischen Pause summte der Türöffner. Ich ging in die Einfahrt hinein. Es war dunkel und die Mülltonnen an beiden Wänden verbreiteten einen unangenehmen Geruch. Es stank, so wie Müll eben stinkt. Im Dunkeln war es gar nicht so einfach, die Stiege I zu finden, und als ich im Flur gezwungen war, einer Urinlacke auszuweichen, war mir das Haus mitsamt seinen Bewohnern gründlich verhasst.
Das Treppenhaus war schmierig und schlecht beleuchtet. Als ich an der Tür mit der Nummer 6 angekommen war, hätte ich am liebsten kehrt gemacht. Es war eine stinknormale Wohnungstür, allerdings mit dicken Sicherheitsschlössern versehen, und anstelle eines Familiennamens war in schlechter Handschrift ComServe2000 auf den weißen Kunststoff geschmiert.
Ich läutete und hörte jemanden hinter der Tür. Ein Auge starrte durch den Spion. Ich vernahm gedämpft zwei Stimmen, eine rief fragend, die andere antwortete brummend. Was sie sagten, konnte ich nicht verstehen. Riegel wurden bewegt, Schlüssel gedreht und langsam öffnete sich die Tür Zentimeter für Zentimeter. Eine dicke Kette, die ausgereicht hätte, Fenrir zu fesseln, kam zum Vorschein und ein Gesicht erschien. Irgendwer hatte da wohl ein mächtig schlechtes Gewissen.
»Was willst du?«, fragte eine weibliche Stimme.
»Ich komme wegen der DVDs.«
»Er will DVDs«, rief sie nach hinten, einem anderen zu.
»Gib sie ihm«, kam die Antwort. Eindeutig ein Mann im Hintergrund.
»Okay, komm rein.«
Die Kette wurde weggeschoben und die Tür öffnete sich. Vor mir stand eine dralle Blondine, vielleicht 20 Jahre alt, mit halblangen Haaren, einem engen weißen Top und einer hautengen Leggins. Neonrosa. Sie hatte mehr Kurven als die Nürburgring-Nordschleife und versteckte keine davon. Ihr Blick war leicht glasig und in der rechten Hand, an der jede Menge Goldblech und bunte Steine baumelten, hielt sie eine gelbe Bierdose.
»Komm rein«, sagte sie schleppend und ich folgte ihrer Einladung. Die Wohnung war schmuddelig, alles vollgeräumt mit Elektronik und Zubehör. Die Blondine nippte an ihrer Dose.
»Wie viele willst du denn?« Hinten im anderen Zimmer hörte ich ein Geräusch und kurz darauf kam ein Mann, Mitte 50, zu uns herein. Er hatte öliges schwarzes Haar mit vielen grauen Strähnen, glatt nach hinten gekämmt, trug ein weißes Rippshirt, eine Goldkette und war ganzkörpertätowiert wie ein Maorihäuptling. Ein Tschik hing wie ein Orden in seinem Mundwinkel, eine violette Plastikjogginghose mit silbernen Streifen vervollkommnete die Aufmachung. Auf dem Rücken hatte er einen durchsichtigen Plastiksack mit DVD-Spindeln, mindestens 200 Stück. Er ließ den Sack zu Boden krachen und kurzzeitig erschien er mir wie ein moderner Krampus, der den Nikolaus erschossen und den armen Alten ausgezogen hatte bis aufs letzte Hemd.
Das Girl war in der Küche verschwunden, ich hörte Blech knacken, die Kühlschranktür schlagen, und sie stand in der Tür, neckisch an den Rahmen gelehnt, und nahm einen tiefen Schluck. Ihre Augen waren stark geschminkt, eines blau geschlagen, und der Lippenstift, nicht biersicher, schon ein bisschen verwischt.
»Eine Spindel«, sagte ich.
»Was?« Er war konsterniert. »So kleine Mengen gehen net, schleich dich.«
»Er ist ja schon da, gib ihm doch wenigstens die Spindel, ist ja eh wurscht.« Sie lächelte mir zu. »Wir verkaufen normalerweise nur Geräte, das Zubehör geht da immer nebenbei mit.«
Er holte ein Messer raus, ließ es schnappen und schlitzte den Plastiksack auf, dann warf er mir eine Spindel zu.
»Lass stecken, für den Kleinkram verrechne ich dir nix«, sagte er, als ich mein Geld hervorholen wollte. Er ging zu dem Mädchen hinüber, nahm ihr das Bier aus der Hand und tat einen Zug. Sie steckte sich einen Tschik an und die beiden lächelten sich so vergnügt zu, wie es nur eine Mischung aus Hormonen und Alkohol möglich macht. Ohne Zweifel waren sie glücklich, auf ihre Art jedenfalls, und ich neidete ihnen ihr Glück so sehr, dass es schlimmer nicht mehr ging. »Willst du nicht lieber noch was anderes haben? Neue MacBooks, Plasmabildschirm oder ein iPhone?«
»Wennst an Freund hast, der was a iPhone haben will, schick ihn vorbei. Wir könnens auch gleich freischalten, dann kannst du mit jeder Sim halafonieren.«
Er griff sich die Kleine, die sich an ihn schmiegte wie ein Kätzchen, und ich war draußen. Ich lief schnell zur Straße raus, steckte den Kopf in den Kragen meines Mantels und schlug die Richtung zur Nationalbibliothek ein.
Die Nasenlöcher der beiden waren rot gewesen wie die Banner der Sowjetunion. Die Geschäftsidee, mit geklauter Elektronik das schnelle Geld zu machen, war definitiv nicht vereinbar mit der Tsunamiwelle an Koks und Bier, auf der die beiden Vögel ritten. Wahrscheinlich arbeitete er oder ein Freund von ihm am Flughafen. Ich hatte die Kartons mit dem Logo der Flughafengesellschaft gesehen, in denen sie die Elektronik aufbewahrten. Die zwei waren auf dem besten Weg, im Knast zu landen.
Immerhin hatte ich nicht zu zahlen gebraucht, und so stellte sich die Frage, was ich mit den zehn Euro anfangen sollte. Sie kamen wie gerufen. Wie immer, wenn das akademische Jahr sich dem Ende zuneigt, waren meine finanziellen Angelegenheiten schwer zerrüttet. Ich verschob die dringende Frage auf später und verbrachte den Tag im Lesesaal der Nationalbibliothek.
II
Es war so gegen fünf Uhr, als ich ausgelaugt vom stundenlangen Exzerpieren und mit leerem Magen das Gebäude verließ. Über dem Heldenplatz wölbte sich der violette Abendhimmel, gegen den sich die bronzenen Reiterstandbilder schwarz abhoben. Im Hintergrund bildeten die Kuppeln der beiden Museen eine Scherenschnittkulisse. Wien zeigte sich in seiner ganzen imperialen Schönheit. Auf dem Heldenplatz hingegen quatschten meine Schuhe in den Regenlacken, der Wind pfiff mir durch den Mantel und die Hand an meiner Ledertasche war nach wenigen Sekunden eingefroren. Das half mir, ein Urteil zu fällen. Ich würde die zehn Euro weder in Nahrungsmittel noch in dringend notwendige Unterwäsche investieren, meine Seele musste hofiert werden. Sie brauchte ein Wellness-Weekend und ich wusste auch schon, wo und bei wem ich bekommen würde, was ich wollte.
Eugen wohnte zu der Zeit in der Anastasius-Grün-Gasse im 18. Bezirk. Er nannte eine kleine Einzimmerwohnung sein Eigen, in der sein Bett den meisten Platz einnahm, ein altes Leninplakat von der Wand lachte und immer eine Espressokanne Kaffee auf dem Herd stand.
So war es auch diesmal. Kaum war ich durch die Wohnungstür gekommen, hatte ich bereits eine Tasse des kochend heißen Liquidkoffeins in Händen, hergestellt von der verehrungswürdigen Firma Illy, und fand mich auftauend auf einem alten Sofa wieder. Eugen saß mir gegenüber auf seinem Bett und kramte ein Brett hervor. Nichts im Leben ist umsonst, und bei Eugen zahlt man mit Backgammon. Eigentlich ein schönes Spiel, aber nach unzähligen Niederlagen, denen nur unwesentlich wenige Siege gegenüberstanden, machte es einfach keinen Spaß mehr, gegen ihn anzutreten. Aber Preis ist Preis, und dem kann man nicht entrinnen.
Auch diesmal waren unsere Backgammonspiele keine Duelle, sondern Hinrichtungen. Ich kam mir vor wie ein Delinquent, der einen Schokodegen schwingt, während sein Gegner eine wohlgeschliffene Katana in Händen hält. Endstand 20 zu 4.
Nicht nur das Ausmaß der Niederlage war monumental, sondern auch die Qualität derselben war erschütternd. Nur einmal gelang es mir, durch geschicktes Taktieren eine 6er-Prime aufzubauen, Eugen war blockiert und beim Hinauswürfeln konnte meinem Sieg nur mehr ein zweimaliges 6 und 1 gefährlich werden. Eine Chance von 2 zu 1296, aber genau das trat ein und ich musste Eugen eine Möglichkeit einräumen, mich zu schlagen. Zeus warf die Schicksalslose und die Moiren beschlossen meinen Untergang, was der Göttervater mit einem Nicken seines fürchterlichen Hauptes quittierte. Mit den Unsterblichen auf seiner Seite würfelte Eugen richtig und ich war draußen. Das Ergebnis war, dass ich so schlecht würfelte, dass ich meinen geschlagenen Stein erst wieder ins Spiel bringen konnte, als Eugen nur noch acht Steine in seinem Endfeld hatte. Da er daraufhin zwei hohe Päsche warf und ich zweimal 2 und 1, musste ich eine doppelte Niederlage einstecken.
Wie immer hatte aber auch diese Niederlage ihr Gutes und so musste ich nicht für das zahlen, dessentwillen ich eigentlich gekommen war: zehn Gramm bestes Schweizer Gras.
Um Viertel nach zwölf machte ich mich auf den Weg zur U6 und fuhr heim.
III
Das Erste, was mir auffiel, als ich zu Hause um die Ecke bog, war ein silberglänzender Mercedes SLR, der direkt vor der Haustüre des Mietshauses geparkt war, in dem ich wohnte. Ich bin wahrlich kein Autonarr, aber bei diesem Wagen war ich bereit, eine Ausnahme zu machen. Geduckt wie eine Raubkatze lauerte er am Gehsteig, zum Sprung bereit. Alles an diesem Auto war Kraft, gepaart mit Eleganz. Ich blieb stehen und genoss den Anblick. Im Halbdunkel der Straßenbeleuchtung schien es, als ob sich die Kiemenschlitze an den Türen im Rhythmus einer tatsächlichen Atmung bewegen würden. Ich war noch nicht allzu lange in Kontemplation versunken – ansonsten hätte mich die Eiseskälte, mit der der Wind durch die Straßenfluchten Wiens pfiff, aus meinen angenehmen Träumen gerissen – als ich im Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm.
Die Haustüre hatte sich geöffnet und heraus fiel, mehr als dass es ging, ein junges Mädchen. Etwa 20, langes kornfarbenes Haar. In eine Guccikombination aus Tweed und scharlachfarbener Seide gehüllt, stolperte die Kleine auf den Benz zu. Aus einer winzigen Tasche, an der ich im Dunkel das D&G-Logo gerade noch ausmachen konnte, holte sie nicht ohne Mühe einen Autoschlüssel hervor. Schwankend drückte sie den Schlüssel, und der Kompressor zwinkerte ihr mit seinen Blinkern zu. Offenbar wollte sie sich voll des guten Weines, oder welche Chemikalien auch immer in ihren Venen toben mochten, hinter das Steuer ihres Wagens setzen.
Sonst eigentlich nicht die Hilfsbereitschaft in Person, machte ich nun doch ein paar Schritte auf die Kleine zu, sie hatte es gerade geschafft, ohne umzufallen von der Gehsteigkante hinunter auf die Straße zu gelangen, und sprach sie an. Es wäre doch schade, sowohl um den Benz, als auch um das Kleid, das Herr Gucci offenbar einzig und allein für das Mädchen angefertigt hatte, dachte ich.
Artig ergriff sie meinen angebotenen Arm, meinen wohlmeinenden Worten aber konnte sie augenscheinlich nicht den geringsten Sinn entlocken. Ihre braunen Augen blickten mich nur verständnislos an. Irgendetwas wollte sie mir sagen, aber ihre wunderbar geformten Sprechwerkzeuge waren nicht mehr in der Lage, etwas anderes als ein niedliches Blubbern zustande zu bringen.
Ich ergriff die Gelegenheit, entwand dem Mädchen sanft die Schlüssel und öffnete ihr die Beifahrertür. Ich wartete, bis der Mechanismus nach oben aufgeschwungen war und bugsierte sie sanft auf den ledernen Sitz. Nachdem ich sie angeschnallt hatte, ging ich auf die andere Seite des Wagens und nützte die Gelegenheit, die sich mir in Form einer willenlosen Schönheit bot, die nicht nur im Alkohol, sondern auch im Geld zu schwimmen schien, schamlos aus. Es ist zwar nicht gentlemenlike, aber die Gelegenheit, ein solches Auto zu fahren, kommt nur einmal im Leben. Außerdem war es fast noch eine gute Tat.
Wir waren keine 200 Meter weit gekommen, als mir der Gedanke kam, dass auch bei wunderbarstem Motorenschnurren der Weg nicht eigentlich das Ziel sein konnte. An der ersten roten Ampel hielt ich und wollte meine schöne Beifahrerin nach ihrem Ziel befragen, aber da war nicht viel herauszuholen aus der Kleinen. Nur ein genuscheltes »Heim« war ihr zu entlocken, dann war sie sanft entschlummert. Die Ampel schaltete auf Grün und ich fuhr weiter. Ganz konnte ich dem Spaß nicht entsagen, und so ließ ich den Motor erst richtig kommen und anschließend sachte die Kupplung schleifen. Die Reifen bissen und 400 Pferde katapultierten uns die Felberstraße hinunter, der Wagen lag perfekt, wie auf Schienen ging es dahin, kein unkontrolliertes Schlenkern, kein Korrekturlenken war nötig. Auch beim Schalten in den Zweiten verhielt sich das Auto so sanft wie ein Kätzchen, perfekt ausbalanciert verteilte sich der Druck auf beide Achsen, es war herrlich.
Noch ein wenig wollte ich den Spaß auskosten, mit quietschenden Reifen unter der Westbahn hindurch, danach mit ordentlich Gas die Schlossallee runter nach Schönbrunn. Was für einen Rausch ein solch seelenloses Ding wie ein Verbrennungsmotor doch erzeugen kann. Langsam gewann ich wieder die Herrschaft über mich und ließ den Benz sanft an einem der Parks ausrollen. Ich beugte mich zu meiner Kopilotin hinüber und wollte sie sanft wecken, aber da war nichts zu machen. So gönnte ich mir einen kurzen Augenblick lang den Genuss des Anblicks ihrer nackten, weißen Schenkel, bevor ich ihr den Rock wieder über das Knie hinunterzog.
Wenn sie mir schon nicht sagen konnte, wo sie hinwollte, dann vielleicht ihre Handtasche. Ich holte mir die kleine Tasche, tatsächlich D&G, und öffnete den Druckknopf. Die Brieftasche lag zuoberst, aber mich interessierte sofort etwas anderes. Waffenöl und Pulvergeruch kamen aus der Tasche, wo doch irgendein wie auch immer benannter ›Fragrance‹-Duft hätte vorherrschen sollen. Ich nahm die Brieftasche weg, und tatsächlich kam darunter ein seidenes Tuch zum Vorschein, das nur ungenügend die Form eines kleinen, gedrungenen Revolvers verdeckte. Ich legte die Brieftasche auf das Armaturenbrett und nahm den Revolver vorsichtig mit dem Taschentuch heraus. Was für eine Verschwendung, dachte ich, das eigelb gefärbte Seidentuch war fleckig vom Öl. Der Revolver selbst war alt und schwarz. Etliche Schrammen im Metall sowie im Holzgriff verrieten häufigen Gebrauch. Außerdem war er kurzläufig und die Kammer noch mit allen sechs Schuss gefüllt. Ich schnupperte. Kein Zweifel, aus der Waffe war vor Kurzem ein Schuss abgefeuert worden. Behutsam legte ich die Knarre zurück in die Tasche und nahm die Hände meiner Gastgeberin genau in Augenschein. Sie waren schlank und wohlgeformt, ein schmaler Weißgoldring an der linken Hand war der einzige Schmuck, und auch Pulverrückstände konnte ich weder sehen noch riechen. So viel CSI hatte ich gesehen, um mich soweit auszukennen.
Ein wahnwitziger Plan formte sich hinter meiner Stirn. Ich schaltete das Radio ein, schloss meinen iPod an das von Mercedes entworfene iPod-Dock an und ließ mir von Lester Young ›That’s All‹ in der wunderbaren Version von ›A Night out with Verve‹ blasen. Bei seinem zweiten Einsatz, der ganz sachte rauchig das kleinere Thema des ersten Solos abwandelt, war ich mir sicher, was zu tun wäre, schließlich hatte ich genug Chandler und Hammett gelesen. Wo so viel Geld herkam, dass das Fräulein Tochter Gucci trägt und Benz fährt, könnte auch für mich was drin sein.
Ich öffnete die Brieftasche und sah die Karten durch. Schließlich wurde ich fündig. Sabine Meyerhöffer, Untere Schreibergasse 6, irgendwo oben in Grinzing. Ich steckte mir eine der Karten ein, Lester jubilierte gerade über dem verrückten Rhythmus von ›In a little spanish town‹, und fuhr dann weiter. ›Highway to Hell‹ hätte zwar besser gepasst, aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Einen Moment lang machte ich mir Sorgen, wie denn die genaue Adresse zu finden wäre, da mein Fahrgast nicht imstande gewesen wäre, mir zu helfen. Aber auch daran hatte Mercedes – oder war es der findige Herr Papa gewesen? – gedacht, und ein GPS-Gerät eingebaut. Die Bedienung war kinderleicht und schon führte mich der elektronische Lotse mit der Stimme von Brad Pitt hinaus in die schöne Gegend.
Die Straßen waren nur wenig befahren, das GPS arbeitete gut, Lester blies wie gewohnt stilsicher und souverän, das Auto zu fahren war wie Schokolade essen und auf dem Beifahrersitz saß eine Schönheit. Aber irgendwie wurde ich dabei nicht richtig glücklich. Lag es am Dope in meiner Tasche, daran, dass das Mädchen möglicherweise eine Tatverdächtige war, die eine Mordwaffe in ihrer Handtasche verstaut hatte, oder dass ich vorhatte, die Arbeit der staatlichen Aufklärungsorgane zu behindern, um dadurch zu ein wenig Geld zu kommen? Dass ich mich dabei selbst strafbar machte?
IV
Langsam lichteten sich die Reihen der dicht verbauten Mietshäuser, die Grünflächen wurden großzügiger, die Mietskasernen verschwanden und an ihre Stelle traten Einfamilienhäuser. Als die Autos teurer und die Architekturen kostspieliger wurden, war ich oben in Grinzing.
Die Untere Schreibergasse fand ich ohne Probleme. Als mich Brad anwies zu halten, leistete ich Folge und genoss den Ausblick, der sich mir unverstellt von störenden Bauten bot. Unter mir lag die Stadt in ihrem Nachtschmuck, über mir spannte sich der dunkle Himmel prachtvoll über das Wiener Becken. Ich war direkt vor einer Garage zum Stehen gekommen. Der Garagenöffner tat seinen Dienst und ich parkte den Benz. Neben mir stand eine grüne Jaguarlimousine mit hellbeigen Ledersitzen, offensichtlich Papas Kutsche. Schnell durchsuchte ich die Handtasche des Mädchens, um Anhaltspunkte für mein weiteres Vorgehen zu finden, es waren aber keine da. So ließ ich einfach die in das Seidentuch gehüllte Waffe in meine ramponierte Ledertasche gleiten. Neben meinem Gemoll und der Tusculumausgabe von Sophokles’ Tragödien fühlte sie sich sichtlich unwohl. Ich ließ das Schloss einschnappen, hängte mir die Tasche um die Schultern, stieg aus und hob das Mädchen aus dem Wagen. Sie war leicht wie eine Feder, und da ich in den Sommermonaten so manch grobmechanische Arbeit verrichtete, um mein dürftiges Dozentengehalt aufzubessern, verfügte ich auch über die nötige Kraft, um die Mademoiselle zum Haus zu tragen.
Dieses selbst war geschmackvoll in die Hanglage eingefügt, zweistöckig und weitläufig. Schöne alten Fichten und Birken umstanden den Bau und entzogen ihn teilweise der Neugier Fremder.
Alleine der Blick dem Schreiberbachtal entlang zur Donau hinunter wäre mein Lebenseinkommen wert gewesen. Rundum nur Grün, Weingärten, ein plätschernder Bach und zu Füßen der Villa die Millionenstadt. Schnell erreichbar, aber doch weit genug entfernt, um nicht von der misera plebs behelligt zu werden.
Der Weg führte mich über einen schönen Rasen durch einen Garten, der im Sommer sicherlich eine Pracht war. Von meiner Position aus konnte ich ein erhelltes Fenster ausmachen, offensichtlich die Küche. Ich stieg eine Steintreppe hinunter, dem erhellten Fenster zu, neben dem sich der Hintereingang befand.
Vor der Tür angekommen, ließ ich meine Tasche zu Boden sinken und wollte gerade läuten, als sich die Tür wie von selbst öffnete. Heraus schaute eine junge Frau. Sie öffnete mir die Tür und ich trat ein. Offenbar war die Art des Heimkommens der jungen Dame kein ungewöhnliches Vorkommnis, ich hatte eher den Eindruck, als handele es sich hierbei um ein wohlvertrautes Ritual.
Die Brünette wies mir den Weg zu einem kleinen Sofa, auf das ich das Mädchen bettete.
»Danke, dass Sie sie heimgebracht haben«, sagte die Dame mit einem starken slawischen Akzent. Offensichtlich handelte es sich um das Hausmädchen. Sie trug einen dünnen Hausmantel über einem Pyjama und flauschige Hausschuhe, alles in verschiedenen Rosatönen gehalten.
» Dobré večer«, probierte ich mein dürftiges Tschechisch. Die Miene der jungen Frau hellte sich auf. »Hier ist meine Karte, bitte richten Sie aus, dass man morgen mit mir Kontakt aufnehmen möge. Es gibt da ein paar Dinge, die ihr Vater wissen sollte.«
Das Mädchen nickte und steckte die Karte ein. »Wollen Sie vielleicht einen Kaffee? Ich kann nicht schlafen und allein ist es so langweilig.«
»Vielen Dank, aber es ist schon spät, vielleicht ein anderes Mal, ich muss leider heim.«
»Soll ich Ihnen Taxi rufen?«
»Nein danke, ist nicht nötig, ich komme allein zurecht.« Ich ging auf die Tür zu. Die Brünette glitt geschmeidig an mir vorbei und öffnete sie.
»Auf Wiedersehen. Übrigens, ich bin Ivanka.« Sie lächelte mich schüchtern an.
»Hat mich auch sehr gefreut. Ich bin Arno und der Meinung, dass nächtens alle Türen von so schönen Frauen geöffnet werden sollten.« Vielleicht war es keine schlechte Option, eine Verbündete in diesem Haushalt zu haben.
Schnell war ich draußen, hängte mir die Tasche um die Schultern, klappte den Kragen meines Mantels hoch und machte mich auf den Weg zur Grinzinger Straße. Irgendwo würde ich dort sicherlich ein Taxi finden. Was auch tatsächlich geschah. Ich ließ mich zur Rotenturmstraße bringen, ging wieder ein paar Meter zu Fuß und stieg in ein zweites Taxi, das mich zum Westbahnhof brachte. Es sollte keine zu offensichtliche Verbindung zwischen meiner Wohnung und der Adresse in Grinzing geben. Am Westbahnhof, der in seiner denkmalgeschützten Scheußlichkeit wie ein Mahnmal für die Sünden der Nachkriegsarchitektur wirkt, ging ich in die Gepäckaufbewahrung und legte die Waffe in ein Schließfach. Da niemand anwesend war, musste ich mir auch keine Sorgen machen, elektronische Kameras gibt es dort nicht. Fürs Erste würde dieses Versteck reichen müssen. Wenn ich später mehr über die Begleitumstände herausgefunden hätte, würde mir garantiert noch ein geeigneterer Platz dafür einfallen. Ich hatte sogar schon einen im Sinn. Die elektronische Schlüsselkarte steckte ich einfach hinter meine Kreditkarte, auch für sie würde sich noch ein besseres Versteck finden lassen. Aber jetzt hatte ich erst einmal 24 Stunden, bis irgendwer das Schließfach öffnen konnte.
Die Felberstraße hinauf war ich allein unterwegs, keine Polizei, kein Blaulicht, alles war ruhig. Die Uhr zeigte zehn nach zwei, für das gesamte Unternehmen hatte ich demzufolge etwa eineinhalb Stunden benötigt, ungefähr die Zeit, die ich auch gebraucht hätte, um von Eugen aus zu Fuß nach Hause zu kommen. Alles war soweit in Butter. Ich schloss auf und trat in den Hausflur.
Nun war Glück gefragt. Aus welcher Wohnung war die Kleine gekommen? Im Parterre fand sich nichts, auch im ersten Stock, wo sich meine eigene Wohnung befand, war nichts zu sehen. Im zweiten Geschoss aber wurde ich fündig, eine der Wohnungstüren war nicht ganz geschlossen, sondern nur angelehnt. Ein Lob den Schlössern im Haus, die ohne Schlüssel von außen nicht zu schließen sind. Ich nahm mir ein Taschentuch aus dem Mantel, um keine Spuren zu hinterlassen, und öffnete die Türe. Nachdem ich sie sachte hinter mir geschlossen hatte, lauschte ich. Nichts war zu hören, kein Geräusch bis auf mein Herz, das mir aus dem Hals springen wollte. Ich stellte meine Tasche vorsichtig ab und zog die Schuhe aus. Unten hatte ich sie zwar ordentlich abgeputzt, aber man weiß ja nie. Ich stellte die Sachen unter einen kleinen Schemel und sah mich um.
Das kleine Vorzimmer hatte zwei Durchgänge, einen in die Küche, den anderen in ein Wohnzimmer, in dem eine Stehlampe mit Pergamentschirm warmes Licht ausstrahlte. An den Wänden hingen ein paar geschmacklose Bilder, eine gewaltige Homecinema-Anlage mit Flachbildschirm, Surround-Boxen und einem wohlgefüllten DVD-Regal bildete den Rest der Einrichtung. Vor einer Couch befand sich ein Rauchglastisch, auf dem in wüster Unordnung Schnapsflaschen, Aschenbecher und benutzte Gläser herumstanden. Dazu kam noch eine Alufolie mit weißem Pulver. Auf der Couch, einem massiven Ensemble aus Leder, saß der Hausherr. Wenn einer sitzt, ist es schwer, seine Größe abzuschätzen, aber der Mann war etwa 1,85 und um die 100 Kilo schwer. Ein fader grauer Anzug, ein weißes Hemd mit geöffnetem Kragen und eine lose Krawatte bildeten seinen Aufzug. Er war ein schwerer Mann gewesen, sauber rasiert, um die 50. Er hatte ein Profil, das einer Büste Cäsars gut zu Gesicht gestanden hätte. Das dünne schwarze Haar klebte am Kopf, überall schimmerte rosig die Kopfhaut durch. Irgendwoher kam er mir bekannt vor, aber ich kam nicht dahinter, woher.
Sein mächtiger Brustkasten war von mehreren Schüssen getroffen, alles ein rotes Durcheinander aus frischem roten und geronnenem schwarzen Blut, Stofffetzen und drei schwarzen Löchern. Ich beugte mich über ihn und besah mir seine Hände, die neben ihm auf der Couch lagen. Sie waren schlank, mit langen Fingern, die auf beiden Seiten von je einem schweren, massigen Goldring geschmückt waren. Am rechten Armgelenk trug er eine massiv goldene Uhr, irgendeine Rolex, an den Füßen teure Lederslipper. Ich war mir nicht sicher, ob es sich um ein Krokodil handelte, vielleicht war es auch nur ein Imitat. Seine Augen waren geöffnet und starrten an die Wand. Der allgemeine Eindruck war der einer soliden Leblosigkeit.
Ich ging durch das Wohnzimmer nach hinten, wo sich sein Schlafzimmer befand. Das Bett war nicht gemacht und die seidenen Laken zerknittert. Das Schlafzimmer war nahezu völlig leer, bis auf einen kleinen Sekretär, auf dem sich ein neues MacBook Air in silbergrau befand.
Ich ging in die Küche und fand glücklich ein paar Einweg-Handschuhe, wie sie für Küchenarbeit verwendet werden. Ich nahm mir zwei und machte mich daran, die Wohnung ein wenig zu untersuchen.
Alles in allem war sie auffallend leer und unpersönlich. Auf dem Sekretär fanden sich ein paar kleine Bücher mit Wahrscheinlichkeitstabellen, wie sie Spieler verwenden. Sie behandelten verschiedene Pokerspiele und Backgammon. Da sie offensichtlich auf Polnisch geschrieben waren, nutzten sie mir wenig. Ich machte mir aber eine Gedankennotiz, mir ein deutsches Exemplar für Backgammon aufzutreiben. Ansonsten waren da noch Werbeschreiben und vier Briefe von Banken. Die meisten Laden waren ebenso leer wie der kleine Tresor im Geheimfach. Im Schrank nur ein paar Anzüge, Hemden und anderes Kleinzeug.
Danach machte ich mich daran, den Mann zu untersuchen. Seine Taschen waren leer. Sein Feuerzeug, selbstredend Dupont 6284 in Gold, lag auf dem Tisch, neben mehreren leeren und halb vollen Zigarettenschachteln. Marlboro und chinesische Lungentorpedos, deren Tabak so schwarz war wie die Nacht. Allein die Brieftasche, in der sich Visitenkarten, ein Ausweis, sein Handy und ein paar Euro in bar fanden, war interessant. Den Namen auf dem Ausweis merkte ich mir, der Mann hieß Mirko Slupetzky. Die Visitenkarten notierte ich mir in mein Notizbuch, in griechischer Schrift. Direkt neben ein paar Stichworten zu einer philologischen Analyse, das würde keinem auffallen. Sein Handy hätte mich sehr interessiert, aber es war ausgeschaltet und ich kannte seinen Code nicht. Ich steckte es trotzdem ein, vielleicht fand sich ja ein Weg, an den Dateninhalt zu kommen. Außerdem hatte ich noch nie ein iPhone in der Hand gehalten.
Das MacBook Air ließ ich in meine Tasche gleiten, mitsamt den dazugehörigen Kabeln. Auf der Festplatte war sicher etwas zu finden. Schließlich ging ich mit den beiden Gläsern, die Lippenstiftspuren aufwiesen, in die Küche und putzte sie sauber, worauf ich sie ins Regal zurückstellte. Dann machte ich schnell das Bett und wischte über einen Großteil der glatten Flächen, es musste ja niemand wissen, dass sich die kleine Benzpilotin in der Wohnung aufgehalten hatte. Da ich mir um die Patronenhülsen keine Sorgen zu machen brauchte, schließlich war ein Revolver benutzt worden, war ich gerade dabei, mich wieder hinaus zu schleichen, als mir die beiden Schlüsselbunde neben der Türe auffielen. Ich sah sie schnell durch und nahm dann den mit den Ersatzschlüsseln. Einen für die Haus- und Wohnungstüre, einen für den Postkasten und einen für das Auto des Toten, einen Skoda. Sachte lehnte ich die Tür wieder an und schlich hinunter, und als ich meine eigene Wohnungstür hinter mir schloss, lehnte ich mich dagegen und atmete mehrmals tief durch.
Es war still in der Wohnung, dunkel und wohlig warm. Bevor der angenehme Teil des Abends beginnen konnte, musste ich schnell den elektronischen Schließfachschlüssel verschwinden lassen und die Handschuhe, die ich oben getragen hatte, verbrennen. Der billige Kunststoff verglühte rückstandslos, nur die Schlüsselkarte stellte mich vor ein Problem. Schließlich ließ ich sie einfach ins Altpapier gleiten. Zwischen den Seiten einer uralten Ausgabe der New York Review of Books war sie bis morgen sicher, falls ich bis dahin Besuch bekommen sollte.
Danach entledigte ich mich meiner kalten, nassen Kleider und zog die Haussachen an, die ich klugerweise winters immer über die Heizung hänge. Schließlich ließ ich mich auf die Couch sinken und holte die Wellnessutensilien hervor. Ich hatte zwar den ganzen Tag nichts gegessen und durch die Taxifahrten auch noch das letzte Geld verbraucht, aber dafür hatte ich zu kiffen wie ein Weltmeister.
Sorgfältig faltete ich den Umschlag einer Philologenzeitschrift und riss ein rechteckiges Stück ab. Eine der kurzen Kanten knickte ich und rollte das Ganze ein. Mit viel Kraft und Geschick hielt der Filter seine Form und ich nahm mir zwei lange Papierchen aus der Schachtel. Ich leckte die gummierte Seite des einen an und fügte beide zu einem L zusammen. Danach zerkleinerte ich eine der Dolden und mischte die kleinen, harzig duftenden Freunde mit Shaq. Nachdem ich den Filter eingesetzt hatte, würzte ich nach Herzenslust und rollte das hauchzarte Papier. Es knisterte verlockend wie das Geschenkpapier früher zu Weihnachten, der Duft stieg mir in die Nase, mein Mund wurde trocken und meine Finger schweißnass vor Vorfreude.
Schließlich legte ich mein Kunstwerk vor mich auf den Tisch, dimmte das Licht und sorgte für Musik. Ich kramte im Regal und holte eine Scheibe heraus, zog sie andächtig aus der Hülle und legte sie auf den Plattenteller. Ich schaltete den Strom ein, die Boxen summten kaum wahrnehmbar, und legte den Arm auf die Platte. Das vertraute Knacken und Rauschen hob an, Keith spielte ein open-e-Riff, Charlie stieg ein und Mick ließ ein saftiges ›Oh yeah‹ hören. ›Rocks off‹ ging ab wie immer und vor mir lagen die 32 Minuten der ersten LP von ›Exile on Main Street‹.
Ich gab mir selbst Feuer und inhalierte tief, hielt den Atem an, solange es ging, um dann ganz langsam auszuatmen. Das THC schlug ein, und der ganze Tag mit all seinen Vorkommnissen war plötzlich unwichtig geworden. Meine Füße kribbelten und eine heiße Hand schien mich am Hinterkopf zu packen. Als ich fertig ausgeatmet hatte, ging gerade der straighte Teil von ›Rocks Off‹ in das atmosphärisch-psychodelische Zwischenspiel über. ›It’s all mesmerized‹, raunte Mick. Dem war nichts hinzuzufügen.
Ich saß noch zwei LP-Längen im Dunkel, vergrub mich im schweren, erdigen Heroinsound der Stones und machte mir Gedanken. Das führte aber zu nichts. Dann ging ich ins Bett. Und das alles wegen zehn Euro.
Kapitel 2
I
Der nächste Morgen kam zu früh. Nach vier Stunden Schlaf bin ich einfach noch nicht so weit, ein neues Heute zu ertragen. Nichtsdestotrotz quälte ich mich aus dem Bett, setzte Kaffee und Tee auf, schenkte mir den Kaffee ein, holte die Zeitungen und aß ein Stück altes Brot. Mehr hatte ich nicht zu Hause.
Die Philologie ist zwar eine schöne, sinnliche und verständnisvolle Geliebte, aber Geld lässt sich mit ihr nur schwer verdienen. Sie ist eine Göttin und keine Hure. Zuerst muss man jahrelang schuften und sich quälen und nach mancher Prüfung, Arbeit und Dissertation landet man, wenn man Glück hat, an der Uni. Man beginnt, die akademische Karriereleiter hinaufzuklettern, als Externer Lektor, der niedrigsten Lebensform an einer Hochschule. Sogar die malaiischen Putzfrauen blicken auf einen herab. Kein Wunder bei einem Einkommen von zehn mal 535 Euro jährlich. Sozialversichert ist man damit selbstverständlich nicht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!